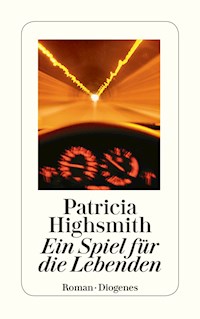
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Freundschaft, Eifersucht und Trauer sind die Themen dieses frühen Highsmith-Romans, in dem zwei Männer dieselbe Frau lieben und sich gegenseitig des Mordes verdächtigen, als Lelia entstellt und blutüberströmt in ihrem Haus in Mexiko liegt. Keiner der ungleichen Freunde will's gewesen sein, und keiner will, daß der andere es war: Theodore, reicher deutscher Künstler, zurückhaltend, gelassen; Ramón, armer mexikanischer Tischler, temperamentvoll, aufbrausend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Patricia Highsmith
Ein Spiel für die Lebenden
Roman
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Robben
Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay
Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta
Diogenes
Ein Spiel für die Lebenden
Für meine Freundin und Lehrerin Ethel Sturtevant, von 1911 bis 1948 Assistant Professor für Englisch am Barnard College, der ich dieses Buch in Zuneigung und in der Hoffnung widme, daß es ihr in einem langen und glücklichen Ruhestand ein wenig Zerstreuung bieten möge.
Und meinen Dank an Dorothy Hargreaves und an Mary McCurdy für ihre Anteilnahme und für ihr Haus.
1
Der Glaube rechnet mit jedem Zufall …
Und wenn du verstehen willst, daß du lieben mußt,
dann ist deine Liebe auf ewig gesichert.
S. Kierkegaard
Bei den Hidalgos war etwas los, genau wie Theodore es erwartet hatte. Er sah zu den vier erleuchteten Fenstern im ersten Stock hinauf, aus denen Gelächter und einladendes Stimmengemurmel drang, rückte die schwere Mappe unter seinem rechten Arm zurecht, so daß er sie besser halten konnte, und fragte sich bereits zum zweiten Mal, ob er bei den Hidalgos klingeln oder wieder ein Taxi suchen und direkt nach Hause fahren sollte.
Zu Hause war es sicher kalt, die Möbel würden mit Tüchern abgedeckt sein. Inocenza, sein Dienstmädchen, war noch auf Besuch bei ihrer Familie in Durango, weil er ihr kein Wort von seiner Rückkehr geschrieben hatte. Außerdem war es noch nicht einmal Mitternacht, der Abend vor dem fünften Februar, einem nationalen Feiertag. Niemand würde morgen arbeiten. Andererseits schleppte er einen Koffer, eine Zeichenmappe und eine Leinwandrolle mit sich herum. Und eingeladen hatte man ihn auch nicht, doch bei den Hidalgos war das nicht so wichtig.
Oder sollte er lieber zu Lelia fahren? Der Gedanke war ihm schon vorhin gekommen, auf dem Flug von Oaxaca hierher, und er wußte nicht, welche Eingebung ihn zu den Hidalgos geführt hatte. Er hatte Lelia geschrieben, daß er heute abend nach Mexiko City zurückkehren würde; vielleicht wartete sie sogar auf ihn. Sie besaß kein Telefon. Doch falls sie nicht gerade malte, machte es ihr nichts aus, wenn er zu den unmöglichsten Zeiten hereinschneite. Lelia war so gutmütig! Er beschloß, erst zu den Hidalgos und danach zu Lelia zu fahren, es sei denn, es würde zu spät.
Er ging zur Tür, stellte den Koffer ab und drückte fest auf die Klingel. Er schellte kein weiteres Mal, obwohl es bestimmt zwei Minuten dauerte, bis jemand aufmachte. Es war Isabel Hidalgo.
»Theodore, du bist wieder da!« begrüßte sie ihn auf englisch. Dann fuhr sie auf spanisch fort: »Komm herein. Wie schön von dir. Komm mit nach oben. Wir haben ein volles Haus.«
»Danke, Isabel. Ich bin gerade aus Oaxaca zurück.«
»Wie aufregend!« Isabel ging direkt ins Wohnzimmer, winkte und verkündete: »Theodore ist da! Carlos, Theodore ist da!«
Theodore setzte den Koffer in der kleinen Diele so ab, daß er möglichst nicht störte, lehnte die Zeichenmappe dagegen und stellte die Leinwandrolle neben den Koffer.
Carlos kam in die Diele, einen Drink in der Hand. Er trug eines seiner verwegen gemusterten Tweedjackets. »Don Theodore!« rief er und schlang einen Arm um ihn. »Sei gegrüßt! Komm herein und trink einen Schluck!«
Die meisten Gäste waren Männer, die grüppchenweise in Zimmerecken standen oder auf den beiden rechteckigen Ausziehsofas saßen, als unterhielten sie sich schon eine ganze Weile, ohne ihre Körperhaltung verändert zu haben. Theodore kannte kaum die Hälfte von ihnen und wollte nicht jedem einzeln vorgestellt werden, doch Carlos mit seiner ungestümen Energie, die noch größer schien, wenn er trank, schleppte ihn reihum von Gast zu Gast, sogar zu den Kindern – zwei amerikanischen Blondschöpfen, die auf einem zur Wand gedrehten Sofa schliefen.
»Nicht aufwecken, bloß nicht aufwecken«, protestierte Theodore rasch.
»Wo hast du dich rumgetrieben?« fragte Carlos.
»Ich war in Oaxaca«, sagte Theodore und lächelte. »Ich habe im letzten Monat ein halbes Dutzend Bilder gemalt.«
»Zeig her!« Er strahlte über das ganze Gesicht.
»Jetzt nicht. Hier ist nicht genug Platz. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Ich …« Er hielt inne, weil Carlos davongestürmt war. Vielleicht wollte er ihm etwas zu trinken holen.
Theodore drehte sich langsam um und suchte nach einer Sitzgelegenheit. In der vagen Hoffnung, es könnte Lelia sein, musterte er flüchtig eine vom Flur hereinkommende Frau, aber sie war es nicht. Jemand rempelte ihn an. Der milde Qualm amerikanischer Zigaretten durchzog das Zimmer, in dem sich fünf oder sechs Amerikaner aufhielten, vermutlich Professoren und Dozenten vom Mexico City College oder von der Ciudad Universidad, an der Carlos Hidalgo Theaterwissenschaften unterrichtete. Auf einem Beistelltisch neben einem der Sofas standen mehrere Flaschen Gin und Whisky sowie einige Gläser.
Mit einem frischen Drink, der wohl für ihn gedacht war, und dem eigenen, halb ausgetrunkenen dunklen Glas bahnte sich Carlos einen Weg von der Küche quer durch das Zimmer und warf jedem ein paar Worte zu. Er war neunundzwanzig, sah aber mit seinem straffen Gesicht jünger aus, weil man unwillkürlich an einen hübschen zehnjährigen Jungen denken mußte. Theodore nahm an, daß es dieser jungenhafte Charme war, den die etwas ältere Isabel so attraktiv fand. Schade nur, dachte er, daß er ein verzogener Junge war. Was Frauen anging, hielt sich Carlos für einen Experten, und vor seiner Heirat mit Isabel – die übrigens so still war, wie man es bei einem Frauenheld wie ihm nicht anders erwarten konnte – hatte er pro Jahr mindestens ein Dutzend Affären gehabt und Theodore gerne davon erzählt. Theodore hörte ihn lieber über seine Arbeit reden und hoffte stets, daß die ziemlich unkritische, für mexikanische Theaterleute aber so typische Begeisterung irgendwann auch auf das Niveau abfärbte. Doch Carlos behauptete, man habe in Mexiko für intellektuelle Dramen nichts übrig. Die Leute verstünden sie nicht oder wüßten einfach nichts mit ihnen anzufangen. Schließlich war Carlos bis zu ihm vorgedrungen, drückte ihm ein Glas Whisky mit Soda in die Hand, hastete wieder davon und rief dabei nach seiner Frau.
Als Theodore zwei flüchtige Bekannte an einem Fenster stehen sah, ging er zu ihnen und sagte: »Guten Abend, Don Ignacio. Wie geht es Ihnen?«
Señor Ignacio Ortiz y Guzman B. leitete eine der staatlich geförderten Kunstgalerien der Stadt. Einmal, vor Monaten, hatte er sich hier in diesem Haus lange mit ihm über Malerei unterhalten. Der andere Mann hieß Vincente Soundso, und Theodore hatte vergessen, was er von Beruf war.
»Malen Sie noch?« fragte Ortiz y Guzman B.
»Ja. Ich bin gerade aus Oaxaca zurück«, erwiderte Theodore, »da habe ich einen Monat gemalt.«
Ortiz y Guzman B. musterte ihn, schien ihn aber nicht gehört zu haben. Der Mann namens Vincente bot einer Frau in seiner Nähe zuvorkommend Feuer an.
Theodore fiel nichts ein, was er sagen konnte, und es entstand ein verlegenes Schweigen. Die beiden Männer begannen, sich wieder zu unterhalten. Theodore mußte an andere Gelegenheiten denken, bei denen er auf Partys oder bei einem Essen etwas gesagt hatte – zugegebenermaßen nichts Wichtiges – und vollständig ignoriert worden war, so als wäre das Gesagte unhörbar oder eine unsägliche Obszönität gewesen. Er fragte sich, ob anderen Leuten dies ebensooft wie ihm passierte. Unbedeutender aussehenden Männern, fand er, wurde zugehört, wie geistlos ihre Bemerkungen auch sein mochten. Die beiden Männer unterhielten sich mittlerweile über jemanden, den Theodore nicht kannte, und zu spät fiel ihm ein, daß Ortiz y Guzman B. vielleicht gern erfahren hätte, daß er gebeten worden war, bei einer Gruppenausstellung im Mai vier Bilder in einer der I.N.B.A.-Galerien auszustellen. Kurz darauf schlenderte Theodore davon und blieb an einer Wand stehen. Bestimmt wurde er nicht öfter ignoriert als alle anderen auch.
Theodore Wolfgang Schiebelhut war dreiunddreißig, schlank und groß – groß vor allem im Vergleich zum Durchschnittsmexikaner. Das helle, mit dunkelblonden Strähnen durchsetzte Haar lag an den Schläfen dicht an, war aber oben ziemlich wuschelig und ungescheitelt. Er machte eine gute Figur, lächelte gern, und sein Gang und seine ganze Art waren von einer Leichtigkeit, die ihm selbst dann, wenn er deprimiert war, etwas Jugendliches und Beschwingtes verlieh. Man hielt ihn meist für einen fröhlichen Menschen, obwohl seine Gedanken oft die eines Pessimisten waren. Da er aber von Natur und Erziehung aus höflich war, kaschierte er seine Niedergeschlagenheit. Gewöhnlich hatten seine Stimmungen keine von ihm oder sonstwem erkennbare Ursache, und er fand, er hätte kein Recht, sie seinem sozialen Umfeld zu zeigen. Er hielt die Welt für bedeutungslos, erwartete kein anderes Ende als das Nichts und nahm an, daß die Errungenschaften der Menschheit letztlich dem Untergang geweiht waren – kosmische Scherze, genau wie der Mensch selbst. Dank dieser Auffassung glaubte er natürlich auch, daß man aus dem Gegebenen das meiste machen sollte, aus der kurzen Zeit, dem kurzen Leben; daß man versuchen sollte, so glücklich wie möglich zu werden und dabei, wenn möglich, andere glücklich zu machen. Theodore fand, daß er so glücklich war, wie man dies vernünftigerweise in einem Zeitalter nur sein konnte, in dem die Atombombe und die allgemeine Vernichtung drohten, auch wenn ihm das Wort »vernünftigerweise« in diesem Zusammenhang zu schaffen machte. Konnte man vernünftigerweise glücklich sein?
»Wir freuen uns ja so, daß du vorbeigekommen bist, Teo«, sagte Isabel Hidalgo. »Carlos hat erst heute morgen gemeint, daß du eigentlich schon wieder zurück sein müßtest. Wir wollten dich für heute abend einladen und haben sogar bei dir angerufen.«
»Muß wohl Gedankenübertragung gewesen sein«, sagte Theodore lächelnd. »Carlos sieht müde aus. Arbeitet er zuviel?«
»Na ja, wie immer. Alle sagen, er sollte sich mal eine Pause gönnen.« Sie lächelte, aber ihre blaugrauen Augen sahen irgendwie traurig aus. »Zusätzlich zu seinem Unterricht an der Universität leitet er gerade die Proben für Othello. Er halst sich einfach immer mehr auf. Selbst heute hat er bis spätabends gearbeitet, ohne was zu essen, und wenn er dann nach Haus kommt, steigt ihm der Alkohol natürlich sofort zu Kopf.«
Theodore lächelte nachsichtig und zuckte die Achseln, obwohl Carlos in der Öffentlichkeit wirklich zuviel trank. Die Gegenwart anderer Menschen schien ihn anzuregen, und er kippte den Alkohol wie Wasser in sich hinein. Noch war er nicht betrunken, aber Isabel wußte, daß es nicht mehr lange dauern würde, und begann deshalb jetzt schon, ihn zu entschuldigen. Daß er sich ständig mehr auflud, hing allerdings, wie Theodore wußte, weniger mit übermäßiger Energie als mit seinem Egoismus zusammen. Carlos sah den eigenen Namen gern auf möglichst vielen Programmzetteln und Plakaten. »Lelia wollte heute abend nicht zufällig vorbeikommen, oder?« fragte Theodore.
»Sie ist jedenfalls eingeladen«, erwiderte Isabel rasch. »Carlos! – Wolltest du nicht Lelia abholen?«
»Stimmt!« rief Carlos in voller Lautstärke quer durch den Raum. »Aber sie hat mich heute mittag in der Universität angerufen und gesagt, daß sie nicht kommen kann. Hat heute abend sicher mit dir gerechnet, Teo.« Carlos lächelte, winkte und wiegte sich im Takt zur kubanischen Tanzmusik, die er gerade aufgelegt hatte.
»Verstehe. Hat sie …« Doch Carlos kehrte ihm schon den Rücken zu und beugte sich wieder über den Plattenspieler. Theodore hatte ihn fragen wollen, ob Lelia für ihn gemalt hatte. Manchmal entwarf sie die Kulissen für seine Stücke. Isabel wollte er lieber nicht nach ihr fragen, da sie wußte – wissen mußte –, daß Carlos eine große Schwäche für Lelia hatte. Immerhin hatte er schon öfter mit ihr herumgealbert, einmal auch in Isabels Beisein, die jedoch so getan hatte, als merke sie nichts.
»Entschuldige, Teo«, sagte Isabel. »Da ist jemand an der Tür.« Sie strich ihm mit nervöser Hand flüchtig über den Ärmel und ging.
Theodore sah, wie Carlos einer Frau ein Glas aufdrängte, obwohl sie entschieden, aber vergebens ablehnte. Er fragte sich, ob Lelia deshalb so früh bei Carlos angerufen hatte, weil sie es vermeiden wollte, ihm erklären zu müssen, daß sie nicht zur Party kommen mochte, wenn er bereits in ihrer Wohnung stand. Carlos etwas abzuschlagen war nämlich fast unmöglich. Theodore betrachtete ein an der Decke hängendes Mobile, dessen Teile sich ständig zu berühren drohten, es aber niemals taten, und er dachte, wie seltsam es doch war, daß er sich in einem Raum voller Künstler, Schriftsteller und Professoren derart einsam fühlte. Selbst den Amerikanern mit ihrem stockenden Spanisch erging es besser als ihm. Als er sich vor gut einer Stunde im Flugzeug vorgestellt hatte, welche Begrüßung ihn erwartete, wenn er Ramón anrief und bei den Hidalgos oder bei Lelia vorbeischaute, war er jedenfalls glücklicher gewesen. Theodore mochte Carlos ganz gern, aber wie oft hatten sie eigentlich ein tatsächlich anregendes, befriedigendes Gespräch über irgendwas geführt? Über irgendwas, dachte Theodore ein wenig verbittert und mußte an jene Diskussion über die Bedeutung des Glaubens denken, die genau dann aufgehört hatte, als Theodore verstummt war, weil er selbst erst nachdenken mußte. Vermutlich gab es Antworten, die allein mit der Zeit kommen würden, und Carlos war noch jung, doch erwartete Theodore einfach, daß etwas dabei herauskam, wenn zwei Leute die Köpfe zusammensteckten. Carlos wirkte ständig irgendwie überdreht, so als hätte er gerade eine Handvoll Benzidrin geschluckt. Man konnte ihn kaum länger als eine Minute für irgendwas interessieren. Von einer Diskussion über ein Stück von Tennessee Williams wandte er sich abrupt dem Bühnenbild irgendeines Franzosen zu, dann kam er auf eine Aufnahme von Sarah Bernhardt zu sprechen, die er in der Universität gehört hatte, oder auf ein Stück von einem Studenten, für dessen Aufführung er möglicherweise staatliche Fördermittel beantragen wollte. Das mochte faszinierend sein, aber letztlich blieb es unbefriedigend. Konnte aus all der Aufgeregtheit überhaupt Kunst entstehen? War Kunst – meist jedenfalls – nicht »in Stille gesammeltes Gefühl«, wie Wordsworth geschrieben hatte? Sogar für einen Lateinamerikaner? Theodore mußte über seine Entschiedenheit lächeln, und sein Lächeln wurde mit einem Lächeln und einem Nicken von einem rotbärtigen, ihm unbekannten Mann erwidert. Irgendwie brachte ihn das zu einem Entschluß. Er würde zu Lelia fahren, bevor es noch später wurde. Sie ging oft nicht vor eins ins Bett, und selbst dann las sie noch eine Weile.
Theodore schaute sich um – und hätte sich von Carlos und Isabel verabschiedet, wenn sie zu ihm hinübergesehen hätten, doch war er froh, sich vor Carlos nicht für sein Gehen rechtfertigen zu müssen. Er trat in die Vorhalle, griff nach Zeichenmappe, Koffer und Leinwandrolle und ging aus dem Haus.
Er schleppte seine Sachen zwei Straßen weit bis zur Avenida de los Insurgentes und fand nach kurzem Warten ein libre. Ein letztes Zögern, ob er mit dem Taxi zu Lelia oder die kürzere Strecke nach Hause fahren sollte, dann: »Granaditas! Numero cien venty siete. Cuatro pesos. Está bien?«
Der Fahrer schimpfte über den Koffer, darüber, daß es so spät war und Feiertag, und verlangte fünf Pesos; Theodore stimmte zu und stieg ein.
Es war ein kühler, frischer Abend. Normalerweise hätte die Fahrt höchstens zehn Minuten gedauert, doch heute verstopften Autos und Fußgänger die Innenstadt von Juarez bis zum Zócalo. Der Fahrer schien sich die meistbefahrenen Straßen auszusuchen, damit es möglichst lange dauerte.
An einer Ampel steckte ein Rowdy den Kopf durch das Fenster und fragte: »Heißt hier jemand Maria?«
Grölendes Gelächter aus den Kehlen eines halben Dutzends junger Männer, und das betrunkene Gesicht zog sich zurück.
Theodore, der von der Kante des Rücksitzes aufgeschreckt war, kurbelte vorsichtshalber das Fenster ein wenig höher. Heute abend würden viele Menschen betrunken sein, besonders dort, wohin er unterwegs war, in der Gegend hinter dem Zócalo. Dann aber fiel ihm ein, daß er ein Geschenk für Lelia hatte, und als er sich vorstellte, wie er ihr seine Zeichnungen und Bilder zeigte, fuhr er abermals auf und sagte dem Fahrer, er solle sich beeilen. Lelia war eine gute Zuhörerin, eine gute Kritikerin und eine gute Geliebte! Sie war, was jeder Mann brauchte, dachte Theodore, aber so selten fand, eine Frau, die zuhörte und ermunterte, die sogar kochen konnte und ihm zu alledem nie etwas übelnahm, selbst dann nicht, wenn sich für ihn alles um die eigenen Launen drehte. Um Augenblicke der Einsamkeit oder spontane Einfälle, die ihn morgens um vier zu ihr eilen ließen, manchmal, weil ihm danach war, sich umzubringen, manchmal, weil er sich unerträglich glücklich fühlte und seine Gefühle mit ihr teilen wollte. Sinnlos, zu hoffen, daß es eine Verkörperung dieses abstrakten Ideals geben könnte. Es gab nur Lelia, und sie war einmalig. Vielleicht gab es niemanden sonst auf der ganzen Welt wie sie.
Vielleicht war Ramón auch da und verbrachte die Nacht mit ihr, dachte Theodore. Doch heute nacht war das nicht besonders wahrscheinlich, außerdem würde er erst anklopfen.
Das Taxi war angekommen. Theodore bezahlte den Fahrer und stieg aus. Mit den geschlossenen Geschäften und alten Häusern, die der Straße ihre hohen, verriegelten Türen zukehrten, war dies nachts ein ziemlich tristes Viertel. Lelias Haustür wurde von innen verriegelt, konnte aber von denen, die Bescheid wußten, mit einem in den Türspalt geschobenen Stock geöffnet werden. Ein Stock, eine alte Stange aus einem hölzernen Vogelkäfig, lehnte gewöhnlich zu diesem Zweck in der Ecke zwischen Tür und Hausmauer. Er stand auch jetzt dort. Theodore nahm ihn, hob den Riegel an und betrat einen kleinen Innenhof voller Gerümpel, der nur vom Licht mehrerer Fenster in den oberen Stockwerken erhellt wurde. Theodore sah, daß Lelias Fenster zu denen gehörte, die erleuchtet waren. Er ging durch einen steinernen, türlosen Torbogen und stieg die Treppe hinauf. Lelia wohnte im zweiten Stock. Er lief über den Flur zu ihrer Tür und klopfte an.
Keine Antwort.
»Lelia?« rief er. »Ich bin’s, Theodore. Laß mich rein!«
Jemandem, den sie nicht sehen wollte, machte sie die Tür nicht auf, aber Theodore gehörte nicht in diese Kategorie. Manchmal war sie in ein Buch vertieft, und wenn er allein oder zusammen mit Ramón kam, brauchte sie schon mal zwei, drei Minuten, bis sie an die Tür kam, doch sie wußte, daß sie geduldig warten würden.
Theodore klopfte etwas lauter. »Ramón? Ich bin’s, Theodore!«
Er rüttelte an der verschlossenen Tür und wünschte sich, er hätte ihren Schlüssel mitgenommen. Er trug ihn stets bei sich, doch aus irgendeinem Grund, vielleicht aus dem, sich eine Weile von ihr völlig frei zu fühlen, hatte er ihn vor seiner Abreise nach Oaxaca vom Schlüsselbund genommen. Das Oberlicht stand einen Spalt offen. Theodore stellte sich auf Zehenspitzen und stieß es weiter auf.
»Lelia?« rief er zum Oberlicht hinauf.
Vielleicht war sie bei einer Nachbarin oder ausgegangen, um zu telefonieren. Er schob seinen Koffer an die Tür, stellte einen Fuß darauf, zog sich vorsichtig hoch und streckte den Kopf durch das Oberlicht, um zu sehen, wohin er fallen würde, falls er durch das Fenster kletterte. Das Licht im Schlafzimmer reichte gerade aus, um ihm zu zeigen, daß das rote Ledersitzkissen knapp zwei Schritt hinter der Tür stand. Er horchte kurz, weil er sich vergewissern wollte, daß kein Hausbewohner auf der Treppe war. Es wäre ihm ziemlich peinlich gewesen, wenn man ihn dabei erwischt hätte, wie er durch Lelias Oberlicht kroch, doch alles, was er hörte, war ein fernes Radio. Er legte die Hände auf den unteren staubigen Rand des Oberlichts, streckte den Kopf durch und stieß sich vom Koffer ab. Kaum drückte sich ihm die Fensterkante in den Bauch, überlegte er, ob er sich nicht lieber wieder zurückschieben sollte. Der Schmerz zwang ihn weiterzumachen, und er wand sich vor, bis die Hände flach gegen die Innenseite der Tür gepreßt waren, seine Hacken den oberen Fensterrand berührten und ihm das Blut bedrohlich in den Kopf schoß. Verzweifelt versuchte er, das rechte Knie durch das Oberlicht zu ziehen. Es ging nicht. Er peilte das rote Sitzkissen an, ließ sich langsam sinken, griff nach dem Sitzkissen und sackte schließlich auf dem Boden zusammen.
Er stand auf, wischte sich den Staub von den Händen und blickte sich erleichtert in dem vertrauten, großen Zimmer um, an dessen Wänden ständig wechselnde Bilder und Zeichnungen hingen, dann schloß er die Tür auf und zog seine Sachen herein. Er knipste die Lampe neben dem Sofa an. Auf Lelias langem Tisch lag ein Strauß weißer Nelken, der in eine Vase gehörte. Außerdem stand eine Flasche Bacardi auf dem Tisch, sein Lieblingsgetränk, vermutlich extra seinetwegen gekauft. Er ging über den kurzen Flur, vorbei an der Küche, zum Schlafzimmer. Da lag sie und schlief.
»Lelia?«
Sie lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett, und auf dem Kissen war Blut, jede Menge Blut, ein roter Kranz um das schwarze Haar.
»Lelia!« Mit einem Satz sprang er zu ihr und riß die dünne, rosafarbene Tagesdecke fort.
Blut färbte ihre weiße Bluse und den rechten Arm, auf dem er einen gräßlichen, tiefen Schnitt entdeckte. Die Wunde war noch feucht. Zitternd und keuchend faßte Theodore sie behutsam an den Schultern, drehte sie um und ließ sie entsetzt wieder los. Ihr Gesicht war verstümmelt.
Theodore sah sich im Zimmer um. Eine Teppichecke war umgeschlagen. Das war das einzige Zeichen von Unordnung. Und das Fenster stand weit auf, was ganz untypisch für Lelia war. Theodore ging zum Fenster und schaute hinaus. Das Fenster ging auf den Innenhof, und im Innenhof gab es nichts, woran jemand nach oben klettern konnte, doch vom Dach, nur ein Stockwerk höher, führte ein Regenrohr wenige Zentimeter am Fensterrahmen vorbei und hörte einen Stock tiefer kurz über dem unteren Fenster auf. Theodore hatte Lelia schon ein dutzendmal gebeten, ein Gitter vor dem Fenster anbringen zu lassen. Vor allen Fenstern der übrigen Wohnungen in Lelias Stockwerk waren Gitter, ebenso ein Stockwerk höher. Aber jetzt war es zu spät, über Gitter nachzudenken. Unmittelbar danach setzte der Schock ein. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und schlug die Hände vors Gesicht.
Plötzlich wurde ihm klar: Ramón war der Täter. Natürlich. Der Mann hatte ein hitziges Temperament. Er selbst war schon mehrmals eingeschritten, weil Ramón Lelia in einem Anfall starrköpfiger Wut schlagen wollte. Wegen irgendeiner Belanglosigkeit hatten sie eine ihrer südländischen Streitereien vom Zaun gebrochen, oder Lelia hatte sich nicht genügend über irgendein Geschenk gefreut – nein, es mußte etwas Schlimmeres gewesen sein, so schlimm, daß er es sich jetzt nicht vorstellen konnte, doch war er sich ganz sicher, daß Ramón es getan hatte. Außerdem besaß Ramón einen Schlüssel. Er hatte einfach durch die Tür kommen können.
»Ai-i-yai-i-i-i!« schrie eine Fistelstimme im Treppenhaus, und zugleich hämmerte jemand an die Tür.
Theodore rannte hin und riß sie auf. Jemand eilte nach unten. Theodore stürzte hinterher und hatte das Erdgeschoß erreicht, als er die Holztür zum Hof über den Zementboden scharren hörte. Er hastete auf den Gehweg und blickte in beide Richtungen, sah aber nur zwei Männer, die in ein Gespräch vertieft die Straße überquerten. Theodore suchte den dunklen Innenhof ab, doch er hatte ja die Holztür gehört. Mit einem Gefühl der Vergeblichkeit und der Ahnung, womöglich das Falsche zu tun, kehrte er zurück ins Haus und stieg die Treppe hinauf. Wenn es der Mörder gewesen war, selbst wenn er es wirklich gewesen war, wäre es sinnlos gewesen, ihm durch die Straßen nachzulaufen, ohne überhaupt zu wissen, in welche Richtung er laufen sollte. Vielleicht war es auch gar nicht der Mörder gewesen, sondern nur irgendein Straßengauner oder jemand von der Party, die, wie ihm erst jetzt auffiel, ein Stockwerk über Lelias Wohnung gefeiert wurde. Doch wenn es der Mörder gewesen war und er hatte ihn entkommen lassen …
Kaum hatte er Lelias Tür hinter sich zugezogen, hielt er inne. Er mußte logisch vorgehen. Erstens: die Polizei anrufen. Zweitens: aufpassen, daß niemand in der Wohnung Fingerabdrücke verwischte. Drittens: Ramón finden und dafür sorgen, daß er mit seinem Leben für das zahlte, was er getan hatte.
Theodore ging wieder hinaus, schloß die Tür und wollte eine Straße weiter zu einer cantina gehen, in der es, wie er wußte, ein Telefon gab, doch begegnete er auf der Treppe im ersten Stock Lelias Nachbarin.
»Sieh an, Don Teodoro! Guten Abend!« sagte die Frau. »Einen frohen Fünften –«
»Wissen Sie, daß Lelia tot ist?« platzte es aus ihm heraus. »Sie ist ermordet worden! In ihrer Wohnung!«
»Aaaaaah!« schrie die Frau und schlug sich die Hand vor den Mund.
Sofort gingen zwei Türen auf. Stimmen riefen: »Was ist los?« – »Was ist passiert?« – »Wer ist umgebracht worden?«
Und Theodore hatte Mühe, die Treppe wieder hochzugehen, die er gerade heruntergekommen war, zurück zu Lelias Wohnung. Die Tür war nicht verschlossen, und schon liefen zwei Männer hinein.
»Bitte!« schrie Theodore. »Sie müssen wieder gehen! Sie dürfen nichts anfassen! Vielleicht lassen sich Fingerabdrücke finden!« Doch es war zwecklos. Zwölf oder fünfzehn Leute warfen einen Blick ins Schlafzimmer, schrien auf und rannten wieder hinaus, vor Entsetzen eine Hand vor den Augen.
»Ihr seid wie ein Haufen Kinder!« fauchte Theodore verächtlich auf englisch.
Señora de Silva erbot sich, von ihrer Wohnung die Polizei anzurufen, doch ehe sie ging, sagte sie zu Theodore: »So um elf Uhr, vielleicht auch ein bißchen früher, da habe ich was gehört. Ein Poltern auf dem Dach. Aber sonst habe ich nichts gehört. Auch nicht, daß eine Scheibe eingeschlagen wurde.«
»Es ging kein Fenster kaputt«, sagte Theodore rasch. »Was haben Sie sonst noch gehört?«
»Nichts!« Sie starrte ihn mit weitaufgerissenen Augen an. »Nur dieses Poltern. Als ob jemand versucht, über das Dach zu klettern. Jedenfalls war da irgendwas auf dem Dach. Aber ich habe nicht nachgesehen. Heilige Mutter Gottes, ich hätte nachsehen sollen!«
»Haben Sie gehört, ob in der Wohnung gekämpft wurde?«
»Nein. Oder vielleicht doch? Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht habe ich tatsächlich so was gehört!«
»Bitte, gehen Sie und rufen Sie die Polizei«, sagte Theodore. »Ich muß hierbleiben und aufpassen, daß keiner in die Wohnung kommt.«
Eine murmelnde Menge hatte sich auf dem Flur vor der Tür versammelt, mehrheitlich Jugendliche von der Straße, dachte Theodore. Ein paar waren betrunken. Er schloß die Tür, sobald er einen der jungen Männer überreden konnte, die Hände vom Türrahmen zu nehmen.
Dann setzte er sich auf das rote Sitzkissen mit dem Gesicht zur Tür und wartete auf die Polizei. Er dachte an Ramón, dessen leidenschaftliche katholische Seele von Lelia völlig gefangen war. Es lastete schwer auf Ramóns Gewissen, daß er sie nicht heiraten, aber auch nicht aufgeben konnte. Mindestens zweimal hatte Theodore gehört, wie Ramón in einem Anfall von Reue oder vielleicht auch von Wut über eine unbedachte Bemerkung von Lelia gesagt hatte: »Ich schwöre dir, Teo, ich bring mich um, wenn ich sie nicht noch in dieser Minute aufgebe!« Oder so was Ähnliches. Und zwischen einem Selbstmord und der Ermordung des Liebesobjektes bestand kein großer Unterschied, dachte Theodore. Psychologisch gesehen, lief es manchmal auf dasselbe hinaus. Statt sich selbst hatte die Bestie nun Lelia getötet!
2
Mit heulenden Sirenen traf die Polizei ein. Es hörte sich an, als käme eine ganze Armee die Treppe herauf, aber sie waren nur zu dritt: ein kleiner, dickbäuchiger, etwa fünfzig Jahre alter Beamter mit einem Patronengurt über der Schulter sowie einem großen Revolver an jeder Seite und zwei hochgewachsene, junge Polizisten in hellen Khakiuniformen. Der Dicke zückte eine Waffe und hielt sie lässig auf Theodore gerichtet.
»Stellen Sie sich an die Wand«, sagte er. Dann wies er einen der Polizisten an, Theodore nicht aus den Augen zu lassen, während er ins Schlafzimmer ging, um sich die Leiche anzusehen.
Die Menge aus dem Flur quoll ins Zimmer, schaute sich neugierig um und unterhielt sich halblaut.
Abwechselnd (so daß Theodore ständig von mindestens zwei Beamten bewacht wurde) gingen die jungen Polizisten ins Schlafzimmer, um sich Lelia anzusehen. Einer stieß einen erstaunten Pfiff aus. Als sie zurückkamen, glotzten sie Theodore mit schockierten, versteinerten Mienen an.
»Name?« fragte der Beamte und zog Bleistift und Papier aus der Tasche. »Alter? … Sind Sie mexikanischer Staatsbürger?«
»Ja, eingebürgert«, erwiderte Theodore.
»Schaffen Sie die Leute hier raus! Niemand darf was anfassen!« rief der Beamte den beiden Polizisten zu.
Die Menge sickerte ins Schlafzimmer.
»Gestehen Sie die Tat?« fragte der Beamte.
»Nein! Ich habe Sie doch hergeholt! Ich habe Lelia gefunden!«
»Beruf?«
Theodore zögerte. »Maler.«
Der Beamte musterte ihn von oben bis unten und wandte sich dann zu einem dunklen untersetzten Mann um, den Theodore nicht bemerkt hatte, obwohl er gleich vorn in der Menge stand. »Wollen Sie weitermachen, Capitán Sauzas?«
Der Mann trat einen Schritt vor. Er trug einen dunklen Hut und einen dunklen offenen Mantel. Zwischen den Lippen hing eine Zigarette. Mit seinen klugen, unpersönlich blickenden Augen sah er Theodore aufmerksam an. »Wieso sind Sie heute abend hier?«
»Ich wollte sie sehen«, sagte Theodore. »Sie ist eine Freundin.«
»Um wieviel Uhr sind Sie gekommen?«
»Vor etwa einer halben Stunde. Gegen ein Uhr.«
»Und hat sie Sie hereingelassen?«
»Nein! – Das Licht war an. Ich habe geklopft, aber es hat niemand aufgemacht.« Theodore blickte auf einen der Revolver, der kurz herumschwenkte und sich dann wieder auf ihn richtete. »Ich dachte, sie sei vielleicht eingeschlafen – oder wäre ausgegangen, um zu telefonieren. Also bin ich durch das Oberlicht geklettert. Nachdem ich sie gefunden hatte, bin ich losgelaufen, um die Polizei zu rufen. Dann traf ich Señora … Señora …«
»Señora de Silva«, half ihm Sauzas.
»Ja«, sagte Theodore. »Ich habe es ihr erzählt, und sie hat gesagt, daß sie die Polizei für mich anrufen würde.« Die Menge im Zimmer, die sich so gruppiert hatte, daß sie Theodore und Sauzas zugleich sehen konnte, hörte mit verschränkten Armen und leichtem Erstaunen zu, doch lebte Theodore lange genug in Mexiko, um auch anscheinend nichtssagende Mienen deuten zu können. Die Menge war mehrheitlich davon überzeugt, daß er der Täter war, und Theodore las dieselbe Überzeugung in den Gesichtern der beiden jungen Polizisten, die ihre Waffen auf ihn gerichtet hielten.
»In welcher Beziehung standen Sie zur Ermordeten?« fragte Sauzas. Er machte sich keine Notizen.
»Sie war eine Freundin«, sagte Theodore und hörte amüsiertes Geraune von den Leuten.
»Wie lange haben Sie die Frau gekannt?«
»Drei Jahre«, antwortete Theodore. »Etwas länger.«
»Pflegten Sie sie öfter morgens um ein Uhr zu besuchen?«
Wieder kicherte es in der Menge.
Theodore richtete sich auf. »Ich habe sie oft spätabends besucht. Sie blieb lange auf«, sagte Theodore und versuchte, das Grinsen und Getuschel zu ignorieren. Einiges konnte er verstehen; sie nannten Lelia »una puta«, eine Hure.
Dann war da noch die Sache mit seinem Koffer. Wollte er einziehen? Nein? Was denn? Warum war er nach Oaxaca gefahren? Er war also zum Haus eines Freundes gefahren, nachdem er auf dem Flughafen gelandet war und bevor er hierhergekommen war. Konnte er das beweisen? Ja. Wer war dieser Carlos Hidalgo? Und wo wohnte er? Sauzas schickte einen der Polizisten los, um Carlos Hidalgo ausfindig zu machen und herzubringen.
Plötzlich kam es zu einem Tumult, als zwei Männer in Zivil hereinkamen und die Menge laut aufforderten, die Wohnung zu verlassen. Die beiden Männer drängten einige Jugendliche zur Tür hinaus. Señora da Silva protestierte und durfte bleiben, nachdem Sauzas sich für sie verwandt hatte.
Kurz und gleichgültig faßte Sauzas Theodores Geschichte zusammen, erzählte, wie er hereingekommen war, und befahl den beiden Männern, im Schlafzimmer nach Fingerabdrücken zu suchen.
»Ich glaube, ich weiß, wer sie umgebracht hat«, sagte Theodore zu Sauzas.
»Wer?«
»Ramón Otero. Ich bin mir nicht sicher, habe aber Grund zu der Annahme, daß er es gewesen ist.« Obwohl Theodore sich Mühe gab, ruhig zu wirken, zitterte seine Stimme.
»Wissen Sie, wo wir ihn finden können?«
»Er wohnt in der Calle San Gregorio 37. Es ist nicht weit von hier. In Richtung Kathedrale und Zócalo.«
»Aha. Und sein Verhältnis zu der Ermordeten?« fragte Sauzas und steckte sich wieder eine Zigarette an.
»Er war auch ein Freund«, sagte Theodore.
»Ich verstehe. War er auf Sie eifersüchtig?«
»Nein, überhaupt nicht. Wir sind gute Freunde. Nur daß ich … daß ich eben weiß, wie emotional Ramón ist. Und wenn er wütend ist, wird er sogar gewalttätig. Ich muß Ihnen aber auch sagen, daß ich gehört habe, wie jemand an die Tür geklopft hat und dann die Treppe runterrannte, vielleicht zwei, drei Minuten nachdem ich gekommen bin. Ich bin zur Tür gelaufen und wollte ihn einholen, aber er ist mir entwischt.«
»Wie hat er ausgesehen?« fragte Sauzas.
»Ich habe ihn nicht zu Gesicht bekommen«, sagte Theodore, während er sich zugleich vorstellte, wie ein Junge mit dreckigem weißem Hemd und heller Hose über die Treppe floh, doch kam ihm das Bild wohl nur in den Sinn, weil so viele Randalierer auf dem Flur, die auf diese Weise an die Tür gehämmert haben könnten, Hose und weißes Hemd trugen. »Nein, ich hab ihn nicht gesehen, tut mir leid. Da war nur dieser ›Ai-i‹-Schrei, genau so, dann klopfte es, und er ist fortgerannt.«
»Hm«, brummte Sauzas nicht sonderlich interessiert. »Egal, Sie glauben jedenfalls, daß es Ramón gewesen ist.«
»Er war zumindest nicht der Junge, der geschrien hat. Aber ich glaube, ja, ich denke, es wäre zumindest möglich, daß es Ramón gewesen ist.«
»Wissen Sie, ob er heute abend hier war?«
»Nein, das weiß ich nicht.« Theodore sah zu Señora de Silva hinüber. »Wissen Sie, ob Ramón heute abend hier war?«
Señora de Silva hob Augenbrauen und Hände: »Quién sabe?«
»Die Fingerabdrücke werden es uns verraten«, sagte Theodore. Er war sich plötzlich sicher, daß man Ramóns Fingerabdrücke im Schlafzimmer finden würde.
»Also schön, machen wir uns auf die Suche nach Ramón. Ramón Otero in der Calle San Gregorio 37«, sagte Sauzas zum letzten noch verbliebenen Polizisten.
Der Polizist salutierte und polterte die Treppe hinab.
»Sie waren ihr Freund«, sagte Sauzas, wieder zu Theodore gewandt. »Sie waren aber nicht ihr Liebhaber, oder?«
»Na ja, doch. Manchmal.«
»Und Ramón? Er war nicht auch noch ihr Liebhaber, oder? Kommen Sie schon. Señora de Silva hat gesagt, Sie wären es beide gewesen.«
Theodore warf ihr einen Blick zu. Sie mußte ziemlich schnell auf Sauzas eingeredet haben, wenn sie ihm das alles gesagt hatte, bevor sie ins Zimmer gekommen waren. Theodore hatte sich damit abgefunden, Lelia mit Ramón zu teilen, war es längst gewohnt, doch war er es keineswegs gewohnt, vor anderen Leuten davon zu sprechen. »Das ist durchaus richtig.«
»Und da gibt es keine Eifersucht zwischen Ihnen? Sie sind alle gute Freunde?«
»Das ist korrekt«, erwiderte Theodore und begegnete dem ungläubigen Blick des Kommissars mit Fassung. Er wußte, woran Sauzas dachte. Fast jeden Tag prangten auf den Titelseiten der Zeitungen Fotos von blutverschmierten Ehefrauen, Freundinnen und Geliebten, die von ihren Ehemännern und Liebhabern umgebracht worden waren. Na ja, vielleicht ging es hier letztlich um nichts anderes, nur war das Motiv sicherlich nicht Eifersucht gewesen.
»Welche Waffe haben Sie benutzt, Señor Schiebelhut?« fragte Sauzas. »Wo ist das Messer?«
Theodore schüttelte müde den Kopf, schreckte aber im nächsten Augenblick auf, als Sauzas seine Taschen abklopfte und ihm innen wie außen über die Schenkel fuhr. Er zog sogar Theodores Hosenbeine hoch und schaute oben in den Socken nach. Sauzas trug einen Silberring mit großem Totenkopf über gekreuzten Knochen. Ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen, sagte er dann: »Señora de Silva sah Sie in großer Eile die Treppe herunterkommen. Sie wollten vom Tatort fliehen, stimmt’s?«
»Aber – ich hatte sie gerade gefunden! Ich war auf dem Weg zu einem Telefon!« Theodore sah Señora de Silva an, deren erstarrtem Gesicht jetzt anzusehen war, daß sie sich ängstlich jeder Ansicht und Meinung enthielt. »Sie müssen doch feststellen können, wann sie gestorben ist. Warum sorgen Sie nicht dafür, daß sie von einem Arzt untersucht wird?«
»Ein Arzt ist unterwegs. Außerdem habe ich sie mir selbst angesehen«, sagte Sauzas gelassen. »Und ich würde sagen, sie ist seit ein, zwei Stunden tot. Ist schließlich nicht meine erste Leiche.« Sauzas ging auf und ab, musterte Lelias farbfleckigen Tisch, die weißen Nelken und die Rumflasche, die geöffnet, aber nicht angebrochen war. Sie war noch randvoll. »Haben Sie die Blumen mitgebracht?«
»Nein«, sagte Theodore. »Die waren schon hier.« Es sah Ramón gar nicht ähnlich, Blumen mitzubringen, dachte er. Wahrscheinlich hatte Lelia den Strauß selbst gekauft und dann aus irgendeinem Grund vergessen, ihn in die Vase zu stellen. »Sie sollten die Flasche auf Fingerabdrücke untersuchen lassen. Lelia kauft immer Rum für mich. Ihre Fingerabdrücke werden drauf sein, aber vielleicht auch noch die von jemand anderem.«
Sauzas nickte. »Enrique!« rief er einen der Polizisten im Schlafzimmer. »Kommen Sie her, und nehmen Sie von dem Señor hier Fingerabdrücke!«
Der Beamte kam sofort und beschäftigte sich mit Theodores Händen, wobei er Lelias Arbeitstisch als Ablage benutzte.
»Señora de Silva«, sagte Sauzas, »wie oft kommt Señor Schiebelhut her?«
Verlegen wie ein Schulmädchen zuckte sie rasch die Achseln. »Ich treffe ihn – vielleicht einmal die Woche. Aber Lelia hat mir erzählt, daß er öfter kommt.«
»Sie wohnen nebenan. Haben Sie je gehört, daß die beiden sich gestritten haben?«
»Ja, manchmal«, sagte sie mit einem Blick auf Theodore. »Nichts Ernsthaftes, glaube ich. Ich weiß nicht.«
»Und wie oft kommt Ramón her?«
Wieder zuckte sie mit den Achseln. »Genausooft. So oft wie Don Teodoro.«
»Und wie ist er? Mögen Sie ihn?«
Señora de Silva suchte die Antwort in den Zimmerecken. »Ah, sí. Er ist nett. Sieht gut aus. Er ist in Ordnung.«
»Welchen der beiden Männer hat sie lieber gemocht?«
Langes Zögern.
Die Tür ging auf. Ein untersetzter, beleibter Mann mit kleinem Koffer kam herein, grüßte Sauzas mit kurzer Handbewegung, und Sauzas zeigte auf das Schlafzimmer.
»Also, welchen hat sie lieber gemocht?« wiederholte er dann.
»Ich glaube … Ich weiß es wirklich nicht, Señor. Ich glaube, sie hatte beide gern. Sonst hätte Lelia sie nicht so oft zu sich gelassen. Sie hatte viele Freunde. Und ihre Freunde haben oft bei mir angerufen, wenn sie mit ihr reden wollten. Ich habe Lelia am Telefon gehört. Sie hatte keine Angst, Leuten abzusagen, die sie nicht sehen wollte«, schloß Señora de Silva mit einem Anflug von Stolz.
»Auf der Fensterbank sind die Fingerabdrücke dieses Mannes da«, sagte einer der Beamten zu Sauzas.
Theodore verfluchte seine Unachtsamkeit. »Ich glaube, ich habe mich aus dem Fenster gebeugt, um in den Hof sehen zu können.«
»Sind sie auswärts gerichtet?« fragte Sauzas den Beamten, der darauf keine Antwort wußte und mit seinen Papieren zurück ins Schlafzimmer ging.
Carlos Hidalgo kam in Begleitung eines der jungen Polizisten. Er war betrunkener als bei ihrer letzten Begegnung – Theodore kannte die Anzeichen –, doch wirkte er bloß verblüfft und wie betäubt, bis er Theodore bemerkte. Dann stürzte er auf ihn zu und legte ihm die Hände auf die Schultern.
»Teodoro, mein Alter! Was ist passiert? Lelia ist ermordet worden?«
Theodore wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort heraus. Carlos hätte ihn sowieso nicht hören können, da der junge Polizist lauthals Carlos’ Namen und Adresse ausrief, als kündige er dessen Ankunft auf einem Ball an; dann wollte Carlos zum Schlafzimmer, das die Beamten noch durchsuchten, aber der dicke Polizist hielt ihn am Arm zurück. Carlos taumelte und schaute mit großen, verängstigten Augen erst auf den Polizisten und dann im Zimmer umher.
»War dieser Mann heute abend in Ihrem Haus?« fragte ihn Sauzas.
»Ja.« Carlos nickte heftig. »Er kam direkt vom Flughafen und hatte einen Koffer bei sich.«
»Von wann bis wann war er bei Ihnen?«
Carlos sah argwöhnisch zu Theodore hinüber, da er den Motiven der Polizei selbst in betrunkenem Zustand nicht traute. Doch Theodore reagierte nicht.
»Ich glaube von zwölf – bis etwa eins«, sagte Carlos, was Theodore überraschend exakt fand.
»Sie können nicht genau sagen, um welche Zeit er gegangen ist?«
»Ich hab ihn nicht gehen sehen. Es waren viele Gäste auf der Party. Vielleicht hat er sich ja von meiner Frau verabschiedet …« So verstohlen, wie sich Carlos beim Sprechen umsah, hätte er auch gelogen haben können.
»Ich habe mich nicht verabschiedet«, sagte Theodore. »Als ich gehen wollte, konnte ich keinen von euch beiden finden und bin deshalb einfach gegangen und mit einem libre zu Lelia gefahren.«
»Mit einem libre zu Lelia«, wiederholte Carlos, als versuche er, sich diese unwahrscheinliche Tatsache einzuprägen.
»Also«, sagte Sauzas und wandte sich Theodore zu. »Mit einem libre zu Lelia, nachdem Sie auf der Party sicher allen gesagt hatten, daß Sie auf dem Weg nach Hause waren. Dabei wollten Sie herkommen, Lelia so rasch wie möglich umbringen und anschließend mit einem weiteren libre nach Hause fahren, stimmt’s? So hätten Sie dann ein Alibi gehabt.«
»Oh, neiin!« rief Carlos mit seiner lauten Bühnenstimme. »Dieser Mann hier –«
»Oder sind Sie vom Flughafen hergefahren, haben sie getötet und sind dann weiter zur Party? Aber warum mußten Sie dann zurückkommen? Haben Sie etwa etwas vergessen?«
»Mein Flugzeug ist um fünf nach elf gelandet«, sagte Theodore. »Es war die Maschine aus Oaxaca. Das können Sie überprüfen lassen. Außerdem hat es mindestens vierzig Minuten gedauert, bis ich bei diesem Verkehr in der Innenstadt war. Und ich bin gleich zu den Hidalgos gefahren.«
»Aber warum haben Sie sich aus dem Haus der Hidalgos geschlichen, ohne sich von irgendwem zu verabschieden?«
»Ich habe mich nicht aus dem Haus geschlichen. Alle waren nur so beschäftigt!«
Plötzlich lachte Carlos auf. »Genau! Beschäftigt! Wir waren heute abend alle sehr beschäftigt!« Als Theodore und Sauzas ihn nur anstarrten, verstummte er ernüchtert. »Ach, Teodoro«, sagte er dann mitfühlend. »Gibt’s denn hier nichts zu trinken?« Er wandte sich in Richtung Küche. Theodore sah ihn stocken, als er ihre Leiche im Zimmer dahinter sah, doch setzte er gleich darauf mit trunkener Entschlossenheit seinen Weg fort.
»Fassen Sie nichts an!« rief der dicke Polizist und lief ihm hinterher.
Theodore hörte einen Streit, dann wurde etwas in ein Glas gegossen, und er wußte, daß es sich um Lelias braunen Tequila handelte.
»Mein Freund braucht einen Drink«, sagte Carlos würdevoll und ging mit Glas und Flasche zu Theodore.
Theodore nahm das Glas dankbar an. Er zitterte so, daß es beim Trinken an seine Zähne schlug.
Weiter ging die Fragerei. Wie lange kannte Carlos Theodore Schiebelhut? Hatte er Lelia Ballesteros gekannt? Wie lange? Hatte sie viele männliche Freunde? Sie hatte viele Freunde und Freundinnen. Wie hatte Theodore ausgesehen, als er am Abend zur Party kam?
»Gut«, sagte Carlos, »sehr gut.« Er nahm Theodore das Glas ab und schenkte sich ein.
»Genug jetzt!« befahl der dicke Polizist.
»Das ist für mich«, sagte Carlos, trank von dem Glas und reichte es Theodore weiter, ehe der dicke Polizist es ihm abnehmen konnte.
Theodore fühlte sich plötzlich erschöpft. Er ging zum Sofa, setzte sich, lehnte sich zur Seite und stützte sich auf den Ellbogen auf.
Langsam watschelte der beleibte Arzt ins Zimmer, und Sauzas drehte sich zu ihm um. – »Sie ist seit – na, zwei, drei Stunden tot. Und sie ist vergewaltigt worden«, sagte der Arzt müde und schloß die letzte Schnalle an seinem Koffer.
Vergewaltigt. Theodore fühlte, wie ihn äußerster Ekel übermannte. Er beugte sich auf dem Sofa vor und preßte die Unterarme auf die zitternden Knie. Unruhig schob er den Ärmelaufschlag zurück; es war zehn vor zwei.
Der Beamte fragte Carlos über Ramón aus.
»Ich kenne Ramón nicht besonders gut. Er arbeitet auf einem ganz anderen Gebiet«, erwiderte Carlos etwas geziert. »Ich habe ihn vielleicht dreimal in meinem Leben gesehen.«
Er hat ihn wesentlich öfter gesehen, dachte Theodore, aber das war jetzt nicht weiter wichtig. Nichts war wichtig, solange Ramón nicht da war. Er schreckte auf, als Carlos bestürzt »Verstümmelt?« rief.
Verständnislos blickte Carlos ihn an. »Sie ist verstümmelt worden?« fragte er, als ob dies alles ändern würde.
Und dann kam Ramón ins Zimmer.
Theodore stand auf.
Ramón sah sich bestürzt um, dann richtete sich sein Blick auf Theodore. Er war mittelgroß, hatte schwarzes Haar und dunkle Augen, eine kräftige, kompakte Figur und dazu jenes rätselhafte Etwas, eine gewisse Vitalität, vielleicht auch nur gewisse Proportionen, die Frauen so ungeheuer attraktiv finden. Sein Gesicht konnte blitzschnell den Ausdruck ändern, wirkte aber stets anziehend, selbst unrasiert, selbst mit wirrem, ungekämmtem Haar, die Art Gesicht, die Frauen fasziniert; und wie er nun in seinem billigen Anzug und mit zerzaustem Haar im Zimmer stand, spürte Theodore, daß jeder glauben mußte, Ramón wäre Lelias Liebling gewesen.
»Wo ist sie?« fragte Ramón.
Der Polizist, der ihn am Arm hielt, zog ihn zum Schlafzimmer, und die Beamten kamen hinterher, um seine Reaktion zu beobachten. Theodore ging mit. Lelia lag auf dem Rücken, den Kopf auf dem Kissen, die malträtierten Arme lang ausgestreckt. Es sah gespenstisch aus, fast als hätte sie sich nur für einen Moment hingelegt, in ihren Kleidern, und etwas Gräßliches wäre geschehen. Theodores angeschlagenem Verstand kam das Blut wie dunkelrote Farbe vor, die man einfach abwaschen konnte. Nur wer genauer hinschaute, sah, daß Lelia keine Nase mehr hatte.
Ramón hielt sich die Hand vor den Mund. Er sackte in sich zusammen und stieß einen seltsamen, halb erstickten Laut aus. Der Polizist zog ihn an der Schulter zurück, kräftig, aber Ramón wand sich los, warf sich vor das Bett und packte Lelias Knie, die von der rosafarbenen Decke gerade noch verhüllt wurden. Er drückte das Gesicht an ihre Schenkel und schluchzte. Theodore wandte den Blick ab. Er fand sich an Ramóns Katholizismus erinnert, zumindest an diese Seite seines Glaubens, die ihn drängte, etwas zu berühren oder zu umarmen, was nicht mehr lebte. Theodore war sich gleichzeitig bewußt, daß er Lelia nicht angefaßt hatte, jedenfalls nicht voller Zuneigung, daß er sie einfach nur umgedreht hatte, wie es ein Fremder getan hätte, und er bedauerte, daß er sie in jenem Augenblick der Zweisamkeit, als er noch allein mit ihr gewesen war, nicht gestreichelt, ihre blutverschmierte Stirn nicht geküßt hatte.
»Wo sind Sie heute abend gewesen, Ramón Otero?« Wie ein Automat begann diesmal der kleine dicke Polizist mit dem Verhör.
Ein Beamter durchquerte mit zwei Schritten das Zimmer und zog Ramón vom Bett fort. Die Frage mußte mehrmals wiederholt werden. Ramón schien die Stimme oder den Verstand verloren zu haben. Wieder starrte er Theodore an.
»Wo bist du heute abend gewesen?« fragte ihn nun Theodore mit seiner tiefen Stimme.
»Zu Hause. Ich war zu Hause.«
»Den ganzen Abend?« fragte Sauzas.
Ramón sah ihn mit dumpfem Blick an, eine Gesichtshälfte naß von Tränen. Mit der rechten Hand hielt er sich den Bauch.
»Du warst doch heute abend nicht hier, oder?« fragte ihn Theodore.
»Doch, ich war hier.«
»Um welche Zeit?« fragte Sauzas.
Ramón schaute ihn an, als müßte er weit in die Vergangenheit zurückblicken. Plötzlich beugte er sich vor und hielt sich den Kopf.
»Was ist mit ihm?« wollte Sauzas ungeduldig von Theodore wissen.
»Vielleicht hat er Kopfschmerzen. Die hat er öfter«, sagte Theodore. »Setz dich, Ramón.«
Einer der Beamten schob Ramón zu dem langen Tisch, an dem ein Stuhl stand. Ramón brach darauf zusammen. Der Beamte nahm seine rechte Hand und begann, Abdrücke der Fingerkuppen zu nehmen.
»Wann waren Sie hier, Ramón?« fragte Sauzas diesmal etwas sanfter. »Haben Sie hier zu Abend gegessen?«
»Ja.«
»Und was dann? Wie lange sind Sie geblieben?«
Ramón gab keine Antwort.
»Haben Sie Lelia getötet, Ramón?« fragte Sauzas.
»Nein.«
»Nein?« fragte Carlos Hidalgo herausfordernd.
Sauzas winkte Carlos zurück. »Um wieviel Uhr sind Sie zum Abendessen gekommen?« Sauzas wartete einen Augenblick, dann trat er rasch auf Ramón zu, als wollte er ihn mit einer Ohrfeige wieder zur Besinnung bringen, doch blieb er abrupt stehen, als Ramón mit unverändert benommener Miene zu reden begann.
»Ich war gegen acht Uhr hier, und wir haben zusammen gegessen. Wir hatten angenommen, daß Teo noch kommt. Wir wollten eine Party feiern. Den Rum habe ich mitgebracht. Dann habe ich mich nicht wohl gefühlt und bin nach Hause gegangen.«
»Wann?«
»Ich glaube … gegen halb elf, vielleicht auch später.«
»Haben Sie sich heute abend mit Lelia gestritten, Ramón?«
»Nein.«
»Sie haben sich nicht wegen Teodoro gestritten? Sie haben gehofft, daß er kommen würde?«
»Ja.« Ramon nickte.
»Ich habe Lelia eine Postkarte geschickt, damit sie wußte, daß ich heute abend zurückkomme«, sagte Theodore, doch Sauzas schien ihn nicht zu hören.
»Und haben Sie diese Blumen mitgebracht, Ramón?«
»Nein«, erwiderte er mit einem Blick auf die Blumen.
»Waren die Blumen hier, als Sie in der Wohnung waren?« fragte Sauzas und strich über die Blumenstengel.
»Ich kann mich nicht erinnern«, antwortete Ramón.
»Haben Sie an diesem Tisch gegessen?«
»Ja.«
»Dann müssen die Blumen gekommen sein, nachdem Sie gegangen sind. Hat sie gesagt, daß sie Blumen kaufen wollte?«
Wieder dachte Ramón angestrengt nach. »Ich weiß nicht mehr«, sagte er verzweifelt und schüttelte den Kopf.
»Suchen Sie in der Küche nach dem Papier, in das die Blumen eingewickelt gewesen sein könnten«, sagte Sauzas zu einem der Beamten. »Suchen Sie gründlich!«
Theodore starrte die Blumen an und wußte nicht, was er davon halten sollte. Er hatte nicht angenommen, daß Ramón sie gekauft hatte. Vielleicht war Lelia ausgegangen, um die Blumen zu besorgen, nachdem Ramón gegangen war, doch warum hatte sie die Nelken nicht in eine Vase gestellt? Hatte der Mörder sie in ihre Wohnung begleitet? Das konnte sich Theodore nicht vorstellen.
Der Beamte kam zurück und meldete, daß er kein Blumenpapier gefunden hatte.
Mit gerunzelter Stirn wandte sich Sauzas an Ramón. »Sie hat nach dem Essen das Geschirr abgewaschen?«
»Ja, und ich habe abgetrocknet.«
Auf Sauzas Anweisung wischte einer der Beamten Ramón mit einem feuchten Tuch über das Gesicht.
»Nimmt er Medikamente gegen diese Kopfschmerzen?« wurde Theodore von Sauzas gefragt.
»Nein, er hat nichts eingenommen. Er ist bloß durcheinander.« Und sobald er das gesagt hatte, begriff Theodore, daß Ramón dieses Verbrechen wohl kaum begangen haben dürfte, wenn er tatsächlich so durcheinander war.
»Heute abend gab es ein Geräusch auf dem Dach«, sagte Sauzas zu Ramón. »Señora de Silva sagte, es hätte sich wie eilige Schritte angehört. Waren Sie noch hier, als das passierte?«
»Schritte auf dem Dach?« wiederholte Ramón.
»Wach auf, Ramón! Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit, dir alles aus der Nase zu ziehen!« platzte es aus Theodore heraus.
»O doch«, gluckste Sauzas und steckte sich wieder eine Zigarette an. »Wir haben die ganze Nacht Zeit.« Er rauchte Gitanes, und der strenge, bittersüße Geruch des Caporal-Tabaks breitete sich im Zimmer aus. »Also? Haben Sie Schritte auf dem Dach gehört?« fragte Sauzas noch einmal.
»Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht.«
Ein Beamter erhob sich abrupt vom Tisch. »Seine Fingerabdrücke sind auf der Flasche«, sagte er und zeigte auf den Bacardi. »Außerdem haben wir einen Abdruck am Bettgestell und welche am Nachtschränkchen gefunden.«
»Was ist mit dem Fensterbrett und den Messern in der Küche?«
»Nur auf einem Messer sind Fingerabdrücke, und die sind von der Frau«, erwiderte der Beamte.
»Aha«, sagte Sauzas gleichgültig. »Haben Sie Lelia geliebt, Ramón?«
»Ja.«
»Wollten Sie sie heiraten?«
Ramón preßte die Lippen aufeinander, sprang vom Stuhl auf und lief zur Tür. Ein Beamter und zwei Polizisten eilten hinter ihm her und zerrten ihn zurück. Sie drehten ihn um, und einen Moment lang sah Theodore einen verzweifelten, müden, verwirrten Ausdruck auf seinem Gesicht, dann stießen sie ihn wieder auf den Stuhl. Er sprang wieder hoch. »Ich habe es nicht getan!« schrie Ramón. »Ich war’s nicht! Ich war’s nicht!«
»Das hat auch niemand behauptet.«
Ramón stand da und wollte sich nicht wieder auf den Stuhl setzen. Auf beiden Seiten hielt ihn ein Polizist am Arm fest. »Hast du es getan, Teo?«
»Nein, Ramón, aber ich habe sie gefunden. Ich kam her und habe sie gefunden«, sagte Theodore.
»Ich glaub dir nicht! Sind das deine Blumen? Streitest du etwa ab, daß du sie hergebracht hast?« Ramóns Stimme wurde hysterisch.
»Das werden wir noch herausfinden, Ramón«, sagte Sauzas. »Señor Schiebelhut sagt, er sei hergekommen und durch das Oberlicht gekrochen, weil er keinen Schlüssel –«
»Aber er hat einen Schlüssel!« unterbrach ihn Ramón und versuchte, sich dem Griff der Polizisten zu entwinden.
»Ich hatte ihn zu Hause gelassen. Ich hatte keinen Schlüssel bei mir. Ich sah Licht, Ramón, und habe sie gerufen.«
»Durchsucht ihn nach einem Schlüssel«, befahl Sauzas einem der Beamten.
Geduldig leerte Theodore den Inhalt seiner Taschen auf den Tisch – Brieftasche, Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln für den Wagen, zwei für das Haus sowie einem Schlüssel für den Briefkasten, Zigaretten, Feuerzeug, Kleingeld, ein Knopf, der sich vom Regenmantel gelöst hatte –, der Beamte tastete eigenhändig jede Tasche ab. Dann wurde geprüft, ob die Schlüssel am Bund zur Tür paßten.
Sauzas wandte sich an Ramón. »Haben Sie Ihren Schlüssel dabei?«
Ramón nickte, griff in die Hosentasche und zog einen Bund mit drei oder vier Schlüsseln heraus.
»Welcher ist es?« fragte Sauzas, und nachdem Ramón den richtigen Schlüssel gesucht und ihm den Bund gegeben hatte, öffnete er die Tür und probierte ihn aus. Der Schlüssel paßte. »Als Sie gingen, haben Sie da hinter sich abgeschlossen, Ramón?«
»Natürlich nicht. Sie war doch in der Wohnung.«
»Haben Sie gehört, daß hinter Ihnen abgeschlossen wurde?«
»Ich glaube nicht.«
»Hatte sie die Angewohnheit, die Tür abzuschließen?«
Ramón zögerte, und Theodore wußte, daß es darauf keine Antwort gab. Solche Angewohnheiten hatte Lelia nicht gehabt. Manchmal schloß sie ab, wenn jemand ging, manchmal auch nicht.
»Die Schlüssel der Señorita«, sagte Sauzas plötzlich. »Sehen Sie nach, ob Sie die finden können, Enrique«, sagte er zu dem Beamten, der in der Flurtür stand.
Der Beamte ging zurück ins Schlafzimmer, und Sauzas folgte ihm.
Theodore sah in der bemalten Tonschale auf dem Bücherregal nach, in die Lelia manchmal ihre Schlüssel geworfen hatte. Die Schale war leer.
Die Schlüssel wurden nicht gefunden. Die Beamten durchsuchten sogar die Küche. Die Schlüssel waren nicht in der Handtasche, in keiner Manteltasche und in keiner Schublade. Theodore und Ramón wurden gefragt, wo Lelia gewöhnlich ihre Schlüssel ablegte, und beide nannten die Tonschale auf dem Bücherregal.
»Sie war nicht besonders ordentlich«, sagte Theodore, »aber wenn sie hier sind, müßten sich die Schlüssel finden lassen.« Er fragte sich, warum Ramón sie mitgenommen haben sollte. Oder ob jemand anders sie an sich genommen haben könnte, jemand, der nun Zutritt zur Wohnung hatte.
»Warum haben Sie die Schlüssel mitgehen lassen?« wandte sich Sauzas plötzlich an Ramón.
»Aber ich hab sie doch gar nicht.«
»Und was haben Sie damit gemacht?«
Ramón erwiderte nur seinen Blick und zündete sich eine seiner kleinen Carmencitas an.





























