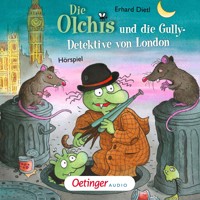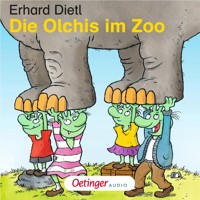14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die tief bewegenden Erinnerungen von Olchi-Erfinder Erhard Dietl an seine Jugend. Seine Kindheit, seine Jugend und die Zeit als junger Erwachsener erlebt Erhard Dietl im Regensburg und München der 1950er, 60er und 70er Jahre. Er, der Erfinder der skurrilen, urkomischen und ganz und gar unkonventionellen Großfamilie der Olchis, wird heute von Millionen Kindern weltweit für seine lustigen Geschichten aus Schmuddelfing geliebt. Jetzt erinnert er sich zurück an seinen Vater, der in Krieg und Gewalt erwachsen wurde und infolgedessen der eigenen Familie meist seltsam fern war, fast wie ein Fremdkörper. Dennoch prägte er seinen Sohn. Erhard Dietl begibt sich auf Spurensuche: Wer war dieser Mann? Möchtergern-Literat und Fotograf, belesen und vielseitig interessiert, aber oft auch aufbrausend und sogar gewalttätig. Seine Erinnerungen sind eine spannende und sehr berührende Zeitreise, die eine Vater-Sohn-Beziehung offenbart, die von Ambivalenz, viel Distanz und wenigen Momenten der Nähe bestimmt war. Kinderbuchautor und Illustrator Erhard Dietl erzählt von seinem Vater. Bisweilen erschütterndes Porträt eines ambivalenten, zutiefst zwiegespaltenen Vaters. Anlässlich seines 70. Geburtstages wirft Erhard Dietl einen sehr persönlichen Blick auf das Deutschland der Nachkriegszeit und die junge Bundesrepublik. Begleiten Sie den Autor bei seiner erkenntnisreichen Spurensuche, einer lesenswerten Reise mitten hinein in die deutsche Nachkriegsgeschichte. Für alle Leser*innen von Sabine Bodes "Nachkriegskinder".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
AUCH WENN MIR MEIN VATER MANCHMAL UNERTRÄGLICH VORKAM, SO SPÜRTE ICH DOCH, DASS ICH IHN LIEB HATTE.
Damals in Regensburg und München, in den 1950er, 60er und 70er Jahren. Erhard Dietl erinnert sich an seine Kindheit und an seinen Vater. Wer war dieser Mann? Einerseits geistreich und gebildet, Redakteur, Fotograf und Literat. Andererseits Spion für die DDR, der gern mal ein Glas zu viel trank. Der aufbrausend, egomanisch und gespalten war und seiner Familie seltsam fern.
»Ein Vater wie meiner« ist eine Geschichte vom Suchen und Scheitern, von Liebe und Vergebung. Eine bewegende Zeitreise ins Nachkriegsdeutschland und das berührende Portrait einer ambivalenten Vater-Sohn-Beziehung vom Autor der erfolgreichen Kinderbuchreihe »Die Olchis«.
Meine Freundin hatte Freunde und Familie in Frankfurt.
Wir wollten dort Silvester feiern und lagen voller Vorfreude im Hotelbett. Am Morgen weckte mich mein Handy.
Es war meine Mutter, ich hörte sie ins Telefon weinen, gerade hatte sie vom Krankenhauspförtner erfahren, dass mein Vater in der Nacht zuvor gestorben war.
Sie hatte versucht, meinen Vater zu erreichen, aber er war nicht ans Telefon gegangen, das neben seinem Bett hing. Dann hatte sie beim Pförtner angerufen. »Es tut mir leid, Herr Dietl ist heute Nacht von uns gegangen«, hatte er ihr gesagt und meine Mutter an die Station weitergeleitet, in der mein Vater lag. Aber die diensthabende Schwester hatte meiner Mutter am Telefon auch nichts Näheres sagen wollen. Ich nahm den nächsten ICE und fuhr ohne meine Freundin zurück nach München.
»Geh gleich heute noch ins Krankenhaus«, bat mich meine Mutter. »Schau, ob du jemanden triffst, der dir was Genaueres sagen kann. Ich selber kann nicht mitkommen, dazu fehlt mir die Kraft.«
Als ich am Krankenhaus ankam, schneite es dicke Flocken und es war längst dunkel geworden. Der Pförtner gab mir den Rat, bei der Verwaltung im Erdgeschoss nach meinem verstorbenen Vater zu fragen. Aber ich fand alle Türen verschlossen, die Korridore waren menschenleer, nur draußen unter dem Vordach stand ein frierender Raucher im Bademantel. Endlich traf ich auf eine Krankenschwester.
»Momentchen«, sagte sie und tippte etwas in ihren Computer. »Ihr Herr Vater ist jetzt unten im Keller. Möchten Sie ihn vielleicht noch einmal sehen?« Sie blickte mich fragend an.
Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, am zweiten Weihnachtsfeiertag in seinem Krankenhausbett, als er zu mir gesagt hatte: »Kannst du mich vielleicht rasieren? Bestimmt seh ich scheußlich aus.« Der Gedanke, ihn zu rasieren, war mir nicht angenehm gewesen.
»Der Rasierer liegt im Nachttisch«, hatte er gesagt. »Ich hab keinen Spiegel und kann ja schlecht ins Bad, in meinem Zustand.«
Also hatte ich seinen Batterierasierer aus der Schublade genommen, und während ich ihn rasierte, waren seine Augen geschlossen gewesen und er hatte den Kopf genießerisch hin und her gedreht.
»Mach es ruhig gründlich«, hatte er gesagt, ohne dabei die Augen zu öffnen. »Auch da weiter unten am Hals.«
Sein stoppeliges Gesicht mit dem Rasierapparat zu berühren, hatte mich Überwindung gekostet. Ich konnte mich nicht erinnern, ihn jemals irgendwo berührt zu haben, außer an seiner Hand, die ich zur Begrüßung meist kurz drückte, zum Abschied reichte meistens ein »Servus«.
Schon immer waren wir eine berührungsfeindliche Familie gewesen. Hatte meine Mutter ihn berührt, als er da in seinem Krankenbett gelegen hatte? Hatte sie ihn tröstend gestreichelt in den schweren Stunden vor seiner Operation? Ich hoffte es, konnte es mir aber nur schwer vorstellen.
Die Nachricht von seinem Tod erschütterte mich …
Ich fragte mich, wie er hatte sterben können in dieser perfekt ausgestatteten Groß-Klinik. Angeblich war die Operation ohne Komplikationen verlaufen, er hatte bald danach schon wieder mit meiner Mutter telefoniert und war guter Dinge gewesen.
Auch die Krankenschwester konnte mir das nicht erklären. »Kommen Sie morgen wieder«, schlug sie vor. »Heute ist leider keiner mehr da, der Ihnen Auskunft geben kann.«
Sie überreichte mir eine weiße Plastiktüte mit den Habseligkeiten meines Vaters und ein Formular, worauf ich den Erhalt bestätigte.
Ohne hineinzusehen, wie eine zerbrechliche Kostbarkeit, trug ich die weiße Tüte durch die stille, menschenleere Klinik. Draußen schneite es immer noch. Auffallend ruhig war es auf den Straßen, kaum Autos, und nur wenige Leute waren unterwegs. Die Stadt schien durchzuatmen, so kurz vor dem Jahreswechsel.
Es fiel mir schwer zu begreifen, dass mein Vater nicht mehr am Leben war. Vielleicht hätte ich mir seinen toten Körper doch noch einmal ansehen sollen? Ich lief hinüber zum Parkplatz, zündete mir eine Zigarette an und schabte den Schnee von den Scheiben. Im dichten Schneetreiben fuhr ich zurück zur Theresienstraße, wo meine Mutter auf mich wartete.
Drei Stockwerke ging es hinauf zur Wohnung und beim Hineingehen warf ich einen Blick in das Zimmer meines Vaters. Diese fünfzehn oder zwanzig Quadratmeter mit ihrem muffigen, aber gemütlichen Geruch, der auch noch da war, wenn man gelüftet hatte. So viele Jahre lang hatte er hier gelebt und gearbeitet. Sein Arbeitszimmer war sein Rückzugsort gewesen, sein Entspannungsraum, seine Bücherhöhle. Ringsum hoch bis zur Decke die braunen, vollgestopften Bücherregale, die kleineren Formate und Taschenbücher standen aus Platzgründen zweireihig, die in der zweiten Reihe waren sicher längst in Vergessenheit geraten. Erst viel später entdeckte meine Mutter die leeren Schnapsflaschen, die mein Vater alle ausgetrunken und hinten in der zweiten Bücherreihe heimlich entsorgt hatte. Zwischen den Büchern lag auch ein bisschen Nippes, lieb gewonnener, verstaubter Krimskrams, seit Jahren unverändert, und nur selten war ein neues Stück dazugekommen.
Seine Bücher hatte mein Vater gehegt und gepflegt, manchmal ließ er das Fenster extra offen, damit sie auch frische Luft bekamen. »Regelmäßiges Lüften ist wichtig, das tut ihnen gut!«, hatte er gesagt und uns immer wieder versichert, dass unter seinen Büchern ganz außerordentlich wertvolle Schätze waren. In unregelmäßigen Abständen hatte er alle seine Bücher liebevoll aus den Regalen genommen, in kleinen Stapeln zum offenen Fenster getragen, den Staub von den Buchrücken geblasen und beinahe zärtlich darübergewischt mit einem weichen Staubtuch.
»Ogottogott, immer diese Bücher!«, hatte man meine Mutter oft jammern hören. »Umziehen können wir nie mehr, mit so vielen Büchern.« Und immer, wenn mein Vater ein bisschen Geld übrig hatte, kamen wieder neue Bände dazu, meistens günstig erstanden in einem Schwabinger Antiquariat.
»Diese Scheißbücher!«, schimpfte meine Mutter dann. »Er hat nur seine Scheißbücher im Kopf. Hat keinen Pfennig in der Tasche und kauft sich schon wieder einen so scheißteuren Bildband. Soll das ein Mensch verstehen? Da werd ich noch verrückt!« Aber das sagte sie nur, wenn mein Vater nicht in der Nähe war.
Auch an der Stirnseite seines Zimmers standen unter dem Fenster zwei niedrigere, schmale Bücherregale mit Taschenbüchern, auf der Ablage staubten handgroße Brocken Halbedelsteine auf kleinen Stoffdeckchen vor sich hin. Auf dem grau melierten Teppichboden lagen zwei kleinere »Perserteppiche«, die meine Mutter Stolperfallen nannte. An der Wand gegenüber waren über dem Bett zwei kleinere Wandteppiche über Eck an die Wand genagelt, denen man im Kampf gegen Motten einmal im Jahr mit Insektenspray zu Leibe rücken musste. Um beim Einsprühen auch ganz oben an die Teppiche zu kommen, musste man sich auf das Bett stellen und dabei die Luft anhalten, denn das tödliche Giftspray durfte man auf gar keinen Fall einatmen. Diesen durchaus herausfordernden Stunt vollführte immer meine Mutter, und später, als sie nicht mehr auf das Bett steigen konnte, bat sie mich darum.
Das schmale, schlichte Bett meines Vaters war heute frisch gemacht, bestimmt vorbereitet für seine Rückkehr aus dem Krankenhaus, die Überwurfdecke picobello glatt gestrichen. Er hatte sie immer seine Sigmund-Freud-Decke genannt. Merkwürdig, wie stolz er immer auf sie gewesen ist, hatte er von Psychologie und von Therapeuten doch nie besonders viel gehalten.
Zwischen den Bücherregalen hatte ein niedriger Rollschrank Platz gefunden, darauf standen der Plattenspieler, ein Holzpferd, eine bemalte Spanschachtel und ein Keramikaschenbecher. Der Rollmechanismus funktionierte schon lange nicht mehr, der Schrank stand immer offen und gab den Blick frei auf Leitzordner und Langspielplatten.
Auch ein hellbrauner 50er-Jahre-Schreibtisch hatte hier im engen Zimmer noch Platz, darauf thronte die schwere, rote IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, und daneben wartete ein gutes Dutzend akkurat gespitzter Faber-Castell-Bleistifte auf ihren Einsatz. Der Schreibtischstuhl mit seinen Armlehnen war aus stabilem Holz. Früher stand da an seiner Stelle ein sogenannter Freischwinger-Stuhl aus weißem Leder, mit elegantem Chromgestänge, den ich ausgemustert und meinem Vater geschenkt hatte. Der Stuhl war jedoch unter seinem Gewicht zusammengebrochen, und mein Vater war nach hinten gesackt und mit dem Kopf gegen die Bücherwand geknallt.
»Weil er halt so fett ist«, hatte meine Mutter damals gemeint. »Ein Wunder, dass er sich nicht den Hals gebrochen hat, bei so einem Sturz.«
»Kommst du?«, hörte ich sie jetzt aus der Küche rufen. Klein und traurig saß sie am Tisch, und ich setzte mich zu ihr.
»Am Telefon muss ich das erfahren, von einem Pförtner! Stell dir vor, der Pförtner hat es schon gewusst. Wieso überhaupt? Warum weiß der so was?« Leise fing sie an zu weinen. »Menschenskind, warum hat mich keiner angerufen? Das gehört sich doch, oder? Was denken die sich? Bin ich denen das nicht wert?«
»Nein, nein«, versuchte ich, sie zu beschwichtigen. »Sicher war es halt noch ein bisserl früh. Die hätten dich später schon noch angerufen, ganz bestimmt sogar.«
»Trotzdem ist es eine Frechheit, dass die mich nicht gleich angerufen haben, nachdem der Vater gestorben ist. Ich hab mich den ganzen Tag geärgert.«
Ich nahm die Habseligkeiten meines Vaters aus der Plastiktüte und legte sie auf die blau-weiß karierte Wachstuchdecke. Seinen Waschbeutel, den Rasierapparat, den Schlafanzug, den kleinen CD-Player mit drei Klassik-CDs, ein Buch (Goethe) und den kleinen Plastik-Weihnachtsmann, den er mit in die Klinik genommen hatte, obwohl er nur ein albernes Mitbringsel von mir gewesen war. Als Letztes nahm ich seine batteriebetriebene Armbanduhr aus der Tüte.
»Warum ist denn die Uhr voller Blut?«, fragte mich meine Mutter. Ihre tränennassen Augen schauten mich erschrocken an, aber ich wusste darauf keine Antwort.
*
»Na ja«, sagte meine Mutter, »schon traurig, dass er nicht mal am Ende ein bisserl Geld gehabt hat. Nur ein paar Schulden hat er uns hinterlassen. Aber das hat man sich ja denken können. Ist ja sein ganzes Leben lang so gegangen und nie anders gewesen bei ihm.« Mein Vater hat ihr nichts vererbt.
Aber nun gehörten ihr wenigstens die wertvollen Bücher, und das war ein kleiner Trost. Er hatte ihr ja immer wieder versichert, dass sehr seltene Erstausgaben darunter waren.
»Das sind Werte, die du dir gar nicht vorstellen kannst«, hatte mein Vater erklärt. »Jeder Antiquar würde sich die Finger danach lecken! Das sind so seltene Bände, wie man sie heutzutage gar nicht mehr findet.«
Aber noch wurden die Bücher nicht verkauft, das Zimmer meines Vaters wurde so belassen, wie es war, und jahrelang wurde nichts darin verändert.
Als meine Mutter schließlich in ein Altenheim umziehen musste, wurde die Wohnung gekündigt und sollte geräumt werden.
Bevor das Räumkommando anrückte, verschenkte meine Mutter brauchbare Dinge an Freunde und Bekannte, die wertvolleren Sachen sollte ich so schnell wie möglich verkaufen, denn sie konnte das Geld dringend gebrauchen.
»Du musst alle meine Wertsachen für mich verscherbeln«, sagte sie, als ich sie in ihrem neuen Altenheim besuchte, wo sie gerade eingezogen war. »Pass aber auf, dass du einen guten Preis dafür bekommst. Lass dich nicht übers Ohr hauen.«
An der Wand ihres Zimmers in der Theresienstraße und in der Küche hingen ihre gesammelten Hinterglasbilder und ein verwittertes, altes Kreuz aus Tirol, auf dem Bauernschrank standen unter Glasstürzen uralte Wachsfiguren und dazwischen eine goldene Kirchen-Monstranz, die ihr der Pfarrer in einem Tiroler Bergdorf geschenkt hatte.
»Meine Monstranz ist etwas ganz Besonderes«, zog sie mich ins Vertrauen. »Hierher ins Altenheim mitnehmen will ich sie auf gar keinen Fall. Hier wird mir das wertvolle Ding nur geklaut.«
Sie bestand darauf, dass ich ihr Testament öffnete, das ich bei mir zu Hause aufbewahrte.
»Ich bin zwar noch nicht tot, aber das ist jetzt ein echter Notfall. Also geh und mach mein Testament auf. Lies nach, was ich für dich aufgeschrieben habe.«
»Kannst du mir das nicht auch so sagen?«
»Nein, nein! Geh und lies mein Testament! Das regt mich alles viel zu sehr auf, ich will nicht darüber reden. Hab ja extra alles für dich aufgeschrieben, und du musst es nur lesen.«
Also nahm ich zu Hause ihren Letzten Willen aus dem Umschlag.
»… und meine goldene Monstranz ist sehr wertvoll!«, hatte sie geschrieben und das sehr wertvoll! zweimal unterstrichen. »Bitte verkaufe sie gut. Von dem Geld bezahlst du meinen Sarg und meine Beerdigung und den Flug deiner Schwester von Amerika nach München. Vom Rest kaufst du dir etwas Schönes …«
Das klang vielversprechend. Noch am selben Tag besuchte ich sie wieder im Altenheim.
»Na, hast du mein Testament gelesen? So machst du es jetzt«, sagte sie und nannte mir auch gleich einen Antiquitätenhändler ihres Vertrauens.
Ich rief ihn an, und bereits am darauffolgenden Nachmittag erschien er in der Theresienstraße, lief neugierig durch die Wohnung und inspizierte mit Kennerblick die Antiquitäten.
»Ja mei«, hörte ich ihn seufzen, »religiöse Sachen sind halt momentan gar nicht gefragt.«
»Ach? Aber das ist alles sehr alt, oder?«
»Ja mei. Alt schon. Aber dieses Zeug will kein Mensch.«
»Wieso denn nicht? Sie wollen es gar nicht mitnehmen?«
»Nur die Bilder und das Kreuz. Und dafür geb ich sechshundert.«
»Sechshundert? Für all die schönen Bilder? Und die goldene Monstranz? Die ist aus einem Tiroler Bergdorf. Eine Rarität!«
»Ja mei. Die ist aus Messing, die brauch ich nicht.«
»Echt nicht?«
»Das Ding kauft mir doch so schnell keiner ab.«
»Oje, meine Mutter wird sehr enttäuscht sein.«
Er schnäuzte sich geräuschvoll. »Na gut, meinetwegen«, sagte er. »Weil ich Ihre Mutter kenne. Dann nehm ich die Monstranz halt mit für hundertzwanzig. Aber mehr geht nicht. Okay?«
Auch für meine Mutter war das okay. Der Antiquitätenhändler war schließlich ein Mann ihres Vertrauens, und mit Tatsachen konnte sie sich schon immer ganz gut abfinden.
»So schlimm ist das nicht«, meinte sie. »Zum Glück haben wir ja noch die vielen wertvollen Bücher. Jetzt geh und verkauf sie auch. Schau halt, dass du möglichst viel dabei rausschlagen kannst.«
Das erste Antiquariat, das ich aufsuchte, war das Lieblingsgeschäft meines Vaters gewesen. Als ich dem Antiquar von den vollen Regalen erzählte, wedelte er abwehrend mit den Händen.
»Bitte keine Bücher!«, stieß er aus. »Verschonen Sie mich! Gerade stirbt eine ganze Lesergeneration weg. Ja, was glauben Sie, unser Lager ist sowieso schon randvoll. Wo soll ich das ganze Zeug denn hintun?«
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Aber darunter sind sicher wertvolle Erstausgaben …«
Er verdrehte die Augen. »Trotzdem. Was wir hier wirklich am allerwenigsten brauchen, das sind Bücher. Es tut mir wirklich leid.«
Drei weitere Antiquariate suchte ich auf, keine Chance.
Leicht verzweifelt, griff ich noch einmal zum Telefon, und bereits nach dem zweiten Anruf geschah ein Wunder. Es gelang mir tatsächlich, für den nächsten Tag einen interessierten Antiquar in die Theresienstraße zu locken, der sich das Ganze zumindest einmal ansehen wollte.
Mit Kennermiene durchpflügte er die Regale, fischte hier und da einen Band heraus und legte ihn in seinen mitgebrachten Plastikkorb. Nach zwanzig Minuten war er fertig, zeigte auf den noch nicht ganz vollen Korb und sagte: »Zweihundert für die da.«
»Zweihundert? Und was ist mit den vielen anderen?«
»Den Rest können Sie vergessen.«
»Wieso denn vergessen? Die wertvollen Bücher? Wollen Sie die alle nicht?«
Er schüttelte entschieden den Kopf. »Die will kein Mensch. Das kann alles weg.«
Tags darauf kam schon der bestellte Räumdienst, zwei tätowierte Männer mit beeindruckenden Oberarmen, der Chef parkte seinen blitzblanken, schwarzen Mercedes draußen vor der Einfahrt, der große Transporter passte gerade so in den engen Hinterhof.
»Die vielen wunderbaren Bücher«, sagte ich zum Chef. »Was machen wir jetzt damit?«
»Kein Thema. Die können wir brauchen, dafür hab ich Abnehmer.«
»Na Gott sei Dank!« Ich war erleichtert. »Und was können Sie uns dafür bezahlen?«
»Zahlen?« Er lachte laut auf. »Vergessen Sie’s! Seien Sie froh, wenn ich das alles kostenlos mitnehme und nicht noch extra was dafür verlange, bei so vielen Büchern.«
Die Räumung der Wohnung wollte ich mir nicht ansehen, und so machte ich ein paar Erledigungen und fuhr anschließend nach Hause.
Als ich später wieder zurückkam, war das Allermeiste bereits weggeräumt, die Möbel waren verschwunden, sogar ein paar Fußbodenbeläge waren herausgerissen worden, auch das Zimmer meines Vaters war fast leer, aber die Regale mit den Büchern standen noch da. An der Tür blieb ich stehen und sah dem Tätowierten dabei zu, wie er die Bücher in kleinen Stapeln aus dem Regal nahm und sie schwungvoll durch das offene Fenster in den Hof hinunterwarf. Ich ging zum Fenster und konnte sehen, dass da unten bereits ein großer Bücherhaufen lag, und der Kollege hatte alle Hände voll zu tun, sie aufzuheben und in den bereitgestellten Transporter zu schleudern.
*
Kurz nach der Beerdigung meines Vaters drückte mir meine Mutter eine Kassette in die Hand, die sie mit ihren Erinnerungen besprochen hatte. Sie war beschriftet mit: »Vater, wie er war.«
Auch hier nannte sie ihn nicht bei seinem Vornamen, nie hatte sie ihn Eduard genannt, immer nur Vater, der Vater, der Vati, oder Vaddi, dein Vater, euer Vater, unser Vater, Vater unser und in sehr seltenen Fällen liebevoll Vatterl.
Auf der Kassette ließ sie ihr Eheleben noch einmal Revue passieren, und ich dachte, das wäre bestimmt eine gute Methode für sie, Vaters Tod zu verarbeiten.
Ich hab etwas entdeckt beim Nachdenken, was vielleicht erzählenswert ist, aber leider, leider wieder nicht positiv. Wenn du es nicht hören willst, wirf das Band gleich weg …
Wir haben uns kurz nach dem Krieg kennenlernt, dein Vater und ich. Er war damals ein attraktiver Mann, so groß und schlank und gescheit, und auch bei den Frauen war er ja immer sehr beliebt. Damals war er ein Diözesan-Jugendführer, und ich hab bei der Post im Fernmeldeamt gearbeitet. Sechs Jahre lang sind wir »miteinander gegangen«, bevor wir endlich geheiratet haben.
Jahrelang sind wir schon zusammen gewesen, und er hat mich nicht mal geküsst. Nie angefasst hat er mich, außer einem Händedruck. Da war ich schon vierundzwanzig. Ich hab zu ihm gesagt: »Wollen wir uns nicht endlich mal verloben, es wird doch langsam Zeit, oder? Ich möchte doch auch mal heiraten, und so kann es nicht weitergehen.«
»Na gut, wenn du meinst, dann machen wir das, du hast sicher recht«, hat er gesagt.
Wir sind zu meinem Vater gegangen, und der hat seine Heiratsgenehmigung gleich gegeben. Danach sind wir zu den Eltern von Eduard, und dort war es schon schwieriger. Nur seine Mutter war da, und Eduard hat es nicht gewagt, mit ihr über die geplante Verlobung zu sprechen.
Ich hab mir ein Herz gefasst und gesagt: »Hat euch der Eduard schon erzählt, dass wir uns verloben wollen?« Einen bösen Blick hab ich geerntet.
»Der hätt aber auch eine andere gekriegt!«, war die Antwort.
»Ich auch!«, hab ich gesagt. »Ich kenn sehr nette Kollegen, die sich für mich interessieren.« Damals hat sich ja sogar ein recht bekannter Mann für mich interessiert, der war ein Sänger oder Schauspieler oder so was. Johannes Heesters hat er geheißen. Er hat ein paarmal mit mir telefoniert und hat mit mir ausgehen wollen, doch ich hab jedes Mal Nein gesagt, weil ich ja in deinen Vater so verliebt war, ich Depp … Immer hat sie bös geschaut, meine Schwiegermutter.
»Jedem Narren gefällt seine Kappe!«, hat sie gemeint.
Sie hat mich nicht gemocht, aber meine Mutter hat den Eduard auch nicht gemocht. Trotzdem haben wir uns dann verlobt, und im November haben wir geheiratet.
Bei der Hochzeitsreise sind wir mit dem Zug nach Österreich gefahren. Dort hat der Eduard Freunde gehabt, die er besuchen wollte, obwohl ich das natürlich nicht so gut gefunden hab. Meine Hochzeitsreise hab ich mir doch ein bisserl anders vorgestellt, aber so war das eben.
Schon in der ersten Nacht im Hotel hat es Ärger gegeben. Der Eduard war den ganzen Tag schon so merkwürdig reserviert gewesen, und am Abend hat er zu mir gesagt: »Morgen fahren wir wieder heim. Ich hab’s mir anders überlegt.«
»Wieso anders? Was ist denn los?«, hab ich gefragt und bin sehr erschrocken.
»So eine Ehe ist nichts für mich«, hat er gemeint. »Ich glaub, das Beste ist, wir lassen uns wieder scheiden. Ich kann das alles nicht.«
Jetzt weiß ich inzwischen, dass er recht gehabt hat damals. Dass er da ein Mal ehrlich gewesen ist und mir die Wahrheit gesagt hat.
Aber natürlich hab ich das nicht glauben und auch nicht hören wollen, das war doch ganz unmöglich, dass er so was sagt, kurz nach unserer Hochzeit. Ich hab ihn gar nicht mehr verstanden und die ganze Nacht geweint.
Irgendwie haben wir die Nacht dann überstanden. Wir haben uns wieder zusammengerauft und auch die letzten Flitterwochen-Tage hinter uns gebracht.
Für mich kam eine Scheidung überhaupt nicht infrage, denn so was war ja eine Schande. Geschiedene Leute waren gebrandmarkt im katholischen Regensburg. Und als eine Geschiedene wieder einen neuen Mann finden, das war überhaupt nicht leicht.
*
»Ich war so saublöd«, hörten wir unsere Mutter manchmal sagen. »Hätt mich längst nach einem anderen umschauen sollen. Hatte ja auch ein paar Möglichkeiten, aber wir waren so streng katholisch und dementsprechend erzogen, so war das halt damals. Die jungen Frauen heutzutage machen das ganz anders. Die lassen sich so was nie im Leben gefallen. So blöd sind die nicht.«
In den 50er-Jahren wohnten wir in Regensburg …
zu viert in einer kleinen Wohnung der Genossenschaftssiedlung »Margarethenau«. Meine Eltern, meine drei Jahre jüngere Schwester Beate und ich, später kam noch unser Rauhaardackel Nicki dazu. Den hatten wir bei einem Münchner Züchter erstanden und merkten gleich, dass er ein echter Spaßvogel war, denn kaum war er durch die Wohnungstür, sauste er zielstrebig unter den Schreibtisch meines Vaters, pinkelte, flitzte zurück in den Flur und zerfetzte einen Regenschirm. Seine Hobbys waren das Graben nach Mäusen und bayerische Blasmusik. Jedes Mal, wenn diese erklang, stand er freudig wedelnd neben dem Radio und jaulte aus voller Kehle herzzerreißend mit.
In unserer Genossenschaftssiedlung klingelten braun gebrannte Männer, mit schweren Perserteppichen über der Schulter, die aussahen, als kämen sie aus fernen Ländern, an den Haustüren. Auch Messer- und Scherenschleifer boten ihre Dienste an. Mein Großvater aber wollte ihnen keine Messer mehr anvertrauen, weil sie sie ihm einmal nicht mehr zurückgebracht hatten. Manchmal erschien ein dicker Mann mit einem Bauchladen in unserer Straße, der den Frauen Nähzeug und den Männern Zigaretten verkaufte. Ab und zu sahen wir auch kleinwüchsige Menschen, und wir Kinder konnten kaum glauben, dass es Erwachsene gab, die noch kleiner waren als wir.
Auch kriegsversehrte Geiger und Sänger musizierten manchmal in den Hinterhöfen, dann gingen die Fenster auf und die Leute warfen ihnen ein paar in Zeitungspapier gewickelte Zehnerl hinunter in den Hof. Der Kartoffelmann klingelte mit seiner lauten Glocke und schrie sein »Gadoffe! Gadoffe!«. Durch das Kellerfenster meiner Großeltern kippte ein Kohlenwagen Eierkohlen und Briketts, dass es nur so staubte. Und im Sommer, wenn es richtig heiß wurde, fuhr schon mal ein Spritzenwagen mit einem riesigen Wassertank durch die Straßen, um den Asphalt zu wässern und so für ein wenig Abkühlung zu sorgen.
An Fronleichnam weckte uns unsere Mutter schon früh am Morgen. Dann halfen wir beim Blumenteppich-Legen auf dem Lindenplatz. Viele Margarethenauer Frauen und Kinder legten in stundenlanger, mühevoller Kleinarbeit beeindruckende Muster aus Tausenden bunten Blüten auf den Asphalt.
Schön geschmückt mit kirchlichen Motiven waren die Straßen, wenn wir dann am Nachmittag auf die Fronleichnamsprozession warteten. Blumensträuße, Tücher und Fahnen sah man an den Fenstern, die Straßenschilder und -laternen waren mit grünen Zweigen dekoriert und wir dachten, dass der liebe Gott sicher seine Freude daran hatte.
Jeden Sonntagvormittag mussten wir in die Kirche zur Messe.
Dort roch es nach verbrauchter Luft und Weihrauch, der Pfarrer stand die meiste Zeit mit dem Rücken zu uns, redete unverständlich und auf Lateinisch. Die Gläubigen durften nur nüchtern zur heiligen Kommunion. Eifrige alte Frauen knieten ganz vorne, die Augen fest geschlossen, die Münder bereitwillig geöffnet, mit herausgestreckten Zungen erwarteten sie voll andächtiger Entzückung den Empfang der heiligen Hostie.
Wir Kinder langweilten uns in der Kirche und konnten es kaum erwarten, dass endlich das letzte Lied gesungen war, der Segen kam und das Amen. Zu Hause wartete ja meistens ein duftender Schweinsbraten im Ofen.
In regelmäßigen Abständen ertönten in der Margarethenau die Sirenen, um Alarm und Entwarnung zu proben. Die nächste Sirene stand gleich gegenüber auf dem Dach des Nachbarhauses und war so laut, dass wir uns die Ohren zuhalten mussten. An manchen Hausmauern sah man noch aufgemalte weiße Pfeile. »Die zeigen auf die Luftschutzkeller«, erklärte mir meine Mutter. »Dadurch hat man im Krieg nach einem Bombentreffer die Verschütteten leichter finden können.«
Auch sie und meine Großeltern hatten sich in einem Luftschutzkeller verstecken müssen, und wir Kinder fanden diese grauen, feuchten Unterschlupfe sehr gruselig.
In so einem Keller war gerade ein notdürftiger »Kindergarten« eingerichtet worden. Mein Vater fand das eine gute Sache, denn inzwischen war ich viereinhalb. Unter »Kindergarten« stellte ich mir einen schönen sonnigen Garten vor, in dem die Kinder im Gras spielten, Orangenlimo tranken und eine Menge Spaß hatten. Als mich meine Mutter an meinem ersten Tag eine steile Treppe in einen grauen, schaurigen Keller hinunterführte, erfasste mich schlagartig Panik.
»Wo ist denn der Garten?«, flüsterte ich beklommen.
»Ach, jetzt komm schon«, sagte meine Mutter, »wenn du dich erst mal daran gewöhnt hast, wird es dir bestimmt gefallen. So schlimm wird’s schon nicht werden.«
Der sogenannte Kindergarten war nichts weiter als ein schäbiger Kellerraum, in dem es leicht moderig roch. Ein paar Stühle und ein kleiner Tisch standen etwas verloren herum, in der Ecke war ein Dreirad geparkt, und drei kleine Kinder spielten mit einem Haufen bunt bemalter Holzklötze.
»Wir sind hier noch im Aufbau«, erklärte uns eine dicke, resolute Frau. Sie hieß Tante Fanni, trug eine Kittelschürze und roch nach Schweiß. Tante Fanni war hier die Aufpasserin.
Draußen schien die Sonne. Ich konnte es immer noch nicht fassen und klammerte mich verzweifelt an den Rockzipfel meiner Mutter, die meinen Kopf streichelte und sagte: »Der Vati will auch, dass du hierbleibst. Jetzt probier es doch einmal. Es wird bestimmt ganz schön hier bei der netten Tante Fanni.«
Auch die Tante Fanni lächelte mich gütig an, nahm mich mit festem Griff an der Hand und führte mich hinüber zu den Holzklötzen. »Du bist doch schon ein großer Bub. Jetzt bau mal was Schönes!«
Meine Mutter wechselte noch ein paar Worte mit ihr, ging noch einmal zu mir und streichelte mir über den Kopf. Dann war ich allein. Keine Ahnung, wie ich diesen Tag überlebt habe.
Als mich meine Mutter am Nachmittag wieder abholte, weinte ich. Und ich weinte auch am Abend noch einmal und erklärte immer wieder, dass ich nie mehr im Leben in diesen schrecklichen Kinderkeller hinuntergehen würde, lieber würde ich sterben.
»Warum stellt er sich so an?«, schimpfte mein Vater, der gern in der dritten Person über mich sprach. »Das ist ja wohl ein Witz! Andere gehen doch auch in einen Kindergarten. Nur unser Herr Sohn denkt, er braucht da eine Extrawurst.«
Weil ich aber immer weiter weinte, durfte ich am nächsten Tag zu Hause bleiben. Meine Mutter hatte Mitleid mit mir und konnte der Tante Fanni ja schlecht ein dauernd weinendes Kind zumuten.
Nie mehr musste ich in diesen Kindergarten, aber immer mal wieder konnte ich jetzt meinen Vater sagen hören: »Pass nur auf! Wenn du nicht spurst, schick ich dich wieder zur Tante Fanni.«
*
In dieser Zeit war ich ein unruhiges Kind, konnte abends oft schlecht einschlafen. Mein Vater schickte meine Mutter mit mir zur Kinderärztin, die mir ein neues Mittel verschrieb, es hieß Contergan.
»Das wird dir helfen«, meinte meine Mutter und flößte mir nun jeden Abend vor dem Zubettgehen einen Suppenlöffel voll zähflüssigem Contergan ein. Das chemische Zeug war schön rosafarben, roch und schmeckte unangenehm süßlich, funktionierte aber prima. Kaum hatte ich den Sirup hinuntergewürgt, wurde ich auch schon müde, und mit dem Einschlafen gab es keine Probleme mehr.
Auch mein Vater war erfreut über die schnelle und zuverlässige Wirkung dieser neuen Wundermedizin. Endlich hatte er am Abend seine Ruhe.