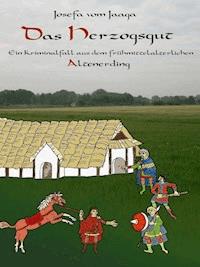Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ende des 18. Jahrhunderts: Während in Frankreich die Revolution wütet, heiratet in Baden Prinzessin Karoline den 20 Jahre älteren Witwer Maximilian Joseph von Zweibrücken, der bald schon Kurfürst von Bayern werden soll. Ihre Bemühungen um ein harmonisches Familienleben werden nicht gerade vereinfacht, als ein gewisser Napoleon Bonaparte sich zum Kaiser der Franzosen krönt und beginnt, sich für eine von Karolines Stieftöchtern zu interessieren. Eine Geschichte über Bayern, Bonaparte, Beauharnais und was sonst noch notwendig ist, damit die Prinzessin zum Prinzen kommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitelübersicht
Liberté, Égalité, Maternité
Der gute Onkel Max
Schoß der Familie
Tante Leopoldine
Endlich Kurfürstin
Zwei Damen Bonaparte
Mord, Eifersucht und Kronen
Gustav und Friederike
Montgelas' erster Kunde
Vive l'empéreur!
Ein unmöglicher Bräutigam
Wenn einer eine Reise tut
Ein Reich für einen Vizekönig
Herzensangelegenheiten
Ein Kurprinz in Mailand
Max Joseph besteht auf Neutralität
La Grande Armée en marche
Zwischenbetrachtung
Personenübersicht
Übersetzungen
Zeittafel
Statt eines Prologs
Die Tür schloss sich mit einem Geräusch, als schnappe eine Falle zu, und Prinz und Prinzessin waren allein im Salon.
Beide hatten sich natürlich erhoben, als alle übrigen den Raum verließen. Die Prinzessin blickte starr zu Boden.
Der Prinz trat an eines der Fenster und blickte hinaus.
»Das ist ein sehr hübscher Garten«, sagte er in die Stille. Die Prinzessin folgte ihm mit Bewegungen, als gehörten ihre Beine nicht zu ihr.
»Der Hofgarten. Jetzt sieht er nach nicht viel aus. Im Sommer ist er wirklich schön.«
»Meine Mutter liebt Parks und Gärten«, sagte er. Und dann, ohne Warnung: »Das muss alles schrecklich für Sie sein.«
Das Mitgefühl in seiner Stimme zersplitterte ihren letzten Versuch, Haltung zu bewahren. Sie brach in Tränen aus.
1. Liberté, Égalité, Maternité
Markgräfin Amalie verheiratet ihre Töchter
Zu gewissen Zeiten, so wird uns erzählt, habe eine neue Spitze an einem Kleid, eine neue Feder an einem Hut, eine achtlos fallengelassene Bemerkung beim Tee oder ein abgelehnter Tanz auf einem Ball mehr Aufmerksamkeit erregt als das Vorrücken von Armeen. Weit davon entfernt, die Erkenntnisse weiserer Schreiber in Abrede zu stellen, können wir doch nicht umhin, festzuhalten, was der tätige Gebrauch des Verstandes dem Leser bereits eingegeben haben wird: dass solches in erster Linie galt für Gegenden, in die gerade keine feindlichen Armeen vorrückten.
Wahr ist: In friedlichen und weniger friedlichen Regionen verlangte die Eitelkeit in jenen Tagen nach goldenen Knöpfen und blitzenden Tressen – an militärischen Uniformen, der Kleidung des Tötens, vielleicht mehr als anderswo. Die kleinen und großen Fürsten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation hatten in den letzten Jahrhunderten viel Übung darin entwickelt, den Klang von Kanonen und den Geruch von Schießpulver von der unmittelbaren Umgebung ihrer überschuldeten Höfe fernzuhalten. Ihre Damen konnten das Augenmerk daher tatsächlich ganz auf jene schmucken Offiziere und unterhaltsamen Skandale richten, hinter denen die Bedeutung der Schlachtfelder so sehr in den Hintergrund trat.
Man hatte sich in diesen Verhältnissen eingerichtet und verstand gut damit zu leben: Während die Fürsten, schwitzend unter ihren gepuderten Perücken, mit den Ministern über Landkarten brüteten, die zu veraltet waren, als dass man auf ihrer Basis einen wirklichen Feldzug hätte planen können, und die Offiziere sich damit beschäftigten, jene Bauernburschen, die man in eine Uniform gepresst hatte, am Desertieren zu hindern, schrieben die Damen Briefe, planten Empfänge und Verwandtenbesuche und bemühten sich, ihre Töchter möglichst zügig unter die Haube zu bringen.
Die Große Landgräfin von Hessen-Darmstadt, Karoline von Pfalz-Zweibrücken, hatte nicht weniger als fünf Töchter zu verheiraten. Sitte und Familientradition hatten die Namen, die bei der Taufe einer Prinzessin zur Auswahl standen, in beklagenswerter Weise eingeschränkt: Karoline, Friederike, Amalie, Wilhelmine, Luise. Die stolze Mutter schöpfte dieses Kontingent in besagter Reihenfolge aus; dazu gesellten sich drei Söhne. Dass sich keine weiteren Töchter einstellten, machte den Gebrauch der noch zur Verfügung stehenden Namen »Marie«, »Charlotte« und »Auguste« unnötig und sparte sie für kommende Generationen auf.
Man muss gestehen, nicht alle Töchter der Landgräfin verheirateten sich gleichermaßen gut; die älteste hatte sich mit dem Spross einer Nebenlinie des hessischen Hauses zu bescheiden, während ihrer viel beneideten Schwester Friederike die Ehre zuteilwurde, vom Neffen und Erben des Preußenkönigs Friedrich vor den Altar geführt und in ihrer Ehe mit zahllosen Geliebten und Mätressen betrogen zu werden. Für die kleine Luise fiel immerhin der Großherzog von Sachsen-Weimar ab. Doch die beste Partie machte unzweifelhaft Wilhelmine, die zweitjüngste Tochter: Katharina die Große gestattete ihr die Ehe mit ihrem Sohn, dem Zarewitsch Paul, was Wilhelmine einen neuen Namen (Natalja) und drei Jahre später den frühen Tod im Wochenbett eintrug.
Demgegenüber fiel die Hochzeit der mittleren Tochter Amalie bescheiden aus. Ihre Mutter hatte diese junge Dame sicherheitshalber mitgenommen nach Sankt Petersburg, obwohl wenig Hoffnung bestand, Amalie könne am russischen Hof Gnade finden. Selbst die wohlwollendsten Freunde mussten zugeben, die äußerlichen Reize dieser jungen Dame stünden ein wenig hinter denen ihrer Schwestern zurück: das dunkle Haar zu strohig, die Lippen zu schmal, die Züge zu kantig. Doch mit gewissen Eigenheiten ihres Charakters, namentlich Zielstrebigkeit und Willensstärke, glich Amalie aus, was die Natur versäumt hatte, ihr an Vorzügen mitzugeben.
»Meine Tochter Amalie mag nicht den besten Kopf haben«, seufzte die Mutter gelegentlich, wenn sie die Berichte der Gouvernanten über die Fortschritte ihrer Kinder entgegennahm, »doch zweifellos den härtesten.«
In der Familie wusste man gut, was es bedeutete, wenn Amalies kantiges Kinn sich ruckartig anhob, woraufhin Amalie mit bebenden Nasenflügeln hörbar einatmete und dazu die Schultern straffte. Wer konnte, suchte in solchen Momenten gern das Weite, ehe das Gewitter losbrach.
Wider Erwarten war es gerade dieser Wesenszug, der Amalie in Sankt Petersburg beinahe zu einem grandiosen Erfolg verholfen hätte. Der junge Zarewitsch Paul, an dominierende Frauen in seinem Leben gewöhnt, schien von ihr ausgesprochen beeindruckt. Eine Weile sah alles danach aus, als ziehe er Amalie gegenüber ihrer Schwester als künftige Braut vor. Leider wurde der junge Mann nicht wirklich nach seinen Wünschen befragt. Zarin Katharina, weise Herrscherin der Reussen, die sie war, entschied sich für die sanfte Wilhelmine; ihrer Ansicht nach genügte es, wenn eine Frau in Sankt Petersburg den Männern die Richtung wies.
Statt in der prunkvollen Residenz zu Sankt Petersburg tanzten Amalies Hochzeitsgäste letztlich im sehr viel engeren Saal des Schlosses von Karlsruhe. Die Familie der Zähringer, in die Amalie einheiratete, mochte nicht so mächtig sein wie die Romanows, doch sie gehörte zu den ältesten Fürstenhäusern Europas. Ihre Anfänge verloren sich im Halbdunkel des elften Jahrhunderts, als die deutschen Kaiser noch Otto oder Heinrich geheißen hatten und nicht wie in neuerer Zeit Joseph, Franz oder Leopold. Die Zähringer regierten die Markgrafschaft Baden seit Menschengedenken und hatten als Nachweis ihrer makellosen adligen Abstammung in den letzten Generationen jeweils mindestens ein Familienmitglied vorzuweisen gehabt, dessen Absonderlichkeit weit genug ging, um es hinter Schloss und Riegel zu halten.
Wie Amalie nach ihrem Einzug erfreut feststellte, waren die Männer der Familie willig, ihren Ehefrauen das Regiment weitgehend zu überlassen – und wo sie nicht willig waren, brachte Amalie es ihnen bei. Erbprinz Karl Ludwig von Baden, zur Unterscheidung von seinem Vater Karl Friedrich meist »Charles« gerufen, lernte bereits im Verlauf der ersten Wochen seiner Ehe, dass er von nun an ganz ebenso die Meinung seiner Ehefrau einzuholen habe, ehe er eine Entscheidung träfe, wie er es bis dahin mit der seiner Mutter getan hatte. Seine Ergebenheit war zweifellos, was Amalie an ihrem Gemahl am besten gefiel.
Amalies Einfluss musste naturgemäß erst den Widerstand der bisherigen Ratgeberin überwinden, die sich auf ihre doppelte Funktion als Markgräfin und Schwiegermutter berief, um ihre älteren Rechte geltend zu machen. Beide markgräflichen Ehemänner, Vater und Sohn, flüchteten sich angesichts des Drachenkampfes in den Salons des Karlsruher Schlosses in ihre Ratssitzungen und taten so, als überhörten sie, was an Gekeife und Gezänk aus dem oberen Stockwerk herunter drang.
Die Zeit und der Tod der alten Markgräfin lösten das Problem im Sinn Amalies, die nun ihre Stellung als erste Dame am Hof von Karlsruhe sicherstellte – ein Rang, der kümmerlich genug war als Trostpreis für eine Dame, die beinahe vom Zaren Paul zur Gattin erwählt worden wäre. Amalie sorgte dafür, dass ihr Schwiegervater, der alte Markgraf Karl Friedrich, sich zur linken Hand mit einer nicht ebenbürtigen Frau vermählte, die Amalie ihre Position nicht streitig machen konnte und über deren Mängel und Unverschämtheiten sie sich künftig bei allen Gelegenheiten verbreitete, und stürzte sich auf alle Anlässe, die ihr gestatteten, das Fischbein-Korsett so eng wie möglich zu schnüren, sich in die Staatsrobe zu zwängen, das markgräfliche Haupt mit hoch aufgetürmten Perücken, Juwelen und Federn zu schmücken und am Eingang ihres Salons die Honneurs zu machen.
Nebenher widmete sie sich der Aufgabe, ihrem Gemahl Charles einen Sohn und Erben zu schenken, der der Erfolg aber lange Zeit versagt blieb. Über die Jahre wuchs die Zahl der Töchter, die in Amalies Gemächern den Nacken über Stickrahmen und Aquarellbilder beugten, auf sechs an, auch sie versehen mit den von der Schicklichkeit vorgeschriebenen Vornamen: Amalie (die hässlichste), Karoline (die eifrigste), Luise (die hübscheste), Friederike (mit dem größten Standesbewusstsein), Marie (die freundlichste) und die kleine Wilhelmine, die nach dem lang ersehnten Erben auf die Welt gekommen war und mit der noch niemand so recht etwas anzufangen wusste. Dass der kleine badische Prinz, der nach fünf Töchtern endlich das Licht der Welt erblickt hatte, wiederum, wie Vater und Großvater, Karl hieß, verstand sich von selbst. Er war ein ruhiges, selbstgenügsames Kind, das die Mutter leichten Herzens seinen Kinderfrauen und Erziehern überlassen konnte, während sie selbst die Angelegenheiten ihrer Töchter wahrnahm.
Dazu gehörte selbstverständlich die Verpflichtung, sich zeitig nach Gatten für ihre Mädchen umzusehen, sobald diese die ersten Kinderjahre hinter sich hatten. Doch gerade, als Amalie begonnen hatte, den Adelskalender und die ausgedehnte Verwandtschaft nach unverheirateten Herren zu durchforsten, stürmte in Paris der Pöbel Bastille und Tuilerien. Die königliche Familie von Frankreich wurde gefangengesetzt, und Franzosen mit blau-weiß-roten Kokarden am Kragen und Bajonetten in den Händen marschierten plötzlich in die linksrheinischen Besitzungen deutscher Fürsten ein. Die Zahl zur Verfügung stehender Heiratskandidaten verringerte sich im selben Maße, wie die Schar der Enthaupteten, Enteigneten und Vertriebenen anstieg.
»Es ist ein Unglück, in diesen Tagen eine Tochter verheiraten zu müssen«, beklagte Amalie sich bei ihrem Ehemann Charles, zu dessen täglichen Pflichten es gehörte, ihr während der gemeinsamen Teestunde aus der Zeitung die Namen jener Adeligen vorzulesen, die sich vor dem mörderischen Straßenpöbel über den Rhein herüber gerettet hatten, deren Eigentum von den Aufrührern konfisziert worden war und die folglich als Heiratskandidaten ausschieden. Amalie verfolgte diese Vorgänge sehr aufmerksam und hielt ihre Ansprache mit einer gewissen Regelmäßigkeit.
Charles, auf einem Hocker zur Rechten von Amalies Armstuhl platziert, die ›Carlsruher Zeitung‹ auf den Knien, war sich bewusst, dass er mit seinem Jawort in der Hofkapelle auch seine lebenslange Bereitwilligkeit erklärt hatte, den Klagen seiner Gemahlin zu lauschen. Er bemühte sich demütig, dieser ehelichen Pflicht nachzukommen, auch wenn es häufig nicht zur völligen Zufriedenheit Amalies geschah. Insgeheim empfand er stets eine gewisse Erleichterung, sobald die Aufmerksamkeit seiner Gattin sich anderen Dingen zuwendete und ihm Gelegenheit gab, die Berichte von den Kriegshandlungen an der Front zu studieren, die Amalie nicht weiter interessierten. Heute war es noch nicht so weit.
»Es ist eine außerordentliche Rücksichtslosigkeit von Ihnen, Charles, meine Bemühungen so wenig zu unterstützen.«
»Ich bitte Sie, meine Liebe. Wer kann dieser Tage überhaupt noch daran denken, eine Familie zu gründen?«
»Sie haben sechs Töchter in die Welt gesetzt, lieber Charles. Man kann Ihnen nur raten, möglichst bald darüber nachzudenken. Andere Väter sind möglicherweise weniger nachlässig dabei, für die Zukunft ihrer Kinder vorzusorgen. Aber ich sehe schon, ich werde mich dieser Frage wohl selbst annehmen müssen. Sie zeigen wie üblich wenig Engagement.«
»Ganz im Gegenteil! Das Wohl meiner Töchter liegt mir sehr am Herzen! Aber Madame, wir haben einen Krieg zu führen, ach, was heißt einen - Dutzende! Die französischen Horden sind überall! Man weiß, wie schlimm es stehen muss, wenn sogar Preußen und Österreich ihre Fehde deswegen begraben. Die ganze Welt steht in Flammen; selbst biedere Handwerksmeister stecken sich die Kokarde an den Hut. Mainz hat den Franzosen die Tore geöffnet, und die Häupter der Hydra wachsen schneller nach, als man sie abschlagen kann. Die Revolution scheint ebenso viele Generäle auszuspucken, wie sie Köpfe rollen macht: Dumouriez, Cartaux, Houchard, Desaix, Doppet, Lafayette, Beauharnais, du Bayet, Kléber, Hoche, Kellermann, de Custine, Schauenburg, man fragt sich ja wirklich, wer sich das noch alles merken soll!«
Während die französische Revolution sich anschickte, den Despotismus deutscher Aristokraten unter der verwirrenden Vielfalt bürgerlicher Befehlshaber zu ersticken, sah Amalie sich gezwungen, ihre Eheplanungen gelegentlich vom Reisewagen aus zu führen. Amalies Schwiegervater, Markgraf Karl Friedrich, schickte die zweitausend Soldaten, die sein Land unter Waffen halten konnte, an die Front und die Familie auf ausgedehnte Reisen nach Norden und Osten, zu Verwandten, deren Ländereien in angenehmer Distanz zu den blutgetränkten Schlachtfeldern am Rhein lagen.
Man traf dort manchen Verwandten wieder, den ähnliche Umstände in die Ferne getrieben hatten. Dazu gehörte eine arme Darmstädter Kusine namens Auguste. Diese Auguste hatte nicht nur das Unglück, eine jüngste Tochter, sondern obendrein noch kränklich und schwerhörig zu sein. Wie unter solchen Voraussetzungen nicht anders zu erwarten, bestanden für sie geringe Aussichten, sich gut zu verheiraten. Auguste hatte mit einem Cousin Amalies mütterlicherseits vorlieb nehmen müssen, dem Pfalzgrafen Maximilian Joseph, einem mittel- und bedeutungslosen jüngeren Bruder des Herzogs von Pfalz-Zweibrücken. Max Joseph – oder »Prince Max«, wie man ihn in Straßburg gerufen hatte - war der zweite Sohn eines zweiten Sohns aus einer Nebenlinie des Hauses Wittelsbach – aus uralter fürstlicher Familie also, definitiv ebenbürtig, aber ohne Land und Vermögen und somit eine ausgesprochen schlechte Partie. Eine Anstellung im Dienst des französischen Königs Ludwigs XVI. als Kommandeur eines Straßburger Regiments sowie eine Grafschaft namens Rappoltsweiler, bestehend aus ein paar Dörfern und Mühlen, das war alles, was Augustes Gatte an Versorgung vorzuweisen hatte. Selbst das hatte die französische Revolution jetzt davon gefegt.
»Lieber Charles«, fragte Amalie ihren Gemahl während einer der nächsten Teestunden, »sollten wir nicht etwas für unsere armen Verwandten tun?«
Erbprinz Charles blickte erstaunt von den Militärzeitungen auf, zu denen er in Gegenwart seiner Gemahlin nach wie vor gern Zuflucht nahm. »Das sollten wir allerdings«, nickte er bereitwillig. Er schätzte den gutmütigen, immer etwas nervösen und durchweg biederen Pfalzgrafen Maximilian Joseph und die sanfte Auguste sehr und konnte kaum glauben, dass seine Gattin ihm freiwillig derart reizende Gesellschaft zugestehen würde. »Es wäre zweifellos eine großzügige Geste von Ihnen, die Ärmsten hierher einzuladen. Sie haben Schreckliches durchgemacht – bei bitterer Kälte am Weihnachtsabend unter den Kugeln der Franzosen fliehen zu müssen! Unfassbar! Ihre Kinder sind noch so klein, gerade für sie wäre es nötig, sich einmal ordentlich zu erholen.«
»Dann ist es abgemacht. Ich hoffe allerdings, Sie lassen sich vom Pfalzgrafen nicht wieder zu solch lächerlichen Amüsements verleiten wie beim letzten Mal; Inkognito-Besuche bürgerlicher Vergnügungsstätten schicken sich ab einem gewissen Alter nicht mehr. Mir ist nicht unbekannt, in welchem Ruf Max Joseph in seiner Jugend stand, dem eines Verführers und Verschwenders nämlich, und es würde mir leid tun, ähnliche Tendenzen an Ihnen zu entdecken.«
Ihr Ehemann, in der sicheren Annahme, ihm selbst würde eine solche Entdeckung noch viel mehr leid tun, versprach es. Die Einladung wurde ausgesprochen und dankbar angenommen, und man empfing die Gäste mit jener herablassenden Güte, wie sie gegenüber armen Verwandten angebracht war. Amalie fand Auguste und ihre Kinder dünner und ausgezehrter denn je, den Sohn verwirrt, die Töchter ängstlich und verschreckt. Den Kindern tat das Zusammensein mit ihren Verwandten gut; Max Josephs Sohn Ludwig und Amalies Sohn Karl standen fast genau im gleichen Alter, und die Mädchen spielten gern mit Amalies jüngster Tochter Wilhelmine. Lediglich für die Mutter ließ sich wenig tun. Egal, wie sehr Amalie sich bemühte, die Verwandten herauszufüttern, Auguste blieb mager und schwächlich, und ihr Gesicht hatte eine ähnliche Tönung wie ihre gepuderte Frisur.
Lediglich Maximilian Joseph, hochgewachsen, breitschultrig, gleichermaßen nervös wie optimistisch veranlagt, schien die Entbehrungen einigermaßen gut verkraftet zu haben. So war Amalies Cousin schon als Kind gewesen. Jeder zufällig vorbeiflatternde Schmetterling ließ ihn seine Pein vergessen, und so genügten auch jetzt ein paar Tage scheinbarer Ruhe, ein Jagdausflug mit Charles oder eine abendliche Partie Vingt-et-un in Amalies Salon, um ihn wieder fröhlicher in die Zukunft blicken zu lassen.
Bei einem solchen Kartenspiel war es auch, als Max Joseph von seinen Plänen berichtete. »Toutefois, man muss zugeben«, sagte er in seinem gemächlichen Pfälzer Dialekt, den er mit zahllosen französischen Einsprengseln würzte, »derzeit gehen unsere Aussichten, jemals nach Straßburg zurückzukehren, gegen Null. Aber vielleicht löst sich alles noch in Wohlgefallen, und Auguste und ich werden dennoch ein schönes Revenu haben, das uns nicht weniger lieb sein soll als unser Rappoltsweiler und mit dem wir unsere Kinder großziehen können.«
»Mein lieber Freund, das freut mich zu hören«, sagte Charles, der bemerkt hatte, wie seine Gemahlin aufhorchte. Auf Amalies Wink hin erkundigte er sich, ob sich für Maximilian Joseph denn ein konkreter Ausweg aus seiner derzeit so traurigen Lage aufgetan habe.
»Ja, sehen Sie, lieber Freund, das ist so: Wie Sie ja wissen, ist das Haus Zweibrücken eine Nebenlinie der Familie Wittelsbach. Der in Bayern sitzende Hauptzweig dieses Geschlechts ist in der vorigen Generation ausgestorben, weswegen mein Onkel Karl Theodor, der Kurfürst der Pfalz, auch den bayerischen Kurfürstenhut erbte und nun statt in Mannheim in München regiert. Seit sein einziger legitimer Sohn verstorben ist, hat mein Onkel keinen direkten Erben mehr. Die Würde des Kurfürsten würde also, so wenig dem jetzigen Inhaber das recht ist, an unsere Seite der Familie fallen.«
»An Ihren älteren Bruder, den jetzigen Herzog der Pfalz, nicht wahr?«, fiel Amalie rasch ein. Max Joseph nickte freundlich; an seinen Ohren tanzten die kleinen goldenen Ringe, die zu tragen er sich in seiner Straßburger Zeit angewöhnt hatte – eine überaus kuriose Marotte nach Amalies Ansicht, der obendrein etwas Frivoles anhaftete.
»An meinen Bruder Karl August, évidemment. Der in diesem Fall als Kurfürst nach München gehen und Auguste und mir Mannheim und die Pfalz überlassen würde – oder das, was unsere französischen Patrioten davon übrig gelassen haben«, ergänzte er seufzend. »Zwar wäre mir lieber, die Leute kämen allmählich zur Vernunft und alles könnte wieder werden wie vor der Revolution, aber auf solches Glück können wir wohl kaum mehr hoffen.«
Amalie lehnte sich zurück in die mit cremefarbenem Damast bezogenen Polster ihres Sessels, ehe sie ihre eigenen Karten wieder aufnahm, und dachte stumm nach über jenen älteren Bruder, von dem Max Joseph gesprochen hatte. Der Herr war ihr nicht unbekannt; von ihren beiden Cousins war Karl August stets derjenige gewesen, den Amalie weniger schätzte: ein wohlbeleibter Bonvivant, der seine Gemahlin wie Luft behandelte und seine Zeit mit Mätressen, Jagden und Schlossbauten verbrachte, die ihn in horrende Schulden gestürzt hatten. Ein derartiges Symbol aristokratischer Überheblichkeit war er, dass die Franzosen ihn in Mannheim explizit hatten fangen wollen, um ihn ihrer heimlichen Gottheit, der Guillotine, zu opfern. Karl August war seinen Häschern gerade noch rechtzeitig entwischt, und sein Bruder Maximilian Joseph, der ihn, soweit Amalie wusste, beerbt hätte, schien brav und bieder genug, das nicht einmal im hintersten Winkel seiner Seele zu bedauern.
Max Joseph war ein seltsamer Mensch.
»Wenn ich mich recht entsinne, hat Ihr Bruder Karl August keine Kinder, lieber Max?«
»Sein armer Sohn ist gestorben«, bestätigte Max Joseph betrübt. »Aber er und ma chère belle-soeur, die Herzogin, sind ja noch nicht zu alt, um weitere Kinder zu bekommen.«
Dazu, dachte Amalie, müsste dem Herzog der Wunsch nach einem Erben wichtiger sein als seine Sehnsucht nach Bequemlichkeit und Genuss, die sich offenbar überall besser stillen ließ als an der Seite seiner Gattin. Sie dachte an das verfettete, vom Wein gerötete Gesicht des Herzogs, an das schwabbelnde Doppelkinn, das jeden Kragen sprengte, an die berüchtigten Bankette und Gelage. Und sie betrachtete die arme Auguste, fröstelnd vor dem prasselnden Feuer im Kamin, dünn, wie sie seit ihrer Kindheit gewesen war, hustend, bleich, mager. Sie zog ihre Schlüsse.
»Vielleicht wird doch noch alles gut für Sie, mein Freund«, sagte Charles inzwischen. »Ich habe gehört, in Paris schießen die Franzosen inzwischen mit Kanonen auf ihre eigenen Leute. Wenn die Österreicher in Italien diesem General Bonaparte einmal ordentlich heimleuchten …« Er verstummte hastig, als ein flammender Blick aus den Augen seiner Gemahlin ihn belehrte, wie wenig sich solche blutrünstigen Themen in Gegenwart von Damen gehörten.
Während besagter General Bonaparte die Strategie für seine künftigen Feldzüge entwarf, tat Amalie, kaum waren die Verwandten abgereist, in ihrer Familie dasselbe. Sie meisterte ihre Aufgabe mit nicht geringerer Bravour als der schmale, langhaarige Korse, dessen stechender Blick bald ganz Europa in Furcht setzen sollte. Bonaparte beschoss Toulon; Amalie bombardierte die alte Zarin Katharina mit brieflichen Lobeshymnen über die Anmut, blonden Locken und außerordentlichen Talente ihrer Tochter Luise, so lange, bis Katharina zu einer Reise des Mädchens nach Sankt Petersburg ihre Zustimmung gab. Der ausersehene Bräutigam war der älteste Sohn des Zarewitschs, ein bildhübscher, äußerst kurzsichtiger, schwärmerischer Fünfzehnjähriger namens Alexander, der, wie Luise sich beklagte, in Gegenwart seiner Großmutter kaum den Mund aufzutun wagte. Sobald er sich mit seiner Verlobten unbeobachtet wähnte, verlor Alexander seine Scheu freilich in einem Ausmaß, das noch Jahrzehnte später während des Wiener Kongresses die Geschichtsschreiber in Erstaunen setzen sollte. Man einigte sich darauf, die Eheschließung noch im selben Jahr stattfinden zu lassen.
Die Hochzeit Luises in Sankt Petersburg war ein erster Triumph für Amalie und rächte endlich ihre eigene, vor Jahren an diesem Ort erlittene Niederlage. Während Bonaparte in Italien die Österreicher vor sich her trieb, vermählte Amalie ihre nächste Tochter, Friederike, mit dem König von Schweden. Gustav IV. war bereits mit dreizehn Jahren an die Macht gekommen, als man seinem Vater auf einem Maskenball in den Rücken schoss. Inzwischen war er siebzehn, zuckte bei allen plötzlichen Geräuschen zusammen und kommandierte seine Umgebung mit der ängstlichen Aggressivität derer, die sich von Mördern und Verschwörern umstellt wissen. Das Brautzimmer der kleinen Frique vor ihrer Hochzeitsnacht war der am gründlichsten durchsuchte und am besten bewachte Raum in ganz Stockholm.
Eine Tochter Amalies also Königin von Schweden, eine andere würde bald (unter ihrem neuen Namen Jelisaweta) Zarin von Russland sein. Amalie, zu Recht mit sich zufrieden, spann nun Pläne für die bereits siebzehnjährige Karoline, deren Verheiratung Amalie vorerst zurückgestellt hatte, da ihre äußerlichen Reize nicht ganz mit denen ihrer Schwester Luise mithalten konnten. Karoline war ebenso dunkelhaarig wie ihre Mutter und hatte auch etwas von Amalies kantigen Gesichtszügen geerbt; im Ganzen war sie zweifellos schön zu nennen, aber auf eine weniger liebliche, herbere Art. Dennoch, ihre Abstammung aus der Familie der Zähringer und ihre geradezu königliche Würde sollten ausreichen, auch dieser Tochter Amalies einen Platz unter den ersten Fürstinnen Europas zu sichern.
Leider war die Zahl regierender Monarchen in Europa dank der Siege der Franzosen inzwischen tatsächlich sehr begrenzt, und die Konkurrenz schlief nicht. Eines der wenigen verbliebenen Filetstücke, um das Amalie sich für Karoline bemühte, war Friedrich Wilhelm, der Kronprinz von Preußen. Amalie war sich in diesem Fall eines Erfolgs sehr sicher, musste sie doch nur ihre verwandtschaftlichen Beziehungen spielen lassen: die Mutter des Kronprinzen war immerhin Amalies Schwester, eine natürliche Verbündete. Wider Erwarten erlitt Amalie in dieser Schlacht ihre erste Niederlage. Die zahlreichen Briefe, die sie über Wochen an ihre Schwester schrieb, entpuppten sich als völlig wirkungslos. Seit sie Königin von Preußen war, war Amalies Schwester nicht nur immer dicker und verzagter, sondern auch zunehmend wunderlich geworden, und ihre spiritistischen Sitzungen mit Geistersehern und Wahrsagern beschäftigten sie weit mehr als die Familienpolitik Amalies. So schnappte ausgerechnet die Darmstädter Verwandtschaft Amalies Karoline diesen vielversprechenden Fang vor der Nase weg: Friedrich Wilhelm ehelichte die kleine Strelitzer Halbwaise Luise, die bei Amalies Tante, der Prinzessin Georg, aufgewachsen war.
Karoline rümpfte leicht die Nase, als Amalie ihr den Fehlschlag gestehen musste, aber das blieb das einzige Anzeichen ihrer Enttäuschung. In jenem höflich-kühlen Ton, den Amalie an dieser Tochter am meisten bewunderte, erklärte sie, sie wünsche dem Paar Gottes Segen. »Zweifellos ist es besser für mich, zurückzustehen, als einen Fürsten zu ehelichen, der seine Neigung anderweitig verschenkt hat.«
Auch Amalie plante nicht, über verschüttete Milch zu klagen – so wenig sie vorhatte, dem preußischen Hof diese Abfuhr je zu verzeihen. Allerdings war das Kontingent an heiratsfähigen königlichen Prinzen nunmehr erschöpft. Betrübt sah Amalie ein, sie werde für ihre übrigen Töchter wohl mit minderen Fürsten vorlieb nehmen müssen.
Oder doch nicht?
»Darf ich Sie bitten, meine Liebe, für den kommenden Donnerstag eine größere Gesellschaft vorzubereiten?«, fragte Markgraf Karl Friedrich von Baden seine Schwiegertochter beim gemeinsamen mittäglichen Déjeuner.
Überrascht blickte Amalie auf. Ihr gegenüber, vor den Fenstern des Speisesaals, streckten die Bäume des Schlossgartens erste knospende Zweige der Frühlingssonne entgegen. Amalies verbliebene Töchter saßen, streng dem Alter nach geordnet, vor ihren Tellern, eine Wand aus raschelndem Stoff in diversen Pastelltönen, und ihr kleiner Sohn Karl lümmelte sich neben seinem Erzieher am Ende des Tischs. Amalies Schwager Ludwig, der jüngere Bruder ihres Mannes, glänzte wie üblich durch Abwesenheit. Charles jedoch hatte sich, ungewöhnlich genug, pünktlich zum Essen eingefunden. Er lächelte bei der Einleitung seines Vaters in sich hinein, merklich zufrieden, ausnahmsweise besser informiert zu sein als seine Gattin.
»Mein lieber Markgraf«, erkundigte Amalie sich, »sind wir denn schon wieder gezwungen, Gäste zu empfangen? Welch' bittere Notwendigkeit, beinahe ein Skandal in diesen traurigen Zeiten! - Hatten Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Eine Soirée vielleicht, mit Gesang und Musik?«
»In der Tat, das erschiene mir passend, vielleicht auch etwas Tanz dazu.« Nun war Amalie vollends verblüfft. Die Staatskasse von Baden war chronisch leer, und Markgraf Karl Friedrich verschrien als notorischer Geizhals. Amalie hatte manchen Strauß mit ihrem Schwiegervater ausgefochten, in dem es um ihre Garderobe und die sonstigen Ausgaben gegangen war, zu denen die erste Dame des Hofs sich wegen ihrer repräsentativen Pflichten gezwungen sah. Dass der Markgraf nicht nur die Erlaubnis zu einer abendlichen Gesangs-, sondern sogar zu einer Tanzveranstaltung geben wollte, war unerhört. Bei einer normalen Soirée genügte es, eine der Gouvernanten ans Fortepiano zu setzen und Amalies Töchter ein paar Lieder dazu trällern zu lassen; ein Tanzabend selbst im kleinsten Kreis dagegen erforderte unweigerlich die Dienste professioneller Musiker, die für ihr Engagement Bezahlung erwarteten. Der Markgraf mochte die Verwunderung seiner Schwiegertochter bemerkt haben, denn er legte den Löffel zur Seite, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und fuhr von sich aus fort:
»Sie haben vollkommen recht, liebe Tochter, was den Charakter der Zeit angeht, in der wir leben. Desto notwendiger erscheint es mir, jenen Unglücklichen, die noch mehr zu leiden hatten als wir, die Hand zu reichen und ihnen ein wenig Ablenkung von ihrer Not zu ermöglichen. Eines Tages, so bleibt nur zu hoffen, werden sie wieder einziehen in ihre angestammten Rechte und sich dann an ihre Freunde in der Not erinnern.« Er schaute fragend in die Runde, und alles nickte pflichtschuldig und verständnislos.
»Darf ich mich erkundigen«, warf Amalie ein, »wem genau Sie diese Hand zu reichen gedenken, verehrter Schwiegervater?«
»Ich schmeichle mir, meine Liebe, dass Sie die Wahl unserer Gäste gutheißen werden.« Ganz sicher freilich war Markgraf Karl Friedrich nicht. Er fand Amalies Reaktionen schwer einzuschätzen. In seinem Ton schwang ein Hauch Ängstlichkeit mit. »Es handelt sich um den Bischof von Straßburg, Kardinal de Rohan, und seinen Verwandten, den Herzog von Enghien.«
»Der Herzog von Enghien!«, rief Amalie erschrocken. Sie saß stocksteif. »Aber mein teurer Markgraf, davon unterrichten Sie mich erst jetzt? Ein junger Fürst des Hauses Condé, ein aus Frankreich vertriebener Bourbone, ein wirklicher Prinz von Geblüt! Diese Ehre, diese Aufregung, diese Arbeit! Man wird einen Ball geben müssen!«
»Einen Ball?«, wiederholte Karl Friedrich. Im Geiste sah er sich bereits mit einer mehrseitigen Gästeliste konfrontiert und überschlug entsetzt die Ausgaben für Diner und Beleuchtung. Ruinieren wollen hatte er sich eines aus Frankreich verjagten Bourbonen wegen eigentlich nicht. Er warf einen hilfesuchenden Blick auf seinen Sohn, aber Charles hielt seine gesamte Aufmerksamkeit wohlweislich auf das Stück Lammkeule gerichtet, das er auf seinem Teller zerlegte. »Denken Sie nicht, Teuerste, dass ein solcher Aufwand ein wenig …«
»Übertrieben? Nein, lieber Schwiegervater, durchaus nicht!«, erklärte Amalie, und sie meinte es auch so. Mochte der Kardinal Rohan in der Halsbandaffäre keine rühmliche Rolle gespielt haben, mochten die heutigen Condés nur noch über eine natürliche Tochter Ludwigs XIV. mit dem Königshaus verwandt sein, so handelte es sich doch um Persönlichkeiten allerhöchsten Rangs! Mehr noch, der Herzog von Enghien war, nach allem, was Amalie wusste, ein vornehmer und noch recht junger Mann – und ausgesprochen unverheiratet! Wie konnte ihrem Schwiegervater die Bedeutung dieser Angelegenheit entgangen sein! »Bedenken Sie, Durchlaucht, der Herzog von Enghien ist Prinz von Frankreich, mit unanfechtbarem Platz in der Thronfolge! Was soll er von uns denken, wenn wir ihn nicht angemessen empfangen? Sollen wir uns etwa dem Verdacht der Hochnäsigkeit aussetzen, oder gar dem heimlicher Sympathie für jene Schurken, die den armen Ludwig XVI. auf der Guillotine ermordeten?«
Notgedrungen musste der Markgraf gestehen, dies sei natürlich nicht seine Absicht. Amalie nickte befriedigt. »Da sehen Sie es. Sie wissen, wie leicht man selbst durch bloße Gedankenlosigkeit in Misskredit kommen kann. Für ein Mitglied der unglücklichen Königsfamilie von Frankreich darf uns nichts zu schade sein! - Wie lange werden die erlauchten Herrschaften denn in der Gegend bleiben?« Sie musterte der Reihe nach ihre Töchter, die die Blicke sittsam und wissend auf ihre Teller gesenkt hielten.
»Wir werden gewiss noch öfter die Ehre haben, sie zu empfangen«, sagte Karl Friedrich, vielleicht in der Hoffnung, das Unausweichliche aufschieben zu können. »Es scheint, als wolle der Herzog von Enghien sich in Ettenheim, also nur zwei Tagesreisen von uns entfernt, niederlassen, solange man ihn nicht zum Heer beruft.«
Die Aussicht auf solch illustre Gäste rief im Schloss zu Karlsruhe eine Aufregung hervor, die zum Namen der Residenzstadt in größtem Gegensatz stand und den Markgrafen samt seinem Schatzmeister in mittlere Verzweiflung stürzte. Man öffnete wieder einmal den großen Marmorsaal, der für Amalies Geschmack viel zu selten benutzt wurde, Dienstboten hasteten treppauf und treppab, Gärtner plünderten ihre Gewächshäuser für den markgräflichen Tischschmuck, Wagenladungen von frischem Kies füllten die Schlaglöcher, die Herbst- und Winterregen in der Einfahrt hinterlassen hatten, und das gesamte Schloss wurde gewienert und geputzt, als gelte es dem Ausbruch einer ansteckenden Krankheit vorzubeugen.
Denn natürlich hatte Markgraf Karl Friedrich am Ende den Wünschen seiner Schwiegertochter nachgeben müssen. Was in Baden Rang und Namen hatte, kündigte sich an, um dem jungen Bourbonen-Prinzen die Ehre zu erweisen. In den Spiegeln an den Wänden rundum malten sich am Abend des Balls aufgeregte Gesichter zwischen flackernden Kerzenflämmchen und vergoldeten Putten. Amalies Töchter, an solche exquisiten Vergnügungen wenig gewöhnt, hatten die vergangenen Nächte kaum geschlafen. Besonders Karoline hatte auch ohne ein Wort ihrer Mutter verstanden, welche Aussichten sich hier für sie eröffnen konnten. Sie benötigte den gesamten Tag und die Hilfe dreier Kammerjungfern, um sich für den Abend anzukleiden.
Die Erwarteten trafen mit exakt jener Verspätung ein, wie sie dem Spross eines königlichen Hauses angemessen war. Als die Kutsche des Kardinals Rohan endlich im Hof vorfuhr und die Erwarteten angekündigt wurden, lief ein allgemeines Raunen durch den Saal, und bei ihrem Eintritt in den Saal öffnete man respektvoll eine Gasse, durch die Markgraf Karl Friedrich den beiden Herren entgegen eilte.
Amalie konnte mit dem Eindruck, den dieser Auftritt auf ihre Gäste machte, sehr zufrieden sein.
Der Herzog von Enghien war, wie sich herausstellte, noch keine fünfundzwanzig, ein junger Herr von vornehmer Herablassung und angenehmen Umgangsformen, dem der Aufenthalt bei der Armee gut bekommen zu sein schien; seine Figur war deutlich schlanker als die der meisten seiner Altersgenossen, und die Orden auf seiner Brust standen ihm ausgesprochen gut. Er hatte die feinen, ein wenig zu ernsten Züge seiner Mutter geerbt und das leicht schwermütige Wesen seines Vaters, vor allem aber brachte er jene gefällige Leichtigkeit der Konversation mit, wie man sie nur am Hof von Versailles wahrhaft erlernen konnte. In den Augen der anwesenden Damen vereinte der Herzog auf sich alle Vorzüge, die ein Herr von Stand aufweisen konnte: Jugend, Schönheit, Tragik, den Ruhm eines tapferen Kriegshelden und die Bereitschaft, mit allen jungen Damen zu tanzen, sofern man dafür eine Gelegenheit und im überfüllten Marmorsaal genug Raum improvisieren konnte.
Der Markgraf selbst machte den Herzog von Enghien mit seinen Enkelinnen bekannt, und Karoline, die als erste aufgerufen wurde, achtete sehr darauf, ihren Knicks ein wenig anmutiger und tiefer ausfallen zu lassen als den ihrer Schwestern. Sie sollte es nicht bereuen; der Herzog erkannte seine gesellschaftliche Pflicht sofort und erbat sich unverzüglich von der entzückenden jungen Dame die Erlaubnis, den Ball mit ihr eröffnen zu dürfen.
Karoline meinte zu schweben, als der Herzog, mit einer Eleganz, die ihr von den einheimischen Herren völlig unbekannt war, ihre Fingerspitzen ergriff und sie ans Kopfende der Tanzfläche führte, wo sie sich an die Spitze der aufgereihten Paare setzten. Sie war sich der neidvollen Blicke bewusst, die ihr von sämtlichen Damen im Saal zuflogen, und meinte vor Glück zu zerspringen.
Sie, Karoline von Baden, eröffnete den Tanz mit dem ranghöchsten, dem vornehmsten und vor allen Dingen dem schönsten Prinzen im Saal! Aus dem großen Deckengemälde über ihren Köpfen lächelte Venus auf die Tanzenden herab.
Hatte man je einen Mann sich so anmutig bewegen sehen? Gab es irgendwo auf der Welt einen zweiten Herrn mit so feinen Zügen, so perfekt gewölbten dunklen Brauen, einem so zierlichen Mund und einer Nase, die sich ähnlich vornehm wölbte und in die Länge zog? Konnte einem Mann die gepuderte Lockenperücke besser zu Gesicht stehen als dem Herzog von Enghien?
Während er eine vor Aufregung und Stolz beinahe ohnmächtige Karoline durch den Tanz geleitete, plauderte der französische Prinz erstaunlich freundlich und herablassend. Man musste ihn dafür bewundern; in diesen dunklen Zeiten war es wahrlich nicht leicht, noch ein Gesprächsthema zu finden, das anzuschneiden sich in Gegenwart einer Dame schickte. Der Herzog von Enghien sprach übers Eislaufen, und als die Musiker nach dem letzten Takt ihre Instrumente absetzten und Karoline sich mit einer ehrerbietigen Verbeugung wieder an Amalies Seite abgeliefert fand, da hatte Karoline sich bereits unsterblich in den jungen Condé-Prinzen verliebt.
Und war es denn verwunderlich? Das traurige Schicksal seines Vetters Ludwigs XVI. und seine eigene Vertreibung aus dem Vaterland verliehen dem Herzog eine melancholische Aura, deren Romantik sich selbst ältere und weisere Damen als Amalies Töchter nicht entziehen konnten. Amalie, wenig romantisch veranlagt, hätte es gern gesehen, hätten sich zu all diesen Verdiensten eine der Geburt entsprechende Stellung und ein ordentliches Vermögen gesellt, aber das mochte ja noch kommen. Irgendwann musste der Wahnsinn von Paris, mussten das Wüten der Guillotine und die Herrschaft des Straßenpöbels ja einmal ein Ende haben, und dann würden die Grafen von Provence und Artois und all die übrigen Bourbons und Orléans und Condés, die nun im Exil lebten, zweifellos wieder in ihre alten Rechte eingesetzt werden.
»Mama«, wagte Karoline sich einige Tage später zu erkundigen, während sie den dunkellockigen Nacken über ihre Näharbeit beugte, »fandest du auch, dass der Herzog von Enghien mich auf dem letzten Ball auffällig bevorzugt hat? Die Gräfin Hochberg war dieser Ansicht, und es täte mir leid, durch mein Verhalten unwissentlich Anlass zu Gerüchten gegeben zu haben.«
»Also, ich fand das gar nicht«, beeilte Marie sich einzuwerfen, ehe ihre Mutter den Mund hätte öffnen können. »Er hat mit dir nur ein Mal öfter getanzt als mit mir, obwohl du viel älter bist als ich, und gewiss wäre ich erneut seine nächste Wahl gewesen, hätte man ihn nicht von der Tanzfläche fort gezogen in ein dummes Gespräch über Politik. Die Gräfin Hochberg klatscht zu viel und malt sich die unmöglichsten Dinge aus.«
»Unmöglich?« Karoline zog ihr Näschen kraus. »Ich wüsste nicht, inwiefern es bei einem jungen Mann unmöglich sein sollte, sich eine – natürlich völlig unschuldige - Neigung des Herzens zu gestatten? Oder hältst du es nur für unmöglich in Bezug auf mich?«
»Alles, was ich zu bedenken geben möchte, liebste Schwester, ist, dass der Herzog von Enghien auch mit Améli getanzt hat.« Niemand musste erklären, was das bedeutete. Karolines Zwillingsschwester war von der Natur so vernachlässigt wie ihr jüngerer Zwilling begünstigt, als hätte sich im Mutterleib alle Schönheit auf die eine und alle Hässlichkeit auf die andere Seite geschlagen. Angesichts von Amélis wie verschobenem Gesicht, den zwinkernden Schlitzaugen mit den aufgequollenen Unterlidern, dem fast unmittelbar unter der Nase sitzenden, verkniffenen Mund und den abstehenden Ohren hatte die Mutter schon früh jeden Gedanken daran aufgegeben, diese Tochter überhaupt verheiraten zu können.
»Und weshalb hat er das wohl getan?«, schoss Karoline zurück. »Doch nur deswegen, um mir eine Gefälligkeit zu erweisen! Alle Welt weiß, wie nahe meine Zwillingsschwester mir steht. Dass der Herzog von Enghien sie nur aus Höflichkeit zum Tanz gebeten hat, steht außer Zweifel, doch ebenso zweifellos handelte es sich um eine Höflichkeit mir gegenüber. Amélis Tänze müssen eigentlich so gelten, als hätte der Prinz mich aufgefordert.«
Karolines Zwillingsschwester Améli rang sich, gebeugt über ihre Lektüre, ein schwächliches Lächeln ab.
Kurz und gut, die Besuche des jungen Condé-Prinzen in Karlsruhe trugen Amalie viel Unruhe ins Haus, kosteten den Markgrafen ein Vermögen und brachten seine Enkelinnen um ihre schwesterliche Eintracht. Umso bedauerlicher, dass sich aus all der Mühe für die Hausherrin keinerlei Erfolg ergeben sollte.
Der Herzog von Enghien residierte in Ettenheim in unmittelbarer Nachbarschaft jenes Verwandten, in dessen Gesellschaft er das Schloss von Karlsruhe zum ersten Mal aufgesucht hatte, des Kardinals de Rohan. Dieser Herr, der bis zur Revolution Fürstbischof von Straßburg gewesen war, ohne sein Bistum allerdings öfter aufzusuchen als unbedingt notwendig, der einst als Gesandter in Wien wegen seines lebensfrohen Gebarens das Missfallen der sittenstrengen Maria Theresia erregt und sich vor einigen Jahren den gewaltigen Lapsus erlaubt hatte, eine Prostituierte mit der französischen Königin zu verwechseln, dieser rundliche, rotwangige Herr also stand inzwischen in seinen späten Sechzigern. Er begleitete den Herzog von Enghien nur selten bei dessen Abstechern nach Karlsruhe, hielt jedoch für Gerüchte jedweder Natur die Ohren offen. So hatte Amalie die überraschende Ehre, den Kardinal, zwei Tage nach einem Ball, an dem die Gäste zu Amalies Zufriedenheit eifrig über eine baldige Verlobung zwischen Karoline und dem Herzog von Enghien geklatscht hatten, bei sich zu empfangen.
Der Kardinal war die Höflichkeit selbst, aber auf eine äußerst kühle, herablassende Art. Nach den einleitenden Floskeln schlug der Kardinal einen Spaziergang durch die Gärten vor, und Amalie, die Übles befürchtete, hatte kaum eine Wahl, als zuzustimmen.
»Es war mir ein tiefes Bedürfnis, Sie aufzusuchen, Durchlaucht«, erklärte der Kardinal gravitätisch, während die Gärtner, die in der Anlage gearbeitet hatten, hastig ihre Schubkarren voll vertrockneten Laubs außer Sicht schafften. »Ich möchte mich persönlich bei Ihnen für das Wohlwollen bedanken, mit dem Sie uns, mich und meinen jungen Verwandten, den Herzog von Enghien, in Baden willkommen geheißen haben.«
Das sei doch eine Selbstverständlichkeit, erwiderte Amalie ebenso würdevoll. »Wer wäre nicht geschmeichelt, sich in der Gegenwart Eurer Eminenz zu wissen? Ebenso wie der Herzog von Enghien hier stets ein Zuhause finden wird, so er es wünscht. Wenn die düsteren Zeiten, in denen wir leben, überhaupt ein Gutes haben, dann, dass wir Unwürdigen die Ehre haben, die Bekanntschaft solch erlauchter Herren zu genießen.«
Der Kardinal wies diese Artigkeiten voll Demut zurück, pries stattdessen sich selbst glücklich, in seiner Not solch angenehmes Asyl gefunden zu haben, und das Gespräch glitt für eine Weile zurück in den Austausch gegenseitiger Lobeshymnen, ehe der Kardinal endlich die Bombe platzen ließ, die er mitgebracht hatte.
»Es erfüllt mich mit großer Freude, hierzulande willkommen zu sein. Noch mehr tut es das in Bezug auf meinen Verwandten. Der Herzog von Enghien ist jung; er sollte mehr vom Leben haben, als unter den düsteren Geschehnissen der Politik zu leiden. Zwar genießt er in Ettenheim die Gesellschaft meiner Nichte, der er seit Jahren leidenschaftlich zugetan ist, doch welchen jungen Mann verlangt es nicht nach Abwechslung? Ich bin sicher, er schätzt die gelegentlichen Besuche bei Ihnen sehr.«
Nur gut, dass der Tonfall des Kardinals Amalie bereits auf Unangenehmes vorbereitet hatte, andernfalls wäre es ihr schwer gefallen, das obligatorische Lächeln beizubehalten. Die Nichte des Kardinals! Und Amalies Töchter nur ›Abwechslung‹! Nach allem, was Amalie wusste, näherte die Dame, die da offenbar ihre Klauen nach dem jungen Condé-Prinzen ausstreckte, sich bereits ihrem dreißigsten Lebensjahr! So etwas konnte ein Mann Amalies Karoline vorziehen? Man hätte wirklich annehmen sollen, ein Herzog von Enghien habe besseren Geschmack!
Amalie erklärte, es erfülle sie mit großem Bedauern, der Nichte des Kardinals, von der sie schon so viel Gutes gehört habe, noch nie begegnet zu sein, und der Kardinal de Rohan versprach, sie bei nächster Gelegenheit vorzustellen, in einem Tonfall, dem klar zu entnehmen war, er werde eine solche Gelegenheit sicherlich nie herbeiführen. Nachdem man noch eine weitere Runde zwischen den letzten blühenden Rosensträuchern gedreht hatte, geleitete Amalie ihren Gast zurück ins Schloss, wo der Kardinal, sichtbar zufrieden damit, die Verhältnisse klargestellt und die Angelegenheit im Sinne seiner Nichte geregelt zu haben, sich mit besten Wünschen und einer untertänigen Verbeugung empfahl.
Amalie blieb es überlassen, ihren Töchtern, insbesondere Karoline, die unangenehme Neuigkeit beizubringen, der Herzog von Enghien habe sein Herz bereits anderweitig verschenkt.
Sie hatte nicht mit einer so heftigen Reaktion gerechnet. Karoline, die gegenüber der Absage des preußischen Kronprinzen so kühl und überlegen geblieben war, diese Karoline zeigte sich nun in heller Aufregung, ja, sie verlor jede Zurückhaltung und weinte bittere Tränen. Amalie begriff es nicht. Das Mädchen war inzwischen ein Jahr älter und erfahrener, sollte es die böse Kunde nicht entsprechend noch etwas ruhiger und abgeklärter aufnehmen?
Das Gegenteil war der Fall. Karoline hatte sich verliebt, und Amalies Worte bescherten ihr zum ersten Mal in ihrem Leben ein gebrochenes Herz.
Lange Zeit konnte und wollte sie sich nicht über den schönen Condé-Prinzen hinweg trösten. Sie zeichnete sein Porträt von vorn, im Profil, im Halbprofil und hätte wohl auch noch seinen Hinterkopf abgebildet, hätte Amalie ihr nicht dringend ein anderes Sujet empfohlen. Zum Ausgleich schrieb sie seitenlange, tränenreiche Gedichte in ihr Tagebuch und beantwortete die Sticheleien ihrer Schwestern mit indigniertem Schmollen.
2. Der gute Onkel Max
Auch wenn aus der verlockenden Verbindung mit einem leibhaftigen Bourbonen-Prinzen nichts wurde: Amalie hatte ihr Gespür für den Lauf der Ereignisse nicht verloren. Anderweitig bewahrheiteten sich ihre Ahnungen nur zu sehr.
Ein Brief aus dem kurpfälzischen Mannheim traf ein, wohin sich Amalies Cousin Maximilian Joseph derzeit mit seiner kleinen Familie geflüchtet hatte. Er enthielt traurige Nachrichten: Nach der Geburt ihres letzten Kinds, eines Sohns, ging es Max Josephs Frau immer schlechter. Der Husten der leidenden Kusine Auguste hatte endgültig die Lunge erfasst; die Ärmste spuckte Blut und ließ bald darauf ihren Gemahl als trauernden Witwer mit einer vierköpfigen Kinderschar zurück.
»Ein schreckliches Los für meinen Cousin«, sagte Amalie und legte das jüngste Schreiben, das dem Anlass entsprechend mit schwarzem Lack versiegelt gewesen war, gedankenverloren zur Seite.
Charles, dem sie Max Josephs Brief soeben vorgelesen hatte, saß erschüttert vor den schweren Falten der geöffneten Vorhänge. »Als liege ein Fluch auf Maximilian Joseph, nicht wahr? Wie lebensfroh war er früher, bis hin zur Unvernunft! Jetzt hat erst die Revolution ihn heimatlos gemacht, nun nimmt das Schicksal ihm noch die Gefährtin.« Er schüttelte den Kopf. »Der arme Max war seiner Auguste aufrichtig zugetan, auf seine Art. Wer hätte gedacht, dass ein ewiger Junggeselle wie er, der seinerzeit so ungern heiratete, nun solche Trauer empfinden würde über den Tod seiner Gattin? Er scheint mir zu Tode betrübt.«
»Zweifellos hat dieser Schlag ihn tief getroffen«, sagte Amalie nachdenklich. Ihr Blick ging an ihrem Gemahl vorbei durchs Fenster hinunter in die Gärten. Es war Anfang April, Narzissen und Krokusse standen in voller Blüte. »Und doch wird ein Mann wie er kaum lange ohne Ehefrau sein wollen«, gab sie zu bedenken. »Sie kennen unseren wackeren Max lange genug, lieber Charles, um es beurteilen zu können. Seinem ganzen Wesen nach ist er halber Franzose, nichts als Galanterie, Komplimente und Schöntun vor den Damen.« Amalie übertrieb nicht. Verliebt zu sein gehörte zu Max Josephs Wesen wie seine Gutmütigkeit, sein umgängliches Wesen und seine Nervosität. Sooft er ein hübsches Gesicht sah, war es um ihn geschehen. Der Versailler Hof, an dem Amalies Cousin gern gesehener Gast gewesen war, hatte davon angeblich so manche Geschichte zu erzählen.
»Zudem sind seine Kinder zu jung, um ohne Mutter aufzuwachsen«, fuhr sie fort. »Max Josephs ältester Sohn ist elf, wenn ich mich nicht sehr täusche, aber der jüngste gerade erst ein Jahr alt! Nein, mein Lieber, ich versichere Ihnen, mein Cousin wird sich wieder verheiraten, sobald die Trauerzeit vorüber ist.«
Nach über zwanzig Jahren Ehe fiel es Charles nicht schwer, zu erraten, in welche Richtung Amalies Gedanken schweiften. Er sah sie an, und es dauerte eine Weile, ehe ihm einfiel, den Mund wieder zu schließen. »Aber Teuerste! Sie werden doch nicht eine unserer Töchter dafür vorschlagen wollen? Bedenken Sie, der gute Maximilian, so freundlich er ist und so sehr ich ihn schätze, steht bereits in seinem vierzigsten Lebensjahr!«
»Ja, es ist in der Tat bedauerlich, dass die leichtsinnige Lebensweise seiner Jugend ihn so lange am Heiraten hinderte.« Amalie schürzte missbilligend die Lippen. »So steht er nun da als Mann in mittleren Jahren mit unmündigen Kindern. Desto mehr Grund für ihn, den Kleinen eine neue Mutter zu geben, schon für den Fall, dass ihn selbst der Tod ereilt.«
Amalie lehnte sich zurück, griff noch einmal nach dem Brief und überflog die Zeilen in Max Josephs Handschrift, um ihrem Gemahl Gelegenheit zu geben, sich mit dem neuen Gedanken vertraut zu machen. Charles hatte die Pause wahrhaft nötig.
»Aber bedenken Sie doch!«, rief er aus. »Welche traurigen Aussichten hätte diese zweite Ehefrau! Meine liebe Amalie, Ihr Cousin Max Joseph ist quasi mittellos; alles, was er besitzt, ist die vage Aussicht, einmal seinen Bruder als Herzog in Mannheim zu beerben!«
»Eine recht sichere Hoffnung, will mir scheinen.«
»Durchaus nicht!«, widersprach Charles. »Damit Max Joseph sich in Mannheim niederlassen kann, müsste Karl Theodor, der alte Kurfürst von Bayern, Maximilians Bruder zu seinem Erben einsetzen und nach München holen. Aber zwischen München und Mannheim herrscht Streit. Karl Theodor verabscheut seine Zweibrückener Neffen, seit diese ihn durch ihren Einspruch in seinen Plänen behindert haben. Erinnern Sie sich nicht? Kurfürst Karl Theodor plante, das alte Wittelsbacher Stammland Bayern an das Haus Habsburg abzutreten und gegen viel lukrativere Gebiete in den Niederlanden einzutauschen.«
»Ich bitte Sie, Charles! Natürlich erinnere ich mich, auch daran, wie sehr Maximilian Joseph und sein Bruder sich gegen die Idee gesträubt haben. Das musste damals zu bösem Blut zwischen München und Mannheim führen. Inzwischen sollte Kurfürst Karl Theodor meinen Cousins dankbar sein! Hätten sie ihn nicht an dem Tausch gehindert, besäße er heute keine Handbreit Land mehr – in den Niederlanden haben sich die französischen Aufrührer breitgemacht.«
»Ich bezweifle, dass Kurfürst Karl Theodor das ebenso sieht wie Sie.« Amalie wedelte den Einwand mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite.
»Mag er denken, was er will. Es ändert nichts daran, dass der bayerische Kurfürst keine anderen Erben hat als seine Zweibrückener Neffen. Einer von meinen Cousins wird bei Karls Theodors Tod den Kurfürstenhut erben müssen.«
»Das ist durchaus nicht sicher!« Charles fing an, zu begreifen, wie ernst es Amalie mit ihrem Ansinnen war, und sein Tonfall wurde flehentlich. »Kurfürst Karl Theodor ist ein treuer Gefolgsmann Österreichs, seine Neffen sind das gerade Gegenteil. Er wird alles tun, um zu verhindern, dass einer der beiden ihn beerbt!«
Das musste Amalie zugeben. Vor allem Maximilian Joseph, der zwanzig Jahre lang als Regimentskommandeur in französischen Diensten gestanden hatte, der am liebsten französisch sprach und ganz und gar französisch fühlte und dachte, war in dieser Hinsicht unverbesserlich. Statt Hass auf jene Aufrührer zu empfinden, die seinen Gönner Ludwig XVI. ermordet hatten, seufzte Max Joseph nur den glücklichen Tagen hinterher, die er im Frankreich seiner Jugend verbracht hatte, und hoffte, sie irgendwie aus dem blutigen Taumel des heutigen Frankreich auferstehen zu sehen. Kein Wunder, dass Kurfürst Karl Theodor diesem Neffen skeptisch gegenüberstand. Dem wankelmütigen Max Joseph war zuzutrauen, er werde sich sogar mit dem Revolutionspöbel aussöhnen, wenn dieser ihm nur lange genug von Paris erzählte.
Charles, durch Amalies nachdenkliches Schweigen ermuntert, fuhr fort: »Österreich verfolgt natürlich seine eigenen Ziele; es hat seine Hoffnungen auf Bayern nicht begraben. Der Kaiser hat Kurfürst Karl Theodor nicht umsonst eine junge Erzherzogin zur Frau gegeben. Wenn seine neue Kurfürstin Karl Theodor einen Erben zur Welt bringt, zerfallen alle Hoffnungen unseres Freundes Max zu Staub! Dann wird Max' Bruder nicht bayerischer Kurfürst und er selbst bleibt nur ein Pfalzgraf ohne alle Einkünfte, dessen Länder der Feind besetzt hält. Womit sollte er eine unserer Töchter da ernähren?« Er war aufgesprungen und fing an, im Zimmer auf und ab zu laufen, stolperte dabei einmal sogar fast über den weiß lackierten Schemel, auf dem Amalie abends ihre schmerzenden Füße auszuruhen pflegte. Der Erbprinz von Baden war sonst nicht dafür bekannt, sich sonderlich für Politik zu interessieren, in diesem Fall aber hatte Charles sich in eine regelrechte Aufregung hinein gesteigert. Das Schicksal seines Freundes, des Pfalzgrafen Max Joseph, mochte ihm näher gehen, als er zugab. Vor allem aber wollte er seine Töchter, an deren Erziehung er wenig genug hatte mitwirken dürfen, vor einer zweifelhaften Zukunft bewahren. Charles wusste gut, wie dringend Amalie ihre Tochter Karoline zu verheiraten wünschte, die sich, nach der unergiebigen Angelegenheit mit dem Herzog von Enghien, inzwischen bereits ihrem neunzehnten Lebensjahr näherte und Gefahr lief, als alte Jungfer zu enden.
Aber war es nicht besser, ledig zu bleiben, als Gattin eines Mannes ohne Vermögen oder Land zu sein, womöglich bis ans Ende ihres Lebens angewiesen auf die Wohltätigkeit glücklicherer Verwandter? Selbst die Mesalliance mit einem Adligen niederen Rangs wäre einem solchen Los doch sicher vorzuziehen!
Amalie schwieg, tat weiter so, als studiere sie das Schreiben ihres Cousins, und wartete, bis Charles sich ein wenig beruhigt hatte. »Wie üblich, mein Lieber«, sagte sie nach einer Weile würdevoll, ohne den Blick von den Seiten zu heben, die sie in der Hand hielt, »sind Sie mangelhaft informiert.«
»Wie meinen Sie?« Charles war sich gedankenverloren durchs schüttere Haar gefahren; er zückte sein Taschentuch, um sich den weißen Puder von den Händen zu wischen.
»Der bayerische Kurfürst wird keinen Sohn haben.« Amalie sagte es mit einer Überzeugung, als habe sie Brief und Siegel darauf. Sie war sich ihrer Sache tatsächlich sicher. Die armen Männer in ihren Regierungskabinetten waren angewiesen auf die offiziellen Berichte und Aussagen der österreichischen Botschafter. Weder Markgraf Karl Friedrich noch sein Sohn Charles besaßen zudem besonderes Geschick, zwischen den Zeilen zu lesen oder Andeutungen zu interpretieren. Glücklicherweise verfügte Amalie auf ihren eigenen Empfängen, bei denen sie Gattinnen und Töchter derselben Gesandten zu Tee und Gebäck einlud, über eine weit ergiebigere Quelle: das unerschöpfliche Reservoir internationalen Hoftratschs.
»Ja, mangelhaft informiert, man kann es nicht anders sagen. Unter der Hand ist bereits zu hören, man sei in Wien sehr unzufrieden mit der jungen bayerischen Kurfürstin Maria Leopoldine.« Amalie lächelte in Charles' verständnisloses Gesicht. »Ich bitte Sie, mein Lieber, ist das so schwer zu verstehen? Kurfürstin Maria Leopoldine ist neunzehn. Kurfürst Karl Theodor, ihr Gatte, einundsiebzig. Selbst falls Kurfürst Karl Theodor noch in der Lage sein sollte, einen Sohn zu zeugen, so ist doch sehr die Frage, ob seine junge Gattin daran ein großes Interesse hat.«
Charles ließ sich auf seinen Sessel fallen und schnappte nach Luft. »Aber … sie hat ihn doch geehelicht! Und der deutsche Kaiser wünscht es! Sie wollen doch nicht etwa sagen, die neue bayerische Kurfürstin würde sich … ihren ehelichen Pflichten entziehen?«
»Es sieht ganz danach aus«, sagte Amalie leichthin. »Die junge Dame ist zwar Habsburgerin, aber gebürtig aus Mailand und scheint ein entsprechend italienisches Temperament mitzubringen. Man hört, sie halte ihren Ehemann für einen senilen, nach Urin stinkenden alten Wüstling.« Charles wurde abwechselnd rot und blass, was Amalie ein Lächeln abnötigte. »Der Kaiser, so habe ich erfahren, hat Maria Leopoldine bereits mehrmals an ihre vordringlichste Aufgabe erinnern lassen, die darin besteht, Kurfürst Karl Theodor ein Kind zu gebären. Doch die Kurfürstin scheint so gekränkt darüber, dass man sie in diese Ehe gezwungen hat, dass sie dem Willen ihres Kaisers und Familienoberhaupts aus purem Trotz die Stirn bietet.«
»Sie meinen also wirklich …«
»Ja, mein Lieber. Die bayerische Kurfürstin Maria Leopoldine verschließt Kurfürst Karl Theodor ihre Schlafzimmertür. Allerdings auch nur dem.« Amalie widmete sich wieder Max Josephs Brief, um Charles Gelegenheit zu geben, diesen neuesten Schlag zu verdauen.
»Nur … dem?«
»Maria Leopoldine scheint sehr … lebensfroh zu sein«, erläuterte Amalie. »Und sie unternimmt keinen Versuch, ihre Affären geheimzuhalten. Im Gegenteil, sie poussiert mit ihren Liebhabern beinahe vor den Augen der Öffentlichkeit. Sollte sie also tatsächlich ein Kind zur Welt bringen, wäre es von vornherein dem Verdacht ausgesetzt, ein Bastard zu sein.«
»Ein schreckliches Benehmen!«, stöhnte Charles fassungslos. »Der Skandal! Und was würde aus ihr und ihrem Kind, falls Karl Theodor sie tatsächlich des Ehebruchs bezichtigt!«
»Bislang scheint Maria Leopoldine klug genug gewesen zu sein, eine Schwangerschaft zu vermeiden. Aber ja, von dieser Seite droht meinem Cousin Maximilian Joseph sicher die größte Gefahr. Wer auch immer der wirkliche Vater wäre: Kurfürst Karl Theodor würde jeden Sohn, den Maria Leopoldine zur Welt bringt, als seinen ausgeben – nur, damit seine Zweibrückener Neffen nichts erben. Selbst wenn er die schwarze Haut eines Mohren oder die Augen eines Mongolen hätte!« Amalie legte den Brief endgültig zur Seite und winkte ihren Ehemann näher heran. Charles beugte sich zu ihr hinüber, und sie flüsterte: »Zumal mein armer Cousin offenbar selbst wenig für seine Sache tut. Im Gegenteil. Aus München war zu hören, Maximilian Joseph selbst sei während eines Besuchs der lebensfrohen jungen Dame in die Hände gefallen.«
»Max Joseph?«, wiederholte Charles verwirrt. »Und die neue Kurfürstin Maria Leopoldine? Aber … ich weiß natürlich, wie gern der gute Max sich von einer schönen Frau in Versuchung … doch wäre das nicht völlig gegen seine eigenen Interessen?«
»Natürlich wäre es das«, lächelte Amalie geringschätzig. »Max Joseph könnte keine größere Dummheit begehen, als seinem Onkel Karl Theodor jenen Erben zu verschaffen, den dieser so dringend braucht. Der Kurfürstin einen Keuschheitsgürtel anzulegen, das hätte sein Bestreben sein müssen! Was habe ich gesagt? Mein Cousin denkt und handelt zu französisch; er kann eine schöne Frau eben nicht ohne Beachtung lassen. Aber womöglich wird seine Dummheit sich sogar zu seinen Gunsten auswirken.«
»Inwiefern?« Charles' Stimme klang schwach; er war vom Gehörten merklich überfordert. Amalie sagte sich, es sei an der Zeit, das Gespräch zu beenden. »Nun, offenbar hat Maria Leopoldine eine gewisse Schwäche für Max Joseph entwickelt. Sie wissen ja, wie charmant und liebenswert er sein kann. Man sagt, es sei die Kurfürstin selbst gewesen, die Max Joseph zur Enthaltsamkeit ermahnte und verspätet auf den Pfad der Tugend zurück schickte. Offenbar hat Maria Leopoldine ihren Neffen weit lieber gewonnen als ihren Ehemann. Wenn es in ihrer Macht steht, wird sie alles tun, damit die Zweibrückener Linie, also meine beiden Cousins, den Kurfürstenhut erbt. Und wie der Zufall es will: es steht in ihrer Macht.« Siegessicher lehnte Amalie sich zurück. »Begreifen Sie nun, weshalb ich die Aussichten des Pfalzgrafen Maximilian Joseph von Zweibrücken für alles andere als schlecht halte?«
»Durchaus, durchaus«, stotterte ihr Ehemann. »Wenn Sie es mir so erklären. Und zweifellos ist die Herzogswürde der Pfalz keine ganz geringe, aber mir scheint doch …«
»Die Herzogswürde!«, entrüstete sich Amalie. »Ich bitte Sie, Charles, denken Sie doch nach! Max Josephs Bruder hat keinen Sohn; er ist älter als Max und seine Lebensweise ist höchst ungesund. Es ist abzusehen, dass Max Joseph einmal selbst Kurfürst von Bayern werden wird. Seine Kinder sind noch unmündig; zweifellos würde im Fall auch seines frühen Tods, den Gott verhüten möge, seine Gemahlin zumindest mit im Regentschaftsrat zu München sitzen. Aber mehr noch: Maximilians Ältester schien mir sehr seiner armen Mutter nachzugehen mit seiner Schwerhörigkeit und seinem Stottern. Gott verhüte, dass er etwa auch ihren Hang zur Schwindsucht geerbt haben sollte! Wie schrecklich wäre es für den armen Maximilian Joseph, dem das Unglück auf dem Fuß zu folgen scheint, nun auch noch seinen Sohn begraben zu müssen! Auch den zweiten Sohn, der noch so klein ist, kann man kaum als außer Gefahr betrachten; die beiden Töchter zählen nicht. Sollten die Prinzen ihre Kindheit jedoch nicht überleben, müssten die Söhne der zweiten Ehefrau ihre Stelle vertreten und ihrem Vater Stütze und Erben sein. – Wirklich, mein Lieber, ich kann Ihr Zögern nicht begreifen. Eine glänzendere Position als die der Pfalzgräfin von Zweibrücken-Birkenfeld scheint mir kaum denkbar!«
Ihr Gemahl, von den weit gespannten Plänen seiner Gattin gleichermaßen schockiert wie überfordert, beeilte sich, ihr recht zu geben, und erklärte sich einverstanden, den trauernden Witwer Max Joseph samt seinen Kindern nach Karlsruhe einzuladen, sobald Amalie dies für angemessen und lohnenswert erachtete.
Eine Einladung erwies sich am Ende als unnötig; man traf sich ohnehin, auf der Flucht vor einer wieder einmal über die Grenze geschwappten Welle weiterer aufrührerischer Franzosen. (Immerhin: Moreau, Bonaparte – das waren Namen, die man bereits kannte; die Dinge konsolidierten sich, fanden der Markgraf und sein Sohn.) Die Flucht führte in diesem Jahr nach Ansbach, das dem König von Preußen unterstand. Letzterer hatte sich völlig aus dem Krieg zurückgezogen und sich gegenüber den französischen Revolutionären für neutral erklärt - eine Ungeheuerlichkeit, nach Amalies Ansicht. Der preußische König mochte tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben, jedenfalls öffnete er klaglos seine Ländereien und Paläste für jene Fürsten, die weniger Glück hatten als er, denen die Franzosen keine Neutralität zubilligten und die dem Klang von Marseillaise und Kanonen daher für eine Weile aus dem Weg gehen mussten.
Zu diesen Flüchtlingen zählte in jenem Herbst neben der markgräflichen Familie von Baden auch wieder einmal Amalies Cousin Maximilian Joseph von Zweibrücken.
Amalie war fest entschlossen, diese günstige Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen. Die unwirtliche Jahreszeit hatte noch nicht begonnen, das Wetter erlaubte des öfteren Ausflüge und Kutschfahrten. Auch die Trauerzeit Max Josephs war zur Hälfte vorüber und gestattete ihm, wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Exilierten nutzten die Gastfreundschaft des Preußenkönigs weidlich aus und veranstalteten Jagden, Tanzabende und Konzerte. Wie hätte man die Zeit, die man fern von Zuhause zubringen musste, besser nützen können als mit dem Anbahnen einer ehelichen Verbindung? Selbst der zögernde Charles musste das letztlich einsehen.
Auf deutlich größeren Widerstand als bei ihrem Ehemann traf Amalie bei der Tochter, die sie für diese Verbindung vorgesehen hatte. Amalie zitierte Karoline zu sich in jenes etwas zu enge, fensterlose Zimmer, das ihr in Ansbach mangels Alternativen als Salon und Kabinett dienen musste. Vorsichtig brachte sie die Sprache auf den Pfalzgrafen Maximilian Joseph von Zweibrücken.
»Wie ich höre, bist du gestern mit Améli und meinem Cousin Max Joseph spazieren gegangen?«
»Nur ein wenig in den Gärten, Mama. Das Wetter war zu schön, um es nicht auszunutzen. Wer weiß, wie lange es noch so bleiben wird? Sie brauchen sich auch keine Sorgen zu machen; wir blieben auf den guten Wegen, und der Pfalzgraf war sehr besorgt, uns zeitig wieder ins Haus zu bringen, ehe wir uns eine Erkältung holen konnten.«
»Ah, der gute Maximilian! Er ist so fürsorglich.«
»Das ist er wirklich, Mama«, sagte Karoline warm. »Améli und ich nennen ihn unter uns ›Onkel Max‹. Ich hoffe, Sie finden das nicht despektierlich, aber der Pfalzgraf ist so umgänglich und freundlich zu aller Welt – wie eben ein guter Onkel.«
»Du scheinst gern in seiner Gesellschaft zu sein.«
»Wer ist das nicht? Er ist fröhlich und hilfsbereit; man könnte sich keinen aufmerksameren Begleiter wünschen.« Etwas verspätet wurde Karoline klar, in welche Richtung die Erkundigungen ihrer Mutter zielten. »Oh, Mama, Sie wollen doch nicht etwa andeuten …«
»Andeuten?« Amalie hob entrüstet die Brauen. »Mein Kind, Anspielungen irgendwelcher Art liegen mir durchaus nicht; sie sind abstoßend und frivol. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass du im Alter von zwanzig Jahren noch immer unverheiratet bist und Chancen ergreifen solltest, die sich dir bieten.«
»Aber Mama!«, klagte Karoline. »Wie können Sie auf eine solche Idee kommen? Der Pfalzgraf ist ja genauso alt wie unser Herr Papa!«
»Desto mehr wird er deine Jugend und Fröhlichkeit zu schätzen wissen und desto würdevoller wird er dich behandeln.«
Wortreich versuchte Karoline, ihrer Mutter zu verdeutlichen, dass Würde und Reife nicht die vordringlichsten Eigenschaften seien, nach denen sie bei ihrem Ehemann suche. Sie fand damit kein Gehör.
»Papperlapapp, Kindchen. Du klingst wie eine naive Träumerin, die von ihrem Ideal schwärmt. Spukt dir etwa immer noch dieser Enghien im Kopf herum? Ich hoffe doch, meine Töchter zu Besserem erzogen zu haben. Im Zweifelsfall ist der Spatz in der Hand der Taube auf dem Dach jedenfalls vorzuziehen. Und dieser Spatz hat alle Chancen, sich zu einem ordentlichen Täuberich auszuwachsen. Wenn du erst Kurfürstin von Bayern geworden bist, wirst du mir Dank sagen.«
Karoline wollte ein weiteres Mal protestieren, sah sich jedoch von ihrer Mutter abrupt damit beauftragt, ihre jüngeren Geschwister durch die Orangerie zu führen. Jene Orangerie, in der auch Amalies Cousin Maximilian Joseph sich so gerne aufhielt.
Dieser nichtsahnende Täuberich, dazu ausersehen, Amalies Tochter zu umgurren, schien übrigens fast ebenso wenig geneigt, den bayerischen Kurfürstenhut zu tragen, wie Karoline es war. Wenigstens konnte man das seinen Worten am abendlichen Spieltisch entnehmen.
»Es ist ein Kreuz mit der Politik«, seufzte er. Er schien noch einmal gealtert seit ihrer letzten Begegnung, und seit dem Tod seiner Frau wirkte er ungewohnt trübsinnig. »Gebe Gott, dass mein Bruder mich überlebt und meine Kinder zu seinen Erben in Mannheim macht, das wäre wohl das Beste für alle. Honnêtement!