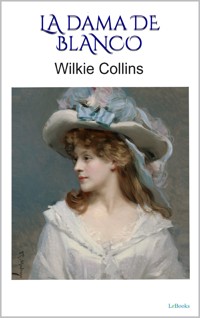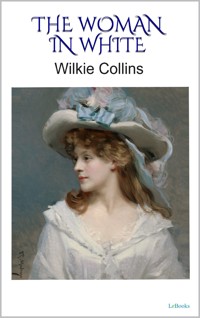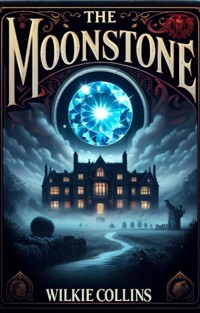Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Valeria hat den Mann ihres Lebens gefunden und heiratet ihn. Aber schon wenige Tage nach der Hochzeit muss sie festellen, dass Eustace ihr etwas verschweigt. Als sie herausfindet, dass ihr Mann wegen Mordes angeklagt war und nur aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, trennt er sich von ihr – dass sie ihm jetzt noch vertrauen kann, mag er nicht glauben. Aber Valerias unerschütterliche Liebe paart sich mit Hartnäckigkeit, und so macht sie sich auf eigene Faust daran, Eustaces Unschuld ein für alle Mal zu beweisen. Auch die skurrilen, ja geradezu beängstigenden Personen, an die sie im Zuge ihrer Nachforschungen gerät, lassen sie ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. Schließlich scheint der Erfolg greifbar nahe zu sein, aber da gerät ihre Entschlossenheit ins Wanken... Der spannende, aber auch berührende Roman "Eine Frau will Gerechtigkeit", der hier in einer völlig neuen deutschen Übersetzung vorliegt, erschien ursprünglich 1875. Zum ersten Mal in der Kriminalliteratur lässt Wilkie Collins darin eine Frau die Ermittlungen führen. Der Autor Wilkie Collins (1824-1889) war einer der großen viktorianischen Schriftsteller. Er arbeitete häufig mit Charles Dickens zusammen und kritisierte wie dieser in seinen Romanen und Kurzgeschichten die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit. Im Mittelpunkt stehen dabei oftmals starke Frauengestalten. Mit seinen bekanntesten Werken Die Frau in Weiß und Der rote Schal begründete er das Genre der Kriminalromane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilkie Collins
Eine Frau will
Gerechtigkeit
Roman
Aus dem Englischen neu übersetzt von Sebastian Vogel
Unter dem Titel The Law and the Lady
erstmals erschienen 1875.
Übersetzung © 2018 Sebastian Vogel
Umschlaggestaltung © Sebastian Vogel
Umschlagbild: Masson/stock.adobe.com
Verlag: Sebastian Vogel
Erikaweg 5
50169 Kerpen
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
ISBN 978-3-746719-14-6
An den Leser
Dieses Buch lege ich Ihnen vor, ohne ein Vorwort zu schreiben. Ich bitte Sie nur darum, einige bewährte Wahrheiten im Kopf zu behalten, die unserer Erinnerung hin und wieder entfallen, wenn wir ein Werk der erzählenden Literatur lesen. Bitte erinnern Sie sich deshalb freundlicherweise an Folgendes: erstens, dass die Taten der Menschen nicht zwangsläufig von den Gesetzen der reinen Vernunft gelenkt werden. Zweitens, dass wir keineswegs immer die Gewohnheit haben, unsere Liebe denen zu schenken, die sie nach Ansicht unserer Freunde am meisten verdient haben. Und drittens (und zuletzt), dass Gestalten, die innerhalb der Grenzen unserer eigenen, individuellen Erfahrung nicht aufgetaucht sind, und Ereignisse, die innerhalb dieser Grenzen nicht stattgefunden haben, dennoch und trotz alledem vollkommen natürliche Gestalten und plausible Ereignisse sein können. Mit diesen wenigen Worten habe ich alles gesagt, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt gesagt werden muss, bevor ich meine neue Geschichte Ihrer Aufmerksamkeit präsentieren kann.
W. C.
London, 1. Februar 1875
Kapitel 1Der Fehler der Braut
Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten wie Sara, die Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst.“
Nachdem mein Onkel Starkweather die Trauungsliturgie der Kirche von England mit diesen altbekannten Worten beendet hatte, schlug er sein Buch zu und sah mich über die Altarbrüstung hinweg an. Auf seinem breiten, roten Gesicht lag ein Ausdruck des herzlichen Interesses. Im gleichen Augenblick tippte mir meine Tante, Mrs. Starkweather, die neben mir stand, auf die Schulter und sagte:
„Valeria, jetzt bist du verheiratet.“
Wo waren meine Gedanken? Was war aus meiner Aufmerksamkeit geworden? Ich wusste es nicht – dazu war ich zu verwirrt. Ich fuhr hoch und blickte zu meinem frisch angetrauten Ehemann. Er schien fast ebenso verwirrt zu sein wie ich. Ich glaube, uns beiden war im gleichen Augenblick derselbe Gedanke gekommen. War es – trotz des Widerspruches seiner Mutter gegen unsere Ehe – wirklich möglich, dass wir Mann und Frau waren? Meine Tante Starkweather legte die Frage durch ein zweites Tippen auf meine Schulter bei.
„Nimm seinen Arm!“, flüsterte sie mit dem Tonfall einer Frau, die jede Geduld mit mir verloren hatte.
Ich nahm seinen Arm.
„Folge deinem Onkel.“
Am Arm meines Mannes folgte ich meinem Onkel und dem Kaplan, der ihm bei der Trauung assistiert hatte.
Die beiden Geistlichen führten uns in die Sakristei. Die Kirche lag in einem trostlosen Viertel Londons zwischen der City und dem West End; es war ein nebliger Tag, die Luft schwer und feucht. Unsere melancholische kleine Hochzeitsgesellschaft passte zu der düsteren Umgebung und dem trüben Wetter. Verwandte oder Freunde meines Mannes waren nicht anwesend; wie ich bereits angedeutet habe, missbilligte seine Familie die Eheschließung. Auch von meiner Seite waren, abgesehen von meinem Onkel und meiner Tante, keine Angehörigen erschienen. Meine beiden Eltern hatte ich bereits verloren, und die Zahl meiner Freunde war gering. Benjamin, der treue alte Angestellte meines Vaters, nahm an der Trauung teil, um mich „wegzugeben“, wie man so sagt. Er kannte mich von Kindesbeinen an, und in meiner tristen Lage war er für mich so gut wie ein Vater.
Die letzte Zeremonie, die es noch zu vollziehen galt, war die übliche Unterzeichnung des Heiratsregisters. In der Verwirrung des Augenblicks (und mangels aller Kenntnisse, die mir als Leitfaden hätten dienen können) beging ich einen Fehler – nach Ansicht meiner Tante Starkweather ein schlimmes Vorzeichen für böse Dinge, die noch kommen würden. Ich unterschrieb nicht mit meinem Mädchen-, sondern mit meinem Ehenamen.
„Was?“, rief mein Onkel in seinem lautesten, fröhlichsten Ton, „du hast schon deinen eigenen Namen vergessen? Nun ja, nun ja! Hoffen wir, dass du es nie bereuen wirst, dich so schnell von ihm verabschiedet zu haben. Versuch’ es noch einmal, Valeria! Versuch’ es noch einmal!“
Mit zitternden Fingern strich ich meine erste Unterschrift durch und brachte meinen Mädchennamen wirklich schlecht zu Papier, nämlich so:
Als mein Mann an der Reihe war, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass seine Hand ebenfalls zitterte und dass er ein sehr schlechtes Exemplar seiner üblichen Unterschrift hinschrieb:
Als meine Tante gebeten wurde, ebenfalls zu unterschreiben, kam sie der Aufforderung nur unter Protest nach: „Ein schlechter Anfang!“, sagte sie und deutete mit dem Hinterende der Feder auf meine erste, ungültige Unterschrift. „Ich hoffe, meine Liebe, du wirst es nicht eines Tages bereuen.“
Schon damals, in den Tagen meiner Unkenntnis und Arglosigkeit, verursachte dieser seltsame, abergläubische Gefühlsausbruch meiner Tante bei mir eine gewisse unbehagliche Empfindung. Es war für mich ein Trost, den beruhigenden Händedruck meines Mannes zu spüren. Und eine unbeschreibliche Erleichterung stellte sich ein, als ich hörte, wie mein Onkel mir beim Abschied mit kerniger Stimme ein glückliches Leben wünschte. Der gute Mann hatte sein Kirchspiel im Norden des Landes (das seit dem Tod meiner Eltern meine Heimat gewesen war) ausdrücklich zu dem Zweck verlassen, bei meiner Hochzeit den Gottesdienst zu halten; er und meine Tante hatten es so eingerichtet, dass sie mit dem Mittagszug die Heimreise antreten konnten. Er schloss mich in seine großen, starken Arme und gab mir einen Kuss, den selbst die Müßiggänger, die vor der Kirche auf Braut und Bräutigam warteten, hören mussten.
„Ich wünsche dir von ganzem Herzen Gesundheit und Glück, meine Liebe. Du bist alt genug, um für dich selbst zu entscheiden, und – keine Beleidigung, Mr. Woodville, schließlich sind wir Freunde – ich bete zu Gott, dass sich deine Entscheidung als richtig erweist. Unser Haus wird ohne dich trostlos genug sein; aber ich beklage mich nicht, mein Liebes. Im Gegenteil: Wenn diese Veränderung in deinem Leben dich glücklicher macht, freue ich mich. Komm, komm! Weine nicht, sonst fängt deine Tante auch noch an – und in ihrem Alter ist das nicht lustig. Nebenbei bemerkt, verdirbt Weinen deine Schönheit. Trockne dir die Augen und schau in den Spiegel hier, dann siehst du, dass ich recht habe. Auf Wiedersehen, mein Kind – und Gott segne dich!“
Er bot seiner Frau den Arm und eilte hinaus. So sehr ich meinen Mann auch liebte – mein Mut sank ein wenig, als ich den letzten wahren Freund und Beschützer meiner Mädchenzeit entschwinden sah.
Als Nächstes folgte der Abschied vom alten Benjamin. Er sagte nur: „Ich wünsche dir alles Gute, meine Liebe; vergiss mich nicht.“ Aber bei diesen wenigen Worten fielen mir die Zeiten damals zu Hause wieder ein. Als mein Vater noch lebte, hatte Benjamin sonntags immer mit uns zu Abend gegessen, und dann hatte er jedes Mal ein kleines Geschenk für das Kind seines Dienstherrn mitgebracht. Ich war knapp davor, „meine Schönheit zu verderben“ (wie mein Onkel es formuliert hatte), als ich dem alten Mann meine Wange zum Kuss hinhielt und ihn leise seufzen hörte, als hätte auch er, was mein zukünftiges Leben anging, keine allzu großen Hoffnungen.
Die Stimme meines Mannes munterte mich auf und lenkte meine Gedanken auf glücklichere Themen.
„Gehen wir, Valeria?“, fragte er.
Auf dem Weg nach draußen hielt ich ihn auf, um den Ratschlag meines Onkels zu befolgen und mir anzusehen, wie ich in dem Spiegel über dem Kamin der Sakristei aussah.
Was zeigt mir der Spiegel?
Der Spiegel zeigt eine hoch gewachsene, schlanke junge Frau von dreiundzwanzig Jahren. Sie ist kein Mensch, der auf der Straße die Aufmerksamkeit auf sich zieht, denn sie ist weder mit den beliebten blonden Haaren noch mit den beliebten gefärbten Wangen ausgestattet. Ihre Haare sind schwarz. Frisiert ist sie in dieser späteren Zeit immer noch so, wie sie schon vor Jahren frisiert war, um ihrem Vater eine Freude zu bereiten: in breiten Wellen, die aus der Stirn zurückgekämmt und hinten wie die Haare der Venus de Medici in einem einfachen Knoten zusammengefasst sind, so dass der Hals darunter sichtbar ist. Ihr Teint ist blass: Außer in Augenblicken der heftigen Erregung ist in ihrem Gesicht keine Farbe zu erkennen. Ihre Augen sind von einem so dunklen Blau, dass sie meist fälschlich für schwarz gehalten werden. Die Augenbrauen sind durchaus wohlgeformt, aber zu dunkel und zu stark ausgeprägt. Ihre Nase neigt ein wenig zu einer adlerartigen Biegung und gilt Menschen, die in der Frage der Nasenform kaum einmal zufrieden sind, als ein wenig zu groß. Das Beste an ihrem Gesicht ist der Mund: Er ist zart geformt und zu höchst vielfältigen Ausdrucksformen in der Lage. Was das Gesicht im Allgemeinen angeht, so ist es in seinem unteren Teil zu schmal und zu lang, in den höheren Regionen von Augen und Stirn dagegen zu breit und niedrig. Das ganze Bild, wie der Spiegel es wiedergibt, zeigt eine Frau von einer gewissen Eleganz, ein wenig zu blass, ein wenig zu ruhig und ernst in Augenblicken der Stille und Erholung – kurz gesagt, eine Person, die dem gewöhnlichen Beobachter auf den ersten Blick nicht auffällt, beim zweiten oder manchmal auch dritten Hinsehen aber an allgemeiner Wertschätzung gewinnt. Was ihre Kleidung betrifft, so verkündet sie nicht, dass die Frau an diesem Morgen geheiratet hat, sondern verbirgt es geflissentlich. Ihr grauer Umhang aus Kaschmir ist mit grauer Seide eingefasst, und darunter trägt sie einen Rock aus dem gleichen Material in derselben Farbe. Auf dem Kopf sitzt eine passende Haube, aufgelockert durch eine Rüsche aus weißem Musselin und eine dunkelrote Rose, die als fröhlicher Farbfleck die Wirkung der gesamten Kleidung vervollständigt.
Ist es mir gelungen oder misslungen, das Bild zu beschreiben, das ich im Spiegel sehe? Das zu beurteilen, ist nicht an mir. Ich habe mir alle Mühe gegeben, mich von den beiden Eitelkeiten fernzuhalten: der Eitelkeit der Selbsterniedrigung und der Eitelkeit, mein eigenes Aussehen zu loben. Im Übrigen ist es, ob gut oder schlecht beschrieben, glücklicherweise erledigt!
Und wen sehe ich im Spiegel an meiner Seite stehen?
Ich sehe einen Mann, der nicht ganz so groß ist wie ich und das Pech hat, älter auszusehen als es seinen Jahren entspricht. Seine Stirn ist frühzeitig kahl geworden. Der üppige, kastanienbraune Bart und der lange, herabhängende Schnauzbart sind vorzeitig von grauen Streifen durchsetzt. Im Gesicht hat er die Farbe, die mir fehlt, und seine Gestalt hat die Festigkeit, an der es meiner Figur mangelt. Er betrachtet mich mit den sanftesten und zärtlichsten Augen (in hellem Braun), die ich jemals im Gesicht eines Mannes gesehen habe. Sein Lächeln ist ungewöhnlich weich; sein vollkommen ruhiges, zurückhaltendes Benehmen hat dennoch eine versteckte Überzeugungskraft, die auf Frauen unwiderstehlich gewinnend wirkt. Beim Gehen zeigt er eine kleine Hemmung – die Folge einer Verwundung, die er sich vor einigen Jahren zugezogen hat, als er in Indien als Soldat diente. Um zu Fuß vorwärtszukommen, trägt er deshalb immer, ob drinnen oder draußen, einen dicken Bambusstock mit einer eigenartig geformten Krücke bei sich, einen alten Lieblingsgegenstand. Abgesehen von diesem kleinen Nachteil (wenn man es einen Nachteil nennen will) ist an ihm nichts Gebrechliches, Altes oder Plumpes. Sein leicht hinkender Gang hat (vielleicht für meinen parteiischen Blick) eine gewisse eigene, ungewöhnliche Anmut, die angenehmer anzusehen ist als die uneingeschränkte Rührigkeit anderer Männer. Und schließlich das Beste: Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Damit bin ich mit der Beschreibung meines Mannes an unserem Hochzeitstag am Ende.
Der Spiegel hat mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Endlich verlassen wir die Sakristei.
Der Himmel war am Morgen schon bewölkt; während wir in der Kirche saßen, hat er sich weiter verdunkelt, und jetzt fällt schwerer Regen. Draußen starren uns die Müßiggänger unter ihren Regenschirmen mürrisch an, während wir zwischen ihren Reihen hindurch zu unserer Kutsche eilen. Kein Jubel; kein Sonnenschein; keine Blumen, die uns auf den Weg gestreut werden; kein üppiges Frühstück; keine geistreichen Reden; keine Brautjungfern; kein väterlicher oder mütterlicher Segen. Eine trostlose Hochzeit, das ist nicht zu leugnen – und (wenn Tante Starkweather Recht hat) auch ein schlechter Anfang!
Am Bahnhof ist für uns ein Abteil reserviert. Der aufmerksame, auf seinen Lohn bedachte Gepäckträger zieht die Jalousien an den Seitenfenstern des Waggons herunter und schließt so alle neugierigen Blicke aus. Nach einer scheinbar unendlichen Verzögerung fährt der Zug an. Mein Mann legt seinen Arm um mich. „Endlich!“, flüstert er, in den Augen eine Liebe, wie Worte sie nicht ausdrücken können; zärtlich zieht er mich an sich. Mein Arm schlingt sich um seinen Hals; meine Blicke beantworten die seinen. Unsere Lippen begegnen sich in dem ersten langen, nicht enden wollenden Kuss unseres Ehelebens.
Ach, welche Erinnerungen an diese Reise steigen in mir hoch, während ich schreibe! Ich will mir die Augen trocknen und meine Papiere für heute schließen.
Kapitel 2Die Gedanken der Braut
Wir waren kaum mehr als eine Stunde gereist, da ging mit uns beiden unmerklich eine Veränderung vor.
Immer noch saßen wir dicht nebeneinander, meine Hand in der seinen und mein Kopf auf seiner Schulter, aber nach und nach verfielen wir immer mehr in Schweigen. Hatten wir den schmalen und doch so beredten Wortschatz der Liebe bereits erschöpft? Oder hatten wir uns in unausgesprochener Einigkeit entschlossen, uns zunächst des Luxus einer sprechenden Leidenschaft zu erfreuen, um es dann mit der tieferen, feineren Hingabe einer Leidenschaft zu probieren, die denkt? Ich kann es kaum feststellen; ich weiß nur, dass eine Zeit kam, in der sich unsere Lippen unter irgendeinem seltsamen Einfluss füreinander verschlossen. Wir reisten weiter, jeder vertieft in seine eigene Träumerei. Dachte er ausschließlich an mich – so wie ich ausschließlich an ihn dachte? Schon vor dem Ende der Reise kamen mir Zweifel, und wenig später wusste ich es mit Sicherheit: Seine Gedanken schweiften von seiner jungen Ehefrau ab und wandten sich nach innen zu seinem unglücklichen Ich.
Für mich war die geheime Freude, meinen Geist mit ihm auszufüllen, während ich ihn an meiner Seite spürte, schon für sich allein ein Luxus.
In Gedanken malte ich mir aus, wie wir nicht weit vom Haus meines Onkels zum ersten Mal zusammengetroffen waren.
Dort, im Norden des Landes, bahnte sich unser berühmter Forellenbach seinen blitzenden, schäumenden Weg durch eine Klamm in der felsigen Moorlandschaft. Es war ein windiger, schattiger Abend. Im Westen hing tief und rot die untergehende, von schweren Wolken umgebene Sonne. Ein einsamer Angler warf seine Fliege an einer Biegung des Baches aus, an der das Altwasser still und tief unter dem überhängenden Ufer lag. Ein Mädchen (nämlich ich) stand, für den Angler darunter unsichtbar, am Ufer und wartete begierig darauf, die Forelle in die Höhe steigen zu sehen.
Der Augenblick kam: Der Fisch nahm die Fliege.
Manchmal auf dem kleinen, ebenen Sandstreifen unten an der Böschung, manchmal auch (wenn der Bach wieder eine Biegung machte) in dem seichteren Wasser, das durch sein steiniges Bett strömte, verfolgte der Angler die gefangene Forelle; in dem schwierigen, heiklen „Spiel“ mit dem Fisch ließ er die Leine hinauslaufen und zog sie wieder ein. Am Ufer entlang folgte ich ihm und beobachtete den Geschicklichkeits- und Klugheitswettbewerb zwischen Mann und Fisch. Ich hatte schon so lange bei meinem Onkel Starkweather gelebt, dass ein Teil seiner Begeisterung für sportliche Betätigung im Freien auch auf mich übergegangen war, und insbesondere in der Kunst des Angelns hatte ich etwas von ihm gelernt. Immer noch folgte ich dem Fremden, den Blick aufmerksam auf jede Bewegung von Angelrute und Leine gerichtet, und nur durch Zufall blieb mir hin und wieder ein wenig Aufmerksamkeit für den unebenen Weg, auf dem ich ging. So trat ich einmal auch auf die lockere, überhängende Erde am Rand der Böschung, und im nächsten Augenblick fiel ich in den Bach.
Die Entfernung war gering, das Wasser war flach, und das Bachbett bestand (zu meinem Glück) aus Sand. Abgesehen von Angst und Nässe konnte ich mich über nichts beklagen. Wenige Augenblicke später stand ich wieder auf trockenem Boden und schämte mich sehr. So kurz der Augenblick auch war, er erwies sich als lang genug, damit der Fisch entwischen konnte. Der Angler hatte meinen ersten instinktiven Angstschrei gehört, sich sofort umgewandt und seine Angelrute weggeworfen, um mir zu helfen. Zum ersten Mal standen wir einander gegenüber – ich auf der Uferböschung, er ein wenig tiefer im flachen Wasser. Unsere Blicke begegneten sich, und ich bin ehrlich überzeugt, dass sich im gleichen Augenblick auch unsere Herzen begegneten. Eines weiß ich mit Sicherheit: Wir vergaßen unsere Erziehung als Lady und Gentleman und blickten uns gegenseitig in ungehörigem Schweigen an.
Ich kam als Erste wieder zu mir. Was sagte ich zu ihm?
Ich sagte etwas darüber, dass ich mir nicht wehgetan hätte, und dann noch etwas anderes. Ich drängte ihn, zurückzulaufen und zu versuchen, ob er den Fisch nicht doch noch fangen könnte.
Widerwillig ging er zurück. Dann kam er wieder zu mir – natürlich ohne Forelle. Ich wusste, wie bitter enttäuscht mein Onkel an seiner Stelle gewesen wäre, und entschuldigte mich in sehr ernstem Ton. In meinem Eifer, Abbitte zu leisten, bot ich ihm sogar an, ihm eine Stelle weiter bachabwärts zu zeigen, an der er es noch einmal versuchen könnte.
Er hörte nicht darauf, sondern forderte mich auf, nach Hause zu gehen und die nasse Kleidung zu wechseln. Mir machte die Nässe nichts aus, aber ich gehorchte ihm, ohne zu wissen, warum.
Er begleitete mich. Mein Rückweg ins Pfarrhaus war auch sein Rückweg zum Gasthaus. Wie er mir erzählte, war er nicht nur wegen der Fischerei in unsere Gegend gekommen, sondern auch wegen der Ruhe und Zurückgezogenheit. Mich hatte er vom Fenster des Gasthauses aus schon ein- oder zweimal gesehen. Jetzt fragte er, ob ich die Tochter des Pfarrers sei.
Ich erklärte es ihm. Ich sagte, dass der Geistliche die Schwester meine Mutter geheiratet hatte und dass die beiden seit dem Tod meiner Eltern wie Vater und Mutter zu mir gewesen waren. Er erkundigte sich, ob er es wagen könne, Doktor Starkweather am nächsten Tag aufzusuchen, und erwähnte dabei den Namen eines Freundes, von dem er glaubte, dass er ein Bekannter des Geistlichen sei. Ich lud ihn ein, uns zu besuchen, als wäre es mein Haus; seine Augen und seine Stimme bezauberten mich. Schon vorher hatte ich mir immer wieder ausgemalt – ehrlich ausgemalt –, wie es wäre, verliebt zu sein. Nie zuvor hatte ich mich in Gesellschaft eines Mannes so gefühlt wie in der Gegenwart dieses Mannes. Als er mich verließ, war es, als würde die Nacht ganz plötzlich über die abendliche Landschaft hereinbrechen. Ich lehnte mich an das Tor des Pfarrhauses. Ich bekam keine Luft, konnte nicht denken; mein Herz raste, als wollte es aus der Brust springen – und alles wegen eines Fremden! Ich glühte vor Scham; aber ach, trotz alledem war ich so glücklich!
Und jetzt, da seit jenem ersten Zusammentreffen kaum mehr als einige Wochen vergangen waren, hatte ich ihn an meiner Seite. Er war für das ganze Leben mein! Ich hob den Kopf von seiner Brust und sah ihn an. Es erging mir wie einem Kind mit einem neuen Spielzeug: ich wollte mich vergewissern, dass er wirklich mir gehörte.
Er bemerkte nicht, was ich tat, ja er machte in seiner Ecke des Abteils nicht die geringste Bewegung. War er tief in seine eigenen Gedanken versunken? Und handelten diese Gedanken von mir?
Sanft legte ich den Kopf wieder hinunter, um ihn nicht zu stören. Wieder wanderten meine Gedanken in die Vergangenheit und zeigten mir ein weiteres Bild aus der goldenen Galerie der früheren Zeiten.
Dieses Mal bildete der Garten des Pfarrhauses den Schauplatz. Es war Nacht. Wir hatten uns heimlich getroffen. Langsam gingen wir außer Sichtweite des Hauses hin und her, einmal auf den schattigen Pfaden des Sträuchergartens, ein anderes Mal im lieblichen Mondlicht auf dem Rasen.
Schon längst hatten wir uns gegenseitig unsere Liebe gestanden und unser Leben einander gewidmet. Unsere Interessen waren schon eins; wir teilten schon die Freuden und Schmerzen des Lebens. In dieser Nacht war ich schweren Herzens hinausgegangen, um ihn zu treffen, um Trost in seiner Nähe zu suchen und Ermutigung in seiner Stimme zu finden. Ihm war aufgefallen, dass ich geseufzt hatte, als er mich in die Arme schloss, und drehte meinen Kopf zärtlich im Mondlicht zu sich, um den Kummer in meinem Gesicht zu lesen. Wie oft hatte er darin in den frühen Tagen unserer Liebe mein Glück erkannt!
„Du bringst schlechte Nachrichten, mein Engel“, sagte er und schob mir dabei zärtlich die Haare aus der Stirn. „Ich sehe hier Linien, die mir von Angst und Kummer erzählen. Fast wünsche ich mir, ich würde dich weniger lieben, Valeria!“
„Warum?“
„Dann könnte ich dir deine Freiheit wiedergeben. Ich brauche diesen Ort nur zu verlassen, dann ist dein Onkel zufrieden, und du bist von allen Sorgen befreit, die dich jetzt bedrücken.“
„Sag’ so etwas nicht, Eustace! Wenn du willst, dass ich meine Sorgen vergesse, dann sag’ mir, dass du mich mehr liebst als je zuvor.“
Er sagte es mir mit einem Kuss. Gemeinsam erlebten wir einen Augenblick des völligen Vergessens der harten Seiten des Lebens – einen Augenblick der köstlichen Versunkenheit ineinander. Als ich in die Wirklichkeit zurückkehrte, war ich gestärkt und gefasst, belohnt für alles, was ich durchgemacht hatte, und bereit, alles für einen weiteren Kuss noch einmal durchzumachen. Schenke einer Frau nur Liebe, dann gibt es nichts, was sie nicht zu wagen, zu erleiden und zu tun vermag.
„Nein, mit ihren Einwänden haben sie aufgehört. Sie haben sich endlich daran erinnert, dass ich volljährig bin und für mich selbst entscheiden kann. Sie haben mich angebettelt, Eustace, dich aufzugeben. Meine Tante, die ich sonst für eine ziemlich harte Frau gehalten hatte, hat sogar geweint – zum ersten Mal, seit ich sie kenne. Mein Onkel war schon immer freundlich und gut zu mir, aber jetzt war er noch freundlicher und besser als früher. Er hat mir gesagt, wenn ich darauf bestehe, deine Frau zu werden, würde er mich an meinem Hochzeitstag nicht im Stich lassen. Wo wir auch heiraten, er werde bereit stehen und den Gottesdienst halten, und meine Tante werde mit mir in die Kirche gehen. Aber er hat mich auch gebeten, ernsthaft zu bedenken, was ich tue – ich soll für eine gewisse Zeit einer Trennung von dir zustimmen und andere nach meiner Stellung zu dir befragen, wenn seine Meinung mich nicht zufrieden stellt. Ach, mein Liebling, sie sind so erpicht darauf, uns zu trennen, als wärst du nicht der beste, sondern der schlechteste aller Männer!“
„Ist seit gestern irgendetwas geschehen, was ihr Misstrauen gegen mich verstärkt hat?“, fragte er.
„Ja.“
„Und was?“
„Erinnerst du dich noch, dass mein Onkel einen gemeinsamen Freund von dir und ihm erwähnt hat?“
„Ja. Den Major Fitz-David.“
„Mein Onkel hat an Major Fitz-David geschrieben.“
„Warum?“
Er sprach das eine Wort in einem Ton aus, der so ganz anders war als sein natürlicher Tonfall, dass seine Stimme für mich völlig fremd klang.
„Wirst du dich auch nicht ärgern, wenn ich es dir sage, Eustace?“, sagte ich. „Wenn ich meinen Onkel richtig verstanden habe, hatte er mehrere Beweggründe, an den Major zu schreiben. Unter anderem wollte er wissen, ob der Major die Adresse deiner Mutter kennt.“
Eustace blieb plötzlich stehen.
Auch ich hielt im gleichen Augenblick inne. Mein Gefühl sagte mir, dass ich mich nicht weiter vorwagen konnte, ohne dass ich Gefahr lief, ihn zu beleidigen.
Um die Wahrheit zu sagen: Als er unsere Verlobung gegenüber meinem Onkel zum ersten Mal erwähnte, war sein Betragen dem äußeren Anschein nach ein wenig kapriziös und eigenartig gewesen. Der Vikar hatte ihn natürlich nach seiner Familie gefragt. Darauf hatte er erwidert, sein Vater sei tot, und dann hatte er sich – allerdings nicht sehr bereitwillig – einverstanden erklärt, seine Mutter über die geplante Eheschließung zu unterrichten. Er teilte uns mit, sie lebe ebenfalls auf dem Land und er habe sie besucht, aber ihre genaue Adresse nannte er nicht. Zwei Tage später war er mit einer verblüffenden Nachricht ins Pfarrhaus zurückgelehrt. Seine Mutter habe nicht die Absicht, respektlos gegenüber mir oder meinen Angehörigen zu sein, aber sie missbillige die Eheschließung ihres Sohnes so entschieden, dass sie (und die Angehörigen ihrer Familie, die alle der gleichen Meinung seien wie sie) es ablehnten, bei der Zeremonie zugegen zu sein, wenn Mr. Woodville darauf bestehe, seine Verlobung mit Mr. Starkweathers Nichte aufrecht zu erhalten. Als Eustace gebeten wurde, die ungewöhnliche Mitteilung zu erläutern, hatte er uns gesagt, seine Mutter und seine Schwestern seien darauf aus gewesen, dass er eine andere Dame heiratete, und nun seien sie zutiefst verletzt und enttäuscht, dass seine Wahl auf eine der Familie unbekannte Frau gefallen sei. Mir reichte diese Erklärung aus; was mich betraf, war sie ein unausgesprochenes Kompliment für meinen überlegenen Einfluss auf Eustace, und ein solches Kompliment nimmt eine Frau stets gern entgegen. Meinen Onkel und meine Tante jedoch befriedigte sie nicht. Der Vikar brachte gegenüber Mr. Woodville den Wunsch zum Ausdruck, an seine Mutter wegen ihrer seltsamen Nachricht zu schreiben oder sich mit ihr zu treffen. Eustace weigerte sich hartnäckig, die Adresse seiner Mutter zu nennen; als Grund führte er an, die Intervention des Vikars sei vollkommen nutzlos. Daraus zog mein Onkel sofort den Schluss, die Heimlichtuerei um die Adresse deute darauf hin, dass etwas nicht stimmte. Er lehnte es ab, Mr. Woodvilles erneute Bitte um meine Hand gutzuheißen, und schrieb noch am gleichen Tag einen Brief, um bei seinem eigenen Freund, dem Major Fitz-David, Nachforschungen über Mr. Woodvilles Referenzen anzustellen.
Unter diesen Umständen von den Beweggründen meines Onkels zu sprechen, hieß sich auf sehr heikles Terrain zu begeben. Eustace ersparte mir weitere Peinlichkeiten, indem er eine Frage stellte, die ich leicht beantworten konnte.
„Hat dein Onkel von dem Major Fitz-David eine Antwort bekommen?“, erkundigte er sich.
„Ja.“
„Durftest du sie lesen?“ Als er das sagte, wurde seine Stimme leiser; sein Gesicht verriet eine plötzliche Furcht, die zu sehen mich schmerzte.
„Ich habe die Antwort bei mir und kann sie dir zeigen“, sagte ich.
Er riss mir den Brief fast aus der Hand, wandte mir den Rücken zu und fing an, ihn im Mondlicht zu lesen. Der Brief war so kurz, dass die Lektüre nicht lange dauerte. Ich hätte sie zu jener Zeit auswendig hersagen können, und ich kann sie auch heute noch auswendig.
Lieber Vikar,
Mr. Eustace Woodville hat völlig recht, wenn er Ihnen gegenüber erklärt, er sei von Geburt und Stellung ein Gentleman, und er habe (durch das Testament seines verstorbenen Vaters) ein Vermögen von zweitausend im Jahr geerbt.
Immer der Ihre
Lawrence Fitz-David
„Kann man sich eine eindeutigere Antwort wünschen?“, fragte Eustace, während er mir den Brief zurückgab.
„Wenn ich mich brieflich nach Informationen über dich erkundigt hätte“, erwiderte ich, „wäre sie für mich eindeutig genug gewesen.“
„Ist sie für deinen Onkel nicht eindeutig genug?“
„Nein.“
„Was sagt er?“
„Warum liegt dir daran, es zu erfahren, mein Liebling?“
„Ich will es wissen, Valeria. Zwischen uns darf es in dieser Angelegenheit kein Geheimnis geben. Hat dein Onkel irgendetwas zu dir gesagt, als er dir den Brief des Majors gezeigt hat?“
„Ja.“
„Und was?“
„Mein Onkel hat mir gesagt, der Brief mit seinen Fragen sei drei Seiten lang gewesen, und wies mich darauf hin, dass die Antwort des Majors nur aus einem Satz besteht. Er sagte: ‚Ich habe angeboten, den Major Fitz-David aufzusuchen und die Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Wie du siehst, geht er auf meinen Vorschlag nicht ein. Ich habe mich bei ihm nach der Adresse von Mr. Woodvilles Mutter erkundigt. Er geht über meine Frage ebenso hinweg wie über meinen Vorschlag und beschränkt sich geflissentlich auf die kürzestmögliche Aussage über bloße Tatsachen. Wende deinen gesunden Menschenverstand an, Valeria. Ist das nicht eine bemerkenswerte Unhöflichkeit von Seiten eines Mannes, der von Herkunft und Erziehung ein Gentleman und außerdem auch mein Freund ist?‘“
An dieser Stelle gebot Eustace mir Einhalt.
„Hast du die Frage deines Onkels beantwortet?“, fragte er.
„Nein“, erwiderte ich. „Ich habe nur gesagt, dass ich das Benehmen des Majors nicht verstehe.“
„Und was hat dein Onkel darauf geantwortet? Valeria, wenn du mich liebst, sag’ mir die Wahrheit!“
„Er hat sich einer sehr heftigen Sprache bedient, Eustace. Er ist ein alter Mann; du darfst seinetwegen nicht beleidigt sein.“
„Ich bin nicht beleidigt. Was hat er gesagt?“
„Er hat gesagt: ‚Lass’ es dir gesagt sein! Im Zusammenhang mit Mr. Woodville oder seiner Familie ist etwas unter der Oberfläche, worauf anzuspielen dem Major Fitz-David nicht freisteht. Richtig interpretiert, Valeria, ist dieser Brief eine Warnung. Zeig’ ihn Mr. Woodville und sage ihm (wenn du möchtest), was ich dir gerade gesagt habe…‘“
Wieder gebot Eustace mir Einhalt.
„Bist du sicher, dass dein Onkel diese Worte gesagt hat?“, fragte er, wobei er mein Gesicht im Mondlicht aufmerksam musterte.
„Ganz sicher. Aber ich behaupte nicht das Gleiche wie mein Onkel. Bitte denk’ das nicht!“
Plötzlich drückte er mich an seine Brust und fixierte mit seinen Augen die meinen. Sein Blick machte mir Angst.
„Lebewohl, Valeria!“, sagte er. „Versuche, freundlich an mich zu denken, mein Liebling, wenn du eines Tages mit einem glücklicheren Mann verheiratet bist.“
Er wollte sich von mir entfernen. In quälendem Entsetzen, das mich von Kopf bis Fuß erbeben ließ, klammerte ich mich an ihn.
„Was meinst du damit?“, fragte ich, sobald ich wieder sprechen konnte. „Ich gehöre dir und nur dir. Was habe ich gesagt, was habe ich getan, womit ich solche schrecklichen Worte verdient hätte?“
„Wir müssen uns trennen, mein Engel“, antwortete er traurig. „Es ist nicht deine Schuld; das Unglück liegt ausschließlich bei mir. Meine Valeria! Wie kannst du einen Mann heiraten, der der Gegenstand des Verdachts deiner nächsten und engsten Angehörigen ist? Ich habe ein trübseliges Leben geführt. Nie habe ich bei einer anderen Frau das Mitgefühl mit mir gespürt, den süßen Trost und die Kameradschaft, die ich bei dir finde. Ach, es ist schwer, dich zu verlieren! Es ist schwer, in ein Leben ohne Freunde zurückzukehren! Aber ich muss das Opfer bringen, mein Liebes, um deinetwillen! Warum dieser Brief so ist, weiß ich ebenso wenig wie du. Wird dein Onkel mir glauben? Werden deine Freunde mir glauben? Ein letzter Kuss, Valeria! Vergib mir, dass ich dich geliebt habe – dass ich dich leidenschaftlich und hingebungsvoll geliebt habe. Vergib mir – und lass mich gehen!“
Verzweifelt, rücksichtslos hielt ich ihn fest. Seine Blicke brachten mich um den Verstand; seine Worte erfüllten mich mit einem Rausch der Verzweiflung.
„Geh’ wohin du willst“, sagte ich, „ich gehe mit dir! Freunde, Ruf – es kümmert mich nicht, wen oder was ich verliere! Ach, Eustace, ich bin nur eine Frau – mach’ mich nicht verrückt! Ich kann ohne dich nicht leben. Ich muss und werde deine Frau sein!“
Mehr als diese wilden Worte konnte ich nicht aussprechen, bevor Kummer und Wahn in mir sich mit einer Flut von Schluchzen und Tränen ihren Weg ins Freie bahnten.
Er gab nach. Er tröstete mich mit seiner liebenswürdigen Stimme; er brachte mich mit seinen zärtlichen Liebkosungen wieder zu Verstand. Er rief den mondhellen Himmel über uns als Zeugen an, dass er mir sein ganzes Leben geweiht habe. Er gelobte – ach, mit so feierlichen, beredten Worten –, dass er Tag und Nacht nur einen Gedanken haben werde: sich einer solchen Liebe wie der meinen als würdig zu erweisen. Und hatte er sein Gelübde nicht eingelöst? War dem Versprechen aus jener denkwürdigen Nacht nicht das Versprechen vor dem Altar gefolgt, das Gelöbnis vor Gott? Ach, was für ein Leben lag vor mir! Welches mehr als nur sterbliche Glück war das meine!
Wieder hob ich den Kopf von seiner Brust, um die köstliche Freude zu schmecken und ihn an meiner Seite zu sehen – mein Leben, meine Liebe, mein Mann, mein Alles!
Noch war ich kaum aus den verzehrenden Erinnerungen an die Vergangenheit erwacht und in die süße Wirklichkeit der Gegenwart zurückgekehrt, da ließ ich meine Wange die seine berühren und flüsterte ihm leise zu: „Ach, wie ich dich liebe! Wie ich dich liebe!“
Im nächsten Augenblick fuhr ich von ihm zurück. Mir blieb fast das Herz stehen. Ich fasste mir ins Gesicht. Was war das da auf meiner Wange? Ich hatte nicht geweint – dazu war ich zu glücklich. Und was spürte ich auf meiner Wange? Eine Träne!
Er hatte das Gesicht immer noch von mir abgewandt. Eigenhändig und mit blanker Gewalt drehte ich es zu mir.
Ich sah ihn an – mein Ehemann hatte an unserem Hochzeitstag Tränen in den Augen!
Kapitel 3 Am Strand von Ramsgate
Es gelang Eustace, meinen Schrecken zu beruhigen. Aber dass es ihm gelungen wäre, auch mein Gemüt zufriedenzustellen, kann ich kaum behaupten.
Er sagte mir, er habe über den Gegensatz zwischen seiner Vergangenheit und seinem jetzigen Leben nachgedacht. In seinen Gedanken waren bittere Erinnerungen an vergangene Jahre hochgestiegen und hatten ihn mit schwermütigen Befürchtungen erfüllt, ob er wohl in der Lage sei, mir zusammen mit ihm ein glückliches Leben zu bieten. Er hatte sich gefragt, ob er mich nicht zu spät kennen gelernt hatte – ob er nicht durch die Enttäuschungen und Ernüchterungen der Vergangenheit schon zu verbittert und gebrochen sei. Solche Zweifel hatten immer stärker auf seiner Seele gelastet und ihm die Tränen in die Augen getrieben, die ich bemerkt hatte – und jetzt flehte er mich bei meiner Liebe zu ihm an, diese Tränen für alle Zeiten aus meiner Erinnerung zu tilgen.
Ich verzieh ihm, tröstete ihn, munterte ihn auf. Dennoch gab es Momente, in denen mich die Erinnerung an das, was ich gesehen hatte, insgeheim beunruhigte; in solchen Augenblicken fragte ich mich, ob ich das vollkommene Vertrauen meines Mannes ebenso besaß wie er das meine.
In Ramsgate stiegen wir aus dem Zug.
Der beliebte Badeort war leer; die Saison war gerade zu Ende. Zu unseren Plänen für die Hochzeitsreise gehörte auch eine Kreuzfahrt ins Mittelmeer mit einer Yacht, die Eustace von einem Freund geliehen hatte. Wir liebten beide das Meer, und angesichts der Umstände, unter denen wir geheiratet hatten, waren wir beide gleichermaßen erpicht darauf, der Aufmerksamkeit von Freunden und Bekannten zu entgehen. Wegen solcher Absichten hatten wir unsere Hochzeit in London im kleinen Kreis gefeiert und dem Kapitän der Yacht die Anweisung gegeben, sich in Ramsgate mit uns zu treffen. In diesem Ort (wo die Besuchersaison zu Ende war) konnten wir uns viel unbemerkter einschiffen als in den beliebten Yachthäfen auf der Isle of Wight.
Drei Tage vergingen – Tage der köstlichen Einsamkeit und des höchsten Glücks, die wir bis zum Ende unseres Lebens nie vergessen und nicht noch einmal durchleben würden.
Am vierten Tag ereignete sich frühmorgens, kurz vor Sonnenaufgang ein kleiner Zwischenfall, der dennoch bemerkenswert war, weil er mir so, wie ich mich selbst kannte, fremdartig erschien.
Ich erwachte plötzlich und unerklärlich aus einem tiefen, traumlosen Schlaf mit einem durchdringenden Gefühl des nervösen Unwohlseins, das ich noch nie zuvor empfunden hatte. In den alten Zeiten im Pfarrhaus war meine Fähigkeit, tief zu schlafen, der Gegenstand so manchen kleinen, harmlosen Scherzes gewesen. Von dem Augenblick an, in dem mein Kopf auf dem Kissen lag, hatte ich nie gewusst, was es heißt, wach zu sein, bis das Dienstmädchen an meine Tür klopfte. Zu allen Jahres- und Tageszeiten hatte ich mich der langen, ununterbrochenen Ruhe eines Kindes erfreut.
Und jetzt war ich Stunden vor der üblichen Zeit ohne erkennbaren Grund aufgewacht. Ich versuchte, mich zu fassen und wieder einzuschlafen. Es war vergebliche Mühe. Eine so große Unruhe ergriff von mir Besitz, dass ich nicht einmal fähig war, still im Bett zu liegen. Mein Mann schlief fest an meiner Seite. Aus Angst, ihn zu stören, stand ich auf und zog meinen Morgenmantel sowie die Hausschuhe an.
Ich ging zum Fenster. Über dem ruhigen grauen Meer stieg gerade die Sonne in die Höhe. Das majestätische Schauspiel übte eine Zeit lang eine beruhigende Wirkung auf den reizbaren Zustand meiner Nerven aus. Aber es dauerte nicht lange, dann kehrte die alte Unruhe wieder zurück. Langsam ging ich im Zimmer hin und her, bis ich der eintönigen Übung überdrüssig war. Ich nahm ein Buch zur Hand und legte es wieder beiseite. Meine Aufmerksamkeit schweifte ab, und der Schriftsteller konnte sie nicht zurückgewinnen. Wieder stand ich auf, sah Eustace an, bewunderte und liebte ihn in seinem ruhigen Schlaf. Erneut ging ich zum Fenster, aber der wunderschöne Morgen langweilte mich. Ich setzte mich vor den Spiegel und sah mich an. Wie hager und mitgenommen ich wirkte, nur weil ich vor der gewohnten Zeit wach geworden war! Ohne zu wissen, was ich jetzt tun sollte, erhob ich mich. Die Einengung durch die vier Wände des Zimmers erschien mir unerträglich. Ich öffnete die Tür, die ins Ankleidezimmer meines Mannes führte, und ging hinein. Würde der Wechsel mir Erleichterung bringen?
Der erste Gegenstand, der mir auffiel, war sein Reisenecessaire. Es lag offen auf dem Toilettentisch.
Ich nahm die Flaschen und Töpfchen, die Bürsten und Kämme heraus, die Messer und Scheren in dem einen Fach, das Schreibzeug im anderen. Ich roch an den Parfüms und Pomaden. Die Flaschen, die ich herausnahm, reinigte ich eifrig mit meinem Taschentuch. Nach und nach räumte ich das Reisenecessaire vollkommen leer. Es war mit blauem Samt ausgeschlagen. In einer Ecke bemerkte ich einen winzigen Streifen aus loser blauer Seide. Als ich es zwischen Zeigefinger und Daumen nahm und daran zog, stellte ich fest, dass das Necessaire einen doppelten Boden hatte, ein Geheimfach für Briefe und Papiere. In meinem seltsamen Zustand – launisch, gelangweilt, neugierig – war es mir ein Vergnügen, die Papiere genauso herauszunehmen wie alles andere.
Ich fand einige quittierte Rechnungen, die bei mir kein Interesse weckten. Dann etliche Briefe, die ich, wie ich nicht zu betonen brauche, beiseite legte, nachdem ich nur einen Blick auf die Adressen geworfen hatte. Und schließlich ganz unten eine Fotografie, die Bildseite nach unten und mit einer Beschriftung auf der Rückseite. Ich sah mir die Schrift an und las die Worte:
„Für meinen lieben Sohn Eustace.“
Seine Mutter! Die Frau, die sich so hartnäckig und unbarmherzig unserer Ehe widersetzt hatte!
Eifrig drehte ich das Foto um. Ich rechnete damit, eine Frau mit strengem, übellaunigem, abweisendem Gesichtsausdruck zu sehen. Zu meiner Überraschung zeigte das Bild aber die Reste großer Schönheit; der Ausdruck war zwar bemerkenswert energisch, aber auch gewinnend, zärtlich und freundlich. Die grauen Haare waren beiderseits des Kopfes zu Reihen kleiner, verschroben altmodischer Locken frisiert und lagen unter einer schlichten Spitzenhaube. An einem Mundwinkel trug ein Mal, wahrscheinlich ein Leberfleck, zu der charakteristischen Eigenartigkeit des Gesichts bei. Ich betrachtete das Porträt genau und prägte es mir gründlich ein. Diese Frau, die meine Angehörigen und mich fast beleidigt hatte, war, so weit der äußere Eindruck reichte, ohne jeden Zweifel ein Mensch von ungewöhnlicher Anziehungskraft – ein Mensch, den zu kennen eine Freude und ein Vorrecht wäre.
Ich verfiel in tiefes Nachdenken. Die Entdeckung der Fotografie beruhigte mich, wie noch nichts anderes mich beruhigt hatte.
Der Schlag einer Uhr im unteren Stockwerk machte mich darauf aufmerksam, wie die Zeit verflog. Sorgfältig legte ich alle Gegenstände genau so, wie ich sie vorgefunden hatte, wieder in das Reisenecessaire (wobei ich mit der Fotografie begann), und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Als ich meinen Mann ansah, der immer noch friedlich schlief, drängte sich eine Frage in meine Gedanken: Warum war diese warmherzige, sanfte Mutter so unerbittlich darauf aus gewesen, uns auseinander zu bringen? Warum tat sie so grob und mit so rücksichtsloser Entschlossenheit kund, dass sie unsere Ehe missbilligte?
Konnte ich diese Frage offen an Eustace richten, wenn er aufwachte? Nein; einen solchen Kurs einzuschlagen, wagte ich nicht. Es war zwischen uns eine stillschweigende Übereinkunft, dass wir nicht von seiner Mutter sprachen – und außerdem wäre er vielleicht verärgert, wenn er erführe, dass ich das Geheimfach seines Reisenecessaires geöffnet hatte.
An diesem Morgen erreichte uns nach dem Frühstück endlich eine Nachricht von der Yacht. Das Schiff war sicher im inneren Hafen vertäut, und der Kapitän wartete an Bord darauf, die Anweisungen meines Mannes entgegenzunehmen.
Eustace zögerte, ob er mich bitten sollte, ihn zur Yacht zu begleiten. Er würde das Inventar des Schiffes überprüfen und verschiedene Fragen entscheiden müssen. Für eine Frau war das nicht sonderlich interessant – es ging um Seekarten und Barometer, Proviant und Trinkwasser. Er fragte mich, ob ich warten wolle, bis er zurückkam. Es war ein verführerisch schöner Tag, und am Meer herrschte Ebbe. Ich sprach mich für einen Strandspaziergang aus; und die Vermieterin unserer Unterkunft, die zufällig gerade im Zimmer war, bot mir an, mich zu begleiten und sich um mich zu kümmern. Wir einigten uns darauf, dass wir so weit in Richtung Broadstairs gehen wollten, wie wir Lust hatten; Eustace würde uns folgen und am Strand treffen, sobald er seine Vorbereitungen auf der Yacht beendet hatte.
Eine halbe Stunde später waren die Vermieterin und ich am Meer.
Das Panorama war an diesem schönen Herbstmorgen nichts weniger als bezaubernd. Die kräftige Brise, der leuchtende Himmel, das glitzernde blaue Meer, die sonnenüberfluteten Klippen und der gelbe Sand zu ihren Füßen, die gleitende Prozession der Schiffe auf dem großartigen Seeweg des Ärmelkanals – alles war so beglückend, so köstlich, dass ich, wäre ich allein gewesen, wahrscheinlich vor Freude getanzt hätte wie ein Kind. Der einzige Wermutstropfen für mein Glück war die unermüdliche Zunge der Vermieterin. Sie war eine vorlaute, gutmütige, strohdumme Frau, die unablässig redete, ob ich zuhörte oder nicht. Sie hatte die Gewohnheit, mich ständig mit „Mrs. Woodville“ anzusprechen, was mir als Ausdruck der Gleichberechtigung zwischen Personen ihres und meines Standes ein wenig zu vertraulich erschien.
Wir waren nach meiner Schätzung bereits mehr als eine halbe Stunde unterwegs, als wir eine Dame überholten, die vor uns am Strand entlangging.
Gerade als wir an der Fremden vorüberkamen, holte sie ihr Taschentuch aus der Tasche und zog dabei unabsichtlich einen Brief mit heraus, der auf den Sand fiel, ohne dass sie es bemerkte. Ich stand dem Brief am nächsten, hob ihn auf und reichte ihn der Dame.
In dem Augenblick, in dem sie sich umdrehte und mir danken wollte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Sie war das Original zu dem fotografischen Porträt aus dem Reisenecessaire! Hier stand mir die Mutter meines Ehemannes von Angesicht zu Angesicht gegenüber! Ich erkannte die eigenartigen kleinen Locken, den sanften, warmherzigen Gesichtsausdruck, den Leberfleck am Mundwinkel. Ein Irrtum war ausgeschlossen. Es war seine Mutter!
Die alte Dame hielt meine Verwirrung natürlich fälschlich für Schüchternheit. Mit vollendetem Taktgefühl und voller Freundlichkeit begann sie ein Gespräch mit mir. Eine Minute später ging ich neben der Frau, die mich als Mitglied ihrer Familie so schroff zurückgewiesen hatte; ich muss eingestehen, dass ich mich entsetzlich fassungslos fühlte und nicht im Mindesten wusste, ob ich die Verantwortung auf mich nehmen sollte, ihr in Abwesenheit meines Mannes zu sagen, wer ich war.
Im nächsten Augenblick wurde die Frage von der vertraulichen Vermieterin entschieden, die auf der anderen Seite meiner Schwiegermutter ging. Ich hatte gerade gesagt, dass wir nach meiner Vermutung nahezu am Ende unseres Spazierganges angelangt sein müssten, nämlich dem kleinen Badeort Broadstairs. „Aber nein, Mrs. Woodville“, rief die unverwüstliche Frau, wobei sie mich wie üblich mit meinem Namen ansprach, „es ist keineswegs so nah wie Sie glauben!“
Mit klopfendem Herzen sah ich die alte Dame an.
Zu meiner unaussprechlichen Verblüffung zeigte ihr Gesicht nicht das geringste Anzeichen des Erkennens. Mrs. Woodville die Ältere sprach mit Mrs. Woodville der Jüngeren weiterhin so ruhig, als hätte sie ihren eigenen Namen noch nie zuvor in ihrem Leben gehört.
Mein Gesicht und mein Betragen müssen ein wenig von der Aufregung verraten haben, unter der ich litt. Als die alte Dame mich am Ende ihres nächsten Satzes zufällig ansah, zuckte sie zurück und sagte in ihrem freundlichen Ton:
„Ich fürchte, Sie haben sich überanstrengt. Sie sind ganz blass – Sie sehen erschöpft aus. Kommen Sie her und setzen Sie sich. Ich leihe Ihnen mein Riechfläschchen.“
Vollkommen hilflos folgte ich ihr zum Fuß der Klippe. Einige herabgefallene Stücke der Kreidefelsen boten uns eine Sitzgelegenheit. Undeutlich hörte ich, wie die redselige Vermieterin ihr Mitgefühl und Bedauern äußerte; ich nahm mechanisch das Riechfläschchen, das die Mutter meines Mannes mir anbot wie einen Akt der Freundlichkeit gegenüber einer Fremden, und das, obwohl sie meinen Namen gehört hatte.
Hätte ich nur an mich selbst denken müssen, ich glaube, ich hätte auf der Stelle eine Erklärung verlangt. Aber ich musste auch Rücksicht auf Eustace nehmen. Über das Verhältnis – freundlich oder feindselig – zwischen ihm und seiner Mutter wusste ich nicht das Geringste. Was konnte ich tun?
Währenddessen sprach die alte Dame immer noch voller taktvollem Mitgefühl mit mir. Sie sagte, sie sei ebenfalls müde. Sie habe eine anstrengende Nacht am Bett einer nahen Angehörigen verbracht, die sich in Ramsgate aufhielt. Erst am Vortage habe sie durch ein Telegramm erfahren, dass eine ihrer Schwestern schwer erkrankt sei. Sie selbst sei Gottseidank noch lebhaft und kräftig, und deshalb habe sie es für ihre Pflicht gehalten, sofort nach Ramsgate aufzubrechen. Gegen Morgen hatte sich der Zustand der Patientin verbessert. „Der Arzt versichert mir, Madam, dass keine unmittelbare Gefahr besteht; und da dachte ich, es würde mir nach der langen Nacht am Krankenbett gut tun, einen kleinen Spaziergang am Strand zu unternehmen.“
Ich hörte die Worte, verstand, was sie bedeuteten, war aber durch meine ungewöhnliche Lage immer noch zu verwirrt und eingeschüchtert, als dass ich die Unterhaltung hätte fortsetzen können. Die Vermieterin machte einen sinnvollen Vorschlag – sie war die nächste, die das Wort ergriff.
„Da kommt ein Gentleman“, sagte sie zu mir und zeigte in Richtung Ramsgate. „Sie können niemals den ganzen Weg zurückgehen. Sollen wir ihn bitten, von Broadstairs eine Kutsche zu der Lücke zwischen den Klippen zu schicken?“
Der Gentleman kam ein wenig näher.
Die Vermieterin und ich erkannten ihn im gleichen Augenblick. Es war Eustace – er kam, um sich mit uns zu treffen, wie wir es verabredet hatten. Die unverwüstliche Vermieterin verlieh ihren Gefühlen am freimütigsten Ausdruck. „Ach, Mrs. Woodville, ist das nicht ein Glück? Da kommt Mr. Woodville!“
Wieder sah ich meine Schwiegermutter an. Wieder hatte der Name auf sie nicht die geringste Wirkung. Sie konnte nicht so scharf sehen wie wir und hatte ihren Sohn noch nicht erkannt. Er aber hatte junge Augen und sah seine Mutter. Einen Augenblick lang blieb er stehen wie vom Donner gerührt. Dann kam er näher, das rötliche Gesicht bleich vor unterdrückten Gefühlen, den Blick starr auf seine Mutter gerichtet.
„Du hier!“, sagte er zu ihr.
„Wie geht es dir, Eustace?“, gab sie leise zurück. „Hast du auch von der Krankheit deiner Tante gehört? Wusstest du, dass sie in Ramsgate ist?“
Er gab keine Antwort. Die Vermieterin zog aus den Worten, die sie gerade gehört hatte, den unausweichlichen Schluss und blickte mit einem Ausdruck der Verblüffung von mir zu meiner Schwiegermutter; sogar ihre Zunge war gelähmt. Den Blick auf meinen Mann gerichtet, wartete ich, was er tun würde. Hätte er nur einen Augenblick gezögert, sich zu mir zu bekennen, der ganze zukünftige Verlauf meines Lebens hätte sich ändern können – ich hätte ihn verabscheut.
Er zögerte nicht. Er kam an meine Seite und nahm meine Hand.
„Weißt du, wer das ist?“, fragte er seine Mutter.
Sie antwortete, wobei sie mich mit einer höflichen Verneigung ihres Kopfes ansah:
„Eine Dame, die ich am Strand getroffen habe, Eustace. Sie hat freundlicherweise einen Brief aufgehoben, den ich verloren hatte. Ich glaube, ich habe den Namen gehört.“ Sie wandte sich zu der Vermieterin: „Mrs. Woodville, nicht wahr?“
Mein Mann schloss seine Finger unbewusst so fest um meine Hand, dass sein Griff mir Schmerzen bereitete. Es ist nur gerecht zu sagen, dass er seine Mutter ins Bild setzte, ohne auch nur einen Augenblick feige zu zögern.
„Mutter“, sage er in aller Ruhe zu ihr, „diese Dame ist meine Frau.“
Sie war bisher sitzen geblieben. Jetzt erhob sie sich langsam und sah ihren Sohn schweigend an. Der erste Ausdruck der Überraschung verschwand aus ihrem Gesicht. Stattdessen verriet ihr Blick jetzt die entsetzlichste Mischung aus Empörung und Verachtung, die ich jemals in den Augen einer Frau gesehen hatte.
„Deine Frau tut mir leid“, sagte sie.
Mit diesen Worten und ohne sonst noch etwas zu sagen, hob sie die Hand und bedeutete ihm, von ihr zurückzuweichen. Dann ging sie ihres Weges, wie wir sie zuerst gesehen hatten: allein.
Kapitel 4Auf dem Heimweg
Als wir wieder unter uns waren, herrschte einen Augenblick lang Schweigen. Als erster sprach Eustace.
„Kannst du zurück gehen?“, fragte er mich, „oder sollen wir weiter nach Broadstairs wandern und mit der Eisenbahn nach Ramsgate zurückfahren?“
Die Fragen stellte er, was sein Benehmen anging, so gefasst, als sei nichts Bemerkenswertes geschehen. Aber seine Blicke und Worte verrieten ihn. Sie sagten mir, dass er insgeheim litt. Die ungewöhnliche Szene, die gerade vorüber war, hatte mich keineswegs der letzten Reste meines Mutes beraubt, sondern meine Nerven aufgeputscht und meine Beherrschung wieder hergestellt. Ich wäre keine Frau gewesen, wenn meine Selbstachtung nicht verletzt und meine Neugier nicht in höchstem Maße gesteigert worden wäre, nachdem die Mutter meines Mannes sich so ungewöhnlich benommen hatte, als Eustace sie mit mir bekannt machte. Welches Geheimnis steckte dahinter, dass sie ihn verachtete und mich bemitleidete? Was war die Erklärung für ihre unbegreifliche Teilnahmslosigkeit, als mein Name zweimal in ihrer Hörweite genannt wurde? Warum hatte sie uns verlassen, als sei ihr der bloße Gedanke, in unserer Gesellschaft zu bleiben, ein Gräuel? Diese Rätsel zu durchschauen, war jetzt das vordringlichste Interesse meines Lebens. Gehen? Ich empfand eine so fiebrige Erwartung, dass ich glaubte, bis ans Ende der Welt gehen zu können, wenn ich nur meinen Mann an meiner Seite hätte und ihn unterwegs befragen könnte.
„Ich habe mich ganz gut erholt“, sagte ich. „Lass’ uns zurückgehen, wie wir gekommen sind: zu Fuß.“
Eustace sah die Vermieterin an. Sie verstand ihn.
„Ich möchte Ihnen meine Gesellschaft nicht aufdrängen“, sagte sie in scharfem Ton. „Ich habe in Broadstairs noch etwas zu erledigen, und nachdem ich dem Ort jetzt schon so nahe bin, kann ich ebenso gut weitergehen. Guten Morgen, Mrs. Woodville.“
Sie legte auf meinen Namen eine besondere Betonung und fügte noch einen vielsagenden Abschiedsblick hinzu, den ich (in meinem augenblicklichen, voreingenommenen Geisteszustand) überhaupt nicht verstand. Es war weder Zeit noch Gelegenheit, sie zu fragen, was sie damit meinte. Mit einer steifen kleinen Verbeugung in Eustaces Richtung verließ sie uns, wie seine Mutter uns verlassen hatte, und nahm mit schnellen Schritten den Weg nach Broadstairs.
Endlich waren wir allein.
Ohne Zeit zu verlieren, stellte ich meine ersten Fragen; ich vergeudete keine Worte mit einleitenden Floskeln, sondern formulierte ganz einfach, was ich wissen wollte:
„Was hat das Benehmen deiner Mutter zu bedeuten?“
Anstatt zu antworten, brach er in Gelächter aus – ein lautes, raues, hartes Gelächter; es war so völlig anders als alle Laute, die ich bisher von seinen Lippen gehört hatte, so seltsam und seinem Charakter, wie ich ihn verstand, so erschreckend fremd, dass ich immer noch auf dem Sand stand und ihm offene Vorhaltungen machte.
„Eustace! So kenne ich dich gar nicht“, sagte ich. „Du machst mir fast Angst.“
Er nahm keine Notiz von mir. Anscheinend verfolgte er einen eigenen Gedankengang, der ihm gerade in den Sinn gekommen war.
„Das war typisch für meine Mutter!“, rief er mit dem Auftreten eines Mannes, der durch irgendeine eigene, humorvolle Idee unwiderstehlich abgelenkt ist. „Erzähl’ mir davon, Valeria!“
„Dir etwas erzählen?“, gab ich zurück. „Nach allem, was geschehen ist, wäre es doch deine Pflicht, mich aufzuklären.“
„Du erkennst den Witz nicht“, sagte er.
„Ich erkenne nicht nur den Witz nicht“, erwiderte ich, „sondern ich sehe in der Sprache und dem Betragen deiner Mutter einige Dinge, die es rechtfertigen, dass ich dich um eine ernsthafte Erklärung bitte.“
„Meine liebe Valeria, wenn du meine Mutter so gut kennen würdest wie ich, wäre eine ernsthafte Erklärung für ihr Betragen das Letzte auf der Welt, was du von mir erwarten würdest. Die Idee, meine Mutter ernst zu nehmen!“ Er platzte wieder mit Lachen heraus. „Mein Liebling, du weißt gar nicht, wie du mich amüsierst!“
Es war alles gezwungen und unnatürlich. Er, der empfindsamste und feinsinnigste aller Männer – ein Gentleman im besten Sinn des Wortes – war auf einmal laut und grob und vulgär! Mein Mut sank unter einem plötzlichen Gefühl von Befürchtungen, die ich trotz aller Liebe zu ihm nicht abschütteln konnte. In unaussprechlicher Bekümmerung und Beunruhigung fragte ich mich: „Fängt mein Mann jetzt an, mich zu täuschen? Spielt er jetzt, da wir noch nicht eine Woche verheiratet sind, eine Rolle – und spielt er sie auch noch schlecht?“ Ich nahm mir vor, sein Vertrauen auf eine neue Art zu gewinnen. Er war offensichtlich entschlossen, mir seine eigene Sichtweise aufzuzwingen. Und ich war meinerseits entschlossen, seine Sichtweise hinzunehmen.
„Du sagst, ich würde deine Mutter nicht verstehen“, sagte ich sanft. „Wirst du mir helfen, damit ich sie verstehen kann?“
„Es ist nicht einfach, dir zu helfen, damit du eine Frau verstehst, die sich selbst nicht versteht“, antwortete er. „Aber ich will es versuchen. Der Schlüssel zum Charakter meiner armen Mutter liegt in einem einzigen Wort: Exzentrizität.“
Hätte er aus dem ganzen Wörterbuch das unpassendste Wort zur Beschreibung der Dame herausgesucht, der ich am Strand begegnet war, so wäre es dieses Wort gewesen: Exzentrizität. Selbst einem Kind, das gesehen und gehört hätte, was ich gesehen und gehört hatte, wäre nicht verborgen geblieben, dass er Schindluder mit der Wahrheit trieb – groben, rücksichtslosen Schindluder.
„Denke daran, was ich gesagt habe“, fuhr er fort. „Wenn du meine Mutter verstehen willst, tu’ das, worum ich dich vor einer Minute gebeten habe – erzähl’ mir davon. Wie kam es überhaupt dazu, dass du mit ihr gesprochen hast?“
„Das hat deine Mutter dir schon gesagt, Eustace. Ich ging hinter ihr, da ließ sie versehentlich einen Brief fallen….“
„Das war kein Versehen“, warf er ein. „Sie hat den Brief absichtlich fallen lassen.“
„Unmöglich!“, rief ich. „Warum sollte deine Mutter den Brief absichtlich fallen lassen?“
„Nutze den Schlüssel zu ihrem Charakter, mein Liebes. Exzentrizität! Das ist die wunderliche Art meiner Mutter, deine Bekanntschaft zu machen.“
„Meine Bekanntschaft machen? Ich habe dir gerade erzählt, dass ich hinter ihr ging. Sie kann nicht gewusst haben, dass ich überhaupt existiere, bevor ich sie angesprochen habe.“
„Das glaubst du, Valeria.“
„Da bin ich mir sicher!“
„Verzeih’ – du kennst meine Mutter nicht so gut wie ich.“
Allmählich verlor ich die Geduld mit ihm.
„Willst du mir damit sagen“, fragte ich, „dass deine Mutter heute gezielt zu dem Zweck, meine Bekanntschaft zu machen, an den Strand gegangen ist?“
„Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel“, erwiderte er kühl.
„Warum, sie hat doch nicht einmal meinen Namen erkannt!“, platzte ich heraus. „Zweimal hat die Vermieterin mich in Hörweite deiner Mutter mit Mrs. Woodville angesprochen, und zweimal, das versichere ich dir mit meinem Ehrenwort, hat es auf sie nicht den geringsten Eindruck gemacht. Sie hat mich angesehen und so getan, als hätte sie ihren eigenen Namen noch nie gehört.“
„‚So getan‘ ist das richtige Wort, sagte er genauso ruhig wie zuvor. „Frauen auf der Bühne sind nicht die einzigen, die so tun können, als ob. Meine Mutter hatte vor, dich gründlich kennenzulernen und dich zu überrumpeln, indem sie dich in der Rolle einer Fremden angesprochen hat. Genau das ist ihre Art: Sie schlägt einen solchen Umweg ein, um ihre Neugier über eine Schwiegertochter zu befriedigen, die sie ablehnt. Wäre ich nicht genau in diesem Augenblick zu euch gekommen, du wärest über dich und mich ausgefragt und ins Kreuzverhör genommen worden, und du hättest ganz arglos geantwortet, weil du geglaubt hättest, du würdest mit einer Zufallsbekanntschaft sprechen. Das ist meine Mutter, wie sie leibt und lebt! Denke daran: Sie ist nicht deine Freundin, sondern deine Feindin. Sie sucht nicht nach deinen Vorzügen, sondern nach deinen Fehlern. Und da fragst du, warum es auf sie keinen Eindruck gemacht hat, als sie hörte, wie du mit deinem Namen angesprochen wirst! Armer Unschuldsengel! Eines kann ich dir sagen: Du hast meine Mutter erst dann in ihrer eigenen Rolle kennen gelernt, als ich der Geheimnistuerei ein Ende gemacht und euch einander vorgestellt habe. Du hast gesehen, wie wütend sie war, und jetzt weißt du auch, warum.“
Ich ließ ihn reden, ohne ein Wort zu sagen. Schweren Herzens, mit einem niederschmetternden Gefühl der Entzauberung und Verzweiflung hörte ich zu. Der Gegenstand meiner Anbetung, der Gefährte, Führer, Beschützer meines Lebens – war er so tief gefallen? Konnte er sich zu so schamlosen Ausflüchten herablassen?
Steckte in allem, was er zu mir sagte, auch nur ein einziges wahres Wort? Ja! Hätte ich nicht das Porträt seiner Mutter gefunden, ich hätte nicht gewusst und nicht einmal ansatzweise vermutet, wer sie wirklich war. Aber davon abgesehen, war alles Lüge, ungeschickte Lüge; dabei sprach zumindest für ihn, dass er an Falschheit und Täuschung offenbar nicht gewöhnt war. Du liebe Güte! Wenn ich meinem Mann glauben sollte, müsste seine Mutter uns nach London, in die Kirche, zum Bahnhof und bis nach Ramsgate verfolgt haben! Zu behaupten, sie habe mich auf den ersten Blick als Eustaces Frau erkannt, am Strand gewartet und den Brief gezielt zu dem Zweck fallen lassen, meine Bekanntschaft zu machen, war das Gleiche wie die Behauptung, jeder dieser ungeheuerlichen Zufälle sei eine Tatsache, die sich tatsächlich zugetragen hatte!
Es hatte mir die Sprache verschlagen. Schweigend ging ich neben ihm und spürte dabei die entsetzliche Überzeugung, dass zwischen meinem Mann und mir ein Abgrund in Gestalt eines Familiengeheimnisses stand. Wenn nicht im Körper, so doch in der Seele waren wir nach einem Eheleben von knapp vier Tagen getrennt.
„Valeria“, fragte er, „hast du mir nichts zu sagen?“
„Nein, nichts.“
„Bis du mit meiner Erklärung nicht zufrieden?“
Als er diese Frage stellte, bemerkte ich in seiner Stimme ein leichtes Zittern. Zu ersten Mal, seit wir miteinander sprachen, konnte ich seinen Ton nach meiner Erfahrung mit einer bestimmten Stimmung in Verbindung bringen, die ich bei ihm bereits gut kennen gelernt hatte. Unter den hunderttausend rätselhaften Einflüssen, die ein Mann auf eine Frau ausübt, die ihn liebt, ist wohl kaum einer für sie so unwiderstehlich wie der Einfluss seiner Stimme. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die beim kleinsten Anlass Tränen vergießen – das liegt vermutlich nicht in meinem Temperament. Als ich aber diese kleine, natürliche Veränderung in seinem Tonfall hörte, wanderten meine Gedanken (ohne dass ich sagen könnte, warum) zurück zu jenem glücklichen Tag, an dem ich mir zum ersten Mal eingestanden hatte, dass ich ihn liebte. Ich fing an zu weinen.
Er blieb plötzlich stehen und nahm mich an der Hand. Dabei versuchte er, mir in die Augen zu sehen.
Ich hielt den Kopf gesenkt und den Blick zu Boden gerichtet. Ich schämte mich meiner Schwäche und meines Mangels an Mut. Deshalb war ich entschlossen, ihn nicht anzusehen.
In dem Schweigen, das nun folgte, fiel er plötzlich mit einem Schrei der Verzweiflung, der mich durchfuhr wie ein Messer, vor mir auf die Knie.
„Valeria! Ich bin niederträchtig – ich bin ein Lügner – ich bin deiner nicht wert. Glaube kein Wort von dem, was ich gesagt habe – es sind Lügen, Lügen, feige, verachtenswerte Lügen! Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe; du weißt nicht, wie ich gequält wurde. Ach, mein Liebling, versuche, mich nicht zu verachten! Ich muss von Sinnen gewesen sein, als ich so zu dir gesprochen habe. Du hast verletzt ausgesehen; du hast beleidigt ausgesehen; ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte dir sogar den Schmerz eines Augenblicks ersparen – ich wollte ihn vertuschen und nichts damit zu tun haben. Um Gottes Willen, bitte mich nicht, dir noch mehr zu sagen! Meine Geliebte! Mein Engel! Da ist etwas zwischen meiner Mutter und mir; es ist nichts, was dich beunruhigen müsste, und nichts, was heute noch jemanden etwas angeht. Ich liebe dich, ich bete dich an, mein ganzes Herz und meine Seele gehören dir. Gib dich damit zufrieden. Vergiss, was geschehen ist. Du sollst meine Mutter nie wiedersehen. Wir werden morgen von diesem Ort abreisen. Wir fahren mit der Yacht fort. Spielt es eine Rolle, wo wir leben, solange wir füreinander leben? Vergib und vergiss! Ach, Valeria, vergib und vergiss!“
Auf seinem Gesicht stand ein unsäglicher Kummer; unsäglicher Kummer lag in seiner Stimme. Denken wir daran. Und denken wir daran, dass ich ihn liebte.
„Zu vergeben, ist einfach“, sagte ich traurig. „Und um deinetwillen, Eustace, werde ich auch versuchen zu vergessen.“
Während ich das sagte, zog ich ihn sanft auf die Füße. Er küsste meine Hände mit dem Gestus eines Mannes, der demütig ist und es nicht wagt, seine Dankbarkeit auf vertraulichere Weise zum Ausdruck zu bringen. Als wir langsam weitergingen, herrschte zwischen uns ein so unerträgliches Gefühl der Peinlichkeit, dass ich in Gedanken sogar nach einem Gesprächsthema suchte, als wäre ich in Gesellschaft eines Fremden! Aus Barmherzigkeit zu ihm bat ich ihn, mir etwas über die Yacht zu erzählen.
Er stürzte sich auf das Thema wie ein Ertrinkender, der nach der rettenden Hand greift.