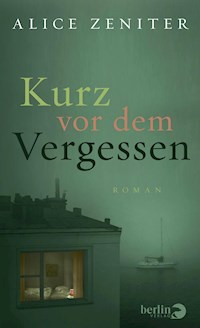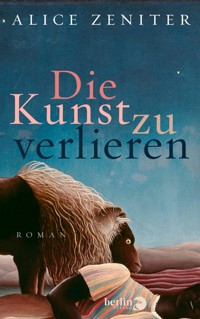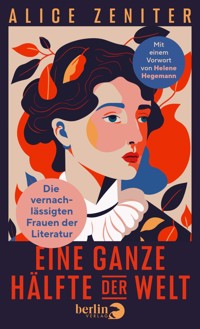
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Bevor Alice Zeniter Autorin wurde, war sie vor allem eins: Leserin. Und immer fehlten ihr bei der Lektüre Heldinnen, mit denen sie sich identifizieren konnte. Seit Simone de Beauvoir wird dieses Manko von Frauen wie Ruth Klüger oder Elke Heidenreich thematisiert. Alice Zeniter, Superstar der französischen Literaturszene, kommt mit ihrer brillanten Analyse zu verblüffenden Einsichten. Es geht um die Darstellung von Frauen in der Literatur, um weibliche Rezeption, aber auch um die Frage, wie man als Autorin den alten Mustern entkommen kann, ohne dabei zu ideologisieren oder zu langweilen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Französischen von Yvonne Eglinger
Mit einem Vorwort von Helene Hegemann
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds, der die vorliegende Übersetzung durch ein Arbeitsstipendium gefördert hat.
© Flammarion 2022
Titel der französischen Originalausgabe: »Toute une moitié du monde«, Flammarion, Paris 2022
© der deutschsprachige Ausgabe:
Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
Zitate
EINLEITUNG
EINE HÄLFTE DER WELT
AUTORIN SEIN
DIE POTENZPARADE
DEN ROMAN »AS USUAL« ÜBERWINDEN
LIEBEN, WEINEN ODER: EINE ROMANFIGUR SEIN
FORM UND CHAOS
EINE VERBINDUNG HERSTELLEN
MEIN PROBLEM MIT AVATAR
ZUM ENDE KOMMEN
DANK
Literatur- und Quellenverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Vorwort
Mit ihren Büchern hat Alice Zeniter am Selbstverständnis Frankreichs gerüttelt und versucht, diesem Frankreich die Identifikation mit etwas anderem zu ermöglichen als seiner verstaubten Idee von sich selbst. Ein Vorgang, der nicht nur ihrem Land ganz guttut. Sondern auch der Literaturgeschichte. Und dem Verhältnis eines jeden Lesenden zu seiner eigenen Wahrnehmung. Ihre Sprache und ihr Denken sind klar und schön und im wildesten Sinne emanzipiert. Ihre Romane sind das auch, sie basieren auf der Bestrebung, ihre Gesellschaft mit den viel zu leicht verdrängten, zu schmerzhaften, zu widersprüchlichen Geschichten ihrer kolonialen Vergangenheit zu konfrontieren, mit ihren Traumatisierungen, mit der knallharten Realität ihrer Marginalisierten. Zeniter will die traditionelle Erzählung einreißen. Zugunsten eines umfassenderen, wahrhaftigen Verständnisses für das, was wir als Identität bezeichnen.
Als ich für dieses Vorwort angefragt wurde, wusste ich kaum etwas über sie. Das Erste, was mir zu ihr einfiel, war, dass die Covergestaltung ihrer Romane im diametralen Kontrast zu deren Inhalt steht, sie offenbar wirklich noch immer als das verkauft werden sollen, was man abfällig zur »Frauenliteratur« degradiert. Ein Begriff, den sie bereits im ersten Kapitel von Eine ganze Hälfte der Welt so zielsicher und smart und allumfassend analysiert, umdeutet, zerfetzt, dass ich mich beim Lesen fühlte, als hätte mir da jemand ein Geschenk überreicht.
Ein Geschenk, von dem ich nicht wusste, dass ich es mir seit Jahren gewünscht hatte. Ein Buch über das Lesen, über das Schreiben, darüber, dass sich die Geschichten, die wir uns übereinander erzählen, weniger an unseren Leben orientieren, als es unsere Leben an diesen Geschichten tun. Eine Analyse dessen, warum sich im klassischen Verständnis des »Plots« eine Ungerechtigkeit breitgemacht hat, die fatale Konsequenzen für mein Leben, für Ihr Leben, für das Leben aller bedeutet, die keinen Platz im aggressiven und lange Zeit dominierenden weißen, männlichen, kolonialen, kapitalistischen Denken hatten, dem wir inzwischen beim Untergang zusehen können und dabei, wie es uns mit in seinen Abgrund zu reißen droht. Darüber, inwiefern dieses Denken der klassischen Narration zugrunde liegt, darüber, weshalb trotzdem immer wieder Nischen in diesem Denken entstanden sind, in denen es nachhaltig boykottiert werden konnte. Über die komplexe Beziehung zwischen Subjektivität und Politik und Erzählung. Und darüber, wie es sein kann, dass wir trotz der ganzen kritischen Aufarbeitung noch immer über antifeministische Plotpoints in Blockbustern jubeln, »wenn Motorräder davonbrausen, wenn ein Hubschrauber einen Zug durch einen Tunnel verfolgt, wenn ein Kuss den Sieg untermauert«.
Man kann dieses Buch als weibliche Kritik des Erzählens labeln. Als literaturwissenschaftlichen Essay darüber, warum manche Romane geschrieben wurden, um zweimal gelesen zu werden. Als klaren, tiefen Orientierungspunkt zwischen zu komplex und zu explosiv gewordenen Informationsprozessen. Man kann das Buch sogar als eine Art selbsttherapeutische Arbeit empfinden, mit der Alice Zeniter ihren Beruf als Schriftstellerin in einer Zeit zu verteidigen versucht, in der sich kaum noch jemand die Beständigkeit erlauben kann, die es braucht, um eine Geschichte zu Ende zu lesen; als eine Arbeit, die eine therapeutische Auswirkung hat auf jeden Menschen, der diese Beständigkeit trotzdem aufbringt und sich auf einen Text einlässt, von dem sich die Autorin wünscht, dass er sich »als Spaziergang benimmt«, der jeden plumpen Spannungsbogen aushebelt und genau deshalb unter Beweis stellt, dass es keine Hollywooddramaturgie braucht, um von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt zu bleiben.
Und gleichzeitig ist Eine ganze Hälfte der Welt eine Abarbeitung an den Büchern, die Zeniter liebt. Und die Sie als Lesender sofort bereit sein werden, auch zu lieben, selbst wenn es Anstrengung und Frustration bedeutet. Sie erinnert uns an die Sprengkraft, die Literatur haben kann, sobald sie die Transformation von Widersprüchen anstrebt und sich vorherrschendem Utilitarismus entzieht. Man kann dieses ganze schwer einzugrenzende, trotzdem glasklare Unterfangen der essayistischen Abwicklung ihrer eigenen Lesebiografie als einen Leitfaden begreifen, der das Lesen von Literatur wieder zu einem kontinuierlichen Dialog mit etwas Zeitlosem und Wiederkehrendem werden lässt. Das Buch lässt es uns als politischen Akt gegen die Konsumideologie begreifen, »jeder aufscheinenden Geschichte reichlich Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob diese innerhalb der Erzählung mit Blick auf die Gesamtökonomie des Werks von Nutzen ist«.
Eine ganze Hälfte der Welt befasst sich mit einer Suche, die jeder Mensch mit der Autorin teilt. Die Suche nach Harmonie mit anderen Körpern, mit der Natur, mit dem Tod, eine Suche, in der Literatur als eine Art dritte Ebene begriffen werden kann, die unseren inneren Rhythmus und die Beziehung zum uns Umgebenden in etwas Schönes und Greifbares verwandelt. In etwas, das wir verstehen und prozessieren, an dem wir innerlich wachsen können, um nicht mehr bloß äußerlich expandieren zu müssen.
Was die Welt gerade offensichtlich braucht, ist etwas, das sie der Logik und der Sprache der Finanzwirtschaft entgegenbringen kann. Was das sein kann, ahnt man, wenn man dieses Buch zu Ende gelesen hat: ein Paradigmenwechsel, der kreative und sinnliche Ansätze in den Vordergrund stellt. Oder einfacher: Poesie, Erzählungen, Geduld und aufrichtiges Begehren.
Helene Hegemann
Zitate
»Ich möchte wissen […] was eigentlich in einemBuch los ist, solang es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, die auf Papier gedruckt sind, aber trotzdem – irgendwas muss doch los sein, denn wenn ich es aufschlage, dann ist da auf einmal eine ganze Geschichte. Da sind Personen, die ich noch nicht kenne und es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe – und manchmal ereignen sich Meeresstürme, oder man kommt in fremde Länder und Städte. Das ist doch alles irgendwie drin im Buch. Man muss es lesen, damit man’s erlebt, das ist klar. Aber drin ist es schon vorher. Ich möchte wissen, wie?«
Michael Ende,Die unendliche Geschichte
»[…] man kommt um die Tatsache nicht herum, dass es der Taktik eines heimlichen Tyrannen entspricht, Wörter zu Papier zu bringen, eine Invasion, eine Methode ist, dem privatesten Raum der Leserinnen und Leser das Empfinden der Schriftstellerin aufzudrängen.«
Joan Didion,»Warum ich schreibe«
EINLEITUNG
Mit diesem Buch habe ich zu Beginn der Covid-19-Pandemie angefangen.[1] Studien mögen zeigen, dass die Menschen während des ersten Lockdowns mehr gelesen haben, ich für meinen Teil hatte über mehrere Wochen große Probleme damit. Ich konnte auch keine Filme mehr anschauen, oder jedenfalls nicht bis zum Schluss, oder aber ich schaute sie, ohne sie eigentlich zu sehen … Sicher, mein über den Haufen geworfener Alltag, die Verunsicherung, der Wunsch, minütlich die pandemischen Entwicklungen zu verfolgen, das Erlernen neuer Verhaltensweisen und der Entzug der eigenen Bewegungsfreiheit hätten als Erklärung meiner abdriftenden, gar mangelnden Aufmerksamkeit völlig ausgereicht, aber ich meinte, in dieser so außergewöhnlichen Zeit auch zu bemerken, dass etwas in meinem Verhältnis zu den Geschichten in die Brüche gegangen war – etwas, das die Jahre zuvor bereits bröcklig und spröde gemacht hatten, unterhöhlt von gewissen Fragen. Ich war nicht mehr sicher, ob ich noch etwas von ihnen wissen wollte, was sie mir zu bieten hatten, womit ich mich noch identifizieren konnte.
Hin- und hergeworfen fand ich mich plötzlich in einer Zeit wieder, die zerstückelt wurde von Bekanntmachungen des Präsidenten und der Regierung, von der Veröffentlichung wissenschaftlicher Studien, die nahezu täglich etwas über das neue Virus herausfanden, von Sechzig-Minuten-Einheiten, in denen es gestattet war, das Haus zu verlassen. Die Zeit war zerhackt, sie sprang wie das Bild alter Fernsehapparate und fing wieder bei null an, die Tage spielten sich alle vor der gleichen Kulisse ab, und die Zukunft schien zurückgedrängt oder per Erlass vertagt worden zu sein.
Die sich sorgfältig abspulende Chronologie, die mir von den meisten Geschichten angeboten wurde (A, dann B, dann C, dann die Auflösung), war mir mit einem Mal fremd geworden, da ich auch mir selbst mein Dasein nicht mehr erzählen konnte, nicht mehr die Einbildungskraft und Identifikation mit anderem aufbrachte, mir nicht länger zu sagen vermochte, »in zwei Wochen passiert das«.
Ich musste in jenem Frühjahr 2020 viel an meine Kindheit denken – an eine Zeit, als ich noch nicht über mich selbst bestimmen konnte, hin- und hergeworfen und zugleich in der Schwebe, an Lippen hängend, die ankündigten, was als Nächstes kommen würde, von hier nach dort verfrachtet, oftmals der Langeweile ausgeliefert.
Als Kind habe ich daher in Romanen begierig nach Geschichten gesucht, die eine Antithese meiner eigenen Erfahrung waren. Ich las Erzählungen von Helden und Erlösern, las von Abenteuern, Jagden, Eroberungen, Schatzsuchen, las Reiseberichte. Ich las vom absatzweise dargereichten Anderswo und fand es so stärkend wie einen Müsliriegel, und ich las verdichtete Handlung, bis all der Handlungsdruck einen Saft herauspresste, der mich schwindeln machte. Das war das genaue Gegenteil der Stunden, die ich in meinem farbenfrohen Kinderzimmer oder auf meinem Platz in der Schule zubrachte, im Musikunterricht oder im städtischen Schwimmbad, wo ich Bahn an Bahn reihte und die notwendigen Bewegungen zählte, um die fünfundzwanzig Meter von Beckenrand zu Beckenrand zu durchmessen.
In den Geschichten, die ich damals las, war alles nett und angenehm, weil auf gewisse Weise alles einfach war, selbst wenn tausend hinterhältige Feinde für Verwicklungen sorgten: Gab es ein Problem, dann handelten die Helden, seien es nun Musketiere, Ganoven, Polizisten, Piraten, Seemänner oder Hobbydetektive. Sie mussten nicht, wie ich, auf die Erlaubnis der Erwachsenen warten, und auch nicht auf ihre Volljährigkeit, ihre finanzielle Unabhängigkeit oder auf den Führerschein. Und wenn das Buch endete, war alles geregelt, ein paar waren tot, andere lebten, das Vorhaben war gescheitert oder geglückt, aber das ein für alle Mal.
Auch im Erwachsenenalter habe ich diese Genugtuung in vielen Geschichten wiedergefunden. Die Ermittlungen von Sherlock Holmes und die Folgen von Dr. House arbeiten mit genau demselben Versprechen, nach demselben Schema: Der Held macht sich auf, (unter-)sucht, tastet sich vor (es gibt unvorhergesehene Wendungen), er handelt sich unterwegs garantiert ein paar Schwierigkeiten ein (noch mehr unvorhergesehene Wendungen), doch am Ende findet er eine Lösung. Vielleicht ist es schon zu spät, dass alle unbeschadet aus der Sache herauskommen. Zu spät, um den Schuldigen festzunehmen oder den Patienten zu heilen. Aber irgendetwas wurde endgültig gelöst.
Im Frühjahr 2020 wusste ich nicht mehr, was ich mit diesen Geschichten anfangen sollte. Widerstreitende Wünsche hatten mich fest im Griff. Wie früher, wie in der Kindheit, war da der Wunsch, dem Helden auf seinen Abenteuern, in die er sich energisch stürzte, zu folgen, mich Figuren anzuschließen, die weder warten noch gehorchen mussten. Mit anderen Worten hegte ich den Wunsch, dass sich die Welt der Geschichten grundlegend von der Wirklichkeit unterscheiden sollte und dass man in dieser Welt wüsste, wie die Zukunft der Dinge oder Wesen aussähe (»in zwei Wochen passiert das«) und dass ich daraus Trost ziehen, mich den Zwängen entziehen könnte.
Doch zugleich regte sich in mir der gegenläufige Wunsch, Geschichten zu finden, die meinem machtlosen, schwebenden Zustand entsprachen, meinem Unverständnis angesichts der Ereignisse, der Zersplitterung aller Ursachen und Zusammenhänge, meiner/unserer Unfähigkeit, die Folgen vorherzusehen, und somit der Unfähigkeit, zu einem Ende, einer Lösung zu kommen … Geschichten zu finden, die mir nicht länger vorgaukeln würden, eine Handvoll Männer könne das Schicksal aller zum Guten oder Schlechten wenden.
Schon seit Jahren, ob lesend oder schreibend, hatte ich jene Geschichten nicht mehr mit derselben Leichtigkeit behandelt, derselben Freude, ich hatte einen Argwohn gegen sie entwickelt, der stetig wuchs. Der Frühling 2020 bewies mir nun, dass sie mir überholte Modelle anboten: Ich konnte nichts damit anfangen, ich konnte sie nicht mehr auf die Welt anwenden. Für sie wollte ich meine »Ungläubigkeit« nicht länger »aussetzen« (um den Ausdruck von Coleridge zu verwenden), denn am Ende würde ich mit leeren Händen dastehen.
Der Frühling ging zu Ende. Der erste Lockdown ebenso. Die Fragen aber, mit ihrem sauren Beigeschmack, sind geblieben. Einerseits will ich, dass die Fiktion mich der realen Welt entreißt, andererseits soll sie mir aber auch etwas über die Welt beibringen. Sind diese zwei Wünsche unvereinbar? Das ist, im Wesentlichen, das Thema dieses Buches.[2]
Nun, da ich ihm ein Geburtsdatum gegeben und die Gründe seiner Existenz umrissen habe, werde ich kurz über seine Existenzform sprechen, oder über seine Vorgehensweise. Über sein Benehmen als Buch vielleicht, denn es gibt wohlerzogene, artige Bücher ebenso wie ungehobelte, miese und punkige.
Dieses Buch ist das Buch einer Schriftstellerin, aber zweifellos und zuallererst das Buch einer Leserin. Es dreht sich ebenso um weit zurückliegende Lektüreerfahrungen wie um Bücher, die ich erst kürzlich aufgeschlagen und auf meinen Nachttisch gelegt habe. Der innere Zusammenhang der von mir behandelten Werke ergibt sich aus dem Umstand, dass ich sie gelesen habe und dass Fetzen, Schatten einzelner Sätze und Figuren sowie bruchstückhafte, ewig wiederkehrende Absätze daraus in mir nachwirken. Ich bin es, die diese so unterschiedlichen zitierten Bücher zu einer Einheit macht.
Betrachtet man das vorliegende Buch als Essay, wird es sich nicht besonders gut benehmen. Es wird sich hier und da widersetzen. Wird der ihm auferlegten Ernsthaftigkeit nicht gerecht werden. Betrachtet man es als Träumerei zur Literatur, wird seine Ernsthaftigkeit hingegen an manchen Stellen übertrieben wirken. Sagen wir also einfach, es ist ein Buch, und lassen es dabei bewenden.
EINE HÄLFTE DER WELT
Im Jahr 2010 war ich mit einem Engländer zusammen und las, so wie er, den Guardian – was mir unheimlich schick vorkam, zumal ich herausgefunden hatte, dass man das »u« nicht ausspricht, ein Detail, das mir unverhältnismäßige Befriedigung verschaffte. Aus dieser Zeitung erfuhr ich vom Bechdel-Test, und zwar aus einem Artikel über die Filmstarts am Thanksgiving-Wochenende – ein entscheidender Moment für neue Produktionen, da er den Anfang der fünf Wochen markiert, in denen viele Filme die weltweit höchsten Zuschauerzahlen verzeichnen. Allerdings, so informierte mich der Guardian, bestanden die meisten großen Hollywoodfilme diesen Test nicht, den ich bis dahin nicht gekannt hatte.
Vielleicht gilt das für Sie heute nicht mehr, aber ich werde ihn trotzdem kurz erläutern: Durch den Bechdel-Test (auch Bechdel-Wallace-Test genannt), der in den 1980er-Jahren in Alison Bechdels Comic The Essential Dykes to Watch Out For erschien, kann man sich das Fehlen beziehungsweise die mangelnde Repräsentation von Frauen im Reich der Geschichten vor Augen führen. Mit seinen nur drei Kriterien ist er erschreckend einfach anzuwenden:
In einem Werk müssen mindestens zwei Frauen vorkommen, die einen Namen tragen.
Diese Frauen reden miteinander.
Sie reden über etwas anderes als über einen Mann.
In den letzten Jahren wurde der Bechdel-Test vielfach abgewandelt, und eine seiner Varianten mag ich besonders, vorgebracht von der amerikanischen Drehbuchautorin Kelly Sue DeConnick: den sexy lamp test. Noch simpler als der Bechdel-Test stellt DeConnicks Version bloß eine einzige Frage: »Könnte man die weibliche Figur durch eine Lampe ersetzen, ohne dass es die Geschichte verändert?« Die Formulierung bringt mich sehr zum Lachen; die Tatsache, dass die Antwort bei so mancher zeitgenössischer Produktion »Ja« lautet, deutlich weniger.
Der Bechdel-Test (und einige seiner Abwandlungen) wird immer häufiger in Film- und Serienrezensionen angewendet, sehr viel seltener hingegen in der Literaturkritik, zumindest der französischen. Dabei könnte er ein krasses Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Figuren beim sogenannten literarischen Kanon aufdecken, also in den Büchern, die uns so häufig von Eltern, Lehrkräften, kultivierten Bekannten und Listen mit unbedingt lesenswerten Romanen aus einschlägigen Zeitschriften ans Herz gelegt werden – kurzum, eine Art gemeinsames kulturelles Fundament, das wertgeschätzt und von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Nach der Schule habe ich mich, wie so viele Studienanfänger, über mehrere Jahre auf das Aufnahmeverfahren der Elitehochschulen vorbereitet und mich daher lange Zeit innerhalb dieses Kanons bewegt.[3] Und anschließend beschäftigte ich mich zwei Jahre als Masterstudentin und drei Jahre als Doktorandin mit dem Theater, wodurch ich fünf Jahre lang nur wenig Romane las – sodass ich erst spät Gelegenheit hatte, mich ein wenig aus dem Joch dieses Kanons zu lösen, der einen beträchtlichen Teil meines Lebens als Leserin geprägt hat.
In Gesprächen und auf Tagungen wurde ich schon mehrmals gefragt, mit welcher berühmten weiblichen Figur der Literaturgeschichte ich mich identifiziere oder welche ich besonders mag. Das bringt mich jedes Mal ins Stottern. Denn wenn ich auf über zwanzig Jahre als Leserin zurückblicke, kommt mir nicht etwa ein Reigen liebenswerter Frauenfiguren in den Sinn, beeindruckend oder stark, aus denen ich wählen könnte.
Im Gegenteil, meine Erinnerung spult eine lange Reihe von Nebenfiguren ab, Objekte der Begierde männlicher Helden, oft passive Versatzstücke der Geschichte, die man entführen, einsperren, vergiften kann (manchmal alles hintereinander), eine Unzahl matter Gestalten, mit vor unerwiderter Liebe fahlem Teint, die sich die Nasen an Fensterscheiben platt drücken, hier und da ein paar weggesperrte Irre, Corneilles Prinzessinnen, die schlagartig an heftigstem Liebeskummer sterben, Racines Prinzessinnen, die sich umbringen, um der Schande eines skandalösen Begehrens zu entgehen, reife Frauen oder kleine Mädchen, die missbraucht und geschändet werden, und, wie sollte es anders sein, eine Fülle oftmals verlassener Ehefrauen, zwangsläufig ans Haus gebunden und auf traurige Weise untreu. Wie könnte ich behaupten, dass ich mich mit ihnen identifiziere? Oder dass ich diese Entführte jener Erhängten vorziehe?
Mit meiner Liste passiver Frauenfiguren will ich natürlich nicht die verantwortlichen Autoren für ihre Einfallslosigkeit tadeln. Sie, ebenso wie ihre Werke, sind Kinder ihrer Zeit, und sie können wenig dafür, dass Frauen – historisch gesehen auf die häusliche Sphäre beschränkt – ganz mehrheitlich ein Leben geführt haben, das »nonstoried« war, um den schwer übersetzbaren Begriff der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Kathryn Rabuzzi zu verwenden, also ein Leben, das nicht erzählt wurde und das darüber hinaus auch nicht leicht zu erzählen ist, das sich nicht in Form einer Geschichte anbietet.
Oder vielleicht betrachten wir, anders ausgedrückt, bloß das als Geschichte (als gute Geschichte), was überwiegend keine weiblichen Lebensweisen enthält, Leben, die in den vergangenen Jahrhunderten durch ihre mangelnde oder wenig ausgeprägte Handlungsfähigkeit gekennzeichnet waren – ein Begriff, den ich hier sowohl im Sinne von Handlungsmacht als auch als die Fähigkeit verstehe, sich selbst als Akteurin oder treibende Kraft im eigenen Ausschnitt der Welt zu begreifen.
So überlegt sich etwa die Erzählerin in Sans alcool, einer Kurzgeschichte der Schweizer Autorin Alice Rivaz aus den 1960er-Jahren, dass sie gern ein »großes Leben« gehabt hätte, doch als alte Jungfer, deren Eltern beide seit Kurzem verstorben sind, verfolgt sie kein anderes Ziel, als alle vegetarischen, keinen Alkohol ausschenkenden Restaurants ihrer Stadt auszuprobieren – die einzig schicklichen Orte, die eine alleinstehende Frau besuchen kann. Besorgt fragt sie sich, mit über vierzig Jahren, ob es Leben gibt, die »wie Vorlagen sind, Leben, die noch zu leben sind, sobald die letzte Seite umgeblättert ist. Und ich wäre nur ein Beispiel unter vielen?« Dieses nicht gelebte Leben, von dem sie jedoch fürchtet, es gelebt zu haben, vergleicht sie mit weißen Seiten, »und mit weiß meine ich: leer«. Hier gibt es keine Geschichten, nichts, aus dem man zusammengenommen ein Buch machen könnte.
Wie Susan S. Lanser am Anfang ihres Aufsatzes »Toward a Feminist Narratology« aus den Achtzigerjahren schreibt: »Die offensichtlichste Frage, die der Feminismus an die Narratologie stellen kann, lautet schlicht: Auf welchem Textkorpus, auf welchem Verständnis von Erzählung und Referenzrahmen gründen die Erkenntnisse der Narratologie?« Ihre Antwort ist klar: Narratologische Bemühungen haben bei der Erstellung eines Kanons oder beim Festlegen von Werkzeugen für die Textanalyse niemals die Geschlechterfrage berücksichtigt; »die Erzählungen, auf denen die Narratologie gründet, wurden entweder von Männern geschrieben oder so behandelt, als stammten sie von Männern«.
In der Tat erweist sich so manches Konzept als sehr beschränkt, um nicht zu sagen unbrauchbar, sobald man es auf einen breiteren Textkorpus anwendet, insbesondere die Idee des »Plots«. Dieser beruht auf einer Abfolge von Handlungen, die von den Protagonisten vorsätzlich ausgeführt werden und »somit eine Macht, ein Vermögen voraussetzen, die möglicherweise weit von dem entfernt sind, was Frauen in der Geschichte und in Texten erlebt haben, und vielleicht sogar fern von den Wünschen dieser Frauen«. Literaturkritiken, sogar feministische, sehen sich häufig gezwungen, Texte von Frauen mit dem Begriff »plotless« (also ohne Handlung) zu beschreiben und sich diesen Werken durch Verneinung zu nähern, sie durch das zu definieren, was sie nicht haben, nicht sind, ehe man sagen kann, was sie sind. Das ist sicher nicht der beste Weg, um Lust auf ihre Lektüre zu wecken …
Aber kehren wir zu der Frage zurück, die mich immer wieder in Verlegenheit bringt: Mit wem habe ich mich beim Lesen identifiziert? Bevor ich erwachsen wurde, stets mit männlichen Figuren: Ich war Bastian Balthasar Bux, nicht die Kindliche Kaiserin, ich war d’Artagnan, nicht Constance Bonacieux, ich war Jean Valjean und nicht Cosette – aus dem guten und einfachen Grund, dass die Kindliche Kaiserin in ihrem Elfenbeinturm gefangen ist, dass Constance Bonacieux ihre Zeit damit verbringt, sich entführen zu lassen, und dass Cosette die Misshandlungen der Thénardiers gegen die Aufsicht der Klosterschwestern tauscht, alles Konstellationen, die (in überspitzter Form) meine eigene kindliche Machtlosigkeit spiegelten, der ich durchs Lesen doch gerade zu entkommen versuchte.
Ich las gefangen in einem Zimmer, aus dem ich aufgrund meiner Kleinheit und Minderjährigkeit nicht herauskam, zumindest nicht sonderlich weit, und die Frauenfiguren, denen ich bei meinen Lektüren begegnete, waren selbst Gefangene, Einsiedlerinnen oder Spielbälle der Starken.[4] Zwangsläufig identifizierte ich mich mit dem anderen, dem handelnden Geschlecht, gegen das die vier Wände eines Zimmers oder einer Zelle scheinbar nichts ausrichten konnten.
Fast mein ganzes Leserinnenleben bin ich ein Mann gewesen. Zunächst mit großem Vergnügen und dann, vermutlich aus Überdruss, mit einer gewissen Genervtheit. Ich war daher sehr erfreut, als ich aus Der Lauf der Dinge von Simone de Beauvoirs Wut erfuhr, die sie bei der Lektüre von Wem die Stunde schlägt empfand. Obwohl ich den Roman sehr mag, verstand ich sofort ihren Abscheu angesichts des Einverständnisses, »das Hemingway an jedem Wendepunkt seiner Erzählungen für gegeben hält« und das voraussetzt, »dass wir das Gefühl haben, genauso wie er arischer Herkunft, männlichen Geschlechts, reich an Geld und Zeit zu sein, und dass wir unseren Körper nie anders als unter dem Aspekt der Sexualität und des Todes auf die Probe gestellt haben«. Und dieses Einverständnis zeigt nur zu deutlich, an wen er sich in seinem Schreiben wendet, welche Leserschaft er sich wünscht. »Ein großer Herr wendet sich an große Herren. Die Schlichtheit des Stils kann täuschen, aber es ist kein Zufall, dass die Rechte ihn über den Klee gelobt hat, denn er hat die Welt der Privilegierten geschildert und verherrlicht«, schreibt Beauvoir.
Heute frage ich mich, ob die Jungen, die mit mir groß geworden sind, ähnliche Erfahrungen machen durften: Konnten sie sich dank einer Geschichte, wenigstens ein einziges Mal, mit einem Mädchen oder einer Frau identifizieren? Da bin ich skeptisch (und würde mit Begeisterung von Kindheitserfahrungen hören, die mich widerlegen), ganz einfach, weil sie es nicht nötig hatten; ihnen stand ein riesiger Textfundus zur Verfügung, der es ihnen erlaubte, sich an männlichen Figuren zu orientieren.
Ein irischer Freund, der als Kind eine reine Jungenschule besuchte, erzählte mir vor einigen Jahren, wie fassungslos seine Klasse reagiert hatte, als ihr Lehrer von ihnen verlangte, Jane Austens Stolz und Vorurteil zu lesen. Das musste ein Witz sein oder aber der Wunsch, sie zu demütigen, denn warum sollte man sie sonst zwingen, sich mit solchem Mädchenkram zu beschäftigen?
In »Sortir les lesbiennes du placard«, einer Radiodokumentation von Clémence Allezard, erklärt die Regisseurin Céline Sciamma, Männer absichtlich außen vor, im Off zu lassen, weil das den männlichen Zuschauern die Möglichkeit gebe, sich mit den dargestellten Frauenfiguren zu identifizieren. Was auf den ersten Blick ausgrenzend wirken könne, sei in Wahrheit der einzige Weg, Männer miteinzubeziehen. Da sie es kaum gewohnt seien, in einem fiktionalen Werk von einem Geschlecht ins andere zu wechseln, würden sie sich unwillkürlich in die männlichen Figuren hineinversetzen, und man müsse diese verschwinden lassen, damit Zuschauer erleben könnten, was Zuschauerinnen und Leserinnen schon immer praktizierten: eine vom Geschlecht losgelöste Identifizierung.
Doch manchmal, wenn ich in meinen Schubladen mit Frauenfiguren krame, kommt mir Denise Baudu aus Zolas Das Paradies der Damen unter, und ich spreche über sie, über ihr nächtelanges Nähen nach den zehrenden Arbeitstagen, um ihrer Verkäuferinnenuniform ein schmeichelnderes, eleganteres Aussehen zu geben und so dem Spott ihrer Pariser Kolleginnen zu entgehen, die in ihr bloß einen hässlichen, ungehobelten Bauerntrampel sehen. Mit ihrem beschwerlichen Start in der Hauptstadt und den vielen zusätzlichen Arbeitsstunden zur Aneignung gewisser Codes, die alle anderen bereits mühelos zu beherrschen scheinen, kann ich mich identifizieren.