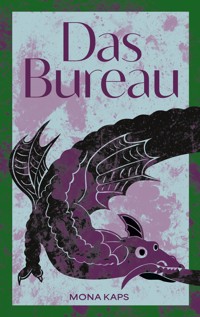Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Varieté voller spezieller Reize, ein leckgeschlagenes Dach, ein heiratswütiger Schweinebaron, ein epischer Rosenkrieg, verfluchte Dreharbeiten, ein fliegendes Musenross, wohlmeinende Sabotageakte, brachiale Einmischungen, und dann gibt es da auch noch die Goldenen Regeln der Madame, die keinesfalls übertreten werden dürfen. Es ist ganz bestimmt nicht Liebe auf den ersten Blick, als Rosi, die Katzenfrau aus dem Kabinett der Wunder, hinter den Kulissen ihrer Wirkungsstätte auf den Filmstar Fabian Fein trifft. Im Gegenteil. Schließlich schläft er nicht nur ohne Vorwarnung auf ihr ein, sondern ruiniert dabei obendrein ihr neues Kostüm. Und obwohl Rosi mit all den haselnussbraunen Haaren auf Kopf und Körper so gar nicht seinem Beuteschema entspricht, findet sie sich rasch in einer geschäftlichen Beziehung mit ihm wieder. Denn der chronisch schlaflose Fabian will das Schlummerwunder, das er in ihren haarigen Armen entdeckt hat, zurück. Ein modernes Märchen für alle, die schon immer einen Jane-Austen-Roman aus der Feder von John Irving oder Pretty Woman in der Verfilmung von Wes Anderson sehen wollten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mona Kaps wurde im vorigen Jahrhundert in einer beschaulichen Kleinstadt geboren, wo sie nicht nur ihre Schulkarriere absolvierte, sondern sehr zum Verdruss ihrer Anverwandten jeden, der zuhören mochte, mit Histörchen rund um ihre Familie unterhielt. Weil sie dachte, dass es vernünftig wäre, quälte sie sich an einer alten Universität zunächst zweieinhalb Jahre mit pharmazeutischen Belangen herum, um sich zuletzt doch noch der brotlosen Kunst in Form eines Literaturstudiums zu widmen. Wie von ihrer Mutter prophezeit, wurde darum nichts Vernünftiges aus ihr.
INHALT
Halloween im Kabinett der Wunder
Sonderwünsche
Die Sintflut
Der Überraschungsbesuch
(eins und zwei)
Kaffeeklatsch im Jandel
Fabians Rosenkrieg
Zum Tee bei der Hautevolee
Nackte Tatsachen
Grenzerfahrungen und Gewissensbisse
Freakshow im Imperial
Die Spendengala
Ein Anruf aus der Schweiz
Keine Stille Nacht
Windbeutel und Strohhalme
Keilende Katzen im Tanzenden Keiler
Luftveränderung
Die Rache der Sira Rogall
Brachiale Kalamitäten
Der Bart der Pharaonin
Vom Schlag getroffen
Billard bei Apollo
Geschiedene Leute
Ein Kleid für die Dolhopf
Vom Stänglein gefallen
Der große Auftritt
Der Antrag
An der Elephantenbar
Sündige Sexabenteuer
Wirbel um Rosi
Aufbruch in neue Gefilde
Eine Hochzeit
Ein Todesfall
Halloween im Kabinett der Wunder
Nichts wies darauf hin, dass sich hinter der massiven Eichentüre der Eratogasse Nummer Dreizehn ein wohlgehütetes Geheimnis verbarg. Allenfalls die Klingel aus Eisen, deren Knopf der Nabel einer tanzenden nackten Frau war, mochte einen Hinweis darauf geben. Doch weil sich ebenjene Eichentüre nur an einigen wenigen Nächten im Monat und dann ausschließlich für Eingeweihte öffnete, blieb das Kabinett der Wunder für alle anderen ein obskures Gerücht. Es existierte nämlich keine Webseite, auf der man seine Neugierde hätte stillen können. Das Kabinett schaltete keine Anzeigen in den Zeitungen und plakatierte keine Litfaßsäulen. Allein auf Karten aus seidigem, perlmuttschimmerndem Papier, die von denen, die glücklich genug waren, sie zu ergattern, wie ein Schatz gehütet wurden, kündeten verheißungsvolle Worte in geschwungener Schrift von den speziellen Reizen, die in diesem speziellen Varieté feilgeboten wurden. Und die Reize waren wirklich sehr speziell. Denn die Damen, die dort auftraten und die man auch als Begleitung buchen konnte, waren sehr lang oder sehr kurz gewachsen, sie hatten einen Buckel oder konnten sich verrenken wie Schlangen, ihnen fehlten Arme und Beine oder sie hatten eine Brust zuviel. Ihre Haut war weiß wie Elfenbein oder von Feuermalen gezeichnet. Sie konnten sehr dick sein oder sehr dünn.
Wie immer war Rosemarie Märzenbacher die Letzte in der Garderobe. Doch statt endlich zu den anderen hinunter in den Roten Saal zu gehen, drehte sie sich vor dem Spiegel. Rosi war sehr angetan von dem, was sie darin sah. Sie trug das funkelnagelneue schwarze Samtkleid, das sie sich nach einer Idee von Madame auf den Leib geschneidert hatte. Der Ausschnitt endete oberhalb ihres Nabels und war mit getigertem Katzenfell besetzt. Das Katzenfell – es war echtes Katzenfell, es hatte unbedingt echtes Katzenfell sein müssen, denn Kunstpelz war nicht weich genug und Kaninchenfell wäre nun wirklich zu gewöhnlich gewesen – harmonierte erstaunlich gut mit Rosis haselnussbrauner Lockenmähne und vor allem mit ihrem eigenen Pelz.
Rosi war die Katzenfrau. Von der Stirn bis zu den Zehenspitzen umhüllte sie ein hauchzarter Haarflaum. An Armen und Beinen, den Schultern und im Gesicht war er goldblond und nur dann zu erkennen, wenn das Licht in einem besonderen Winkel auf sie fiel. Auf ihrem Bauch und ihren Brüsten, den Innenseiten ihrer Oberschenkel und auch am Rücken wucherten die Haare allerdings kräftig haselnussbraun und waren zum Teil fast fingerlang. Und wenn sie wie jetzt (und wie einige Gäste später in dieser Nacht) darüberstrich, so konnte sie nicht unterscheiden, wo ihr Pelz endete und das Katzenfell begann. Rosi rückte die Kette mit der Münze zurecht, die zwischen ihren Brüsten baumelte.
Von unten aus dem roten Saal erklang das goldlackierte Klavier und Rosi riss sich endlich los. Sie hatte zwar Anna Armlos schon hundertmal gesehen, aber es war immer eine Schau, wenn sie auf einem Barhocker balancierte und ihre Zehen über die Tasten tanzen ließ. Rosi griff nach den Katzenohren, die sie extra für die heutige Halloweenfeier aus den Fellresten genäht hatte, und steckte sie in ihre Locken. Sie warf einen letzten zufriedenen Blick in den Spiegel und sprang zur Türe hinaus. Kaum an der Treppe angelangt, blieb sie jedoch wie angewurzelt stehen. Denn genau auf dem Treppenabsatz unter ihr taumelte jemand in einem maßgeschneiderten Zweiteiler gegen die Wand und hockte sich umständlich auf die Stufen.
»Was treiben Sie denn hier?«, fragte sie und stakste zu ihm. Die Gäste hatten hinter den Kulissen nichts verloren und sie fragte sich, wie dieser Herr überhaupt die verborgene Tapetentüre gefunden hatte. Hui, sah der miserabel aus. Kalkweiß. Eine Fahne hatte er nicht. Vielleicht Drogen? Sie mochte nicht wissen, welche Seuche der ausbrütete. Immerhin klappte er sein linkes Auge auf und Rosi musste unwillkürlich an einen Uhu denken.
»Ich bin nur müde.«
Und als wollte er das bestätigen, gähnte er und klappte das Auge wieder zu.
Rosi fand, dass er trotzdem verdächtig schief auf der Stufe hockte. »Fehlt Ihnen etwas? Brauchen Sie einen Krankenwagen?«
»Keinen Krankenwagen.«
»Sie können nicht hier sitzen bleiben.«
Unvermittelt klappte der Uhu nun beide Augen auf und ihm gelang ein böses, eisblaues Starren. »Ist es zu viel verlangt, mich einfach ein paar Momente in Frieden sitzen zu lassen? Ohne Ihr Geplapper? Davon hatte ich heute Abend, weiß der Himmel, schon genug.«
Madame sagte immer, eine erstklassige Gesellschaftsdame lässt sich von übler Laune nicht beeindrucken, sie ist höflich und munter, egal wie unhöflich oder respektlos der Kunde sie behandelt. Und Rosis Mutter predigte schon solange sie denken konnte, dass eine wohlerzogene Dame nicht laut wird, sondern in jeder Lebenslage die Contenance bewahrt. Rosi zählte also langsam bis zehn.
»Will sich der aufgeplusterte Uhu vielleicht kurz hinlegen?«, fauchte sie dann doch.
Der aufgeplusterte Uhu äugte langsam. Sein Blick blieb an den Katzenohren hängen, die in ihren Locken steckten. Es zuckte um seine Mundwinkel. »Sie sind die Katzenfrau.«
»Ja. Ich bin die Katzenfrau. Hoch mit Ihnen. Ich weiß einen besseren Platz für Sie.«
Den gab es tatsächlich. Er würde sich dort hinlegen und nichts anstellen können und Rosi könnte in aller Ruhe Madame alarmieren, damit die entschied, was mit dem müden Krieger passieren sollte. Oben im ersten Stock, neben Madames Büro, lag ein Raum, den Madame »das Séparée« und alle anderen hinter vorgehaltener Hand »Rosis Rumpelkammer« nannten. Er war teilweise noch so eingerichtet wie damals, als Madames Großmutter das Regiment über die Eratogasse Dreizehn übernommen hatte. Das Haus war zu diesem Zeitpunkt ein Bordell gewesen, in dem sich Künstler und Mäzene, Intellektuelle und Stadtväter, Schreiberlinge, Banker und Geschäftsleute, Kaufmänner und wahrscheinlich auch Schweinehändler aufs Angenehmste die Zeit vertrieben hatten. Und genauso sah das Séparée auch aus. Es gab dort ein altes Eisenbett, schwere, dunkelrote Samtvorhänge und eine abenteuerliche Tapete mit Brokatmuster. An einer Stange hingen in Kleidersäcken ausgediente Kostüme, es lagen zerbrochene Requisiten herum und am Fenster standen unter einer schwenkbaren Stehlampe ein Stuhl und ein gewaltiger Küchentisch mit einer Nähmaschine, diversen Nähutensilien und Katzenfellresten darauf.
Es war ein hartes Stück Arbeit, den Uhu dorthin zu befördern. Zwar hatte Rosi wohlweislich die Stöckelschuhe auf der Treppe zurückgelassen, um nicht umzuknicken, aber da er vor allem mit Gähnen beschäftigt war, brachte er es fertig, mehr als einmal auf ihre bloßen Füße zu trampeln und dermaßen ungeschickt über die Stufen zu stolpern, dass sie zwar nicht die Treppe hinunterpurzelten, Rosi aber mit dem Ellenbogen gegen die Wand schrammte. Der endgültige Untergang waren schließlich die ausgetretenen Orientteppiche, die irgendwann einmal aus dem ganzen Haus zusammengetragen und kreuz und quer im Séparée ausgelegt worden waren. An einem davon blieb der Uhu hängen und kam ins Schleudern. Rosi krachte bäuchlings auf das Bett, worüber sie im ersten Moment froh war. Dann fiel der Uhu ungebremst auf sie und Rosi sah Sterne.
»Können Sie nicht aufpassen? Sie haben mir das Kreuz gebrochen«, schimpfte sie, als sie wieder Luft bekam. Sie zappelte und trat und schaffte es immerhin, sich auf den Rücken zu drehen. Der Uhu seufzte nur. Er steckte mit seiner Nase direkt in ihrem Ausschnitt und damit verließ ihn jeglicher Ehrgeiz, in die Höhe zu kommen. »Sie fusseln ja«, murmelte er anstelle einer Entschuldigung und dann regte er sich nicht mehr.
»Runter von mir! Ich bekomme keine Luft!«
Rosi rüttelte an seiner Schulter. Zuerst dachte sie, dass ihn ein Schlaganfall oder Herzinfarkt niedergestreckt hatte. Aber nein, er schnaufte noch, und so entspannt, wie er das tat, bestand bald kein Zweifel mehr, dass er eingeschlafen war. Rosi verkniff sich einen Schweinehändlerfluch. Stattdessen zerrte sie an seinen Haaren, hielt ihm die Nase zu, kniff in sein Ohrläppchen und haute, so fest sie sich das bei einem Gast traute, mit den Fäusten auf seinen Rücken. Nichts. Der Uhu rührte sich nicht. Zu guter Letzt schrie sie Zetermordio. Aber unten im Roten Saal, wo die Halloweenfeier in vollem Gange war, hörte sie freilich niemand und der Uhu ließ sich davon ebenfalls nicht stören.
Als sie merkte, dass ihre Beine allmählich taub wurden, wurde sie panisch und versuchte ein letztes Mal, sich unter ihm hervorzuwinden. Alles, was sie damit bewerkstelligte, war ein Knacken der Rückennaht ihres Kleids. Nun stieß Rosi doch den Schweinehändlerfluch aus. Sie saß – oder besser lag – in der Patsche. Halloween im Kabinett war ein besonderer Abend für besonders geneigte Gönner und Stammkunden, denn statt zum normalen Betrieb waren sie zu einem rauschenden Fest geladen. Was aber auch bedeutete, dass keine von Rosis Kolleginnen so schnell in den ersten Stock käme, um sich umzuziehen. Man würde sie frühestens finden, wenn das Fest vorbei war und das würde – wie sie das Krakeelen von unten einschätzte – noch einige Stunden dauern. Rosi bezweifelte, dass der Uhu vorher wach wurde. Sie linste wütend zu ihm. Sein Gesicht kam ihr verdächtig bekannt vor, obwohl sie sich fast sicher war, ihn im Kabinett noch nie gesehen zu haben. Er war ganz bestimmt kein besonders geneigter Gönner. Sie betastete sein Jackett. Tuch aus Rosshaar. Schmaler Schnitt. Ziernähte. Rosi tippte auf Mattenklott, den besten Herrenausstatter der Stadt. Außerdem grübelte sie, ob man zu dieser späten Stunde und zu dieser vorgerückten Jahreszeit überhaupt einen so umbrabraunen Anzug tragen durfte. Oder die cognacfarbenen Brogues. Ihre Mutter hätte darüber vermutlich die Stirn gerunzelt. Darüber und, dass der Träger des Anzugs ausgerechnet ins Kabinett der Wunder geraten war.
Es wäre ungerecht zu behaupten, dass niemandem im Roten Saal auffiel, dass Rosi fehlte. Einige der besonders geneigten Gönner fragten natürlich nach ihr. Lola suchte sie, weil sie ihr eine Lästerei von Fanni mit den Feuermalen erzählen musste, und Madame hatte ein ungutes Gefühl. Ihre mit Strasssteinen besetzte Augenklappe juckte und das tat die eigentlich nur, wenn etwas im Busch war. Aber am Ende waren sie doch alle viel zu sehr von den Gästen und deren Wohlbefinden in Beschlag genommen, als dass sich irgendeine der Damen ernsthafte Gedanken gemacht hätte. Selbst Madame verdrängte irgendwann das ungute Gefühl und das Jucken unter der Augenklappe.
Allerdings traf sie beides wieder mit voller Wucht, sobald der letzte Gast gegangen und bis auf Lola alle Damen ausgeflogen waren. Sie stieg in den ersten Stock. Als Erstes stachen ihr auf dem Treppenabsatz Rosis Stöckelschuhe ins Auge, die dort verborgen im Schatten der Stufen schmollten. In der Garderobe fand sie schließlich Lola, die halb umgezogen und reichlich angeschickert inmitten der unaufgeräumten Kostüme saß und ihr kichernd mitteilte, dass die Besitzerin der Stöckelschuhe verschollen war.
»Hast du schon in allen Zimmern nachgesehen?«, fragte Madame.
Lola schüttelte den Kopf. Ihr blieb das Kichern im Halse stecken und sie schaute plötzlich ganz danach aus, als wollte sie in Tränen ausbrechen. »Vielleicht wurde sie entführt oder umgebracht«, hauchte sie.
Madame seufzte. »Unsinn. Schau, ihre Handtasche und ihre Kleider sind noch hier. Sie ist bestimmt im Haus.«
Mit Lola auf den Fersen machte sich Madame auf die Suche und schaute zielsicher zuerst im Séparée nach, denn das war immer der erste Ort im Kabinett, an dem sie Rosi suchen würde.
»Was zum Henker …?«, murmelte sie, als sie durch die angelehnte Tür lugte.
Weil der Uhu sie in aller Stille erdrückte und nicht auch noch schnarchte dabei, war Rosi tatsächlich selbst ein wenig eingeschlummert und hatte so das Ende der Halloweenfeier und das damit einhergehende Gegacker glatt verpasst. Lolas Freudenschrei dagegen weckte sie sofort. Als Rosi Madame und ihre Freundin auf der Türschwelle sah, fiel ihr zwar nicht der Uhu, aber doch wenigstens ein tonnenschwerer Stein vom Herzen. »Hurra!«
»Warum hast du nicht gerufen?«, fragte Madame und war in drei Schritten am Bett.
»Das habe ich ja. Ihr habt mich nicht gehört. Der hätte mich abmurksen können und ihr hättet es nicht gemerkt.«
»Ist er tot?«, fragte Lola und fing wieder zu kichern an.
Nein, das war der Uhu nicht. An seinem komatösen Tiefschlaf hatte sich allerdings ebenfalls nichts geändert und auch Madame scheiterte mit sämtlichen Versuchen, ihn aufzuwecken.
»Den wird heute keiner mehr vermissen. Lassen wir ihn schlafen. Ich glaube, er hat es nötig.«
Mit vereinten Kräften versuchten sie nun, den Uhu von Rosi herunter-, beziehungsweise Rosi unter ihm hervorzuzerren. Lola war aufgrund ihres Buckels keine rechte Hilfe und sie kippte bald hysterisch lachend auf den Orientteppich, den Verursacher allen Übels. Alles, was die Damen darum zustande brachten, war, ihn so zu drapieren, dass wenigstens wieder Blut in Rosis Beine floss, denn je mehr sie an ihm schoben, drückten und rissen, umso mehr klammerte er sich mit beiden Armen an Rosi fest. Madame streifte die Augenklappe ab, die sie ohnehin nur zu Ehren ihrer Großmutter und der Atmosphäre wegen trug.
»Tut mir leid, Zuckerstück. Ich fürchte, du musst hierbleiben.«
»Das kannst du nicht machen! Der zerquetscht mich.«
»Denk an das Geld, das wir ihm morgen früh für diese Eskapade abrechnen.«
»Das ist mir gerade kein Trost.«
Doch Madame zog ihm bereits die Schuhe aus und ließ sich auch sonst durch weiteres Jammern und Wehklagen nicht erweichen. Unbarmherzig scheuchte sie Lola in die Garderobe, um Rosis Handy zu holen, und legte es griffbereit neben sie aufs Bett, damit sie bei ihr in der Wohnung im zweiten Stock anrufen konnte, falls ein Notfall eintrat. Etwa, wenn sich der Uhu verdünnisieren wollte, ohne zu zahlen. Anschließend verfrachtete Madame Lola, deren Lachanfall sich mittlerweile in einen Schluckauf verwandelt hatte, in ein Taxi. Auf ihrem Weg zurück nach oben schaute sie noch einmal im Séparée vorbei und wünschte eine angenehme Nachtruhe. Rosi streckte ihr ganz undamenhaft die Zunge heraus.
Als Madame am nächsten Vormittag nach dem Rechten sah, fand sie die Szenerie nahezu unverändert. Sie setzte sich an die Bettkante und stellte die Tasse Kaffee, die sie Rosi mitgebracht hatte, auf die Truhe daneben. Da es ihr erfolgversprechender erschien, weckte sie zuerst Rosi.
»Der ist ja immer noch da«, stöhnte sie schläfrig. »Ich dachte, ich hätte vielleicht nur schlecht geträumt.«
»Keine Sorge, wir holen ihn jetzt aus Schlummerland zurück.«
Dazu war diesmal jedoch keinerlei Anstrengung von Nöten. Zu Rosis grenzenloser Überraschung ächzte der Uhu ohne jegliches Zutun in ihren Ausschnitt und gab zu erkennen, dass er unter den Lebenden weilte. Dann wälzte er sich schwerfällig neben sie auf den Rücken und glotzte auf die zerfließenden, finsteren und sehr barocken Blumenbuketts der Tapete. Ganz eindeutig hatte er Schwierigkeiten damit, sich zusammenzureimen, wo genau er eigentlich steckte.
Am liebsten wäre Rosi auf dem schnellsten Wege in die Höhe geschossen und aus dem Séparée geflüchtet, aber sie war vollkommen steif, ihr Rücken verbogen, die linke Seite taub, ihr schmerzten sämtliche Glieder und so setzte sie sich zunächst vorsichtig auf. Sie hatte ja schon einige merkwürdige Nächte in ihrem Leben hinter sich, aber das war mit Abstand die schlimmste. Zerstreut tastete sie nach ihrer Halskette, die sie von der Tante Teres bekommen hatte, um sich zu vergewissern, dass sie an Ort und Stelle war. Sie langte in jede Menge feuchter Haare.
»Uäh. Schau dir das an. Das ist ja ekelhaft. Der hat mich vollgesabbert!«
»Jetzt trink erst einmal deinen Kaffee, Zuckerstück.«
Rosi schüttelte sich – heiße Schokolade wäre ihr lieber gewesen – und rutschte aus dem Bett. Praktisch auf allen Vieren tappte sie in die Garderobe. Dort musste sie feststellen, dass auch das Katzenfell an ihrem Kleid verklebt war. Den Schaden an der Rückennaht inspizierte sie darum erst gar nicht. Und weil sie zu müde und zu wasserscheu für die Dusche war, kletterte sie in ihr graues Straßenkleid. Natürlich erst, nachdem sie mit einem Desinfektionstuch in ihrem Ausschnitt herumgefuhrwerkt hatte.
Zurück im Séparée saß der Uhu inzwischen auf dem Bett und hatte den Kopf in beiden Händen vergraben. Er wusste wahrscheinlich noch immer nicht, wohin er geraten war. Madame stand vor ihm und hatte die geschäftsmäßige Miene aufgesetzt. Zweifellos wollte sie abkassieren. Rosi war bereit für ihren Kaffee und das Spektakel. Sie hockte sich also in die erste Reihe auf die Truhe und gönnte sich einen Schluck.
Sie wurde nicht enttäuscht. Der Uhu begann in seinen Hosentaschen zu kramen und förderte einen Zehner und einige Münzen zutage.
»Das wird nicht reichen, fürchte ich. Nehmen Sie auch Anzahlungen?«
Wenn es ums Geld ging, verstand Madame nicht den geringsten Spaß. Entsprechend umwölkte sich ihr Gesicht. Rosi freute sich, sie würde auf ihre Kosten kommen. Den Uhu dagegen beschäftigte anstatt Madames düsterer Miene etwas anderes. Er blinzelte langsam.
»Hatten Sie gestern Nacht nicht eine Augenklappe?«
»Jetzt bin ich in zivil. Und versuchen Sie nicht, abzulenken.«
Der Uhu steckte seine paar Kröten wieder ein und fischte stattdessen sein Handy hervor. Er wählte eine Nummer und reichte es an Madame weiter, deren zornige Miene etwas verrutschte. »Kaspern Sie das bitte mit der Dolhopf aus. Gibt es hier irgendwo ein Bad?«
Damit er kein Schindluder treiben konnte, brachte ihn Rosi hin. Für den weiteren Verlauf des Dramas wollte sie sich ohnehin mit einem zweiten Kaffee und einigen Keksen aus der kleinen Küche neben der Garderobe stärken. Das Telefonat, das zweifelsohne höchst interessant verlaufen war, verpasste sie deshalb und hörte bloß, wie sich Madame mit den Worten »Bringen Sie eine Kreditkarte, es wird teuer« verabschiedete. Auch der Uhu trudelte erst nach dem Ende der Unterredung im Séparée ein, wo er mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre er in seinem natürlichen Habitat, wieder auf das Bett plumpste.
»Wer auch immer das war, sie hat sich nicht zufrieden angehört«, sagte Madame und gab ihm das Handy zurück.
Der Uhu zuckte die Achseln. »Die Dolhopf ist nie zufrieden.« Er reckte und streckte sich ausführlich und gähnte. Sehnsüchtig schaute er auf die Tasse in Rosis Händen. »Könnte ich bitte auch einen Kaffee haben?«
Madame durchbohrte ihn mit ihrem berühmten vernichtenden Blick, der noch jeden ungehobelten Gast und jedes aufmüpfige Mädchen im Kabinett zur Räson gebracht hatte. Rosi bekam auch prompt eine Gänsehaut, obwohl der Blick gar nicht ihr galt.
»Ein Glas Wasser?«, erkundigte sich der Uhu ungerührt.
»Hier gibt es nichts umsonst.«
Er kramte daraufhin wieder in seiner Hosentasche herum und hielt triumphierend den Zehner in die Höhe. »Das sollte doch wenigstens für einen Kaffee reichen.«
Das war ein Tassenpreis nach Madames Geschmack, also schnappte sie sich den Schein und steckte ihn sofort ein. »Rosi, mach dem Herrn bitte einen Kaffee.«
»Schön stark und mit Milch, wenn es keine Umstände macht.«
»Und sei so lieb und bring gleich eines der mobilen Kartenlesegeräte aus dem Büro mit.«
Rosi zog eine beleidigte Schnute. Immerhin bedankte er sich artig, als sie mit der hässlichsten Tasse zurückkam, die sie in der kleinen Küche nebenan finden konnte. Nachdem er es die ganze Zeit vermieden hatte, nahm er sie nun genauer unter die Lupe.
»Habe ich wirklich die ganze Zeit geschlafen?«, fragte er zögernd.
»Ja. Leider.«
Kopfschüttelnd trank er in einigen großen Schlucken den Kaffee.
Der Uhu schielte gerade in die leere Tasse und kämpfte ziemlich offensichtlich damit, ob er es wagen durfte, nach einer zweiten Runde zu fragen, als eine rauchgeschwängerte Furie hereinstürmte. Die Putzfrau, die im Roten Saal zugange war, musste sie hereingelassen haben. So wie die Furie an ihrem Zigarillo zog, hätte sie glatt als Feuerspuckerin im Kabinett auftreten können. Zu Rosis Leidwesen verwandelte sie den Uhu aber nicht direkt in einen Aschehaufen. Sie haute ihm auch nicht ihre Handtasche auf den Kopf, obwohl sie ganz danach aussah. Na ja. Man konnte nicht alles haben.
»Sie sind ein Idiot, Fabian. Warum sind Sie nicht in Ihrem Hotel?«, polterte sie.
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Und ich will sie jetzt nicht hören.«
Das wollte niemand, da waren sich die drei Grazien einig. Sowieso schauten sich Madame und die Furie abschätzend an und überlegten, wer welche Schrammen bei einem etwaigen Scharmützel davontragen würde und ob sich ein solches Scharmützel überhaupt lohnte. Madame eröffnete die Partie und nannte die Summe, die nun einmal zustande kam, wenn man eines ihrer Mädchen zwölf Stunden lang inkommodierte und obendrein ihr Kleid kaputt machte. Da wurden einige Tausender fällig. Der Uhu stieß einen anerkennenden Pfiff aus.
»Das ist nicht Ihr Ernst«, hustete dagegen die Dolhopf, die sich an ihrem Zigarillo verschluckt hatte.
»Doch.«
Der Furie war ganz offensichtlich ihre körperliche Unversehrtheit egal, denn sie verschränkte die Arme vor der knochigen Brust und erwiderte, dass sie für Schäden an irgendwelchen Fetzen sicher nicht aufkommen werde.
»Haben Sie eine Ahnung, was für ein Drama es war, bis ich vier passende Katzenpelze ergattern konnte?«, platzte Rosi heraus. »Und wie lange ich daran gesessen bin?«
Die Dolhopf warf den Katzenohren, die nach wie vor keck, wenn auch etwas schief, in Rosis Locken steckten, einen missbilligenden Blick zu. »Nein. Und es ist mir auch egal.«
»Meine liebe Frau Dolhopf, seien Sie nicht grätig und geben Sie den Damen ihre Gage, ich habe hier für genug Ärger gesorgt«, mischte sich der Uhu ein.
»Mit Karte oder bar?«, fragte Madame.
Schnaubend schnippte die Dolhopf ihren Zigarillostummel in die leere Kaffeetasse des Uhus, zückte dann aber eine Kreditkarte. Die Lesegeräte waren Madames einzige Verneigung vor der Moderne – normalerweise bevorzugten die Kunden die gute alte Barzahlung via Briefumschlag. Noch während die Quittung aus dem Kartenlesegerät ratterte, wandte sich Madame dem Uhu zu. »Ich will Sie hier nie wieder sehen. Und richten Sie Ihrem Freund aus, dass er keinen Fuß mehr über die Schwelle meines Kabinetts setzen oder eines meiner Mädchen buchen darf, wenn er mir noch einmal jemanden anschleppt, den ich nicht eingeladen habe.«
»Ach, dann ist das hier wieder auf dem Mist von Tippelbruder Steger gewachsen? Na bravo, das hätte ich mir denken können«, zischte die Dolhopf.
Madame begleitete die beiden nach unten, wo sie ohnehin eine Kontrollrunde drehen wollte. Rosi winkte und schlüpfte in die Garderobe, um dort endlich die Kostüme ihrer Kolleginnen zum Lüften auf die Stange zu hängen und sich für den eigenen Aufbruch zu rüsten.
»War das nicht dieser Schauspieler?«, fragte Madame, als Rosi später im Roten Saal gestiefelt und gespornt an ihr vorübersprang.
»Keine Ahnung. Dieser aufgeplusterte Uhu hat mein schönes funkelnagelneues Kleid ruiniert. Mehr brauche ich über den nicht zu wissen.«
Und damit zwitscherte Rosi Richtung U-Bahn und ihres eigenen Bettes davon.
Sonderwünsche
Madame hatte recht. Der aufgeplusterte Uhu war tatsächlich Schauspieler. Einschlägige Fachorgane wie etwa das Achtuhrblatt hatten Fabian Fein sogar in den Stand eines Filmstars erhoben, und bevor er im Kabinett der Wunder Rosis funkelnagelneues Kleid besudelte, hatte er fünf schlaflose Nächte, eine Taxifahrt quer durch die Stadt und die Premiere seines neuesten Films hinter sich gebracht. Die turbulente Liebeskomödie rund um einen schusseligen Insolvenzverwalter und die querschnittsgelähmte Inhaberin einer bankrotten Schuhfabrik hatte vor nicht allzu langer Zeit seine ganz persönliche Abwicklung ausgelöst. Doch weil die Show unter allen Umständen weitergehen musste, gab es nichts auf der Welt, das für einen gnadenvollen Dispens ausreichte und so hatte er sich – eskortiert von bleierner Müdigkeit und seiner alten Flamme Sira Rogall – zunächst auf dem roten Teppich und später, sobald auf der Leinwand die merkantilen und amourösen Wunder vollbracht waren, inmitten von Glitzer, Glamour und Gewühl wiedergefunden. Wo Fabian damit befasst war, dem mitleidigen Gaffen und dem spöttischen Getuschel über die zarte Romanze seiner Exfrau Nummer Zwei in spe und dem Regisseur mit Grandezza zu begegnen. Dass Vanessa wenigstens auf ihren berühmt-berüchtigten Scheidungsanwalt gehört und der Arx deswegen ohne seine neue Muse vom Bohnenkamp und den anderen grauen Herren von den Produktionsfirmen hofiert wurde, war ihm nicht wirklich ein Trost. Fabian zog daher haarige Gewächse in seinem Herzen und nachdem erst der Zunke von seiner neuesten Nebenrolle schwadroniert und dann die Society-Expertin einer auflagenstarken Illustrierten mit gezücktem schwarzen Notizbuch eine geschlagene Dreiviertelstunde lang versucht hatte, ihm den Stand der Dinge mit Sira Rogall zu entlocken, war der Steger aufgetaucht. Der hatte Fabian auf die Schulter geprankt und erklärt, dass er seinen Daseinszweck ausreichend erfüllt und seine Schuldigkeit getan habe, und ihm einen Ausflug auf die Gasse mit ihren Verlockungen und Sirenen aufgeschwatzt. Und weil Fabian befürchtete, dass Sira noch auf die Idee kommen könnte, ihn zu vorgerückter Stunde auf einen Absacker in ihre Wohnung zu schleppen, war er willig in ein Taxi gestiegen und im Kabinett der Wunder gelandet.
Das übrigens gar nicht weit entfernt vom Leda war, seinem derzeitigen Domizil, wo er sich verkroch, seitdem Exfrau Nummer Zwei das Schloss an der Wohnungstüre ausgetauscht hatte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre er für immer im Leda abgetaucht, doch die Dolhopf hatte eigenmächtig und moralisch unterstützt von seinem jüngeren Bruder Felix vor einer Weile einen Makler engagiert, der sich mit delikater, prominenter Kundschaft und deren Wohnbedürfnissen auskannte. Nun deckte sie ihn regelmäßig mit Wohnungsangeboten ein und presste in seinen ohnehin platzenden Terminkalender Besichtigungstouren durch leerstehende Fabrikhallen, Penthäuser, Altbauwohnungen und andere Perlen der Architektur.
»Selbst Felix hat inzwischen begriffen, dass ich gerne auf dem Musenhügel wohne, obwohl der vergammelt ist«, erklärte er seiner zornigen Assistentin mit großen Gesten und gewichtiger Miene, als die beiden nach einem solchen Ausflugstag unverrichteter Dinge im Leda eintrudelten. Fabian fand nämlich Hotelzimmer schon immer anheimelnd genug. Er brauchte sich um nichts zu kümmern, das Bett wurde gemacht, der Boden gesaugt, das Bad geputzt. Es existierten weder Briefkasten noch Mülleimer, die von Schmierfinken oder übereifrigen Verehrerinnen durchwühlt werden konnten und Mutenschlager kam auch nicht auf die Idee, ihm die Society-Expertin für eine Homestory auf den Hals zu hetzen. Nur seine Katze, die momentan bei seinen Eltern untergebracht war, fehlte ihm.
»Sie können nicht ewig in dieser Rumpelkammer bleiben«, erwiderte die Dolhopf. »Irgendwann muss auch die schönste Trotzphase ein Ende haben.«
Anstatt in seine Höhle zu entfleuchen, musste Fabian sich mit seiner Assistentin ins hauseigene Lokal setzen. Er ahnte, dass weitere Unannehmlichkeiten seiner harrten.
»Ich muss zehn Kilo abnehmen«, stöhnte er, als sie ihm ein Schnitzel bestellte. »Das wissen Sie.«
»Und Sie wissen, dass ich nichts von künstlerisch wertvollen, selbstzerstörerischen Rollen halte.«
Sie blies dem Kellner, von dem die Sage ging, dass er ebenso wie der Koch ein Neffe von Frau Leda war, und der einen ähnlich abgenutzten Charme wie die fleckigen Tischdecken und die vergilbten Tapeten verbreitete, eine Aschewolke ins Gesicht und orderte für sich den kleinen gemischten Salatteller.
»Sie sollten etwas Vernünftiges essen.«
»Mir vergeht der Appetit, wenn ich Termine mit Ihnen kläre.«
»Warum tun Sie das dann immer ausgerechnet beim Essen?«
»Weil Sie mit vollem Mund weniger Widerworte geben.«
Fabian gähnte.
Während sie auf das Essen warteten, unterhielt ihn die Dolhopf mit den neuesten Anekdoten aus dem Boulevard. Laut dem Achtuhrblatt war Sira Rogall vom Zunke schwanger (zu schön, um wahr zu sein) und außerdem war Felix mit einem neuen klapprigen Gestell (aka Nachwuchsmodel) im Nachtleben gesichtet worden. Zweifellos wollte die Dolhopf orakeln, um wen es sich dabei handelte, denn während sie sich regelmäßig über Fabians »Flittchenschweif« ärgerte, amüsierte sie sich königlich über die amourösen Abenteuer seines Bruders. Fabian gähnte wieder.
»Kommenden Donnerstag und Freitag drehen Sie auf Gestüt Hohenfelden den ersten Werbespot für den Whisky«, hob die Dolhopf schließlich an, kaum dass er den ersten Bissen Schnitzel im Mund hatte. Aus ihrer Tasche holte sie einen beachtlichen Stapel Unterlagen hervor, den sie auf die Tischplatte krachen ließ. »Ich würde gerne mit Ihnen …«
»Ich drehe einen Werbespot?«
»Allerdings. Sie haben einen Vertrag über drei Werbespots und eine Printkampagne unterschrieben. Letztere haben wir im Februar abgeschlossen. Erinnern Sie sich?«
Natürlich erinnerte er sich. Die beiden Bluthunde mit dem scheußlichen Mundgeruch, die ständig an ihm hochgesprungen waren und ihren Sabber in seinem kostbaren Gesicht und an seinen Hosenbeinen abwischten, sowie das Moor, in dem er sich eine nahezu tödliche Bronchitis zugezogen hatte, würde er sein Lebtag nicht vergessen.
»Ich bin nicht in Form.«
Werbefilmchen waren auch ohne sabbernde Bluthunde mit Mundgeruch eine Drangsal, ein Drehtag dauerte achtundvierzig Stunden, und abgesehen davon, dass er überzeugt war, seine Karriere wohl eines Tages mit Werbung für Migränetabletten beenden zu müssen, verkaufte man natürlich seine Seele, sein Talent und die Kunst an den schnöden Mammon.
»Fabian, Sie sollen da keinen Hamlet geben, sondern Werbung für Whisky machen. Dazu brauchen Sie nicht in Form zu sein.«
Die übrigen Anwesenden interessierten sich nicht für den Disput zwischen dem Filmstar und seiner Assistentin. Der Vertreter, der sich in die hinterste Ecke zurückgezogen hatte, brütete lieber über dem antiken Schachbrett, dem ein weißer Bauer und ein schwarzer Springer fehlten, und der Kellner polierte lustlos einige trübe Gläser und wartete darauf, das Geschirr abzuräumen.
»Ich will keinen Werbespot drehen«, sagte Fabian und stieß dem undankbaren Publikum zum Trotz dramatisch seinen Teller weg.
»Ach. Sie wollen also lieber eine saftige Schadensersatzklage am Hals haben.«
»Aber …«
»Schadens. Ersatz. Klage.«
Er schwieg und schaute der Dolhopf dabei zu, wie sie mit gewaltigem Appetit sein restliches Schnitzel vertilgte. Ihrem Sermon zu den geplanten Werbefilmen hörte er bloß mit halbem Ohr zu. Diese Marketingleute versuchten ernsthaft, ihn umzubringen und es interessierte seine Entourage nicht im Mindesten.
»So. Ich verschwinde. Ich habe nämlich ein Privatleben«, sagte die Dolhopf zuletzt.
»Seit wann?«
»Sie sind ein Idiot, Fabian.«
Er blickte ihr nach, wie sie aus dem Restaurant stach und sich noch im Gehen einen Zigarillo ansteckte und nun entweder in ihre leere Wohnung oder zum Kickboxen fahren würde. Fabian seufzte und machte sich auf den Weg in seine Höhle.
Das Leda war altmodisch und überschaubar, kein Luxusbunker mit tausend Betten. Nicht einmal eine Leuchtreklame pappte draußen an der Wand. Dafür ein Zigarettenautomat von Hulesch & Quenzel, der bloß sporadisch funktionierte und bereits so manchen Raucher gepeinigt hatte, und daneben einer für Kondome, der immer etwas auswarf. Man lief durch unzählige gewundene Korridore und legte abenteuerliche Fußwege zu den Zimmern zurück. Diese hatten müde, abgeschlagene Holzmöbel mit einer Menge Schnörkel, dazu verschossene Samtvorhänge, quietschende Türen und Fenster, die knarzten und sich nur mit gewaltiger Anstrengung aufstoßen ließen. Für gewöhnlich verirrte sich keine illustre Gästeschar ins Leda. Die meisten Übernachtungsgäste waren Handelsreisende und Touristen, die kein anderes Bett in der Stadt gefunden hatten, und hin und wieder flatterte eine staubige Motte mit ebenso staubiger Kundschaft im Schlepptau herein. Auch die einquartierten Dauergäste, ein Heldentenor, der vor Jahren nach einer Kehlkopfentzündung die Stimme und jeglichen Elan zu singen verloren hatte, sowie eine zwischenzeitlich mittellose Bankierswitwe, verliehen dem Etablissement keinerlei Glamour. Fabian passte also so gar nicht hinein, sondern eher ins Imperial, ins Grandhotel, ins Jandel oder ins Regent.
In seinem Zimmer angekommen, warf er zuerst die Unterlagen für den Werbespot in die nächstbeste Ecke. Es war ihm nie sonderlich erfolgreich gelungen, sich den Einflüsterungen seines Agenten Mutenschlager zu verweigern. Die Verlockung durch den schnöden Mammon war meist stärker als die Unverkäuflichkeit seiner Künstlerseele. Zu der aktuellen Wahnsinnstat hatte er sich hinreißen lassen, kurz nachdem Exfrau Nummer Zwei den berühmt-berüchtigten Scheidungsanwalt konsultiert hatte, um die Ehe auch vor dem Gesetz hinzurichten. Überhaupt hätte Mutenschlager nichts Profitableres passieren können. Seitdem Vanessa Fabian vor die Türe gesetzt hatte, ließ dieser sich blindlings vor jeden Karren spannen, der seinem persönlichen Mephisto einfiel, und so wie Fabian die Lage einschätzte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sein kostbares Gesicht zur Vermarktung von Kaffeevollautomaten herhalten musste.
Er schenkte sich einen Schlummertrunk – eben jenen zu bewerbenden Whisky – ein und befasste sich mit dem Drehbuch seines nächsten Films. Der Streifen war nicht gerade dazu angetan, seinen Katzenjammer zu vertreiben. Ein Börsenmakler, stets auf der Überholspur des Lebens, bricht auf dieser zusammen, als bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert wird. Gemeinsam mit einer Lernkrankenschwester, gebeutelt von ihrer Affäre mit dem Chefarzt, macht er sich auf, um all das zu unternehmen, wofür er bislang keine Zeit gefunden hat. Dabei lernt er in heitertraurigen Episoden das Leben neu kennen. Sobald er begreift, worauf es wirklich ankommt: Exitus auf einer Berghütte.
Schneller als erwartet tränten Fabians Augen vom vielen Gähnen so sehr, dass die Buchstaben verschwammen. Er hob den Vorhang seines allnächtlichen Dramas und schluckte ein Schlummerbonbon, knipste das Licht aus und konzentrierte sich auf das Ticken des Weckers. Das tat er lieber als Schafe zählen. Es war nicht etwa die Schuld von Exfrau Nummer Zwei oder ihrer Drohung, ihn ganz und gar nicht waidgerecht ausbluten zu lassen, dass er praktisch jede Nacht kein Auge zutat. Fabian plagte sich schon seit frühester Jugend mit Schlaflosigkeit und auch in dieser Nacht wälzte er sich bald nach links, wälzte sich nach rechts, raufte die Haare, presste das unbenutzte Kissen an sich, wälzte sich auf den Rücken, kratzte sich die Nase, warf das unbenutzte Kissen hinaus, weil es ihn störte, zog die Bettdecke über den Schädel, legte sich quer über die Matratze, fischte das unbenutzte Kopfkissen wieder vom Boden und knipste zuletzt das Licht an.
Er schluckte eine zweite Schlaftablette und wünschte sich selige Schwärze herbei. Dieselbe selige Schwärze, die er eine knappe Woche zuvor im Kabinett der Wunder kennengelernt hatte und die andere wohl gemeinhin als Schlaf bezeichneten.
Fabian turnte aus den Federn, stolperte über einen herrenlosen Schuh auf dem Fußboden und begab sich auf die Suche nach seinem Handy. Er tastete unter das Bett, schaute in der Dusche und neben dem Rasierer nach, er durchwühlte den Koffer und den Schrank und die Kleiderhaufen auf den Sesseln und fand es schließlich gehorsam und griffbereit auf dem Nachtkästchen. Bei der Dolhopf war besetzt. An ihr Blackberry ging sie nicht. So schnell gab Fabian allerdings nicht auf. Er angelte sich einen Stift und das Skizzenbuch.
Kurz vor Mitternacht, gerade als er die dritte misslungene Version der Katzenfrau zerknüllte und quer durch die Höhle warf, wurde die Leitung zur Dolhopf frei.
»Himmelherrgott! Was treiben Sie? Bei Ihnen war stundenlang belegt.«
»Ich habe telefoniert.«
»Sie haben erreichbar für mich zu sein. Mit wem telefonieren Sie überhaupt?«
Ihr Feuerzeug klickte und die Dolhopf tat einen genüsslichen Zug. »Das geht Sie nichts an. Außerdem sollten Sie zu dieser späten Stunde besser höflich sein, sonst ziehe ich den Stecker.«
»Ich werde den Werbespot nicht drehen können.«
»Darüber haben wir heute bereits diskutiert.«
»Die wollen mich auf einen Gaul setzen. Darüber haben wir noch nicht diskutiert.«
»Fabian, es ist spät. Um halb sechs muss ich Sie wecken. Ich möchte schlafen.«
»Schlafen ist das richtige Stichwort.«
Die Dolhopf stöhnte. Denn sie wusste natürlich, was sie erwartete. Schließlich lag ihr Fabian, seit Madame die massive Eichentüre hinter ihnen zugeworfen hatte, mit der seligen Schwärze in den Ohren.
»Mir gehen das Kabinett der Wunder und das, was dort passiert ist, nicht aus dem Kopf. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob es sich wiederholen ließe.«
»Das ist doch Blödsinn. Sie hatten fünf Nächte kaum geschlafen. Früher oder später mussten selbst Sie mal umkippen und Ruhe geben.«
»Das schon. Aber doch nicht stundenlang.«
»Das war Zufall.«
»Aber nein, ich glaube, das war die Katzenfrau.«
Fabian waren schon Gerüchte über das Kabinett der Wunder zu Ohren gekommen, bevor der Steger im Taxi »Heute ist dein Glückstag, alter Knabe« gewiehert und theatralisch wie ein schlechter Bühnenmagier in seine innere Manteltasche gelangt und ihm statt eines weißen Kaninchens eine Handvoll seidiger, perlmuttschimmernder Sedcards überreicht hatte. In Anbetracht der Vorkommnisse, die sich dann im Varieté abgespielt hatten, fragte sich Fabian nun nicht zum ersten Mal, ob der Steger mit seinem Spruch nicht ins Schwarze getroffen hatte.
»Warum machen Sie nicht einen Spaziergang die Straße runter und schauen dort vorbei und fragen artig, ob sie nicht wieder Ihr Kopfkissen spielen möchte.«
»Oh, Sie wissen doch, dass man da erst durch fünf brennende Reifen springen muss, ehe man Einlass findet. Abgesehen davon habe ich mir und vermutlich auch meinen Kindeskindern ein Hausverbot eingehandelt. Wie Sie sehr genau wissen.« Fabian machte eine dramatische Pause. »Und stellen Sie sich nur einmal den Pressewirbel vor, wenn herauskäme, dass ich dort bin.«
Die Dolhopf schwieg einen Moment und er überlegte, ob er den Bogen noch ein wenig weiter spannen konnte. Allerdings war seine Assistentin schneller als er.
»Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass ich es leid bin, Ihre Grenzerfahrungen auszubaden?«
»Falls Sie auf die unselige Geschichte mit dieser verrückten Rothaarigen anspielen …«
»Nein. Ich dachte an die drei nackten Flittchen im Pool vom Grandhotel.«
Die beiden Schlummerbonbons mochten vielleicht nicht wirkten, die drei Schluck Whisky taten es jedoch sehr wohl. Dazu die haarigen Zähne der Dolhopf und schon entsprangen seinem Hirn die fantastischsten Einfälle.
»Ich muss ausgeschlafen sein, ehe ich auf einen Gaul klettere. Das heißt, ich muss die Katzenfrau treffen. Kümmern Sie sich also bitte darum. Der Steger meinte, man könnte die Damen auch für allerhand Aktivitäten außerhalb des Kabinetts buchen.«
»Wollen Sie mich ärgern oder rasten Sie endgültig aus?«, polterte die Dolhopf.
»Das dürfen Sie sich aussuchen«, erwiderte er würdevoll.
»Wie oft habe ich Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Schlaftabletten nicht mit dem Whisky herunterspülen sollen?«
»Die Katzenfrau oder der Werbespot. Entscheiden Sie sich.«
Dem Pfauchen am anderen Ende der Leitung nach zu urteilen, inhalierte die Dolhopf eine mindestens tödliche Menge Rauch. »Das Weib ist absolut nicht Ihr Beuteschema.«
Zugegebenermaßen hatte er dasselbe auch dem Steger im Taxi erklärt, nachdem er die betreffende Sedcard eingehend studiert hatte und aus rein professionellem Interesse eine vage Neugierde auf das Kabinett und seine Darstellerinnen verspürt hatte.
»Na und? Das liegt nur daran, dass mir dunkelhaarige Frauen am Arm nicht stehen. Ich wirke zu blass daneben. Aber da ich mit der Katzenfrau weder über einen roten Teppich flanieren noch mich fotografieren lassen will, ist ihre Haarfarbe egal.«
»Ich habe mich entschieden. Sie sind endgültig ausgerastet.«
»Ganz und gar nicht. Fragen Sie den Stylisten.«
»Wie viele von Ihren Tabletten haben Sie eingeworfen?«
Fabian zuckte die Achseln. »Was weiß ich. Zwei? Drei?«
»Fallen dem Filmstar noch mehr Sonderwünsche ein?«, seufzte sie. »Soll sie vielleicht wieder diese albernen Katzenohren aufsetzen?«
»Lassen Sie mich nachdenken.«
Die Dolhopf legte auf. Nicht nur das. Sie machte ihre Drohung wahr, schaltete überdies das Blackberry aus und zog beim Festnetz den Stecker. Na, die hatte Nerven. Für eine derartige Insubordination sollte er ihr umgehend kündigen. Was ja leider nicht mehr zu ihr durchdrang, weshalb die Kündigung ein paar Stunden warten musste.
Fabian schluckte eine weitere Schlaftablette. Er kniff die Augen zusammen und ging im Geiste den Text für den nächsten Drehtag durch. In den Nächten davor hatte er bereits ausführlichst getestet, ob es beim Einschlafen half, wenn er sich die Katzenfrau in allen Einzelheiten ins Gedächtnis rief. Am Ende war er allerdings stets frustriert darüber gewesen, wie lückenhaft seine Erinnerung an sie war. Vielleicht sollte er den Steger beknien, dass der ihm wenigstens die Sedcard überließ. Damit er sich die unters Kopfkissen legen und auf deren wundertätige Wirkung hoffen könnte. Denn ihm war natürlich klar, dass die Dolhopf einen Teufel tun und im Kabinett der Wunder anrufen oder gar die Katzenfrau buchen würde. Ein paar Momente wärmte er sich an dem Gedanken, dass sie es vielleicht doch tun würde. Dann aber wälzte er sich bald nach links, wälzte sich nach rechts, raufte die Haare, presste das unbenutzte Kissen an sich, wälzte sich auf den Rücken, kratzte sich die Nase, warf das unbenutzte Kissen hinaus, weil es ihn störte, zog die Bettdecke über den Schädel, legte sich quer über die Matratze, fischte das unbenutzte Kopfkissen wieder vom Boden und knipste zuletzt das Licht an. Ihm war es herzlich egal, ob er Felix vielleicht aus den Armen des aktuellen klapprigen Gestells riss. Er rief ihn an, um sich nach den Fortschritten der Kurzgeschichte zu erkundigen, an der dieser seit Monaten herumwerkelte.
Die Sintflut
Von der Tante Teres hatte Rosi nicht nur die Halskette mit der Goldmünze, sondern auch – sehr zum Verdruss der meisten Märzenbacher – eine Villa samt greisem Kakadu geerbt. Da die Villa nicht dem üblichen Gardemaß entsprach, wurde sie von der Sippschaft als Gartenlaube bezeichnet. Einen noch sehr viel weniger schmeichelhaften Ausdruck hatte Großmutter Märzenbacher parat. Sie hielt die Villa für ein Hurenhaus und wunderte sich schon zu Lebzeiten der Tante Teres (und auch danach) lautstark darüber, dass sich der Erdboden darunter nicht auftat und alles mit Haut und Haar verschlang.
Eben diese alte rosa Gartenlaube machte Rosi derzeit Sorgen. Nicht etwa, weil ihre Dielen seit Jahr und Tag knarrten oder weil sie die Türen hätte ölen müssen und ein paar Fenster klemmten. Die Gartenlaube hatte ein undichtes Dach. Rosi bemerkte das Unglück an einem Sonntagnachmittag, als es wie aus Eimern goss und sie das lausige Wetter zum Stöbern nutzte. Sie war auf den Dachboden gestiegen, weil sie die Katzenfellreste des zwischenzeitlich wieder instand gesetzten Samtkleids verstauen wollte. Aber gegenüber dem gewaltigen Schrank, worin sie abgelegte Kleidung, abgeschnittene Knöpfe, Wollreste und anderen Kram hortete, der in ihrem Nähzimmer keinen Platz mehr fand, hatte sich ein Rinnsal am Dachbalken gebildet. Und tropfte munter auf die Bühnenmemorabilien der Tante Teres. Rosi trug also die Katzenfellreste wieder hinunter ins Trockene und anschließend einen Eimer hinauf. Dann zerrte sie Fotoalben, gemalte Plakate, Zeitungsausschnitte, Autogrammkarten, das Bandoneon und drei Schrankkoffer voller mottenzerfressener Kostüme aus der Gefahrenzone. Das letzte Mal hatte sie die Sachen in der Hand gehabt, als sie während eines Rotwein-Lasagne-Abends Lola unvorsichtigerweise von der Varietékarriere der Tante Teres erzählt hatte und ihre Freundin dann unbedingt hatte herausfinden wollen, ob der Pelz von der Tante Teres genauso aussah wie der von Rosi. Nun waren vor allem die Plakate der unzähligen Auftritte, die »La Loba« rund um den Globus absolviert hatte, in Mitleidenschaft gezogen und Rosi war froh, dass sie nach dem Rotwein-Lasagne-Abend die schönsten hatte rahmen lassen und in der Küche und dem Nähzimmer aufgehängt hatte.
Bis Rosi alles durchsortiert hatte, war aus dem Rinnsal eine Sintflut geworden. Nach zwei Stunden war der Eimer vollgelaufen. Anscheinend hatte anstelle des Erdbodens der Himmel genug von ihrem Lebenswandel und wollte sie fortschwemmen. Vielleicht hätte sie Lola öfter in die Kirche begleiten und Kerzen anzünden sollen. Es regnete nämlich die ganze Nacht durch, und weil sie Angst vor einem richtigen Wasserschaden hatte, blieb Rosi bis zum Morgengrauen, als der Himmel endlich ein Einsehen hatte und seine Schleusen schloss, auf dem Dachboden, um den Eimer zu wechseln.
Ein starker Kaffee wäre um diese Uhrzeit vermutlich schlauer gewesen, doch Rosi beschloss, dass eine heiße Schokolade mit Rum ihrem Gemütszustand zuträglicher sein würde. Die trug sie zum Fenstererker im Wohnzimmer, wo man einen Ausblick auf die Rosenstöcke und den Gartenpavillon hatte. Rosi konnte sich gut vorstellen, wie die Tante Teres dort auf der breiten Fensterbank gethront und mit ihren Galanen aus dem abgegriffenen Adressbuch telefoniert hatte. Darum hatte Rosi das schwarze Bakelittelefon an seinem Platz gelassen und auch das Adressbuch hatte sie behalten. Vor allem das Adressbuch war ihr im Gegensatz zu den Bühnenmemorabilien immer nützlich erschienen, denn es fanden sich darinnen nicht allein die Galane und Varietékollegen der Tante Teres, sondern auch jede Menge Handwerker, Geschäftsleute, Lieferanten und Privatbanken, die mit den Märzenbachers seit Generationen Geschäfte trieben. Trotz der Querelen mit ihrer Sippe hatte Rosi (und ganz offensichtlich auch die Tante Teres) nie gezögert, ihren Namen einzusetzen, wenn es ihr nutzte. Und das tat es jetzt ganz ohne Zweifel. Schließlich rückte die Kavallerie noch am selben Vormittag an, um ihr leckgeschlagenes Dach in Augenschein zu nehmen.
»Nichts hält ewig«, sagte der Zimmermann, der im morschen Gebälk turnte und die Delle untersuchte, die der Regen ins Dach gedrückt hatte.
»Alle fünfzig Jahre muss man spätestens mit einem neuen Dach rechnen«, setzte der Dachdecker hinzu.
Die beiden waren sich nämlich einig, dass die Gartenlaube ein neues Dach brauchte. Ein komplett neues Dach. Mit Dachstuhl, Dachpfannen und den anderen wundersamen Dingen, die auf ein Dach gehörten. Und da die Gartenlaube im vorletzten Jahrhundert erbaut worden war, würde der Denkmalschutz auch ein Wörtlein mitreden. Rosi kippte beinahe um, als sie hörte, wie viel ihr verrottetes Mansardendach verschlingen würde.
»Uns bricht die Gartenlaube über dem Kopf zusammen. Was machen wir denn jetzt, Schreihals?«, fragte sie den Kakadu, der bloß mit den lahmen Flügeln flatterte, krächzte und ein paar Federn verlor. Rosi nippte an der zweiten heißen Schokolade mit Rum. »Vielleicht bekomme ich für dich nutzloses Vieh etwas, wenn ich dich an ein Tierlabor verscherble?«
Seit jeher machten sie große Geldbeträge, die sie zahlen musste, panisch. Sie sah sich dann immer, wie sie, alt und grau, beim Tingeltangel oder auf dem Straßenstrich hinter dem Bahnhof stand, wo sie besoffenen, stinkenden, schmutzigen Seefahrern einen blies, um das nächste warme Essen zu organisieren. Bislang fehlte in diesem Horrorszenario allerdings der Umstand, dass sie obendrein obdachlos sein würde.
»Aber, aber Frau Märzenbacher, da regen Sie sich nicht auf«, gurrte der Pfennigfuchser von der noblen Bank, wo die Sippschaft seit eh und je ihr Geld hortete und bei dem Rosi gleich nach dem Besuch der Handwerker vorstellig wurde. Er malte ein Blatt mit Zahlenreihen und Pfeilen voll. »Da müssen wir keinen Kredit aufnehmen. Da lösen wir einfach den Bausparvertrag hier auf. Der ist sowieso fällig. Sie stehen da nicht im Regen.«
Zurück in der Gartenlaube hängte sie das Blatt mit den Zahlen und Pfeilen an den Kühlschrank. Rosi verspürte das dringende Bedürfnis nach einer weiteren heißen Schokolade mit Rum. Schließlich kam sie langsam in das Alter, in dem sie jeden Morgen ihr Gesicht kritisch nach Krähenfüßen absuchte und auch die Locken und den Pelz einer eingehenden Musterung unterzog. Denn sie hatte sich geschworen, nicht mehr im Kabinett der Wunder aufzutreten, sobald sie irgendwo an ihrem Körper ein graues Haar entdeckte.
»Was meinst du, Schreihals? Den Schneiderladen können wir uns jetzt wohl in die Haare schmieren. Madame wird mich zwanzig Jahre länger als geplant auf die Piste schicken müssen.« Der Kakadu hockte auf der Lehne eines Küchenstuhls und sträubte den Schopf. Er schaute skeptisch aus. »Möchtest du lieber obdachlos sein und auf dem Kirschbaum wohnen? Wo dich die Katze holt?«
Es hob Rosis Stimmung nicht im Mindesten, als am nächsten Morgen der Dachdecker samt seinen wackeren Gesellen und dem schweren Gerät anrückte. Sie ängstigte sich um ihren Garten. Rosen und Lavendel konnten zertrampelt, die Himbeeren und Apfelbäume umgeknickt werden.
»Frau Märzenbacher«, adressierte der Dachdecker ihre Brüste, als wüsste er genau, dass sie diejenigen waren, die am Ende seine Rechnung bezahlten, »wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden behutsam sein.«
Was bedeutete, dass sie den riesigen Container für die Überreste des Daches mitten in den Rosen abstellten. Und dabei einem unglücklichen Lavendelstrauch die Hälfte seiner Äste abbrachen. Rosi versuchte sich nicht vorzustellen, was sie umwühlten, wenn sie das Ding in zwei Wochen voll beladen wieder abtransportierten. Länger sollte der Verhau nämlich nicht dauern. Daran hatte Rosi keinen Zweifel. Bis zum selben Abend, nach einer Unmenge Staub und ohrenbetäubendem Lärm, lagen beinahe alle Ziegel im Container. Nur der morsche Dachstuhl ragte trotzig gen Himmel. Es gruselte ihr gewaltig vor ihrer fast nackten Gartenlaube. Am liebsten hätte sie ihre Handtasche, die schwertlilienfarbene Jacquardstola aus Kaschmir und Seide, die Nähmaschine, ihre lädierte Stoffkatze und den Kakadu gepackt und wäre in den Gartenpavillon umgezogen, aber vor dem gruselte es sie noch mehr. Rosi war sich nämlich sicher: Dort spukte es. Die Lichterkette rings um das Dach und die Fenster führte ein rätselhaftes Eigenleben. Die Glühbirnen brannten von alleine und wann es ihnen passte.
Rosi war deshalb froh, dass sie für ein paar Stunden ins Kabinett der Wunder auswitschen konnte. Das schwarze Samtkleid sollte endlich seinen großen Auftritt bekommen.
Doch vor der Garderobe fing Madame sie ab und zitierte sie ins Büro. Das war nicht gerade der flauschigste Ort der Welt und wirkte dank der Eisenregale mit den Aktenordnern, der kahlen weißen Wände und dem hellen Licht wie ein Fremdkörper in der verschnörkelten Plüschatmosphäre des Kabinetts. Nur zwei rote Samtsofas und der wuchtige Schreibtisch aus fast schwarzem Holz, der den meisten Platz einnahm und angeblich unglaublich wertvoll und antik war, stammten noch von Madames Großmutter. Rosi kannte wirklich keine Kollegin, die gerne in den »Marderbau« ging.
»Zuckerstück«, sagte Madame, sobald sie hinter ihrem windschnittigen Bildschirm saß, und tat, als sei nichts Besonderes. Rosi ahnte jedoch, dass Madame sich nicht nach dem Zustand ihres Daches erkundigen wollte. Sie tippte auf etwas Geschäftliches.
Der Grund, weshalb sich die Eichentüre der Eratogasse Dreizehn nur in den drei Nächten um Vollmond öffnete, war, dass dieses sehr spezielle Varieté der Anbahnung diente. Denn die Haupteinnahmequelle des Kabinetts der Wunder bestand eben darinnen, dass man die Gesellschaft der Damen zu horrenden Preisen buchen konnte. Und wollte man eine von Madames Damen buchen, so musste der geneigte Neukunde zunächst einen Platz im Varieté ergattern. Was etwa durch Fürsprache eines bereits gut eingeführten Stammgastes geschehen konnte, wobei sich auch hartnäckig das Gerücht hielt, dass ein Platz sogar vererbt werden konnte. Rosi spekulierte deshalb, dass ein neuer Gast ein Auge auf sie geworfen und um eine Verabredung gebeten hatte. Sie rätselte, wer das sein konnte, denn sie konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, in letzter Zeit irgendjemandes Aufmerksamkeit erregt zu haben.
Aber da täuschte sie sich.
»Zuckerstück …«, sagte Madame.
»Egal was es ist – ich mache es«, sagte Rosi. »Ich brauche jetzt jeden Groschen.«
Madame stutze und runzelte die Stirn. »Warte doch erst einmal …«
»Hast du eine Ahnung, wie viel ein verrottetes Mansardendach kostet? Den Garten machen die mir auch kaputt. Fünf Rosenstöcke sind platt. Die Sippschaft würde sich eher die Hände abhacken, als mir zu helfen, und meine Cousine will ich nicht wieder anpumpen.« Rosi schnappte nach Luft.
»Zuckerstück, du bist das geizigste und vernünftigste Ding, das mir je untergekommen bist«, fing Madame nun geduldig an und deutete auf Rosis treue Handtasche. »Dieses Museumsstück schleppst du herum, seit ich dich kenne. Hast du für die damals nicht dein erstes Geld verpulvert, das du hier verdient hast? Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine finanzielle Lage gar so dramatisch ist.«
»Und was wird aus meinem Schneiderladen? Du predigst doch immer, wie schwer es ist, in unserem Gewerbe den Absprung zu schaffen, und dass man keinesfalls darin alt werden soll.«
Madame seufzte und erklärte ihr (nicht zum ersten Mal), sie könne gerne bis zu ihrem Lebensende die Kostüme für das Kabinett schneidern und im Übrigen würde sie auch der Mattenklott mit Kusshand zurücknehmen. »Im äußersten Notfall musst du eben ein paar Zimmer deiner Villa untervermieten.«
»Denkst du, Lola würde bei mir einziehen wollen?«
»Hör auf, dich zu grämen, sonst kommen die grauen Haare schneller, als dir lieb ist. Dir steht ein Geldsegen ins Haus.«
Aha. Rosi hielt den Mund, denn es wurde spannend. Als sie sich alles angehört hatte, wäre sie beinahe vom Stuhl gekippt. Was Madame ihr zweifelsohne ansah.
»Gerade hast du noch vollmundig erklärt, du würdest alles tun, egal was es ist.«
»Da wusste ich ja noch nicht, um wen es geht.« Ausgerechnet der Uhu wollte sie buchen. Eine ganze Nacht. Uäh. »Du hattest dem doch Hausverbot verpasst.«
»Ich habe es mir anders überlegt.« Madame grinste wie ein Marder, der ein Hühnernest ausnahm. »Schau, Zuckerstück. Dieser Herr Filmstar scheint zwar launisch und eitel zu sein, aber harmlos. Nichts, mit dem du nicht fertig werden würdest. Derzeit ist er wohl etwas … schlapp und er will unbedingt ausprobieren, ob du ihn wieder einschläferst. Leichter kannst du dein Geld nicht verdienen.«
Das sah Rosi etwas anders. Wenn es irgendwie ging, dann vermied sie unter allen Umständen, über Nacht bei einem Kunden zu bleiben. Sie fand das lästig. Man bekam einen steifen Nacken und zu wenig Schlaf. Die Locken verknoteten, die Gesichter verknitterten, die Luft wurde dick infolge verschiedener Ausdünstungen. Und jemand, der sie zuvor unelegant bestiegen hatte, blies ihr anschließend zur Krönung seinen Mundgeruch ins Ohr. Diese ganzen Genüsse sollte man Rosis Meinung nach schön den Gattinnen und Freundinnen, den Geliebten und Affären vorbehalten und professionelle Gesellschaftsdamen damit verschonen. Mit Schrecken dachte sie daran, wie lange ihr nach dem Halloweenabenteuer die verbogenen Knochen wehgetan hatten. Da verbrachte sie ja leichter noch eine Nacht bei ihrem leckgeschlagenen Dach.
»Der hat mich und mein schönes, funkelnagelneues Samtkleid vollgesabbert.«
»Wenn dir die Angelegenheit so zuwider ist, dann brauchst du nicht tapfer zu sein.«
»Was ist, wenn der Uhu nicht bloß schlafen will?«
»Es ist alles inbegriffen.«
»Wann soll ich den gnädigen Herren denn treffen?«
»Morgen.«
»Schon. Und wo?«
Madame rümpfte die Nase. »Im Leda. Er ist praktisch ein Nachbar von uns.«
»Er wohnt in dem ramponierten Kasten?«, fragte Rosi überrascht. Schon seit etwa hundert Jahren, also seit sie im Kabinett der Wunder auftrat, hatte Rosi den ramponierten Kasten, der ganz bestimmt in keinem Touristenführer erwähnt wurde, nicht mehr betreten. Dabei hatte sie früher als Lehrmädel bei der greisen Schneiderin in der Meletegasse dort in der Mittagspause oft eine heiße Schokolade getrunken. Doch Madame und Frau Leda befanden sich in einem Clinch, der bereits in der Generation ihrer Großmütter begonnen hatte und dessen Grund schon lange vergessen, aber nicht vergeben war. Rosi hätte den Uhu und seinen umbrabraunen Anzug ganz woanders gesucht. Nämlich in den besten Häusern am Platze.
»Er ist wohl einer der Dauergäste.«
Rosi seufzte schicksalsergeben. Sie hatte keine Lust auf den Uhu. Dabei konnte sie nicht einmal so genau sagen, warum. Schließlich gab es wirklich unangenehmere Kundenwünsche, die obendrein sehr viel weniger lukrativ waren. Ihr kam das Blatt mit den Zahlen und Pfeilen an ihrem Kühlschrank in den Sinn. Und der in weite Ferne gerückte Schneiderladen. Vielleicht waren ein bisschen Sabber und ein verspannter Nacken und sogar das Leda doch zu verschmerzen.
»Also gut. Wenigstens schnarcht er nicht. Falls es schlimm wird, mache ich die Augen zu und denke an mein Dach.«
»Braves Mädchen. Dann wäre das also geklärt«, sagte Madame und erklärte Rosi, dass sie nun ihre Tasche nehmen und nach Hause gehen könne. »Du kennst die Regel. Meine Mädchen tauchen nicht übernächtigt bei einem Kunden auf. Selbst wenn der angeblich nur schlafen will.«
»Und wann darf ich dann endlich mein Kleid vorführen?«
»In vier Wochen, Zuckerstück. Das läuft dir ja nicht weg.«
»Aber die anderen räumen nie die Kostüme ordentlich auf!
Da ist immer alles voller Falten und Knitter.«
»Ich werde schon ein wachsames Auge darauf haben.«
Rosi war der Abend endgültig verhagelt. Der Uhu verdarb ihr jetzt schon zum zweiten Mal den großen Auftritt. Aber sie wusste es natürlich besser, als mit Madame über deren »Goldene Regeln« zu diskutieren. Schnaubend und schmollend stapfte sie aus dem Marderbau. Das Kabinett der Wunder war zwischenzeitlich vom Klappern der Absätze, Rascheln der Stoffe, Gegacker und allgemeinem Flügelschlagen erfüllt. Zentrum des Ganzen war natürlich die Garderobe. An der wollte sie sich still, heimlich und leise vorbeischleichen. Doch in der offenen Türe lungerte Lola herum. Die steckte schon halb in ihrem Kostüm, einer Korsage, die durchaus an ein medizinisches Hilfsmittel aus dem vorletzten Jahrhundert erinnerte und so konstruiert war, dass es wirkte, als würde der Buckel die Schnürung sprengen.
»Was machst du denn für ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, Rosina? Bangst du noch immer um dein Dach? Ich dachte, die Handwerker waren schon da. Was hat Madame von dir gewollt?«
In der Garderobe war es nun plötzlich sehr viel stiller geworden. Rosi seufzte. Sie ahnte, dass alle die Ohren spitzten. Obwohl Madame Klatsch und Tratsch nicht litt, hatte Lola trotzdem dafür gesorgt, dass wirklich jeder im Kabinett der Wunder über Rosis Missgeschick während der Halloweenfeier im Bilde war. Flüsternd erzählte sie Lola darum in kurzen Sätzen, was ihr am nächsten Abend blühte.
»Im Ernst? Der bucht dich zum Einschlafen?«, trompetete Rosis Freundin wie immer alles direkt heraus. Rosi schloss die Augen. Das Gekreisch aus der Garderobe ließ das komplette Haus wackeln. Jetzt machte der Uhu sie also auch noch zum Gespött der Kolleginnen im Kabinett. Schlimmer konnte es ja wirklich nicht mehr kommen.
Der Überraschungsbesuch(eins und zwei)
Bevor Fabian zu seiner Marketingmission für Whisky aufbrach, oder wie er überzeugt war, bevor er von einem Gaul stürzen und sich das Genick brechen würde, blieben ihm sage und schreibe zwei volle Tage ohne Verpflichtungen. Jedenfalls hatte er ernsthaft geglaubt, ihm würden sage und schreibe zwei volle Tage ohne Verpflichtungen bleiben. Aber da hatte er die Rechnung wie immer ohne seine Entourage gemacht. Der Werbemarathon für den Film vom Arx war zwar abgeschlossen und alle Interviews gegeben und auch Glitzer, Glamour und Gewühl der trubeligen Vorweihnachtszeit waren noch nicht richtig in Schwung gekommen, doch fand die Dolhopf andere Mittel und Wege, ihn zu beschäftigen. Und so peitschte sie ihn am ersten freien Tag durch einen weiteren Maklertermin, ließ seinen Schopf neu einfärben, zwang ihn, sich bei seiner Stiefmam, zu melden und jagte ihn zu guter Letzt zu einer Vorbesprechung der Spendengala einer Stiftung, die sich der Erforschung seltener Erbkrankheiten verschrieben hatte.
»Womit werden Sie mir morgen den Tag verderben?«, erkundigte er sich gähnend, während er in seiner Höhle im Leda Joghurt und Müsli mit Banane und Honig löffelte. Jetzt, wo er ernsthaft mit der Diät für den moribunden Börsenmakler begonnen hatte, erschien ihm der Film doch keine so gute Idee mehr. »Haben Sie ein Interview mit dem Zecke vom Achtuhrblatt oder ein Kaffeekränzchen mit Hurstel vereinbart, weil Exfrau Nummer Zwei jetzt auch noch die Katze will?«
Die Dolhopf holte die Seifenschale aus dem Bad, zündete sich einen Zigarillo an und stieß einige derart auffallend zufriedene Rauchkringel aus, dass er glatt fürchtete, ins Schwarze getroffen zu haben.
»Beinahe hätte ich es vergessen. Heute um neun kommt Ihr Betthupferl.«
»Mein was?«
»Ihr Betthupferl. Sie hatten mir aufgetragen, das Callgirl mit den haselnussbraunen Locken zu organisieren, damit Sie ausgeschlafen auf ihren vierbeinigen Co-Star steigen. Ich habe für heute Abend um neun Uhr einen Termin vereinbart. Das ist in einer Dreiviertelstunde.«
Fabian ließ den Löffel sinken.
»Erinnern Sie sich nicht?«
Natürlich erinnerte er sich daran, mit dem Schädel voller Whisky und Schlaftabletten den exzentrischen Filmstar gegeben und abstruse Sonderwünsche geäußert zu haben.
»Seit wann tun Sie, was ich sage?«
Das trug ihm eine Ladung Zigarilloqualm ein. »Ich möchte jedenfalls nicht in Ihrer Haut stecken, wenn Ihre Schatzmeisterin Ende des Monats Kassensturz macht. Das Betthupferl verlangt für seine exklusive Anwesenheit denselben Stundensatz wie Sie.«
»Jojo ist gerade mein geringstes Problem. Ich habe fast kein Bargeld da – oder haben Sie das wohlweislich gleich mitorganisiert?«
»Ach, bei einem derart exklusiven Escortservice bringen die Damen ein mobiles Kartenlesegerät mit. Das funktioniert mit SIM-Karte. Wie bei einem Handy.«
»Himmel. Die Freuden der Technik. Dann müssen Sie jetzt nur noch mein Plastikgeld aus Ihrem Gewahrsam entlassen.«
Die Dolhopf schepperte. »So weit kommt es noch! Ich habe das Geld im Voraus überwiesen. Von Ihrem Spielgeldkonto. Natürlich steht es Ihnen frei, ein Trinkgeld zu geben, wenn Sie mit der Darbietung des Betthupferls zufrieden waren.«
»Das haben Sie ja alles ganz fantastisch organisiert«, hörte er sich sagen.
»Nicht wahr? Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, mich anzurufen, wenn Sie Ihr Betthupferl über haben oder wieder keinen hochbekommen. Diesmal können Sie sich die ganze Nacht im Bad einsperren und so tun, als würden Sie duschen. Ich helfe Ihnen ganz bestimmt nicht.«
Und damit warf sie die Türe hinter sich ins Schloss und ließ Fabian zurück, bedröppelt und jeglicher Möglichkeit beraubt, eine Szene zu machen. Er seufzte und schwor sich, falls er jemals wieder unpässlich in die Fänge einer Sirene geriet, garantiert nicht seine Assistentin herbeizuzitieren, um ihn ohne Kollateralschäden aus einer misslichen Lage hinauszumanövrieren. Anschließend genehmigte er sich einen Schluck Whisky. Es bestand nicht der Hauch einer Chance, dass ihn die Dolhopf nur foppte. Fabian beschloss, sich nicht beeindrucken zu lassen, sondern sein gewohntes Abendprogramm zu absolvieren. Er lüftete den Qualm hinaus und tappte ins Bad. Unter der Dusche überlegte er, ob er für die Katzenfrau den lässigen Filmstar geben sollte. Er baute sich mit der Zahnbürste vor dem Spiegel auf, straffte die Schultern, hielt den Kopf gerade und suchte nach einem abgebrühten, freundlichen Monolog, um sie direkt wieder fortzuschicken. In den paar Minuten, die ihm blieben und die er eigentlich dazu nutzen sollte, um sich außer einer Unterhose etwas anzuziehen und die verstreuten Skizzenbücher und die schmutzige Wäsche unter das Bett und in den Koffer zu stopfen, fiel ihm nichts Überzeugendes ein. Er würde improvisieren und der Dolhopf wegen Übereifers kündigen müssen.