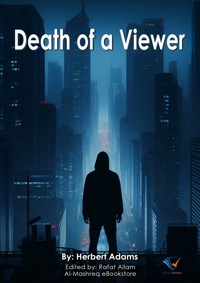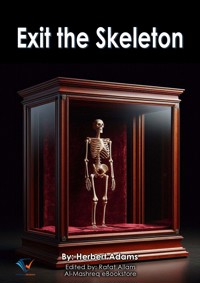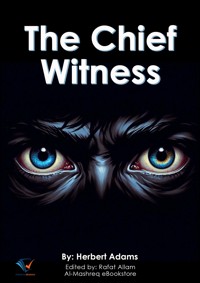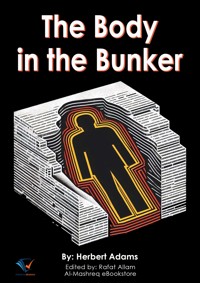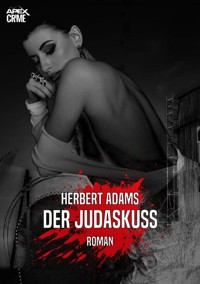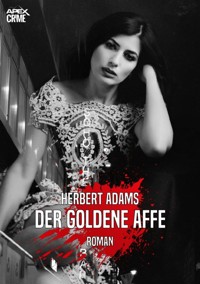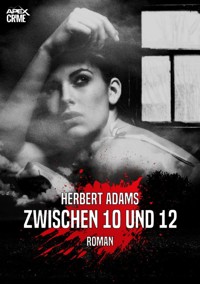6,99 €
Mehr erfahren.
Er war allein, als er nach kurzer Fahrt Lavender Cottage, ein reizendes kleines Häuschen, das über den weiten Golfplatz hinwegblickte, erreichte.
Der Name des Hauses ließ an feine alte Damen des vergangenen Jahrhunderts, an Reifröcke und Ringellöckchen denken, aber die Wirklichkeit war ganz anders. Auf sein Klingeln öffnete ein junges, frisches Hausmädchen und meldete ihn der Besitzerin. Beim Betreten des Wohnzimmers wusste er sofort, dass ihm noch nie im Leben eine solche Frau begegnet war. Künstler würden ihr Haar vielleicht anders beschrieben haben, ihn erinnerte es an den Glanz alten, hochpolierten Mahagonis. Ihre Augen zeigten ein klares Smaragdgrün, ihre Haut ließ an weiche, weiße Seide denken, ihre vollen roten Lippen wussten nichts von einem Lippenstift, und dies alles wurde von einem freundlichen, mutwillig erscheinenden Lächeln verklärt. Ein kurzer wollener Rock, Jackett und Weste im Herrenschnitt und eine kleine schwarze Krawatte. Sie saß am Schreibtisch und rauchte eine Zigarette in einer langen Spitze.
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Eine Tasse Tee erschien erstmals im Jahr 1951; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1957.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
HERBERT ADAMS
Eine Tasse Tee
Roman
Apex Crime, Band 148
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
EINE TASSE TEE
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Er war allein, als er nach kurzer Fahrt Lavender Cottage, ein reizendes kleines Häuschen, das über den weiten Golfplatz hinwegblickte, erreichte.
Der Name des Hauses ließ an feine alte Damen des vergangenen Jahrhunderts, an Reifröcke und Ringellöckchen denken, aber die Wirklichkeit war ganz anders. Auf sein Klingeln öffnete ein junges, frisches Hausmädchen und meldete ihn der Besitzerin. Beim Betreten des Wohnzimmers wusste er sofort, dass ihm noch nie im Leben eine solche Frau begegnet war. Künstler würden ihr Haar vielleicht anders beschrieben haben, ihn erinnerte es an den Glanz alten, hochpolierten Mahagonis. Ihre Augen zeigten ein klares Smaragdgrün, ihre Haut ließ an weiche, weiße Seide denken, ihre vollen roten Lippen wussten nichts von einem Lippenstift, und dies alles wurde von einem freundlichen, mutwillig erscheinenden Lächeln verklärt. Ein kurzer wollener Rock, Jackett und Weste im Herrenschnitt und eine kleine schwarze Krawatte. Sie saß am Schreibtisch und rauchte eine Zigarette in einer langen Spitze.
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Eine Tasse Tee erschien erstmals im Jahr 1951; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1957.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
EINE TASSE TEE
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
»Ist das Ihre erste Seereise?«
»Meine erste und jedenfalls auch die letzte.«
»Gefällt es Ihnen nicht?«
»Ich genieße jeden Augenblick, aber wenn ich nach Hause komme, erwartet mich eine Stellung – und da ist von Luxusdampfern keine Rede mehr.«
»Doch! Aber mir geht es auch so...«
»Dann sind wir ja Leidensgefährten«, lachte sie und blickte dann wieder schweigend nach der Küste.
Es war Mitte Juli und der dritte Tag der Reise. Nach einer etwas stürmischen Überfahrt glitt die Atlanta Star sanft in den ersten Fjord, den die beiden je gesehen hatten.
Dunkel und geheimnisvoll lag die bergige Küste vor ihnen, unzählige Sterne flimmerten in dem schwarzblauen Samt des Himmels, und der Mond zeichnete seinen silberglänzenden Weg auf das Wasser, dessen glatte Oberfläche nur durch die Wellen gekräuselt wurde, die das Riesenschiff verursachte. Das Wunder dieser prachtvollen Sommernacht ließ die beiden Menschen vergessen, wie fremd sie einander waren. Er, ein gutaussehender Mann in der Mitte der Zwanzig, sie, einige Jahre jünger, dunkeläugig, schlank und – nach seiner Meinung wenigstens – außergewöhnlich hübsch.
»Nur drei Wochen«, murmelte sie und blickte über die Reling auf das schimmernde Wasser des Fjords.
»Man behauptet, eine Seereise dürfte nie länger als drei Wochen dauern. In den ersten acht Tagen lernt man die Menschen an Bord kennen, in der zweiten Woche gewinnt man sie gern, und in der dritten fängt man an, sie unausstehlich zu finden...«
»Dauern Ihre Freundschaften gewöhnlich so lange?«, fragte sie.
»Ist doch merkwürdig, dass Frauen alles gleich persönlich auffassen müssen«, gab er zurück. »Drei Tage sind schon vorüber. Drei verlorene Tage, denn ich habe erst heute zum ersten Mal mit Ihnen sprechen können. Ich habe viel nachzuholen, Miss... übrigens, ich heiße Bruce Dickson.«
»Schotte, wie ich annehme?«
»Nein, ich nicht, aber mein Pate. Ihm verdanke ich meinen Vornamen und einen silbernen Patenbecher – das ist alles.«
»Vielleicht haben Sie ihn enttäuscht.«
»Möglich. Aber jetzt sind Sie an der Reihe. Also noch einmal: ich heiße Bruce Dickson.«
»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Dickson«, lachte sie. »Ich heiße Ella Chilcott.«
»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Miss Chilcott.« Er verbeugte sich tief. »Reisen Sie allein?«
»Ja. Und Sie?«
»Gleichfalls – bis jetzt wenigstens. Aber nun nicht mehr, wie ich hoffe.«
Sie lachte leise auf, und beide blickten wieder zu den hohen Bergen der Küste hinüber.
»Wollen Sie mir erzählen, was für eine Stellung auf Sie wartet?«, fragte er dann.
»Sie fangen an! Männerarbeit ist immer interessanter als die von uns Mädels.«
»Darüber lässt sich streiten. Ich bin Arzt und gehe jetzt als Assistent zu einem älteren Kollegen in Dorset, Wintley Harford heißt das Nest, mit der Aussicht, später die Praxis mal übernehmen zu können...«
»Wintley Harford – doch nicht Dr. Endicott?«
»Allerdings... kennen Sie ihn?«
»Ja. Ein Onkel von mir lebt dort in der Nähe: Mr. Blount.«
»Der alte Bartholomäus Blount? Gutsbesitzer und Friedensrichter? Er ist doch das große Tier da? Der Mann, um den sich alles dreht.«
»Stimmt alles. Merkwürdig, dass Sie gerade Onkel Barty kennen...«
»Bis jetzt noch nicht, aber bald – von seinem Kahlkopf bis hinunter zu den Hühneraugen, wie ich hoffe.«
Sie lachte wieder.
»Das bezweifle ich stark; erstens hat er wundervolles dichtes Haar und zweitens wahrscheinlich überhaupt keine Hühneraugen. Er ist verblüffend rüstig und kann Ärzte nicht ausstehen; er glaubt nicht an sie, behauptet, alle wären Wichtigtuer und Schwindler...«
»So eine Niedertracht! Aber man kann nie wissen. Auch die kräftigsten Menschen können einmal zusammenbrechen, und wenn man mich dann kommen lässt, könnte ich ja, wenn Ihnen etwas daran liegt... wissen Sie, so ein paar Tropfen Arsenik in seine Medizin...«
»Sie sollten sich schämen, so etwas zu sagen. Nutzen würde mir das übrigens nichts. Meine Chance habe ich verloren.«
»Wieso?«
»Das werden Sie schon erfahren, wenn Sie nach dort kommen. Onkel Blount ist Junggeselle und hat einen ganzen Haufen bedürftiger Neffen und Nichten. Manchmal zieht er den, dann wieder einen anderen vor. Und so sind sie natürlich alle sehr eifersüchtig aufeinander und tun, was sie nur irgend können, um einen guten Eindruck, bei ihm zu machen.«
»Und warum sollte er nicht Sie begünstigen?«
»Ich sagte Ihnen ja schon, dass ich meine Chance verloren habe. Vor drei Jahren, nach dem Tod meiner Mutter, lebte ich eine Zeitlang in seinem Haus.«
»Er hätte Sie doch adoptieren können...«
»Das wäre vielleicht auch geschehen, wenn ich mich gut betragen hätte.«
»Das ist ja fürchterlich, was man da zu hören bekommt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass man in einem Nest wie Wintley Harford auf Abwege geraten könnte...«
»Vielleicht erleben Sie das selbst noch«, gab sie lachend zurück. »Ich war respektlos, und das genügte völlig. Wenn mich irgendjemand vielleicht gewarnt hätte... aber so musste ich jedenfalls gehen.«
»Was haben Sie denn eigentlich verbrochen, wenn ich fragen darf?«
»Eine seiner Nichten lebt in seinem Haus. Sie werden sie sicherlich kennenlernen – Miss Aird. Ich sage Tante Isabel, obgleich sie nicht meine Tante ist.«
»Wohl so eine Art ältliche Cousine?«
»Ja. Alle meine Vettern und Basen sind viel älter als ich, und ich musste sie Onkel und Tante nennen. Die erste Lektion, um Respekt zu lernen, nehme ich an...«
»Und vollkommen richtig! Auch ich werde sehr bald ein paar graue Haare bekommen und bin sehr dafür, dass man respektvoll behandelt wird. Doch das nur so nebenbei. Bitte weiter, Miss Chilcott.«
»Tante Isabel ist sanft und nachgiebig, lebt aber in ständiger Angst vor Onkel Barty und wird von ihm behandelt wie ein... ein Fußabtreter. Die anderen Verwandten besuchten ihn ab und zu und wurden auch nicht viel besser behandelt. Mit der Zeit werden Sie sie alle kennenlernen...«
»Sind sie auch sanft und nachgiebig?«
»Das können Sie selbst herausfinden. Wenn sie dort sind, zieht Onkel Barty sie ständig auf; sind sie weg, amüsiert er sich über ihre Unterwürfigkeit. Er erzählte mir immer wieder, dass ihre Zuneigung weiter nichts als Schwindel wäre, dass nicht einer von ihnen Rückgrat hätte, dass keiner auch nur ein Wort gegen ihn wagen würde, um nicht die Aussichten auf eine Erbschaft aufs Spiel zu setzen. Er freute sich, wenn der eine den anderen schlechtmachte, um sich selbst bei ihm in ein besseres Licht zu setzen.«
»Reizender alter Herr! Und worüber stolperten Sie?«
»Er war zu sehr daran gewöhnt, dass jeder vor ihm kroch. Und einmal sagte er etwas, das mich die Selbstbeherrschung verlieren ließ. Ich erzählte ihm, wie abstoßend er war, fragte ihn, wie er Zuneigung von Menschen erwarten könnte, die er gegeneinander aufhetzte, sagte ihm, dass es erbärmlich und niederträchtig von ihm sei, mit seinem Geld seine eigenen Verwandten so zu locken und aufzustacheln...«
»Da haben Sie dem alten Herrn ja allerhand erzählt! Und was sagte er?«
»Ich muss mich wirklich sehr deutlich ausgedrückt haben. Natürlich hatte ich kein Recht, so zu sprechen; ich war ja noch nicht einmal siebzehn Jahre alt. Aber ich sah Tante Isabel weinen, und da konnte ich mich nicht mehr halten. Es macht ihm direkt Vergnügen, seine Verwandten zu quälen und zu peinigen.«
»Er war natürlich ärgerlich?«
»Ärgerlich? Wütend war er! Ich musste meine Sachen packen und sofort das Haus verlassen. Die Schwester meines Vaters nahm mich auf. Diese Seereise war ihr letztes Geschenk für mich, bevor ich mit meiner Arbeit anfange. Haben Sie schon viele solcher Seereisen gemacht?«
Der Ton dieser letzten Worte ließ erkennen, dass sie nicht weiter über sich selbst zu sprechen wünschte. Aber Bruce Dickson war nicht der gleichen Meinung.
»Das ist meine dritte Reise; die beiden vorhergehenden brachten mich nach dem Mittelmeer. Und vom alten Barty haben Sie nie wieder etwas gehört?«
»Kein Wort. Nicht einmal mein Name durfte dort mehr erwähnt werden, hat man mir erzählt. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur den Wunsch hatte, ihn zu erwähnen.«
»Schon im eigenen Interesse? Ich kann mir nicht denken, dass ich eine sehr große Liebe für diese Herrschaften empfinden werde, aber der alte Herr interessiert mich. Wie kommt es eigentlich, dass er so vermögend ist, und die anderen keinen Pfennig besitzen?«
»Männliche Ungerechtigkeit«, lächelte das junge Mädchen. »Sein Vater hatte einen Sohn und drei Töchter. Der Sohn bedeutete ihm alles, die Töchter aber nichts. Onkel Barty ist der einzige seiner Generation, der noch lebt. Seine Schwestern heirateten, sie und ihre Männer starben, und deren Kinder sind es, die er jetzt so peinigt. Aber so schlecht ist Onkel Barty eigentlich nicht. Er hat auch Augenblicke, wo er menschlich denkt und fühlt.«
»Aber durch die ständige Kriecherei vor ihm zu sehr verwöhnt...«
»Das mag sein. Eigentlich muss man seinen Vater, der sein Vermögen so verteilte, für alles verantwortlich machen.«
»Und die anderen Neffen und Nichten? Sind sie ungefähr so alt wie Sie?«
»Aber nein!«, rief sie. »Alle fünf sind alt genug, um meine Eltern sein zu können. Ein Vetter ist verheiratet und hat einen neunzehnjährigen Jungen...«
»Wie kommt es dann, dass Sie so spät auf der Bildfläche erschienen?«
»Meine Mutter war die jüngste und heiratete als letzte. Sie führte den Haushalt für Onkel Barty, und er hat es ihr eigentlich nie verziehen, dass sie ihn verließ. Jetzt aber wirklich genug von meiner Familie. Ich würde nie so viel davon gesprochen haben, wenn Sie nicht nach Wintley Harford gehen würden. Eigentlich ein merkwürdiges Zusammentreffen. Jetzt erzählen Sie mir aber etwas von sich, Mr. Dickson.«
»Mein Vater ist Arzt, lebt noch. Ich bin der jüngste von sechs Geschwistern. Einer musste immer den anderen erziehen. Das zweifelhafte Resultat können Sie ja an mir bewundern. Aber Sie haben mir nicht erzählt, was für eine Stellung Sie jetzt antreten?«
»Sekretärin, bei einem Mitglied des Parlaments.«
»Große Möglichkeiten, um frühere Irrtümer gutmachen zu können!«
Er blickte nach dem Salon, aus dem die gedämpften Klänge der Musik zu ihnen drangen.
»Wollen wir nicht tanzen? Und darf ich Ella zu Ihnen sagen? Die Zeit verrinnt so schnell auf solch einer Reise...«
»Und die dritte Woche, in der man anfängt, sich nicht ausstehen zu können, ist sehr bald da«, unterbrach sie ihn lachend.
Zweites Kapitel
»Wie geht es Ihnen, Mr. Blount? Ich musste Ihnen doch meine herzlichsten Glückwünsche bringen. Wie sagt der Psalmist: Euer Leben währet siebzig Jahre... Sollte ich je dieses Alter erreichen, kann ich mir nur wünschen, dann so gesund und kräftig zu sein, wie Sie es heute sind.«
»Danke, Vikar. Sehr nett von Ihnen, Mrs. Hake. Meine Neffen kennen Sie wohl schon?«
»Eine ganze Familienversammlung, um den Tag zu feiern«, strahlte Ehrwürden Nikodemus Hake. »Alle können sehr stolz auf Sie sein, Mr. Blount. Ja, ja, alles gute Bekannte. Wie geht es Ihnen, Miss Isabel? Nach Ihrem Onkel sind Sie der beste Mann in der Gemeinde. Habe ich das nicht immer gesagt, liebe Frau?«
»Das schon«, entgegnete Mrs. Hake, »nur zweifle ich, ob man das wirklich als ein Kompliment auffassen darf.«
»Vielleicht hast du recht, meine Liebe. Frauen müssen in erster Linie weiblich sein – und das ist Miss Isabel... immer bereit, Gutes zu tun.« Er wandte sich einem der Herren zu. »Und das hier ist – einen Augenblick, ich vergesse nie ein Gesicht – ach, jetzt hab ich’s: Sie sind Charles Aird. Wie geht es Ihnen, Charles?«
»Ich fürchte, Sie haben sich geirrt, Sir. Charles ist nicht hier. Ich bin Aubrey Burrard.«
»Ach, jetzt erinnere ich mich: Aubrey Burrard, der Architekt...«
»Wieder falsch, Vikar«, lachte der alte Barty. »Aubrey ist Künstler – das sollen wir wenigstens glauben. Er malt modern, müssen Sie wissen, Bilder, die niemand versteht und kein Mensch ansieht, geschweige denn kauft. Gehört zu einer ganz neuen Richtung... nichts als Verschwendung von Zeit und Farbe.«
Der freundliche Geistliche blickte bestürzt und verblüfft auf den Künstler, der aber nicht antwortete, sondern nur verdrossen vor sich hinsah.
»Ja, ich verstehe ja die moderne Malerei auch nicht, bin aber überzeugt, dass sie für den Künstler selbst etwas... hm... Wundervolles sein muss«, sagte er begütigend.
»Auch da sind Sie auf dem Holzweg, Vikar«, Blounts laute Stimme klang verächtlich. »Es soll ja gar nicht wundervoll sein; die Farbenkleckser verstehen es ja selbst nicht. Einmal hat ein Maler sechs Kollegen vor sein Bild gesetzt. Jeder sollte aufschreiben, was es darstellt. Nicht zwei Antworten stimmten überein, und der schlaueste von ihnen erklärte, dass er das Bild nicht beschreiben, sondern nur fühlen könnte. Kann ich mir denken. Der Mann muss viel ausgehalten haben!« Und er lachte schallend.
Ein verlegenes Schweigen folgte. Bartholomäus Blount war ein Mann, dessen Persönlichkeit alles andere in den Schatten stellte und erdrückte. Fast zwei Meter groß, dichtes, schneeweißes Haar, blaue, scharfe Augen, ein faltenloses Gesicht, dessen gesunde Farbe nicht an siebzig Lebensjahre denken ließ. Breitbeinig stand er auf dem Teppich vor dem Kamin und blickte selbstbewusst und überlegen von einem zum anderen.
Mrs. Hake begann, hastig mit Isabel über kirchliche Angelegenheiten zu sprechen. Isabel, die Haushälterin des alten Mannes, war klein und dunkel, ungefähr in der Mitte der Vierzig, die sie ganz und gar nicht zu verleugnen suchte. Möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, schien ihr Hauptwunsch zu sein.
»Hier haben wir den Architekten.« Onkel Barty wies auf einen anderen jungen Mann, der seinem Bruder, dem Künstler, auffallend ähnelte. »Rupert. Bis jetzt hat er noch kein einziges Haus gebaut, und ich bezweifle, dass er es je so weit bringen wird. Auch wieder die ganz modernen Ideen! Bruch mit allen alten Überlieferungen. Eisenbeton mag ja sehr praktisch sein, aber schön ist er nicht. Warum Privathäuser und öffentliche Gebäude auf einmal wie Fabriken oder Gefängnisse aussehen müssen, ist mir unklar.«
»Schönheit« – der Vikar lächelte Rupert an – »liegt im Auge des Betrachters...«
»Die Wilden bewundern tätowierte Gesichter und Nasenringe«, sagte Mr. Blount grob. »Gibt’s nicht bald Tee?«, wandte er sich scharf an Isabel.
»Ich klingle sofort«, entgegnete sie leise.
»Vielleicht erinnern Sie sich noch an Edwin und seine Frau«, fuhr der alte Mann fort. »Und hier haben wir auch ihren Sohn Dick. Alle sind sie gekommen, um mir zu meinem Geburtstag Glück und langes Leben zu wünschen«, fügte er mit nicht zu verkennender Ironie hinzu.
»Ihr Vorgänger würde sich sicher an uns erinnern, Mr. Hake«, sagte Edwin, ein kleiner, dunkler Mann mit blassem Gesicht, der seiner Schwester Isabel ähnlich sah. Er war offensichtlich fest entschlossen, auf jeden Fall liebenswürdig zu sein und alle mehr oder weniger angenehmen Anspielungen zu überhören.
»Ihr Vorgänger hat uns getraut, Mr. Hake, aber wir tragen es ihm nicht nach. Stimmt das nicht, Daphne?«
Er wandte sich seiner um vieles größeren Frau zu.
»Das habe ich ihm schon lange verziehen«, kicherte sie geziert. »Sie sind erst seit drei Jahren hier, Mr. Hake? Finden Sie Wintley Harford nicht reizend? So eine wundervolle Gegend und so interessante Menschen.« Ihr Lächeln war an Onkel Barty gerichtet.
»Ja«, bestätigte der Vikar. »Nach meiner Tätigkeit in Manchester ist es hier sehr friedlich und angenehm. Der richtige Platz, um die letzten Jahre seines Lebens in Ruhe und zugleich nützlicher seelsorgerischer Arbeit zu verbringen.«
Ein höhnischer Blick flog von einem der beiden Brüder zum anderen. Dann brachte der Tee eine willkommene Abwechslung.
»Eine Geburtstagstorte, wie ich sehe«, versuchte der Vikar sein Glück von neuem, »aber keine Kerzen.«
»Siebzig Kerzen auszublasen, ist keine Kleinigkeit«, bemerkte der neunzehn Jahre alte Dick. »Aber ich glaube, du könntest es, Onkel Barty.«
»Ja, mein Junge, und noch ein paar dazu«, sagte der alte Mann lächelnd.
Tee und Kuchen wurden herumgereicht.
»Edwin«, sagte Isabel hastig, »das ist Onkels Tasse.«
Er nahm die Tasse und brachte sie dem alten Herrn, der immer noch vor dem Kamin stand. Mr. Blount dankte und stellte sie auf den Kaminsims hinter sich.
»Zu heiß«, brummte er. »Noch etwas Milch.«
Eine allgemeine Unterhaltung entspann sich.
»Noch etwas Tee, Onkel?«, fragte der Architekt Rupert. »Zu liebenswürdig«, lächelte Onkel Barty ironisch, als sein Neffe Isabel die leere Tasse zurückgab.
»Wundervolles Porzellan«, sagte Mrs. Hake. »Ich muss sagen, aus solch kostbaren Tassen schmeckt der Tee noch einmal so gut – nur hat man Angst, sie zu benutzen.«
»Heute ist ja eine besondere Gelegenheit«, bemerkte Isabel mit ihrer etwas schrillen Stimme. »Wir gebrauchen die Tassen auch nicht alle Tage. Aubrey, bring dies bitte Onkel Barty.« Der verdrossen aussehende Künstler brachte die kostbare Tasse an den Kamin. Jeder schien in irgendeiner Weise gefällig sein zu wollen.
»Haben Sie gehört«, fragte der Vikar plötzlich, »dass sich hier ganz in der Nähe eine – wie soll ich sagen –, eine Nackt-Kolonie niedergelassen hat? Was können wir dagegen machen?«
»Nichts«, erwiderte Onkel Barty kurz. »Lassen Sie die Leute in Ruhe; die werden schon allein zur Vernunft kommen. Man spricht davon, als ob Nachtkultur eine Beschäftigung wäre. Ist es aber gar nicht. Man kann seine Sachen ausziehen, aber was ist dann?... Die meisten Menschen müssen für ihren Lebensunterhalt arbeiten, und ohne Kleider lässt sich das schlecht machen. Ein Mann kann ohne Taschen nicht existieren – von Wärme wollen wir noch gar nicht sprechen. Na, und die Frauen? Die hätten schon längst auf Kleider verzichtet, wenn sie nicht wüssten, dass sie mit Kleidern viel netter aussehen.«
»Ausgezeichneter Gedanke, Onkel«, rief Edwin. »Anzüge sind nur der Taschen wegen notwendig! Ein nackter Mann mit einem kleinen Handköfferchen, in dem er Schlüssel, Taschentuch und was er sonst noch braucht, unterbringt, würde etwas merkwürdig aussehen.«
»Eigentlich kein Thema für Damenohren«, sagte Mr. Blount, »aber – was gibt’s?«, wandte er sich dem Butler zu, der ihm ein Telegramm auf einem silbernen Tablett überreichte. Er riss es auf und las laut vor: »Mögest Du den 17. Oktober noch viele Male erleben. Herzliche Glückwünsche. Deine Nichte Ella.«
Sein Ton ließ nicht erkennen, wie er diese Worte aufnahm. Die anderen Verwandten tauschten vielsagende Blicke miteinander aus.
»Es freut mich, dass Ella daran gedacht hat«, sagte Isabel.
»Eigentlich hätte sie doch eine kleine Aufmerksamkeit senden müssen«, murmelte Daphne vorwurfsvoll.
»Da fällt mir ein«, rief Onkel Barty in seiner gewohnten, spöttischen Weise. »Haben Sie schon meine Geschenke gesehen, Mrs. Hake?«
»Nein«, antwortete sie aufstehend, »aber das möchte ich noch nachholen.«
Er führte sie zu einem kleinen Tischchen und legte das Telegramm in die Mitte der verschiedenen Geschenke.
»Wirklich ein großes Ereignis, wenn man siebzig wird«, brummte er. »Charles konnte nicht kommen, hat mir dafür aber hundert Zigarren geschickt. Ausgezeichnete sogar. Eine habe ich schon geraucht. Möchte wissen, wieviel er dafür schuldig geblieben ist. Das hier ist von Isabel« – er wies auf einen kleinen Stoß Taschentücher. »Erst dachte ich, es wären gestickte Hosenträger wie im vergangenen Jahr – aber die hier gefallen mir besser.«
»Es ist immer so schwierig, einem Mann etwas zu schenken«, murmelte Mrs. Hake. »Mein Mann kann immer Socken gebrauchen, und die stricke ich ihm. Sonst wüsste ich auch nicht, was ich ihm schenken sollte. Was für ein hübsches Bild!« Sie wies auf ein kleines Aquarell, das eine Karte mit der Aufschrift In Liebe von Edwin und Daphne trug.
»Ja«, sagte der alte Herr höhnisch. »Sie bestärken mich in meinem schlechten Geschmack. Nicht wahr, Aubrey?«
»Und das ist natürlich Dick«, Mrs. Hake nahm ein Lichtbild in silbernem Rahmen auf.
»Mit seiner Fußballmannschaft«, erklärte die Mutter stolz. »Er hat letztes Jahr an allen Spielen teilgenommen.«
»Hat sich viel zu lang auf der Schule herumgedrückt«, brummte der Onkel. »Wenn ein junger Mensch für seinen Lebensunterhalt zu sorgen hat, ist es besser, er beginnt möglichst früh damit.«
»Du hast recht, lieber Onkel«, bestätigte Daphne mit honigsüßer Miene. »Du hast immer recht. Aber wenn heutzutage ein Anwalt zu etwas kommen will, muss er die bestmögliche Erziehung haben. Pflichtest du mir nicht bei, lieber Onkel? Wenn Dick nach Cambridge hätte gehen können, würde das von großem Nutzen für ihn gewesen sein.«
»Hätte sich um ein Stipendium bemühen sollen«, sagte Mr. Blount bissig. »Mit etwas mehr Verstand hätte er das schaffen können. Wie gefallen Ihnen die Bücher?«, wandte er sich wieder an Mrs. Hake.
»Sehr nett«, sagte sie gedankenlos.
Dann meldete der Butler: »Das Pferd ist fertig, Sir.«
»Aber heute Nachmittag wirst du doch nicht ausreiten, Onkel?«, rief Isabel hastig.
»Und warum nicht?«, entgegnete er schroff. »Jeden Nachmittag nach dem Tee reite ich bei gutem Wetter spazieren. Warum soll ich das nicht tun, wenn ich siebzig geworden bin? Ich habe mich doch seit gestern nicht verändert. Ich hoffe, das noch in den nächsten fünf, nein, zehn Jahren so machen zu können. Mr. und Mrs. Hake werden mich sicherlich entschuldigen.«
»Aber natürlich«, murmelten die beiden. »Wir wollten sowieso gehen. Lassen Sie sich durch uns bitte nicht aufhalten.«
Auf den Gedanken wäre der alte Herr überhaupt nicht gekommen. Er verabschiedete sich von den beiden und ging mit weitausholenden Schritten zur Tür.
»Ihr seid ja noch hier, wenn ich zurückkomme«, warf er seinen Verwandten über die Schulter zu.
Dann schloss sich die Tür hinter ihm.
Drittes Kapitel
»Der alte Mann wird jeden Tag unausstehlicher«, sagte Daphne. »Ich kann nicht verstehen, warum ihr euch alles gefallen lasst. Immer wieder sage ich Edwin, dass Onkel mehr Respekt vor uns haben würde, wenn wir etwas mehr Rückgrat hätten.«
»Wie du uns das eben vorgemacht hast«, warf Isabel ein, »als du sagtest Ja, lieber Onkel, du hast immer recht!««
Sie war keine gute Schauspielerin, aber ihre Nachahmung war nicht schlecht. Daphne errötete verärgert.
»An seinem Geburtstag wollte ich mich nicht mit ihm zanken – und nicht in Gegenwart von Fremden.«
»Und hattest immer noch die stille Hoffnung, er würde großmütig die Kosten für Dicks Studium in Cambridge übernehmen.«
»Das müsste er auch! Edwin ist sein ältester Neffe und unser Dick sein einziger Großneffe. Wenn er nur ein bisschen Familiensinn hätte, dürfte er überhaupt nicht erst darauf warten, dass man ihn darum bittet.«
»Darauf warten kann er ja gar nicht«, versetzte Isabel bissig. »Die Möglichkeit hat er ja nie. Du bist mit deinen Anliegen ja immer zuerst da.«
Alle blickten die Sprecherin überrascht an. Ein Streit zwischen den beiden Frauen war nichts Außergewöhnliches, aber heute klangen Isabels Worte ungewöhnlich scharf.
»Und wenn wir mal um etwas bitten«, gab Daphne zurück, »erhalten wir herzlich wenig. Dafür sorgst du schon, meine Liebe.«
»Na, na«, begütigte ihr Mann. »Lasst doch die Streitereien; es führt ja doch zu nichts. Der alte Herr ist heute siebzig Jahre alt, und wir müssen versuchen, ihm den Tag so angenehm wie möglich zu machen, auch wenn es nicht ganz einfach ist.«
»Ich begreife nicht, warum du so viel Aufhebens machst, dass er siebzig geworden ist«, sagte sein Sohn Dick. »Er kann noch sehr gut seine zwanzig Jahre leben, vielleicht noch heiraten und ein halbes Dutzend Kinder haben – euch zum Ärger...«
»Sei still, Dickie«, rief seine Mutter tadelnd.
Man saß noch im Wohnzimmer, wo der Tee eingenommen worden war. Der Geistliche mit seiner Frau hatte sich verabschiedet, und die Familienmitglieder erwarteten die Rückkehr des alten Mannes von seinem gewohnten Nachmittagsspazierritt. Es war ein behaglicher Raum, in dem sie sich befanden, einer der vielen behaglichen Räume des alten, großen Gebäudes. Die dunkle Eichentäfelung, der große, offene Kamin ließen unwillkürlich an die Gastfreundschaft vergangener Tage denken. Die alten, wertvollen Möbel, der riesige Perserteppich hatten wohl schon Generationen gedient, aber sie gehörten zu diesem Raum, zu diesem Haus und zum alten Barty. Die Stimmung in dem großen Zimmer war unbehaglich. Die beiden Brüder, Rupert und Aubrey, standen verdrossen am Fenster. Man sah ihnen an, sie wünschten sich weit weg, aber sie waren aus London gekommen und so gezwungen, die Nacht in Wintley Harford zu bleiben. Edwin besaß in der Nähe Dorchesters eine kleine Hühnerfarm und war mit Frau und Sohn im Auto herübergekommen. Wie ihr Onkel behauptete, hinderte die Farm sie nur daran, Dummheiten zu machen, war aber sonst zu nichts nütze. Sie versuchten, ihren Sohn Dick bei einem Anwalt in Dorchester unterzubringen, da der alte Barty für ein Studium in Cambridge nicht zu haben war. Die beiden Schwägerinnen, die immer noch aufeinander herumstichelten, waren gleichaltrig, aber so grundverschieden, wie zwei Frauen es nur sein konnten. Isabel war klein und unbedeutend, Daphne kolossal. Sie lieferte den Beweis für die Behauptung, dass kleine Männer sich meistens von großen Frauen angezogen fühlen – vielleicht kommen sie sich dann selbst größer vor. Der kleine Edwin war offensichtlich außerordentlich stolz auf seine große, rundliche Frau, hatte aber manchmal Schwierigkeiten, seine väterliche Autorität Dick gegenüber aufrechtzuerhalten, der nach seiner Mutter geraten war und seinen Vater um Kopfeslänge überragte.
Daphnes einziger Ehrgeiz war schick zu sein. Wenn sie sich auch nicht alles leisten konnte, was sie sich wünschte, so gab es doch, Gott sei Dank, Dinge, die auch für eine schmale Börse erreichbar waren. Ihre Lippen und Fingernägel glänzten ständig in leuchtenden Farben, und nichts gefiel ihr mehr, als bei allen passenden Gelegenheiten ihre mächtigen, strumpflosen Beine sehen zu lassen, ihre in Sandalen steckenden Füße, deren Nägel das gleiche Rot zeigten. Ihre Augenbrauen waren schon seit langem verschwunden, und der übermäßig lange, dunkle Strich an ihrer Stelle raubte dem rundlichen, etwas törichten Gesicht auch den letzten Anspruch auf Charakter. Aber für Edwin war und blieb sie unvergleichlich.
»Warum ist eigentlich Charles nicht gekommen?«, unterbrach sie schließlich das immer drückender werdende Schweigen. »Schreibt, er hätte Grippe und befürchtet, Onkel Barty anzustecken. Eigentlich sehr schlau gemacht, und das Fahrgeld hat er auch gespart. Warum haben wir denn nur nicht an Zigarren gedacht, Edwin? Onkel Barty scheint sich ja viel aus Zigarren zu machen.«
»Aber, liebes Kind« – ihr Mann warf einen vorsichtigen Blick nach dem am Fenster stehenden Maler – »du hast doch selbst gesagt, dass ihm ein kleines Bild besser gefallen würde.«
»Das scheint aber nicht zu stimmen. Wo, meinst du, wird er das Bild hinhängen, Isabel?«
»Sicher über sein Bett, neben Dicks Foto«, entgegnete ihre Schwägerin ironisch. »Dann kann er beide zu gleicher Zeit sehen.«
»Das möchte ich bezweifeln. Aber Zigarren wären doch richtiger gewesen. Wenn er die Zigarren raucht, muss er ja an den Geber denken.«