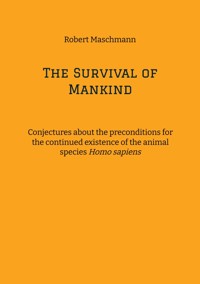9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein Mann und seine Familie haben ein Meer aus Feuer überlebt, das ihre Heimat zu Asche verbrannt hat. Die Tage sind nun dunkel und düster. Es gibt kaum noch Nahrungsmittel und Trinkwasser. In den Nächten herrscht eine undurchdringliche Finsternis. Die Ehefrau des Mannes ermordet schließlich ihre beiden Kinder und begeht Selbstmord. Der Mann folgt ihnen nicht in den Tod. Er glaubt, dass es irgendwo noch eine bunte, lebendige Welt gibt, die er finden muss, um leben zu können und nicht sterben zu müssen. So macht er sich auf den Weg durch die Asche der verbrannten Erde, um diese Welt zu suchen. Doch der Tod lässt ihn nicht mehr aus den Augen und jeden Tag muss er um sein Leben kämpfen. Aber durch die Kämpfe, die er zu bestehen hat und durch die Menschen, die er auf seinem Weg trifft, zeigt ihm diese neue und dunkle Welt aus Asche, was es in Wahrheit bedeutet, ein Mensch zu sein. So wird seine Suche nach einer nicht zerstörten, heilen Welt auch zu einer Reise in sein innerstes Selbst, zu einer Reise in das kalte Herz der Finsternis…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Ähnliche
„Wenn du am Morgen widerwillig aufwachst, dann halte dir vor Augen: Ich wache auf, um die Arbeit eines Menschen zu tun.“
Marc Aurel, Selbstbetrachtungen
„Blicke in dich. In deinem Innern ist eine Quelle, die nie versiegt, wenn du nur zu graben verstehst.“
Marc Aurel, Selbstbetrachtungen
Robert Maschmann
Einführung in die Philosophie des Stoizismus
Eine Reise in das kalte Herz der Finsternis
© 2024 Robert Maschmann
ISBN
Softcover:
978-3-384-10046-7
Hardcover:
978-3-384-10047-4
E-Book:
978-3-384-10048-1
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Der Jäger
Der Hund
Michael
Die Anderen
Judit
Hanna
Svenja
Das Meer
Einführung in die Philosophie des Stoizismus
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Das Meer
Einführung in die Philosophie des Stoizismus
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
Vorwort
Dieses Buch ist die Neuauflage meines im Jahre 2018 veröffentlichten Buches „Reise ins Innere der Finsternis“. Eine Neuauflage ist deswegen notwendig geworden, da ich im Unterschied zur Veröffentlichung im Jahre 2018 einen neuen Schluss eingefügt habe, der mir im Hinblick auf den Verlauf der in diesem Buch erzählten Geschichte angemessener erscheint. Auch habe ich für diese Neuauflage den ursprünglich von mir angedachten Titel „Einführung in die Philosophie des Stoizismus“ verwendet.
Der Jäger
Zum ersten Mal seit dem Beginn seiner Reise durch die zerstörte Welt sah der Mann heute am frühen Nachmittag wieder einen anderen Menschen. Für einen Augenblick nur fing er durch Zufall mit seinem Fernglas einen Schatten ein, der sich gar nicht mehr so weit entfernt von ihm zwischen den verbrannten, toten Bäumen eines Waldes bewegte und der so schwarz und so unwirklich war wie die toten Bäume selbst. Aber ohne jeden Zweifel konnte der Mann den Umriss des Schattens als die Gestalt eines Menschen erkennen.
Viele Tage folgte der Mann nun schon dem Fluss seiner Heimat nach Westen und suchte sich an dessen Ufer seinen Weg entlang verkohlter Waldstücke und abgebrannter Feldhaine, vorbei an den toten und schwarzen Gerippen von Bäumen, Büschen und Sträuchern, deren Blätter und feinen Äste die Feuerstürme mit ihrer Gluthitze zu Asche zerblasen hatten.
Seitdem diese Feuer wieder erloschen und verschwunden waren, verhüllte eine tiefhängende, undurchdringliche und dunkelgraue Wolkendecke Tag und Nacht den gesamten Himmel von Horizont zu Horizont. Trotzdem fiel kein Regen mehr. Deshalb gab es in dieser neuen und verbrannten Welt seit langem schon nur noch das Wasser des Flusses. Auch aus diesem Grund musste der Mann dem Fluss folgen.
An einem einzigen Tag hatten die Feuer beinahe alles verschlungen, verbrannt und als Asche wieder ausgespien, was sich auf der Oberfläche der Erde befand. Auch das Wasser des Flusses war von dieser Asche immer noch trüb und grau. Darum trank der Mann das Wasser aus dem Fluss nur dann, wenn er es vorher gefiltert und gereinigt hatte. Trotzdem war ihm und auch seiner Familie anfangs davon übel geworden, aber nach einiger Zeit konnten sie es trinken, ohne krank zu werden. Jetzt, da seine Familie tot und er auf dem Weg nach Westen und zum Meer war, gab ihm dieses Wasser, ja der Fluss selbst die Gewissheit, Tag für Tag, solange er in seiner Nähe blieb, am Leben zu bleiben.
Anstatt des Regens waren nach den Feuern aus dem düster gewordenen Himmel für einige Zeit nur noch die zarten Flocken der Asche gefallen, die nun wie ein feiner und dunkler Schnee die verwüstete Oberfläche der Erde bedeckten. Dann, nach dem Ende des Ascheregens, hatte auch der Wind die verwandelte Welt verlassen. Nur kurz, nur wenige Tage, bevor er für immer verschwand, hatte der Wind mit der Asche gespielt, sie ungleichmäßig über die zerstörte und verbrannte Erde verteilt, kleine Wehen gebildet und manche Stellen ganz von ihr befreit. Auf diese Weise behielt die Erde die Erinnerung daran, dass es den Wind jemals gegeben hatte. Diese neue, dunkle Welt aus Asche schien nun fertig zu sein und nichts, weder Wind noch Regen, sollte sie mehr verändern.
Manchmal glaubte der Mann, vor sich auf seinem Weg den zarten Trieb einer Pflanze in der Asche gesehen zu haben. Dann blieb er stehen, ging in die Hocke, kniete sich auf den Boden, wischte mit der Hand vorsichtig die Asche beiseite und untersuchte mit seinen Fingern ein wenig die an der Oberfläche steinharte Erde. Aber unter der Asche war sie überall nur schwarz, ausgetrocknet und tot. Alles am Boden war zu Asche verbrannt und die Wurzeln der Pflanzen schon längst verfault. Auch Insekten sah und fand er keine mehr. Nur die Würmer waren noch da, weiter unten. Um sie zu finden und zu essen, musste er tiefer graben.
Tag für Tag suchte der Mann mit seinem Fernglas die Aschefelder, die sanft ansteigenden Abhänge des Tales, die gegenüberliegende Seite des Flusses bis zum Horizont ab und hielt nach Tieren und vor allen Dingen nach Vögeln Ausschau. Doch seit den Bränden hatte er keine Tiere und keine Vögel mehr gesehen. Nur den Schatten dieses anderen Menschen.
Entlang seines Weges gab es viele kleine Dörfer und einzelne Weiler, die Häuser meist niedergebrannt bis auf ihre Fundamente, jedes angefüllt mit einem Balkengewirr, schwarz und verkohlt, mit eingestürzten Decken und zerschlagenen Ziegeln, die Gärten zerstört, die Autos nur noch ausgebrannte Wracks, die Straßen zerbrochen. Einzelne Häuser, in jedem Dorf, in jeder Stadt vielleicht eines, manchmal auch gar keines, waren kaum zerstört und verbrannt. Den Grund dafür konnte der Mann nicht erkennen. Diese Häuser hatten nie irgendetwas Außergewöhnliches oder Besonderes an sich. Auch sein Haus war von den Flammen verschont worden. Deshalb, so glaubte der Mann, war er noch am Leben.
In den kaum zerstörten wie auch in den wenigen, nur halb verbrannten Häusern suchte er nach Lebensmitteln und all dem, was er für seine Reise durch die Asche brauchen konnte. In allen anderen, völlig niedergebrannten und zerstörten Häusern war, wenn überhaupt, nur in den Kellern noch etwas Brauchbares zu finden. Selten fand der Mann einen Zugang zu einem dieser Keller, der dann aber meistens genauso wie das Haus, zu dem er gehörte, vollständig verwüstet und zerstört war. Viel an Lebensmitteln war es nicht, was er in den Häusern und in den Kellern fand. Vielleicht fand er eines Tages gar nichts mehr. Das hätte seinen sicheren Tod bedeutet. Aber daran dachte er nicht. Er wollte leben. Um jeden Preis. Deshalb war er unterwegs. Doch der Tod beobachtete ihn stets genau und ließ ihn nicht aus den Augen.
Am Tage auf den Aschefeldern zwischen den Dörfern und Städten übersah der Mann die Umgebung weit nach allen Seiten. Der Tod konnte ihm hier nicht lange verborgen bleiben. Welche Gestalt auch immer er annahm, um ihn zu täuschen und ihn zum Narren zu halten: schon aus der Ferne würde der Mann den Tod erkennen. Auch diesen anderen Menschen hatte er schließlich gesehen. In den ausgeglühten Dörfern und Städten mit ihrem unübersicht lichen Gewirr von Ruinen, zerstörten Straßen und ausgebrannten Fahrzeugen war der Tod dem Mann jedoch ganz nah. In jeder Ruine, hinter jeder eingestürzten und verbrannten Mauer konnte er sich verbergen und auf den Mann warten, um ihm das Leben zu nehmen; heimtückisch, hinterhältig und überraschend, so wie es seine Natur war. Vielfältig und wandelbar war hier seine Gestalt. Ein anderer Mensch vielleicht, der in einem zerstörten Haus mit einer Pistole, einem Gewehr oder auch nur mit seiner Verzweiflung bewaffnet auf den Mann lauert. Vielleicht aber auch eine einstürzende Decke oder eine umstürzende Mauer, die den Mann in einer Ruine auf der Suche nach Nahrung begräbt. Doch der Mann musste in diese Städte und Dörfer hineingehen, musste die Ruinen absuchen, musste in die Keller der Häuser kriechen. Nur dort fand er Nahrungsmittel und alles das, was er sonst noch zum Überleben brauchte. Jeden Tag musste der Mann sich dem Tod ausliefern. Aber so wie am Tage lauerte der Tod auch in der Dunkelheit der Nacht schlaflos und unsichtbar auf seine Beute. Der Mann hatte aus diesem Grund stets Angst davor, in der Nacht noch durch die Asche gehen zu müssen, denn er konnte in der undurchdringlichen Finsternis nichts sehen und der Boden war immer uneben, zerfurcht und löcherig. Sehr leicht hätte er sich deshalb bei einem Gang durch die Finsternis einen Knöchel verstauchen oder stolpern und sich beim Fallen einen Knochen brechen können. Dann wäre er verloren gewesen. Denn in dieser neuen und verbrannten Welt gab es keine Hilfe mehr. Trotzdem war der Mann überzeugt, den Tod hier in der Asche besiegen zu können.
Tagsüber folgte der Mann dem Fluss oft entlang einer Straße, die mehr oder weniger nahe an dessen Ufer verlief und auf der verstreut nun viele ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen waren. Nur noch deren Metallgerippe waren übrig geblieben als Skelette seltsamer Dinge einer längst vergangenen, versunkenen Zeit, vernichtet und zerstört. Der Asphalt war durch die Hitze an manchen Stellen aufgebrochen und die Asphaltstücke waren gelegentlich ineinander geschoben wie Eisschollen auf einem Fluss. Auch eine große Zahl verbrannter und manchmal mit dem Asphalt verschmolzener Leichen lag neben und auf der Straße, meist nur noch Kohleklumpen mit verschmorten Armen und Beinen, manchmal glänzend schwarz, erschlagen vom Feuer, vom Leichentuch der Asche bedeckt. Sah er ab und zu verbrannte Menschen, die ihn fast noch wie lebendig aus dunklen und leeren Augenhöhlen und mit gebleckten weißen Zähnen anstarrten, dann erschrak er stets darüber, wie selbstverständlich und alltäglich der Anblick dieser zahllosen Leichen für ihn schon geworden war. Sie gehörten nun als Tote zu dieser neuen Welt aus Asche, so wie sie früher als Lebende zu der untergegangenen, schon fast vergessenen, bunten Welt gehört hatten.
Meist kam er nur mühsam voran, da er einen etwa zweieinhalb Meter langen, mehr als einen Meter breiten und mit fast einen Meter hohen hölzernen Bordwänden versehenen vierrädrigen Handwagen recht schwer und beladen hinter sich herzog. Aus zwei Stricken hatte der Mann zwei Schlaufen geknotet, die Stricke an der Deichsel des Handwagens festgezurrt und die Schlaufen über seine Schultern gestreift. Ein Geschirr für ihn, um den Handwagen besser ziehen zu können. Die zerstörte Straße konnte er mit dem Handwagen kaum benutzen. Deshalb versuchte er auf Feldwegen zu gehen, die recht oft entlang des Flusses und der Straße verliefen. Wenn es keine Feldwege gab, dann war er gezwungen, sich seinen Weg über abgebrannte Felder und Wiesen zu suchen. Sein Marsch mit dem Handwagen war dann eine Qual.
Gelegentlich musste der Mann größere Waldstücke umgehen, denn zahlreiche umgestürzte Bäume versperrten ihm den Weg durch sie hindurch. Immer noch stürzten auch Bäume um und machten jeden Aufenthalt in einem Wald sehr gefährlich. Es wunderte ihn deshalb, den anderen Menschen gerade in einem verbrannten Wald zwischen den toten Bäumen gesehen zu haben. Wusste dieser Mensch nicht, wie gefährlich das war? War dieser Mensch vielleicht nicht sonderlich schlau?
Hin und wieder stieg der Mann auf einen Hügel oder eine Anhöhe an seinem Weg, um sich einen besseren Überblick über das Gelände vor ihm zu verschaffen. Dort stand er dann meist eine Weile und atmete tief die merkwürdigerweise sehr frische, nach Brand schmeckende Luft ein. Die Welt kam ihm von hier oben stets wie gereinigt, wie desinfiziert und gesäubert vor für etwas Neues, bisher noch nie Gesehenes. Mit einem beinahe ehrfürchtigen Staunen betrachtete er jedes Mal erneut die zerstörte und verwüstete Welt unter ihm wie ein Entdecker, der als erster Mensch einen neuen, unbekannten, exotischen Kontinent bereist. Seine Hoffnung und auch seine Neugier trieben ihn so immer weiter vorwärts, immer weiter hinein in die Trostlosigkeit dieser neuen Welt aus Asche, auch wenn ihn diese neue Welt am Ende womöglich doch töten würde.
Von Zeit zu Zeit saugte ihm die Erinnerung an den Selbstmord seiner Frau und ihrem Mord an seinen beiden Kindern alle Kraft aus den Beinen; sie wurden schwer wie Blei und gehorchten seinem Willen nicht mehr. Er stützte sich dann mit den Händen auf seine zitternden Knie, atmete schwer und wollte schreien. Einmal tat er es auch und erschrak sehr über den Zorn und den Hass in seiner Stimme, denn er glaubte, stets glücklich gewesen zu sein mit seiner Frau in der alten, verbrannten Welt und sie immer geliebt zu haben, auch nach den Bränden, als sie sich veränderte und sie ihm immer fremder wurde. Aber seine Frau war eine Mörderin. Sie hatte ihn belogen und getäuscht, sie hatte seine Liebe für ihren Mord an seinen Kindern missbraucht. Warum sollte er da seine Frau nicht auch hassen, warum sollte er da nicht zornig sein dürfen?
So war jeder Schritt hier in der Asche für den Mann stets wie ein Abschied aus seinem alten, verbrannten Leben, aber noch nie war einer seiner Schritte bis jetzt auch ein neuer Anfang für ihn gewesen. Seine Schritte trieben nur die Zeit voran und seine Fuß spuren zeigten ihm, wie er sich selbst in die Vergangenheit hinein verlor. Dort war er nur noch ein flüchtiger Schatten, zusammengesetzt und geformt aus den Bruchstücken fahler und verblassender Erinnerungen.
Das Keuchen seines Atems, das Knirschen seiner Schritte auf dem verbrannten Boden, das Rumpeln und Klappern des Handwagens: die einzigen Geräusche, die noch zu hören waren. Wäre er nicht mehr da, dann würde es endlich ganz still sein.
Auch der Mensch, den er heute gesehen hatte, war allein. Da war sich der Mann ganz sicher. Würden ihm mehrere Menschen durch die Asche folgen, dann hätten ihn diese bestimmt schon längst überfallen, obwohl er ein Gewehr, eine Pistole und ein Katana hatte. Ihre Überzahl hätte sie mutig gemacht und der Hunger hätte sie schließlich ihre Zweifel und ihre Vorsicht vergessen lassen. Dieser andere Mensch, allein und auf sich selbst gestellt, war aber scheinbar noch nicht hungrig und verzweifelt genug, um einen Angriff zu wagen.
Das Gewehr schnallte sich der Mann immer deutlich sichtbar mit einem Riemen auf den Rücken, die Pistole steckte er sich stets in einen Gürtel, mit dem er seine verschlissene und stumpf riechende schwarze Lederjacke zusätzlich geschlossen hielt. Das Katana trug er so oft es ging in der Hand und nur wenn sein Marsch zu beschwerlich wurde, dann legte er es in den Handwagen, um diesen zusätzlich mit beiden Händen besser ziehen zu können. Denn sobald der Mann das Katana in seiner Hand hielt, glaubte er zu wissen, seine Heimat in Wahrheit immer noch in der längst vergangenen bunten und lauten Welt zu haben und nur für eine Weile hier in der Asche leben zu müssen. Dann hatte er das Gefühl, noch er selbst zu sein und die verbrannte Erde sei nur eine falsche Welt, aus der er entkommen und die er hinter sich lassen konnte. Dann war er sich sicher, in dieser neuen, dunklen und kalten Welt bestehen zu können, nicht verrückt werden zu müssen in ihrer Trostlosigkeit und die alte, bunte und lebendige Erde jenseits all dieser Zerstörung irgendwann wiederzufinden.
Vor zwei Tagen schon meinte der Mann, in der Totenstille der Abenddämmerung das kaum vernehmbare Knacken einiger Äste hinter sich dort, woher er gekommen war, gehört zu haben. Seit einer ganzen Weile und geduldig wie ein Jäger auf der Fährte seiner Beute schien der andere Mensch ihm also bereits durch die Asche zu folgen. Es wäre deshalb sehr einfach für diesen anderen Menschen gewesen, den Mann während dieser Zeit mit einem Gewehr oder einer Pistole aus einer sicheren Entfernung zu töten oder ihn zumindest schwer zu verletzen. Aber der Mann war noch am Leben und niemand hatte bis jetzt auf ihn geschossen. Das konnte nur einen Grund haben: sein Jäger hatte kein Gewehr und keine Pistole. Auch darüber gab es für den Mann keinen Zweifel.
Obwohl er allein und unbewaffnet war, suchte der andere Mensch dennoch die Nähe des Mannes und wartete nur auf eine günstige Gelegenheit, um ihn zu überfallen, denn er wollte natürlich den Inhalt des Handwagens für sich haben. Der Jäger wusste genau, was sich in diesem Handwagen befand. Dort hatte der Mann neben einer Garnitur Kleidung, ein paar Decken, zwei Kissen, einem Rucksack und sonstigen nützlichen Dingen für seine Reise auch seine ganzen Nahrungsmittel und Vorräte verstaut: Reis und Nudeln, Konserven mit Obst, Gemüse und Fertiggerichten, mit Hunde- und Katzenfutter, ebenso ein paar Schachteln mit Notverpflegung wie auch zwei oder drei Packungen mit Keksen sowie Vitamintabletten, Mineralstoffpräparate und Medikamente, alles über viele Tage hinweg zusammengesammelt aus den Häusern der Dörfer und Städte entlang des Flusses. Drei, wenn er sparsam war, vielleicht auch vier Wochen sicherte ihm diese Nahrung sein Überleben, obwohl der Handwagen jetzt nur noch zur Hälfte mit Lebensmitteln gefüllt war. Es lohnte sich für den Jäger, dafür sein Leben zu riskieren, den Kampf mit dem Mann zu suchen, ihn zu töten, denn die Suche nach Nahrung in dieser Welt aus Asche war mühselig und gefährlich.
So wertvoll war der Inhalt des Handwagens für den Mann, dass er ihn jeden Tag überprüfte und in einem Notizbuch alle Veränderungen festhielt. Damit man nicht schon aus der Ferne erkennen konnte, was er im Handwagen alles transportierte, hatte er über dessen gesamte Länge und Breite zwei Decken geworfen und diese mit Schnüren unter dem Handwagen hindurch festgebunden. Der Mann wusste genau, wie nutzlos das war. Aber er hatte das Gefühl, damit etwas für seinen Schutz und seine Sicherheit getan zu haben.
Sein Jäger war eine große Gefahr für ihn, denn sein Jäger war hungrig. Nein, für den Mann gab es da keinen Zweifel: ganz bestimmt war sein Jäger sogar sehr hungrig. Alle Menschen, da war sich der Mann sicher, die so wie er noch auf der zernarbten und zerschundenen Oberfläche der verwüsteten Erde lebten, unterwegs waren in den endlosen Aschewüsten von einem Nirgendwo in ein anderes, hatten so wie er ständig Hunger und waren so wie er stets auf der Suche nach Nahrung. Wie Tiere waren sie damit beschäftigt, sich selbst am Leben zu erhalten, in der Erde nach Nahrung zu wühlen, sich gegenseitig die Nahrung abzujagen, sich gegenseitig für Nahrung zu töten und am Ende doch irgendwo zu verenden. Der Mann bildete sich ein, in der vergangenen, hellen, lauten und bunten Welt wäre es anders gewesen. Als hätten dort die Menschen besser gelebt und wären sinnvoller gestorben als Insekten, die mit einem letzten knisternden Geräusch in der Flamme einer Kerze verdampfen.
Am späten Nachmittag kam der Mann zu einem alten Bahndamm, der sich wie eine Barriere von links, von Süden kommend in einem sanften Bogen wie eine Rampe ansteigend durch die Landschaft vor ihm zog. Der Bahndamm trug schon längst keine Gleise mehr, sondern war nur noch das Relikt einer vor langer Zeit stillgelegten Bahnlinie und endete steil aufragend am Flussufer. Hier hatte er, so schätzte der Mann, eine Höhe von mindestens sechs oder sieben Metern erreicht. Über den Fluss selbst führte früher einmal eine Eisenbahnbrücke. Die Fundamente der Brücke waren am Flussufer dort, wo der Bahndamm endete, noch zu sehen.
Vor ihm brach die Straße in einer Schneise durch den Bahndamm hindurch. Mitten in dieser Schneise stand ein ausgebranntes Autowrack. Zwei verkohlte Leichen saßen auf den Vordersitzen. Vielleicht waren diese Menschen auf den kindischen Gedanken verfallen, in dieser Schneise wenigstens etwas Schutz vor den Flammen zu finden und hatten deswegen ihr Auto dort abgestellt. Ein Teil der Schädeldecke bei beiden Leichen fehlte und war weggerissen. Der eine Mensch musste den anderen erschossen und sich dann selbst getötet haben. Als der Mann das Innere des verbrannten Autos und die Leichen genauer in Augenschein nahm, fand er die Pistole zwischen den verkrampften, verdorrten Fingern der Leiche auf dem Fahrersitz. In dem verformten Metallgestänge der verbrannten Rückbank lag die verkohlte Leiche eines Kindes. Er konnte an den Resten des Körpers und am Kopf des Kindes keine Schussverletzungen erkennen. Sie hatten es offensichtlich nicht fertiggebracht, ihr Kind zu erschießen. Sie hatten es lieber auf der Rückbank verbrennen lassen.
Neben der Böschung des Bahndamms, vielleicht zwanzig Schritte vom Wrack des Autos entfernt, lag der verbrannte Körper eines Etwas, das scheinbar ein Hund gewesen war. Seine Beine waren wie ab geknickte, verdorrte Äste in die Luft gestreckt, sein Körper war nur noch ein schwarzer Klumpen. Der Hund hatte keine Chance gehabt, den Flammen zu entkommen. Die Menschen im Auto hatten es gar nicht erst versucht. Das wunderte den Mann nicht. Nachdem die Feuer über die Erde hereingebrochen waren, hatte er mit Entsetzen beobachtet, wie rasend schnell sie überall über das Land zogen. Wie Rudel wilder Hunde, die ihre Beute zu Tode hetzen.
Die Straße führte nach der Schneise entlang einiger verbrannter Waldstücke hin zu einem Dorf in der Ferne; sicherlich, wie der Mann schätzte, mindestens drei- oder viertausend Schritte entfernt. Er überquerte mit seinem Handwagen die Straße von der linken auf die rechte Seite, zog ihn durch die Öffnung im Bahndamm und bog dann scharf nach rechts in die Richtung des Flusses ab. Falls dieser andere Mensch nicht bemerkt hatte, dass er entdeckt worden war, würde er ihm sicher weiter entlang der Fußspuren im vermeintlichen Schutz des Bahndammes folgen. Das war, so dachte der Mann, die Gelegenheit für ihn, seinen Jäger genauer in Augenschein zu nehmen und herauszufinden, mit wem er es da zu tun hatte.
Kurz nach der Schneise, hinter dem Bahndamm, blieb der Mann stehen, legte das Katana auf den Handwagen, streifte das Geschirr ab und begann mit dem Fernglas in der Hand den Abhang des Bahndammes hinaufzuklettern. Er musste sich durch die Gerippe verbrannter Büsche hindurchkämpfen, deren verkohlte Äste er mit seinen Armen brach wie Streichhölzer. Oben angekommen legte er sein Gewehr und seine Pistole griffbereit neben sich in die Asche und streckte vorsichtig, spärlich verdeckt durch einen verkohlten Strauch, seinen Kopf über den Kamm des Bahndamms hinaus. Rechts von ihm, vielleicht einhundert Schritte entfernt, war jetzt die Schneise mit dem verbrannten Auto. Links von ihm, ebenfalls in einer Entfernung von vielleicht einhundert Schritten, waren der Fluss und die Fundamente der Eisenbahnbrücke. Dann suchte er mit dem Fernglas das Gelände auf der anderen Seite des Bahndamms genau und sorgfältig ab. Entlang des Flussufers gab es dort viele kleinere verkohlte Waldstücke, in und zwischen denen der Jäger Deckung nehmen konnte. Heute Nachmittag war er unvorsichtig gewesen. Deshalb hatte der Mann ihn gesehen. Jetzt schien der Jäger aus seinem Fehler gelernt zu haben. Bis zur Dämmerung lag der Mann auf dem Kamm des Bahndamms. Aber er konnte nichts entdecken. Keine Bewegung, kein Laut, keine Spur, kein Anzeichen eines Menschen dort draußen in der Öde, die aussah wie eine verschneite Winterlandschaft an einem trüben, nebligen Tag. Bestimmt lag sein Jäger jetzt irgendwo dort unten regungslos in der Asche und war ihm mit Sicherheit schon sehr nahe gekommen. Vielleicht war dieser andere Mensch doch klüger und gerissener als der Mann dachte. Vielleicht war es aber auch zu offensichtlich, dass er den Bahndamm benutzte, um seinem Jäger dort aufzulauern.
Schließlich fing es an zu dämmern. Der Mann muss te seinen Hinterhalt aufgeben. Er schob das Fernglas in seine Lederjacke, warf sich das Gewehr auf den Rücken, steckte die Pistole in den Gürtel, rutschte und kletterte vorsichtig auf allen Vieren mit den Füßen voran wieder die Böschung des Bahndammes hinunter, legte das Fernglas in den Handwagen, klopfte sich die Asche aus der Kleidung, schirrte sich an, nahm sein Schwert und hielt nach einem Schlafplatz Ausschau.
Bei Einbruch der Dämmerung musste der Mann sich immer beeilen, um einen Platz für die Nacht zu finden, denn es wurde rasch dunkel und die Nächte waren von einer undurchdringlichen Finsternis. Die Dämmerung, die Zeit des Übergangs, war nur noch kurz. Es blieb wenig Zeit übrig zwischen dem Kampf ums Überleben am Tag und dem Schlaf in der Nacht. Am Morgen wurde es dann kaum hell und das Licht tauchte die verbrannten Landschaften, die ausgeglühten Städte und Dörfer auch tagsüber lediglich in einen stets gleichmäßigen und fahlen Dämmerschein. Keine Sonne, kein Mond und keine Sterne waren mehr zu sehen. Von Menschen gemachtes Licht gab es nicht mehr. Manchmal, selten, glühte die Wolkendecke in der Nacht für kurze Zeit in einem dunkelroten, düsteren Licht, das genauso lautlos und plötzlich wieder verschwand wie es gekommen war. Sah der Mann dieses Glühen in den wenigen Stunden, in denen er trotz seiner Erschöpfung nicht schlafen konnte, dachte er mit Unbehagen und neugierig zugleich darüber nach, was in und jenseits dieser undurchdringlichen Wolken decke wohl geschah. Hatten nicht Menschen vor Tausenden von Jahren mit der gleichen neugierigen Furcht darüber nachgedacht, was für seltsame Dinge denn der Mond und die Sterne waren und wer am Tag die Sonne über den Himmel zog? Hatten die Menschen darauf je wirklich eine Antwort gefunden?
Der Mann suchte sich den Ort, an dem er dann die Nacht verbringen wollte, immer nahe am Fluss oder in der Ruine eines Hauses. Heute fand er diesen Ort am Rand eines verkohlten Auenwaldes, der etwa zweihundert Schritte in westlicher Richtung vom Bahndamm entfernt direkt am Ufer des Flusses lag. Der Jäger konnte ihm hier bis zur Dunkelheit im Schutz des Bahndamms noch näher kommen, aber die Dämmerung und die hereinbrechende Nacht ließen dem Mann keine andere Wahl. In der Finsternis musste jedoch auch der Jäger genauso wie der Mann dort bleiben, wo er war. Und bis jetzt, so als würde er jeden heraufziehenden Tag in seinem Körper spüren, war der Mann immer schon vor dem Beginn der Morgendämmerung aufgewacht. Der Jäger würde ihn auch morgen nicht überraschen können.
Er löste die Schnüre der Decken, mit denen er den Inhalt seines Handwagens zu verbergen versuchte, legte die Schnüre und die Decken in den Handwagen hinein, verstaute dort ebenfalls auch das Gewehr, die Pistole und sein Katana, nahm einen Besen aus dem Handwagen heraus und säuberte damit an einer Stelle etwa fünfzehn Schritte in südlicher Richtung vom Rand des Auenwaldes entfernt den Boden von der wenigen Asche, brachte den Besen zum Handwagen zurück, nahm von dort eine Decke mit und breitete sie auf dem von der Asche gesäuberten Boden aus. Erschöpft kniete er sich auf die Decke, setzte sich auf seine Fersen und starrte einige Zeit wie gedankenverloren in das Waldstück vor ihm hinein. Nach einer Weile fingen seine Augen an zu suchen, aber es war kein Muster, keine Ordnung, kein Sinn in diesem Gewirr der Äste und Stämme zu erkennen. Ein beklemmendes Gefühl stieg in ihm auf und der Wunsch, dass es nun bald dunkel werde und er nichts mehr sehen und endlich schlafen könne. Unendlich schwer und müde fühlte er sich in solchen Momenten am Ende eines Tages und er konnte deutlich den Sinn der Welt und seines Lebens in seinen Knochen, in seinem Fleisch und in seinen Eingeweiden spüren. Aber er weigerte sich stets, ihn auch anzunehmen.
Der Mann fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, so als ob er damit seine Müdigkeit wenigstens für eine Weile noch vertreiben könnte und studierte wie jeden Abend den Ort, an dem er die Nacht über blieb, genau und sorgfältig, um sich im letzten Licht des Tages einen kurzen Weg einzuprägen, auf dem er dann in der vollkommenen Dunkelheit zu einem anderen, neuen Schlafplatz gehen wollte. Er hatte zuvor schon, noch bevor mit seinem Handwagen vor dem Auenwald stehen geblieben war, an dessen Saum eine kleine Nische entdeckt, die fünf oder sechs Schritte breit und mehr als einen Meter hoch etwa sieben oder acht Schritte in den Wald hinein führte. Das war genug Platz für ihn und seinen Handwagen. Die Nische war, soweit er sehen konnte, frei von verkohlten Stämmen und Ästen und befand sich jetzt in westlicher Richtung etwa einhundert Schritte entfernt von ihm. Dort gab es auch keine verbrannten Baumstämme mehr, die umstürzen und ihm gefährlich werden konnten, sondern nur noch Unterholz und Gestrüpp. Dorthin, so entschied er, wird er in der Dunkelheit gehen. Während die Finsternis über den östlichen Horizont heraufzog, suchte er mit dem Fernglas wieder die Umgebung ab: den Bahndamm, die Schneise, die Straße, die Anhöhen des Tales, das Dorf in der Ferne, die gegenüberliegende Seite des Flusses. Aber er konnte keinen Menschen, kein Tier, keine Bewegung entdecken.
Zuerst hatte der Mann sich über den vergeblichen Versuch geärgert, seinem Jäger auf dem Bahndamm aufzulauern. Dann jedoch war sein Ärger rasch wieder verflogen. Denn er war, so dachte der Mann jedenfalls, diesem anderen Menschen gegenüber jederzeit im Vorteil. Die Asche lag zwar überall und jeder seiner Schritte hinterließ eine Spur. Sein Jäger wusste deshalb immer ganz genau, welchen Weg er ging. Aber er hatte trotzdem nichts zu befürchten. Nachts war die Finsternis undurchdringlich. In der Nacht konnte der Jäger ihn unmöglich aufspüren, denn er sah nichts. Er konnte ihn nur tagsüber angreifen und der Mann wusste ja, dass der Jäger kein Gewehr und keine Pistole hatte. So hätte der Mann nun einfach abwarten können, bis der Hunger und die Verzweiflung den anderen Menschen am Tag in seine Arme trieb. Er wäre ihm dann weit überlegen gewesen. Schließlich war er es, der das Gewehr und die Pistole hatte. Doch der Mann wollte nicht länger die Beute sein. Er wollte nicht gejagt werden wie ein Tier. Er wollte nicht darauf warten, bis der andere Mensch vielleicht vor Erschöpfung nicht mehr weitergehen konnte und irgendwo auf der verbrannten Erde und den Aschefeldern hinter ihm verhungerte. Morgen, wenn er in das nächste Dorf kommt, wird er dort dem Jäger auflauern. So wird er es machen. Er wird sich in einem der Häuser am Rande des Dorfes verschanzen, sich dort ein sicheres Versteck suchen und auf diesen anderen Menschen warten, wie lange es auch immer dauern mag. Dann wird endgültig er der Jäger sein und der andere Mensch die Beute. Noch auf eine Entfernung von vierhundert Schritten konnte er mit seinem Gewehr Gegenstände und Dinge von der Größe eines ausgewachsenen Menschen treffen. Oftmals hatte er das auf seinem Weg durch die Aschewüste schon ausprobiert. Also müsste er seinen Jäger nur nahe genug herankommen lassen. Er würde ihn nicht verfehlen. Aber das würde er nicht tun können. Der Mann wollte kein Mörder sein. Deshalb musste er morgen einen anderen Weg finden, um sich seines Jägers zu entledigen.
Als es vollständig dunkel geworden war und die Finsternis ihn ganz verschluckt hatte, stand der Mann auf, verstaute die Decke wieder im Handwagen, schirrte sich an und machte sich auf den etwas abschüssigen Weg zu der Nische, die er am Rand des Auenwaldes entdeckt hatte. Vorsichtig ging er die kurze Strecke zu seinem neuen Schlafplatz. Die Asche dämpfte seine Schritte; nur die Konserven und Büchsen auf dem Handwagen schlugen durch die Unebenheiten des Bodens hin und her und füllten die Finsternis mit einem dumpfen, metallischen Klappern. Er hatte immer die Befürchtung, man könnte es kilometerweit hören. Aber schon wenige Schritte vom Handwagen entfernt war davon kaum mehr etwas zu vernehmen. Nach einhundert Schritten blieb er stehen, suchte tastend die Nische mit seinen Händen, erkannte, dass er genau vor ihr stand, rutschte kniend langsam, vorsichtig und geräuschlos hinein, untersuchte mit seinen Händen sorgfältig den Boden, schob noch zwei oder drei Äste beiseite, zog auch den Handwagen in die Nische und breitete die Decke, die er vor seinem Gang durch die Finsternis in den Handwagen hineingelegt hatte, nun sorgfältig auf dem Boden der Nische aus. Es erstaunte den Mann immer wieder, wie gut er im Laufe der Zeit gelernt hatte, in diesen pechschwarzen, undurchdringlich dunklen Nächten präzise die Stelle zu finden, die er sich in der kurzen Dämmerung als Versteck und Schlafplatz ausgesucht hatte. Alles war gut gegangen, denn der Tod hatte dem Mann bei dessen Gang durch die Nacht nur zugesehen. Er saß wie jede Nacht zuvor nur still in der Finsternis und lächelte spöttisch über diesen Mann, der sich so viel Mühe gab, ihn zu überlisten.
Obwohl er immer angezogen schlief, musste der Mann sich zudecken, damit er nicht fror und die Kälte ihn nicht dauernd weckte. Ein Feuer machte er in der Nacht nie, denn viel zu groß war die Gefahr, in dieser perfekten Finsternis schon über weite Entfernungen gesehen und entdeckt zu werden. Aus dem gleichen Grund gebrauchte er auch die Taschenlampe nicht, die er in seinem Handwagen dabei hatte. Nur im äußersten Notfall wollte er sie benutzen. Um im Schlaf nicht die Asche auf dem Boden einzuatmen, zog er sich immer eine Atemschutzmaske über den Mund. Seine entsicherte Pistole lag in der Nacht stets griffbereit neben ihm. Dann schob er sich noch das Kissen unter seinem Kopf ein wenig zurecht, schloss die Augen und versuchte zu schlafen.
Gegen Ende der Nacht schreckte er aus einem tiefen Schlaf auf. Mit verschleiertem Blick suchte er nur für einen kurzen Moment die Uhr, die früher immer neben seinem Bett gestanden hatte. Der kalte Brandgeruch der Asche erinnerte ihn aber sofort daran, dass er in einem verkohlten Auenwald in einer verbrannten Welt lag und es seine Uhr und sein weiches Bett schon längst nicht mehr gab.
Nach dem Aufwachen blieb der Mann stets regungslos liegen, lauschte in die Finsternis hinein und wartete, bis es hell wurde. Aber es war immer nur die Totenstille, die er hörte. Wie würde es wohl sein, nichts mehr zu hören, nicht einmal mehr die Stille?
Heute aber, in dieser Nacht, kam wie schon in man chen Nächten zuvor aus dem Süden ein dumpfes, unterirdisches Rollen zu ihm heran und er sah über den südlichen Horizont ein feines, blutrotes Licht fließen. Der Fluss, sein Auenwald, der Bahndamm und die Aschefelder waren in eine schwache, rötliche Helligkeit getaucht, gerade hell genug, um die Konturen der Dinge in nächster Nähe zu erkennen. Er kannte die Ursache dieses Rollens nicht, aber er war sich stets sicher, dass daraus auf keinen Fall eine Gefahr für ihn entstehen konnte, weil das Rollen aus einer viel zu großen Entfernung zu ihm herankam. Er hörte ihm nur zu und spürte, wie die Erde unter ihm lebte und sich bewegte. Während er regungslos in seine Decke gehüllt lauschte, gewöhnten sich seine Augen allmählich an die spärliche Helligkeit und er begann schemenhaft die Dinge um ihn herum zu erkennen. Aber dort draußen in der Finsternis war nicht nur dieses dunkle Rollen aus der Ferne. Der Mann meinte auch zu spüren, dass etwas Anderes, etwas Fremdes und Bedrohliches ihm jetzt schon sehr nahe war. Da, plötzlich, wuchs nicht weit von ihm entfernt in der Nähe seines in der Dunkelheit verlassenen Schlafplatzes aus dem mit Asche bedeckten Boden eine schwarze Gestalt empor, die sich schließlich für einen Moment nur deutlich und scharf gegen die rötlich schimmernde Wolkendecke über dem südlichen Horizont abzeichnete. Ihm war, als hätte er gerade einen Dämon gesehen, der aus der Hölle heraufgestiegen kam, um hier auf der Erde sein Unwesen zu treiben, vielleicht um Menschen zu jagen, ihr Fleisch zu essen und sich dann noch mit den Leichen zu vergnügen. Eine schreckliche kindliche Angst stieg in ihm auf, ließ sein Herz schneller schlagen und machte seinen Körper ganz heiß. Fest umklammerte er seine Pistole. Es war die einzige Bewegung, die er sich trotz seiner Angst erlaubte.
Der Jäger, nur ein Schatten in der Dunkelheit, hatte eine Axt in der Hand und bewegte sich nun gebückt, langsam, vorsichtig und geräuschlos auf die Stelle am Rand des Auenwaldes zu, wo der Mann zuerst seine Decke ausgebreitet und dann nach einem neuen Schlafplatz Ausschau gehalten hatte. Ohne Zweifel wollte er den Mann im Schlaf überraschen und ihn mit der Axt erschlagen. Schließlich hielt der Jäger inne, kauerte sich auf den Boden und musterte angestrengt und genau die Stelle, wo er den schlafenden Mann vermutete. Aber dort war nichts zu sehen, dort zeichneten sich im Schein des spärlichen rötlichen Lichts nicht die Konturen eines auf dem Boden liegenden Mannes ab. Der Jäger sah sich in der Asche kniend um, denn er hatte begriffen, was hier geschehen war. Aber wohin war der Mann gegangen, wo hatte er sich sein Versteck, seinen neuen Schlafplatz gesucht? Natürlich, es war ihm sofort klar: der Mann hatte sein Versteck in den verkohlten, mit Asche bedeckten Überresten des Auenwaldes gefunden. Dort musste er irgendwo am Rand, vielleicht aber auch unter dem Gewirr der verkohlten Äste liegen. Dort hätte auch er, der Jäger, sich versteckt. Da der Mann seinen Schlafplatz in der undurchdringlichen Finsternis der Nacht ge wechselt hatte, konnte er nicht weit entfernt sein. Vielleicht einhundert, vielleicht auch nur fünfzig Schritte. Es wäre für den Mann viel zu gefährlich gewesen, mehr als einhundert Schritte in dieser absoluten Finsternis zu gehen. Ganz sicher schlief der Mann jetzt dort in der Dunkelheit, glaubte in Sicherheit zu sein und er hatte immer noch die Möglichkeit, den Mann im Schlaf zu töten. Aufgeben konnte der Jäger jetzt nicht, das war ausgeschlossen. Denn er wusste nicht, wann er das nächste Mal in der Nacht etwas sehen konnte und dadurch die Möglichkeit hatte, den Mann im Schlaf zu überraschen. Bis dahin war er möglicherweise schon verhungert.
Der Mann lag wie erstarrt unter seiner Decke und versuchte, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Er stellte sich diese vermeintliche Kreatur aus der Hölle vor, wie sie dort draußen kauerte und überlegte. Ärger stieg in ihm auf und verdrängte seine Angst. Es musste für den Jäger offensichtlich sein, wohin er in der Dunkelheit verschwunden, wo nun sein neuer Schlafplatz war. Zu durchsichtig für einen Jäger war sein Verhalten als Beute. Außerdem hatte er nicht damit gerechnet, dass dieser andere Mensch heute Nacht etwas sehen konnte. Er war sich viel zu sicher gewesen, im Vorteil zu sein.
Langsam und lautlos näherte sich der Jäger dem Versteck des Mannes. Angestrengt und konzentriert suchte er mit seinen Blicken die fast undurchdringliche Dunkelheit vor ihm ab. Trotz des roten Dämmerlichtes konnte er die Spuren des Mannes in der Asche kaum erkennen.
Dann löste sich der Mann aus seiner Erstarrung, nahm die Atemmaske ab und rutschte behutsam, vorsichtig und ohne ein Geräusch zu verursachen, seine Pistole fest umklammert, rückwärts etwas weiter in den Wald hinein, bis seine Füße an ein Hindernis, wahrscheinlich an einen verkohlten Ast oder Stamm stießen und ihm ein weiterer Rückzug versperrt war. Langsam, ganz langsam setzte er sich auf, die Pistole im Anschlag, dem Eingang zur Nische und dem näherkommenden Jäger zugewandt. Dieser hatte von dem Rückzug des Mannes in die Nische hinein nichts bemerkt, denn er unterbrach seine Suche nicht und war schließlich genau an der Stelle, wo seine vermeintliche Beute sich versteckt hielt.
Der Jäger sah zuerst den Handwagen und wie von einem spitzen, scharfen Schmerz getroffen hielt er inne und erstarrte. Schemenhaft und undeutlich hatte er auch den Mann in der Dunkelheit erkannt und ebenso die Pistole, mit der dieser jetzt auf ihn zielte. Eine Weile kauerte er, ohne sich zu bewegen, vor der Nische und starrte in die spärlich erhellte Finsternis hinein. Dann stand er langsam auf. Seine Gestalt zeichnete sich wieder scharf gegen die blutrot schimmernde Wolkendecke ab. Er hatte verloren. Der Mann in der Nische konnte ihn nun einfach mit einem Schuss aus seiner Pistole töten. Aber der Mann schoss nicht. Er konnte den Jäger nicht einfach erschießen. Der Mann musste warten, bis es einen Grund dafür gab.
Das unterirdische Rollen aus der Ferne hatte aufge hört und das rötliche Glimmen hinter dem südlichen Horizont begann allmählich schwächer zu werden. Zugleich wurde es über dem östlichen Horizont heller. Der nächste Tag brach an.
„Geh’n Sie zurück!“
Der Befehl kam aus der Dunkelheit des verkohlten Waldes heraus. Unheimlich und fremd klang die Stimme des Mannes für ihn selbst, so lange hatte er sich schon nicht mehr sprechen gehört. Der Jäger stand nur regungslos vor der Nische und schwieg.
„Versteh’n Sie meine Sprache nicht?“
„Ich versteh’ Dich sehr gut.“
Zur Überraschung des Mannes hatte der Jäger eine weibliche Stimme.
„Zurück!“
Er machte eine Bewegung mit seiner Pistole. Da die Frau aber immer noch starr und regungslos stehen blieb, wurde die Stimme des Mannes etwas lauter und schärfer.
„Geh’n Sie zurück! Sonst schieße ich gleich.“
Die Frau machte schließlich zögernd wenige Schritte rückwärts. Der Mann streifte die Decke ab und arbeitete sich in der Hocke bis an den Rand der Nische vor, die Pistole immer auf die Frau gerichtet. Er versuchte in der spärlichen Dämmerung des anbrechenden Tages und in dem verlöschenden rötlichen Licht etwas Weibliches an ihr zu entdecken. Sie trug eine Art weiten Overall und darüber eine dicke, ihr viel zu große Weste, die leer um einen schon fast nicht mehr vorhandenen Körper baumelte. Die Frau musste bis auf die Knochen abgemagert sein. Um den Kopf hatte sie ein Tuch geschlungen, ähnlich einem Turban, das nur durch zwei schmale Schlitze hindurch ihre Augen und ihren Mund erkennen ließ. Deutlich konnte er den modrigen, unangenehmen Geruch ihrer Kleidung wahrnehmen. Niemals hätte er diesen anderen Menschen für eine Frau gehalten, aber der Klang seiner Stimme war eindeutig.
Der Mann wusste im ersten Moment gar nicht, was er mit dieser Frau nun reden sollte, die ohne Zweifel immer noch die Absicht hatte, ihn umzubringen. Es wäre besser gewesen, sie sofort zu töten. Der Mann wusste das. Trotzdem stellte er, anstatt zu schießen, eine Frage.
„Wie lange verfolgen Sie mich schon?“
„Ist das wichtig?“
„Nein, eigentlich nicht. Woher kommen Sie?“
„Ist das wichtig?“
Der Mann stand einen Moment schweigend da und musterte die Frau. Er verstand nicht, warum sie ihn provozierte, obwohl doch er die Pistole hatte.
„Nein. Haben Sie mich heute auf dem Bahndamm gesehen?“
„Du musst mich noch fragen, wie ich heiße…“
„Ist das wichtig?“
„Nee. Und klar. Klar hab’ ich Dich gesehen. So wie Du mich heute schon mal gesehen hast. Hältst mich vielleicht für blöd. Bin ich aber nich’. Wusste, dass Du da oben liegst und auf mich wartest.“
„Na ja, es war ja auch nicht so schwer zu erraten, dass ich das machen werde.“
„Wenn Du meinst.“
Sie verstummte und sah den Mann an. Der legte seinen Kopf etwas schief, musterte erneut die Frau und schien erst kurz über seine nächsten Worte nachdenken zu müssen, bevor er wieder etwas sagte.
„Warum wollen Sie mich umbringen?“
„Wieso Dich umbringen? Wie kommst Du darauf?“
Für einen Augenblick nur huschte ein kleines, feines Lächeln über den Mund des Mannes. Hielt sie ihn wirklich für so dumm und naiv?
„Na ja, Sie haben sich in der Dunkelheit mit einer Axt an mich herangeschlichen. Wollten Sie nur nachsehen, ob ich auch gut schlafe und mir nichts fehlt?“
Sie ging auf seine Bemerkung nicht ein, sondern starrte lediglich für einen Moment auf den Boden vor ihren Füßen, bevor sie ihn erneut ansah.
„Du hast Sachen, die ich brauche. Lebensmittel…“
„Aber Sie können selbst Lebensmittel suchen. So wie ich.“
„Es gibt nicht genug für alle. Du bist jetzt vor mir. Du nimmst alles weg.“
„Geh’n Sie halt woanders hin. Ins Land hinein.“