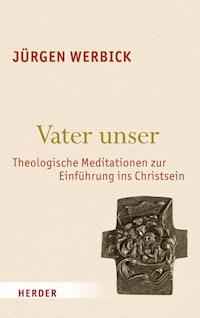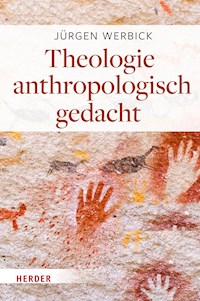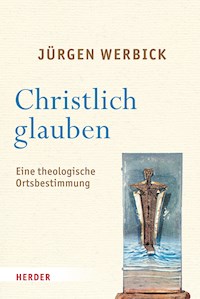Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Wie ist Theologie zu bestimmen: Ist sie wissenschaftlich und kirchlich zugleich? Erfordert ihre Kirchlichkeit nicht Abstriche an ihrer Wissenschaftlichkeit? Oder ihr Wissenschaftsanspruch Abstriche an ihrer Kirchlichkeit? Nach langer Zeit liegt mit Jürgen Werbicks Lehrbuch eine neue Wissenschaftslehre vor, die diese zentralen Fragen aufgreift und klärt. Didaktisch klug aufbereitet wird sie so den neu konzipierten theologischen Studienprogrammen gerecht und setzt weiterführende Impulse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Werbick
Einführung in die theologische Wissenschaftslehre
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2010
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Einbandgestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-33418-4
ISBN (Buch) 978-3-451-30222-0
0. Einleitung:
0.1 Gute Gründe – in der Innen- und der Außenperspektive
Was bewegt Menschen zum Glauben – oder zum Unglauben? Wie kommen sie dazu, sich vom Vertrauen auf einen guten Ausgang ihres Lebens tragen zu lassen und motiviert zu sein, mit all ihren Möglichkeiten und Kräften auf diesen guten Ausgang hinzuleben? Die guten Gründe oder Motive, die Menschen zum Glauben bewegen, sind ihnen selbst meist verborgen. Und es ist sehr die Frage, ob sie durch Selbstprüfung oder rationale Selbstreflexion einen Zugang zu ihnen finden können. Die Alltagserfahrungen im Umgang mit glaubenden, zweifelnden und nicht glaubenden Menschen scheint zudem dafür zu sprechen, dass man kaum durch die besseren Argumente zum Glauben kommt – dass Argumente allenfalls eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Schwierigkeiten mit dem Glauben zu erleichtern oder auszuräumen. Glaubensgewissheit und Glaubenshoffnung kann man nicht herbeiargumentieren. Sie stehen – von seltenen Ausnahmen vielleicht abgesehen – kaum am Ende diskursiv-rationaler Vergewisserungsprozesse und sind der reflexiven Selbstvergewisserung weithin unverfügbar.
Aus der Perspektive diskursiver Vergewisserungsprozesse, in denen ohne Rücksicht auf »subjektive Befindlichkeiten« allein das Gewicht der Argumente den Ausschlag geben soll, erscheinen Glaubensüberzeugungen deshalb eher als argumentativ nicht mehr zu würdigende individuelle Einstellungen, mit denen es jede und jeder halten möge, wie sie oder er es will, vergleichbar den Vorlieben des guten Geschmacks, über die zu streiten kaum lohnt: Chacun à son goût. Jeder soll doch glauben, was er will, und nach seiner Façon selig werden. Er ist nicht rechenschaftspflichtig, kann – wieder von Ausnahmen abgesehen, etwa wenn religiöse Überzeugungen grob gegen den guten Geschmack oder das friedliche Miteinander verstoßen – auch gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Seine Überzeugungen sind argumentativ ohne Gewicht, können im wissenschaftlichen Diskurs gar nicht erwogen und »abgewogen« werden.
Richard Rorty hat sich diese weit verbreitete Sicht der Dinge zu eigen gemacht und gefolgert, die Religionen sollten sich aus dem öffentlich-wissenschaftlichen Raum der Suche nach Wahrheit und Wissen heraushalten. Die Geltung ihrer Überzeugungen gründe sich auf rein privaten und argumentativ nicht ausweisbaren Annahmen; sie habe auch keine Bedeutung für die Geltung anderer, wissenschaftlich begründbarer Geltungsansprüche; solche Überzeugungen erklärten nichts. So seien sie für den Zusammenhang wissenschaftlich relevanter Überzeugungen bedeutungslos. Man könne ihnen anhängen oder nicht. Das mache im Kontext argumentativ überprüfbaren Wissens keinen Unterschied.1 Religiöse Überzeugungen sind – so wird man dann folgern – ihrem kommunikativen Charakter entsprechend privat. In der öffentlichen Urteilsbildung, auch im Wissenschaftsspiel des Gründe-Gebens und Gründe-Verlangens (Richard Brandom2), haben sie keinen Ort und verdienen sie keinen Kredit. Sind sie tatsächlich – wie hier unterstellt – in jeder Hinsicht oder im Wesentlichen unbegründet?
In der »Innensicht« derer, die religiöse Überzeugungen teilen, spricht jedenfalls Entscheidendes dafür, sich mit diesen Überzeugungen zu identifizieren, so wie etwa in der Sicht eines Liebenden alles für seine Geliebte spricht, dafür spricht, dass es unübertrefflich gut und verheißungsvoll ist, mit ihr das Leben zu teilen. Aber ist diese Sicht der Dinge begründbar? Liebende können sicher viel Gutes über die Geliebte oder den Geliebten sagen; und sie können wohl – wenn man sie danach fragt – auch mehr oder weniger ausführlich erläutern, warum sie der Überzeugung sind, mit diesem Menschen ihr Leben teilen zu wollen. Aber sind das schon gute Gründe, die geeignet wären, im argumentativen Diskurs mehr oder weniger gut begründeten Einwänden Stand zu halten? Im Einzelfall mag das so aussehen: Die Freundin versteht gar nicht, wie man zu dieser Partnerwahl kommen kann. Man fühlt sich genötigt, ihre Sicht »von außen« – die Perspektive der Beobachterin – soweit zu übernehmen, dass man auch für sie einigermaßen nachvollziehbare Hinweise auf die eigene Faszination geben kann, die sie offenkundig noch nicht teilt. Man »bezeugt«, was einen selbst bewegt und fasziniert. Aber es ist von vornherein klar, dass dieses »Zeugnis« nur begrenzte Überzeugungskraft haben wird. Zwar spricht sich die eigene Faszination darin aus. Aber diese lässt sich offenkundig in den meisten Fällen nicht so mitteilen, dass sie auf die In-Frage-Stellerin übergreift und nun von ihr geteilt wird. Das ist im erwähnten Fall eigentlich auch nicht das Ziel meiner Äußerung. Die Adressatin meiner Äußerung soll meine Faszination nicht wirklich oder doch nur begrenzt nachvollziehen. Hier geht es ja um meine Liebe, nicht um die ihre. Sie soll sie womöglich besser verstehen. Ich möchte ihre Zweifel zum Schweigen bringen, damit diese schließlich nicht auch mich selbst noch erreichen. Aber »eigentlich« empfinde ich es ein wenig prekär, mich mit der Außen- oder Beobachterperspektive der In-Frage- Stellerin auseinanderzusetzen.3 Und überhaupt: Sind die von ihr vorgebrachten Zweifel tatsächlich das Votum einer unbeteiligt-neutralen »Beobachterin«, die meine allzu große Faszination mit ihren Beobachtungen und stichhaltigen Einschätzungen mäßigen will und dazu allen Grund hat? Oder ist sie selbst mehr in die Sache verwickelt als sie sich vielleicht eingesteht, eher selbst Beteiligte als unparteiliche Beobachterin?
Ich habe dieses Beispiel breit ausgeführt, weil es manche erhellende Parallelen zur Situation der Glaubenszeugen aufweist; und so auch zu dessen wissens- oder gar »wissenschaftstheoretischen« Verlegenheit angesichts des ernsten Spiels Gründe-Geben und Gründe-Verlangen. Dass sich gerade in die Parallele die Nicht-Vergleichbarkeit einzeichnet, wird gleich zum Thema werden. Die Parallele liegt im prekären Verhältnis einer Teilnehmer- oder Innenperspektive zur mehr oder weniger unparteilichen Beobachter- oder Außenperspektive: In der Teilnehmerperspektive wird eine Faszination erlebt, die sich den Beobachtern schwer oder gar nicht erschließt und deshalb von ihnen in Frage gestellt werden kann: Ist an dieser Faszination wirklich etwas dran oder täuscht sie sich abgründig? Hat sie den nüchternen Blick für die Tatsachen oder lässt sie sich in ihrer Begeisterung leichtsinnig über die Stolpersteine der Realität hinwegtragen? Die Innenperspektive ist – so scheint es – ärmer an Realitätswahrnehmung, an kritischer Differenzierung, an »rationaler« Urteilsfähigkeit, die gute Gründe verlangt und auf den Prüfstand stellt. Aber andererseits: Sieht der Blick der Liebe nicht mehr? Nimmt er nicht innerlicher, mit- und einfühlender, aber durchaus mit seinen eigenen guten Gründen die Schönheit und Gutheit der Geliebten wahr? Wird er ihrer Wirklichkeit damit nicht eher gerecht als die leidenschaftslosen und unparteilichen Beobachter(innen)? Hat Blaise Pascal deshalb nicht Recht mit seiner Feststellung: »Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt«?4
Was den Reichtum der einen Perspektive ausmacht, markiert offenkundig die Armut der anderen; und umgekehrt: Der Beobachter sieht vielleicht mehr und genauer, weil er sich nicht »fesseln« lässt von dem, was er sieht. Er schaut daneben und dahinter; er sieht vielleicht nüchtern kommen, was die in der Binnenperspektive der Faszinierten »Befangene« nicht an sich herankommen lässt. Aber sieht der Beobachter tatsächlich, was die Faszinierte sieht – und begeistert? Hat er Organe für all das, was die Faszinierte am Geliebten wahrnimmt und was ihr Entzücken auslöst. Ist ihm der Reichtum aufgegangen, von dem die Liebenden leben und den sie mit ihrer Liebe »vermehren« können? Wer von beiden ist also »realistischer«?
0.2 Faszination und Verdacht
Die offenkundige Parallele lässt sich noch weiter ausziehen. Der kritische Realismus der Beobachter äußert einen Verdacht: Was die Faszination auslöste und immer noch hervorruft, verdient diese Faszination vielleicht doch nicht. Der Beobachter teilt sie ja selbst nicht. Jedenfalls versucht er, sie bei seiner Wahrnehmung auszuschalten oder einzuklammern, damit er »unparteilich« sieht, was hier vorgeht und was es damit auf sich hat. Der Verdacht kann freilich auch der des Faszinierten selbst sein. Die lebensweltliche, ganz selbstverständlich vollzogene Gewissheit soll auf den Prüfstand gestellt werden; sei es, weil es erste Zweifelnsgründe gibt, denen man wenn möglich etwas entgegensetzen will, sei es, dass man sich über die Tiefe und Wohlbegründetheit der immer noch selbstverständlich gelebten Faszination Rechenschaft geben will. Im letzten Fall wird der Verdacht dann vielleicht nur der sein, dass man es bisher mit der »Tiefe« und Verbindlichkeit der hier vollzogenen Gewissheit zu leicht genommen hat. Der Verdacht provoziert Begründungsversuche. Wenn es gut mit ihnen geht, kann man zur lebensweltlich selbstverständlichen Gewissheit zurückkehren und sie nun – in welchem Sinne auch immer – vertieft vollziehen. Findet der Zweifel mehr stichhaltige Gründe, als der in Zweifel gezogenen Gewissheit gut tut, wird einem diese Gewissheit nachhaltig problematisch oder gar aus der Hand geschlagen. Es gelingt nicht mehr, zu dem zurückzukehren, von dem man ausgegangen war. Man hatte Anlass, die kritische Beobachtung der bisher weitgehend unangezweifelten Überzeugung beizubehalten oder gar von dieser Überzeugung Abstand zu nehmen. Abstand statt Identifikation: ist das nicht sowieso die »reifere«, eben objektivere Haltung? Abstand statt Identifikation: das kann auch heißen, dass einem die lebendige Faszination – der Glaube daran, dass sie mich weiterhin tragen und beseelen wird – abhanden gekommen ist, warum auch immer. Es ist nicht von vornherein ausgemacht, was zur Distanzierung nötigt oder verurteilt. Aber sie gibt den Raum für eine offenbar fällige kritische Prüfung, für die Erprobung unterschiedlicher Sichtweisen und das Gewichten der Argumente, die für die eine oder für die andere Sichtweise sprechen.
Es ist immer das Gleiche: Die Außenperspektive des Beobachtens drängt sich gleichsam hinein in die Binnenperspektive der unmittelbar Beteiligten; sie macht sich vielleicht sogar darin breit. Liebende mögen dem Verdacht oder denen, die ihn hegen, die Tür weisen und darauf bestehen, dass die von außen an sie herangetragenen Verdachtsgründe sie nicht zwingen, sich in die argumentative Würdigung des Verdachts und damit in die zumindest methodische Distanznahme von ihrer lebensweltlich vollzogenen Faszination hineinziehen zu lassen. Diese Beziehung hat ihre eigene Wahrheit. Die in ihr Lebenden können allein beurteilen, ob sie lebendig und für sie selbst faszinierend ist. Argumente, die geeignet wären, Außenstehende zu überzeugen, müssen nicht und können der Sache nach nur sehr begrenzt aufgeboten werden. Das Zeugnis der Beteiligten ist hier jedenfalls das primäre Datum. Es hat mit seinem Anspruch auf Glaubwürdigkeit seine eigene Autorität, die bis auf weiteres Achtung und nur bei Vorliegen schwerer Verdachtsgründe den Zweifel der Nichtbeteiligten verdient. Aber auch wenn Zweifel entstanden sein sollten, die Beteiligten müssen sich von ihnen nicht anfechten lassen. Die Beweggründe, die in der »privaten« Vergewisserung der Wahrheit ihrer Beziehung den Ausschlag geben, kommen im öffentlichen Spiel des Gründe-Gebens und Gründe-Verlangens ja gar nicht oder allenfalls am Rande vor. Die Beteiligten selbst beurteilen – in der Regel letztinstanzlich –, was sie in ihrer Beziehung erfahren und was diese deshalb tatsächlich ist. Contra experientiam non valet argumentum – gegen die Erfahrung der unmittelbar Beteiligten kommt kein Argument auf. Genau mit dieser Begründung hatte ja Richard Rorty den Glaubenden zu verstehen gegeben, sie müssten sich nicht, ja sie könnten sich auch gar nicht der Nötigung zur argumentativen Rechenschaft aussetzen, welche die diskursiven Vergewisserungsprozesse der Wissenschaften bestimmt.
0.3 Gründe (an)geben und Begründungen bewerten
Wiederum andererseits: Geht es nicht auch in der Beteiligtenperspektive – für die Faszinierten – entscheidend darum, Verdachts-Gründe zu entkräften, vor denen man die Augen nicht verschließen darf? Sie mit besseren Gründen auszuräumen, von denen sich schließlich auch die In-Frage-Steller(innen) überzeugen könnten? Die guten (Gegen-)Gründe gegen den Verdacht mögen die schon Überzeugten und so auch ihre Lebensoption Bezeugenden und über deren Berechtigung Rechenschaft Gebenden eher überzeugen als die In-Frage-Steller(innen). Sind diese Gründe und Argumente deshalb wertlos und bedeutungslos? Sie sind gewiss vor-eingenommen: eingenommen von einer Faszination, die die Anwälte des Verdachts nicht teilen. Aber heißt vor-eingenommen schon Wirklichkeits-verzerrend und irrtümlich? Oder erschließen sich die »besten« Gründe vielleicht nur denen, die zuinnerst von dem ergriffen sind, zu dem sie sich bekennen? Und außerdem: Wer könnte hieb- und stichfest behaupten, dass die Anwälte des Verdachts ihrerseits unparteilicher urteilten, so als ob sie unbeteiligte, interesselose Beobachter wären? Haben nicht auch sie ihre Interessen: das Interesse etwa, Recht zu behalten mit ihrem Verdacht, ihrer Anklage, ihrer Distanzierung?5 So wie die Anklagevertreter vor Gericht gewissermaßen von Amts wegen dafür engagiert und am Geschehen beteiligt sind, alles ins Feld zu führen, was für den Verdacht spricht, damit der Angeklagte schließlich überführt werden kann. Der Staatsanwalt ist offenkundig an der Triftigkeit seiner Anklage interessiert, ja er muss daran interessiert sein. Tut sich hier – im wissenschaftstheoretischen Diskurs wie vor Gericht – nicht die eigentliche Spannung auf, von der nun zu reden wäre: die zwischen Verteidiger- und Anklägerperspektive? Und muss in diesem Spannungsfeld nicht doch versucht werden, mit guten Argumenten zu einer verlässlichen Orientierung zu kommen?
Klar: die forensische Kommunikationssituation ist offensichtlich bestimmt vom unauflöslichen Ineinander diskursiver und persuasiver Intentionen. Es kommt ja auf den Überzeugungserfolg an. Aber es wäre ein Erfolg mit schlechtem Gewissen, wenn man nicht selbst der Überzeugung sein dürfte, nicht nur »gewonnen« zu haben, sondern der Wahrheit zumindest auf der Spur geblieben zu sein. Selten wird man definitiv klären können, welche Rolle die gut begründeten Argumente und welche Rolle die persuasive Performance der jeweiligen Anwälte gespielt haben. Das mindert keineswegs das Gewicht der guten Argumente, die dabei im Spiel waren. Es lässt nur bis zu einem gewissen Grad offen – und muss es offen lassen –, wie sie beim Ausgang des Verfahrens tatsächlich ins Gewicht gefallen sind.
Zurück zu unserem Beispiel, seiner Erschließungskraft wie seiner Grenze im Blick auf die hier zu verhandelnde wissenschaftstheoretische Fragestellung: Diskursiv-argumentative Vergewisserung erzeugt die lebensweltlichen Gewissheiten nicht. Aber sie kann zu ihrer »Entstörung« Wesentliches beitragen. Inwieweit sich die binnenperspektivisch Beteiligten auf sie einlassen, mag davon abhängen, wie nachhaltig sie von dem Verdacht heimgesucht sind, der ihre lebensweltliche (Beziehungs-)Gewissheit in Frage stellt, inwieweit sie also selbst der Rückfrage an ihre (Beziehungs-)Gewissheit Gewicht geben, die von außen den Innenraum der Gewissheit zu infiltrieren scheint. Der Rückfrage oder dem Verdacht wenig Gewicht geben kann nur, wer gute Gründe hat, zumindest zu haben meint, die Urteilskompetenz der Anwälte des Verdachts in Zweifel zu ziehen und der selbst eingenommenen Beteiligtenperspektive eine schlechthin überlegene Bedeutung beizumessen. Die Liebesgewissheit wird – solange sie einigermaßen intakt ist – den Liebenden dazu die Möglichkeit geben: Keine und keiner kann in unserer Liebe kompetent mitsprechen; keine und keiner sonst kann beurteilen, was in ihr geschieht und was sie ausmacht. Man ist als Liebende(r) gleichwohl geneigt, von der Faszination der Liebe Zeugnis zu geben, zu zeigen, was mir meine Liebe bedeutet – vielleicht auch nur diesen geliebten Menschen mit »Besitzerstolz« in Szene zu setzen. Aber all das bleibt der Liebesgewissheit doch äußerlich. Sie weiß sich nicht vor einem Gerichtshof, vor dem sie genötigt wäre, sich mit den Anwälten des Verdachts auseinanderzusetzen.
0.4 Zeugnis und Urteil
Ist es mit der Beziehung der Glaubenden zu ihrem Gott nicht ebenso? Ja und nein. Die Glaubensbeziehung ist nach christlichem Verständnis eine Liebesbeziehung, die in dem, was sie zuinnerst ausmacht, nicht unbeteiligt von außen beurteilt werden kann. Aber sie ist eine Beziehung, die von vielen geteilt werden kann, ja ihrer Intention nach allen Menschen zugänglich ist. Alle können sich in dieser Beziehung einfinden und sollen in ihr die Erfüllung ihres Menschseins finden. So sind auch alle zur Mitsprache eingeladen und berechtigt: ob und warum sie sich dieser Beziehung anvertrauen oder verweigern; ob und warum sie Beteiligte, ja Ergriffene sein wollen bzw. ob und aus welchen Gründen sie in Distanz bleiben und die Erfüllung ihres Menschseins anderswo suchen. Die Innenperspektive des Glaubens ist nach außen geöffnet; sie ist zugänglich. Man soll sich frei in sie hineinbegeben, in sie einleben, einfühlen und hineindenken können – und dabei alle Vorbehalte und so auch den Verdacht mitbringen dürfen, hier fänden die Menschen nicht zu ihrer Vollendung, als Glaubende verfehlten sie sich vielmehr gegenüber den wertvollsten Intuitionen des Menschseins und der Menschwerdung.
Ohne diese Erlaubnis, alles in den Glauben mitzubringen und hineinzubringen, was mich ausmacht, wäre die Glaubensperspektive auch für mich nicht zugänglich, jedenfalls nicht so zugänglich, dass ich mich frei zu ihr verhalten könnte. Medien der Zugänglichkeit in Freiheit sind die guten Gründe, die gegen Verdachtsmomente standhalten, gute Erfahrungen, die Menschen wiederum mit guten Gründen für sich einnehmen können. »Außenstehende« können sie prüfen und für sich entscheiden, ob sie gut genug sind: ob man auf sie hin mit dieser Perspektive eigene Erfahrungen machen will.
Mitmenschlich Liebende werden sich meist nicht genötigt sehen, die eigenen guten Gründe und Erfahrungen Außenstehenden als Erfahrungsangebot zugänglich zu machen – ihre Beteiligtenperspektive bereitwillig den Erfahrungen »der Anderen« zu öffnen und diesen Erfahrungen soviel Gewicht zu geben, wie die Glaubenden, die sich unvermeidlich in der Situation vorfinden, ihre Glaubensperspektive den Anfragen der Anderen auszusetzen, damit sie diesen in freier Überzeugung zugänglich werden kann. Die Perspektive derer, die einander in der Faszination der Liebenden zugetan sind, hat ihre eigene Wahrheit, die nicht – oder nur sehr selten von einzelnen »Mitgeliebten« (Richard von Sankt Viktor6) – geteilt werden kann. Diese Wahrheit ist zu verantworten, damit aus der Faszination nicht eine »folie à deux« wird, die sich um den Rest der Welt nicht kümmert. Aber die Liebesbeziehung will und kann sich nicht oder nur ganz selten in dem Sinne auf andere hin öffnen, dass ihre eigene Wahrheit von ihnen in dem, was sie zuinnerst ausmacht, nachvollzogen werden könnte. Darin unterscheidet sich die Wahrheit einer mitmenschlichen Liebesbeziehung von der Wahrheit, die der Glaube zu leben versucht. Die Glaubensperspektive öffnet sich »nach außen« und öffnet sich damit auch der argumentativen Vermittlung, da sie sonst gar nicht frei übernommen werden könnte. Die Wahrheit des Glaubens bezieht die Menschen auf den einen Gott. Und es müssen gute Gründe dafür namhaft gemacht und geprüft werden können, ob es der »wahre« Gott – das »wahre Absolute« – ist; ob die Zeugnisse verlässlich sind, die so von ihm sprechen. Es müssen Verdachtsgründe argumentativ gewürdigt und gegebenenfalls zurückgewiesen werden können, die gegen die Verantwortbarkeit dieser Beziehung und gegen die Glaubwürdigkeit der Zeugnisse sprechen, denen die Glaubenden sich anvertrauen, wenn sie sich dem in den Zeugnissen bezeugten Gott anvertrauen. Ein Glaube, der nicht im Medium der diskursiven Prüfung von Gründen über seine Verantwortbarkeit Rechenschaft geben will, wäre nicht zu verantworten. Er würde sich unzugänglich machen für frei vollzogene Überzeugungsprozesse, die sich den Zeugnissen nicht Fragen-los anvertrauen können. Das mag und wird in der Regel nicht in gleicher Weise für Beziehungen gelten, in denen die Faszination mitmenschlich-partnerschaftlicher Liebe erfahren wird.
0.5 Glaube, Liebe und Wahrheit
Und dennoch zeigt sich in der Differenz noch einmal eine tiefere Vergleichbarkeit. Liebende Menschen sind in dem, was sie erfahren und suchen, von dem ergriffen oder zu dem unterwegs, was die Liebe sein soll und was sie in all ihren Realisierungen ausmacht. Aber was macht die Liebe aus? Was ist ihre Wahrheit? Nicht die je individuelle Wahrheit der je individuellen Liebesbeziehung; auch nicht nur das, was die Menschen, die sie zu leben versuchen, in ihr suchen; sondern das, was sie zur Liebe macht. Es ist die »innere Norm«, der man zwar auf unendlich vielen Wegen und in unendlich vielfältigen Beziehungen auf der Spur bleiben kann, die aber als solche durchaus eine Norm mit Wahrheitsanspruch ist; mit dem Anspruch der Beurteilung vieler konkreter Erfahrungen und Beziehungen: Wo und wie erfüllen diese, was die Liebe ausmacht? Wo und wie bleiben sie dahinter zurück? Die Orientierung an dieser inneren Norm bedeutet keine überflüssige und der Liebe abträgliche Moralisierung. Sie ist vielmehr unausweichlich, wenn die Liebe von all dem unterschieden werden soll, was in diesem oder jenem Aspekt der Liebe mehr oder weniger ähnlich sieht und in ihr vorkommen kann, sie in Wirklichkeit aber oft auch verrät: Überwindung des Alleinseins, Anspannung und Entspannung der Lust, Hörigkeit, Nachgiebigkeit, Selbstbestätigung, Flucht in die emotionale Geborgenheit, Regression, Machismo. Muss die Liebe von all dem unterschieden werden? Ist sie denn überhaupt »mehr« als all das Genannte oder eine individuelle »Auswahl« aus diesem Cocktail und noch manchem anderen? Ist sie überhaupt mehr als die Summe der »angenehmen Gefühle«, die man sich in mitmenschlichen Beziehungen wechselseitig verschaffen kann?7 Mehr als eine befriedigende Idealisierung, die den Menschen das erhebende Gefühl vermittelt, eben nicht nur animalisch auf maximalen Lustgewinn fixiert zu sein?
Man müsste doch zu einem begründeten Urteil darüber kommen können, ob es um die Liebe so steht – oder ob sie noch etwas ganz anderes ist. Etwa das Sich-Öffnen für die Wirklichkeit des anderen Menschen und darin für die Präsenz einer göttlichen Wirklichkeit, die mir das Andere und die anderen zur Verheißung macht statt zum Untergang? Aber wie könnte man zu einem diskursiv-begründeten Urteil darüber gelangen, was die Liebe ist oder sein kann und wie man an sie glauben darf? Welche Argumente können hier ins Feld geführt werden? Und wie sind sie zu gewichten? Wie könnte man sich über Kriterien verständigen, nach denen schwache oder zweifelhafte von starken Argumenten zu unterscheiden wären?
Diese Fragen sind offenbar so komplex und sie erscheinen so wenig lösbar, dass es nahe liegt, hier eine für wissenschaftliche Argumente unzugängliche Grauzone zu unterstellen. Aber sollten die Fragen, die den äußersten Horizont menschlichen Selbstverständnisses markieren und ihn noch einmal öffnen, nur durch mehr oder weniger beliebige Optionen beantwortet werden können, so als wären es Fragen des persönlichen Geschmacks, mit denen man es halten kann, wie man will? Da es sich nun einmal um Fragen von erheblicher existentieller Tragweite und Dramatik handelt, wird man nicht zu schnell kapitulieren und sich damit zufrieden geben dürfen, dass Entscheidungen hier grundlos getroffen werden müssen, oder doch nur mit Gründen, die allein denen einleuchten, die – als Mitbeteiligte an meiner Teilnehmerperspektive – die gleiche Entscheidung getroffen haben. Zustimmung zu meiner Überzeugung ist ja nur etwas wert, wenn sie nicht nur mein Akzeptanzbedürfnis befriedigt (und befriedigen soll), sondern mich selbst als urteilsfähig anerkennt, da von den Zustimmenden selbst Urteilsfähigkeit in Anspruch genommen wird. Zustimmung gewinnt also gerade dadurch ihr Gewicht, dass sie angesichts der Möglichkeit, mit besseren Gründen widersprechen zu müssen, im konkreten Fall gewährt wird. So liegt im gut begründeten Widerspruch mehr Akzeptanz als in der leichthin gegebenen Zustimmung: die Anerkennung als urteilsfähiger, zur Korrektur eigener Überzeugungen aus Vernunftgründen fähiger Diskurspartner. Und so vollzieht das Werben um Zustimmung die Öffnung »nach außen«: auf die hin, die die Zustimmung etwas kosten würde – so wie ich es mir etwas kosten lassen muss, ihre auf gute Gründe sich stützende Zustimmung zu gewinnen.
Es gibt also gute Gründe dafür, das Spiel Gründe-Geben und Gründe-Verlangen auch im Blick auf die Fragen, die Glauben und Liebe aufwerfen, nicht verloren zu geben. Es gibt dafür nicht zuletzt deshalb gute Gründe, weil man hier ja tatsächlich beansprucht, solche guten Gründe geltend zu machen. Was liegt näher, als sich »rational« mit diesem Anspruch auseinanderzusetzen und zu prüfen, wie viel wissenschaftlicher Kredit ihm eingeräumt werden kann – und eingeräumt werden muss!
0.6 Einführung in die theologische Wissenschaftslehre: Zielangabe, Vorausblick
Mit der Frage, wie man dabei vorzugehen hätte, beschäftigt sich dieses Buch. Deshalb trägt es den Titel Einführung in die theologische Wissenschaftslehre. Es wird zu diskutieren sein, auf welche Möglichkeiten einer argumentativen Vergewisserung religiöser Überzeugungen die Theologie zurückgreifen kann. Man wird von den hier folgenden Überlegungen keine Beweise für die Wahrheit christlicher Glaubensüberzeugungen erwarten dürfen, keine Begründung dafür, warum es so und nicht anders mit der darin zum Ausdruck gebrachten Wirklichkeit stehen muss. Begründungen können triftig sein, auch wenn sie nicht zu unausweichlichen Annahmen führen. Sie können die Verantwortbarkeit einer Überzeugung und der ihr entsprechenden Praxis begründen, ohne dieses Urteil auf den Erweis der Unverantwortlichkeit – der Nicht-Verantwortbarkeit – aller konkurrierenden Überzeugungen gründen zu können oder gründen zu müssen. Es lässt sich offenkundig ein verantwortungsvolles Ja zu der Überzeugung A in den hier angesprochenen wie in vielen anderen Bereichen lebensrelevanter Überzeugungen in den seltensten Fällen durch den Nachweis erreichen, alle denkbaren Überzeugungsalternativen (B … Z) seien irrational oder gar unzutreffend, eine Identifikation mit ihnen sei deshalb nicht zu verantworten. Viel wäre hier schon erreicht, wenn man hinreichend tragfähige gute Gründe dafür geltend machen könnte, dass es rational verantwortbar ist, sich mit der Überzeugung A zu identifizieren und von ihr her nach einer Vergewisserung der das alltägliche Leben tragenden Basis-Gewissheiten zu suchen.
In diesen Vorblick sind einige Kategorien eingegangen, die wissenschaftstheoretisch dringend klärungsbedürftig sind: Rationalität, Vernünftigkeit, Wahrheit, Begründung, Überzeugung, Argumentation, Verantwortbarkeit u. v. m. Auch hier wäre schon viel erreicht, wenn man einen sinnvollen (vielleicht nicht den einzig möglichen) Sprachgebrauch vorschlagen könnte, der es dann auch erlauben würde, die möglicherweise erreichbare Rationalität von Glaubensüberzeugungen zu anderen Rationalitätsformen in ein rational nachvollziehbares Verhältnis zu setzen. Es muss sich zeigen, wie weit man hier kommt. Gut stünde es für die Sache der Theologie, wenn sich hinreichend begründet aufweisen ließe, wie Glaubensüberzeugungen elementar dazu beitragen können, dass sich wissenschaftliche Welt- und Selbstwahrnehmung erweitert und vertieft – und damit auch relativiert wird. In diesen Aufweis muss eine theologische Wissenschaftslehre ihren ganzen wissenschaftstheoretischen und theologischen Ehrgeiz setzen. Ohne ihn wäre sie wissenschaftstheoretisch belanglos, also keine Wissenschaftslehre. Diesem Aufweis nachgeordnet und nur von ihm her zu beantworten ist die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Sinne die Theologie selbst Wissenschaft ist. Die Antwort auf diese Frage kann also nicht am Anfang, sie wird hoffentlich am Ende einer theologischen Wissenschaftslehre stehen.
Die Qualifikation Einführung bezieht sich nicht nur auf Umfang oder Anspruchsniveau dieses Buches. Sie verspricht vielmehr, dass die Bezugnahmen auf eine in verschiedenste Richtungen gehende und hoch differenzierte wissenschaftstheoretische Diskussion außerhalb wie innerhalb der Theologie überschaubar und im Rahmen einer theologischen Grundausbildung an der Universität rezipierbar bleiben. Die Offenheit für Größe und Differenziertheit der wissenschaftstheoretischen Herausforderung, der die Theologie heute ausgesetzt ist, soll dabei möglichst wenig leiden. Wer mit den anstehenden Problemen einigermaßen vertraut ist, wird freilich auch wissen, dass es ohne mehr oder weniger gut begründete methodische und inhaltliche Akzentsetzungen nicht abgehen kann. Das zeigen ja auch die beiden »klassischen« theologischen Wissenschaftslehren, denen der hier vorgelegte Versuch viel verdankt.8
Die Qualifikation theologisch soll nicht nur zum Ausdruck bringen, dass es primär um den Ort der Theologie in der Universitas litterarum gehen soll. Mit ihm ist darüber hinaus die theologische Intuition angesprochen, der die Untersuchung zu folgen und die sie auszuarbeiten sucht. Die Theologie bringt – so möchte ich diese Intuition im Vorgriff umreißen – eine spezifische Wahrnehmung von Wirklichkeit in eine spezifische Wissensform. Das »Wissen« der Theologie misst das weite Feld zwischen anderen elementaren oder wissenschaftlich ausgearbeiteten Wissensformen und dem christlichen Glauben aus. Es begreift sich als Validierung (im Sinne argumentativer Stabilisierung) und als Evaluierung (im Sinne der Relevanz-Erprobung) einer Option, die Wirklichkeit im Ganzen als von einer bestimmten Dynamik getragen bzw. auf das immer deutlichere Bestimmtsein alles Wirklichen durch diese Dynamik hingeordnet zu verstehen und mit-handelnd zu ergreifen. Die Wissensform der Theologie schließt das Wissen um diesen Options-Charakter ein: das Wissen darum, dass Wirklichkeit hier nicht abgebildet oder kausal erklärt, sondern gedeutet wird; dass sie gedeutet wird zugunsten einer Lebenspraxis, die glaubende Menschen als Erfüllung ihres Lebens begreifen und ergreifen wollen. Dass sich diese deutende – hermeneutische – Wahrnehmung von Wirklichkeit zu verantworten hat im Kontext anderer Weisen, Wirklichkeit wahrzunehmen, diese Wahrnehmung zu einer bestimmen Form des Wissens auszuarbeiten und so auch Formen sinnvoller Praxis zu begreifen oder zu ermöglichen, steht theologisch außer Frage. Wie das geschehen kann, ist Thema dieses Buches. Die spezifische Wissensform der Theologie sucht sich darüber hinaus zu realisieren als validierende und evaluierende Durcharbeitung der theologisch relevanten Sachzusammenhänge von der grundlegenden Option her, der glaubende Menschen in ihrem Leben, Handeln und Glauben vor allem und in allem zu folgen versuchen. Wissenschaftliche Theologie will in diesem Sinne die genannten, vielfach als problematisch empfundenen Zusammenhänge ad extra und ad intra nachvollziehbar klären und als einzigen, in sich differenzierten Zusammenhang ausarbeiten.9
0.7 Die leitende Intuition
Die Wahrnehmung von Wirklichkeit, die der Glaube zu vollziehen und der die Theologie nachzudenken versucht, um so die dem Glauben gemäße Wissensform auszuarbeiten, ist die der Liebe. Das kann nach dem über den strukturellen Zusammenhang von Glaube und Liebe oben Gesagten kaum überraschen, ist aber zunächst nur eine Intuition, für die von den empirisch-wissenschaftlichen Zugängen zur Wirklichkeit her kaum Verständnis aufgebracht werden dürfte. Welche wissenschaftstheoretische Bedeutung sollte der Liebe als Zugang zur Wirklichkeit denn eingeräumt werden können? Schafft sie überhaupt Zugang zur Wirklichkeit? Verfehlt sie ihn nicht notorisch? Und wie könnte sie, die doch eher auf Fühlen als auf Wissen zu beruhen scheint, eine Wissensform hervorrufen und hervorbringen, die sich dem Zusammenhang aller anderen Wissensformen eingliedert bzw. für ihn gar eine unverzichtbare Bedeutung haben sollte?
Auf diesen Wust an weit ausgreifenden Fragen wiederum nur eine unscheinbare, in ihrer theologischen wie wissenschaftstheoretischen Bedeutung jetzt noch kaum zu würdigende Andeutung, die sich vielleicht doch als tragfähige und im wissenschaftstheoretischen Diskurs belastbare Antwort erweisen wird: Liebe bahnt einen spezifischen Zugang zur Wirklichkeit, da sie die Geliebte (bzw. den Geliebten) als individuelles Dasein im Horizont der Gesamtheit alles Wirklichen wahrnimmt und affirmiert: sich ganz mit den Anliegen identifiziert, dass es mit ihr (bzw. mit ihm) gut sei und gut werden möge und dass dieses Gutsein im Horizont des Alls der Wirklichkeit unwiderruflich gelte. Dieses individuelle Dasein ist für den Liebenden nicht nur eine mehr oder weniger singuläre Konstellation von gesetzmäßigen und deshalb erklärbaren Abläufen, sondern eine Wirklichkeit, deren individuelle Ausprägung gerade so, wie sie ist, absolute Bedeutung für mich gewinnen kann – nicht als Endpunkt von Erklärungen und Ableitungen, sondern als Anfang, als Ursprung einer neuen Lebensmöglichkeit und einer neuen Wahrnehmung aller Wirklichkeit. Die Individualität des Anderen kann mir unendlich bedeutsam werden, weil sie mich berührt und ich in der Lage bin, sie »zuvor« selbst zu berühren: ihr so »innerlich« nahe zu kommen und vertraut zu werden, dass ich an ihrer inneren Welt mehr oder weniger intensiv teilhaben kann, miterleben kann, was sie bewegt, erfährt, will und initiiert.10 Sie ist für mich zugänglich und zur Möglichkeit des Mitlebens geworden. Es käme mir nie in den Sinn, Wirklichkeit ohne das hier Erfahrene für »vollständig erfasst« zu halten. Zu ihr gehört nun unabdingbar, was mir hier zugänglich und in diesem Sinne wirklich geworden ist: das Leben und Leiden und Hoffen und die Leidenschaft dieses Anderen; einmalig und unwiederholbar, mein Verstehen und Mitleben, vielleicht auch meine Abgrenzung hervorrufend. So ordne ich dieses individuelle geliebte Dasein eben nicht nur – in der Perspektive des unberührten Beobachters – in die alles umfassenden und erklärenden Zusammenhänge der nach Erklärung verlangenden Wirklichkeit ein; ich beziehe vielmehr ebenso das All des Wirklichen auf diese Individualität, die im All des Wirklichen nicht zur in ihr untergehenden quantité négligeable werden darf, sondern ihr Gutsein und Gutwerden in ihr realisieren und erfahren soll.
So leben wir miteinander und füreinander in der Teilnehmerperspektive, in der sich die Perspektiven der ersten und der zweiten Person miteinander verschränken. Die Beobachterperspektive der dritten Person – des von Ich und Du zunächst unberührten Er bzw. Sie – können wir doch nicht ausschalten: Das geliebte Du kommt als Individuum unter vielen Individuen vor und lebt mit ihnen in Zusammenhängen, die eine gemeinsame Welt bestimmen und die Situation ausmachen, in der es sein Dasein zu vollziehen hat. Der Blick des Liebenden ist der teilnehmend ans Innere rührende, individualisierende und der von außen kommende, ins All des Wirklichen einordnende zugleich. Und er transzendiert die Perspektive der dritten, beobachtend-einordnenden Person noch einmal auf eine Perspektive hin, in der das geliebte Du nicht auf das All des Wirklichen hin relativiert, sondern in seiner unverlierbaren individuellen Bedeutung gewürdigt wird. Liebende tasten sich in diese Perspektive hinein und erfahren, dass sie sie nicht »realisieren« können: Die (bzw. der) geliebte Andere bleibt ihnen in ihrer (seiner) Bedeutung letztlich unzugänglich, bleibt das Mysterium des Anderen in seinem Eigensein, das sich dem Blick des mitmenschlichen Du nicht erschließt und allenfalls von Ihm gewürdigt werden könnte – von der unendlichen dritten Person, die die Perspektive des Unendlichen realisieren könnte, weil Er sie selbst geöffnet hat.
Theologie realisiert sich und bezieht sich auf Teilnehmer- und Beobachterperspektiven; sie ist durch und durch perspektivisch angelegt. Ausgerichtet ist sie auf eine Perspektive der dritten Person, die gleichwohl eine Teilnehmerperspektive ist: die Perspektive des Absoluten, der sich selbst zum Teilnehmer bestimmt und so eine Teilhabe an sich selbst gewährt, die alles endliche Wissen in den Dienst der Würdigung stellt: Wissen nimmt am Dasein des Gewussten teil, damit dieses da sein, als es selbst zur Geltung kommen kann; damit die Wissenden in der ersten und zweiten Person füreinander da sein können, wie der liebende Absolute sie in ihr Dasein gerufen hat, damit sie füreinander da sind. Die Absolutheitsperspektive aber ist den Menschen nur als systematischer Grenzbegriff gegeben; und dieses Gegebensein wird in der Trinitätslehre artikuliert. Gehaltvoll können sie an ihr nur teilhaben in einem Teilnehmer-Wissen: in jener Teilnehmerperspektive, in der die Wissenden füreinander da sind und ihr Wissen dem Gut-sein-Lassen des Du dient; in der sie in der Nachfolge des Mensch gewordenen Absoluten am Liebeswillen des Absoluten teilzunehmen versuchen, ohne sich über ihre eigene Perspektive der ersten Person erheben zu können. Die Teilnehmerperspektive ist ursprünglich; sie ist meine Perspektive und gilt der Würdigung des einzelnen anderen in jener Würde, in der er oder sie niemals nur Exemplar eines Allgemeineren sein kann. Die Beobachterperspektiven relativieren die Teilnehmerperspektiven, damit das in ihnen Wahrgenommene tatsächlich als es selbst gewürdigt werden kann und nicht zu stark in der Ich-Befangenheit der Teilnehmer-Iche befangen bleibt. Das Abstrahieren in den Perspektiven der dritten Person, das zu einem immer allgemeingültigeren Wissen führen soll, vollendet sich nicht in einer teilnahmslosen Perspektive von nirgendwoher nach nirgendwohin, sondern – so die wissenschaftstheoretische Grundüberzeugung der Theologie – in der unendlich teilnahmsvollen Perspektive dessen, der es tatsächlich vermag, die Einzelnen als solche zu würdigen. So kann auch das Wissenschaftsideal der Theologie niemals am puren Objektivismus des teilnahmslosen, beobachtenden Wissens orientiert sein, sondern zuletzt nur am teilnehmend-perspektivischen Wissen, das ja selbst in den Naturwissenschaften nie wirklich überholt wird.11
Sind hier tatsächlich wissenschaftstheoretisch bzw. wissenstheoretisch tragfähige Aussagen gemacht? Andere Wissensformen werden sich nicht ohne weiteres auf diese Perspektive der Unendlichkeit bezogen sehen, in der sich die Frage stellen kann, welche Bedeutung unser Lieben und Geliebtsein für die Wirklichkeit im Ganzen haben mag. Sie werden diese Frage für einen Ausdruck des Überschwangs halten, den man Liebenden gerade noch hingehen lässt, der aber der ernsthaften Disziplin des Wissenserwerbs schlechthin unangemessen ist. Aber müssten nicht auch sie sich im Horizont des Unendlichen fragen lassen, was das in ihnen erfasste Wissen und die in ihnen vorangetriebene Wissensakkumulation bedeutet? Weshalb es beispielsweise einen bemerkenswerten Unterschied ausmachen sollte, Leiden zu vermindern, Leben zu verlängern oder die Funktionsweise einer weltzerstörenden Ökonomie immer genauer zu erfassen und entsprechende Verhaltensweisen zu entwickeln?
Liebe transzendiert die Teilnehmerperspektive auf die Unendlichkeitsperspektive der dritten Person hin: In ihr geht es nicht nur um desengagierte Beobachtung und um Erklärung der das Beobachtete jeweils bestimmenden Zusammenhänge; in ihr will vielmehr noch einmal verstanden sein, wie der als Nächster geliebte Andere das unumgreifbare Geheimnis bleibt, das unsere liebende Nähe unendlich relativiert – und was es bedeutet, einander in diesem Sinn Manifestation des Unendlichen zu sein. Die Theologie bezieht sich auf diesen wechselseitigen Verweiszusammenhang der Perspektiven, der dem Menschen in der Liebe mit besonderer Prägnanz aufgehen kann. Sie artikuliert ihn als die Gleichzeitigkeit und Gleichsinnigkeit eines bejahendaffirmativen Anderen-, Selbst- und Gottbezugs, des Sinnzusammenhangs von Nächsten-, Selbst- und Gottesliebe. Sie hat darüber hinaus zu zeigen, wie die Beobachterperspektive der generalisierten dritten Person von diesem Verweiszusammenhang umgriffen ist und sich innerhalb seiner entwickelt, ihn aber nicht noch einmal relativiert oder gar negiert.
Diskursive Vergewisserungen in der relativ distanzierten Beobachterperspektive werden gesucht, wo die Es-Wirklichkeit der Dinge und Prozesse gegenüber der Bedeutung verleihenden Er- bzw. Sie-Wirklichkeit – der im Absoluten bzw. von ihm selbst als solcher vollzogenen Unendlichkeitsperspektive – Autonomie und Eigenbedeutung gewinnt; auch dadurch Eigenbedeutung gewinnt, dass die umfassende Gottes-Perspektive undeutlich wird und in den »Hintergrund« tritt. Welt kann dann als das All der Es-Wirklichkeit aus sich selbst oder noch einmal vertieft vom Göttlichen her verstanden werden. Sie kann selbst als das Absolute und Unendliche gedacht werden, das sich dann freilich selbst nicht verstünde und die Perspektiven der ersten und zweiten Person deshalb auch nicht mehr als bedeutsam begründen könnte. Oder die Welt – das All der Es-Wirklichkeit, der nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten erklärbaren Prozesse – wird auch als autonome Eigenwirklichkeit als auf die Ich-, Du- und Er- (oder Sie-)Perspektive bezogen und in ihr als bedeutsam verstanden. Die wissenschaftstheoretische Herausforderung der Theologie besteht gerade darin, die letztgenannte Möglichkeit als den umfassenden Unendlichkeitshorizont aller Formen des Wissens auszuweisen. Ihre eigene Wissensform bestimmt sich schließlich darin, dass sie die in der Liebe aufscheinende Pluri-Perspektivität als Organisationsprinzip des in ihr selbst Auszusagenden ausweisen kann: Gott ist die Liebe; so begründet er denen, die er liebt, die Möglichkeit des Mit-Ihm-Wissens und darin die Möglichkeit alles auf Ich, Du, Es, in all dem jedoch auf Ihn (oder auch auf Sie) bezogenen Wissens. Wo aber Gott den Menschen in der Welt wirklich wird, wo er als unendlich beziehungsmächtige Liebens- und Lebenswirklichkeit im Endlichen aufscheint, da bleibt der Mensch nicht mehr nur unbeteiligt »wissender« Beobachter; »wer dem Auferstandenen begegnet, stirbt als Zuschauer Gottes, um als dessen Zeuge und Akteur aufzuerstehen« (Dietrich Bonhoeffer12).
Die hier vorgelegte Einführung in die theologische Wissenschaftslehre will diesen systematischen Zusammenhang möglichst nachvollziehbar herzustellen versuchen, in dem sich die theologische Selbstvergewisserung mit anderen, für Welt- und Selbstverständnis relevanten wissenschaftlichen Perspektivierungen verknüpft und als Wissenschaft sui generis versteht. Der systematische Anspruch wird dabei nicht mit der Stringenz einer Schritt für Schritt unabweisbaren Rekonstruktion eingelöst werden, wie es die Anspielung auf Fichtes immer wieder in Angriff genommenes und beziehungsreich unvollendet gebliebenes Projekt einer philosophischen Wissenschaftslehre verheißen mag.13 Dargestellt werden soll vielmehr eine fortschreitende Perspektivenverknüpfung, ein Sich-ineinander-Schieben von Perspektiven, die man als Theologie Treibender immer schon »bewohnt« und bearbeitet, deren Miteinander, Ineinander und Gegeneinander in einer Wissenschaftslehre aber mit methodischer Konsequenz nachvollzogen werden müsste. Dabei wird sich – günstigstenfalls – ein Feld von miteinander auf nachvollziehbare Weise verwobenen Artikulationszusammenhängen ergeben, die die Theologie von ihrer eigenen Grundintuition her als den Welt-umfassenden Horizont des Unendlichen begreifen und offen halten können sollte.
Das Verfahren, ein Verweisungsnetz immer dichter zu knüpfen, bringt es mit sich, dass dabei die wichtigsten Zusammenhänge immer wieder neu, hoffentlich gehaltvoller und beziehungsreicher in den Blick genommen werden. Scheinbare Wiederholungen sind vorprogrammiert. Sie werden sich insoweit als motiviert erweisen, als es mit ihrer Hilfe gelingt, die angestrebte Verknüpfung der Perspektiven Schritt für Schritt einleuchtender und nachvollziehbarer zu machen. Der Autor bittet um Geduld und verspricht, so viel Sorgfalt aufzuwenden, dass sich die Leser(innen) auf dem Weg durch dieses Buch möglichst nicht im Unwegsamen verlieren.
Die viel gescholtene und in vielem ja auch hochproblematische Studienreform im Rahmen des Bologna-Prozesses, die zu mehr Interdisziplinarität verpflichtet, hat den Anlass gegeben, dieses Buch zu konzipieren. Die Fundamentaltheologie war nun nachdrücklicher als zuvor gefordert, die Verantwortung für die wissenschaftstheoretische Grundlegung der Theologie zu übernehmen. Es hat auch zuvor nicht an Stimmen gefehlt, sich dieser fundamentaltheologischen Aufgabe explizit zuzuwenden und ihr womöglich auch einen eigenen Traktat zu widmen.14 Aber erst im Rahmen der Bologna-Reform scheint es zu gelingen, die wissenschaftstheoretische Perspektive im »normalen« Lehrprogramm der Theologie zu verankern. Ich habe diese Aufgabe gern übernommen, für ihre Ausgestaltung aber ebenso gern und dankbar auf Anregungen von Kollegen zurückgegriffen, mit denen ich interdisziplinäre Lehrveranstaltungen gestalten durfte. Nennen möchte ich ausdrücklich die Kollegen Klaus Müller, Thomas Pröpper, Reinhard Feiter, Alfons Fürst, Guido Hunze und Hubert Wolf. Annette Wilke hat mir ebenfalls mit ihrem fachlich-kollegialen Rat weitergeholfen. Ich danke ihr dafür. Meinen Mitarbeiter(inne)n Dr. Martin Rohner, Georg Kleemann und Eva Leiting bin ich für ihr Mitdenken herzlich dankbar. Monika Aumüller und Eva Leiting haben darüber hinaus geduldig und mit großer Sorgfalt Redaktionsaufgaben übernommen. Ihnen gilt mein Dank ebenso wie Herrn Stephan Weber vom Verlag Herder, der das Projekt als Lektor umsichtig und kompetent begleitet hat. Für das Ergebnis mit seinen vielen Leerstellen und offenen Fragen, gewiss auch mit manchen Fehlern, bin ich selbst verantwortlich. Man möge mir nachsehen, dass ich so vieles nicht im Blick hatte, was auch noch wichtig, vielleicht sogar unerlässlich gewesen wäre. Andere mögen es aus ihrer Perspektive würdigen.
Dieses Buch ist primär für den akademischen Unterricht konzipiert. Die jedem Kapitel beigegebenen zusammenfassenden Thesen sollen bei der Durcharbeitung die Ergebnissicherung erleichtern. So sind sie nicht als Kurzfassung zu verstehen, sondern als Hilfen zur Überprüfung des Kenntnisstandes. Wer die Thesen erläutern kann, hat die zuvor dargelegten, elementaren Gedankengänge gut nachvollzogen und dürfte sich die entsprechenden »Leistungspunkte« zu Recht auf seinem Studienkonto gut schreiben. Aber so weit geht die Selbstverantwortung der Studierenden innerhalb des Bologna-Prozesses natürlich noch nicht.
Zusammenfassende Thesen:
0. Einleitung
0.1 Gute Gründe – in der Innen- und der Außenperspektive
Die wissenschaftstheoretisch-theologiekritische These: Religiöse Überzeugungen sind bloß subjektiv, nicht wissenschaftsfähig, weil sie in wissenschaftlich kontrollierten Erklärungszusammenhängen keine Rolle spielen können. Es macht wissenschaftlich gesehen, also im Blick auf das für alle kompetenten Beurteiler Nachvollziehbare, keinen Unterschied, ob man sie teilt oder nicht.
Die Antwort Glaubender: Auch der Glaube hat seine Gründe. Und sie haben nicht nur in der Innen- oder Teilnehmerperspektive Geltung, eine »bloß subjektive«, nur auf mich bezogene Bedeutung (vgl. Blaise Pascal: »Das Herz hat seine Gründe/seine Logik, die die Vernunft nicht kennt«). Überdies wäre zu bestreiten, dass nur die unparteilich-»subjektlose« Außen- oder Beobachterperspektive (Pascal: die Logik der Vernunft) wissenschaftliche Bedeutung haben kann.
0.2 Faszination und Verdacht
Innen- und Außenperspektive stehen ja nicht beziehungslos nebeneinander, sodass man beliebig die eine verlassen und die andere einnehmen, oder die andere ignorieren und eben nur bei der einen bleiben könnte. Die Außenperspektive der Beobachter durchdringt die Innenperspektive der Beteiligten (Glaubenden, Faszinierten) mit dem Zweifel an den »Beweg-Gründen« des Glaubens und seiner Faszination (wie auch anderer Faszinationen). Damit provoziert sie zu »tieferer« Begründung – zur Begründung durch möglichst starke Argumente, die eben nicht nur für mich, den »Teilnehmer« gelten sollen – oder zur Revision des nicht hinreichend Begründeten, zur Modifikation oder gar zur Aufgabe meiner Beteiligten-Position.
0.3 Gründe (an)geben und Begründungen bewerten
Gute Gründe wollen den Streit zwischen Faszination und Verdacht vor dem Gerichtshof der Vernunft schlichten: zwischen dem Ankläger (dem Verdacht) und den Verteidigern (den Beteiligten, Faszinierten). Vor diesem Gerichtshof sind alle »Partei«. Im Prozess aber soll die Richterin Vernunft mit ihrem möglichst unparteilichen, vernünftigen Urteil das entscheidende Wort haben; sollen die unterschiedlichen Perspektiven sich auf vernünftige Weise durchdringen, so dass der Faszination wie dem Verdacht der ihnen jeweils zustehende Raum gegeben wird.
0.4 Zeugnis und Urteil
Die Glaubensperspektive soll keine bloße Binnenperspektive bleiben. Sie soll ja überzeugen können und so »von außen« zugänglich werden. So setzt sie sich Diskursen aus, in denen rationale Überzeugungen entstehen und sich als solche ausbilden können. Die in Diskursen zu begründenden Urteile richten sich auf die Gültigkeit der Zeugnisse für mich: Darf ich mich darauf verlassen, dass sie auch für mich Verlässliches bezeugen? Zeigt das Zeugnis her, was »Gott sei Dank« ist? Oder verrät es nur den Wunsch der Zeugen, vielleicht auch nur die nicht aufgebrachte Bereitschaft, sich auf die Realität einzulassen, so, wie sie nun einmal ist?
0.5 Glaube, Liebe und Wahrheit
In der Glaubensperspektive geht es um »letzte Fragen«: Was ist Liebe und was ist Menschsein bzw. Leben wesentlich? Kann man hier überhaupt noch argumentieren oder nur noch optieren, grundlos entscheiden – je nachdem wie man Liebe, Menschsein, Leben leben will? Es werden von den in letzten Fragen nach Antworten Suchenden im Diskurs zwischen mehr oder weniger Überzeugten und nicht Überzeugten Gründe für die Glaubensoption gefordert und genannt. Diese sind auch wissenschaftstheoretisch zu würdigen. Man sollte nicht von vornherein davon ausgehen, dass es solche Gründe gar nicht geben kann.
0.6 Einführung in die theologische Wissenschaftslehre: Zielangabe, Vorausblick
Die hier zu bearbeitenden Grundfragen: Auf welche Möglichkeiten einer argumentativ-diskursiven Vergewisserung religiöser Überzeugungen kann die Theologie zurückgreifen? Und in welchem Verhältnis findet diese sich dabei zu »den« Wissenschaften vor? Theologie geht es um die Validierung und Evaluierung der Glaubensoption im Kontext anderer Weisen, Wirklichkeit wahrzunehmen bzw. zu ihr überhaupt erst einen Zugang zu finden; im Kontext anderer wissenschaftlicher Vorgehensweisen, sich des Wirklichen und Verlässlichen zu vergewissern.
0.7 Die leitende Intuition
Ist Liebe ein sinnvoller, ja sogar unabdingbarer Zugang zur Wirklichkeit? Das in der Liebe vollzogene Vertrautsein in der »Teilnehmerperspektive« – der Perspektive des Teilnehmens am Leben des Anderen – ist ein Wirklichkeitszugang zur Innenwelt des Anderen, der nicht zu ersetzen ist. Hier können sich die Perspektiven der 1. und der 2. Person durchdringen (und herausfordern). Sie bleiben gleichwohl der Perspektive der 3. Person – der desengagierten (interesselosen) Beobachter von außen – ausgesetzt, in der die 1. und die 2. Person als Individuen unter vielen vorkommen. Ist auch diese Perspektive der 3. Person noch umfangen und relativiert von der Perspektive dessen, der die Vielen nicht nur von außen wahrnimmt und als bloße Exemplare vorkommen lässt, sondern als die je Einzelnen in Liebe würdigt? Hat Theologie ihr wissenschaftstheoretisches Profil etwa darin, dass sie diesen Perspektivenzusammenhang umfassend thematisieren und die genannten Perspektiven der 1., 2. und 3. Person begründet miteinander vermitteln kann? (↗ Leitperspektive Trinitätslehre).
1 Vgl. Richard Rorty, Wahrheit und Wissen sind eine Frage der sozialen Kooperation. Nicht die Religion, wohl aber religiöser Zwist kann aufgehoben werden: Die Suche nach Gott ist den Menschen nicht einmontiert, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 279 vom 4. Dezember2001, S. 14. Georg M. Kleemann geht detailliert und kritisch auf die von Rorty hierin Anspruch genommene strikte Trennung von Privatem und Öffentlichem ein (von Rortyweiter ausgeführt in seinem Buch: Kontingenz, Ironie und Solidarität, dt. Frankfurta. M. 1989). Der Privatbereich ist gegenüber dem Bereich des öffentlichen Diskurses für Rorty der Raum, »in dem der Einzelne sich vor niemand anderem rechtfertigen muss«(Georg M. Kleemann, Private Götter, öffentlicher Glaube. Richard Rorty und die Religion, in: Theologie und Philosophie 82 [2007], 21–45, hier 25; vgl. die hier genannten Belege). Es ist schwer nachzuvollziehen und wird im Folgenden von mir ausdrücklich bestritten, dass im – wie auch immer zu verstehenden – Bereich des Privaten keine Verantwortungs- und dementsprechend auch keine Argumentationspflichten übernommenwerden müssen. Zumindest hoch umstritten ist Rortys These, Religion hätte im Bereichdes Öffentlichen nichts zu suchen und allenfalls private Bedeutung.
2 Vgl. Robert Brandom, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in den Inferentialismus, dt. Frankfurt a. M. 2001.
3Jörg Schenuit beruft sich auf Kierkegaard, um das eigentlich Unangemessene dieser Konstellationzu markieren: »Für den Liebenden ist es das Selbstverständlichste von der Welt,über seine Liebe zu reden. Eine Abscheulichkeit wäre es dagegen, wenn er anfinge, Gründefür sein Verliebtsein zu benennen. Das wäre das untrügliche Zeichen dafür, dass er in Wirklichkeit nicht verliebt sei, sondern seine Verliebtheit nur vortäusche« (Jörg Schenuit, Das neubürgerliche Gift und die Saat des Dichters, in: Fuge. Journal für Religion und Moderne 3: Der Staub Gottes, Paderborn 2008, 9–27, hier 9 f.). Man könnte als von der Schönheit der Geliebten Faszinierter und in sie Verliebter etwa darlegen, wie ihr Gesichtund ihre Figur perfekt den Schönheitsidealen entsprechen, die sich evolutionär mehr oderweniger invariabel ausgeprägt haben. Aber das wäre in der Tat nicht nur geschmacklos, sondern erregte darüber hinaus den kaum zu widerlegenden Verdacht, mit der Liebe zudieser »arche-typisch Schönen« könne es nicht weit her sein. Die hier eigentlich interessierende Frage ist freilich, ob die Situation des über seinen Glauben befragten Glaubendentatsächlich die des Hals-über-Kopf-Verliebten ist? Schenuit problematisiert das in seinem Beitrag selbst.
4 Blaise Pascal, Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées), hg. von E. Wasmuth, Gerlingen 9 1994, 141, Aphorismus 277. Er lautet im Französischen: »Lecœur a sa raison, que la raison ne connait pas«, und ist wegen des Doppelsinns von raison(Grund und Vernunft) ins Deutsche nur schwer zu übersetzen.
5 Die hier assoziierte Gerichtsmetapher wird sich als wissenschaftstheoretisch höchst belangvollherausstellen. Als solche ist sie schon von Kant geltend gemacht worden: als Gerichtshofder Vernunft. Vgl. Immanuel Kant, Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik derreinen Vernunft, B XIII.
6Richard hat die Figur des Mitgeliebten in trinitätstheologischen Zusammenhängen eingeführt, aber durchaus im Blick auf mitmenschliche Erfahrungen profiliert; vgl. Richardvon Sankt-Victor, Die Dreieinigkeit, Übertragung und Anmerkungen von Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1980, 95–101 (III. Buch, cap. XI–XV).
7Friedrich Nietzsche zitiert in diesem Sinne einen Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg:»Man liebt weder Vater, noch Mutter, noch Frau, noch Kind, sondern die angenehmen Empfindungen, die sie uns machen« (Menschliches, Allzumenschliches I, Aphorismus133, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, München – Berlin 1980[KSA], 127).
8 Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt a. M. 1973; Helmut Peukert, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Analysenzu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung, Düsseldorf 1976.
9 Mit dieser Ausarbeitung unterwirft sie sich dem Wissenschaftskriterium der Systematizität. Vgl. Paul Hoyningen-Huene, Systematizität als das, was Wissenschaft ausmacht, in: Information Philosophie 37 (2009), Heft 2, 22–27, mit der pointierten Schlussthese: »Die ganze Wissenschaft ist nur eine Systematisierung des alltäglichen Denkens« (ebd., 27). In dieser Zuspitzung ist die These jedoch zumindest einseitig. Wenn Systematisierung unabdingbar Theoriebildung erfordert, so ist – jedenfalls für die alltägliche Wissenschaftspraxis – eine Spannung zwischen der Einbeziehung des Einzelnen in eine umfassende Theorie und dem möglichst konkreten Gegenstandsbezug der Forschung zu konstatieren. Marcus Beiner spricht diese Spannung in seinem als Einführung empfehlenswerten Buch: Humanities. Was Geisteswissenschaft macht. Und was sie ausmacht, Berlin 2009, 18, wie folgt an: »Gegenstandsbezug und Theoriebezug stehen […] in einem Spannungsverhältnis […]: Je näher am Gegenstand gearbeitet wird, desto schwieriger wird eine theoretische Einbettung; je besser eine theoretische Einbettung gelingt, desto gefährdeter ist die Angemessenheit dem Untersuchungsgegenstand gegenüber.« Es ist dies – abstrakter formuliert – die Spannung zwischen (theoretischer) Allgemeinheit und Besonderheit; die Theologie ist von ihr – wie sich gleich zeigen wird – in besonderer Weise herausgefordert und in Anspruch genommen.
10 Schwundform dieser Hochschätzung des Individuellen und der Erkenntnis, die sich inihr erschließt, ist das Herrschafts- und Kontrollwissen, das sich an biographischen oderbiometrischen »Identitätsmerkmalen« festmacht und dazu dient, ein Individuum zweifelsfreiunverwechselbar als dieses festzustellen: Hier wird ein Unterscheidungswissen bereitgestellt, das der Unterscheidung der Individuen dient und nicht der Würdigung derdurch Merkmale unterschiedenen Individualitäten.
11Marcus Beiner (Humanities, 27 ff.) macht die Perspektivität als Leitkategorie der Geisteswissenschaftengeltend, die freilich auch in den Naturwissenschaften ihre Geltung nichtvollständig verliert. Er führt nachvollziehbar aus, wie es in den Geisteswissenschaften entscheidendum die Explikation der Perspektiven und – wie ich hinzufügen würde – um die Herausarbeitung des Verhältnisses der verschiedenen Perspektivierungen zueinandergeht. Das gilt – wie sich noch zeigen wird und oben ja schon angedeutet wurde – ebensound in spezifischer Weise für die Theologie.
12 Ethik, Dietrich Bonhoeffer Werke, Bd. 6, hg. von E. Feil u. a., München 1992, 79.
13 Vgl. die verschiedenen Fassungen der Einleitung in die Wissenschaftslehre sowie die Darstellung der Wissenschaftslehre von 1801 in: Fichtes Werke, hg. von I. H. Fichte, Berlin1971, Bd. 1 und 2.
14 In seinem Lexikon-Aufsatz zum Stichwort Fundamentaltheologie (in: J. Höfer – K. Rahner[Hg.], Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 4, Freiburg im Breisgau 2 1960, 452–460, hier 459) formulierte Gottlieb Söhngen schon im Jahre 1960: »So gipfelt die Fundamentaltheologiein einer theologischen Wissenschaftstheorie, welche Offenbarung und Theologievor den Anspruch der Wissenschaft und die Wissenschaft vor den Anspruch der Offenbarung und Theologie stellt.« Für die konkrete Ausgestaltung des Faches hat diese Feststellung aber kaum Konsequenzen nach sich gezogen. Eine eigene Ausarbeitung fanddiese fundamentaltheologische Aufgabe katholischerseits tatsächlich nur in dem bereitsgenannten Buch von Helmut Peukert (Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie).
1. Glaubens-Wissenschaft?
1.1 Glauben – logisch?
Glauben und Logik – wie geht das zusammen? Das Subjektivste, die innere, innerliche Ergriffenheit des Menschen von dem, was ihn unbedingt angeht,1 wovon Menschen sich unbedingt angehen und bestimmen lassen und wozu sie sich in allem, was sie sind und sein wollen, verhalten. – Die äußerste Objektivität, an der sich nichts deuteln lässt, die man eben nicht so oder auch ganz anders sehen kann, die undiskutierbar gilt, mit einer Notwendigkeit, der niemand sich entziehen kann, will er aus der »gemeinsamen Welt« mit ihren elementaren Selbstverständlichkeiten nicht herausfallen. Glauben: das kann man, wenn man will, muss es aber nicht. Der Logik muss man gehorchen, ob man will oder nicht, es sei denn, man stellt die Fähigkeit der Menschen von Grund auf in Frage, zu vernünftigen und zustimmungswürdigen Einsichten zu kommen. Glaube und Logik: Wie kann man sie in einem Atem nennen?
Für Menschen in einer vormodernen Gesellschaft mag es so gewesen sein: der christliche Glaube als elementare Selbstverständlichkeit, so selbstverständlich, dass mit ihm alles Andere – alles andere als selbstverständlich Geltende – auf dem Spiel stand: friedlich-menschliches Zusammenleben, die Möglichkeit der Erkenntnis, die Moral. Kein Stein würde auf dem anderen bleiben, wenn man sich erlaubte, die Fundamente zu untergraben. Und die Fundamente waren Glaubens-Fundamente, unerschütterlich in Gott selbst gegründet, von seiner Kirche verbürgt. Wer das bestritt, stand außerhalb, auf schwankendem Boden. Oder er war schon dabei, in den unendlichen Abgrund der Gott-losigkeit zu fallen, der Wahrheitslosigkeit, der Morallosigkeit. Nichts ließ sich mehr begründen und der Beliebigkeit entreißen, wenn man den Grund in Frage stellte, der alle Begründungen trug und sie allein tragen konnte.
Gott-logisch: ohne Gott keine tragfähigen Begründungen. Noch Descartes hat es so gesehen und geltend gemacht, weil er dem radikalen Zweifel, der alles haltlos zu machen drohte, nicht anders Halt gebieten konnte.2 Wenn auch Gott und seine Güte noch zweifelhaft würden, gäbe es überhaupt kein Halten mehr. Aber was ist ein Halt, was ist ein Fundamentum inconcussum wert, vor dem der Zweifel nur deshalb Halt machen soll, weil der Zweifelnde seinen letzten Rückhalt nicht verlieren will, weil er doch nicht bereit ist, an allem zu zweifeln? Der Gotteslogik folgen nur die Furchtsamen und Phantasielosen. Sie können sich nicht vorstellen, ohne einen letzten Halt auszukommen. So finden sie nichts dabei, letzte Gewissheiten auf Wünsche oder Weigerungen zu gründen, so als wäre es ein Argument, dass man ohne Gottesgewissheit alle Gewissheit verlöre. Als ob es nicht genau darauf ankäme, der Ungewissheit auch im Letzten noch standzuhalten und ihr gewachsen zu sein.
Friedrich Nietzsche beflügelt die Phantasie des Zweifels, so dass sie hinwegkommt über die Barriere des Unvorstellbaren: dass es keinen Gott gibt, keine Wahrheit, kein unverfügbar Vorgegebenes, dem die Menschen sich unterwerfen müssten, kein unabdingbar verpflichtendes Sollen. Es ist schon so: Wenn Gott nicht ist, wenn er »tot ist«, fällt mit ihm alles, was man mit ihm begründete; fällt die Gott-Logik, fallen die Gott-verbürgten Selbstverständlichkeiten, an denen man sich bisher nicht zu zweifeln getraute. Dieses Ereignis ist – so räumt Nietzsche ein –
»viel zu gross, zu fern, zu abseits vom Fassungsvermögen Vieler, als dass auch seine Kunde schon angelangt heissen dürfte; geschweige denn, dass Viele bereits wüssten, was eigentlich sich damit begeben hat – und was Alles, nachdem dieser Glaube untergraben ist, nunmehr einfallen muss, weil es auf ihm gebaut, an ihn gelehnt, in ihn hineingewachsen war: zum Beispiel unsre ganze europäische Moral. Diese lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz, die nun bevorsteht: wer erriethe heute schon genug davon, um den Lehrer und Vorausverkünder dieser ungeheuren Logik von Schrecken abgeben zu müssen, den Propheten einer Verdüsterung und Sonnenfinsternis, deren Gleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat?«3
Nietzsche selbst und sein Zarathustra4 sollen und wollen die Propheten des Unvorstellbaren sein. Es ist ihre Sendung, diese abgründigste Erschütterung – die Logik der Gott-losigkeit und der Sonnenfinsternis mit all ihrem Schrecken – endlich zu Bewusstsein zu bringen: damit die Menschen zu einer neuen Logik aufbrechen und entschlossen ohne Gott und die Gott-verbürgten Selbstverständlichkeiten zu leben wagen. Die »freien Geister«, die diese Propheten um sich sammeln, haben hinter sich gelassen, was den Menschen bisher Heimat und Sicherheit bot. Ihr »Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung, – endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist, endlich dürfen unsre Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so ›offnes Meer‹.–«5
Glauben? Ja, auch die freien Geister beseelt ein Glaube. Woran glauben sie? »Daran: dass die Gewichte aller Dinge neu bestimmt werden müssen«6 – weil sie von keinem Gott her vorbestimmt sind, weil es nun die Menschen selbst sind, die das Gewicht der Dinge abwägen und bestimmen. Darin liegt die höchste Selbststeigerung des Menschen – die zum Übermenschen, der sich die »Umwertung aller Werte« zutraut und sie entschlossen vollzieht.
Gott logisch? Es ist eine längst überwundene, endlich in all ihren Konsequenzen außer Kraft zu setzende Logik, die an Gott festgemacht ist. Sie und die von ihr beherrschte »Grammatik«7 als überwunden zu durchschauen, als freiheitsverkleinernd, als (über-)menschen- und naturfeindlich, und sie tatsächlich zu destruieren, das ist Nietzsches Denk-Leidenschaft. Gott-Logik, das kann jetzt nur noch die kritische Rekonstruktion und Destruktion einer perversen Logik sein, die ihre bezwingende Macht verliert, wenn man Einblick genommen hat in ihre Entstehung und ihr Funktionieren, in die Pathologie des Religiösen, für die sie die Verantwortung trägt. Hat man nachgewiesen, auf welchen »Irrgängen der Vernunft« sich die Religion »in’s Dasein geschlichen«,8 ins menschliche Leben, Fühlen und Denken eingeschlichen hat, und konnte man sie genetisch erklären – als Fehlentwicklung des menschlichen Strebens nach Macht –, so ist es um ihren Kredit geschehen. Man kann die in ihr behauptete andere Welt dann zwar noch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Aber es bleibt nur ein minimaler, leerer, völlig bedeutungsloser Möglichkeitsrest, mit dem man »gar nichts anfangen [kann], geschweige denn, dass man Glück, Heil und Leben von den Sinnenfäden einer solchen Möglichkeit abhängen lassen dürfte.«9
1.2 Glauben und Wissen
Die Religionskritik des 19. und 20. Jahrhunderts kann gar nicht anders denken: Auf festem Boden steht das Wissen von Religion, soweit es »genetisch« erklärt, wie es zu den unwissenschaftlichen und von den Wissenschaften als vollkommen unzutreffend erwiesenen religiösen Überzeugungen kam. Wissenschaft bedeutet Entlarvung bzw. Widerlegung religiöser Einstellungen und Überzeugungen. Eine Wissenschaft, die das Wissen des Glaubens herausarbeiten und als solches legitimieren wollte, kann es nicht geben; sie wäre eine Contradictio in adiecto. Die Glaubensüberzeugungen erscheinen als Ausgeburten des Wunsches und der Angst. Was sie an Wissen beanspruchen, ist allein dem Bedürfnis geschuldet, sich in einer Welt geborgen zu fühlen, die doch »in Wirklichkeit« auf die Menschen und ihre Wünsche keinerlei Rücksicht nimmt; einem Bedürfnis, das der Mensch sich nicht erfüllen darf, wenn er die äußerste Herausforderung des Menschseins ergreifen und ihr gewachsen sein will. Wiederum Nietzsche: »noch nie hat eine Religion, weder mittelbar, noch unmittelbar, weder als Dogma, noch als Gleichnis, eine Wahrheit enthalten. Denn aus Angst und dem Bedürfniss ist eine jede geboren …«10 Das falsche Wissen der Religion tröstet, indem es vertröstet. Dieser Trost muss dem Menschen aus der Hand geschlagen werden, damit er endlich begreift, was vor ihm liegt – wozu er wirklich berufen ist. »›Glaube‹ heisst Nicht-wissen-wollen, was wahr ist«,11 heißt, sich dem Schmerz der Wahrheit und des Wissens entziehen. Dagegen steht der Mut der freien Geister, sich vom Wissen enttäuschen und über den Bannkreis der eigenen, viel zu kleinen Wünsche hinausführen zu lassen:
»Man hat jeden Schritt breit Wahrheit sich abringen müssen, man hat fast Alles dagegen preisgeben müssen, woran sonst das Herz, woran unsre Liebe, unser Vertrauen zum Leben hängt. Es bedarf Grösse der Seele dazu: der Dienst der Wahrheit ist der härteste Dienst. – Was heisst denn rechtschaffen sein in geistigen Dingen? Dass man streng gegen sein Herz ist, dass man die ›schönen Gefühle‹ verachtet […] Der Glaube macht selig: folglich lügt er …«12
Das Wissen muss die wunschbestimmten Überzeugungen zerstören, damit die Übermalungen von der Wirklichkeit abgewischt werden, mit der die Glaubenden sich das Leben in ihr erträglich machten, und die Welt endlich ihr wahres Gesicht zeige: Das ist das Wissenspathos des Intellektuellen im 19. Jahrhundert.13 Ent-täuschung ist der Preis des Wissens, den die Gläubigen nicht zahlen wollen. Intellektuelle sind Menschen, die den Schmerz der Enttäuschung tragen und ihn den anderen zumuten. Der Preis des Wissens wird von denen gern bezahlt, denen sich dabei die neuen Möglichkeiten des Menschseins auftun, mit denen das Wissen die Wissenden beschenkt. Die Glaubenden weigern sich, diesen Preis zu zahlen. So sind sie genötigt, die Möglichkeiten des Fortschritts schlecht zu machen. Mit ihrem illusionären Wissen um eine Zukunft, die nicht von dieser Welt sein soll, sündigen sie an der Zukunft und an den Möglichkeiten der Menschen in dieser Welt.
Wunschbefreites, illusionsloses, Wissenschafts-generiertes Wissen steht gegen Wunsch-generiertes Pseudo-Wissen bzw. gegen Überzeugungen, die sich gegen das von den Wissenschaften erzeugte Wissen immunisieren, um nicht von ihm zersetzt zu werden. Das war die »Schlachtordnung«, die das Ringen um das Verhältnis von Glauben und Wissen im 19. Jahrhundert weithin bestimmte. Die Apologeten des rechten Glaubens wurden in dieser Schlachtordnung auf eine zunehmend hilflose Defensivposition festgenagelt bzw. sie zogen sich selbst auf diese Position zurück. Die Erkenntnisse der Wissenschaften stellten infrage, was man im Glauben voraussetzte und zu wissen meinte: die Möglichkeiten eines göttlichen Eingreifens in natürliche Prozesse, die Schöpfung am Anfang, Gottes machtvoll-liebende Fürsorge für die Seinen in der Geschichte, die Unterscheidung von Leib und Seele, die Willensfreiheit usf. Die Apologeten des Glaubens setzten sich gegen die (empirischen) Wissenschaften zur Wehr, indem sie sich auf ein höheres Wissen beriefen, dem das natürlich-wissenschaftliche Wissen der Menschen gar nicht widersprechen könnte, wenn es nicht – wovon man leider ausgehen müsse – durch antireligiöse Vorurteile und Ressentiments verfälscht wäre. Das 1. Vatikanische Konzil (1870) hat das Verhältnis von Glauben und säkularen Wissenschaften in diesem Sinne bestimmt. Es geht davon aus,
»dass es eine zweifache Ordnung der Erkenntnis gibt, die nicht nur im Prinzip, sondern auch im Gegenstand verschieden ist: und zwar im Prinzip, weil wir in der einen (Ordnung) mit der natürlichen Vernunft, in der anderen mit dem göttlichen Glauben erkennen; im Gegenstand aber, weil uns außer dem, wozu die natürliche Vernunft gelangen kann, in Gott verborgene Geheimnisse vorgelegt werden, die, wenn sie nicht von Gott geoffenbart wären, nicht bekannt werden könnten.«14
Der Glaube wird hier als eine der natürlichen Vernunft übergeordnete Erkenntnis verstanden. Auch die übernatürliche