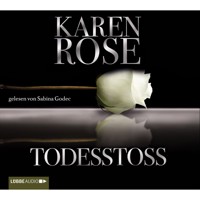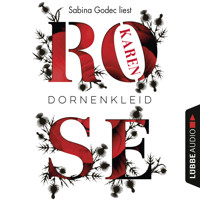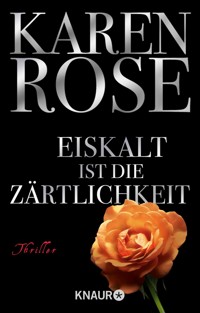
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Chicago-Reihe
- Sprache: Deutsch
Perfekt spielt Grace Winters die glückliche Ehefrau - doch in Wahrheit ist ihr Leben die Hölle. »Eiskalt ist die Zärtlichkeit« ist ein fesselnder romantischer Thriller über eine Frau, die alles riskiert, um dem Horror ihrer Ehe zu entkommen. Grace Winters spielt perfekt die Rolle der glücklichen Ehefrau, doch in Wahrheit ist ihr Leben die Hölle. Ihr Ehemann Robb ist ein unberechenbarer Psychopath. Schließlich setzt die junge Frau alles auf eine Karte: Sie täuscht ihren eigenen Tod vor, um endlich frei zu sein. Und der Plan geht zunächst auch auf. Doch während Grace sich in ihrem neuen Leben einrichtet und sich schließlich sogar einer neuen Liebe zu öffnen wagt, hat Robb ihre Spur aufgenommen. Er will sich zurückholen, was ihm gehört! Unwiderstehlicher Romantic Thrill von Bestseller-Autorin Karen Rose Bestseller-Autorin Karen Rose liefert mit Eiskalt ist die Zärtlichkeit einen atemberaubenden Mix aus nervenaufreibender Spannung und leidenschaftlicher Romantik. Ein Pageturner, der die Abgründe menschlicher Beziehungen erkundet und gleichzeitig einen Hauch Romantik mitbringt. »So packend wie eine kalte Hand im Nacken - und doch zugleich auch eine bewegende Liebesgeschichte.« Publishers Weekly Die Chicago-Thriller der Bestseller-Autorin Karen Rose sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Eiskalt ist die Zärtlichkeit« (Band 1) - »Das Lächeln deines Mörders« (Band 2) - »Des Todes liebste Beute« (Band 3) - »Der Rache süßer Klang« (Band 4) - »Nie wirst du entkommen« (Band 5) - »Heiß glüht mein Hass« (Band 6)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Karen Rose
Eiskalt ist die Zärtlichkeit
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»So packend wie eine kalte Hand im Nacken – und doch zugleich auch eine bewegende Liebesgeschichte.«Publisher Weekly
Perfekt spielt Grace Winters die glückliche Ehefrau – doch in Wahrheit ist ihr Leben die Hölle. Ihr Ehemann Robb ist ein unberechenbarer Psychopath. Eines Tages setzt die junge Frau alles auf eine Karte: Sie täuscht ihren eigenen Tod vor, um endlich frei zu sein. Der Plan geht zunächst auch auf. Doch während Grace sich in ihrem neuen Leben einrichtet und sich schließlich sogar einer neuen Liebe zu öffnen wagt, hat Robb ihre Spur aufgenommen. Er will sich zurückholen, was ihm gehört!
Inhaltsübersicht
Prolog
Asheville, North Carolina
1. Kapitel
Douglas Lake, East Tennessee
Asheville, North Carolina
2. Kapitel
Chicago
Asheville
3. Kapitel
Carrington College, Chicago
Sevier County, Tennessee
4. Kapitel
Chicago
State Bureau of Investigation (SBI)Raleigh, North Carolina
Chicago
5. Kapitel
Chicago
Asheville, North Carolina
Chicago
6. Kapitel
Asheville, North Carolina
Asheville, North Carolina
Chicago
Asheville
7. Kapitel
University of North Carolina, Charlotte
Chicago
8. Kapitel
Boone, North Carolina
Sevier County, Tennessee
Chicago
Asheville
Chicago
9. Kapitel
Chicago
10. Kapitel
Hickory, North Carolina
Chicago
Asheville
Raleigh, North Carolina
11. Kapitel
Chicago
Greenville, North Carolina
12. Kapitel
Chicago
Chicago
Asheville
Hickory, North Carolina
Chicago
13. Kapitel
Asheville
Asheville
Charleston, South Carolina
Asheville
Chicago
Chicago
Asheville
14. Kapitel
Chicago
Asheville
Chicago
Asheville
15. Kapitel
Chicago
Chicago
Chicago
16. Kapitel
Chicago
Chicago
Chicago
17. Kapitel
Charlotte, North Carolina
Chicago
Chicago
18. Kapitel
Raleigh, North Carolina
Chicago
Chicago
Chicago
Raleigh, North Carolina
19. Kapitel
Chicago
Chicago
Chicago
20. Kapitel
Chicago
Chicago
Asheville
Chicago
Chicago
21. Kapitel
Chicago
Chicago
Chicago
Chicago
Asheville
22. Kapitel
Asheville
Asheville
Western North Carolina
Asheville
Asheville
Western North Carolina
23. Kapitel
Interstate 40 Richtung Blowing Rock, NC
Western North Carolina
24. Kapitel
25. Kapitel
Asheville
26. Kapitel
Chicago
Für meine Freundinnen, die [...]
Prolog
Asheville, North Carolina
Vor neun Jahren
Die Geräusche wirkten beruhigend. Das sanfte Piepsen der Monitore, das leise Scharren der Schwesternschuhe auf dem gefliesten Boden, die gedämpften Stimmen auf dem Flur. Sie lullten sie trotz der Schmerzen ein, und sie fiel in einen unruhigen Schlaf. In Sicherheit, dachte sie, bevor sie wegdämmerte.
»Wo ist meine Frau? Ich muss zu meiner Frau!«
Die verzweifelte Stimme riss Mary Grace aus ihrem Dämmerschlaf. Sie versuchte, die Augen zu öffnen, erinnerte sich aber dann, dass sie zugeschwollen waren. Er ist hier.
Jemand hielt ihn zurück. Jemand mit einer tiefen Stimme, die in ihr kleines Zimmer drang. Vielleicht der Arzt. Ja, so musste es sein.
»Immer langsam, Officer Winters. Ihre Frau braucht Ruhe.«
»Was ist passiert? Lassen Sie mich los! Ich will zu Mary Grace!«
»Ihre Frau hatte einen bösen Unfall. Sie sieht ziemlich mitgenommen aus.«
»Was …« Sie hörte, wie er sich räusperte. »Ist sie schwer verletzt?«
Mary Grace lauschte angestrengt. Wie schwer war sie verletzt? Der scharfe Schmerz in ihrem Arm und ihrem Kopf drohte ihr das Bewusstsein zu rauben. Der Rest ihres Körpers fühlte sich taub an. Das kommt von den Schmerzmitteln, dachte sie und wehrte sich gegen die Benommenheit, die sie zu überwältigen drohte.
»Sie hat einen komplizierten Armbruch erlitten, den wir an zwei Stellen mit Metallstiften richten mussten. Auch ihr rechtes Bein ist gebrochen. Wir haben direkt über dem Knie einen weiteren Metallstift eingesetzt. Außerdem hat sie zahlreiche Blutergüsse im Gesicht und am Hinterkopf und über dem Auge eine tiefe Platzwunde. Es hat nur wenig gefehlt, und sie hätte das Auge verloren.«
Mary Grace unterdrückte ein Schaudern. Jede noch so kleine Kopfbewegung schmerzte höllisch.
»Aber sie wird sich bestimmt wieder erholen.« Sie hörte die Verzweiflung in der Stimme ihres Mannes.
Eine lange Pause folgte, die Mary Graces Herz zum Rasen brachte.
»Sie wird doch wieder gesund werden, oder? Verdammt, Doktor, sagen Sie mir die Wahrheit!«
Ja, bitte, die Wahrheit, dachte Mary Grace. Und machen Sie schnell. Die Benommenheit drohte sie wieder einzuholen.
»Ihre Frau ist eine Treppe hinuntergestürzt, Officer Winters. Dabei hat sie sich den neunten Wirbel des Rückgrats gebrochen. Sie ist eine ganze Weile mit gequetschtem Rückenmark bewusstlos dagelegen.«
»Oh mein Gott!«
Ihr Herz hörte auf zu rasen und schien stillzustehen. Es dauerte einen Moment, bis sie wieder mühsam atmen konnte.
»Nun, sie hat Lähmungserscheinungen.«
Oh mein Gott, dachte Mary Grace. Oh mein Gott.
»Ist das … geht das vorüber?«
»Das ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen. Wir müssen warten, bis die Schwellung abklingt, dann lassen wir einen Spezialisten für Rückenmarksverletzungen aus Raleigh kommen, der Ihre Frau gründlich untersuchen wird.«
»Kann ich sie sehen?«
»Nur für ein paar Minuten. Ich werde hier auf Sie warten.«
Sie hörte, wie er sich in das Krankenzimmer schob; seine Cowboystiefel knirschten auf dem Boden. Dann konnte sie ihn riechen, sein aufdringliches Aftershave, das er stets benutzte. Sie spürte seine Körperwärme, als sich seine große Gestalt zu ihr herabbeugte.
»Gracie«, sagte er bekümmert. »Mary Grace, was hast du dir getan, Liebling?« Seine Finger strichen über ihren Handrücken, und ein kalter Schauer fuhr ihr über den Nacken. Er neigte sich vor, und seine Lippen streiften ihre Wange. Sein Schnauzbart kitzelte ihre Haut, als er ihre Wange bis zum Ohr mit einer Spur kleiner Küsse bedeckte.
Dann geschah es. Sie hatte darauf gewartet, hatte gewusst, dass es kommen würde.
»Ein Wort«, hauchte er so leise an ihr Ohr, dass niemand außer ihr ihn hören konnte. »Ein Wort aus deinem dämlichen Mund, und das nächste Mal leiste ich ganze Arbeit, das schwöre ich dir.« Es sah aus, als würde er mit den Lippen ihr Ohrläppchen liebkosen. »Verstanden?«
Mary Grace schaffte es, ein wenig mit dem schmerzenden Kopf zu nicken, damit er sich zufrieden gab. Er richtete sich auf, strich ihr mit der Hand über das Haar und griff unmerklich hinein, als wolle er daran ziehen. Eine Welle von Übelkeit überrollte sie.
»Ach, Gracie, Liebling. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen.«
Instinktiv wich ihr Körper vor seiner bekümmert klingenden Stimme zurück, doch jede Muskelanspannung bereitete ihr weitere Schmerzen.
»Mehr Zeit kann ich Ihnen heute nicht gestatten, Officer Winters. Am besten gehen Sie zurück zur Wache, und wir benachrichtigen Sie, wenn sich etwas ändert. Noch besser wäre es allerdings, wenn Sie nach Hause fahren würden.«
»Das werde ich tun.« Sein schwerer Seufzer hing in der Luft. »Wo ist der Junge?«
Wieder setzte ihr rasendes Herz für einen Moment aus. Robbie. Wo war Robbie? Eine trübe Erinnerung nagte an ihrem Bewusstsein. Robbie, wie er ihre Hand hielt, wie er sie anflehte, nicht zu sterben, sie anflehte, doch zu warten, bis der Rettungswagen kam. War es dieses oder das vorige Mal gewesen? Sie kämpfte gegen die lähmende Wirkung der Medikamente an, denn sie musste wissen, bei wem ihr Sohn untergebracht war.
»Er ist bei der Krankenhaustherapeutin. Er hat seine Mutter gefunden, verstehen Sie? Der Schock kann ein böses emotionales Trauma in einem Jungen seines Alters auslösen.«
Robs barsche Stimme drang durch den Raum. Er steht jetzt neben dem Arzt, dachte sie. Er wird gleich gehen. Dann ist er allein mit meinem Sohn. »Der Junge ist stark. Er wird es überleben.«
Mary Grace krallte ihre Hände in das Laken, zerrte daran, bis ihre Finger schmerzten. Sie fühlte sich losgelöst von ihrem Bewusstsein. Hilflos in ihrem eigenen Körper gefangen. Er wird es überleben. Er muss überleben. Bitte, Robbie, halte durch, bis ich nach Hause komme.
Danach wird sich unser Leben ändern. Sie musste ihren Sohn beschützen und schwor sich, dass Rob Winters ihnen beiden nie wieder ein Haar krümmen würde. Aber wie sollte sie das schaffen?
Ich werde einen Weg finden.
1
Gegenwart
Douglas Lake, East Tennessee
Sonntag, 4. März, 9:30 Uhr
Gott, das hier hasse ich am meisten an unserer Arbeit. Wie, zum Teufel, kannst du jetzt etwas essen?«
Hutchins blickte über den Lake Douglas hinweg, der in der stillen Morgenfrühe vor ihnen lag, und dachte an die Leiche, die sie herausziehen würden, und an die widersinnige Verschwendung von Leben. Mit der unerschütterlichen Ruhe eines Sheriffs, der auf eine langjährige Erfahrung zurückblickte, stopfte er den Rest seines Doughnuts in sich hinein. »Weil ich bestimmt keinen Appetit mehr habe, wenn sie den Jungen rausgeholt haben. Verhungern will ich aber auch nicht.« Er warf einen mitfühlenden Blick auf das blasse Gesicht seines jüngsten Rekruten. »Wirst dich schon daran gewöhnen, Junge.«
McCoy schüttelte den Kopf. »Man sollte meinen, dass sie vernünftiger wären.«
»Die jungen Leute sind selten vernünftig. Schon gar nicht, wenn sie Frühjahrsferien haben. Auch daran wirst du dich gewöhnen. Ich rechne fest damit, dass wir noch weitere aus dem See ziehen werden, bevor die Urlaubssaison vorüber ist.«
»Vermutlich werde ich die Eltern informieren müssen, wenn unsere Arbeit beendet ist.«
Hutchins zuckte mit den Schultern und zündete sich eine Zigarette an. »Du hast den Fall übernommen, Junge. Dann musst du ihn auch zu Ende bringen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist das auch nicht gerade, aber du musst noch lernen, schlechte Nachrichten zu überbringen.«
McCoy konzentrierte sich auf das Boot, das langsam einen Haken über den Boden des Sees zog. »Sie hoffen immer noch, dass er lebt. Heiliger Strohsack, Hutch – wie können Eltern sich dermaßen an ihre Hoffnung klammern? Die anderen Jungs haben es klar und deutlich zu Protokoll gegeben. Sie haben getrunken und herumgealbert, und der Kleine hat seinen Jet-Ski kaputtgefahren. Sie haben gesehen, wie er untergegangen ist.«
Hutchins sog an seiner Zigarette und stieß den Rauch mit einem Seufzer wieder aus. »College-Kids sind dumm. Ich sag’s dir immer wieder. Aber Eltern …« Er schüttelte seinen grauen Kopf. »Eltern hoffen. Sie hoffen, bis du sie zwingst, eine Leiche zu identifizieren.«
»Oder das, was davon übrig ist«, brummte McCoy.
»Hey, Tyler.« Die Worte tönten unter statischem Knistern aus McCoys Funkgerät.
»Hey, Wendell«, antwortete McCoy und schluckte. Bei der Vorstellung, was Wendells Haken zutage beförderte, kam ihm die Galle hoch. »Was hast du gefunden?«
»Tja, eine Leiche ist es nicht, so viel steht fest.«
Hutchins griff nach dem Funkgerät. »Was redest du da, Junge?«
»Es ist ein Auto, Sheriff.«
Hutchins schnaubte verächtlich. »Da unten liegen genug Autos herum, um einen Gebrauchtwagenhandel aufzumachen. Das Haus meiner Urgroßmutter steht auch da unten.« Der ganze Mist war noch übrig aus der Zeit, als die Tennessee Valley Authorities in den dreißiger Jahren die Staudämme gebaut und das Tal geflutet hatten. Das war allgemein bekannt.
»Ja, lauter Fords der Serie Model T. Der hier ist neueren Datums. Sieht aus wie ein Ford aus den späten Achtzigern. Auf dem Rücksitz liegt ein Kinderrucksack – einer von diesen Mutant-Ninja-Turtle-Dingern. Wir holen ihn ran.«
»Verdammt.« Hutchins zertrat seine Zigarette unter dem Stiefelabsatz. »Irgendwas ist immer. Holt ihn ran und sucht dann weiter nach dem Jungen.
Asheville, North Carolina
Sonntag, 4. März, 22:30 Uhr
»Verdammter Hurensohn.« Der Junge rang nach Luft. »Scheißkerl.«
Rob Winters starrte den Halbwüchsigen, der bereits kurz vor der Ohnmacht stand, leidenschaftslos an. Schade eigentlich. Er hatte gehofft, der Junge habe mehr Mumm. Mit vierzehn hatte er die Schläge seines Alten hoch erhobenen Hauptes über sich ergehen lassen. Er verstärkte den Druck auf die Hand des dunkelhäutigen Jungen, die er wie ein Schraubstock umklammert hielt. Der Junge stöhnte wieder und taumelte rücklings gegen die Gassenmauer. Ein dumpfer Aufprall ertönte, als sein Kopf mit den albernen Zöpfchen gegen den Stein schlug.
»Ich weiß nichts. Hab ich doch schon gesagt.« Der Junge sog scharf den Atem ein und versuchte seine Hand zu befreien. »Sie können mich ruhig gehen lassen. Ich sag den Bullen nichts, ich schwör’s, Mann. Beim Grab meiner Mutter.«
Winters verzog höhnisch die Lippen. »Ich wette den Monatsvorrat an Lebensmittelmarken deiner Mama darauf, dass sie noch quicklebendig ist, und wenn du auch am Leben bleiben willst, dann sagst du mir, was ich wissen will.« Winters’ Stimme klang ruhig und leise, im krassen Gegensatz zu den keuchenden Schreien, die über die blutigen, geschwollenen Lippen des Jungen kamen. »Alonzo Jones. Wo ist er?«
Der Junge wehrte sich, doch Winters drückte ihn fester an die Gassenmauer. Er wimmerte, woraufhin Winters seinen unbarmherzigen Griff noch verstärkte. Winters neigte sich so dicht dem Kopf des Jungen entgegen, dass seine Lippen dessen Ohr streiften. »Hör zu, Junge, hör mir sehr gut zu, denn ich sag’s nur einmal. Ich muss wissen, wo ich Alonzo Jones finde, und du willst eine gesunde Hand behalten. Wenn ich noch fester zudrücke, werden deine Nerven dauerhaft beschädigt sein, und du bekommst Probleme, wenn du das nächste Mal vorhast, ein Kaufhaus auszuräumen.«
Die Augen des Jungen weiteten sich, und das Weiße darin blitzte hell in der Dunkelheit auf. »Ich hab kein Kaufhaus ausgeräumt, Mann. Ich schwör’s. Oh, verdammt!« Das letzte entfuhr ihm als schriller Schrei, als Winters seine Hand hart quetschte.
»Doch, hast du. Wir haben dich auf Video aufgenommen, Junge. Du und diese Bande, mit der du dich rumtreibst. Anführer ist ein gewisser Alonzo Jones. Jetzt kannst du mit mir zur Wache kommen und uns ganz genau erzählen, wie ihr einem zweiundsechzigjährigen unbewaffneten Weißen ein Messer in den Bauch gestoßen habt, oder du erzählst mir, wo ich Alonzo Jones finde. Den will ich noch dringender sprechen, als ich deinen traurigen Arsch im Knast vergammeln sehen will.«
Der Junge fuhr sich mit der Zunge über seine blutige Lippe, und seine Augen wurden schmal vor Hass. »Du bist ein Bulle? Scheiße, Mann. Ich muss gar nicht mit dir reden. Ich brauche mit keinem anderen außer mit meinem Anwalt zu reden. Über brutale Übergriffe der Polizei. Ihr weißen Bullen habt Spaß daran, uns Schwarze zu verprügeln.« Er ließ sich gegen die Mauer fallen. Schweißperlen traten ihm auf die Stirn, als er versuchte, seine Hand aus dem eisernen Griff zu befreien. »Du bist am Arsch.«
Winters lächelte und genoss den Anblick des Jungen, als der Hass in seinen Augen wieder der Angst wich. Dann drückte er kräftig zu und senkte den Kopf, um über das Brüllen des Jungen hinweg das Knacken der Knorpel zu hören.
»Arschficker, Scheißkerl!«
»Dass deine ach so heilige Mutter dir einen solchen Wortschatz durchgehen lässt! Sag, wo Jones ist. Auf der Stelle.«
Der Junge sackte in sich zusammen, und seine Knie schlugen auf dem Asphalt auf. »Bei seiner Frau.«
Winters ließ die Hand des Jungen los, krallte die Finger um seinen dünnen, schmutzigen Hals und drückte sein Gesicht auf die Straße, während der Junge schützend seine verletzte Hand bedeckte. »Ihr Name?«
»Ich weiß …« Ein erstickter Schmerzensschrei unterbrach seine erbärmliche Lügen. Dann hob Winters den Daumen vom Kehlkopf des Jungen. »Chaniqua«, keuchte er.
Winters’ Stiefel traf den Jungen an der Hüfte, der sich daraufhin zusammenkrümmte und wie ein kleines Kind weinte. »Den Nachnamen, du unnützes …«, er trat erneut zu, und seine Stiefelspitze traf den Jungen in den Bauch und schleuderte ihn auf den Rücken, »… feiges Stück Scheiße.«
Ein schwaches Stöhnen drang zu ihm hinauf. »Pierce. Chaniqua Pierce. Friseurin. In … der Innenstadt.«
Winters verzog das Gesicht, als der Junge auf seine Stiefel kotzte. Wut und Abscheu kochten in ihm hoch, und er trat wieder nach dem Jungen. Dann noch einmal. Und noch einmal. »Jetzt weißt du, wie der alte Mann sich gefühlt hat, als er zusammengerollt auf dem Boden seines Ladens lag und in einer Lache seines eigenen Bluts sterben musste.« Winters wischte mit einem Stiefel den größten Teil des Erbrochenen an der schmutzigen Hose des Jungen ab. Dann zielte er erneut und trat hemmungslos zu. Der magere Körper des Jungen prallte gegen die Ziegelmauer, seine Augäpfel rollten nach hinten, und Blut floss in einem steten Strom aus seinem Mundwinkel. Ein finaler Tritt gegen den Kopf gab ihm den Rest, und der Junge erzitterte und stieß seinen letzten Atemzug aus.
Winters holte tief Luft und wischte den anderen Stiefel am Hemd des Jungen ab.
Ein Stück Scheiße weniger auf der Straße. Er fand, dass er gute Arbeit geleistet hatte, schälte sich die dünnen Latex-Handschuhe von den Fingern und warf sie in einen Müllcontainer. Man konnte nie vorsichtig genug sein, wenn man mit Straßengangs zu tun hatte. Fiese Krankheiten lauerten überall auf der Straße.
Während er die Viertelmeile zum Parkplatz seines Lieferwagens zurücklegte, entfernte er die Wattepads aus seinem Mund, den falschen Überbiss von seinem Oberkiefer und zog sich die graue Perücke vom Kopf. Nun konnte ihn niemand mehr mit diesem Straßenjungen in Verbindung bringen, selbst dann nicht, wenn sich jemand die Mühe machte, die Polizei zu rufen. Er warf einen raschen Blick über die Straße, bevor er sorgfältig seine Perücke verstaute, dann wechselte er die Stiefel und warf das schmutzige Paar mit gerunzelter Stirn auf den Rücksitz. Es waren seine besten Stiefel. Winters zuckte mit den Schultern. Sue Ann würde sie später reinigen. Er schwang sich auf den Fahrersitz und fühlte sich unbesiegbar.
Es war an der Zeit, Miss Chaniqua Pierce einen Besuch abzustatten.
Er war kaum fünf Minuten gefahren, als sich sein Pieper meldete. Aus dem Augenwinkel spähte er nach der Nummer, während er den Blick ansonsten auf den Abschaum gerichtet hielt, der zu dieser Zeit, wo anständige Menschen längst im Bett waren, herumlungerte. Verdammte Scheiße. Konnte dieses Weibsstück ihn nicht mal fünf Minuten in Ruhe lassen. Mit einem wütenden Knurren zog er sein Telefon aus der Tasche und gab die Nummer ein.
»Ross.«
Winters knirschte mit den Zähnen. Ross, wie in Lieutenant Ross. Wie in Quotenfrau, geschrieben in großen, schwarzen Druckbuchstaben. Das Miststück, das den Job an sich gerissen hatte, der ihm zustand.
Er bemühte sich, so viel falsche Freundlichkeit in seine Stimme zu legen, wie er mit halb vollem Magen zustande bringen konnte. »Winters. Was gibt’s?«
»Dasselbe wie die letzten sechs Male in der vergangenen Stunde, als ich versucht habe, Sie zu erreichen. Was ist Ihnen denn so viel wichtiger, als meine Anrufe zu beantworten, Detective?«
Winters holte tief Luft. Sie hatte ihn schon einmal wegen Insubordination abgemahnt. Insubordination. Schon bei dem Gedanken revoltierte sein Magen, und die Wut nagte an ihm. Er war »verwarnt« worden. Verwarnt, verdammt noch mal, von einem inkompetenten Miststück mit einem Arsch, so groß wie South Carolina. Mit einiger Mühe gelang es ihm, sich zu beherrschen. »Ich war bei einem Informanten, Lieutenant.«
»Haben Sie Jones gefunden?«
»Nein, aber ich weiß, wo er ist.«
»Möchten Sie mir verraten, wo?«
Damit sie einen ihrer handverlesenen, arschkriechenden Lieblinge hinschicken und ihn verhaften lassen konnte? Nie im Leben, zum Teufel. »Ich möchte lieber warten, bis ich mir sicher bin.«
»Das kann ich mir denken. Ich möchte es aber lieber jetzt wissen.«
Miststück. »Er ist bei seiner Freundin.«
Am anderen Ende der Leitung entstand eine angespannte Pause. Ein Punkt für mich, dachte er. »Hat diese Freundin einen Namen, Detective? Und treiben Sie bitte nicht wieder Ihre Spielchen mit mir. Ich will Antworten, und zwar sofort.«
Winters biss die Zähne so heftig zusammen, dass es wehtat. »Sie heißt Chaniqua Priest.« Oder Pierce oder so. Am Ende hatte der Junge nur noch gegurgelt. Vielleicht hatte er auch Priest gesagt.
»Haben Sie eine Adresse?«
»Ich weiß nur, dass sie in der Innenstadt wohnt.«
»Sehr hilfreich, Detective. Halten Sie Ihren Informanten zur Verfügung, für den Fall, dass wir noch Fragen haben.«
Winters unterdrückte ein leises Lachen. Wenn sein Informant noch Fragen beantwortete, dann höchstens aufgespießt von den Zinken einer glühenden Forke. »Ja, Sir«, antwortete er, wohl wissend, dass das »Sir« sie mehr ärgerte als alles andere, wenngleich sie rein technisch gesehen ihn deswegen nicht belangen konnte. »Hatte es einen besonderen Grund, dass Sie mich sprechen wollten, Lieutenant?«
»Ja. Sheriff Hutchins aus dem Sevier County in Tennessee hat versucht, Sie zu erreichen. Er sagt, Sie sollen ihn dringend anrufen.« Sie rasselte die Telefonnummer herunter, und er speicherte sie unverzüglich in seinem Gedächtnis. Namen und Zahlen konnte er sich leicht merken. Auf dem Weg nach Gatlinburg war er einmal durch Sevier County gefahren, aber von einem Hutchins hatte er noch nie gehört.
Winters bog auf den Parkplatz des ersten Kaufhauses ein, an dem er vorbeikam, und wählte Hutchins’ Nummer. Der Sheriff wäre in Kürze zu sprechen, wie Hutchins’ Assistent ihm erklärte, er möge bitte warten. Winters tat brummend wie ihm geheißen. Wehe, es ist nichts Wichtiges, dachte er. Er vergeudete wertvolle Minuten, während er warten musste. Endlich bequemte sich der erlauchte Sheriff ans Telefon zu kommen.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ, Officer Winters«, sagte er atemlos, und Winters hörte im Hintergrund das Ächzen eines Stuhls, als der Sheriff sich offenbar setzte.
»Ich bin Detective Winters«, korrigierte er scharf. Hatte Ross ihm das nicht gesagt? Miststück.
»Oh, Verzeihung. Ihr Lieutenant sagte mir bereits, dass Sie befördert worden sind. Mein Gehirn ist im Augenblick ein bisschen überlastet. Wir haben den ganzen Tag lang den Douglas Lake nach einem Unfallopfer abgesucht, und eben gerade hatte ich das Vergnügen, die Eltern informieren zu müssen.«
»Ach, du Schande«, sagte Winters und verdrehte die Augen.
»Aber was geht es Sie an, nicht wahr? Hören Sie, Winters, als wir den See abgesucht haben, haben wir noch etwas anderes gefunden. Ich dachte, Sie sollten es erfahren, bevor die Bürokraten sich einmischen.«
Winters lauschte gespannt den Worten des Sheriffs, und plötzlich waren Lieutenant Ross und Alonzo Jones so ziemlich das Letzte, was ihn interessierte.
Sie hatten seinen Wagen gefunden. Sieben Jahre hilfloser Wut stürzten mit der Wucht eines Güterzugs auf ihn ein. Sie hatten seinen Wagen gefunden, aber sein Junge war nicht darin gewesen.
Seine Frau auch nicht.
2
Chicago
Montag, 5. März, 7:00 Uhr
Na, was ist der Anlass?«Caroline fuhr so heftig zusammen, dass sie sich mit dem Mascarabürstchen über die Stirn fuhr und einen breiten schwarzen Streifen hinterließ. Mit erzwungener Ruhe wandte sie sich um, die Mundwinkel ärgerlich herabgezogen, die Augen schmal zusammengekniffen. Sie hasste ihre nervösen Reaktionen, die ihr auch die Zeit noch nicht hatte austreiben können, denn sie gaben ihr das Gefühl, in einer fremden Haut zu stecken. Caroline holte tief Luft und steckte das Mascarabürstchen wieder in seine Patrone zurück.
»Du sollst das nicht tun, das weißt du doch.«
Dana lehnte mit verschränkten Armen am Pfosten der Schlafzimmertür und hob die Augenbrauen. »Verzeihung.« Dann lächelte sie. »Du siehst ein bisschen wie ein Waschbär aus.«
Caroline stieß einen Seufzer aus, während sie ihr ruiniertes Make-up im Spiegel betrachtete. »So etwas kann ich heute wirklich nicht gebrauchen, Dana. Ich habe schon genug Stress, auch ohne dass du dich von hinten an mich heranschleichst.« Sie kramte in der Schublade nach einer Tube mit Make-up-Entferner.
Dana erstarrte. »Ich habe mich nicht angeschlichen. Ich habe nach dir gerufen, als ich in die Wohnung kam, und dann habe ich fünf Minuten lang mit Tom geredet, bevor ich dich gesucht habe. Du hast einfach nichts gehört. Ach, zum Kuckuck, Caro, mach doch nicht so ein Theater deswegen. Wisch es einfach ab.«
Caroline schloss ein Auge und rubbelte an dem verpfuschten Make-up herum. »Geht nicht. Es ist wasserfest.«
»Ich hasse dieses wasserfeste Zeug.« Dana beugte sich über Carolines Frisiertisch und griff nach der Mascara. »Seit wann benutzt du wasserfeste Wimperntusche?«
Caroline nahm ihr die Mascara aus der Hand und konzentrierte sich aufs Schminken. »Seit Eli gestorben ist.«
Danas Miene wurde ernst. »Entschuldige, Caroline. Das war gedankenlos von mir.«
Caroline schloss die Schublade mit einem Ruck. »Schon gut. Man könnte meinen, dass es inzwischen vorbei wäre, aber offenbar überstehe ich keinen Tag, ohne wenigstens ein oder zwei Mal ein bisschen zu heulen.«
»Es ist ja erst zwei Monate her, Schätzchen.«
»Zwei Monate und zwölf Tage.« Eli Bradford war ihr Lehrer gewesen, ihr Chef, ihr Freund. Abgesehen von Dana und Tom war Eli der einzige Mensch auf der Welt gewesen, der ihr verborgenstes Geheimnis kannte. In der mittlerweile vertrauten Reaktion auf die Erinnerung an den Mann, der ihrer Vorstellung von einem Vater näher kam als jeder andere, schnürte sich ihr die Kehle zusammen. Jetzt war er nicht mehr da, und er fehlte ihr mehr, als sie es für möglich gehalten hätte. Sie zwang sich, an etwas anderes zu denken. »Nun, wenn du schon mal in meine Privatsphäre eingedrungen bist: Wie sehe ich aus?«
Dana schürzte die Lippen und neigte den Kopf, bereit, auf Carolines gewünschten Themenwechsel einzugehen. »Der Haaransatz ist zu hell. Du musst nachfärben.«
Caroline beugte sich vor, um ihren Scheitel zu betrachten. Ein schmaler, goldener Streifen, der eindeutig in starkem Kontrast zu den kaffeebraunen Wellen stand, zog sich über ihren Kopf. »Verdammt. Ich habe doch erst vor zwei Wochen nachgefärbt.«
»Ich habe dir gesagt, dass du keine dunkle Farbe nehmen sollst. Aber hast du auf mich gehört? Nein.«
»Klugscheißerin. Damals dachte ich, es wäre am besten so.« Rasch flocht sie ihr Haar, um das verräterische Blond zu verbergen.
Dana schüttelte den Kopf. »Es ist zu dunkel. War von Anfang an zu dunkel. Du solltest es ein bisschen aufhellen.«
»Da-na«, seufzte Caroline und gab sich keine Mühe zu verbergen, wie gereizt sie war.
»Caro-line.« Dana imitierte ihren Tonfall, wurde dann jedoch sachlich. »Nach so langer Zeit glaubst du immer noch, dass du dich hinter dieser Haarfarbe verstecken musst?«
»Ich gehe lieber auf Nummer sicher.« Das war ihre Standardantwort.
»Auf jeden Fall«, sagte Dana leise und senkte für einen Moment den Blick. Dann sah sie Caroline mit ernster Miene an. »Du könntest es ein ganz klein wenig aufhellen. Der Kontrast lässt dein Gesicht so blass erscheinen. Besonders zu dieser Jahreszeit, wenn der Winter gerade erst vorüber ist.«
»Vielen Dank.«
Dana lächelte, und die Stimmung im Zimmer hellte sich plötzlich auf. »Keine Ursache. Aber dein Pulli gefällt mir wirklich. Das Blau passt gut zu deiner Augenfarbe.«
»Zu spät und nicht genug, liebe Freundin. Und diese Bezeichnung meine ich nur im weitläufigen Sinne.« Das war denkbar weit von der Wahrheit entfernt, und sie wussten es beide. Danas einzigartige Mischung aus Frohsinn und Nüchternheit hatte Caroline schon über manchen schwarzen Tag hinweggeholfen. Sie waren beste Freundinnen. Und nachdem sie über so viele Jahre hinweg völlig allein und auf sich gestellt gewesen war, wusste Caroline Stewart den Wert einer besten Freundin wie Dana Dupinsky weiß Gott zu schätzen. Eine bessere, klügere oder treuere gab es nicht. Caroline schob die Füße in ein Paar Pumps mit flachem Absatz. »Sieht man, dass die hier ein Sonderangebot zu zehn neunundneunzig sind?«
Mit zusammengekniffenen Augen musterte Dana Carolines Füße. »Nein. Wozu dieser Aufwand heute Morgen? Und das bringt uns zu meiner Frage zurück: Was ist der Anlass?«
»Mein neuer Boss hat heute seinen ersten Tag. Ich will einfach nur einen guten Eindruck hinterlassen.« Sie drehte sich seitlich zum Spiegel und prüfte ihre Erscheinung. »Ich möchte professionell aussehen, ohne zu übertreiben.« Sie betrachtete sich noch eingehender. »Meinst du, dass diese Ohrringe zu gewagt sind?«
Dana schnaubte durch die Nase. »Diese Ohrringe sind so weit davon entfernt wie du selbst, mein Herz.«
»Zieh jetzt bloß nicht über mein Liebesleben her. Beantworte einfach nur meine Frage.«
»Du hast kein Liebesleben, Caroline. Und die Ohrringe sind in Ordnung. Keine Sorge. Du siehst großartig aus. Du bist eine ausgezeichnete Sekretärin, und dein neuer Boss wird beeindruckt sein.«
Caroline seufzte. »Das hoffe ich. Ich habe mich so an die Zusammenarbeit mit Eli gewöhnt. Ich wusste, was er brauchte, noch bevor er es ausgesprochen hatte. Und diesen Job muss ich unbedingt behalten, wenigstens bis zu meinem Abschluss.« Nach dem College-Abschluss wollte sie sich an der juristischen Fakultät einschreiben, und dann wären die täglichen Sorgen einer Sekretärin, die das Büro der Historischen Abteilung am Carrington College zu organisieren hatte, Schnee von gestern.
»Alles wird gut.«
Caroline warf ihr einen milde tadelnden Blick zu. »Das sagst du immer.«
»Und ich habe immer Recht.«
Caroline lächelte. »Was bist du nur für ein Dickkopf.«
»Aber ein Dickkopf, der Recht hat.«
»Das stimmt.« Caroline trat dichter an den Spiegel heran und zog den Rollkragen ihres Pullis herab, um ihren Hals zu betrachten.
»Man sieht sie nicht«, sagte Dana weich. »Keine Angst.«
Caroline rückte den Kragen wieder zurecht und straffte den Rücken. »Dann bin ich bereit, Dr. Maximillian Alexander Hunter entgegenzutreten.«
Dana lachte. »Heißt er so? Das hört sich an, als wäre er ein vierhundert Jahre alter Geschichtsprofessor.«
»Er ist Geschichtsprofessor.«
»Sag ich doch.«
Caroline zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich ist er nicht älter, als Eli war. Solange ich nicht für Monika Shaw arbeiten muss, bin ich glücklich, selbst wenn Hunter sich als vierhundert Jahre altes ausgestopftes Känguru erweisen sollte.«
Sie ging in Richtung der Küche, und Dana folgte ihr auf den Fersen. »Wie nimmt die alte Shaw-Zicke es auf?«
Caroline lachte leise, doch ihre Miene wurde wieder ernst, als sie Tom an dem winzigen Klapp-Küchentisch sitzen und Cornflakes löffeln sah. Pro Tag verschlang er mindestens eine Packung. Mit vierzehn Jahren hatte er einen Wachstumsschub nach dem anderen und fraß ihr buchstäblich die Haare vom Kopf. Sie bediente sich ihres Mom-Tonfalls, als sie sagte: »Dana, hör bitte auf, sie als Zicke zu bezeichnen.«
»Lass es gut sein, Mom«, sagte Tom, und sein Löffel hielt auf halbem Weg zum Mund inne. »Ich hab gesehen, wie du gelacht hast.«
»Du!« Caroline zauste sein dickes, blondes Haar. Kurz geschoren, wie er es trug, fühlte es sich wie eine Scheuerbürste an und kitzelte ihre Handfläche. »Erwischt. Du musst dich beeilen, sonst …«
»Verpasst du den Bus«, vollendete Tom den Satz. Er schaufelte sich weitere vier Löffel in den Mund, bevor er nach seinem Rucksack griff. »Muss los. Nach der Schule hab ich Training, Mom. Vor fünf bin ich nicht zu Hause.«
»Pass …«
»Auf dich auf«, sagte er mit einem frechen Grinsen. »Du auch auf dich. Viel Glück mit Hunter.« Sein Lächeln erstarb. »Und nimm dich in Acht vor der Shaw, ja?«
Caroline legte eine Hand an seine Wange. Tom war über einsachtzig groß und seine Wange damit beinahe außerhalb ihrer Reichweite. »Mach ich. Keine Angst. Die Shaw kann uns nichts tun. Sie ist gehässig und rachsüchtig, aber eher gewinne ich den Nobelpreis, als dass sie sich die Zeit nimmt, unsere Familiengeheimnisse auszugraben. Mach dir keine Sorgen, Schatz, bitte.«
Tom furchte die Stirn, und seine blauen Augen sprühten vor einer Mischung aus Angst und Zorn. »Machst du dir selbst eigentlich niemals Sorgen?«
Caroline betrachtete sein Gesicht, das das Abbild ihres eigenen war. In dieser Hinsicht war das Schicksal ihnen gnädig gewesen. Hätte Tom ausgesehen wie er, wäre es entschieden schwieriger gewesen, den Jungen zu verstecken. »Doch, ich mache mir Sorgen«, erwiderte sie aufrichtig. Sie hatten so vieles gemeinsam durchgestanden, dass er nichts als die reine Wahrheit verdiente. »Manchmal überstehe ich einen ganzen Tag ohne die Angst, dass er hinter irgendeinem Gebüsch hervorspringt und mich zurückschleppt, doch diese Tage sind selten. An manchen Tagen wünsche ich mir, wir könnten uns wieder im Hanover House verstecken, aber ich weiß, dass Dana uns in den Allerwertesten treten und auf die Straße setzen würde.« Sie sah das Aufblitzen eines Lächelns in seinen Augen und wusste, dass ihr Humor seiner Angst die Spitze genommen hatte, wie immer.
Dana drängte sich neben Tom und legte ihm den Arm um die Schultern. »Genau das würde ich tun. In der Beziehung bin ich eine böse Hexe.«
Tom brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Ja, ich erinnere mich. ›Iss deine Erbsen auf‹«, imitierte er Danas Stimme. »›Mach deine Hausaufgaben‹. ›Nach halb neun kein Gameboy-Spielen mehr.‹ Mann, war ich froh, als wir aus diesem Gefängnis ausziehen konnten.«
Das stimmte nicht. Caroline erinnerte sich noch sehr gut an den Tag, als sie den Schutz von Hanover House verlassen und in die große, böse Welt Chicagos hinaustreten mussten, mit nichts in der Hand außer einem Koffer voller Kleiderspenden von anderen, die das Schicksal weniger herausgefordert hatte. Sie erinnerte sich an seine stillen Tränen, den Ausdruck von höchster Not auf seinem kleinen Gesicht, die Art, wie sein Blick hektisch hin und her gehuscht war. Immer auf der Hut. Aber er hatte gehorcht. Hatte seine kleine Hand in ihre geschoben und war ohne einen einzigen Blick zurück auf die Straße hinausgetreten. In den sieben Jahren hatte er es weit gebracht. Sie beide hatten es weit gebracht.
»Tom, Schätzchen.« Caroline schüttelte den Kopf und suchte nach den richtigen Worten. »Ich habe noch Angst. Aber ich bin nicht mehr zu Tode verängstigt. Er könnte uns aufspüren, das ist schon richtig. Er könnte aus irgendeinem Gebüsch springen und uns zurück nach North Carolina zerren.« Von »zu Hause« redete sie längst nicht mehr; sie sagte auch nie »Vater« oder »mein Mann«. Niemals, wirklich niemals benutzten sie die Namen, die sie hinter sich gelassen hatten. In diesen kleinen Dingen waren sie noch genauso wachsam wie vor sieben Jahren. Ihre Beachtung hatte ihnen Sicherheit beschert.
Und es war entschieden besser, Vorsicht als Nachsicht walten zu lassen, denn alles andere hätte ihren Tod bedeutet.
Caroline richtete sich ein wenig auf. »Aber jetzt sind wir stärker, wir beide. Jetzt stehen uns Waffen zur Verfügung, die wir damals nicht hatten.«
Dana verstärkte ihren Griff um Toms Schultern. »Ja, ich zum Beispiel.«
Caroline lächelte. »Und sie ist wirklich Furcht erregend, vergiss das nicht. Aber wir haben noch mehr. Ich besitze jetzt eine Ausbildung. Ich kenne meine Rechte.« Sie zögerte. »Und ich weiß, wie man wegläuft.«
Tom biss die Zähne zusammen. »Ich will nicht wieder weglaufen.«
»Und wir werden es wahrscheinlich nie wieder tun. Aber falls er kommt …«
»Wenn er kommt, lass ich dich nicht im Stich.«
Caroline seufzte und zuckte mit den Schultern. »Schatz, darüber haben wir schon tausend Mal geredet.«
»Ich laufe nicht weg«, versicherte er. »Ich lass dich nicht allein.« Plötzlich wirkte er so viel älter als vierzehn. Caroline stellte fest, dass ihr Sohn im Begriff war, ein Mann zu werden. Und sie wusste, was sie sagen musste, selbst, als ihr die Worte fast im Halse stecken blieben.
»In Ordnung. Sollte dieser Tag jemals kommen, bleiben wir unzertrennlich zusammen.« Wieder hob sie die Hand, um sein Gesicht zu berühren. »Aber mach dir wenigstens heute keine Sorgen. Und das Gleiche gilt für morgen und übermorgen.«
»Denk nicht über den Tag hinaus«, flüsterte er wie zu sich selbst.
»Du hast ihm viel beigebracht, Caro.«
Carolines Blick glitt von ihrem Sohn zu ihrer besten Freundin. Sie hatten ihm in der Tat viel beigebracht. Sie beide zusammen, sie und Dana. Und ob sie zusammenblieben oder nicht, Tom hatte das Zeug zu überleben, ganz gleich, was geschah. Sie hatte ihm geholfen, Freunde zu finden, die sich sofort seiner annehmen würden, sollte ihr etwas zustoßen. Das war eine tröstliche Sicherheit.
»Zeit für die Schule. Hab einen schönen Tag, Schatz.«
»Ich will’s versuchen.« Er zögerte kurz, beugte sich dann herab und gab ihr ein Küsschen auf die Wange. »Tschüss.«
Beim Hinausgehen ließ er die Tür so stark hinter sich ins Schloss fallen, dass die Wände der kleinen Wohnung erzitterten. Einen Moment lang stand Caroline reglos da, dann zwang sie sich zurück in die Gegenwart. »Möchtest du Kaffee?«
»Nein. Ich habe schon welchen getrunken. Wie seid ihr ausgerechnet heute auf das Thema gekommen?«
»Ach, Tom hat Angst, dass Shaw sich an mir rächen will, weil ich zu dem Komitee gehörte, das Hunter als Elis Nachfolger empfohlen hat.«
»Sie wollte wohl selbst Fachbereichsleiterin werden, wie?«
»Von Anfang an. Ich glaube, sie hat die Tage bis zu Elis Pensionierung gezählt. Und als er dann den Herzinfarkt hatte …« Sie musste sich räuspern, damit ihre Stimme nicht brach, und unterdrückte mit Mühe das Zittern ihrer Hände, als sie sich eine Tasse Kaffee einschenkte. »Du hättest sie auf Elis Begräbnis sehen sollen.«
»Ich habe sie gesehen.« Dana holte einen Karton halbfette Milch aus dem Kühlschrank und goss ein wenig davon in Carolines Tasse. »Sie war wie die sprichwörtliche Katze, die den Sahnetopf ausgeschleckt hat.«
»Tja, ich bin heilfroh, dass ich nicht für sie arbeiten muss. Hunter müsste schon fast so schlimm sein wie Jack the Ripper, damit ich ihn so … ablehne, wie ich Monika Shaw … ablehne.«
»Ablehne?« Dana hörte auf, Cornflakes in ein Schälchen zu schütten, und blickte grinsend über die Schulter zurück. »Starke Worte benutzt die Dame heute Morgen.«
Caroline erwiderte ihr Grinsen. »Na gut, ich hasse sie. Sie ist ein gemeines Luder. Zufrieden?«
Danas heiseres Lachen erfüllte die Küche. »Ja. Die reine Wahrheit reicht mir.«
Caroline warf einen viel sagenden Blick auf Danas gefülltes Cornflakes-Schälchen. »Ich dachte, du willst kein Frühstück.«
»Ich habe nur gesagt, dass ich keinen Kaffee will. Ich komme um vor Hunger. Meine Schränke sind leer.«
»Da-na.« Caroline seufzte. Sie setzten sich an den Tisch.
»Was?«
»Du hast alles den Kindern gegeben, nicht wahr?« Im Grunde war das keine Frage, sondern eine Feststellung.
Dana hob kampflustig das Kinn. »Ja.« Dann ließ sie die Schultern sinken. »Wir haben gestern eine neue Familie reingekriegt. Aus Toledo. Sie waren halb verhungert, Caro, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Mutter war so zugerichtet, dass ihr Gesicht nicht mal mehr zu erahnen war. Ihr Rücken …« Sie schauderte. »Es geht mir immer noch an die Nieren, nach all den Jahren.«
»Weil du ein Mensch bist. Wäre es nicht so, könntest du in deinem Beruf nicht so großartig sein, wie du es bist.«
Und Danas Beruf, dachte Caroline, besteht darin, Leben zu retten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dana führte Hanover House, eine Zuflucht für misshandelte Frauen und ihre Kinder. Hanover House bot Sicherheit und medizinische Betreuung, falls nötig – und meistens war sie dringend notwendig. Doch das Beste war, dass Hanover House Hoffnung und die Aussicht auf einen Neubeginn bot. Caroline wusste nicht genau, woher Dana neue Versicherungskarten und Geburtsurkunden bekam, und sie hatte sie nie danach gefragt. Sie war so dankbar gewesen, als sie die Urkunde mit dem neuen Namen ihres Sohnes in den Händen hielt, dass sie hatte weinen müssen. An diesen Augenblick erinnerte sie sich, als wäre es gestern gewesen und nicht vor sieben Jahren. Tom Stewart. Geboren im Rush Memorial Krankenhaus in Chicago, Illinois. Vater unbekannt. Der Nachname entsprach dem auf der Geburtsurkunde, die sie für sich selbst … entliehen hatte. Caroline Stewart. Es gab sogar Tage, an denen sie eine oder zwei Stunden lang nicht daran dachte, wer sie in Wirklichkeit war. Woher sie wirklich kam. An denen Mary Grace Winters nichts weiter als ein Albtraum war. An denen Mary Grace Winters nicht mehr existierte.
Caroline Stewart war ihre Zukunft. Und Caroline hatte die feste Absicht, das Beste daraus zu machen.
»Caroline?« Dana klimperte mit ihrem Löffel an den Rand des Schälchens.
Caroline seufzte. »Ich dachte nur gerade an meine eigenen Erfahrungen in Hanover House.« Über den Tisch hinweg drückte sie Danas Hand, sah die dunklen Ringe unter den braunen Augen ihrer Freundin, die ihr vorher nicht aufgefallen waren. »Und an meine Erlebnisse mit dir. Aber was ist mit dir, Dana? Geht es dir gut? Du siehst so müde aus.«
»Wenn ich ein paar Stunden geschlafen habe, geht es mir wieder gut. Ich bin von Hanover House aus direkt zu dir gekommen. Eines der neuen Kinder aus Toledo hat Streptokokken, und …«
»Und du hast die ganze Nacht bei ihm gesessen.«
»Er ist erst drei Jahre alt und schrecklich verstört.« Danas braune Augen füllten sich mit Tränen, was bei ihr nicht oft zu beobachten war. »Scheiße, Caroline. Der Kleine hat Narben. Schlimmer noch als die Mutter. Ich hatte ihn im Arm, weil er nicht im Bett liegen mochte. Sein Rücken war ein einziger blau-schwarzer Bluterguss. Sobald ich ihn berührte, hat er geschrien. Sein Vater …« Jetzt liefen ihr Tränen über die Wangen. »Sein Vater hat ihn mit Zigaretten verbrannt. An den Füßen, verdammte Scheiße!« Sie erstickte ein Schluchzen und schob die halb leere Schüssel mit Cornflakes von sich.
Caroline drückte mit einer Hand Danas zusammengeballte Finger, die andere glitt seitlich an ihrem Hals hinauf und berührte ihre eigenen Narben. Make-up und Kragen verbargen sie vor den Augen anderer, doch für sie waren sie immer gegenwärtig. Vor ihrem inneren Auge sah sie sie wie damals, als sie noch frisch waren, und sie fühlte noch immer die lähmende Angst, roch noch immer den stechenden Geruch von verbranntem Fleisch.
»Die Narben an den Füßen werden heilen, Dana. Du musst dich darauf konzentrieren, die Verletzungen der Seele zu kurieren.«
Dana schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob ich das noch kann, Caroline. Ich bin so müde.«
Caroline wehrte sich gegen das unwillkürliche Stirnrunzeln, denn Dana war stets unermüdlich. Sie hatte noch nie zuvor von Aufgeben gesprochen, selbst wenn keinerlei Geldmittel mehr aufgetrieben werden konnten und sie sich selbst eine Nullrunde nach der anderen auferlegen musste, selbst wenn es in Hanover House mehr Frauen und Kinder als Betten gab. Sogar wenn die Frauen selbst aufgaben. Dana war immer stark. Aber heute nicht. Wahrscheinlich stößt jeder mal an seine Grenzen, dachte Caroline und verschob ihre aufmunternden Worte auf einen anderen Zeitpunkt.
»Dann geh doch zu Bett, meine Liebe. Wenn du ausgeschlafen hast, sieht alles nicht mehr so furchtbar aus. Du kannst mein Bett haben. Alles, was ich habe, steht dir zur Verfügung. Aber meine Vorratsschränke sind leider auch ziemlich leer.« Sie drückte Dana eine Papierserviette in die Hand. »Tom und seine Freunde sind gestern nach einem Basketball-Spiel wie die Heuschrecken hier eingefallen. Haben alles gegessen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ich schätze, mir fehlen sogar ein Messer und drei Gabeln. Hoffentlich lösen sie keinen Alarm aus, wenn sie den Metalldetektor am Eingang der Schule passieren.«
Dana schaffte ein kleines Lachen und wischte sich über die Augen. »Danke, aber ich kann nicht. Ich muss zurück und nach Cody sehen.«
»Nach dem kleinen Jungen? Ich kann das in der Mittagspause für dich übernehmen, Dana. Ich kann nach ihm sehen. Falls er einen Arzt braucht, hole ich Dr. Lee.« Dr. Lee war ein Kinderarzt im Ruhestand, der das Frauenhaus auf freiwilliger Basis betreute. Als Dana den Mund aufmachte, um zu widersprechen, hob Caroline warnend den Zeigefinger. »Komm gar nicht erst auf die Idee, nein zu sagen. Wenn du dich überforderst, fängst du dir Streptokokken ein, und dann steckt dir Dr. Lee seinen Spatel in den Rachen, und du musst aaaah sagen.«
Dana ließ müde die Schultern sinken. »Du hast ja Recht. Am besten bleibe ich ein paar Stunden hier. Siehst du Evie heute noch?«
»Wahrscheinlich. Sie arbeitet heute Nachmittag im Büro.« Evie war ihr neuester Fall, ein durchgebrannter Teenie, der inzwischen volljährig war. Evie wohnte bei Dana, solange sie am Carrington College studierte, wo sie als Carolines Assistentin im Büro der Historischen Abteilung arbeitete.
»Dann sag ihr, dass alles in Ordnung ist. Sie kriegt Angst, wenn ich nicht nach Hause komme.«
»Mach ich. Und jetzt muss ich zur Arbeit. Um nichts in der Welt möchte ich Dr. Maximillian Hunter an seinem allerersten Tag warten lassen.«
Asheville
Montag, 5. März, 8:00 Uhr
»Ist …«, Sue Ann räusperte sich. »Ist alles in Ordnung, Rob?«
Gott bewahre ihn vor dummen Weibern. Winters saß in Unterhosen, den Kopf in die Hände gestützt, auf der Bettkante, und Miss Oberschlau wollte wissen, ob alles in Ordnung war. »Sehe ich so aus, als wäre alles in Ordnung, Sue Ann?«
Sie zögerte kurz, bevor sie mit ihrer weinerlichen Flüsterstimme antwortete. »Nein, Rob. Soll ich dir irgendetwas holen? Ein Aspirin?«
Er dachte an die leere Flasche auf dem Nachttisch. Noch was zu trinken. Hinter den vorgehaltenen Händen kniff er die Augen noch fester zu. Mein Sohn. Ich will meinen Sohn. Aber sein Sohn würde nie wieder nach Hause kommen. Das wusste er jetzt. »Nein, du sollst mir nichts holen«, antwortete er bitter. »Hau einfach ab und lass mich in Ruhe.«
Eine Bodendiele knarrte, und er roch ihr billiges Parfüm, als sie näher kam. Der Duft war so aufdringlich, dass ihm davon übel wurde. Von ihr wurde ihm übel. »Rob, ich weiß, du fühlst dich nicht gut, aber …«
Auf ihren Schmerzensschrei folgte eine lange Zeit der Stille.
»Ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Muss ich dir erst erklären, was das heißt?«, knurrte er, ballte die Hand zur Faust und öffnete sie wieder.
Langsam rappelte Sue Ann sich hoch und betastete behutsam ihren Wangenknochen. »Möchtest du frühstücken?«
Allein bei der Erwähnung von Essen drehte sich Winters der Magen um. Er fuhr herum, holte gleichzeitig weit aus, und seine Faust verfehlte nur knapp ihr Ziel, als Sue Ann zurückwich. »Ich will nur, dass du deine verdammte Fresse hältst. Ich will weiter nichts, als dass mein Sohn hier ist und nicht auf dem Grund vom Lake Douglas. Ich will nur, dass jeder, der ihm auch nur ein Haar gekrümmt hat, tot ist.« Er blickte auf seine Hände, die sich zu Fäusten ballten und wieder öffneten. Was er wollte, war, denjenigen, der ihm seinen Sohn genommen hatte, aufspüren und den Schweinehund mit seinen eigenen Händen umbringen.
»Du weißt doch gar nicht mit Sicherheit, ob er tot ist, Rob. Sie haben keine …« Sie räusperte sich erneut und schob mit einer Hand eine Haarsträhne, die sich gelöst hatte, zurück in ihren schlaffen Knoten. »Vielleicht könntest du noch einen Sohn haben. Unseren Sohn.«
Ein roter Schleier senkte sich vor seine Augen, und er stand langsam auf. »Du glaubst, dein Wurf könnte ihn ersetzen?« Ein warmes Gefühl der Befriedigung überkam ihn, als er ihren Wangenknochen unter seinem Handrücken spürte, das dumpfe Geräusch hörte, als ihr Körper gegen die Wand prallte, und ihr ersticktes Schluchzen, das sie zu unterdrücken versuchte, als sie in eine Zimmerecke kroch. Blöde Kuh. »Hau endlich ab.«
»Aber es wäre doch dein Baby, Rob«, flüsterte Sue Ann aus der Ecke. »Dein Sohn.«
»Verdammt noch mal, widersprich mir nicht.« Er verzog das Gesicht, als sein Zeh gegen ihr Schienbein stieß. »Wag es nie wieder, mir zu widersprechen.« Dann richtete er sich auf, ging zum Bett hinüber und streckte sich darauf aus. »Lass mich in Ruhe.«
Er hörte das Rascheln ihres Kleids, als sie sich mühsam aufrichtete. Früher war sie einmal ganz akzeptabel gewesen. Sogar hübsch, wenn man nicht so genau hinsah. Aber die Jahre hatten Sue Ann nicht eben freundlich behandelt. Klar, kochen und sauber machen, das konnte sie immer noch. Aber die Vorstellung, sie zu heiraten, reichte, um seine Übelkeit noch zu verstärken. Und das würde er tun müssen. Sie heiraten. Wenn er noch einen Sohn haben wollte, musste er mit der Frau, die ihn gebar, verheiratet sein. Kein Mensch durfte behaupten, dass Rob Winters seinen Sohn nicht rechtmäßig behandelte. Kein Mensch. Er wandte den Kopf ein wenig und sah, wie Sue Ann auf die Tür zuging.
»Sue Ann?«
»Ja, Rob.«
»Ruf Ross an und sag ihr, ich hätte die Grippe. Ich gehe heute nicht zur Arbeit.
Er fing ihren Blick auf, der die leere Flasche betrachtete, und sah sie aus zusammengekniffenen Augen an, zufrieden, dass ihr Mondgesicht noch blasser wurde.
»Ja, Rob.« Die Tür knarrte, als sie sie öffnete.
»Draußen auf der hinteren Veranda stehen meine Stiefel. Die müssen geputzt werden.«
»Ja, Rob.«
Er wartete, bis die Tür sich geschlossen hatte. Langsam wälzte er sich auf den Bauch und griff nach dem gerahmten Foto, das auf seinem Nachttisch stand. Mit ernsten blauen Augen blickte der kleine strohblonde Junge zu ihm auf. Rob Winters schloss die Augen und stellte sich wieder einmal vor, wie er den Mann, der ihm den Sohn gestohlen hatte, bestrafen würde. Aber heute … Heute war es anders. Heute würde diese Bestrafung unendlich viel härter ausfallen. Denn bevor Hutchins den Wagen aus dem See gezogen hatte, war ihm ein winziger Hoffnungsschimmer geblieben, dass Robbie nach Hause kommen könnte. Jetzt aber wusste Winters, dass er nie mehr zurückkommen würde.
3
Carrington College, Chicago
Montag, 5. März, 10:15 Uhr
Jeder sagt, dass Montage die Hölle sind, doch für Caroline brachten sie ein willkommenes Gefühl der Routine mit sich, denn in ihrem Leben hatte es bisher wenig Konstantes gegeben. Irgendwie schienen die Budgetfragen, das Archivieren, die unablässigen Fragen ratloser Studenten sie eher aufzubauen als zu langweilen. Das hier war ihre eigene kleine Welt, die andere vielleicht als unbedeutend bezeichnen würden, doch hier blühte sie auf.
Ein trauriges Lächeln umspielte ihren Mund, als ihr Blick zufällig auf das gerahmte Foto von Eli auf ihrem Schreibtisch fiel. Er war ihr erster Professor in Carrington gewesen. Ihr erster und ihr bester. Er verfügte über die seltene Begabung, Geschichte in dreidimensionalen Bildern auferstehen zu lassen, sodass sie lebte und atmete, was Caroline von Anfang an in seinen Bann gezogen hatte. Sie hatte lange überlegt, welches Hauptfach sie vor dem Jurastudium belegen sollte. Ein Seminar bei Eli Bradford hatte ihr die Entscheidung kinderleicht gemacht.
Sie dachte an ihre erste Woche in der Abendschule. An das ungewohnte Gefühl, nach so vielen Jahren wieder in einem Klassenzimmer zu sitzen. Sie war eine junge Mutter mit einem siebenjährigen Sohn, einem Vollzeit-Knochenjob und herzlich wenig Zeit, den einzigen Kurs, den sie sich in diesem Vierteljahr leisten konnte, zu genießen. Sie war Eli aufgefallen, und er hatte sie am dritten Abend gebeten, nach dem Ende des Seminars noch zu bleiben.
Als er bemerkt hatte, dass sie auf die Vorstellung, mit ihm allein zu sein, wie ein verängstigtes Kaninchen reagierte, war Mitgefühl in seine freundlichen alten Augen getreten. »Sie sind geradezu gierig nach Wissen, Miss Stewart«, hatte er gesagt. »Das gefällt mir.« Dann hatte er ihr eine Stelle als seine Sekretärin angeboten, einschließlich aller Vorteile, die das Carrington College seinen Beschäftigten zu bieten hatte. Er erwies sich als flexibel, ließ zu, dass sie ihre Arbeitszeit nach ihrem Stundenplan einrichtete und dass sie Tom in den Schulferien und an den Wochenenden, wenn sie arbeitete, ins Büro mitbrachte. Eli und Dana hatte sie es zu verdanken, dass sie nie einen Babysitter benötigt hatte, nicht ein einziges Mal in den sieben Jahren, seit sie mit kaum mehr als den Kleidern, die sie am Leibe trug, nach Chicago gekommen war.
Und jetzt war er tot. Eli war tot. Die Trauer durchbohrte sie wie ein Dolchstoß. Er würde es nicht erleben, dass sie ihren Abschluss machte, und sie stand schon so kurz davor. Nur noch ein Vierteljahr, dann hatte sie ihr Diplom in der Tasche. Es war noch immer kaum zu glauben. Sie, die die Highschool abgebrochen hatte, bekam ein College-Diplom. Sie war Dana, die sie so gedrängt hatte, ihren Highschool-Abschluss nachzuholen, zutiefst dankbar, und ebenso Eli, dass er ihr die Chance gegeben hatte, so viel mehr zu erreichen, als sie in ihren kühnsten Träumen für möglich gehalten hatte.
Ihr Seufzer ließ die Papiere auf dem Schreibtisch rascheln. Und jetzt war Eli tot.
Caroline warf einen Blick auf die Uhr, entschlossen, sich nicht den ganzen Tag lang ihrem Kummer hinzugeben. Ihr blieb nur noch eine Stunde bis zu Dr. Hunters Eintreffen, gerade noch Zeit genug, die Gehaltsabrechnungen fertig zu stellen.
Ein schlurfendes Geräusch riss sie aus ihrer Konzentration. Dieses Geräusch hatte sie schon einmal gehört, vor sehr langer Zeit. Es war ein Geräusch, wie es in Krankenhäusern vorkam, von Patienten, die, gestützt auf Stöcken oder Gehwagen, über Fliesenböden schlurften und vor der schmerzlichen Aufgabe standen, wieder laufen lernen zu müssen. Ein Geräusch, das sie immer noch erschauern ließ. Aber sie unterdrückte diesen Impuls. Es war ein ungeschriebenes Gesetz in der Reha gewesen, dass man niemals Mitleid oder Ekel vor verletzten und genesenden Menschen in seiner Umgebung zeigte. Caroline hob den Blick von ihren Papieren, als das Schlurfen aussetzte, und lächelte. Sie sah eine glatte, weiße Hand mit langen Fingern, die das gebogene Ende eines Gehstocks umklammerten. Als sie an der Gestalt hinaufsah, bemerkte sie eine schlanke Taille und einen sehr kräftigen Oberkörper in einem Doppelreiher. Sie schluckte und ließ den Blick weiter hinaufwandern, bis er das Gesicht eines Mannes erreichte, der vor ihrem Schreibtisch stand. Er war groß, größer als Tom. Ein dunkler Typ, aber eindeutig nicht bedrohlich, sein Kinn war kantig und stark ausgeprägt, seine dunklen Brauen waren leicht zusammengezogen, das Haar dicht und schwarz, im Nacken kurz geschnitten. Eine Locke fiel ihm in die Stirn, was ihm etwas Jungenhaftes verlieh. Sein marineblauer Anzug war maßgeschneidert und saß gut an den breiten Schultern. Der Mann trug eine Krawatte mit Paisleymuster, die seine kräftigen Halsmuskeln betonte. Rauchgraue Augen erwiderten ihren Blick, sein ernster Mund zeigte nicht den Hauch eines Lächelns. Abrupt hakte er den Stock hinter seinem Rücken in den Gürtel ein, sodass sein Jackett ihn verbarg.
Aus unerfindlichen Gründen klopfte Carolines Herz ein wenig schneller. Das war ein Mann, der diese Bezeichnung verdiente, wie Dana sagen würde. Jetzt begriff Caroline, was »Sexappeal« bedeutete. Er entströmte nahezu jeder seiner perfekten Poren.
Erbarmen.
Caroline räusperte sich. »Kann …« Sie verschluckte sich fast an dem Wort und spürte, wie ihr vor Verlegenheit die Glut ins Gesicht stieg. Aber ein Mann wie er ließ sicher täglich schmachtende, stotternde Frauen in seinem Gefolge zurück. Sie räusperte sich noch einmal. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Das hoffe ich. Ich suche Caroline Stewart.«
Die Augen der Frau weiteten sich, und Max hatte plötzlich das Gefühl, dass der Raum um ihn herum enger wurde. Ihr Lächeln war echt gewesen und hatte beinahe ausgereicht, um ihn die strenge Miene vergessen zu lassen, die er an seinem ersten Tag aufsetzen wollte. Ihr dunkelbraunes Haar war zu einem lockeren Zopf geflochten, der ihr bis zur Hälfte des Rückens ging, ein paar Löckchen, die sich daraus gelöst hatten, umrahmten ihr Gesicht. Es war ein hübsches Gesicht mit regelmäßigen Zügen, einer schönen, mittelgroßen Nase, vollen Lippen und zarten, fragend hochgezogenen Brauen. Doch es waren vor allem ihre Augen, die ihn anzogen. Blau wie die karibische See mit einem offenen Blick, sodass er in ihnen lesen konnte wie in einem Buch. Sein Gesicht hatte großen Eindruck auf sie gemacht. Das passierte ihm häufig. Sein Stock überraschte sie, schreckte sie jedoch nicht ab. Diese Reaktion war eher ungewöhnlich und hatte entschieden mehr zu bedeuten.
Dann erhob sie sich und streckte ihm ruhig die Hand entgegen. Sie hatte hübsche, saubere, unlackierte Nägel, die zu dem schlichten Make-up passten, das ihre Gesichtszüge dezent unterstrich. Sie reichte ihm nicht einmal bis zur Schulter. Wie er sie so ansah, kam er sich größer und stärker vor. Wieder sprach sie, und ihre Stimme mit der gedehnten Sprachweise war wie geschmeidiger Honig, sie klang tief und erotisch.
»Ich bin Caroline Stewart.«
Ihr Lächeln war eine Spur strahlender geworden, was seine Lippen ebenfalls leise zucken ließ. Seine Sekretärin. Schön, schön. Endlich hellt sich das Leben ein bisschen auf, dachte er, als er die ihm dargebotene Hand schüttelte. »Ich bin Dr. Hunter.« Sie blinzelte, und ihr Mund blieb überrascht offen stehen. Ihre kleine Hand erschlaffte in seiner. »Sie haben mich doch erwartet, oder?«
»Ich – hm.« Sie schluckte heftig und gewann ihre Fassung zurück. »Ja, ich habe Sie erwartet.« Ihre Mundwinkel kräuselten sich zu einem Lächeln, was ein Grübchen auf ihre Wangen zauberte. »Aber Sie habe ich nicht erwartet. Nicht wirklich.« Sie schüttelte ihm herzlich die Hand.
»Und wen haben Sie erwartet? Wirklich erwartet?«
»Einen fünfundsechzigjährigen Mann.« Sie neigte den Kopf zur Seite und kniff ihre unglaublichen Augen leicht zusammen. »Dieser alte Heimlichtuer. Sie haben Wade Grayson sicher schon kennen gelernt, nicht wahr? Einen der Professoren?«
Er nickte verhalten. »Ja, ich bin ihm einmal begegnet. Während meines Vorstellungsgesprächs beim Dekan.«
Seine Sekretärin lachte leise, ein volltönendes, belustigtes Lachen. »Seit der Dekan Ihre Einstellung angekündigt hat, hat er mich in dem Irrglauben gelassen, dass Sie ein allein stehender, älterer Herr wären.« Sie hob den Blick, und ihr Grübchen vertiefte sich. »Keine Sorge. Früher oder später werde ich es ihm heimzahlen. Sie sind also mein neuer junger Chef. Willkommen, Dr. Hunter.«
Hübsch und entzückend. Das wird ja von Sekunde zu Sekunde besser, dachte er. »Danke. Freut mich, Sie kennen zu lernen, Ms Stewart.«
»Hier nennen mich alle Caroline. Wie möchten Sie am liebsten angeredet werden?« Ihre tiefblauen Augen blitzten ihn an. »Ich hoffe, Sie verlangen nicht, mit Ihrem vollständigen Namen angesprochen zu werden.«
Er konnte ein Lächeln nicht mehr länger unterdrücken. »Es würde Ihnen recht geschehen, wenn ich darauf bestünde.« Er zögerte, fasste dann einen Entschluss. Diese Phase seines Lebens wollte er ohne die alten Barrieren beginnen. Schluss mit »Dr. Hunter«. »Nennen Sie mich Max.«
»Das klingt entschieden besser als Maximillian Alexander.« Sie schüttelte den Kopf, und ihr Blick drückte immer noch Belustigung aus. »Ihre Eltern haben wohl große Hoffnungen in Sie gesetzt.«
Ihr Sinn für Humor gefiel ihm. »Ist das nicht der Hauptgrund, weshalb man Kinder hat?«
Caroline dachte an Tom und alles, was sie für ihn geopfert hatte und weiterhin bereitwillig opfern würde. »Ja, da haben Sie vollkommen Recht.« Sie trat hinter dem Schreibtisch hervor und blieb vor ihm stehen, den Kopf in den Nacken gelegt. »Ich zeige Ihnen Ihr Büro, und dann müssen Sie mir sagen, wie Sie vorzugehen gedenken.«
Sie ging zu einer geschlossenen Tür, und fünf Herzschläge lang rührte sich Max nicht vom Fleck, sondern heftete den Blick auf ihre runden, anmutig schwingenden Hüften. Die Heftigkeit seiner körperlichen Reaktion überrumpelte ihn. Verliere jetzt nicht den Verstand, ermahnte er sich selbst. Suche keine Entschädigung für Elise, indem du dich in das erste weibliche Wesen verknallst, das dir über den Weg läuft. Er hörte jedoch nicht auf die Stimme der Vernunft, das wusste er selbst, sondern betrachtete immer noch ihr rundes Hinterteil in dem schlichten schwarzen Rock. Er schluckte und war kaum in der Lage, den Blick zu heben, als sie, die Hand auf dem Türgriff, innehielt. Sie blickte über die Schulter zurück und sah ihn immer noch reglos auf der Stelle stehen.
»Das hier ist Ihr Büro«, sagte sie, und ihre Augen blickten wieder nüchtern. Die Veränderung kam so abrupt und unvermittelt wie der traurige Stich in seinem Herzen. Ihre Stimme sagte: »Ihr Büro.« Ihre Augen sagten, dass der Raum auf ewig Eli Bradford gehöre. Sie hatte den alten Professor geliebt, so viel stand fest.
Max griff nach seinem Stock und folgte ihr in das holzgetäfelte Büro mit den Unmengen von Bücherregalen. Ein weinroter Plüschteppich bedeckte den Boden und bildete einen schönen Kontrast zu dem Holz. Mit dem Hauch von Zitronenduft der Möbelpolitur mischte sich der angenehme Geruch alter Bücher und des Leders eines langen, abgenutzten Sofas, das zu einem gelegentlichen Nickerchen einlud. An den Wänden hingen gerahmte Drucke, eine Auswahl von Monet, Warhol und O’Keefe. In einer Zimmerecke fand ein imaginärer Luftkampf zwischen zwei Modellflugzeugen statt, einer britischen Spitfire und einer deutschen ME-109, die an dünnen Drähten hingen. Max bemerkte mit einem Lächeln, dass die ME-109 in Flammen aufging. In Dr. Bradfords Welt trugen offenbar noch die Guten den Sieg davon.
Ein großer Mahagonischreibtisch beherrschte den Raum, dazu gab es einen passenden Sessel, der von hinten durch ein großes Panoramafenster erhellt wurde. Der Blick führte auf den verschneiten Hof, wo gelegentlich ein Student der Kälte trotzte, die den Vorfrühling beherrschte. Ein schönes Büro, dachte er erfreut. Doch beim Anblick des Schreibtischs, der abgenutzt, zerkratzt und völlig leer geräumt war, zog er eine Augenbraue hoch. Das restliche Zimmer war angefüllt mit Büchern, was den leeren Schreibtisch noch stärker in den Mittelpunkt rückte.
Caroline durchquerte das Zimmer und justierte die Jalousien, um die grelle Morgensonne auszublenden. »Von hier aus hat man so ziemlich den schönsten Ausblick auf den Campus. In einem Monat können Sie die Blumengärten der Landwirtschaftsschule sehen.« Sie wandte sich um und bemerkte seinen viel sagenden Blick auf den leeren Schreibtisch. »Er hat … Dr. Bradford gehört. Ich wusste nicht, ob Sie Ihren eigenen Schreibtisch haben oder lieber diesen benutzen wollen.« Mit einer unbewusst zärtlichen Geste strich ihre Hand über die zerkratzte Platte. »Falls Sie ihn behalten möchten, werde ich Ihnen einen Katalog geben, aus dem Sie alles an Büromaterial, was Sie benötigen, bestellen können.«
Sie hob den Blick und sah ihn an, und er war nicht sicher, ob sie sich des Flehens in den blauen Tiefen ihrer Augen überhaupt bewusst war. Es war noch deutlicher als das Lächeln wenige Minuten zuvor. Dekan Whitfield hatte ihm gesagt, wie beliebt Bradford gewesen war. Offenbar übertraf die Zuneigung seiner Sekretärin noch die aller anderen.
Sie schluckte und wandte sich ab, doch er hatte das kummervolle Schimmern in ihren Augen trotzdem bemerkt. »Falls Sie … seine Sachen lieber nicht übernehmen wollen, lassen Sie es mich bitte wissen. Viele von uns sind nur zu gern bereit, sie an Ihrer Stelle zu behalten.«