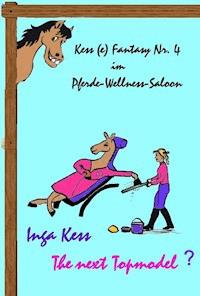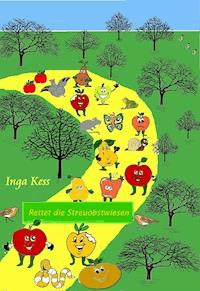Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich einmal kurze Geschichten ist eine in ihrer Vielfalt interessante Sammlung von Beiträgen, die in Anthologien veröffentlicht wurden. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit, entspannen Sie sich und lassen sich unterhalten und auch berühren. "Das braune Einhorn" erzählt von einem Einhornfohlen, das zum Entsetzen seiner Mutter anders ist als alle Einhornfohlen. Es ist braun. Ihm fehlt sogar das Horn. "Tödlicher Irrtum" erzählt von der Bildhauerin Nelli, die ihrem Mann eine Affäre unterstellt, nur weil er in der letzten Zeit den Duft von Gucci Flora mit nach Hause bringt. "Er - meine große Liebe? Das muss sich eine junge Frau fragen, als sich ihre große Liebe als Illusion, als ein Machwerk der Stasi, entpuppt. "Leise erklingt eine Zigeunerweise" - Wollen Sie wissen, wer dort draußen in der Nähe der Wagenburg so herzzerreißend Geige spielt? Es ist ein schwarzgelockter Zigeunerjunge, der eine Melodie voller Sehnsucht, Wehmut und Leidenschaft spielt. Warum spricht er nicht? Ja, früher, das waren noch Zeiten. Da gab es "Das Wintertaxi". Wer wissen will, was das war, der muss sich in die kalten Zeiten nach dem Krieg zurückversetzen lassen. Dort wird er auch wie "Alle Jahre wieder (dem) der Weihnachtshase(n) begegnen und erfährt, ob es "Arme oder warme Ritter?" heißen muss. "Die Zuflucht" versetzt uns in das Jahr 1349, als der Schwarze Tod, die Pest, umgeht. Geißler wollen die Kirchenburg in Merklingen stürmen, dennoch rettet der Schultheiß Wunibald Weise auf abenteuerliche Weise einen jüdischen Arzt und seine Familie. "Drakon & Co.": Ein Ungeheuer auf violettem Hintergrund schmückt den Eingang einer Buchhandlung. Zwinkert er etwa mit seinem linken Auge einer Besucherin zu? Was machen all diese Drachen in der Buchhandlung? Und zum Schluss erfahren Sie, dass "Alles Glück der Erde" auf dem Rücken der Pferde sitzt, besonders dann, wenn man zwei Zauberstäbe besitzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inga Kess
Endlich einmal kurze Geschichten
- für jeden etwas
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Wie alles begann
"Kann ich hier reiten lernen?"
Tür frei bitte zum Nikolausreiten!
Die letzte Reitstunde im Nobelstall
Wo fängt Armut an
Das braune Einhorn
Najade auf dem Meeresgrund
Die Eisprinzessin
Die Freiheit und die Hoffnung sind blau
Ganz leise erklingt eine Zigeunerweise
Arme oder Warme Ritter
Fernsehen bei Radio Moseler
Eine Tarnkappe, gibt's die?
Henriculus Agrippinus - das letzte Heinzelmännchen von Köln
Der Opa und sein Enkel
Tödlicher Irrtum
Mr. Pritchard's Geschäfte
Mörderische Sahara
Morde für „La Tulipe noire"
Der Fensterbohrer ist unterwegs
Datt is ja wie in Babel
Gute Nacht - schlaf schön ...
Das Wintertaxi
Alle Jahre wieder: Der Weihnachtshase
Mai-Ling kann nicht sprechen
Das Buchstabenspiel
Exotische Haustiere
Schnuffi mag kein Gucci-Flora
Der weiße Indianerbüffel
Das gestohlene Zauberbuch
Rettet die Streuobstwiesen!
Henriette
Nie mehr umziehen
Die Zuflucht
Er – meine große Liebe?
Adel verpflichtet
Schau mir in die Augen Kleines
Nicht berechenbar
Drakon & Co.
Alles Glück der Erde…
Impressum neobooks
Vorwort
Irgendwann im Jahre 2010 entdeckte ich meine Vorliebe für Schreibwettbewerbe. Seitdem wurden zahlreiche Kurzgeschichten und Gedichte von mir in über fünfzig Anthologien veröffentlicht. Darüber hinaus schrieb ich das Buch "Erzähl mir nichts vom Pferd - Geschichten einer Pferdenärrin".
Immer wieder werde ich gefragt, wo man meine Geschichten lesen kann. Sollen meine Leserinnen und Leser fünfzig Anthologien kaufen? Wohl kaum, deshalb dieser Sammelband, der meine bereits veröffentlichten Werke der Jahre 2010 bis 2014 umfasst.
Neuhausen, Juni 2017
Inga Kess
Wie alles begann
Heute - mit über siebzig Jahren - werde ich immer noch gefragt: „Reiten Sie schon lange?“ Was soll ich darauf antworten? Wie kam ich eigentlich zur Reiterei? Vage Erinnerungen an Kindheitserlebnisse tauchen dann vor meinem inneren Auge auf.
Reitschulen oder Reitunterricht gab es kurz nach dem Kriege bei uns auf dem Land nicht. Als Leseratte kannte ich natürlich Pferde, wie z.B. Iltschi, das Pferd Winnetous, Rih, den Rappen von Kara Ben Nemsi oder Hatatitla Old Shatterhands Pferd. Bei uns am Niederrhein gab es nur Brabanter, auch Belgier genannt, schwere Kaltblüter, die als Arbeitspferde gebraucht wurden. Mein Traum Pferde wie Iltschi, Rih oder Hatatitla zu reiten, würde sich wohl nie erfüllen.
Als Kind schlich ich mich heimlich auf die großen Wiesen am Niederrhein. Dort verbrachten die schweren Kaltblüter manchmal einen Ruhetag. Noch heute sehe ich die mächtigen Arbeitspferde mit ihrem seltsam verschimmelten Fell vor mir. Immer noch höre ich die Warnungen der Erwachsenen: „Pferde beißen vorne, treten hinten und trachten dem Menschen nach dem Leben.“ Ich habe diese Riesen als gutmütig kennen gelernt, kletterten wir doch auf Pferde, auf denen noch nie ein Reiter gesessen hatte, ritten sie ohne Sattel, ohne Trense, ohne Halfter. Weg konnten die Dicken nicht. Die Weide war, wie damals üblich, mit Stacheldraht eingezäunt. Einige Grasflächen lagen unter dem Meeresspiegel. Es gab viele für das Auge kaum erkennbare Sumpfstellen. Natürlich war es streng verboten, zu den Pferden zu gehen, geschweige denn sie zu reiten. Wir Kinder versuchten es immer wieder – natürlich heimlich.
Wieder einmal saßen meine Freundin und ich verbotenerweise auf den schweren Arbeitspferden und versuchten, sie in Gang zu bringen. Als der Bauer kam, sprangen wir ab und flüchteten. Zu jener Zeit war man mit Prügel nicht zimperlich. Gott sei Dank rannten wir schneller als der Bauer. Doch, oh Schreck, kaum in Sicherheit, bemerkte ich, dass mir ein Schuh fehlte, und zwar eine Lackleder-Sandalette meiner Mutter.
Kurz nach dem Krieg besaß ich keine eigenen Schuhe. Meine Füße waren sehr schnell gewachsen. Obwohl es bereits Spätherbst war, trug ich noch die Sandalen mit langen Strümpfen und dicken Socken. Jetzt war ein Schuh weg. Was war zu tun? Endlich gab der Bauer die Suche nach uns auf. Von irgendwo her besorgte ich einen riesigen Ast oder ein Brett – so genau weiß ich das nicht mehr – robbte auf dem Bauch zu der Sumpfstelle und angelte tatsächlich den Schuh aus dem Sumpf.
Indessen hatten sich die geflochtenen Riemchen, deren Ränder nur geklebt waren, aufgelöst. Vom Sumpf aufgequollen sahen sie schrecklich aus. Mir blieb mir nichts anderes übrig, ich musste die Schuhe weiter tragen. Außerdem verhängte meine Mutter als Strafe Stubenarrest. Nun traute ich mich nicht mehr zu den Pferden, träumte aber jede Nacht von tollen Ritten und feurigen Rossen.
Mit zunehmendem Alter verblasste die Erinnerung an die Pferde. Man sah sie nur noch selten. Der Traktor hatte die Pferde ersetzt.
"Kann ich hier reiten lernen?"
Nach langen Jahren flammte mein Interesse für Pferde und Reiten wieder auf. Mittlerweile achtundzwanzig oder neunundzwanzig Jahre alt, arbeitete ich als Lehrerin in der Nähe einer rheinischen Großstadt. Eine Kollegin bat mich, sie zum Reiten aufs Land zu fahren, weil ihr Auto in der Werkstatt war.
In der Reitanlage angekommen, schlenderten wir zum Pferdestall. Einige Pferde standen in Boxen, andere in Ständern, was heute aus Tierschutzgründen verboten ist. Ständer waren kleine, durch Wände abgetrennte Bereiche, in denen sich die Pferde nur mit Mühe hinlegen konnten. An der Frontseite befand sich die Futterkrippe, darunter war meist ein eiserner Ring angebracht, an dem die Pferde mit einem Strick angebunden wurden.
Energisch ging meine Kollegin zu einem Pferd in einem Ständer, sprach es von hinten an, klopfte ihm das Hinterteil, drückte sich an ihm vorbei und fütterte es mit Leckerbissen. Wie ich auf der Stalltafel lesen konnte, hieß die riesige Fuchsstute Freya. Mit ihr sollte ich später noch Bekanntschaft machen.
Die Mahnungen meiner Kindertage vergessend, sprach ich Freya, ebenfalls von hinten, mutig an. Dann klopfte ihr das Hinterteil, drückte mich an ihr vorbei bis an den Trog und gab ihr ein Stück Brot. Manierlich mit ganz weichen Lippen fraß sie vorsichtig das Stück Brot aus meiner Hand. Ein völlig neues Gefühl beschlich mich. Ich, die vor Hunden Angst hatte, der Katzen unheimlich waren, die mit Vögeln nichts anfangen konnte, empfand wie in meinen Kindertagen eine spontane Zuneigung zum Pferd.
In der Zwischenzeit wurden Sättel gebracht. In dieser Reitschule durften die Reitschüler nicht selbst satteln. Das war Aufgabe der Lehrlinge des Reitlehrers. Ihre Pflicht war es auch, die Pferde in die Reithalle zu führen. In der Reithalle stand bereits der Chef. Er teilte meiner Kollegin einen dicken gemütlich aussehenden Schwarzbraunen mit dem Namen Angriff zu. Interessiert schaute ich der Reitstunde zu.
Der Reitlehrer gab in strengem Ton Kommandos wie: „Geben Sie mal eine Parade, warum lassen Sie das Pferd so auf der Vorhand latschen? Jetzt setzen Sie sich doch mal auf ihren ... Nun packen Sie doch mal zu“, und so weiter. Viel anfangen konnte ich mit diesen Befehlen nicht. Ob die Reiter nun die Kommandos befolgten oder nicht, konnte ich nicht erkennen. Ich wusste ja nicht einmal, was sie bedeuteten.
Meine Kollegin, die ich nicht für ausgesprochen sportlich hielt, ritt eifrig mit, blieb auf dem Pferd sitzen, ohne runterzufallen – die anderen Reiter ebenfalls. Das Zuschauen machte mir Spaß, Angst vor Pferden hatte ich ja nicht, wie meine heutige Erfahrung zeigte. Warum sollte ich nicht auch reiten? Alles Glück dieser Erde liegt - wie jeder weiß - auf dem Rücken der Pferde!
Zunächst erkundigte ich mich nach dem Preis der Reitstunden. Reitstunden waren damals wahnsinnig teuer – zehn Stunden auf der Zehnerkarte kosteten 200 DM. Ein Pferd im Reitstall unterzustellen über 500 DM.
Augenscheinlich war ich in einem Nobel-Reitstall gelandet. Dort wurden die Pferde vom „Personal“ geputzt, gesattelt und in die Halle geführt. Ich war plötzlich die „gnädige Frau“, eigentlich nicht so mein Ding. Vom Wunsch beseelt, reiten zu lernen, fragte ich kurz entschlossen den Reitlehrer, ob ich bei ihm reiten lernen könne. Er schaute mich skeptisch an, machte irgendeine dumme Bemerkung, dass man mit dem Reiten im jugendlichen Alter beginnen solle. Für den Turniersport sei es allerdings zu spät. Jedoch ließ er sich herab, mir zu sagen, dass ich mit Longenstunden beginnen könne.
Wenn ich vor dem Gespräch mit dem Reitlehrer noch nicht fest davon überzeugt war, dass ich auch wirklich reiten lernen wollte, so weckte sein Verhalten meinen Widerspruchsgeist. Jetzt erst recht. Ich kaufte eine Zehnerkarte.
Eine junge Praktikantin empfahl mir, zur Longenstunde in einer Skihose und Stiefeln zu erscheinen. Beides besaß ich nicht. Was tun? Kurz entschlossen überprüfte ich meine Finanzen, denn üppig war mein Lehrergehalt damals nicht. Die Reitstunden allein waren sehr teuer. Trotzdem kaufte ich Gummistiefel und eine gebrauchte Reithose im Sonderangebot.
Passend angezogen, erschien ich zur ersten Reitstunde. Als ein Pferd zu mir in die Bahn geführt wurde, kam es mir vor, als würde ich mitleidig belächelt. Fachmännisch erklärte meine Kollegin: „Die Fabiola hat aber mächtig Wurf, die kann keiner aussitzen, ist aber butterweich.“ „Was bedeutet das schon wieder?“ fuhr mir durch den Kopf.
Das Reiten lernt man in der Regel an der Longe. Das ist eine lange Leine, an der das Pferd vom Longenführer im Kreis bewegt wird. Die Stute Fabiola war wohl wie die anderen Pferde dieser Reitschule ein ausgedientes Turnierpferd. Ein Lehrling erklärte mir, wie ich aufzusteigen hätte. Verständnisvoll nickte ich. Ganz nach Vorschrift stieg ich auf – vielmehr wollte ich aufsteigen. Bevor ich oben war, setzte sich das Pferd bereits in Bewegung. Irgendjemand eilte zur Hilfe und hielt das Pferd fest, kritisierte mich aber nicht gerade freundlich „Wenn Sie das Pferd in den Bauch treten, muss es ja vorwärts gehen.“ „Habe ich doch nicht!!!“ Oder hatte ich doch?
Endlich saß ich im Sattel, und gleich ging es munter los. Vermutlich hoppelte ich ziemlich auf dem Pferd herum, dennoch hatte ich das Gefühl, weich in den Rhythmus der Bewegung gezogen zu werden. Was der Reitlehrer da alles erzählte: „Absätze tief, Kopf hoch, Brust raus, mehr in die Bewegung eingehen“, plätscherte an meinen Ohren vorbei, ich hörte es, aber erfasste kaum, was er sagte.
Am Ende der Longenstunde, besser gesagt am Ende einer guten Longenviertelstunde, fragte mich der Reitlehrer: „Gnädige Frau, wo sind Sie bisher geritten?“ Wahrheitsgemäß antwortete ich, dass dies meine erste Reitstunde sei. Woraufhin er mich nur groß ansah, etwas von Tiefstapler murmelte und mich für die nächste Stundezum Abteilungsreiten einteilte.
Abteilung kannte ich schon. Schließlich hatte ich mich direkt nach meinem Entschluss reiten zu lernen, in schlauen Büchern informiert. Wenn die Pferde in gleichmäßigem Abstand hintereinander gehen, nennt man das Abteilungsreiten. Das traute ich mir zu, überheblich wie ich war.
Dieses Mal wurde Flicka, eine wunderschöne 20jährige Rappstute in die Halle geführt. Sie kam meinen Vorstellungen von Winnetous Rappen sehr nahe. Wo aber waren die anderen Reiter? Wo die Abteilung? Ich blieb der einzige Reitschüler. „Sind Sie neu hier? Sitzen Sie schon mal auf, die Stute ist ganz brav", begrüßte mich eine junge Dame, ein Lehrling des großen Meisters. Sie zeigte mir an dem Sattel einen kleinen Riemen Angstriemen oder auch Maria-Hilf-Riemen genannt, an dem ich mich ruhig festhalten könne. Die Stute war wirklich brav, sie ließ sich nicht von meinen Stiefelspitzen irritieren, blieb ruhig stehen. Als sie merkte, dass ich fertig war, drehte sie mit mir gemächlichen Schrittes ihre Runden.
Die Hilfsreitlehrerin sagte „Terapp“ und verschwand. Gehorsam trabte Flicka an und trabte und trabte, ließ sich auch gut sitzen. Während der Longenstunde hatte mir niemand beigebracht, wie ein Pferd zu bremsen war. Nur daran denkend, wie schön das Reiten war, hörte ich im Unterbewusstsein den Regen prasseln. Irgendetwas schien sich plötzlich geändert zu haben. Die Stute schnaubte und rollte mit den Augen. Mit dem ersten Donnergrollen wurde mir bewusst, dass ein Gewitter aufzog. Um Gottes willen, ich war allein in der Halle. Was nun? Als ob die Stute auf einen Startschuss gewartet hätte, raste sie los. Gott sei Dank fiel mir der Maria-Hilf-Riemen ein. Festhalten konnte ich mich schon, aber ruhig bleiben? Die Stute raste Runde um Runde, meine Beine bollerten gegen ihren Körper, trieben sie dadurch immer mehr an. Die Rappstute trabte schneller und schneller. Heute weiß ich, starker Trab ist nichts dagegen.
Der Reitlehrer war mittlerweile höchstpersönlich in der Halle erschienen und schrie von der sicheren Tribüne herab: „Nun geben Sie doch endlich einmal eine Parade, parieren Sie das Pferd doch durch!“ Wie sollte ich eine Parade geben, ohne zu wissen, was das ist und wie das geht. Noch hatte ich Zeit zu fragen: „Was ist denn das?“. Der große Meister aber raufte sich nur die Haare, brüllte: „Halten Sie endlich das Pferd an.“ Ich kreiste weiter Runde um Runde im Trab, hielt mich am Maria-Hilfsriemen fest und dachte: „Irgendwann muss doch der Sprit zu Ende sein.“
Es kam noch schlimmer. Am Halleingang stand ein Transformatorenhäuschen. Ein Blitz schlug ein. Plötzlich glich Flicka einem Blitz. Ein erneutes Donnern und Flicka erschrak fürchterlich. Gebannt vor Schreck blieb sie stehen. Eine Stille breitete sich aus. Das Gewitter hörte so schnell auf, wie es gekommen war. Endlich konnte ich Flickas Zügel nachfassen und absteigen. Unfassbar: Flicka war nicht einmal einziges Mal angaloppiert. „Sie hatte wohl keine Galopphilfe bekommen", lästerte der Lehrling.
Tür frei bitte zum Nikolausreiten!
Nach etwa der dritten Reitstunde hieß es: Am Freitag ist Nikolausreiten! Alle machen mit! An einzelne Programmpunkte erinnere ich mich nicht mehr genau, einer ist mir jedoch im Gedächtnis geblieben. Jeweils ein Reiter musste an ein Tor reiten, vom Pferd absteigen, ein Tor öffnen, wieder aufsteigen, an eine Bar reiten, absteigen, einen Schnaps trinken wieder aufsteigen und dann mit den anderen um die Wette galoppieren. Wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommen sollte, hätte ich mich sicherlich geweigert mitzumachen.
Zum Wettbewerb wurde mir das Riesenross Freya, jene 1,80 m große Fuchsstute, die mich zum Reiten lernen animiert hatte, zugeteilt. Das Auf- und Absteigen erwies sich als Problem. Aber schlau wie ich war, machte ich mir den linken Bügel länger, um besser aufsteigen zu können. Kaum saß ich oben auf dem Pferd, riefen die Zuschauer: „Galopp!“ Freya galoppierte los, obwohl ich während meines Reitunterrichtes noch nie galoppiert war. Am Gatter schrie das Volk: „ Brr!“ Mein Pferd stand. Ich sprang ab, öffnete das Tor, stieg auf. Wieder kam das Kommando von der Tribüne: „Galopp“. Brav galoppierte die Stute an, „Brrr!“ scholl es abermals von der Tribüne. Das Pferd stand, ich stieg ab, trank den Schnaps und wollte wieder aufsteigen. Diesmal dauerte die Prozedur wohl zu lange. Unversehens raste das Pferd los. Ehe ich mich versehen hatte, saß ich auf dem Boden. Das Volk grölte und nahm an, dass mein Sturz eine Schaueinlage gewesen sei.
Irgendwie kam ich, mich am Angstriemen festhaltend wieder auf das Pferd. Es galoppierte nach Anweisung des Publikums - man glaubt es kaum - als erstes durchs Ziel. Mir zitterten die Knie.
Die Strapazen waren jedoch schnell vergessen, die nächste Reitstunde war festgelegt. Aber es sollte noch schlimmer kommen.
Die letzte Reitstunde im Nobelstall
Wie gewohnt, führte ein Lehrling ein Pferd in die Bahn. Es war Freya, die große Fuchsstute, die ich schon kannte. Was war mit ihr geschehen? Ihr Fell hatte überall haarlose kreisrunde Löcher. Seltsam fand ich das schon. Heute weiß ich, dass die Stute Pilz hatte. Damals bekam ich lediglich die Anweisung, kein anderes Pferd anzufassen und nach dem Reiten meine Hände zu desinfizieren.
Die Stunde begann ganz manierlich. Aber nach etwa einer halben Stunde wurde meine Fuchsstute warm, ihr Fell schien zu jucken. Plötzlich beobachtete ich wieder dieses Augenrollen, das kannte ich schon! Gewitter? Nein, strahlender Sonnenschein. Aus heiterem Himmel begann mein Pferd plötzlich zu bocken. „Reiten Sie doch vorwärts", erscholl die Stimme des Reitlehrers. „Können vor Lachen“, fuhr mir durch den Kopf. Ohne Rücksicht auf ihre Reiterin versuchte Freya, sich an der Bande zu scheuern. Zunächst verlief die Übung im Trab, dann im Galopp. Ich schoss von einem Hallenende zum anderen.
Nach und nach verließen die anderen Reiter teils zu Fuß, teils auf dem Pferd sitzend, die Reithalle. Ich war also wieder allein -– wenn auch diesmal nicht ganz. Der Reitlehrer saß auf der sicheren Tribüne ….. Au! Schon wieder ein Stoß ins Kreuz. Plötzlich saß ich vor dem Sattel. Irritiert hielt die Stute kurz an. Ich setzte mich wieder dahin, wo ich hingehörte. Doch wieder begann Freya zu buckeln und war mittlerweile über und über mit weißem Schaum bedeckt. Nun versuchte die Stute, mich an der Bande abzustreifen. Jetzt hatte ich die Nase gestrichen voll. Ich wartete nur ab, dass sich die Stute in Richtung Hallenmitte drehte, und ließ mich runterfallen. Der Reitlehrer brüllte: „So geht das nicht!“ Das wusste ich auch.
Nachdem Freya ihre Reiterin los war, raste sie wie von Furien getrieben auf die Bande zu, Scheuern an der Bande, von der Bande weg. Panik, Panik nicht nur beim Pferd, anscheinend auch beim Reitlehrer: „Fangen Sie Ihr Pferd ein“, forderte er mich von der Tribüne aus auf. Freya ließ sich weder beruhigen noch einfangen. Auch dass ein mutiger Lehrling mit einem Hafereimer in die Reithalle stürzte, nützte nichts. Alle Einfangversuche waren umsonst. Irgendjemand öffnete das Hallentor. Dort im Hof hatte man in Windeseile eine Gasse aus Strohballen gelegt. Durch diese Gasse lief das Pferd in den Stall.
Kaum war die Stute sicher in der Box, ertönte hinter mir eine Stimme. „Wollen Sie Ihr Pferd nicht trocken reiten?“ „Muss ich das denn?“ fragte ich ganz verschüchtert. „Selbstverständlich“, kam auch prompt die Antwort des Reitlehrers. Selbstverständlich war das für mich zwar nicht, aber in meiner kurzen Reitpraxis hatte ich eins bereits gelernt: Der Reitlehrer hat immer recht.
Voller Angst mit schlotternden Knien saß ich auf einem mit weißem Schaum bedeckten Pferd, ritt Schritt, nichts passierte mehr.
Stolz, so mutig gewesen zu sein, trank ich im Reiterstübchen mein verdientes Bier und erwartete vom Reitlehrer ein dickes Lob für meine Tapferkeit. Der aber öffnete den Mund und sagte nur einen Satz: "Sie lernen das Reiten nie, Sie haben ja Angst“. Was hörte ich da?! In mir brach eine Welt zusammen.
Ich ließ meine restlichen vier oder fünf Reitstunden verfallen. verfallen.
Pferdemanie - Geschichten von Pferdemenschen für Pferdemenschen, Hrsg. Christian Behrens, Pferdoman Verlag, 2010
Erzähl mir nichts vom Pferd, Geschichten einer Pferdenärrin, Manuela Kinzel Verlag, Göppingen, 1. Aufl. 2012, 2. Aufl. 2012, 3. Aufl.
Wo fängt Armut an
Outfit, Handydesign, ja selbst die Marke der Schultasche oder des Füllhalters können heute darüber entscheiden, ob ein junger Mensch seitens seiner Gleichaltrigen als Underdog oder aber als Gleichberechtigter betrachtet wird. Der Maßstab für soziale Akzeptanz unter Jugendlichen hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verschoben. In der Frage, was und wie viel ein Kind braucht, wie Kinderarmut zu definieren ist, sind sich selbst die Politiker uneinig und feilschen um Höhe und Art staatlicher Zuwendungen.
Was Armut heißt, beantwortet sich für unsere Generation vor einem völlig anderen Erfahrungshintergrund.
Gemessen am heutigen Maßstab waren Kinder, die noch kurz vor oder während des Krieges geboren wurden, in den ersten Jahren nach dem Krieg sehr arm. Nur wussten sie dies nicht und hätten auch daher den Begriff Kinderarmut, heute ein oft gebrauchtes Schlagwort, nie für sich reklamiert, denn so ging es zahllosen Kindern, von einigen Ausnahmen abgesehen.
Viele der Kinder waren mit ihren Eltern aus Ostpreußen oder Schlesien vertrieben worden. Zwei Drittel der Kinder einer Schulklasse hatten keinen Vater mehr. Die Väter waren im Krieg gefallen. Einige Väter galten als vermisst oder waren, im günstigsten Fall, noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt.
Manch eine Stadt zählte vor dem Krieg rund 20.000 Einwohner, nach dem Krieg waren es über 60.000. Die einheimische Landbevölkerung war durch die Menge der Flüchtlinge, die zugewiesen wurde, nicht mehr in der Lage zu helfen. Viele hatten kaum selbst etwas. Es waren einfach auch zu viele, die da kamen. So waren die meisten Zugezogenen dankbar für einen Kürbis oder ähnliche Naturalien, für die die Frauen den ganzen Tag Kartoffeln lesen mussten, auch die Kinder halfen dabei. Damals gehörte die Kinderarbeit auch hier zur Normalität.
Eine Frau, durch den Krieg in eine Stadt verschlagen, war Kriegerwitwe mit drei kleinen Kindern. Sie war gut ausgebildet, hatte einen Beruf gelernt, was zu jener Zeit außergewöhnlich war. Vor dem Krieg arbeitete sie als Sekretärin in einem großen Industrieunternehmen. Feldarbeit überhaupt nicht gewohnt, arbeitete sie trotzdem zunächst bei einem Bauern, um die drei kleinen Kinder zu ernähren. Wie alle anderen Frauen arbeitete sie auf dem Feld, um die schmale Rente ein wenig aufzubessern. Geld gab es aber keins, nur einen Kürbis pro Tag. Die Kinder bekamen in der Regel ein paar Kartoffeln. Herbstferien, sogenannte Kartoffelferien, richteten sich nach der Kartoffelernte.
Später bekam die junge Witwe eine Arbeit bei einem Verband, der sich um Kriegsopfer kümmerte.
Die junge Frau hatte bei der Evakuierung des Ruhrgebietes fast ihren gesamten Hausrat verloren. Einen Lastenausgleich gab es für sie nicht. So ging es in der kleinen Familie recht sparsam zu.
Weder Mutter noch Kinder fühlten sich arm, denn die schrecklichen Hungerjahre während der Zeit der Besatzung durch die Siegermächte, in denen nur die Schulspeisung den Hunger linderte, waren vorbei. Die Jüngste litt noch an den Folgen einer Hunger-Tuberkulose, damals eine weit verbreitete Krankheit.
Diese Jüngste erinnert sich an ein Weihnachten direkt nach dem Krieg, als sei es gestern gewesen. An jenem Weihnachten bekam sie ein Glas Marmelade geschenkt. Immer noch sieht sie das Glas Brombeermarmelade vor sich, ein ganz großes Glas Brombeermarmelade, ganz für sie alleine. Die Freude war riesig, so dass sie die Freude voller Glück mit allen teilen wollte, mit ihrem Bruder, mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter. Alle ließ sie von ihrer Marmelade probieren, auch ihre beste Freundin durfte kosten - und letztendlich blieb für sie selbst kaum etwas übrig. Aber sie war glücklich und zufrieden, weil sie ein so schönes Geschenk bekommen hatte, das so groß war, dass sie es noch mit ihrer Familie und ihrer Freundin teilen konnte.
Wenige Jahre später schockte das Kind eine andere Geschichte zutiefst, so dass sie diese auch bis heute noch nicht vergessen hat.
Bettler an der Straße gehörten zum Straßenbild. Da saßen sie nun, Kriegsversehrte, Hungernde und baten um eine milde Gabe. Manchmal klingelten sie auch an der Haustüre und baten um etwas zu essen. Die Kleine war allein zu Hause, als es schellte. Ein Bettler stand an der Haustüre und erklärte, dass er schrecklichen Hunger habe und sich kein Essen kaufen könne. Von den Worten des Mannes tief berührt, lief sie hoch in die Wohnung und holte ein mit Wurst belegtes Brötchen, das sie von einer Nachbarin geschenkt bekommen hatte. Es sollte ihr Abendessen werden. Normalerweise gab es keine Brötchen. Dazu fehlte immer noch das Geld, und ein Brötchen mit Butter und Wurst gab es so gut wie nie. Doch die Kleine wusste noch zu gut, wie sich Hunger anfühlte. Schweren Herzens nahm sie deshalb ihr Brötchen und brachte es dem Mann. Dieser fragte zunächst noch freundlich: „Hast du denn kein Geld?“, worauf die Kleine sagte: „Geld kann man doch nicht es sen!“ Wutentbrannt nahm der Bettler das Brötchen und warf es in den Stadtgraben, wo sich die Enten über die Mahlzeit her machten.
Ungesehene Tränen - Anthologie zum Literaturwettbewerb Kinderarmut, Custos Verlag, Solingen, 2011
Das braune Einhorn
Das Mondlicht ließ die Schneekristalle auf den Tannen glitzern wie tausend Diamanten. Fassungslos beugte sich die strahlend weiße Einhornstute über ihr neugeborenes Fohlen. Die junge Mutter konnte es einfach nicht fassen, ihr Fohlen unterschied sich zu ihrem Entsetzen von allen andere Einhornfohlen: Es war braun.