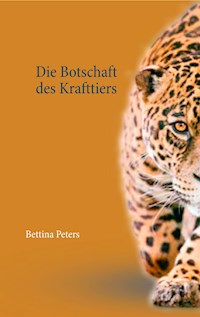Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir alle haben schon einmal von ihr gehört: Erika Mustermann. Doch wer ist eigentlich diese geheimnisvolle Fremde, die für die deutsche Frau schlechthin steht? Hier kommt der Inbegriff der Durchschnittsdeutschen endlich einmal selbst zu Wort und erzählt ihre Geschichte. Die ist natürlich alles andere als außergewöhnlich. Hätte es da nicht kürzlich diesen Vorfall mit den Gartenzwergen gegeben … Denn seit Neuestem steckt die 45-jährige Erika in einer ordentlichen Midlife-Crisis und hat sich nicht mehr ganz so gut unter Kontrolle. Da hilft nur eins: Ab zum Psychologen. Was alles zum Vorschein kommt, wenn man die eigene Komfortzone verlässt, das überrascht schließlich sogar die pünktliche und ordnungsliebende Erika. Eine wunderbare fiktive Autobiografie, die einem beim Lesen vor lauter Lachen die Tränen in die Augen treibt und auf einzigartige Weise beschreibt, wie wir Deutschen – den Statistiken zufolge – wirklich ticken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Peters hat sich nach einem Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften als Texterin und Autorin selbstständig gemacht. 2015 kommt sie zum ersten Mal mit Erika Mustermann ins Gespräch. Was diese zu erzählen hat, ist so außergewöhnlich normal, dass die Idee zur Biografie entsteht.
Erika Mustermann ist 45 Jahre lang der Inbegriff der Durchschnittsdeutschen. Als sie merkt, dass so viel Normalität nicht mehr normal ist, krempelt sie mit deutscher Gründlichkeit ihr Leben um. Mit ihrem Buch möchte sie auch Lieschen Müller dazu ermutigen, sich auf die Suche nach dem großen Glück zu machen.
Bettina Peters
Erika Mustermann
Das geheime Leben der bekanntesten Durchschnittsdeutschen
Inhalt
Prolog
Hier und heute: Auf dem Boden der Tatsachen
Das Musterkind: Wie alles begann
Alltag - und andere Katastrophen
Männer - und was alles schiefgehen kann
Familie - und noch mehr Wahnsinn
Veränderungen - und wie die Welt sich weiterdreht
Herausforderungen - man tut, was man kann
Vom Reisen - und dem Glück, endlich anzukommen
Große Ereignisse - und kein Ende in Sicht
Quellenverzeichnis
Prolog
Der Gartenzwerg hatte seine Nase verloren. Traurig stand er inmitten seiner makellosen Genossen, die heute Morgen ein hämisches Lächeln auf den tönernen Lippen trugen.
Erika, du spinnst!, schalt ich mich selbst. Gartenzwerge lächeln nicht. Zumindest nicht hämisch.
Andersrum verloren Gartenzwerge auch nicht einfach ihre Nasen. Vorsichtig bahnte ich mir den Weg durch die Armee der Zwerge. Der Nasenlose stand zwischen dem fröhlichen Sänger und einem verschmitzten Alten mit Pfeife, der mich immer an meinen Großvater erinnert hatte. Heute jedoch wirkte die bunte Heerschar, die ich mit so viel Liebe zusammengestellt und gepflegt hatte, seltsam bedrohlich. Im Kreise seiner perfekten Freunde stach der verstümmelte Zwerg hervor wie ein Fremdkörper.
Mitfühlend hob ich ihn auf. Dort, wo einmal seine Nase gewesen war, prangte ein scharfkantiges Loch. Auf Spurensuche bückte ich mich noch einmal, scheitelte die wohlgestutzten Grashalme und brachte schließlich zwei kleinere Objekte zum Vorschein. Die fehlende Nase und einen mittelgroßen Stein. Einen von der Art, die Menschen benutzen, um sie auf anderer Leute Zwerge zu werfen. Die Sache war eindeutig. In meinem Schrebergarten fand man nicht einfach so irgendwelche Steine. Und schon gar keine nasenlosen Zwerge.
»Wer macht denn so was?«, flüsterte ich fassungslos, die entstellte Figur tröstend an meine Wange gedrückt.
»Mensch, Frau Mustermann«, unterbrach die schneidende Stimme des Postboten jäh meine düsteren Gedanken, »Sie sind ja über den heiligen Rasen gelaufen! Nicht, dass Sie noch einen Grashalm abknicken!«
»Das geht dich gar nichts an, du Brieftaube!«, sagte ich leise in die kalte Zipfelmütze in meinem Gesicht.
»Wie bitte?«
»Das geht dich gar nichts an, du blöde Brieftaube!« Ich schrie jetzt, so laut ich konnte. »Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß!«
Mit aller Kraft schleuderte ich dem Mann den ramponierten Zwerg entgegen. Er flog gut – auch ohne Nase – und zersprang mit einem dramatischen Scheppern neben dem gelben Postfahrrad in tausend Stücke. Das fehlende Riechorgan sollte von nun an nicht mehr sein größtes Problem sein.
»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?« Mit einem beherzten Sprung rettete der Briefträger sich hinter seinen Drahtesel. Das süffisante Grinsen war aus seinem Gesicht verschwunden. »Das war doch nur ein Scherz!«
»Siehst du mich lachen?«, brüllte ich. »Siehst du hier irgendjemanden lachen?«
Wie von Sinnen packte ich den Sängerzwerg und warf ihn seinem nasenlosen Genossen hinterher. Der Postbote schrie laut um Hilfe.
»Halt den Mund und verteil deine Briefe!«
Als Nächstes war der Pfeifen-Opa an der Reihe. Dann der Pausbäckige mit der Säufernase. Der Ziehharmonikazwerg zerschellte besonders imposant – das musste ich mir merken. Rasend vor Wut griff ich nach der nächsten Figur und stolperte ungelenk über den verträumten Flötenspieler. Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, den Zwerg wurfbereit in der rechten Hand, war der Briefträger verschwunden.
»Ja, lauf nur weg!«, schrie ich hysterisch. »Bevor ich noch einen Grashalm abknicke!«
Wie eine Furie schwang ich herum. Die Gartenzwergarmee bot einen Anblick der Verwüstung. Jenseits des Jägerzauns glänzten die bunten Leichenteile der Gefallenen in der Sonne. Die Stockrosen wiegten sich selbstgefällig in der lauen Sommerbrise, als wäre nie etwas geschehen. Fröhlich summend landete eine Hummel auf den prächtigen Blüten. Das perfekte Idyll am Münchner Stadtrand. Und die blumengewordene Provokation.
»Euch wird das Grinsen auch noch vergehen!«, brüllte ich.
Ich griff nach der Harke, die an der Wand meines Geräteschuppens lehnte. Mit einem gezielten Schlag enthauptete ich die üppige Stockrose, die mir am nächsten stand. Bunte Blütenblätter landeten lautlos auf dem gepflegten Rasen. Pinke, rote, weiße und gelbe. Zischend sauste die Harke durch die Luft und fraß eine Schneise der Zerstörung durch die geschmackvoll angelegten Blumenrabatten.
Keuchend betrachtete ich das Chaos, das einmal mein Garten gewesen war. Ich war noch lange nicht fertig.
»Legen Sie die Harke weg!«, befahl eine Männerstimme vom Eingang des Grundstücks her.
Wie in Trance fuhr ich herum, die Harke zum nächsten Schlag bereit. Am Gartenzaun standen zwei Polizisten in Uniform, die behandschuhten Hände an den Halftern ihrer Dienstwaffen.
»Legen Sie die Harke langsam weg und kommen Sie zu uns!«
»Ich denk ja nicht dran!«, schrie ich aufmüpfig. »Das ist mein Garten. Mein Eigentum! Was ich hier mache, geht Sie gar nichts an!«
Wild entschlossen schwang ich die Harke durch die Luft und fällte die riesige Sonnenblume, die mit einem erstaunten »Plopp« zu Boden ging.
»Ich sage es Ihnen nicht noch mal!«, drohte der ältere der beiden Polizisten.
»Dann ist ja gut!«
Ich hob die Harke, trat näher an die ausladende Hortensie, setzte zum Schlag an – und fand mich im nächsten Moment auf dem Boden wieder. Auf mir die Polizisten. Unter mir die Harke, die sich schmerzhaft in meinen Rücken bohrte. Um mich herum das Stockrosenmassaker, Gartenzwergleichen und schockierte Nachbarn. Nur die Hummel summte noch immer unbeeindruckt durch ihr kleines Paradies.
Ich kicherte. Erst leise, dann immer lauter und hysterischer. Zum ersten Mal seit Jahren lachte ich, bis mir die Tränen kamen. Japsend beobachtete ich, wie die Polizisten sich aus meinem Blumenbeet schälten, die Erde von den Hosen und die dahingemetzelten Blütenblätter aus den verschwitzten Haaren klopften. Als sie mir Handschellen anlegten und mich unsanft in ihren Streifenwagen verfrachteten, lachte ich noch immer.
Hier und heute: Auf dem Boden der Tatsachen
»Eigentlich bin ich ganz normal.«
Etwas unbehaglich rückte ich das kratzige Kissen unter meinem Kopf zurecht. Toll. Das sagen Psychopathen bestimmt auch immer, dachte ich nervös.
»Lassen Sie sich Zeit«, sagte der Mann.
Als ob Zeit etwas ändern würde! Ich ließ den Blick durch den hellen Raum schweifen. Er hatte sich Mühe gegeben, das musste man ihm lassen. Das beigefarbene Sofa sah genauso aus wie mein eigenes. Genauso wie die Couchgarnituren von rund achtzig Prozent der Bundesbürger. Grob geschätzt. Selbst die Liegekuhle, in die ich mich gleich noch etwas tiefer hineindrückte, erinnerte mich an meine eigene, in jahrelanger Arbeit selbst zerschlissene Lieblingscouch. Verrückt!
Gedankenverloren sah ich mich weiter in dem quadratischen Raum um. Vom fleckenunempfindlichen Veloursteppich über die hellholzige Schrankwand bis hin zur weißen Raufasertapete eine perfekte Kopie meines eigenen Wohnzimmers.
Clever, dachte ich nicht ohne Bewunderung. Aber eigentlich wusste ich es besser. Das war kein kluger Schachzug, um mein Vertrauen zu gewinnen – das war einfach nur Standard. Die klassische Einrichtung des Durchschnittsdeutschen. Kein Wunder, dass mich das an etwas erinnerte.
Es kostete eine gute Portion Willenskraft, mich wieder auf den Sessel mir gegenüber zu konzentrieren. Auf den Mann, der darin saß und sehr wahrscheinlich für die Einrichtung in diesem Raum verantwortlich war. Ein Mittel-Mann: mittelgroß, mittelalt, mittelblond, mittelattraktiv. In seiner beigen Hose und dem hellgrauen Hemd verschmolz er mit der farblosen Umgebung wie ein bleiches Chamäleon. Bestimmt konnte er auch seine Augen in schönster Echsenmanier unabhängig voneinander bewegen. Im Moment jedoch waren beide Augen fest auf mich gerichtet.
Der Mann betrachtete mich mit einer Mischung aus professioneller Distanz und wissenschaftlichem Interesse. Ungefähr so, wie man einen Frosch auf dem Seziertisch ansieht. Vorausgesetzt, man seziert Frösche. Was ich in der Regel nicht mache. Ich töte nur Gartenzwerge.
Ob er wohl ahnte, dass er eine Massenmörderin vor sich hatte? Ich wagte es zu bezweifeln. Aber er würde es noch früh genug erfahren. Ihm als meinem Psychotherapeuten schuldete ich schonungslose, vollständige Offenheit. So war der Deal.
»Sie müssen an sich arbeiten, Frau Mustermann!«, hatte der Richter gesagt. »Ich möchte Sie nie wieder hier sitzen sehen. Wenn ich Sie jetzt gehen lasse, dann nur, wenn Sie mir das versprechen. Suchen Sie sich Hilfe!«
Und er hatte recht. Ich brauchte dringend Unterstützung. Ich entschuldigte mich bei dem Postboten, der im Zeugenstand ähnlich blass wirkte wie im Angesicht schnell näherkommender Gartenzwerge, und wälzte die Gelben Seiten. Die Wahl fiel auf Dr. Max Müller, Psychologischer Psychotherapeut mit Kassenzulassung. Auch deshalb, weil er als einziger noch in diesem Jahrhundert einen freien Termin anzubieten hatte. Ob das wohl ein schlechtes Zeichen war? Die durchschnittliche Wartezeit bis zum Beginn einer Therapie beträgt in den deutschen Großstädten fünf Monate. Das hatte ich gerade erst gelesen. Ich hatte keine fünf Monate. Was ich hatte, waren ein traumatisierter Briefträger, ein verwüsteter Schrebergarten, zerfetzte Pflanzenleichen und verstümmelte Gartenzwerge. Und keine Ahnung, wie das alles passiert war. Denn eigentlich, ich sagte es bereits, war ich ganz normal. Ehrlich!
Ich richtete meinen Blick wieder auf den Mann im Sessel und stellte fest, dass auch er seine Musterung abgeschlossen hatte. Was er vor sich sah, war schnell zusammengefasst: Mich. 45 Jahre alt, unverheiratet, straßenköterblond. Größe: normal. Gewicht: normal. Besondere Kennzeichen: keine. Name: Erika Mustermann. Es konnte losgehen!
»Ich brauche Ihre Hilfe«, sagte ich verlegen. Irgendjemand musste schließlich irgendwann etwas sagen. Diese Stille machte mich ganz nervös.
»Okay«, sagte Max Müller. Sonst nichts. Ich setzte mich auf meinem – seinem – Sofa auf und fand ihn blöd. Ganz offiziell. Hätte ich einen Gartenzwerg zur Hand gehabt, ich hätte für nichts garantieren können.
»Was wollen Sie denn wissen?«, fragte ich barsch. Wenn er jetzt »Alles« sagen würde, wär ich weg!
»Erzählen Sie mir doch erst mal, warum Sie hier sind.«
Also berichtete ich, was geschehen war. Von dem nasenlosen Gartenzwerg und der restlichen Gang. Wie sie fliegen lernten und neben einem vorlauten Postboten zerschellten. Wie die Stockrosen mit meiner Harke Bekanntschaft machten. Und ich mit zwei Polizisten, einer Arrestzelle und zu guter Letzt einem gnädigen Richter.
»Und was meinen Sie, warum das alles passiert ist?«, fragte Max Müller, als ich fertig war.
»Ich habe keine Ahnung«, sagte ich kleinlaut.
»Dann schlage ich vor, Sie hören auf, mich blöd zu finden, und wir gehen der Sache auf den Grund.«
Mir war, als er hätte er mit seinen stechenden Reptilienaugen direkt in die schwärzeste Ecke meiner Seele geblickt. Ich spürte die Röte in meinem Gesicht aufsteigen und setzte mich in der seltsam vertrauten Sitzkuhle zurecht.
»Gut«, sagte ich.
»Gut«, sagte er. »Erzählen Sie mir mehr von sich. Wer ist Erika Mustermann?«
Das Musterkind: Wie alles begann
Wie das in der Regel so ist mit den Entstehungsgeschichten, war meine eigene für mich selbst zunächst eher unspektakulär. Meine Mutter hätte dazu vielleicht etwas mehr beitragen können. Aber da es hier ja um mich geht und nicht um meine Mutter, kann ich Ihnen nur berichten, wie sich die Sache für die kleine Erika darstellte.
Es war das Jahr 1971. Meine Eltern Renate und Erwin Mustermann lebten in einem schmucken Reihenmittelhaus am Stadtrand von München. Nachdem sie ihr Hochzeitsgeld ebenso wie ein Startkapital aus zwei Bausparverträgen in die Anzahlung ihres Eigenheims, eine massive Schrankwand Eiche rustikal, eine graubraune Sofagarnitur und einen Küchentraum im legendären Siebzigerjahre-Grün investiert hatten, fanden sie es an der Zeit, eine Familie zu gründen. Mit 24 und 26 Jahren waren sie im allerbesten Alter für das erste Kind. So kam es, dass sich schon bald die kleine Sabine ankündigte, die ihr Leben für immer verändern sollte. Und die Mustermanns wollten noch mehr. Da sie mit meiner Schwester Sabine offenbar nicht vollständig ausgelastet waren, trafen sie rund ein Jahr nach ihrer Geburt eine revolutionäre Entscheidung: Sie wollten ein zweites Kind. In einer Zeit, in der jede deutsche Frau in ihrem Leben statistisch gesehen rund 1,6 Kinder zur Welt brachte, müssen sich die mustergültigen Mustermanns gefühlt haben wie eine Großfamilie. Die angepasstesten Eltern der Welt waren im Begriff, die Statistik zu übertreffen.
Doch zurück zum Tag meiner Geburt. Ich hatte mir scheinbar schon früh vorgenommen, mich mit meinen Eltern und dem Rest meiner kleinen Welt gut zu stellen und kam pünktlich zum errechneten Geburtstermin auf die Welt. Ganz im Gegensatz zu Sabine, die unsere Eltern schon vor ihrem ersten Zusammentreffen auf eine harte Probe gestellt hatte. Erst hochdosierte Wehenmittel und die Androhung eines Kaiserschnitts hatten meine Schwester zwei Jahre zuvor davon überzeugen können, endlich den Mutterleib gegen die harte Realität einzutauschen. Wäre es nach ihr gegangen, dann hätte ich mir wahrscheinlich nach all den Jahren immer noch die Gebärmutter mit ihr teilen müssen. Mit tagelanger Verspätung und unter heftiger Gegenwehr war sie dann schließlich auf der Bildfläche erschienen. Schreiend natürlich. Man munkelt, Sabine habe schon lauthals geschrien, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblickt hatte. Im Mutterleib also. Und obwohl ich das für ein Gerücht halte: Jeder, der meine Schwester kennt, hat sich sicher schon mehr als einmal gefragt, ob es nicht doch der Wahrheit entspricht.
Auf jeden Fall hatte Sabine mit ihrem dramatischen ersten Auftritt die Messlatte für das zweite Kind der Familie angenehm niedrig angesetzt. So kam es, dass ich mit meiner eigenen, fast etwas langweiligen Geburt gleich richtig punkten konnte. Flupp, da war ich. Eine kleine Erika. 3400 Gramm schwer, 52 Zentimeter groß. Schrumpelig, glitschig und eher schlecht gelaunt. Alles ganz normal. Die Hebamme säuberte mich notdürftig und reichte mich meiner glücklichen Mutter.
»Da ist sie«, sagte sie überflüssigerweise – ich bin sicher, meiner Mutter war mein Erscheinen durchaus schon aufgefallen. »Ihre kleine Erika. Ein wahres Musterkind.«
Auch wenn ich selbst in diesem Moment über eine rein körperliche Anwesenheit wohl nicht hinauskam, meine ich mich deutlich an den Gesichtsausdruck der Hebamme zu erinnern. Sie schien mächtig stolz auf ihr kreatives Wortspiel. Ein Musterkind. Ich war die buchstäbliche Neugeburt des Durchschnitts und hieß mit Nachnamen Mustermann. Wenn Sie mich fragen, war der Musterkind-Witz, der mich durch meine gesamte Kindheit begleiten sollte, eher lahm als kreativ.
Soweit ich weiß, verzichteten meine Eltern an diesem schönen Tag jedoch darauf, die vorwitzige Hebamme auf ihre wenig originelle Bemerkung hinzuweisen, und widmeten sich lieber ihrem frisch geschlüpften Familienzuwachs. Ob das ein Ausdruck purer Erschöpfung oder auf ein gesteigertes postnatales Harmoniebedürfnis zurückzuführen war, werden wir wohl nie erfahren.
Ich gewöhnte mich schnell an die unwirtliche Umgebung außerhalb meines liebgewonnenen Mutterleibs und begnügte mich für den Augenblick damit, auf Mamas Brust eine Verschnaufpause einzulegen. So verschlief ich den ersten Besuch meines Lebens, der aus Mamas Schwester Inge, ihrem Mann Josef und meiner damals fünfjährigen Cousine Annika bestand. Berichten zufolge habe ich da wohl nicht viel verpasst. In ihrer Angst vor Keimen nötigte meine Mutter in den ersten Lebensmonaten ihrer Kinder alle Besucher nämlich zu einer peniblen Säuberungsaktion, die jeder Quarantänestation das Wasser reichen konnte. Da es ihr aus organisatorischen Gründen nicht möglich war, ihre Gäste nackt auszuziehen und mit dem Hochdruckreiniger abzuspritzen, bediente sie sich dafür aller anderen Hilfsmittel, die der Markt so hergab.
Als Mamas Familie nun endlich ihren strengen Hygienevorschriften genügte und einen ersten Blick auf die kleine Erika werfen durfte, hielten sich die Begeisterungsstürme entsprechend in Grenzen.
»Und, wie findest du deine neue Cousine?«, fragte meine stolze Mutter ihr kleines Patenkind.
»Geht so.«
»Wem sieht sie denn ähnlich? Der Mama oder dem Papa?«
»Weiß nicht«, lautete Annikas gelangweilte Antwort. »Sieht aus wie jedes Baby. Gut, dass wir die nicht mit nach Hause nehmen müssen.«
Baby Erikas besagte erste Verschnaufpause dauerte Mama zufolge mehrere Jahre. Ich war ein angenehmes Kind, das offenbar nicht viel zu erzählen hatte: Auf den obligatorischen »Da-bin-ich-und-ich-habe-Hunger-Schrei« unmittelbar nach Verlassen des Geburtskanals sollten lange Zeit keine weiteren folgen. Ich meldete mich nur dann zu Wort, wenn ich wirklich etwas zu erzählen hatte, und verinnerlichte schon früh die deutschen Tugenden, zu denen man in der Familie Mustermann erzogen wurde. Das jedenfalls war den Erzählungen meiner Mutter zu entnehmen, mit denen sie ungefragt und exzessiv ihre spärlich gesäten Bekannten unterhielt. Ihre Erika war nämlich so zuverlässig und höflich wie genügsam. Nach ihrer Erika konnte man von Anfang an die Uhr stellen. Ihre Erika schlief, wenn es Schlafenszeit war, und trank, wann immer es Essenszeit war – und zwar systematisch. Linke Brust, rechte Brust, Bäuerchen. Dann schlief Klein-Erika mit einem zufriedenen Lächeln auf den satten Babylippen ein. Ein Kind wie aus dem Bilderbuch. In einer ebenfalls bilderbuchartigen rosafarbenen Babywelt, in der sich Hello Kitty sicher wie im Paradies gefühlt hätte. Natürlich kannte zu der Zeit noch niemand das spätere Kult-Kätzchen.
Während sich die Brust-Bäuerchen-Babylippen-Sache relativ schnell änderte, blieb ich doch weiterhin ein liebes, ruhiges Mädchen. Alle mochten mich. Außer Sabine vielleicht. Meine Schwester und ich hätten kaum unterschiedlicher sein können. Wenn ich das Musterkind war, dann war sie wohl das Montagsmodell der Reihe, das immer und überall aneckte und für Ärger sorgte. Sabine war das egal. Sie machte, was sie wollte – und das war in der Regel genau das Gegenteil von dem, was alle anderen von ihr erwarteten.
Als Sechsjährige schnitt sie ihren Barbiepuppen Irokesenschnitte und malte ihnen Totenkopf-Tattoos auf die streichholzdünnen Oberarme. Ihr nächstes Styling-Opfer sollte ihre kleine Schwester werden. Ich hatte die blonden Flusen auf meinem vierjährigen Kopf gerade erstmals zu einer Art Frisur wachsen lassen und schrie wie am Spieß, als Sabine mir mit Mamas großer Schneiderschere auf die Pelle rückte. Die Tür flog auf, unsere Eltern stürmten das Kinderzimmer – und fanden ihre beiden Töchter in einem verstörenden Kampf verkeilt auf dem Fußboden vor. Sabine hielt noch immer die Schere umklammert. Ich schätze, sie sah aus wie eine Massenmörderin in der Ausbildung.
Den folgenden Zimmerarrest nutzte meine Schwester dazu, ihr rosafarbenes Barbiehaus mit dem Edding schwarz anzumalen. Genug Zeit hatte sie ja nun.
Abgesehen von Sabines gelegentlichen Eskapaden verlief meine Kindheit in ruhigen Bahnen. Papa war selbstständiger Tischler und verbrachte einen Großteil der Woche in seiner kleinen Werkstatt am anderen Ende unseres Wohnviertels. Wenn er abends nach Hause kam, roch er wunderbar nach Sägespänen und ehrlicher Arbeit. Mama hatte eigentlich Ärztin werden wollen, es dann aber nur bis zur Hobby-Quacksalberin geschafft. Das sagte mein Vater zumindest immer. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis ich diese Äußerung verstand. Auf jeden Fall hatte meine Mutter vor Sabines Geburt als Sekretärin gearbeitet und kümmerte sich jetzt neben der Kindererziehung um Papas Buchführung.
Die Wochenenden im Hause Mustermann gehörten der Familie und dem Garten. Und natürlich dem Auto – einem großen, schwarzen Audi, der Papas ganzer Stolz war. Er hatte einen Schonbezug über dem Fahrersitz, weil mein Vater als Handwerker nun einmal häufig in Arbeitskleidung unterwegs war. Da dieser Schonbezug aber nicht schmutzig werden durfte, lag zusätzlich ein großes Handtuch auf dem Sitz. Dieses Handtuch jedoch durfte unter keinen Umständen schmutzig werden – wer sitzt schon gern auf verdreckten Draufsitzhandtüchern?
»Dann macht doch einen Schonbezug über den Schonbezug!«, schlug Sabine eines Tages vor. »Und vielleicht noch einen Schonbezug über den Schonbezug über dem Schonbezug. Und diesen Schonbezug …«
»Schon gut!«, fiel Mama ihr ins Wort. »Danke für den konstruktiven Vorschlag. Und jetzt leg bitte das frische Handtuch auf den Schonbezug.«
Ich fand das alles irgendwie komisch und erntete zum ersten Mal in meinem mustergültigen Leben so etwas wie Anerkennung von meiner Schwester.
»Jetzt hast du’s auch gemerkt!«, seufzte sie erleichtert. »Vielleicht gibt es ja doch noch etwas Hoffnung.«
Dass ich nicht ganz verstand, was sie damit sagen wollte, behielt ich lieber für mich. Stattdessen sonnte ich mich in dem Moment schwesterlicher Eintracht, von dem es in den folgenden Jahren nicht viele geben sollte.
Während Mama samstagnachmittags Unkraut zupfte und ihre prächtigen Blumenbeete in Form brachte, wusch unser Vater die Familienkutsche. Sabine und ich halfen den beiden, wie eben nur Kinder helfen können. Wir reichten Papa den Schwamm, hielten den Gartenschlauch und polierten Chromfelgen, bevor wir das Wort auch nur aussprechen konnten. Wir schleppten volle Unkrauteimer auf den Kompost, harkten im Herbst das Laub unserer Apfelbäume zusammen und mähten mit unseren pinkfarbenen Plastikrasenmähern den Vorgarten. In unbeobachteten Momenten aßen wir Blumenzwiebeln und setzten Papas Fußmatten unter Wasser. Was man halt so macht als Kinder. Danach traf sich die Familie zu Kaffee, Kakao und Kuchen am massiven, von Papa selbst gebauten Küchentisch. Ich liebte unsere idyllischen Familiensamstage. Sabine nannte sie spießig und hasste sie.
Am Sonntag wurde ausgeschlafen. Irgendwann holte Papa dann beim Bäcker um die Ecke frische Brötchen, während Mama das Frühstück vorbereitete. Es gab gekochte Eier – sieben Minuten, Eiweiß hart und Eigelb flüssig, wie sich das gehört – und selbst gemachte Erdbeermarmelade. Dann, so war der Plan, sollten Sabine und ich zusammen spielen, damit Mama und Papa etwas Zeit für sich hatten. Und damit begann der spannende Teil des Wochenendes.
»Lass uns Memory spielen!«, befahl Sabine. Dass meine Schwester um nichts bat, sondern einforderte, was auch immer sie gerade haben wollte, war wohl eine der ersten Lektionen meines noch jungen Lebens gewesen. Also spielten wir Memory. Sabine mischte die Karten und legte sie kreuz und quer auf dem großen Küchentisch aus, von dem wir gerade erst das benutzte Frühstücksgeschirr abgeräumt hatten. Dann rückte sie sich einen der schweren Stühle zurecht.
»Du musst dir erst die Hände waschen!«, wies ich sie im schönsten Mama-Ton zurecht.
»Muss ich nicht. Sie sind ja gar nicht schmutzig.«
»Sind sie wohl! Wer weiß, wer schon alles die Karten angefasst hat?«
»Du und ich! Wer sonst sollte unser Memory benutzt haben?« Sabines Stimme wurde mit jeder Silbe lauter.
»Und was ist mit den Arbeitern in der Memory-Fabrik?«, fragte ich herausfordernd. »Meinst du, die waschen sich immer die Hände, bevor sie unsere Spiele einpacken?«
»Das machen alles Roboter!«, behauptete meine Schwester, die ein großer Fan der Sendung mit der Maus war.
»Roboter haben auch schmutzige Hände. Mit Öl dran. Und Keimen. Davon wird man krank!«
Ich hatte noch nie einen Memory-Einpack-Roboter gesehen und war mir nicht sicher, ob er überhaupt Hände hatte. Aber bei einem so wichtigen Thema wie Hygiene wollte ich auf keinen Fall klein beigeben.
»Du bist echt noch schlimmer als Mama!« Genervt rannte meine Schwester ins Bad, um sich die Hände zu waschen. Vielleicht drehte sie auch nur kurz den Wasserhahn auf, um ihre reinliche Spielgefährtin ruhigzustellen. Ganz sicher konnte man sich bei ihr niemals sein.
Als sie zurück in die Küche kam, hatte ich die Zeit genutzt, um die unordentlich auf dem Tisch verteilten Spielkarten in übersichtlichen Viererreihen anzuordnen.
»Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Bestimmt hast du dir auch alle Karten angeguckt!«
»Habe ich nicht!«, widersprach ich beleidigt. »Ich habe nur etwas aufgeräumt.«
»So geht das nicht!«, rief Sabine böse und wirbelte die frisch geordneten Pappbildchen wieder durcheinander. »Das darf nicht ordentlich sein!«
»Dann spiele ich nicht mit!« Wütend funkelten wir uns an.
»Dann lass es eben!« fauchte meine Schwester.
Entschlossen fegte sie die Karten vom Tisch auf den klinisch reinen Teppichboden. Mit einem missbilligenden Schnauben bückte ich mich, um sie wieder aufzuheben. Doch meine Schwester hielt mich zurück.
»Denk nicht mal dran!«, zischte sie bedrohlich. »Wenn du diese Karten aufhebst, dann hau ich dich!«
»Hier wird niemand gehauen«, murmelte Papa geistesabwesend, der gerade im passenden Moment in die Küche gekommen war.
Triumphierend streckte ich Sabine die Zunge raus und räumte das Chaos auf.
»Streber«, fauchte sie so leise, dass nur ich es hören konnte.
Es war mir egal. Der Fußboden war wieder sauber.
»Und was machen wir jetzt?«
»Wir puzzeln!«, entschied Sabine.
Mühsam zog sie ihr Lieblingspuzzle aus den Untiefen ihrer überquellenden Spielkiste. Die Autowerkstatt mit Tankstelle. Ich hätte viel lieber mein rosa Feenpuzzle gemacht. Eine leise Stimme in meinem Inneren jedoch hielt mich davon ab, das auch nur vorzuschlagen. Heute weiß ich, es war der pure Überlebensinstinkt.
Sabine schüttete den Pappkarton auf dem großen Tisch aus und begann die Teile zurechtzulegen. Ich entspannte mich etwas. Der Sturm hatte sich wohl fürs Erste gelegt. Mit beiden Händen griff ich ebenfalls nach den Puzzleteilen und begann sie systematisch zu ordnen. Eine Weile arbeiteten wir still und konzentriert zusammen.
»Ich hab die Decke mit der Hebebühne fertig!«, berichtete meine Schwester schließlich stolz. »Und wie weit bist du?«
»Ich habe alle Teile mit drei Löchern zusammen.«
Fassungslos starrte Sabine auf die ansehnliche Sammlung gleicher Puzzleteile, die ich fein säuberlich auf dem Tisch vor mir aufgereiht hatte.
»Wen interessieren denn die Löcher?«, schrie sie, als sie endlich ihre Stimme wiedergefunden hatte.
»Mich«, antwortete ich arglos. Irgendwie musste man doch schließlich anfangen.
Genau in diesem Moment kam unsere Mutter zur Tür herein.
»Was ist denn hier los?«, fragte sie. »Streitet ihr euch schon wieder?«
»Mit Erika kann man nicht spielen«, maulte Sabine. »Die will immer nur alles ordentlich machen.«
»Ordnung ist das halbe Leben!«, belehrte Mama meine große Schwester.
»Dann ist das halbe Leben eben scheiße!« Zufrieden registrierte Sabine, wie ich beim Klang des verbotenen Schimpfwortes zusammenzuckte. »Es sei denn, man heißt Erika. So ein Psycho!« Und weg war sie. Wütend. Der typische Sabine-Abgang mit knallenden Türen und einer Extra-Portion Vorwurf, die noch Stunden später in der Luft zu liegen schien.
Ich war mir keiner Schuld bewusst und sah hilfesuchend zu meiner Mutter auf.
»Mach dir nichts draus«, sagte sie und tätschelte meinen mittelblonden Hinterkopf. »Sabine ist einfach nicht so wie wir. Du bist kein Psycho. Du bist ganz normal.«
Aus Mamas Mund klang das wie das größte Kompliment, das ein Mensch jemals bekommen hatte. Mit stolzgeschwellter Brust räumte ich das Durcheinander auf, das mein Wirbelwind von Schwester hinterlassen hatte. Ich war ganz normal!
Am darauffolgenden Sonntag spielten wir Mikado. Schwungvoll ließ Sabine die bunt gestreiften Holzstäbchen auf den blanken Küchentisch donnern. Kreuz und quer wirbelten die Hölzer durch die Gegend, um schließlich in einem wilden Durcheinander zum Liegen zu kommen. Ich hatte noch nie Mikado gespielt, wusste aber von meiner Schwester, was von mir erwartet wurde. Fasziniert betrachtete ich das entstandene Chaos und streckte die Hand aus.
»Nicht!«, wies Sabine mich zurecht. »Ich fang an!« Geschickt packte sie eines der Stäbchen und zog es aus dem Haufen, ohne dass sich die benachbarten Hölzer bewegten.
»Hah!«, rief sie triumphierend und griff nach dem nächsten Hölzchen. So ging das weiter, bis sie endlich mit einer unkonzentrierten Bewegung den fragilen Turm zum Wackeln brachte.
Jetzt war ich an der Reihe. Ohne groß nachzudenken, griff ich mit beiden Händen in den Stäbchen-Haufen und schob die Holzspieße zu einer ordentlichen, glatten Schicht zusammen. Sah viel schöner aus!
Mit offenem Mund starrte die sonst so schlagfertige Sabine die fein säuberlich aufgereihten Mikadostäbe an.
»Du kannst doch nicht den ganzen Stapel verschieben!«, zischte sie schließlich.
»Ich war dran!«
»Ja, aber … du darfst immer nur ein Hölzchen anfassen!«
»Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, ich kann Hölzchen rausziehen, bis was wackelt.«
»Es hat gewackelt!«, schrie Sabine mit sich überschlagender Stimme. Schon als Kind besaß sie das fragwürdige Talent, sozusagen in Großbuchstaben schreien zu können. »JEDES EINZELNE STÄBCHEN HAT GEWACKELT!«
»Okay«, sagte ich gelassen, »dann bist du dran.«
»Du bist echt nicht normal!«
»Bin ich wohl! Mama sagt das auch!«
»Dann spiel doch mit Mama!«
Das Thema Mikado war ein für alle Mal durch. Gleich unter den Punkten »Memory« und »Puzzeln« gesellte es sich auf die schnell wachsende Liste der Spiele, die meine Schwester und ich nie wieder zusammen spielen sollten.
»Waren Sie denn wirklich ein so ordentliches Kind?«
Ich hatte die Anwesenheit des blassen Chamäleons vollkommen ausgeblendet und zuckte beim Klang seiner Stimme unwillkürlich in der Sitzkuhle seines Sofas zusammen. So intensiv hatte ich schon lange nicht mehr an meine Kindheit gedacht.
Es war unsere zweite Sitzung und bisher fühlte sich das Ganze eher an wie ein gemütliches Kaffeekränzchen ohne Kaffee als eine professionelle Therapie.
»Ich mag es gern ordentlich«, bestätigte ich. »Wer Ordnung hält, verschwendet neunzig Prozent weniger Zeit mit suchen.«
Für den Bruchteil einer Sekunde meinte ich, in Max Müllers Augen ein belustigtes Funkeln wahrzunehmen. Etwas pikiert setzte ich mich auf der beigefarbenen Couch auf. Lachte der mich etwa aus?
»Was ist denn so schlimm am Suchen?«
»Was ist denn so schlimm am Ordnunghalten?«, konterte ich kampflustig.
»Nichts«, sagte der Psychotherapeut ruhig, »es klingt nur nicht gerade nach Spaß. Schon gar nicht für ein kleines Kind.«
»Oh, ich hatte Spaß!«, erboste ich mich. »Jede Menge! Pausenlos hatte ich Spaß! Da machen Sie sich mal keine Sorgen!«
Okay, das klang jetzt selbst in meinen Ohren etwas übertrieben. Warum hatte ich bloß das Gefühl, diesem komischen Schnösel etwas beweisen zu müssen?
»Das freut mich«, erwiderte er mit einem ungebührlichen Grinsen.
Ich glaubte ihm kein Wort. »Soll ich jetzt weitererzählen?«
»Gern. Erzählen Sie mir mehr. Was hat der kleinen Erika Spaß gemacht?«
Als ich fast fünf war, kam ich den Kindergarten. Mama wollte wieder arbeiten gehen.
»31,1 Prozent der Frauen sind heutzutage erwerbstätig«, erklärte sie mir. »Also fast alle!«
Ich war beeindruckt. Auch wenn ich nicht wusste, was »erwerbstätig« hieß: Wenn es so viele Frauen im Land machten, war es bestimmt etwas Gutes.
Darüber hinaus waren meine Eltern der Meinung, ich müsse auch mal andere Kinder als Sabine treffen – zumal die Beziehung zu meiner Schwester spätestens seit dem Mikado-Desaster eher frostig war. Ihren Freunden aus der Nachbarschaft erzählte Sabine immer, sie sei ein Einzelkind. Das sagte wohl alles.
Ich hatte mich zu Hause bisher sehr wohlgefühlt und nicht den Eindruck, dass in meinem Leben etwas fehlte, aber Mama und Papa sahen das anders. Genau genommen sah Mama das anders und Papa pflichtete ihr bei, um das Thema schnell abhaken zu können.
Als die Sommerferien vorbei waren und der Kindergarten losging, wurde ich krank. Der Arzt sagte, ich sei einfach erkältet. Mama meinte, es wäre ganz sicher eine handfeste Laryngitis und der Arzt ein Idiot. Papa nannte es Würfelhusten. Auf jeden Fall musste ich das Bett hüten und durfte erst in den Kindergarten gehen, als alle drei mich für geheilt hielten. So kam es, dass ich zwei Wochen später als geplant an Mamas Hand die nahe gelegene Kita erkundete – und mich plötzlich ohne Mamas Hand inmitten fremder Kinder zwischen Bergen an Spielsachen wiederfand.
Alle außer mir kannten sich bereits. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich unglaublich einsam. Unvermittelt dachte ich an Mama und meinen missglückten Fahrrad-Stunt vom vergangenen Wochenende. Ich hatte mir ordentlich das Knie aufgeschlagen und war schluchzend in Mamas Arme gesunken, während Sabine lässig meinen verbogenen Fahrradlenker gerichtet und ein spontan selbst komponiertes Lied über kleine Heulsusen gesungen hatte.
»Jeder Mensch weint in seinem Leben rund achtzig Liter Tränen«, hatte meine Mutter mich getröstet. »Das ist keine Schande!«
Ich hatte gerade entschieden, dass der erste Tag im Kindergarten ein würdiger Anlass war, um ein paar Milliliter kostbare Tränenflüssigkeit zu investieren. Da setzte sich ein großes, schlaksiges Mädchen zu mir, das sich als Christine vorstellte.
»Ich kenne dich!«, sagte sie bestimmt. »Du bist Kerstin. Ihr wohnt neben dem Spielplatz. Euer Hund kackt immer in den Sandkasten, sagt mein Papa.«
»Wir haben keinen Hund.« Dass ich außerdem nicht Kerstin hieß und nicht neben dem Spielplatz wohnte, vergaß ich vor lauter Aufregung zu erwähnen.
»Natürlich!«, widersprach Christine. »Ich seh euch doch immer.«
Ein winziges Mädchen mit rotblonden Zöpfen gesellte sich zu uns, bevor ich zu einer Erwiderung ansetzen konnte. Ihr kleines Gesicht mit dem etwas verhuscht wirkenden Blick wurde fast vollkommen von einer riesigen Hornbrille verdeckt, mit der sie aussah wie Puck, die Stubenfliege. Ich war ein großer Fan von Biene Maja und ihren Freunden und lächelte entzückt.
»Das ist Kerstin«, stellte Christine mich vor. »Sie wohnt neben dem Spielplatz.«
Puck warf mir einen scheuen Blick zu und machte einem dicken Jungen Platz, der sich etwas unsanft auf die Bank neben mir drängte.
»Kerstin ist neu hier«, klärte Christine ihn auf.
»Nö. Die war letzte Woche auch schon hier. Ich kenne die«, behauptete das Pummelchen und zog weiter, um Puck von der nächsten Bank am anderen Ende des Zimmers zu vertreiben.
Ich war also Kerstin, wohnte neben dem Spielplatz und hatte einen Hund, der in Sandkästen kackte. Von mir aus, dachte ich schicksalsergeben und machte mir nicht die Mühe, das Missverständnis aufzuklären. Viel wichtiger war schließlich, dass ich eine Freundin gefunden hatte – und die wollte ich um nichts in der Welt vor den Kopf stoßen.
Christine und ich verstanden uns prächtig. Wir bastelten und malten, machten das Piratenschiff im Garten unsicher und hielten uns gegenseitig das Pummelchen vom Leib, das sich schnell zu einer echten Plage entpuppte. Mama hatte recht gehabt: Es war eine völlig neue, angenehme Erfahrung für mich, nicht immer nur mit Sabine zusammen zu sein.
»Hast du Lust, Verstecken zu spielen?«, fragte Christine nach einer Weile.
Argwöhnisch starrte ich meine neue Spielgefährtin an. Sabine fragte nie, ob ich Lust auf irgendetwas hatte. Vor allem aber hatte ich gerade vor einigen Tagen äußerst schlechte Erfahrungen mit dem Versteckspiel gemacht. Alles hatte ganz harmlos angefangen.
»Los, du versteckst dich!«, hatte meine Schwester befohlen.
Gehorsam war ich davongeflitzt und hatte mich für ein innovatives Versteck hinter dem Sofa entschieden. Dort hatte ich aufgeregt auf Sabines Schritte gelauscht und inständig gehofft, dass sie mich nicht allzu schnell entdecken würde. Alles blieb still. Ich beglückwünschte mich innerlich zu meinem grandiosen Versteck. Die Minuten vergingen. Langsam wurde es langweilig. Vielleicht war mein Versteck auch einfach zu schwierig. Doch wo war Sabine überhaupt? Hätte ich sie nicht wenigstens hören müssen? Tapfer verharrte ich hinter der Couch und wünschte mir nun doch, dass sie mich bald finden würde. Als ich endlich Schritte hörte, streckte ich erleichtert meine steifen Glieder und machte mich auf meine Entdeckung gefasst.
»Erika? Wo bist du denn?«, rief meine Mutter. Sie klang verwundert.
»Hier«, sagte ich und schälte mich aus meinem Versteck.
»Was machst du denn hinter dem Sofa?«
»Wir haben Verstecken gespielt. Aber Sabine hat mich nicht gefunden.«