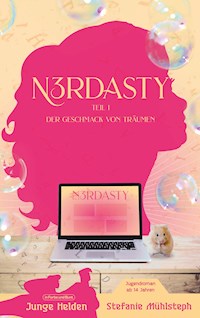Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Mechatronik die richtige Entscheidung war? Schon im Vorkurs zweifelt Sophie an ihrer Studienentscheidung. Da taucht ausgerechnet ihre erste große Liebe Kostja auf und wirbelt ihre wohl geordneten Gefühle kräftig durcheinander. Doch der junge Mann, den sie einmal so gut kannte, hat sich verändert und Sophie weiß nicht, wen sie retten soll: Sich selbst vor dem Chaos in ihrem Leben oder Kostja vor der Dunkelheit in seinem Herzen. Ein bittersüßer Liebesroman über verliebte Studenten, chaotische Universitäten und Nerds.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2018 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
Covergestaltung:
Lektorat:
Korrektorat:
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-95869-
Besuchen Sie unsere Webseite:
amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Liebe ist wie ein Glas, das zerbricht, wenn manes zu unsicher oder zu fest anfasst.(Russisches Sprichwort)
Inhalt
Intro: Liebe beginnt mit den Augen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Outro: Dem Herzen kannst du nichts befehlen
Ergänzung
E-Techniker-Ode
»Sophie, hast du Hausaufgaben gemacht?«, fragte Elli. Sie sah mich nicht an, sondern durch mich hindurch. Ich konnte es genau sehen. Ihre Augen fixierten nicht mich, sondern irgendeinen imaginären Punkt hinter mir.
Ich schob ihr den Ordner als Antwort entgegen. Ohne ein Dankeswort verschwand sie mit den Unterlagen. Manchmal fragte ich mich, warum ich das tat. Warum ich nicht einfach Nein sagen konnte.
Mein Kopf fühlte sich plötzlich zu bleiern an, um ihn noch eigenständig halten zu können. Die Schwerkraft riss ihn auf den Tisch. Die Platte kühlte meine Wange und verdrängte das Gefühl, weinen zu müssen. Das Quietschen von Sohlen und Schaben von über den Boden gezogenen Stühlen drang an meine Ohren.
Alle zog es aus dem Klassenzimmer nach draußen, um die ersten Sonnenstrahlen des Jahres auf den Bänken im Innenhof zu genießen. Ich blickte ihnen nicht nach.
Die Sehnsucht, dazuzugehören, war schon vor langer Zeit gestorben – und doch schmerzte es, alleine zu sein. Freundschaft ließ sich auf viele Weisen auslegen. Keine davon, die ich erwartet hatte, fühlte sich innig oder wahrhaftig an. Damals, als sich eine meiner selbst ernannten besten Freundinnen versteckte, um nicht mit mir zusammen gesehen zu werden, lernte ich viel über das Wörtchen Freundschaft.
Und dass Mädchen grausam sein konnten.
»Sophie?«
Ich drehte meinen Kopf auf die andere Seite, ohne ihn groß anzuheben, und blickte in tiefschwarze Augen mit langen Wimpern.
Kostja war mir so nahe, dass ich die braunen Punkte rund um seine Iris sehen konnte. Hitze stieg prickelnd meine Ohren empor.
Die Welt war schlagartig still geworden.
Sein ungebändigtes, dunkelbraunes Haar fiel ihm in die Augen. »Alles gut, Copoka?«
Elster. So nannte er mich schon, seit wir dieselbe Klasse besuchten. Manchmal fragte ich mich, warum er sich mit mir abgab.
Ich schenkte ihm ein Lächeln. »Willst du nicht auch raus?«, beantwortete ich seine Frage mit einer Gegenfrage. Ich blieb ihm lieber eine Antwort schuldig, als der dunklen Traurigkeit in meinem Inneren auch noch eine Stimme zu verleihen.
Er machte keine Anstalten, sich von mir zu entfernen. »Nur, wenn du mit mir kommst.«
Mein Herz raste. Es würde mich nicht wundern, wenn er es hören konnte. »Deine Freunde warten bestimmt«, sagte ich.
»Dann lass sie nicht noch länger warten«, erwiderte Kostja.
Ich schlug die Augen nieder, um meinen Kampf mit den Tränen zu verstecken.
Wenn er sprach, ließ er mich alles vergessen. Ein Blick aus seinen wunderschönen Rabenaugen und in meinem Herzen ging die Sonne auf. Gleichzeitig schmerzte mich seine Nähe. Weil ich Angst hatte. Angst um ihn und was die Anderen von ihm dachten.
Ich fürchtete mich davor, dass sie ihn eines Tages ausgrenzten. Dass sie ihm das stahlen, was ich so bewunderte. Ich wollte ihn aber auch nicht verlieren oder von mir stoßen.
Ich war egoistisch, was Kostja betraf, das wusste ich. Doch etwas daran zu ändern kam für mich nie in Frage. Dafür liebte ich es zu sehr, ihn um mich zu haben, sein Lachen, den Glanz seiner dunklen Augen, das wirre Haar und die Grübchen um sein Kinn.
Ich liebte ihn und konnte und wollte nichts dagegen unternehmen.
»Auf deine Verantwortung, Kruk.«
Kostja sprang auf, grinste mich an und reichte mir seine Hand. »Die übernehme ich gerne.«
Es war der Schultag, an dem ich Kostja das letzte Mal sah.
This is the Story of a man who will forever be my love,
If I imagine him – I fly up – to the stars above.
(Bine* - Loverboy)
I’m hooked on a feeling dröhnte aus dem Zimmer meiner Mitbewohnerin, während ich die letzten Kisten auspackte und zusammenfaltete, meine wenigen Bücher in zu kleine Regale stapelte und Klamotten wahllos in den schlanken, viel zu hohen Einbauschrank warf.
Stilistisch erinnerte die Einrichtung an eine Militärkaserne und die Dicke der Mauern an asiatische Papierwände. Ich hoffte inständig, dass Mia nicht jede Nacht derart geräuschvoll mit ihrem Freund über Skype Sex hatte.
Ein unheilverkündender Geruch stieg mir in die Nase. Mia braute etwas zusammen – denn kochen konnte man ihre kulinarischen Künste nicht nennen.
Meine Mitbewohnerin, Mia, selbst hatte schon während meines Vorstellungsgesprächs zugegeben, dass sie den Begriff kochen weit auslegte; deswegen müsse man sich an bestimmte Düfte gewöhnen. Aber ‚Nudeln machen‘ konnte sie, auch wenn sie sehr kompakt aneinander klebten – was natürlich Absicht war. Als Student müsse man schließlich mit seiner Zeit gut wirtschaften und könne nicht den ganzen Garungsprozess über am Herd stehen – so Mias logische Begründungen für verkrustete Töpfe und angebrannte Pfannen.
Student. Dieser Ausdruck löste immer noch ein wohliges Gefühl in mir aus. Für mich war es nicht einfach ein Wort oder eine Bezeichnung. Es bedeutete Freiheit. Die Chance auf einen Neuanfang.
Ich sank auf das Bett und blickte aus dem Fenster. Es war Ende September, der Herbst hatte die Blätter der Bäume mit gelbroten Lippen geküsst und die Sonne brach am Himmel durch ein Meer aus weiß schäumenden Wolken hindurch.
In mir war es still geworden. Keine schmerzlichen Gefühle drängten sich mehr in meinen Kopf, keine ängstlichen Gedanken in mein Herz. Ich war nicht mehr das Mädchen, das Mutlosigkeit im Herzen trug, sondern endlich ganz und heil.
»Sophie, ich bin feddisch!«, brüllte Mia mit ihrem liebreizenden hessischen Akzent, von dem ich weniger verstand als ich sollte.
»Bin unterwegs.«
Ich klappte mein Laptop zu und durchquerte den Raum mit weniger als zwei Schritten. Kurz blickte ich über meine Schulter ins Zimmer zurück. Mein Zimmer. Unabhängigkeit fing immer klein an; und bei mir mit diesen winzigen zehn Quadratmetern.
Ich hopste die Stufen zum Gemeinschaftsraum hoch und blickte auf einen Tisch, bestückt mit Parmesan, Pesto und dampfenden Nudeln.
Mia saß schon mit Teller und Gabel bewaffnet auf einem Stuhl und schaufelte sich einen Batzen Nudelmasse drauf.
»Du musst sie bloß gut mit dem Pesto mischen, dann trennen sie sich von alleine.« Sie grinste mich an und deutete mit einem Nicken auf den Herd. »Und danach gibt es Pudding mit extra vielen Schokoklumpen, damit man auch etwas zum Kauen hat.«
»Danke«, sagte ich und schenkte ihr ein Lächeln. Egal wie schlecht sie kochen konnte, Mia hatte das Herz am rechten Fleck.
Zusammen tauchten wir in eine andächtige Futterstille.
Die kräftigen Stimmen von Marvin Gaye und Tammi Terrell schallten mit ‘Cause baby, there ain‘t no mountain high enough durch die Wohnung.
Seit ich hier wohnte – also drei Tage – füllte Mia die Stille der WG mit Liedern aus den Siebzigern. Wenn sie keine Dreads und Haufen an Highheels gehabt hätte, hätte ich darauf wetten können, dass sie Schlaghosen und Kleider mit grellen Farben und psychedelischen Mustern im Schrank versteckte ... was sie vielleicht auch tat. Denn Dreads und Highheels passten auch nicht unbedingt zusammen.
Ich schnappte mir einen Teller aus dem Regal, fischte eine frisch gespülte Gabel aus der Spülmaschine und setzte mich zu Mia. Es war das erste Mal seit meinem Abitur, dass ich mich nicht fremd oder unwillkommen fühlte. Mia hatte schließlich mich unter allen Bewerbern ausgewählt; und ich war mir sicher, dass wir Freunde werden konnten. Mia würde es nicht bereuen, sich für mich entschieden zu haben – das schwor ich mir.
Im Grunde gäbe es in der WG noch Platz für zwei weitere Mitbewohner. Diese Zimmer waren allerdings Erasmus-Studenten vorbehalten und standen – zumindest dieses Semester – leer. Damit genossen Mia und ich den Luxus, dass jede von uns alleine ein eigenes winziges Bad nutzen konnte und wir uns auch alleine auf dem Halbstockwerk befanden – was nicht mit Ruhe gleichzusetzen war.
»Wo bringst du dein anderes Gelärsch eigentlich unter?«
Ich brauchte einen Moment, bis ich wusste, was sie meinte. Dann blickte ich zum Couchtisch. Das Terrarium nahm die komplette Fläche ein. »In meinem Zimmer.«
Mia starrte mich aus ihren großen, grünen Augen an. »Das Ding ist mindestens einen Meter lang. Wo willst du das hinstellen?«
»Es ist sogar genau einen Meter lang«, gab ich stolz zur Antwort. »Schildkröten brauchen viel Platz. Und am Fußende des Bettes sollte sich Frau Schmidt wohlfühlen.«
»So verbaust du die Schrankschubladen.«
Ich machte eine wegwerfende Geste. »Ich besitze nicht einmal so viele Klamotten, um den Schrank voll zu bekommen.«
»So Probleme hätte ich gerne.« Mias Worte gingen in einem Seufzer unter. »Und deine Frau Schmidt«, sie zwinkerte mir zu, »ist nach ihrer Größe wohl eher noch ein Fräulein oder Schmidti.«
Wie auf Kommando drang ein hohes Fauchen aus dem Terrarium.
»Das sieht Frau Schmidt wohl anders.«
Bei meinem Einzug wurde mir schon gesagt, dass der Karlshof sehr speziell sei. Legendäre Partys wurden hier geschmissen, die Fassaden mit Kletterseilen bezwungen, Swimmingpools zwischen den Wohngemeinschaften gebaut und sogar die Polizei soll des Öfteren mitfeiern. So ganz konnte ich das allerdings nicht glauben.
Dass der Karlshof und seine Bewohner etwas bizarr waren, konnte ich jedoch guten Gewissens bestätigen. Noch vor meiner ersten Nacht dort klopften mir völlig fremde Menschen an die Wohnungstür zur WG – splitterfasernackt.
Auch das Aussehen des Karlshofs war einzigartig und kaum vergleichbar mit anderen Wohnheimen in Darmstadt. Die Wohngemeinschaften erreichte man über Laubengänge, fassadenbreite Balkons, die wie das Skelett des Gebäudes aussahen - als habe man es von innen nach außen gekehrt. Die WGs besaßen stattliche Fenster, die einen tiefen Einblick in die Wohnungen boten. Anonymität suchte man hier vergebens. Mia erzählte mir von dem lockeren Austausch mit den Nachbarn, die unangekündigt immer mal vorbeikamen. Mit über 950 Zimmern und Menschen war man im Karlshof nie wirklich alleine.
Die Wohngemeinschaften teilten sich über eineinhalb Geschosse auf. Wenn man eine Wohnung durch die gläserne Tür betrat, stand man gleich im Aufenthaltsraum, der Küche und Wohnzimmer gleichermaßen war. Von dort aus führten Treppen jeweils eine halbe Etage hinauf oder herunter zu immer zwei Zimmern und einem Bad.
Unten wohnte ich und oben, direkt über meinem Zimmer, Mia.
Durch die Bezeichnungen der Wohnblöcke hatte ich immer noch nicht durchgeblickt. Es gab insgesamt fünf Häuser, diese wurden die in Haus Sechs, Acht und Zehn unterteilt, welche wiederum Buchstaben besaßen.
Einprägsamer wären Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff oder Gryffindor, wobei die grundlegende Verteilung nicht vom sprechenden Hut unternommen wurde, sondern von der Wohnheimverwaltung – was allerdings nicht weniger magisch und diffus war.
Der Karlshof war gleichermaßen befremdend und berauschend. Eine eigene, kleine Welt voller Studenten und schräger Vögel.
Nach dem Essen verließ ich Mia, Frau Schmidt und mein neues Zuhause und machte mich auf dem Weg zu Yema, meiner ersten und einzigen Freundin, die ich während der Oberstufe hatte.
Yemas Wohngemeinschaft befand sich im Gebäude 8A und lag meiner WG fast gegenüber – auf der anderen Seite des Hofs.
Mein Blick ging Richtung Frankfurt. Vom Balkon aus konnte ich bei gutem Wetter bis nach Mainhatten sehen und die unzähligen Hochhäuser betrachten, die sich vor dem Horizont erhoben.
Das Abendlicht tauchte die Metropole in einen rotgoldenen Glanz und verschmolz die Spitzen der Hochhäuser zu Zinnen und Türmen eines gigantischen Märchenschlosses.
Der Knall einer zugeschmissenen Tür riss mich aus meiner Trance. Erschrocken fuhr ich herum.
Mit großen Schritten eilte der Unruhestifter davon, die Hände lässig in die knielange Cargohose versenkt. Das dunkelbraune Haar stand wild nach allen Seiten ab.
Der lockere Spruch blieb mir im Halse stecken, mein Mund wurde trocken.
Das konnte nicht sein!
Nur er bewegte sich so.
Nur er trug sein Haar so unordentlich.
Der Unruhestifter bog zum Treppenhaus ab und verschwand aus meinem Blickfeld. Sein Gesicht war mir verborgen geblieben.
»Kostja«, entkam es meinen Lippen, ohne auch nur an seinen Namen gedacht zu haben.
Mein Körper bewegte sich, setzte einen Fuß vor den anderen. Schneller. Immer schneller. Bis ich rannte.
Die WGs flogen an mir vorbei.
Ich bog zum Fahrstuhl ab und konnte gerade noch sehen, wie sich die Türen schlossen.
Ich drückte heftig auf die Knöpfe des Aufzugs und schlug mit der flachen Hand auf die blinkenden Lichter, als sich endlich mein Hirn zu Wort meldete.
Was tat ich hier überhaupt?
Meine Hand stoppte in der Luft.
Das konnte nicht Kostja sein. Kostja war spurlos verschwunden, ohne einen Hinweis wohin. Ich hatte ihn angerufen, SMS und E-Mails geschickt. Nie erhielt ich eine Antwort. Es war ganz und gar absurd, dass er dieser Kerl war.
Ich ließ die Hand sinken.
Wenn er es wirklich war, was sollte ich sagen? Drei Jahre waren seit unserer letzten Begegnung vergangen. Er hatte mit Sicherheit ein anderes Leben, erinnerte sich vielleicht nicht mal mehr an mich.
Und falls er sich doch erinnert?, fragte mein Herz. Was dann?
Die Zeit war nicht stehen geblieben.
Ich schüttelte heftig den Kopf und damit alle Gedanken beiseite. Ich hatte mir etwas geschworen, als ich den Immatrikulationsbogen ausgefüllt hatte. Und jetzt war nicht die Zeit, wieder zu zweifeln, in meine alte Passivität zu verfallen und einfach den Kopf in den Sand zu stecken.
Niemals mehr.
Ich musste wissen, ob dieser Kerl mein Kostja war!
»Niemals mehr!«, stieß ich aus.
»Was, niemals mehr?«
Erschrocken fuhr ich herum und starrte einen rotblonden Kerl mit R2-D2-Shirt und Fleshtunnel im Ohr an.
»Die Alte sein«, antwortete ich überrascht.
»Du meinst, mehr wie Rose Tyler?« Er deutete auf mein Doctor Who-Top.
Ein Lächeln zuckte über meine Lippen. »I am the Bad Wolf. I create myself.«
Entschlossen legte ich die Hand auf das Geländer des Treppenhauses, nickte dem R2-D2-Typen zu, und rannte die Treppen hinab – dem Aufzug hinterher.
Ich nahm zwei Stufen auf einmal, sprang auf die Zwischenetagen und hetzte weiter. Meine Hand führte mich an der Brüstung entlang und bewahrte mich mehr als einmal davor, über meine eigenen Füße zu fallen.
Blut rauschte in meinen Ohren, die Lunge ächzte.
Ich hielt in einer Etage, doch der Aufzug sauste weiter.
Fuck! Der Aufzug würde deutlich vor mir unten sein – wo auch immer er hin wollte. Ich schnappte nach Luft und ignorierte meine schlackernden Knie. Meine WG in der dreizehnten Etage kam mir plötzlich nicht mehr hochromantisch vor.
Ich jagte weiter die Treppen hinunter und schnaufte wie eine verstopfte Dampflok. Wann war ich bloß so unsportlich geworden?
Mit letzter Kraft erreichte ich den Hof. Ein Schwall aus mir bekannten und unbekannten Sprachen verstopfte meine Ohren. Zwischen Bäumen wurden Fahrräder abgeschlossen, Tischtennis und Volleyball auf aufgeschüttetem Sand gespielt, Menschen jonglierten mit Diabolos, Devilsticks und einige übten sogar mit Schweif-Pois.
Es war ein Rummel an Menschen, die die letzten warmen Tage ausnutzten.
Ich stützte mich an der nächstbesten Wand ab, versuchte mit meinem rasselnden Atem keinen Tornado zu erzeugen und blickte mich um. Doch da war nichts. Niemand, der wie Kostja aussah – nicht einmal ansatzweise.
Frust nagte an mir. Wie konnte ich ihn entwischen lassen? Jetzt würde ich niemals erfahren, ob es tatsächlich Kostja gewesen war.
Aber immerhin hatte ich es versucht, beschwichtigte mich meine innere Stimme. Ich hatte gehandelt. Im letzten April noch wäre ich dazu nicht fähig gewesen. Ich wäre erstarrt und hätte diesen Augenblick einfach vorüberziehen lassen und mir hinterher zermürbende Fragen gestellt. Ein bisschen stolz war ich auf meine neue Einstellung, mein neues Ich.
Dennoch ... Der Gedanke an Kostja ließ meine Seele brennen. Nicht einmal einer meiner Ex-Freunde hatte mich so berührt wie er. Ich hätte Kostja so viel zu sagen. Dinge, die ich während unserer Schulzeit nicht einmal denken wollte. Dinge, die mein Herz belasteten und mich niemals los ließen, diese Gefühle und Gedanken nicht vergessen lassen konnten. Mein Abschluss fehlte.
»Blödsinn!« Ich schlug mir mit einer Handfläche auf die Wangen. Ich hatte mir selbst versprochen, nicht in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Das Leben fand hier und jetzt statt und ich würde diese Zeit genießen – mit allen Sinnen.
Mit einem Ruck stieß ich mich von der Wand ab. Schwarze und weiße Punkte tanzten vor meinen Augen. Trotzig ignorierte ich das meine ächzenden Muskeln und wankte auf das Gebäude zu, in dem sich Yemas WG befand.
Sportlich gesehen hatte ich definitiv noch Luft nach oben.
»Du siehst aus wie eine gekochte Languste«, sagte Yema, während ich erschöpft auf ihr Bett fiel.
»Und dein Zimmer, als hätte eine Bombe eingeschlagen.« Damit hatte ich nicht einmal übertrieben.
Auf dem Schreibtisch türmten sich Kabel über Laptop, Dockingstation und Bildschirm; Klamotten hingen aus dem vollgestopften Schrank heraus und auf dem Teppich lag ein Mix aus Büchern, Zeitschriften, DVDs und ... Tangas?
»Meine Kreativität braucht Chaos«, erklärte Yema und schob mit dem Fuß ihre Schlüpfer unter einen Stapel von veralteten Spiegel NEON-Ausgaben.
»Ich dachte immer, Asiaten seien ordentlich«, bemerkte ich in einem provokativen Tonfall.
Yema streckte mir die Zunge raus. »Ihr Weißwurstliebhaber schmeißt auch alle Menschen aus Fernost in den gleichen Topf, was?«
Ich stützte mich mit den Ellenbogen auf ein paar Bücher über 5€-Rezepte und Uni-Survival-Guides ab. Yema stand vor ihrem Schreibtisch und malte mit gekonnten Pinselstrichen ihren Lieblingsspruch an die Wand: There Are No Dreams That Should Be Laughed At.
Sie hatte diese Eleganz an sich, die nur asiatische Frauen besaßen. Ich beneidete sie dafür. Yema hingegen lehnte ihre chinesischen Wurzeln auf das heftigste ab. Der Grund dafür waren ihre Großeltern, die ihr immer wieder einzutrichtern versuchten, wie ein gutes Mädchen - nach ihrer Meinung - sein musste. Bescheiden, hübsch anzusehen und vor allem sollte sie den Mund halten. Yema brach zwar nicht den Kontakt zu ihnen ab, aber sie wurde zu einer Rebellin.
Ich lächelte. »Du bist kein Mensch aus Fernost, du kannst nicht einmal Chinesisch.«
Sie drehte sich zu mir um und rümpfte gespielt verschnupft ihre Stubsnase. »Es heißt Mandarin und ich besitze wirklich nicht die Zungenfertigkeit, um vier verschiedene Tonarten zu erzeugen. Aber Arschloch kann ich auf jeder Sprache sagen, sogar auf Mandarin.«
Mit dem Ärmelsaum ihres viel zu langen Karohemdes putzte sie die Farbe von den Pinselborsten, stopfte ihn in eine Stiftebox und setzte sich auf den Bürostuhl. »Ich wäre lieber mit dir in einer Wohngemeinschaft«, seufzte sie und legte den Kopf in den Nacken. »Meine Mitbewohner sind ... eigenartig.«
»Mia ist eigenartig, deine Mitbewohner sind bloß menschenscheu«, gab ich zurück. »Und wir sind ja nicht weit voneinander entfernt. Wir wohnen fast in einer WG.«
»Einer riesigen WG mit Verrückten«, fügte Yema hinzu.
Sie schaufelte mit dem Fuß ein paar Zeitschriften zur Seite und rollte mit dem Stuhl zu mir. »Willst du mir jetzt endlich verraten, warum du so außer Puste warst?«
»Ich bin die Treppe runter gerannt.« Keine Lüge.
Yema zog eine Augenbraue hoch. »Und warum rennt die unsportlichste Person, die ich kenne, von der dreizehnten Etage bis ins Erdgeschoss, wenn der Aufzug einwandfrei funktioniert?«
»Ey!«, stieß ich verletzt aus. »Jetzt werde mal nicht persönlich, ich streue dir auch kein Salz in die Wunde, dass du kein Eis essen oder Kakao trinken kannst.«
»Du versuchst, abzulenken«, sagte Yema. Ihr angestrengter Gesichtsausdruck sagte mir, dass es für mich als Ausweg nur noch der Sprung aus dem Fenster gab. »Hör auf dich zu winden und spuck es aus.«
Mein Herz machte einen Satz. Aus dieser Geschichte kam ich nicht mehr raus. Yema würde so lange bohren, bis sie ihre Antwort bekam. Aber wie konnte ich das nur beschreiben? »Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen.«
Yema beugte sich zu mir. Ihre Mandelaugen zeigten Sorge. »War es jemand aus der Schule?«
Ich knirschte mit den Zähnen. »Gewissermaßen.«
»Wen?«
»Konstantin Sorokin.« Sein Name hatte den Geschmack von Zartbitterschokolade.
»Ah!«, sie sank gegen die Stuhllehne. »Ich erinnere mich an ihn.« Yema legte einen Finger an die schmalen Lippen. »Er war ein netter Kerl, weich, freundlich ... und erinnerte mich immer so ein bisschen an ein Mädchen.«
Ich rollte mit den Augen. Das war typisch. Ein empathischer Elefant im Porzellanladen.
»Ja, schon gut«, beschwichtigte sie schnell. »Ich weiß, dass du ihn mochtest.« Sie kräuselte die Stirn. »Und du bist dir sicher, dass er es war? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er einfach die Schule verlassen und niemand hat mehr etwas von ihm gesehen oder gehört. Als sei er vom Erdboden verschluckt worden.«
»Ich kann dir nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er es war ... ich habe ihn nicht mehr erwischt.«
Yema zuckte mit den Schultern. »Dann beim nächsten Mal.« Mit dem Fuß kehrte sie ein paar DVDs unter das Bett und beförderte Schokoriegel zu Tage. »Wenn er wirklich hier wohnt, wirst du ihn bestimmt wiedersehen.«
»Außer er war wirklich ein Geist«, seufzte ich tonlos.
Enttäuschung schnürte mir den Magen zusammen. Vielleicht hatte ich meine einzige Chance, Kostja je wiederzusehen, doch vertan.
»Oh Baby, ich vermisse dich so sehr!«
Obwohl die Tür geschlossen war und ein halbes Stockwerk zwischen uns lag, konnte ich Mia so gut hören, als befände sie sich im Nebenraum.
»Willst du dein Shirt für mich ausziehen? Dann kriegst du auch meine Titties zu sehen ...«
Nicht schon wieder!
Ich schnappte nach meinem Smartphone, stopfte mir die In-Ears in die Ohren, schaltete Spotify ein und drehte die Lautstärke auf, bis die Lautstärkebegrenzung mich stoppte. Noch eine Nacht konnte und wollte ich diese liebestolle Geräuschkulisse nicht ertragen.
Ich zog meine Beine an, rollte mich auf die Seite und schloss die Augen. Musik hüllte mein Bewusstsein ein. Musik und die Gefühle, die ich mit ihr verband.
Hedwig’s Theme von John Williams wurde eingespielt und Erinnerungen tauchten vor meinem inneren Auge auf. Kostja hatte Harry Potter geliebt, daran konnte ich mich noch gut erinnern.
2007 hatten wir uns vor Sonnenaufgang vor einem Buchladen getroffen, um eines der ersten Exemplare von Die Heiligtümer des Todes zu ergattern. Kostjas strahlende Rabenaugen und aufgeregte Erzählungen waren bis heute eine meiner wertvollsten Erinnerungen. Es bedeutete mir viel, meinen Rausch mit ihm zu teilen und zu spüren, dass er ebenso für Bücher brannte.
Es erinnerte mich daran, wie wir uns begegnet waren.
Die unendliche Geschichte war und wird immer eines meiner liebsten Bücher sein. Der Einband sah geliebt aus und die Seiten vergilbt. Es roch nach mehr als Druckerschwärze und Papier; es duftete nach Abenteuern. Bei dem Buch handelte es sich um eine illustrierte Ausgabe von 1979, die ich von meiner Oma kurz vor ihrem Tod geschenkt bekommen hatte. Ein Familienerbstück.
Es war ein verregneter Sommer, nachdem die Schule sogar noch abstoßender war als sonst – und das nicht nur, weil meine Oma gestorben war.
Atréju spendete mir Kraft, während ich mir eher wie der kleine, dickliche Bastian vorkam, der sich vor der Welt zu verstecken versuchte.
Jede Zeile von Die Unendliche Geschichte war wichtig für mich; sie erinnerte mich an meine Oma. Zu jener Zeit wie auch jetzt fürchtete ich mich nicht vor Schmerzen oder vor dem Unbekannten ... Ich hatte vielmehr Sorge, zu vergessen. Wie das Nichts, das Phantásien und all seine Bewohner verschlingt. Ich hatte Furcht davor die Menschen aus meinem Herzen zu verlieren, die mir lieb und teuer waren. Gesten, Erinnerungen, Düfte, Gefühle - alles war wichtig.
So nahm ich damals das Buch auch mit in die Schule. Ich konnte mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich an der Bushaltestelle gestanden und dem immer stärker werden Regen zugesehen hatte. Als ich in meinen Rucksack griff, bekam ich den Schock meines Lebens: das Buch war weg. Das flaue Gefühl im Magen war mir bis heute immer noch präsent.
Ich hatte unendliche Angst um mein Buch und rannte zurück zur Schule, wo ich es vermutete. Grausame Bilder drängten sich vor mein inneres Auge.
Als ich ankam, zerging ich vor Tränen. Aufgelöst rannte ich ins Klassenzimmer, durchsuchte es ... und fand das Buch nicht. Dann rollte ich mich auf dem Boden zusammen und weine. Ich schluchzte laut und bat meine Oma um Verzeihung.
„Du suchst das hier, oder?“ An Kostjas Stimme konnte ich mich noch erinnern, als sei seitdem keine Sekunde vergangen. „Du musst nicht weinen, ihm ist nichts passiert.“
Er strich mir über das klamme Haar und schob mir das Buch zwischen die Finger. Erst dann fand ich den Mut, ihn anzublicken. Das Buch drückte ich gegen meine Brust, als bestünde die Chance, es darin zu versenken und vor der Welt in Sicherheit zu bringen.
Kostja verstand meinen Blick. „Das Buch sieht geliebt aus“, sagte er und fuhr sich durch das Haar, als schäme er sich für seine Worte, „deswegen konnte ich es nicht einfach hier liegen lassen. Geliebte Sachen dürfen nicht einsam sein. Niemals.“
Es war der Augenblick, als ich mich in Kostja verliebte.
Memory of that – just the memory of what we had
(Bine* - A Bag full of Memories)
Sonnenstrahlen kitzelten an meiner Nase und rissen mich aus dem behaglichen Nebel des Schlafs in die harte Wirklichkeit.
A Great Big World drang aus den In-Ears.
Ich zog die Stöpsel aus meinen Ohren und wollte mir die Bettdecke über den Kopf ziehen, als mir etwas auffiel.
Sonne?
Moment mal! Um sieben Uhr dürfte die Sonne nicht scheinen, geschweige denn es derart hell sein.
Ich hob ein Lid und blickte auf die blinkenden Zahlen meines Weckers: 0:00
Entsetzen durchzuckte mich und schnürte meine brennenden Eingeweide zu einem handlichen Päckchen zusammen. Ich riss beide Augen auf. Gab es heute Nacht einen Stromausfall?
Mit zitternden Händen fischte ich das Handy unter meinem Kopfkissen hervor. 8:30 Uhr zeigte das Display.
»Scheiße!«, stieß ich aus und sprang aus dem Bett. In 30 Minuten ging der Vorkurs für Mathematik los!
Ohne Rücksicht auf Verluste und Lautstärke zog ich Klamotten aus dem Schrank; putzte mir die Zähne und zog mich an, während ich Stifte, Block und anderen Kram in meinen Rucksack feuerte - und ein Repertoire an Flüchen vor mich hinmurmelte, um meinem Ärger Luft zu machen.
Die Schuhe konnte ich auch noch im Aufzug schnüren.
Ich schmiss die Zahnbürste auf mein Bett, wischte mir mit dem Ärmel Zahnpastareste aus dem Gesicht und stürmte in einem Zustand von halb angezogen und chaotisch aus der Wohnung. Mit einem Knall fiel die Tür hinter mir ins Schloss.
Das graue Wetter und die morgendliche Kälte war nebensächlich. Was eine katastrophale Scheiße schon am ersten Tag! Hoffentlich hatte ich an die Schlüssel gedacht!
Hüpfend streifte ich mir die Socken über, den Rucksack schleifte ich hinter mir her wie ein erlegtes Tier. Die Schuhe klemmten zwischen meinen Achseln.
Mein Puls machte dem eines Hamsters ernsthafte Konkurrenz.
Fieberhaft checkte ich mit dem Handy die Verbindung. Wenn ich den Bus jetzt tatsächlich verpasst hatte, musste ich mit dem Fahrrad zur Uni fahren. Oder war es vielleicht klüger, gleich das Rad zu nehmen? Wenn ich mich anstrengte, konnte ich vor dem Bus an der Uni sein. Schweißüberströmt, aber vor dem Bus.
Jeder Ansatz eines Plans, um aus dem Wirrwarr doch noch irgendwie einen Ausweg zu finden, war chaotisch.
Warum hatte ich meinen Handy-Wecker nicht gestellt? Verdammt, warum passierte das ausgerecht jetzt?
Wie schon am Vortag schlug ich auf den Rufknopf des Aufzugs, als würde er durch brachiale Gewalt schneller kommen. Wenn die elektrischen Geräte irgendwann einen Aufstand probten, würde mich die Fraktion der Aufzüge bestimmt vor einen Kadi zerren – wenn es denn Gerichtsverhandlungen gäbe und nicht enden würde wie bei Matrix.
Der Aufzug brauchte gefühlte Stunden, bis er bei mir ankam und sich dazu herabließ, die Türen zu öffnen. Ich schlüpfte hinein, drückte auf den Knopf für das Erdgeschoss und schnürte mir die Schuhe.
Mit einem PING setzte sich der Aufzug träge in Bewegung.
Es war einer dieser Momente, in denen ich mir wünschte, ich hätte Superkräfte ... oder besser gesagt, dass mir ein Sprung aus dem dreizehnten Stock nichts ausmachte.
Ich blickte in den Spiegel und wäre am liebsten ins Bodenlose versunken. Eine leichenblasse Kreatur in verboten bunter Montur, die noch nie eine Haarbürste gesehen hatte, starrte mich an.
Gut ... Ich war also die verfilzte Katzenlady des Jahrgangs. Das hätten wir schon einmal geklärt.
Mit den Fingern versuchte ich, meine Haare zu einer annehmbaren Frisur zu bändigen – und machte es nur noch schlimmer.
Viel zu schnell war der Aufzug im Erdgeschoss. Ich ließ die Versuche, aus mir einen Menschen zu machen, bleiben und rannte aus dem Aufzug. Egal wie desolat ich aussah, ich musste pünktlich bei diesem verdammten Kurs sein! Für einen zweiten ersten Eindruck hatte ich auch noch morgen Zeit.
Eine Ahnung ließ mich plötzlich zusammenzucken, taumeln und fast stürzen. Warum fühlte ich mich so leicht? Da fehlte was!
Fahrig griff ich nach etwas auf meinem Rücken – und erwischte nur Luft. Mist, meine Tasche!
Ich bremste scharf ab und knickte beim Versuch, mich auf der Stelle um 180° zu drehen, um. Stechend bohrte sich der Schmerz in den Knöchel.
Auch das noch!
Mit zusammengebissenen Zähnen spurtete ich zurück zum Aufzug. Ich fuhr mit den Händen zwischen die Türen und konnte sie im letzten Augenblick am Schließen hindern.
Schimpfend schnappte ich meinen Rucksack und humpelte in Höchstgeschwindigkeit auf den Hof.
Das Fahrrad war nun mein letzter Ausweg.
»Cholera jasna!«, fluchte ich lauthals auf Polnisch und trat noch stärker in die Pedale des uralten Fahrrads. Verdammte Scheiße, was hatte ich mir da eingebrockt? Schlechter konnte das Studium kaum beginnen.
Der Oktoberwind fuhr in meinen viel zu dünnen Pulli und ließ mich frösteln. Ich hätte wenigstens an eine Jacke denken können.
Meine Hände waren rot und schmerzen vor Kälte. Die hupenden Autos neben mir nahm ich kaum wahr.
Ich rauschte am Hochzeitsturm vorbei und bog an der nächstgrößeren Kreuzung scharf nach rechts ab. Wie hieß das Gebäude nochmal? Hexagon. S3|11-08. Gut, dass ich gestern in weiser Voraussicht den Weg per Google-Maps nachgefahren bin. Wenigstens etwas.
Ich atmete erleichtert aus, als das große graue Gebäude mit dem Charme eines 80‘er Jahre Baus vor mir auftauchte. Noch während der Fahrt stieg ich von meinem Drahtesel ab und warf es schwungvoll dorthin, wo auch alle anderen Fahrräder lagen: Am Metallgitter mit dem großen Schild Fahrräder abstellen verboten.
Zum Abschließen war jetzt keine Zeit mehr. Aber wer klaute schon so ein altes Rad wie meins? Es war so verrostet, dass es an einem mittelschweren Wunder grenzte, dass es überhaupt noch Schrauben besaß.
»Scheißladen! Scheiß Profs! Scheiß Uni!«, hörte ich eine männliche Stimme brüllen. Vor Schreck blieb ich stehen und musterte einen Kerl in einer dreckig grauen Latzhose. Er schoss an mir vorbei wie The Flash persönlich – und auch sein hochroter Kopf hatte Ähnlichkeit mit dem Kostüm des Helden.
Was war wohl in den gefahren so über das Unigelände zu fegen? Einen guten Eindruck machte das jedenfalls nicht.
Es dauerte einen Moment, bis ich mich wieder gefangen hatte, dann stürmte ich ins Gebäude und blieb abrupt im Vorraum stehen. Ein Schauer durchfuhr mich. Wohin musste ich überhaupt?
Aufgeregte Stimmen drangen an meine Ohren und drei Kerle mit Van Dyke-Gedächtnisbart, „I won’t fix your PC“- und „21 is only half the truth“-Shirts bahnten sich ihren Weg in einen Hörsaal.
Wenn ich Lautstärke, Kleidung der Studenten und das Schild vor mit der Aufschrift „Mathe-Vorkurs“ kombinierte, konnte ich zu dem Schluss kommen, dass ich weder viel zu spät war, noch mich in einem falschen Gebäude befand.
Ich spürte einen Anflug von Erleichterung. Vielleicht war der Tag doch noch zu retten.
»Sophie?«
Ich drehte mich um und sah Yema, die ihre Hände in die Hüfte stemmte.
»Bist du in einen Farbtopf gefallen?« Sie musterte mich aus zusammengekniffenen Augen.
»Es ist echt so schlimm!?«
»Thomas Gottschalk machst du damit keine Konkurrenz, aber es ist schon sehr bunt ... für dich.« Yema runzelte die Stirn. »Und kannst du mir verraten, warum du weder auf meine Anrufe, noch auf das Klingeln an deiner Tür reagiert hast?«
»Also, das ist ... ich hatte In-Ears in den Ohren, weil Mia und ihr Freund wieder so laut waren heute Nacht«, stotterte ich vor mich hin. »Dann hat der Wecker nicht geklingelt, der Aufzug kam nicht, ich hätte fast meinen Rucksack vergessen und den Bus habe ich auch verpasst.« Wenn ich so drüber nachdachte, hatte ich die ganze Palette an Katastrophen mitgenommen, die möglich waren. Konnte man das schon einen Rekord nennen?
Yema winkte ab. »Du hast es ja noch rechtzeitig geschafft. Und was Mia angeht«, eine steile Falte bildete sich zwischen ihren Brauen. »Deren Sexleben hätte ich gerne.«
»Sagt jemand, der nichts anbrennen lässt«, setzte ich nach und erntete prompt Yemas drakonischen Dafür-wirst-du-in-der-Hölle-schmoren Blick.
»Ich meine damit eine Beziehung«, sagte Yema. »So etwas Echtes mit Liebe, Hingabe, Akzeptanz und – ganz wichtig - Humor.«
»Das wäre wirklich schön«, seufzte ich.
»Meinst du?«, sie rümpfte die Nase. »Du hattest eine Beziehung mehr als ich ... obwohl der Kerl auch zum Lachen in den Keller gegangen ist ... und ich rede jetzt nicht von seinem IQ.«
»Ich hatte drei Beziehungen«, korrigierte ich. An manche Dinge erinnerte man sich nicht gerne zurück – oder schätzte sie als Totalverlust der Zurechnungsfähigkeit ein.
»Das war Händchen halten, mehr nicht.« Yema machte ein Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Das zählt nicht als Beziehung.«
»Wie dem auch sei«, lenkte ich ein. »Hier hast du die Auswahl an Männern.«
Ungeniert deutete Yema hinter sich auf zwei schlaksige Kerle mit Call of Duty-Shirts, die auf dem Boden saßen und geistesabwesend in ihre Laptops stierten. »Die? Das ist nicht dein ernst.«
»Wenigstens sind sie nicht dumm und dümmerer.«
Yema schüttelte den Kopf und schob mich mit sanfter Gewalt Richtung Hörsaal. »Ich helfe dir, ein Niveau zu finden, das keinen Limbo tanzt.«
Ich wehrte mich nicht. Es hätte auch keinen Sinn gehabt. Wenn sich Yema etwas in den Kopf gesetzt oder eine Meinung gebildet hatte, war sie nur mit Gewalt davon abzubringen.
Der Saal war gigantisch. Die Größe des Raums und die Masse an Menschen, die darin saßen, verschlugen mir den Atem. Das Licht war künstlich kalt wie das eines Aquariums, doch es schmälerte nicht im Geringsten die Autorität, die diese vier Wände versprühten.
Beleuchtet von Spotlights stand das Pult wie eine einsame Insel im Zentrum des Hörsaals. Hinter ihm befanden sich gigantische Tafeln. Ich kannte Physikräume aus der Schule, aber das hier war mit keinem Klassenraum, den ich je gesehen hatte, zu vergleichen Es war eine völlig neue Dimension ... was sagte ich ... eine andere Welt als die Beschränktheit, die man aus der Schule kannte. Ich spürte geradezu, wie mein Hirn alle Eindrücke aufsog - und mein Intelligenzquotient stieg.
»479 Plätze«, murmelte Yema neben mir atemlos, »drahtlose Mikrofone, W-LAN, Touchpanel, fünf Projektoren und sechs gigantische Tafeln von drei Metern Länge. Das ist der größte Hörsaal, den der Fachbereich Elektrotechnik zu bieten hat. Einzigartig, oder?«
Ich nickte und ließ die Atmosphäre auf mich wirken.
»Lass uns einen Platz suchen«, sagte Yema, schnappte sich den Saum meines Pullovers und zog mich hinter sich her.
Ich musterte die dunkle Decke, Neonlichter und weiß getünchte Wände. Stimmen schwirrten umher und ich blickte in fremde Gesichter, die so aufgewühlt aussahen wie ich mich fühlte.
Und mir fiel auf, dass hier wirklich wenig Mädels waren. Zehn hatte ich gezählt, Yema und mich mit eingeschlossen.
»Gott, bin ich aufgeregt!«, quietschte Yema und ließ sich auf einen Klappstuhl fallen. Aus ihrem Rucksack fischte sie ein blau-orangefarbenes Buch, auf dem fett „Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1“ stand.
»Du hast dir den Papula gekauft?«, fragte ich. Mein Magen fuhr plötzlich Achterbahn und das Entsetzen konnte ich kaum überspielen.
»Aber sicher doch.« Yema strich über das Buch, als wäre es ihr größter Schatz. »Ich habe sogar schon ein bisschen darin geschmökert. Nicht ganz einfacher Kram, kann ich dir sagen.« Sie grinste selig. »Ich freue mich schon richtig auf die ersten Übungen.«
»Sagt jemand mit Physik- und Mathematik-LK.« Meine Bestürzung steigerte sich zur Fassungslosigkeit. Wenn Yema mit ihrem Einserabitur schon anfing zu lernen, bevor die Uni überhaupt begonnen hatte, wie sollte es dann mit jemandem wie mir enden, der mit Hängen und Würgen gerade einmal einen Zweierschnitt bekommen hatte und nur fünf Punkte im Physik-Leistungskurs aufweisen konnte?
Etwas in mir verkrampfte sich.
»Schau mal, das muss der Professor sein«, lenkte mich Yema von meinen Sorgen ab. »Aber der sieht so schrecklich jung aus.«
Ich blickte hinab und erkannte einen Mann und erkannte einen Mann mit kurzen, dunkelbraunen Haaren, der schätzungsweise Ende zwanzig war und ein kariertes Hemd, Jeans und Sneakers trug.
Nein, so sah kein Professor aus. Zumindest hatte ich mir so nie einen vorgestellt.
Er schritt auf das Pult zu, zog das Mikro hervor und nestelte an der Schnur herum.
Ich musterte ihn genauer und er kam mir auf eine merkwürdig bekannt vor.
»Ich bitte um Ruhe.« Seine Baritonstimme erfüllte den kompletten Saal. »Suchen Sie sich bitte einen Sitzplatz und stellen langsam die Gespräche ein. Der Vorkurs wird in wenigen Minuten beginnen.«
Sein rollendes R bereitete mir eine wohlige Gänsehaut und ein Déjà-vus. Die Erinnerung konnte ich nicht benennen. Es war eher eine Ahnung. Irgendwann hatte ich ihn schon einmal gesehen und gehört.
»Sophie? Hallo? Jemand zuhause?« Yema fuchtelte mit einer Hand vor meinen Augen herum.
»Was?« Ich blinzelte verdutzt. Mein Verstand fühlte sich an, als sei er gerade aus einem Traum erwacht.
»Du bist richtig weggetreten«, sagte Yema. Ihre Mandelaugen bohrten sich in mein Hirn, als sögen sie meine Gedanken heraus. »Hast du überhaupt mitbekommen, was ich dir gesagt habe?«
Ich schüttelte den Kopf.
Seufzend zückte sie ihr Smartphone und hielt es mir hin, während sie zum Pult sah. »Ich habe schnell auf der Webseite des Fachbereichs nachgesehen, wer das sein könnte. Und du wirst es nicht glauben ...« Sie brach ab, ihre Augen weiteten sich. »So sieht ein echter Professor aus!« Mit bloßem Finger deutete sie nach unten.
Ein unscheinbarer Mann mit Brille und Halbglatze schleuderte seine Tasche auf das Pult, nahm sich einen Stuhl und Greifhaken und machte sich daran, die Tafeln herunter zu ziehen.
»Das ist Professor Albert«, raunte Yema aufgeregt. Der Geräuschpegel hatte sich schlagartig gesenkt. Auch wenn es nicht wirklich leise war, so hörte man nur noch ein leises Murmeln. Die Ruhe vor dem Sturm.
Der kleine Professor bekam von dem jungen Mann, der vorher gesprochen hatte, das Headset festgemacht, dann wandte sich Professor Albert uns zu. »Herzlich Willkommen an der TU Darmstadt, wehrte Herren«, er pausierte und spähte angestrengt in die Menge, »und Damen. Ich darf Sie zu dem Mathematik-Vorkurs für alle Studiengänge der Elektrotechnik, Informationssystemtechnik und Mechatronik begrüßen. In den nächsten zwei Wochen werden wir Ihre Mathematikkenntnisse auffrischen und sie auf das Grundstudium vorbereiten ... so gut es geht.«
Dann legte er los. Und wie er loslegte!
Ich hatte mal von Dozenten gehört, die eine Tafel vollschrieben und danach gleich wieder wischten, um die langsamen und faulen Studenten zu bestrafen. Ich wäre unter Garantie unter diesen Leuten gewesen, obwohl ich weder bequem noch außerordentlich lahm war.
Der Professor erklärte, während er Zahlen, lateinische und griechische Buchstaben an die Tafel schrieb, und verlangte, dass wir mitdachten.
Während ich mitschrieb und immer wieder bei Yema abguckte, ob ich mich auch nicht vertan hatte, war es schon eine Herausforderung, auch nur zu atmen.
Yema hingegen war in ihrem Element. Ihr stand Zahlensalat in den glasigen Augen, aber sie genoss es. Sie suhlte sich geradezu in den Gleichungen, Reihen und Folgen. Es war ein mathematischer Masochismus auf höchstem Niveau – und ich wusste nicht, ob ich sie dafür bewundern oder hassen sollte.
Mit einem Mal landete ein Papierflieger auf meinem Schoß. Irritiert blickte ich meinen Nachbarn an, der mir grinsend sein Exemplar zeigte. Sollte das ein Flashmob werden?
Ich zuckte mit den Schultern. Normalerweise hätte ich den Flieger zur Seite gelegt und mich weiter auf das Wesentliche konzentriert, aber ich wollte mir nicht am ersten Tag schon den Ruf eines unlustigen Klemmarsches einhandeln – wenn ich denn schon die durchgeknallte Katzenlady war. Und ein bisschen Unsinn konnte niemandem schaden.
Ich erkannte aus dem Augenwinkel, dass mein Nachbar mir stumm mit den Fingern bedeutete, dass wir in vier ... drei ... zwei ... eins.
OH!
Ich warf meinen Papierflieger – als einzige.
Dreck.
Ein Seitenblick verriet mit, dass mein Nachbar ein bösartig grinsendes Arschloch war. Ich hatte das Bedürfnis ihm einen Ellenbogen in die Rippen zu bohren.
Meine Wangen prickelten vor Furcht und ich konnte schwören, dass rotwangig nicht die Bezeichnung war, mit der man mich beschrieben hätte.
Plötzlich gehörte mir die Aufmerksamkeit des Hörsaals. Der Dozent hatte aufgehört zu schreiben und blickte mir von unten herauf direkt in die Augen.
Der Flieger landete mit einem perfekten Looping zu seinen Füßen.
»Soll das lustig sein?«, fragte er grimmig. »Gehören sie auch zu diesen Spaßvögeln, die dem Mathe-Vorkurs von Stuttgart nacheifern wollen?«
Ich wusste nicht, was er meinte, aber mir wurde heiß und kalt zugleich. Ein dicker Kloß hatte sich in meiner Kehle festgesetzt. Ich schüttelte wie ein Idiot den Kopf.
Professor Albert nickte. »So etwas werde ich auch zu verhindern wissen«, dröhnte seine Stimme durch die Lautsprecher. »Und jetzt packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie auf der Stelle meinen Vorlesungssaal. Sie können zurückkehren, wenn Sie vernünftig geworden sind und das Studium nicht für die Bühne Ihrer Scherze halten.«
Die Worte trafen mich mit der Gewalt eines ICEs. Mein Magen tobte vor Wut auf mich selbst, während ich wie in Trance meine Sachen packte. Yemas Augen schrien mich an: „Was hast du getan?!“ Schweigend stand sie auf und ließ mich passieren.
Schwerfällig stieg ich die Treppen hoch, verfolgt von hunderten Augenpaaren. Mein Körper fühlte sich an, als wöge ich mehr, als mit gut tat. Ich öffnete die Tür und ließ sie hinter mir ins Schloss fallen.
Jäh gaben meine zitternden Knie nach und ich sackte zusammen wie eine Puppe, deren Drähte durchgeschnitten worden waren.
So hatte ich mir meinen Studienbeginn nie vorgestellt.
Es kostete Kraft, den Tränen nicht freien Lauf zu lassen und mich zu beruhigen. Langsam verstummte die anklagende Beschämung und ich hatte wieder genug Energie, um aufzustehen. Nur nicht den Mut verlieren!
Zögernd erhob ich mich, kratzte das bisschen meiner Selbstachtung zusammen, die übrig geblieben war, und schleppte mich dem Ausgang entgegen.
Meine Schritte hallten an den Wänden wider. Es war ruhig, obwohl nur wenige Meter entfernt gut fünfhundert Seelen in einem Raum saßen. In der Schule wäre das unmöglich gewesen. Die Lehrer bekamen kaum dreißig Schüler gebändigt. Fünfhundert von der Sorte? Sodom und Gomorrha wäre nichts dagegen gewesen.
Hier in der Universität lagen die Dinge anders, denn auch wenn es niemand zugab, so dachten es doch alle: Es ging um unsere Zukunft. Das war kein Spiel mehr, kein Witz. Hier wurde entschieden, was wir mit unserem restlichen Leben anfangen würden.
Und ich war so doof und warf einen Papierflieger auf meinen Professor.
Klasse, Sophie!, dachte ich. Der wird dich auch nie wieder vergessen.
Ich hatte einen ordentlichen Fehlstart hingelegt. Aber wie in der Formel 1 war auch hier nicht alles verloren. Wobei man den Vorkurs nicht einmal als Qualifying sehen durfte.
Durch die bodenhohen Fenster konnte ich das Schloss sehen - das Residenzschloss Darmstadt mit seinen rostroten Steinen, der barocken Fassade und dem Keller-Klub. Irgendwann wollte ich da hinein; und wenn es nur zum Lernen war, denn die Bibliothek hatte angeblich bis 1 Uhr geöffnet.
Mit wenig Enthusiasmus schlurfte ich die Treppen hinunter und blickte zu dem Schild und Haufen an Fahrrädern, zu denen ich meinen alten Drahtesel achtlos geworden hatte – und erkannte im ersten Augenblick nichts, was meinem Fahrrad auch nur ähnlich sah.
Meine Handflächen wurden schwitzig.
Ich näherte mich dem Haufen und umrundete ihn, doch meins war nicht da.
Hatte ich es vielleicht woanders abgestellt?
Ich hatte zwar kein gutes Gedächtnis, aber so kopflos konnte nicht einmal ich sein.
Nochmals stiefelte ich um das Schild, starrte auf die anderen Fahrräder und hoffte, irgendwo doch noch meines zu erblicken.
Es tauchte nicht auf.
Shit.
Wieder zitterten meine Beine als seien sie aus Gelee. Wie ein Sack plumpste ich auf die steinernen Stufen und starrte auf den Haufen gebogenes Metall mit Rädern.
So viel Pech konnte doch kein Mensch alleine haben. Irgendjemand trieb heute einen üblen Scherz mit mir oder das Schicksal übte daran, wie viel Frust ich ertragen konnte, bevor ich hysterisch schreiend im Kreis rannte.
Was sollte ich tun? Oder besser, was konnte ich tun? Zur Polizei gehen und eine Anzeige gegen Unbekannt stellen? Hatte das jemals irgendwem etwas gebracht? Mein Fahrrad hatte ja nicht einmal einen Fahrradpass. Genauso gut konnte ich warten, dass eine Nadel im Heuhaufen gefunden wurde. Wahrscheinlich befand sich mein Fahrrad schon auf dem Weg in eine Werkstatt, um ausgeschlachtet zu werden. Dass ich es jemals wiedersehen würde, war unwahrscheinlich – und wenn, dann würde ich es bestimmt nicht erkennen.
Ich seufzte. Mit dem Bus zurück zum Wohnheim fahren kam nicht infrage. Was wollte ich dort auch? Mia war bestimmt nicht da und auf gähnende Leere konnte ich auch hier starren.
Ich zupfte mein Smartphone aus der Tasche. Acht verpasste Anrufe, sagte meine schlaue Gehirnschiene. Yema hatte wirklich versucht, mich zu erreichen. Ich öffnete WhatsApp und scrollte immer länger, fieser werdende Nachrichten und Wörter mit ausschließlich Großbuchstaben und Totenkopfsmilies herunter.