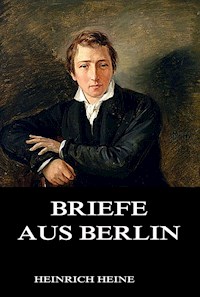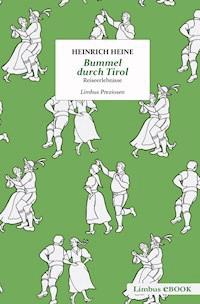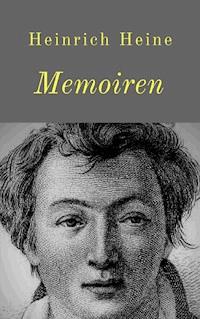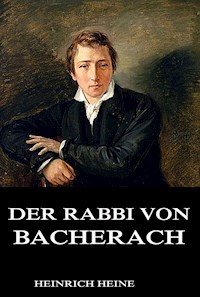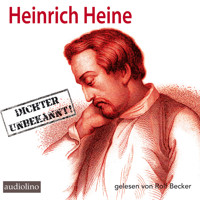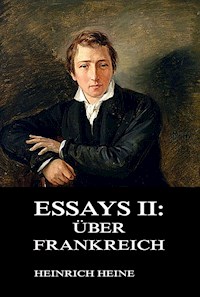
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet die folgenden Essays des deutschen Schriftstellers: Französische Maler Französische Zustände Über die Französische Bühne Lutetia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1066
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays II: Über Frankreich
Heinrich Heine
Inhalt:
Heinrich Heine – Biografie und Bibliografie
Französische Maler
Gemäldeausstellung in Paris. 1831
A. Scheffer
Horace Vernet
Delacroix
Decamps
Lessore
Schnetz
L. Robert
Delaroche
Nachtrag. 1833
Französische Zustände
Vorrede zur Vorrede
Vorrede
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Zwischennote zu Artikel IX
Beilage zu Artikel VI
Tagesberichte
Über die Französische Bühne
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Siebenter Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Lutetia
Préface
[Entwurf der]Vorrede
Zueignungsbrief an Seine Durchlaucht, den Fürsten
Pückler-Muskau
Erster Teil
Zweiter Teil
Anhang
Kommunismus, Philosophie und Klerisei
Gefängnisreform und Strafgesetzgebung
Aus den Pyrenäen
Musikalische Saison von 1844
Essays II, Heinrich Heine
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849619749
www.jazzybee-verlag.de
Dieses Werk bzw. Inhalt und Zusammenstellung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. Die Details der Lizenz und zu der Weiterverwertung dieses Werks finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. Der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon wurden der TextGrid-Datenbank entnommen, wo der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon ebenfalls unter voriger Lizenz verfügbar sind. Eine bereits bestehende Allgemeinfreiheit der Texte bleibt von der Lizensierung unberührt.
Heinrich Heine – Biografie und Bibliografie
Berühmter Dichter und Schriftsteller, geb. 13. Dez. 1797 in Düsseldorf, gest. 17. Febr. 1856 in Paris, war der Sohn unbegüterter jüdischer Eltern, erhielt die ersten und wichtigsten politischen Eindrücke zu der Zeit, als die Rheinlande unter der antifeudalen Herrschaft Napoleons standen (1806–13), besuchte 1808–15 das Lyzeum (Gymnasium) und sollte dann Kaufmann werden. Nach verunglückten Versuchen in dieser Laufbahn (in Hamburg 1816–1819) widmete sich H. mit Unterstützung seines reichen Oheims Salomon H. (s. oben) 1819–24 den Rechtsstudien in Bonn, Göttingen und Berlin, doch besuchte er zugleich germanistische und philosophische Vorlesungen mit Eifer. Er trat 28. Juni 1825 zum Christentum über, promovierte 20. Juli d. J. in Göttingen und beabsichtigte hierauf, sich als Rechtsanwalt in Hamburg niederzulassen, unterließ dies jedoch wegen mannigfacher Anfeindungen und lebte abwechselnd in London, München (1828, als Redakteur von Cottas »Politischen Annalen«), Oberitalien, namentlich aber in Berlin und Hamburg, bis er, durch Verdruß und Enttäuschungen niedergedrückt, 1831 nach Paris übersiedelte, dem damaligen Mekka des Liberalismus. In dieser ersten Epoche waren die Herzenserlebnisse, die er durch die unglückliche Liebe zu seiner Cousine Amalie H. und später zu deren jüngerer Schwester Therese erfuhr, auf seine dichterische Entwickelung von tiefstem Einfluß. Seine lyrischen Bekenntnisse beruhen großenteils auf diesen Erfahrungen. Trotz gelegentlicher Sehnsucht nach Deutschland, die H. in Paris empfand, war es ihm nicht mehr möglich, wieder dauernd dahin zurückzukehren; er konnte es nur zweimal, im Herbst 1843 und im Sommer 1844, besuchen. Durch den berüchtigten Bundestagsbeschluß vom Dezember 1835, der alle Schriften des sogen. Jungen Deutschland, wozu auch H. gerechnet wurde, verbot, wurde seine finanzielle Lage sehr gefährdet. Sein Haupteinkommen bestand in einer jährlichen Pension von 4000, seit 1838 von 4800 Frank, die ihm sein Oheim Salomon, der Vater von Amalie und Therese, ausgesetzt hatte. In Paris trat H. seit Oktober 1834 in leidenschaftliche Beziehungen zu einer schönen, gutherzigen, aber ungebildeten und allzu lebenslustigen Französin, Eugenie Mirat (gest.19. Febr. 1883 in Passy bei Paris), mit der er sich 31. Aug. 1841 auch kirchlich trauen ließ. Infolge seiner großen Finanznot tat er 1836 oder 1837 den bedenklichsten Schritt seines Lebens, indem er sich um eine Staatspension aus dem geheimen Fonds der französischen Regierung bewarb, die ihm in der Höhe von 4800 Frank jährlich bis zum Sturz der Julimonarchie 1848 gewährt wurde. 1845 befiel ihn ein Rückenmarkleiden, das ihn seit dem Frühling 1848 bis zu seinem Tod an das Krankenlager, die »Matratzengruft«, fesselte. Trotz seines jammervollen körperlichen Zustandes bewahrte er aber eine bewundernswürdige Frische des Geistes, und manche seiner bedeutendsten Schöpfungen in Vers und in Prosa sind hier entstanden: sein Witz verließ ihn nicht, und seine Weltanschauung vertiefte sich unter der schweren Zucht der Leiden. Heines Grab auf dem Friedhof von Montmartre in Paris wurde 1901 mit einer Marmorbüste von Hasselrijs geschmückt, der auch auf Korfu für das Schloß Achilleion der Kaiserin Elisabeth von Österreich ein Denkmal des Dichters errichtet hatte. Dagegen wurde die Errichtung eines solchen in einer deutschen Stadt verhindert, und das von Herter entworfene Standbild fand 1896 in New York einen wenig günstigen Platz.
In die literarische Welt trat H. mit »Gedichten« (Berl. 1822) ein, denen bald darauf die »Tragödien mit einem lyrischen Intermezzo« (das. 1823) folgten. Die Gedichte fanden sofort von den hervorragendsten Stimmführern der damaligen Kritik, von Varnhagen, Immermann, die wärmste Anerkennung, aber noch viel mehr Erfolg hatten die zwei ersten Bände von Heines »Reisebildern« (Hamb. 1826–27), die später durch zwei neue Bände (das. 1830–31) vermehrt wurden. Hier hatte sich ein geniales Individuum, romantisch und revolutionär zugleich, mit ungebundenster Subjektivität und mit bis dahin unbekanntem souveränen Witz über alles, was die Zeit interessierte, ausgelassen und Naturbilder voll tiefster Poesie, Menschenbilder von plastischer Kraft entworfen. Die hier eingeflochtenen Lieder gab H. vereint mit den früher veröffentlichten und durch neue vermehrt im »Buch der Lieder« (Hamb. 1827) heraus, das, immer neu aufgelegt, als einer der größten Schätze deutscher Poesie bis auf die Gegenwart anerkannt ist. Nach seiner Übersiedelung nach Paris übernahm es H., zwischen den Deutschen und Franzosen geistig zu vermitteln. So entstanden die ausgezeichneten Beiträge »Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland« (Par. u. Leipz. 1833, 2 Bde.; neue Aufl. u. d. T. »Die romantische Schule«, Hamb. 1836); dann die »Französischen Zustände« (das. 1833), eine Sammlung seiner aus Paris für die »Allgemeine Zeitung« in Augsburg geschriebenen Aufsätze, mit einer gegen die Reaktion in Preußen gerichteten äußerst heftigen Vorrede, und »Der Salon« (das. 1835–40, 4 Bde.), in dem er sehr eigenartig über die Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland einerseits sowie bei allem Humor mit sittlichem Ernst über französisches Leben, Politik, Bühne und Kunst anderseits berichtete und humoristische Novellen, wie die »Memoiren des Herrn von Schnabelewopski« und die »Florentinischen Nächte«, veröffentlichte. In Paris lernte H. auch die Anfänge des Sozialismus in Saint-Simon und Enfantin kennen, für deren Lehren er sich erwärmte, und die er eigentümlich zu einer Theorie des heidnisch-lebensfreudigen Sensualismus im Gegensatz zum christlich-jüdischen Spiritualismus ausbildete. In den erwähnten Schriften über deutsche Literatur und Philosophie zeigen sich die deutlichsten Spuren hiervon. Nach der unbedeutenderen Arbeit über »Shakespeares Mädchen und Frauen« (Par. u. Leipz. 1839) gab H. die großen Skandal hervorrufende Denkschrift »Ludwig Börne« (Hamb. 1840) heraus, in der er seinen tiefen Gegensatz zum »spiritualistischen Nazarener« Börne am schärfsten äußerte. H. war bei all seinem Liberalismus doch geistiger Aristokrat und besaß für die hitzige Gesinnungstüchtigkeit Börnes nicht das geringste Verständnis. H. wendete sich in dieser Zeit auch in seinen Gedichten der Politik zu, zumal in den »Neuen Gedichten« (Hamb. 1844), deren vorzügliche Romanzen zu seinen besten Leistungen gehören. Als neuer Aristophanes, aber zugleich als alles vaterländischen Gefühles bar erwies er sich in dem satirischen Epos: »Deutschland, ein Wintermärchen« (Hamb. 1844), während sein »Atta Troll« (das. 1847) durch glänzende Schilderungen und gesunde, echt poetische Tendenz ausgezeichnet ist. Noch folgte aus Heines Krankenstube die berühmte Gedichtsammlung »Romancero« (Hamb. 1851), die seine schönsten Balladen und ergreifendsten Klagen enthält und in einem »Nachwort« des Dichters Rückkehr zum Theismus bekennt; ferner das phantastische Tanzpoem »Der Doktor Faust« (das. 1851) und »Vermischte Schriften« (das. 1854, 3 Bde.). Aus seinem Nachlaß erschienen »Letzte Gedichte und Gedanken« (Hamb. 1869) und viele Jahre nach seinem Tod ein nur die früheste Jugend schildern des Fragment seiner »Memoiren« (hrsg. von E. Engel, das. 1884); über das Schicksal des übrigen Teiles davon ist nichts Sicheres bekannt.
Heines Bedeutung ist schwer abzuschätzen; das Urteil über ihn ist durch der Parteien Haß und Gunst verzerrt. Seine dichterischen Gaben waren zweifellos sehr bedeutend; er besitzt die zarteste Innigkeit des Gefühls, berauschende Leidenschaft, große Anschaulichkeit der Phantasie, überraschende Einfälle und Gedankenblitze und vor allem einen zündenden, unerschöpflichen Witz; dabei verfügt er in Vers und Prosa über eine höchst einschmeichelnde und individuelle Sprache. Aber die Fehler, Schwächen und Unarten seines im Grunde doch gutmütigen Charakters zerrütteten sein Leben und zerfetzten seine Poesie, so daß durch die Vereinigung von hoher Begeisterung und niedriger Prosa, von Pathos und Gemeinheit eine durchgängige Disharmonie in Heines Werken anzutreffen ist. Sein Einfluß auf die weitere Entwickelung unsrer Literatur war und ist jedoch kaum zu ermessen, und selbst Geister von ganz abweichender Grundrichtung verraten die Abhängigkeit von ihm.
Die erste Gesamtausgabe der Werke Heines besorgte A. Strodtmann (Hamb. 1861–66, 21 Bde.), die beste kritische Ausgabe mit allen Lesarten, mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen Elster (Leipz. 1887–90, 7 Bde.). Heines Werke wurden wiederholt in alle Kultursprachen, auch ins Japanische, übersetzt. Er ist im Ausland einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Dichter. Aber aus der überaus großen Fülle der Übersetzungen können hier nur die »Œuvres« (Par. 1834–35, 6 Bde.) und die »Œuvres complètes« (das. 1852 ff., 14 Bde.) erwähnt werden, deren erste vollständig u. deren zweite bis zum 7. Band unter des Dichters Mitwirkung entstanden. Zahllos sind die Kompositionen Heinescher Gedichte, deren berühmteste die von Rob. Schumann. Aus der reichen Literatur über H. heben wir hervor: Alfred Meißner, Heinrich H. (Hamb. 1856); Strodtmann, Heinrich Heines Leben und Werke (Berl. 1867–69, 2 Bde.; 3. Aufl. 1884); Hüffer, Aus dem Leben Heinrich Heines (das. 1877); Karpeles, Heinrich H. und seine Zeitgenossen (das. 1887) und Heinrich H. Aus seinem Leben und seiner Zeit (Leipz. 1899); Bölsche, Heinrich H. Versuch einer ästhetisch-kritischen Analyse seiner Werke (das. 1887); Elster, Heines Buch der Lieder nebst einer Nachlese nach den ersten Drucken und Handschriften (Heilbr. 1887) und Zu Heines Biographie (in der »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte«, Bd. 4), ferner dessen Einleitung zur Pantheonausgabe des »Buchs der Lieder« (Berl. 1902); Keiter, Heinrich H. (in den Schriften der Görres-Gesellschaft, Köln 1891); Legras, Henri H. poète (Par. 1897); G. Brandes, Das junge Deutschland (Leipz. 1891).
Französische Maler
Gemäldeausstellung in Paris. 1831
Der Salon ist jetzt geschlossen, nachdem die Gemälde desselben seit Anfang Mai ausgestellt worden. Man hat sie im allgemeinen nur mit flüchtigen Augen betrachtet; die Gemüter waren anderwärts beschäftigt und mit ängstlicher Politik erfüllt. Was mich betrifft, der ich in dieser Zeit zum ersten Male die Hauptstadt besuchte und von unzählig neuen Eindrücken befangen war, ich habe noch viel weniger als andere mit der erforderlichen Geistesruhe die Säle des Louvres durchwandeln können. Da standen sie nebeneinander, an die dreitausend, die hübschen Bilder, die armen Kinder der Kunst, denen die geschäftige Menge nur das Almosen eines gleichgültigen Blicks zuwarf. Mit stummen Schmerzen bettelten sie um ein bißchen Mitempfindung oder um Aufnahme in einem Winkelchen des Herzens. Vergebens! die Herzen waren von der Familie der eigenen Gefühle ganz angefüllt und hatten weder Raum noch Futter für jene Fremdlinge. Aber das war es eben, die Ausstellung glich einem Waisenhause, einer Sammlung zusammengeraffter Kinder, die sich selbst überlassen gewesen und wovon keins mit dem anderen verwandt war. Sie bewegte unsere Seele wie der Anblick unwürdiger Hülflosigkeit und jugendlicher Zerrissenheit.
Welch verschiedenes Gefühl ergriff uns dagegen schon beim Eintritt in eine Galerie jener italienischen Gemälde, die nicht als Findelkinder ausgesetzt worden in die kalte Welt, sondern an den Brüsten einer großen, gemeinsamen Mutter ihre Nahrung eingesogen und als eine große Familie, befriedet und einig, zwar nicht immer dieselben Worte, aber doch dieselbe Sprache sprechen.
Die katholische Kirche, die einst auch den übrigen Künsten eine solche Mutter war, ist jetzt verarmt und selber hülflos. Jeder Maler malt jetzt auf eigene Hand und für eigene Rechnung; die Tageslaune, die Grille der Geldreichen oder des eigenen müßigen Herzens gibt ihm den Stoff, die Palette gibt ihm die glänzendsten Farben, und die Leinwand ist geduldig. Dazu kommt noch, daß jetzt bei den französischen Malern die mißverstandene Romantik grassiert und, nach ihrem Hauptprinzip, jeder sich bestrebt, ganz anders als die anderen zu malen oder, wie die kursierende Redensart heißt, seine Eigentümlichkeit hervortreten zu lassen. Welche Bilder hierdurch manchmal zum Vorschein kommen, läßt sich leicht erraten.
Da die Franzosen jedenfalls viel gesunde Vernunft besitzen, so haben sie das Verfehlte immer richtig beurteilt, das wahrhaft Eigentümliche leicht erkannt und aus einem bunten Meer von Gemälden die wahrhaften Perlen leicht herausgefunden. Die Maler, deren Werke man am meisten besprach und als das Vorzüglichste pries, waren A. Scheffer, H. Vernet, Delacroix, Decamps, Lessore, Schnetz, Delaroche und Robert. Ich darf mich also darauf beschränken, die öffentliche Meinung zu referieren. Sie ist von der meinigen nicht sehr abweichend. Beurteilung technischer Vorzüge oder Mängel will ich soviel als möglich vermeiden. Auch ist dergleichen von wenig Nutzen bei Gemälden, die nicht in öffentlichen Galerien der Betrachtung ausgestellt bleiben, und noch weniger nützt es dem deutschen Berichtempfänger, der sie gar nicht gesehen. Nur Winke über das Stoffartige und die Bedeutung der Gemälde mögen letzterem willkommen sein. Als gewissenhafter Referent erwähne ich zuerst die Gemälde von
A. Scheffer
Haben doch der Faust und das Gretchen dieses Malers im ersten Monat der Ausstellung die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da die besten Werke von Delaroche und Robert erst späterhin aufgestellt wurden. Überdies, wer nie etwas von Scheffer gesehen, wird gleich frappiert von seiner Manier, die sich besonders in der Farbengebung ausspricht. Seine Feinde sagen ihm nach, er male nur mit Schnupftabak und grüner Seife. Ich weiß nicht, wie weit sie ihm unrecht tun. Seine braunen Schatten sind nicht selten sehr affektiert und verfehlen den in Rembrandtscher Weise beabsichtigten Lichteffekt. Seine Gesichter haben meistens jene fatale Couleur, die uns manchmal das eigene Gesicht verleiden konnte, wenn wir es, überwacht und verdrießlich, in jenen grünen Spiegeln erblickten, die man in alten Wirtshäusern, wo der Postwagen des Morgens stillehält, zu finden pflegt. Betrachtet man aber Scheffers Bilder etwas näher und länger, so befreundet man sich mit seiner Weise, man findet die Behandlung des Ganzen sehr poetisch, und man sieht, daß aus den trübsinnigen Farben ein lichtes Gemüt hervorbricht, wie Sonnenstrahlen aus Nebelwolken. Jene mürrisch gefegte, gewischte Malerei, jene todmüden Farben mit unheimlich vagen Umrissen sind in den Bildern von Faust und Gretchen sogar von gutem Effekt. Beide sind lebensgroße Kniestücke. Faust sitzt in einem mittelaltertümlichen roten Sessel, neben einem mit Pergamentbüchern bedeckten Tische, der seinem linken Arm, worin sein bloßes Haupt ruht, als Stütze dient. Den rechten Arm, mit der flachen Hand nach außen gekehrt, stemmt er gegen seine Hüfte. Gewand seifengrünlich blau. Das Gesicht fast Profil und schnupftabaklich fahl die Züge desselben streng edel. Trotz der kranken Mißfarbe, der gehöhlten Wangen, der Lippen welkheit, der eingedrückten Zerstörnis trägt dieses Gesicht dennoch die Spuren seiner ehemaligen Schönheit, und indem die Augen ihr holdwehmütiges Licht darüber hingießen, sieht es aus wie eine schöne Ruine, die der Mond beleuchtet. Ja, dieser Mann ist eine schöne Menschenruine, in den Falten über diesen verwitterten Augbraunen brüten fabelhaft gelahrte Eulen, und hinter dieser Stirne lauern böse Gespenster; um Mitternacht öffnen sich dort die Gräber verstorbener Wünsche, bleiche Schatten dringen hervor, und durch die öden Hirnkammern schleicht, wie mit gebundenen Füßen, Gretchens Geist. Das ist eben das Verdienst des Malers, daß er uns nur den Kopf eines Mannes gemalt hat und daß der bloße Anblick desselben uns die Gefühle und Gedanken mitteilt, die sich in des Mannes Hirn und Herzen bewegen. Im Hintergrunde, kaum sichtbar und ganz grün, widerwärtig grün gemalt, erkennt man auch den Kopf des Mephistopheles, des bösen Geistes, des Vaters der Lüge, des Fliegengottes, des Gottes der grünen Seife.
Gretchen ist ein Seitenstück von gleichem Werte. Sie sitzt ebenfalls auf einem gedämpft roten Sessel, das ruhende Spinnrad mit vollem Wocken zur Seite; in der Hand hält sie ein aufgeschlagenes Gebetbuch, worin sie nicht liest und worin ein verblichen buntes Muttergottesbildchen hervortröstet. Sie hält das Haupt gesenkt, so daß die größere Seite des Gesichtes, das ebenfalls fast Profil, gar seltsam beschattet wird. Es ist, als ob des Faustes nächtliche Seele ihren Schatten werfe über das Antlitz des stillen Mädchens. Die beiden Bilder hingen nahe nebeneinander, und es war um so bemerkbarer, daß auf dem des Faustes aller Lichteffekt dem Gesichte gewidmet worden, daß hingegen auf Gretchens Bild weniger das Gesicht und desto mehr dessen Umrisse beleuchtet sind. Letzteres erhielt dadurch noch etwas unbeschreibbar Magisches. Gretchens Mieder ist saftig grün, ein schwarzes Käppchen bedeckt ihre Scheitel, aber ganz spärlich, und von beiden Seiten dringt ihr schlichtes, goldgelbes Haar um so glänzender hervor. Ihr Gesicht bildet ein rührend edles Oval, und die Züge desselben sind von einer Schönheit, die sich selbst verbergen möchte aus Bescheidenheit. Sie ist die Bescheidenheit selbst, mit ihren lieben blauen Augen. Es zieht eine stille Träne über die schöne Wange, eine stumme Perle der Wehmut. Sie ist zwar Wolfgang Goethes Gretchen, aber sie hat den ganzen Friedrich Schiller gelesen, und sie ist viel mehr sentimental als naiv und viel mehr schwer idealisch als leicht graziös. Vielleicht ist sie zu treu und zu ernsthaft, um graziös sein zu können, denn die Grazie besteht in der Bewegung. Dabei hat sie etwas so Verläßliches, so Solides, so Reelles wie ein barer Louisdor, den man noch in der Tasche hat. Mit einem Wort, sie ist ein deutsches Mädchen, und wenn man ihr tief hineinschaut in die melancholischen Veilchen, so denkt man an Deutschland, an duftige Lindenbäume, an Höltys Gedichte, an den steinernen Roland vor dem Rathaus, an den alten Konrektor, an seine rosige Nichte, an das Forsthaus mit den Hirschgeweihen, an schlechten Tabak und gute Gesellen, an Großmutters Kirchhofgeschichten, an treuherzige Nachtwächter, an Freundschaft, an erste Liebe und allerlei andere süße Schnurrpfeifereien. – Wahrlich, Scheffers Gretchen kann nicht beschrieben werden. Sie hat mehr Gemüt als Gesicht. Sie ist eine gemalte Seele. Wenn ich bei ihr vorüberging, sagte ich immer unwillkürlich: »Liebes Kind!«
Leider finden wir Scheffers Manier in allen seinen Bildern, und wenn sie seinem Faust und Gretchen angemessen ist, so mißfällt sie uns gänzlich bei Gegenständen, die eine heitere, klare, farbenglühende Behandlung erforderten, z.B. bei einem kleinen Gemälde, worauf tanzende Schulkinder. Mit seinen gedämpften, freudlosen Farben hat uns Scheffer nur einen Rudel kleiner Gnomen dargestellt. Wie bedeutend auch sein Talent der Porträtierung ist, ja, wie sehr ich hier seine Originalität der Auffassung rühmen muß, so sehr widersteht mir auch hier seine Farbengebung. Es gab aber ein Porträt im Salon, wofür eben die Scheffersche Manier ganz geeignet war. Nur mit diesen unbestimmten, gelogenen, gestorbenen, charakterlosen Farben konnte der Mann gemalt werden, dessen Ruhm darin besteht, daß man auf seinem Gesichte nie seine Gedanken lesen konnte, ja, daß man immer das Gegenteil darauf las. Es ist der Mann, dem wir hinten Fußtritte geben könnten, ohne daß vorne das stereotype Lächeln von seinen Lippen schwände. Es ist der Mann, der vierzehn falsche Eide geschworen und dessen Lügentalente von allen aufeinanderfolgenden Regierungen Frankreichs benutzt wurden, wenn irgendeine tödliche Perfidie ausgeübt werden sollte, so daß er an jene alte Giftmischerin erinnert, an jene Lokusta, die, wie ein frevelhaftes Erbstück, im Hause des Augustus lebte und schweigend und sicher dem einen Cäsar nach dem andern und dem einen gegen den andern zu Dienste stand mit ihrem diplomatischen Tränklein. Wenn ich vor dem Bilde des falschen Mannes stand, den Scheffer so treu gemalt, dem er mit seinen Schierlingsfarben sogar die vierzehn falschen Eide ins Gesicht hineingemalt, dann durchfröstelte mich der Gedanke: wem gilt wohl seine neueste Mischung in London?
Scheffers Heinrich IV. und Ludwig Philipp I., zwei Reitergestalten in Lebensgröße, verdienen jedenfalls eine besondere Erwähnung. Ersterer, le roi par droit de conquête et par droit de naissance, hat vor meiner Zeit gelebt; ich weiß nur, daß er einen henri-quatre getragen, und ich kann nicht bestimmen, inwieweit er getroffen ist. Der andere, le roi des barricades, le roi par la grâce du peuple souverain, ist mein Zeitgenosse, und ich kann urteilen, ob sein Porträt ihm ähnlich sieht oder nicht. Ich sah letzteres, ehe ich das Vergnügen hatte, Se. Majestät den König selbst zu sehen, und ich gestehe, ich erkannte ihn dennoch nicht im ersten Augenblick. Ich sah ihn vielleicht in einem allzusehr erhöhten Seelenzustande, nämlich am ersten Festtage der jüngsten Revolutionsfeier, als er durch die Straßen von Paris einherritt, in der Mitte der jubelnden Bürgergarde und der Juliusdekorierten, die alle wie wahnsinnig die Parisienne und die Marseiller Hymne brüllten, auch mitunter die Carmagnole tanzten: Se. Majestät der König saß hoch zu Roß, halb wie ein gezwungener Triumphator, halb wie ein freiwilliger Gefangener, der einen Triumphzug zieren soll; ein entthronter Kaiser ritt symbolisch oder auch prophetisch an seiner Seite; seine beiden jungen Söhne ritten ebenfalls neben ihm, wie blühende Hoffnungen, und seine schwülstigen Wangen glühten hervor aus dem Walddunkel des großen Backenbarts, und seine süßlich grüßenden Augen glänzten vor Lust und Verlegenheit. Auf dem Schefferschen Bilde sieht er minder kurzweilig aus, ja fast trübe, als ritte er eben über die Place de Grève, wo sein Vater geköpft worden; sein Pferd scheint zu straucheln. Ich glaube, auf dem Schefferschen Bilde ist auch der Kopf nicht oben so spitz zulaufend wie beim erlauchten Originale, wo diese eigentümliche Bildung mich immer an das Volkslied erinnert:
Es steht eine Tann' im tiefen Tal,
Ist unten breit und oben schmal.
Sonst ist das Bild ziemlich getroffen, sehr ähnlich; doch diese Ähnlichkeit entdeckte ich erst, als ich den König selbst gesehen. Das scheint mir bedenklich, sehr bedenklich für den Wert der ganzen Schefferschen Porträtmalerei. Die Porträtmaler lassen sich nämlich in zwei Klassen einteilen. Die einen haben das wunderbare Talent, gerade diejenigen Züge aufzufassen und hinzumalen, die auch dem fremden Beschauer eine Idee von dem darzustellenden Gesichte geben, so daß er den Charakter des unbekannten Originals gleich begreift und letzteres, sobald er dessen ansichtig wird, gleich wiedererkennt. Bei den alten Meistern, vornehmlich bei Holbein, Tizian und van Dyck, finden wir solche Weise, und in ihren Porträten frappiert uns jene Unmittelbarkeit, die uns die Ähnlichkeit derselben mir den längst verstorbenen Originalen so lebendig zusichert. »Wir möchten darauf schwören, daß diese Porträte getroffen sind!« sagen wir dann unwillkürlich, wenn wir Galerien durchwandeln. Eine zweite Weise der Porträtmalerei finden wir namentlich bei englischen und französischen Malern, die nur das leichte Wiedererkennen beabsichtigen und nur jene Züge auf die Leinwand werfen, die uns das Gesicht und den Charakter des wohlbekannten Originals ins Gedächtnis zurückrufen. Diese Maler arbeiten eigentlich für die Erinnerung, und sie sind überaus beliebt bei wohlerzogenen Eltern und zärtlichen Eheleuten, die uns ihre Gemälde nach Tische zeigen und uns nicht genug versichern können, wie gar niedlich der liebe Kleine getroffen war, ehe er die Würmer bekommen, oder wie sprechend ähnlich der Herr Gemahl ist den wir noch nicht die Ehre haben zu kennen und dessen Bekanntschaft uns noch bevorsteht, wenn er von der Braunschweiger Messe zurückkehrt.
Scheffers »Leonore« ist in Hinsicht der Farbengebung weit ausgezeichneter als seine übrigen Stücke. Die Geschichte ist in die Zeit der Kreuzzüge verlegt, und der Maler gewann dadurch Gelegenheit zu brillanteren Kostümen und überhaupt zu einem romantischen Kolorit. Das heimkehrende Heer zieht vorüber, und die arme Leonore vermißt darunter ihren Geliebten. Es herrscht in dem ganzen Bilde eine sanfte Melancholie, nichts läßt den Spuk der künftigen Nacht vorausahnen. Aber ich glaube eben, weil der Maler die Szene in die fromme Zeit der Kreuzzüge verlegt hat, wird die verlassene Leonore nicht die Gottheit lästern, und der tote Reuter wird sie nicht abholen. Die Bürgersche Leonore lebte in einer protestantischen, skeptischen Periode, und ihr Geliebter zog in den Siebenjährigen Krieg, um Schlesien für den Freund Voltaires zu erkämpfen. Die Scheffersche Leonore lebte hingegen in einem katholischen gläubigen Zeitalter, wo Hunderttausende, begeistert von einem religiösen Gedanken, sich ein rotes Kreuz auf den Rock nähten und als Pilgerkrieger nach dem Morgenlande wanderten, um dort ein Grab zu erobern. Sonderbare Zeit! Aber, wir Menschen, sind wir nicht alle Kreuzritter, die wir mit allen unseren mühseligsten Kämpfen am Ende nur ein Grab erobern? Diesen Gedanken lese ich auf dem edlen Gesichte des Ritters, der von seinem hohen Pferde herab so mitleidig auf die trauernde Leonore niederschaut. Diese lehnt ihr Haupt an die Schulter der Mutter. Sie ist eine trauernde Blume, sie wird welken, aber nicht lästern. Das Scheffersche Gemälde ist eine schöne, musikalische Komposition; die Farben klingen darin so heiter trübe wie ein wehmütiges Frühlingslied.
Die übrigen Stücke von Scheffer verdienen keine Beachtung. Dennoch gewannen sie vielen Beifall, während manch besseres Bild von minder ausgezeichneten Malern unbeachtet blieb. So wirkt der Name des Meisters. Wenn Fürsten einen böhmischen Glasstein am Finger tragen, wird man ihn für einen Diamanten halten, und trüge ein Bettler auch einen echten Diamantring so würde man doch meinen, es sei eitel Glas.
Die oben angestellte Betrachtung leitet mich auf
Horace Vernet
Der hat auch nicht mit lauter echten Steinen den diesjährigen Salon geschmückt. Das vorzüglichste seiner ausgestellten Gemälde war eine Judith, die im Begriff steht, den Holofernes zu töten. Sie hat sich eben vom Lager desselben erhoben, ein blühend schlankes Mädchen. Ein violettes Gewand, um die Hüften hastig geschürzt, geht bis zu ihren Füßen hinab; oberhalb des Leibes trägt sie ein blaßgelbes Unterkleid, dessen Ärmel von der rechten Schulter herunterfällt und den sie mit der linken Hand, etwas metzgerhaft und doch zugleich bezaubernd zierlich, wieder in die Höhe streift; denn mit der rechten Hand hat sie eben das krumme Schwert gezogen gegen den schlafenden Holofernes. Da steht sie, eine reizende Gestalt, an der eben überschrittenen Grenze der Jungfräulichkeit, ganz gottrein und doch weltbefleckt, wie eine entweihte Hostie. Ihr Kopf ist wunderbar anmutig und unheimlich liebenswürdig; schwarze Locken, wie kurze Schlangen, die nicht herabflattern, sondern sich bäumen, furchtbar graziös. Das Gesicht ist etwas beschattet, und süße Wildheit, düstere Holdseligkeit und sentimentaler Grimm rieselt durch die edlen Züge der tödlichen Schönen. Besonders in ihrem Auge funkelt süße Grausamkeit und die Lüsternheit der Rache; denn sie hat auch den eignen beleidigten Leib zu rächen an dem häßlichen Heiden. In der Tat, dieser ist nicht sonderlich liebreizend, aber im Grunde scheint er doch ein bon enfant zu sein. Er schläft so gutmütig in der Nachwonne seiner Beseligung; er schnarcht vielleicht, oder, wie Luise sagt, er schläft laut; seine Lippen bewegen sich noch, als wenn sie küßten; er lag noch eben im Schoße des Glücks, oder vielleicht lag auch das Glück in seinem Schoße; und trunken von Glück und gewiß auch von Wein, ohne Zwischenspiel von Qual und Krankheit, sendet ihn der Tod durch seinen schönsten Engel in die weiße Nacht der ewigen Vernichtung. Welch ein beneidenswertes Ende! Wenn ich einst sterben soll, ihr Götter, laßt mich sterben wie Holofernes!
Ist es Ironie von Horace Vernet, daß die Strahlen der Frühsonne auf den Schlafenden gleichsam verklärend hereinbrechen und daß eben die Nachtlampe erlischt?
Minder durch Geist als vielmehr durch kühne Zeichnung und Farbengebung empfiehl sich ein anderes Gemälde von Vernet, welches den jetzigen Papst vorstellt. Mit der goldenen dreifachen Krone auf dem Haupte, gekleidet mit einem goldgestickten weißen Gewande, auf einem goldenen Stuhle sitzend, wird der Knecht der Knechte Gottes in der Peterskirche herumgetragen. Der Papst selbst, obgleich rotwangig, sieht schwächlich aus, fast verbleichend in dem weißen Hintergrund von Weihrauchdampf und weißen Federwedeln, die über ihn hingehalten werden. Aber die Träger des päpstlichen Stuhles sind stämmige, charaktervolle Gestalten, in karmosinroten Livreen, die schwarzen Haare herabfallend über die gebräunten Gesichter. Es kommen nur drei davon zum Vorschein, aber sie sind vortrefflich gemalt. Dasselbe läßt sich rühmen von den Kapuzinern, deren Häupter nur, oder vielmehr deren gebeugte Hinterhäupter mit den breiten Tonsuren, im Vordergrunde sichtbar werden. Aber eben die verschwimmende Unbedeutenheit der Hauptperson und das bedeutende Hervortreten der Nebenpersonen ist ein Fehler des Bildes. Letztere haben mich durch die Leichtigkeit, womit sie hingeworfen sind, und durch ihr Kolorit an den Paul Veronese erinnert. Nur der venezianische Zauber fehlt, jene Farbenpoesie, die, gleich dem Schimmer der Lagunen, nur oberflächlich ist, aber dennoch die Seele so wunderbar bewegt.
In Hinsicht der kühnen Darstellung und der Farbengebung hat sich ein drittes Bild von Horace Vernet vielen Beifall erworben. Es ist die Arretierung der Prinzen Condé, Conti und Longueville. Der Schauplatz ist eine Treppe des Palais Royal, und die arretierten Prinzen steigen herab, nachdem sie eben auf Befehl Annens von Österreich ihre Degen abgegeben. Durch dieses Herabsteigen behält fast jede Figur ihren ganzen Umriß. Condé ist der erste, auf der untersten Stufe; er hält sinnend seinen Knebelbart in der Hand, und ich weiß, was er denkt. Von der obersten Stufe der Treppe kommt ein Offizier herab, der die Degen der Prinzen unterm Arme trägt. Es sind drei Gruppen, die natürlich entstanden und natürlich zusammengehören. Nur wer eine sehr hohe Stufe in der Kunst erstiegen, hat solche Treppenideen.
Zu den weniger bedeutenden Bildern von Horace Vernet gehört ein Camille Desmoulins, der im Garten des Palais Royal auf eine Bank steigt und das Volk haranguiert. Mit der linken Hand reift er ein grünes Blatt von einem Baume, in der rechten hält er eine Pistole. Armer Camille! dein Mut war nicht höher als diese Bank, und da wolltest du stehenbleiben, und du schautest dich um. »Vorwärts, immer vorwärts!« ist aber das Zauberwort, das die Revolutionäre aufrechterhalten kann; – bleiben sie stehen und schauen sie sich um, dann sind sie verloren, wie Eurydike, als sie, dem Saitenspiel des Gemahls folgend, nur einmal zurückschaute in die Greuel der Unterwelt. Armer Camille! armer Bursche! das waren die lustigen Flegeljahre der Freiheit, als du auf die Bank sprangest und dem Despotismus die Fenster einwarfest und Laternenwitze rissest; der Spaß wurde nachher sehr trübe, die Füchse der Revolution wurden bemooste Häupter, denen die Haare zu Berge stiegen, und du hörtest schreckliche Töne neben dir erklingen, und hinter dir, aus dem Schattenreich, riefen dich die Geisterstimmen der Gironde, und du schautest dich um.
In Hinsicht der Kostüme von 1789 war dieses Bild ziemlich interessant. Da sah man sie noch, die gepuderten Frisuren, die engen Frauenkleider, die erst bei den Hüften sich bauschten, die buntgestreiften Fräcke, die kutscherlichen Oberröcke mit kleinen Kräglein, die zwei Uhrketten, die parallel über dem Bauche hängen, und gar jene terroristischen Westen mit breitaufgeschlagenen Klappen, die bei der republikanischen Jugend in Paris jetzt wieder in Mode gekommen sind und gilets à la Robespierre genannt werden. Robespierre selbst ist ebenfalls auf dem Bilde zu sehen, auffallend durch seine sorgfältige Toilette und sein geschmiegeltes Wesen. In der Tat, sein Äußeres war immer schmuck und blank, wie das Beil einer Guillotine; aber auch sein Inneres, sein Herz, war uneigennützig, unbestechbar und konsequent wie das Beil einer Guillotine. Diese unerbittliche Strenge war jedoch nicht Gefühllosigkeit, sondern Tugend, gleich der Tugend des Junius Brutus, die unser Herz verdammt und die unsere Vernunft mit Entsetzen bewundert. Robespierre hatte sogar eine besondere Vorliebe für Desmoulins, seinen Schulkameraden, den er hinrichten ließ, als dieser Fanfaron de la liberté eine unzeitige Mäßigung predigte und staatsgefährliche Schwächen beförderte. Während Camilles Blut auf der Grève floß, flossen vielleicht in einsamer Kammer die Tränen des Maximilian. Dies soll keine banale Redensart sein. Unlängst sagte mir ein Freund, daß ihm Bourdon de l'Oise erzählt habe: er sei einst in das Arbeitszimmer des Comité du salut public gekommen, als dort Robespierre ganz allein, in sich selbst versunken, über seinen Akten saß und bitterlich weinte.
Ich übergehe die übrigen noch minder bedeutenden Gemälde von Horace Vernet, dem vielseitigsten Maler, der alles malt, Heiligenbilder, Schlachten, Stilleben, Bestien, Landschaften, Porträte, alles flüchtig, fast pamphletartig.
Ich wende mich zu
Delacroix
der ein Bild geliefert, vor welchem ich immer einen großen Volkshaufen stehen sah und das ich also zu denjenigen Gemälden zähle, denen die meiste Aufmerksamkeit zuteil worden. Die Heiligkeit des Sujets erlaubt keine strenge Kritik des Kolorits, welche vielleicht mißlich ausfallen könnte. Aber trotz etwaniger Kunstmängel atmet in dem Bilde ein großer Gedanke, der uns wunderbar entgegenweht. Eine Volksgruppe während den Juliustagen ist dargestellt, und in der Mitte, beinahe wie eine allegorische Figur, ragt hervor ein jugendliches Weib, mit einer roten phrygischen Mütze auf dem Haupte, eine Flinte in der einen Hand und in der andern eine dreifarbige Fahne. Sie schreitet dahin über Leichen, zum Kampfe auffordernd, entblößt bis zur Hüfte, ein schöner, ungestümer Leib, das Gesicht ein kühnes Profil, frecher Schmerz in den Zügen, eine seltsame Mischung von Phryne, Poissarde und Freiheitsgöttin. Daß sie eigentlich letztere bedeuten solle, ist nicht ganz bestimmt ausgedrückt, diese Figur scheint vielmehr die wilde Volkskraft, die eine fatale Bürde abwirft, darzustellen. Ich kann nicht umhin zu gestehen, diese Figur erinnert mich an jene peripatetischen Philosophinnen, an jene Schnelläuferinnen der Liebe oder Schnelliebende, die des Abends auf den Boulevards umherschwärmen; ich gestehe, daß der kleine Schornsteinkupido, der, mit einer Pistole in jeder Hand, neben dieser Gassenvenus steht, vielleicht nicht allein von Ruß beschmutzt ist; daß der Pantheonskandidat, der tot auf dem Boden liegt, vielleicht den Abend vorher mit Kontermarken des Theaters gehandelt; daß der Held, der mit seinem Schießgewehr hinstürmt, in seinem Gesichte die Galeere und in seinem häßlichen Rock gewiß noch den Duft des Assisenhofes trägt; – aber das ist es eben, ein großer Gedanke hat diese gemeinen Leute, diese Krapüle, geadelt und geheiligt und die entschlafene Würde in ihrer Seele wieder aufgeweckt.
Heilige Julitage von Paris! ihr werdet ewig Zeugnis geben von dem Uradel der Menschen, der nie ganz zerstört werden kann. Wer euch erlebt hat, der jammert nicht mehr auf den alten Gräbern, sondern freudig glaubt er jetzt an die Auferstehung der Völker. Heilige Julitage! wie schön war die Sonne und wie groß war das Volk von Paris! Die Götter im Himmel, die dem großen Kampfe zusahen, jauchzten vor Bewunderung, und sie wären gerne aufgestanden von ihren goldenen Stühlen und wären gerne zur Erde herabgestiegen, um Bürger zu werden von Paris! Aber neidisch, ängstlich, wie sie sind, fürchteten sie am Ende, daß die Menschen zu hoch und zu herrlich emporblühen möchten, und durch ihre willigen Priester suchten sie »das Glänzende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehn«, und sie stifteten die belgische Rebellion, das de Pottersche Viehstück. Es ist dafür gesorgt, daß die Freiheitsbäume nicht in den Himmel hineinwachsen.
Auf keinem von allen Gemälden des Salons ist so sehr die Farbe eingeschlagen wie auf Delacroix' Julirevolution. Indessen, eben diese Abwesenheit von Firnis und Schimmer, dabei der Pulverdampf und Staub, der die Figuren wie graues Spinnweb bedeckt, das sonnengetrocknete Kolorit, das gleichsam nach einem Wassertropfen lechzt, alles dieses gibt dem Bilde eine Wahrheit, eine Wesenheit, eine Ursprünglichkeit, und man ahnt darin die wirkliche Physiognomie der Julitage.
Unter den Beschauern waren so manche, die damals entweder mitgestritten oder doch wenigstens zugesehen hatten, und diese konnten das Bild nicht genug rühmen. »Mâtin«, rief ein Epicier, »diese Gamins haben sich wie Riesen geschlagen!« Eine junge Dame meinte, auf dem Bilde fehle der polytechnische Schüler, wie man ihn sehe auf allen andern Darstellungen der Julirevolution, deren sehr viele, über vierzig Gemälde, ausgestellt waren.
»Papa!« rief eine kleine Karlistin, »wer ist die schmutzige Frau mit der roten Mütze?« – »Nun freilich«, spöttelte der noble Papa mit einem süßlich zerquetschten Lächeln, »nun freilich, liebes Kind, mit der Reinheit der Lilien hat sie nichts zu schaffen. Es ist die Freiheitsgöttin.« – »Papa, sie hat auch nicht einmal ein Hemd an.« – »Eine wahre Freiheitsgöttin, liebes Kind, hat gewöhnlich kein Hemd und ist daher sehr erbittert auf alle Leute, die weiße Wäsche tragen.«
Bei diesen Worten zupfte der Mann seine Manschetten etwas tiefer über die langen müßigen Hände und sagte zu seinem Nachbar: »Eminenz! wenn es den Republikanern heut an der Pforte St. Denis gelingt, daß eine alte Frau von den Nationalgarden totgeschossen wird, dann tragen sie die heilige Leiche auf den Boulevards herum, und das Volk wird rasend, und wir haben dann eine neue Revolution.« – »Tant mieux!« flüsterte die Eminenz, ein hagerer, zugeknöpfter Mensch, der sich in weltliche Tracht vermummt, wie jetzt von allen Priestern in Paris geschieht, aus Furcht vor öffentlicher Verhöhnung, vielleicht auch des bösen Gewissens halber; »tant mieux, Marquis! wenn nur recht viele Greuel geschehen, damit das Maß wieder voll wird! Die Revolution verschluckt dann wieder ihre eignen Anstifter, besonders jene eitlen Bankiers, die sich gottlob jetzt schon ruiniert haben.« – »Ja, Eminenz, sie wollten uns à tout prix vernichten, weil wir sie nicht in unsere Salons aufgenommen; das ist das Geheimnis der Julirevolution, und da wurde Geld verteilt an die Vorstädter, und die Arbeiter wurden von den Fabrikherrn entlassen, und Weinwirte wurden bezahlt, die umsonst Wein schenkten und noch Pulver hineinmischten, um den Pöbel zu erhitzen, et du reste, c'était le soleil!«
Der Marquis hat vielleicht recht: es war die Sonne. Zumal im Monat Juli hat die Sonne immer am gewaltigsten mit ihren Strahlen die Herzen der Pariser entflammt, wenn die Freiheit bedroht war, und sonnentrunken erhob sich dann das Volk von Paris gegen die morschen Bastillen und Ordonnanzen der Knechtschaft. Sonne und Stadt verstehen sich wunderbar, und sie lieben sich. Ehe die Sonne des Abends ins Meer hinabsteigt, verweilt ihr Blick noch lange mit Wohlgefallen auf der schönen Stadt Paris, und mit ihren letzten Strahlen küßt sie die dreifarbigen Fahnen auf den Türmen der schönen Stadt Paris. Mit Recht hatte ein französischer Dichter den Vorschlag gemacht, das Julifest durch eine symbolische Vermählung zu feiern: und wie einst der Doge von Venedig jährlich den goldenen Bukentauro bestiegen, um die herrschende Venezia mit dem Adriatischen Meere zu vermählen, so solle alljährlich auf dem Bastillenplatze die Stadt Paris sich vermählen mit der Sonne, dem großen, flammenden Glücksstern ihrer Freiheit. Casimir Périer hat diesen Vorschlag nicht goutiert, er fürchtet den Polterabend einer solchen Hochzeit, er fürchtet die allzu starke Hitze einer solchen Ehe, und er bewilligt der Stadt Paris höchstens eine morganatische Verbindung mit der Sonne.
Doch ich vergesse, daß ich nur Berichterstatter einer Ausstellung bin. Als solcher gelange ich jetzt zur Erwähnung eines Malers, der, indem er die allgemeine Aufmerksamkeit erregte, zu gleicher Zeit mich selber so sehr ansprach, daß seine Bilder mir nur wie buntes Echo der eignen Herzensstimme erschienen, oder vielmehr, daß die wahlverwandten Farbentöne in meinem Herzen wunderklar widerklangen.
Decamps
heißt der Maler, der solchen Zauber auf mich ausübte. Leider habe ich eins seiner besten Werke, das »Hundehospital«, gar nicht gesehen. Es war schon fortgenommen, als ich die Ausstellung besuchte. Einige andere gute Stücke von ihm entgingen mir, weil ich sie aus der großen Menge nicht herausfinden konnte, ehe sie ebenfalls fortgenommen wurden. Ich erkannte aber gleich von selbst, daß Decamps ein großer Maler sei, als ich zuerst ein kleines Bild von ihm sah, dessen Kolorit und Einfachheit mich seltsam frappierten. Es stellte nur ein türkisches Gebäude vor, weiß und hochgebaut, hie und da eine kleine Fensterluke, wo ein Türkengesicht hervorlauscht, unten ein stilles Wasser, worin sich die Kreidewände mit ihren rötlichen Schatten abspiegeln, wunderbar ruhig. Nachher erfuhr ich, daß Decamps selbst in der Türkei gewesen und daß es nicht bloß sein originelles Kolorit war, was mich so sehr frappiert, sondern auch die Wahrheit, die sich mit getreuen und bescheidenen Farben in seinen Bildern des Orients ausspricht. Dieses geschieht ganz besonders in seiner »Patrouille«. In diesem Gemälde erblicken wir den großen Hadji-Bey, Oberhaupt der Polizei zu Smyrna, der mit seinen Myrmidonen durch diese Stadt die Runde macht. Er sitzt schwammbauchig hoch zu Roß, in aller Majestät seiner Insolenz, ein beleidigend arrogantes, unwissend stockfinsteres Gesicht, das von einem weißen Turban überschildet wird in den Händen hält er das Zepter des absoluten Bastonadentums, und neben ihm, zu Fuß, laufen neun getreue Vollstrecker seines Willens quand même, hastige Kreaturen mit kurzen, magern Beinen und fast tierischen Gesichtern, katzenhaft, ziegenböcklich, äffisch, ja, eins derselben bildet eine Mosaik von Hundeschnauze, Schweinsaugen, Eselsohren, Kalbslächeln und Hasenangst. In den Händen tragen sie nachlässige Waffen, Piken, Flinten, die Kolbe nach oben, auch Wertzeuge der Gerechtigkeitspflege, nämlich einen Spieß und ein Bündel Bambusstöcke. Da die Häuser, an denen der Zug vorbeikommt, kalkweiß sind und der Boden lehmig gelb ist, so macht es fast den Effekt eines chinesischen Schattenspiels, wenn, man die dunkeln putzigen Figuren längs dem hellen Hintergrund und über einen hellen Vorgrund dahineilen sieht. Es ist lichte Abenddämmerung, und die seltsamen Schatten der magern Menschen- und Pferdebeine verstärken die barock magische Wirkung. Auch rennen die Kerls mit so drolligen Kapriolen, mit so unerhörten Sprüngen, auch das Pferd wirft die Beine so närrisch geschwinde, laß es halb auf dem Bauch zu kriechen und halb zu fliegen scheint – : und das alles haben einige hiesige Kritiker am meisten getadelt und als Unnatürlichkeit und Karikatur verworfen.
Auch Frankreich hat seine stehenden Kunstrezensenten, die nach alten vorgefaßten Regeln jedes neue Werk bekritteln, seine Oberkenner, die in den Ateliers herumschnüffeln und Beifall lächeln, wenn man ihre Marotte kitzelt, und diese haben nicht ermangelt, über Decamps' Bild ihr Urteil zu fällen. Ein Herr Jal, der über jede Ausstellung eine Broschüre ediert, hat sogar nachträglich im »Figaro« jenes Bild zu schmähen gesucht, und er meint die Freunde desselben zu persiflieren, wenn er scheinbar demütigst gesteht: er sei nur ein Mensch, der nach Verstandesbegriffen urteile, und sein armer Verstand könne in dem Decampsschen Bilde nicht das große Meisterwerk sehen, das von jenen Überschwenglichen, die nicht bloß mit dem Verstande erkennen, darin erblickt wird. Der arme Schelm, mit seinem armen Verstande! Er weiß nicht, wie richtig er sich selbst gerichtet! Dem armen Verstande gebührt wirklich niemals die erste Stimme, wenn über Kunstwerke geurteilt wird, ebensowenig als er bei der Schöpfung derselben jemals die erste Rolle gespielt hat. Die Idee des Kunstwerks steigt aus dem Gemüte, und dieses verlangt bei der Phantasie die verwirklichende Hülfe. Die Phantasie wirft ihm dann alle ihre Blumen entgegen, verschüttet fast die Idee und würde sie eher töten als beleben, wenn nicht der Verstand heranhinkte und die überflüssigen Blumen beiseite schöbe oder mit seiner blanken Gartenschere abmähte. Der Verstand übt nur Ordnung, sozusagen die Polizei im Reiche der Kunst. Im Leben ist er meistens ein kalter Kalkulator, der unsere Torheiten addiert; ach! manchmal ist er nur der Fallitenbuchhalter des gebrochenen Herzens, der das Defizit ruhig ausrechnet.
Der große Irrtum besteht immer darin, daß der Kritiker die Frage aufwirft: was soll der Künstler? Viel richtiger wäre die Frage: was will der Künstler, oder gar, was muß der Künstler? Die Frage, was soll der Künstler? entstand durch jene Kunstphilosophen, die, ohne eigene Poesie, sich Merkmale der verschiedenen Kunstwerke abstrahierten, nach dem Vorhandenen eine Norm für alles Zukünftige feststellten und Gattungen schieden und Definitionen und Regeln ersannen. Sie wußten nicht, daß alle solche Abstraktionen nur allenfalls zur Beurteilung des Nachahmervolks nützlich sind, daß aber jeder Originalkünstler und gar jedes neue Kunstgenie nach seiner eigenen mitgebrachten Ästhetik beurteilt werden muß. Regeln und sonstige alte Lehren sind bei solchen Geistern noch viel weniger anwendbar. Für junge Riesen, wie Menzel sagt, gibt es keine Fechtkunst, denn sie schlagen ja doch alle Paraden durch. Jeder Genius muß studiert und nur nach dem beurteilt werden, was er selbst will. Hier gilt nur die Beantwortung der Fragen: Hat er die Mittel, seine Idee auszuführen? Hat er die richtigen Mittel angewendet? Hier ist fester Boden. Wir modeln nicht mehr an der fremden Erscheinung nach unsern subjektiven Wünschen, sondern wir verständigen uns über die gottgegebenen Mittel, die dem Künstler zu Gebote stehen bei der Veranschaulichung seiner Idee. In den rezitierenden Künsten bestehen diese Mittel in Tönen und Worten. In den darstellenden Künsten bestehen sie in Farben und Formen. Töne und Worte, Farben und Formen, das Erscheinende überhaupt sind jedoch nur Symbole der Idee, Symbole, die in dem Gemüte des Künstlers aufsteigen, wenn es der heilige Weltgeist bewegt, seine Kunstwerke sind nur Symbole, wodurch er andern Gemütern seine eigenen Ideen mitteilt. Wer mit den wenigsten und einfachsten Symbolen das meiste und Bedeutendste ausspricht, der ist der größte Künstler.
Es dünkt mir aber des höchsten Preises wert, wenn die Symbole, womit der Künstler seine Idee ausspricht, abgesehen von ihrer innern Bedeutsamkeit, noch außerdem an und für sich die Sinne erfreuen, wie Blumen eines Selams, die, abgesehen von ihrer geheimen Bedeutung, auch an und für sich blühend und lieblich sind und verbunden zu einem schönen Strauße. Ist aber solche Zusammenstimmung immer möglich? Ist der Künstler so ganz willensfrei bei der Wahl und Verbindung seiner geheimnisvollen Blumen? Oder wählt und verbindet er nur, was er muß? Ich bejahe diese Frage einer mystischen Unfreiheit. Der Künstler gleicht jener schlafwandelnden Prinzessin, die des Nachts in den Gärten von Bagdad mit tiefer Liebesweisheit die sonderbarsten Blumen pflückte und zu einem Selam verband, dessen Bedeutung sie selbst gar nicht mehr wußte, als sie erwachte. Da saß sie nun des Morgens in ihrem Harem und betrachtete den nächtlichen Strauß und sann darüber nach, wie über einen vergessenen Traum, und schickte ihn endlich dem geliebten Kalifen. Der feiste Eunuch, der ihn überbrachte, ergötzte sich sehr an den hübschen Blumen, ohne ihre Bedeutung zu ahnen. Harun al Raschid aber, der Beherrscher der Gläubigen, der Nachfolger des Propheten, der Besitzer des salomonischen Rings, dieser erkannte gleich den Sinn des schönen Straußes, sein Herz jauchzte vor Freude, und er küßte jede Blume, und er lachte, daß ihm die Tränen herabliefen in den langen Bart.
Ich bin kein Nachfolger des Propheten und besitze auch nicht den Ring Salomonis und habe auch keinen langen Bart, aber ich darf dennoch behaupten, daß ich den schönen Selam, den uns Decamps aus dem Morgenlande mitgebracht, noch immer besser verstehe als alle Eunuchen mitsamt ihrem Kislar Aga, dem großen Oberkenner, dem vermittelnden Zwischenläufer im Harem der Kunst. Das Geschwätze solcher verschnittenen Kennerschaft wird mir nachgerade unerträglich, besonders die herkömmlichen Redensarten und der wohlgemeinte gute Rat für junge Künstler und gar das leidige Verweisen auf die Natur und wieder die liebe Natur.
In der Kunst bin ich Supernaturalist. Ich glaube, daß der Künstler nicht alle seine Typen in der Natur auffinden kann, sondern daß ihm die bedeutendsten Typen, als eingeborene Symbolik eingeborner Ideen, gleichsam in der Seele geoffenbart werden. Ein neuerer Ästhetiker, welcher »Italienische Forschungen« geschrieben, hat das alte Prinzip von der Nachahmung der Natur wieder mundgerecht zu machen gesucht, indem er behauptete, der bildende Künstler müsse alle seine Typen in der Natur finden. Dieser Ästhetiker hat, indem er solchen obersten Grundsatz für die bildenden Künste aufstellte, an eine der ursprünglichsten dieser Künste gar nicht gedacht, nämlich an die Architektur, deren Typen man jetzt in Waldlauben und Felsengrotten nachträglich hineingefabelt, die man aber gewiß dort nicht zuerst gefunden hat. Sie lagen nicht in der äußern Natur, sondern in der menschlichen Seele.
Dem Kritiker, der im Decampsschen Bilde die Natur vermißt und die Art, wie das Pferd des Hadji-Bey die Füße wirft und wie seine Leute laufen, als unnaturgemäß tadelt, dem kann der Künstler getrost antworten, daß er ganz märchentreu gemalt und ganz nach innerer Traumanschauung. In der Tat, wenn dunkle Figuren auf hellen Grund gemalt werden, erhalten sie schon dadurch einen visionären Ausdruck, sie scheinen vom Boden abgelöst zu sein und verlangen daher vielleicht etwas umnaterieller, etwas fabelhaft luftiger behandelt zu werden. Die Mischung des Tierischen mit dem Menschlichen in den Figuren auf dem Decampsschen Bilde ist noch außerdem ein Motiv zu ungewöhnlicher Darstellung; in solcher Mischung selbst liegt jener uralte Humor, den schon die Griechen und Römer in unzähligen Mißgebilden auszusprechen wußten, wie wir mit Ergötzen sehen auf den Wänden von Herkulanum und bei den Statuen der Satyren, Zentauren usw. Gegen den Vorwurf der Karikatur schützt aber den Künstler der Einklang seines Werks, jene deliziöse Farbemnusik, die zwar komisch, aber doch harmonisch klingt, der Zauber seines Kolorits. Karikaturmaler sind selten gute Koloristen, eben jener Gemütszerrissenheit wegen, die ihre Vorliebe zur Karikatur bedingt. Die Meisterschaft des Kolorits entspringt ganz eigentlich aus dem Gemüte des Malers und ist abhängig von der Einheit seiner Gefühle. Auf Hogarths Originalgemälden in der Nationalgalerie zu London sah ich nichts als bunte Kleckse, die gegeneinander losschrien, eine Emeute von grellen Farben.
Ich habe vergessen zu erwähnen, daß auf dem Decampsschen Bilde auch einige junge Frauenzimmer, unverschleierte Griechinnen, am Fenster sitzen und den drolligen Zug vorüberfliegen sehen. Ihre Ruhe und Schönheit bildet mit demselben einen ungemein reizenden Kontrast. Sie lächeln nicht, diese Impertinenz zu Pferde mit dem nebenherlaufenden Hundegehorsam ist ihnen ein gewohnter Anblick, und wir fühlen uns dadurch um so wahrhafter versetzt in das Vaterland des Absolutismus.
Nur der Künstler, der zugleich Bürger eines Freistaats ist, konnte mit heiterer Laune dieses Bild malen. Ein anderer als ein Franzose hätte stärker und bitterer die Farben aufgetragen, er hätte etwas Berliner Blau hineingemischt oder wenigstens etwas grüne Galle, und der Grundton der Persiflage wäre verfehlt worden.
Damit mich dieses Bild nicht noch länger festhält, wende ich mich rasch zu einem Gemälde, worauf der Name
Lessore
zu lesen war und das durch seine wunderbare Wahrheit und durch einen Luxus von Bescheidenheit und Einfachheit jeden anzog. Man stutzte, wenn man vorbeiging. »Der kranke Bruder« ist es im Katalog verzeichnet. In einer ärmlichen Dachstube, auf einem ärmlichen Bette, liegt ein siecher Knabe und schaut mit flehenden Augen nach einem rohhölzernen Kruzifixe, das an der kahlen Wand befestigt ist. Zu seinen Füßen sitzt ein anderer Knabe, niedergeschlagenen Blicks, bekümmert und traurig. Sein kurzes Jäckchen und seine Höschen sind zwar reinlich, aber vielfältig geflickt und von ganz grobem Tuche. Die gelbe wollene Decke auf dem Bette und weniger die Möbel als vielmehr der Mangel derselben zeugen von banger Dürftigkeit. Dem Stoffe ganz anpassend ist die Behandlung. Diese er innert zumeist an die Bettlerbilder des Murillo. Scharfgeschnittene Schatten, gewaltige, feste, ernste Striche, die Farben nicht geschwinde hingefegt, sondern ruhigkühn aufgelegt, sonderbar gedämpft und dennoch nicht trübe; den Charakter der ganzen Behandlung bezeichnet Shakespeare mit den Worten: the modesty of nature. Umgeben von brillanten Gemälden mit glänzenden Prachtrahmen, mußte dieses Stück um so mehr auffallen, da der Rahmen alt und von angeschwärztem Golde war, ganz übereinstimmend mit Stoff und Behandlung des Bildes. Solchermaßen konsequent in seiner ganzen Erscheinung und kontrastierend mit seiner ganzen Umgebung, machte dieses Gemälde einen tiefen melancholischen Eindruck auf jeden Beschauer und erfüllte die Seele mit jenem unnennbaren Mitleid, das uns zuweilen ergreift, wenn wir aus dem erleuchteten Saal einer heitern Gesellschaft plötzlich hinaustreten auf die dunkle Straße und von einem zerlumpten Mitgeschöpfe angeredet werden, das über Hunger und Kälte klagt. Dieses Bild sagt viel mit wenigen Strichen, und noch viel mehr erregt es in unserer Seele.
Schnetz
ist ein bekannterer Name. Ich erwähne ihn aber nicht mit so großem Vergnügen wie den vorhergehenden, der bis jetzt wenig in der Kunstwelt genannt worden. Vielleicht weil die Kunstfreunde schon bessere Werke von Schnetz gesehen, gewährten sie ihm viele Auszeichnung, und in Berücksichtigung derselben muß ich ihm auch in diesem Bericht einen Sperrsitz gönnen. Er malt gut, ist aber nach meinen Ansichten kein guter Maler. Sein großes Gemälde im diesjährigen Salon, italienische Landleute, die vor einem Madonnabilde um Wunderhülfe flehen, hat vortreffliche Einzelnheiten, besonders ein starrkrampfbehafteter Knabe ist vortrefflich gezeichnet, große Meisterschaft bekundet sich überall im Technischen; doch das ganze Bild ist mehr redigiert als gemalt, die Gestalten sind deklamatorisch in Szene gesetzt, und es ermangelt innerer Anschauung, Ursprünglichkeit und Einheit. Schnetz bedarf zu vieler Striche, um etwas zu sagen, und was er alsdann sagt, ist zum Teil überflüssig. Ein großer Künstler wird zuweilen ebensowohl wie ein mittelmäßiger etwas Schlechtes geben, aber niemals gibt er etwas Überflüssiges. Das hohe Streben, das große Wollen mag bei einem mittelmäßigen Künstler immerhin achtungswert sein, in seiner Erscheinung kann es jedoch sehr unerquicklich wirken. Eben die Sicherheit, womit er fliegt, gefällt uns so sehr bei dem hochfliegenden Genius; wir erfreuen uns seines hohen Flugs, je mehr wir von der gewaltigen Kraft seiner Flügel überzeugt sind, und vertrauungsvoll schwingt sich unsere Seele mit ihm hinauf in die reinste Sonnenhöhe der Kunst. Ganz anders ist uns zumute bei jenen Theatergenien, wo wir die Bindfäden erblicken, woran sie hinaufgezogen werden, so daß wir, jeden Augenblick den Sturz befürchtend, ihre Erhabenheit nur mit zitterndem Unbehagen betrachten. Ich will nicht entscheiden, ob die Bindfäden, woran Schnetz schwebt, zu dünn sind oder ob sein Genie zu schwer ist, nur soviel kann ich versichern, daß er meine Seele nicht erhoben hat, sondern herabgedrückt.
Ähnlichkeit in den Studien und in der Wahl der Stoffe hat Schnetz mit einem Maler, der oft deshalb mit ihm zusammen genannt wird, der aber in der diesjährigen Ausstellung nicht bloß ihn, sondern auch, mit wenigen Ausnahmen, alle seine Kunstgenossen überflügelt und auch, als Beurkundung der öffentlichen Anerkenntnis, bei der Preisverteilung das Offizierskreuz der Ehrenlegion erhalten hat.
L. Robert
heißt dieser Maler. Ist er ein Historienmaler oder ein Genremaler? höre ich die deutschen Zunftmeister fragen. Leider kann ich hier diese Frage nicht umgehen, ich muß mich über jene unverständigen Ausdrücke etwas verständigen, um den größten Mißverständnissen ein für allemal vorzubeugen. Jene Unterscheidung von Historie und Genre ist so sinnverwirrend, daß man glauben sollte, sie sei eine Erfindung der Künstler, die am babylonischen Turme gearbeitet haben. Indessen ist sie von späterem Datum. In den ersten Perioden der Kunst gab es nur Historienmalerei, nämlich Darstellungen aus der heiligen Historie. Nachher hat man die Gemälde, deren Stoffe nicht bloß der Bibel, der Legende, sondern auch der profanen Zeitgeschichte und der heidnischen Götterfabel entnommen worden, ganz ausdrücklich mit dem Namen Historienmalerei bezeichnet, und zwar im Gegensatze zu jenen Darstellungen aus dem gewöhnlichen Leben, die namentlich in den Niederlanden aufkamen, wo der protestantische Geist die katholischen und mythologischen Stoffe ablehnte, wo für letztere vielleicht weder Modelle noch Sinn jemals vorhanden waren und wo doch so viele ausgebildete Maler lebten, die Beschäftigung wünschten, und so viele Freunde der Malerei, die gerne Gemälde kauften. Die verschiedenen Manifestationen des gewöhnlichen Lebens wurden alsdann verschiedene »Genres«.
Sehr viele Maler haben den Humor des bürgerlichen Kleinlebens bedeutsam dargestellt, doch die technische Meisterschaft wurde leider die Hauptsache. Alle diese Bilder gewinnen aber für uns ein historisches Interesse; denn wenn wir die hübschen Gemälde des Mieris, des Netscher, des Jan Steen, des van Dou, des van der Werff usw. betrachten, offenbart sich uns wunderbar der Geist ihrer Zeit, wir sehen sozusagen dem sechzehnten Jahrhundert in die Fenster und erlauschen damalige Beschäftigungen und Kostüme. In Hinsicht der letztern waren die niederländischen Maler ziemlich begünstigt, die Bauerntracht war nicht unmalerisch, und die Kleidung des Bürgerstandes war bei den Männern eine allerliebste Verbindung von niederländischer Behaglichkeit und spanischer Grandezza, bei den Frauen eine Mischung von bunten Allerweltsgrillen und einheimischem Phlegma. z.B. Mynheer mit dem burgundischen Samtmantel und dem bunten Ritterbarett hatte eine irdene Pfeife im Munde; Mifrow trug schwere schillernde Schleppenkleider von venezianischem Atlas, Brüsseler Kanten, afrikanische Straußfedern, russisches Pelzwerk, westöstliche Pantoffeln und hielt im Arm eine andalusische Mandoline oder ein braunzottiges Hondchen von Saardamer Rasse; der aufwarstende Mohrenknabe, der türkische Teppich, die bunten Papageien, die fremländischen Blumen, die großen Silber- und Goldgeschirre mit getriebenen Arabesken, dergleichen warf auf das holländische Käseleben sogar einen orientalischen Märchenschimmer.
Als die Kunst, nachdem sie lange geschlafen, in unserer Zeit wieder erwachte, waren die Künstler in nicht geringer Verlegenheit ob der darzustellenden Stoffe. Die Sympathie für Gegenstände der heiligen Historie und der Mythologie war in den meisten Ländern Europas gänzlich erloschen, sogar in katholischen Ländern, und doch schien das Kostüm der Zeitgenossen gar zu unmalerisch, um Darstellungen aus der Zeitgeschichte und aus dem gewöhnlichen Leben zu begünstigen. Unser moderner Frack hat wirklich so etwas Grundprosaisches, daß er nur parodistisch in einem Gemälde zu gebrauchen wäre. Die Maler, die ebenfalls dieser Meinung sind, haben sich daher nach malerischen Kostümen umgesehen. Die Vorliebe für ältere geschichtliche Stoffe mag hierdurch besonders befördert worden sein, und wir finden in Deutschland eine ganze Schule, der es freilich nicht an Talenten gebricht, die aber unablässig bemüht ist, die heutigsten Menschen mit den heutigsten Gefühlen in die Garderobe des katholischen und feudalistischen Mittelalters, in Kutten und Harnische, einzukleiden. Andere Maler haben ein anderes Auskunftsmittel versucht: zu ihren Darstellungen wählten sie Volksstämme, denen die herandrängende Zivilisation noch nicht ihre Originalität und ihre Nationaltracht abgestreift. Daher die Szenen aus dem Tiroler Gebirge, die wir auf den Gemälden der Münchener Maler so oft sehen. Dieses Gebirge liegt ihnen so nahe, und das Kostüm seiner Bewohner ist malerischer als das unserer Dandys. Daher auch jene freudigen Darstellungen aus dem italienischen Volksleben, das ebenfalls den meisten Malern sehr nahe ist, wegen ihres Aufenthaltes in Rom, wo sie jene idealische Natur und jene uredle Menschenformen und malerische Kostüme finden, wonach ihr Künstlerherz sich sehnt.
Robert, Franzose von Geburt, in seiner Jugend Kupferstecher, hat späterhin eine Reihe Jahre in Rom gelebt, und zu der eben erwähnten Gattung, zu Darstellungen aus dem italienischen Volksleben, gehören die Gemälde, die er dem diesjährigen Salon geliefert. »Er ist also ein Genremaler«, höre ich die Zunftmeister aussprechen, und ich kenne eine Frau Historienmalerin, die jetzt über ihn die Nase rümpft. Ich kann aber jene Benennung nicht zugeben, weil es, im alten Sinne, keine Historienmalerei mehr gibt. Es wäre gar zu vag, wenn man diesen Namen für alle Gemälde, die einen tiefen Gedanken aussprechen, in Anspruch nehmen wollte und sich dann bei jedem Gemälde herumstritte, ob ein Gedanke darin ist; ein Streit, wobei am Ende nichts gewonnen wird als ein Wort. Vielleicht wenn es in seiner natürlichsten Bedeutung, nämlich für Darstellungen aus der Weltgeschichte, gebraucht würde, wäre dieses Wort Historienmalerei ganz bezeichnend für eine Gattung, die jetzt so üppig emporwächst und deren Blüte schon erkennbar ist in den Meisterwerken von Delaroche.
Doch ehe ich letzteren besonders bespreche, erlaube ich mir noch einige flüchtige Worte über die Robertschen Gemälde. Es sind, wie ich schon angedeutet, lauter Darstellungen aus Italien, Darstellungen, die uns die Holdseligkeit dieses Landes aufs wunderbarste zur Anschauung bringen. Die Kunst, lange Zeit die Zierde von Italien, wird jetzt der Cicerone seiner Herrlichkeit, die sprechenden Farben des Malers offenbaren uns seine geheimsten Reize, ein alter Zauber wird wieder mächtig, und das Land, das uns einst durch seine Waffen und später durch seine Worte unterjochte, unterjocht uns jetzt durch seine Schönheit. Ja, Italien wird uns immer beherrschen, und Maler wie Robert fesseln uns wieder an Rom.
Wenn ich nicht irre, kennt man schon durch Lithographie die Pifferari von Robert, die jetzt zur Ausstellung gekommen sind und jene Pfeifer aus den albanischen Gebirgen vorstellen, welche um Weihnachtzeit nach Rom kommen, vor den Marienbildern musizieren und gleichsam der Muttergottes ein heiliges Ständchen bringen. Dieses Stück ist besser gezeichnet als gemalt, es hat etwas Schroffes, Trübes, Bolognesisches, wie etwa ein kolorierter Kupferstich. Doch bewegt es die Seele, als hörte man die naiv fromme Musik, die eben von jenen albanischen Gebirgshirten gepfiffen wird.
Minder einfach, aber vielleicht noch tiefsinniger ist ein anderes Bild von Robert, worauf man eine Leiche sieht, die unbedeckt, nach italienischer Sitte, von der barmherzigen Brüderschaft zu Grabe getragen wird. Letztere, ganz schwarz vermummt, in der schwarzen Kappe nur zwei Löcher für die Augen, die unheimlich herauslugen, schreitet dahin wie ein Gespensterzug. Auf einer Bank im Vordergrunde, dem Beschauer entgegen, sitzt der Vater, die Mutter und der junge Bruder des Verstorbenen. Ärmlich gekleidet, tiefbekümmert, gesenkten Hauptes und mit gefalteten Händen sitzt der alte Mann in der Mitte zwischen dem Weibe und dem Knaben. Er schweigt; denn es gibt keinen größeren Schmerz in dieser Welt als den Schmerz eines Vaters, wenn er gegen die Sitte der Natur sein Kind überlebt. Die gelbbleiche Mutter scheint verzweiflungsvoll zu jammern. Der Knabe, ein armer Tölpel, hat ein Brot in den Händen, er will davon essen, aber kein Bissen will ihm munden ob des unbewußten Mitkummers, und um so trauriger ist seine Miene. Der Verstorbene scheint der älteste Sohn zu sein, die Stütze und Zierde der Familie, korinthische Säule des Hauses: und jugendlich blühend, anmutig und fast lächelnd liegt er auf der Bahre, so daß in diesem Gemälde das Leben trüb, häßlich und traurig, der Tod aber unendlich schön erscheint, ja anmutig und fast lächelnd.
Der Maler, der so schön den Tod verklärt, hat jedoch das Leben noch weit herrlicher darzustellen gewußt: sein großes Meisterwerk, »Die Schnitter«, ist gleichsam die Apotheose des Lebens; bei dem Anblick desselben vergißt man, daß es ein Schattenreich gibt, und man zweifelt, ob es irgendwo herrlicher und lichter sei als auf dieser Erde. »Die Erde ist der Himmel, und die Menschen sind heilig durchgöttert«, das ist die große Offenbarung, die mit seligen Farben aus diesem Bilde leuchtet. Das Pariser Publikum hat dieses gemalte Evangelium besser aufgenommen, als wenn der heilige Lukas es geliefert hätte. Die Pariser haben jetzt gegen letztern sogar ein allzu ungünstiges Vorurteil.
Eine öde Gegend der Romagna im italienisch blühendsten Abendlichte erblicken wir auf dem Robertschen Gemälde. Der Mittelpunkt desselben ist ein Bauerwagen, der von zwei großen, mit schweren Ketten geschirrten Büffeln gezogen wird und mit einer Familie von Landleuten beladen ist, die eben haltmachen will. Rechts sitzen Schnitterinnen neben ihren Garben und ruhen aus von der Arbeit, während ein Dudelsackpfeifer musiziert und ein lustiger Gesell zu diesen Tönen tanzt, seelenvergnügt, und es ist, als hörte man die Melodie und die Worte:
Damigella, tutta bella,
Versa, versa il bel vino!