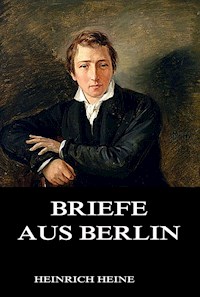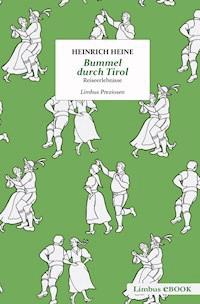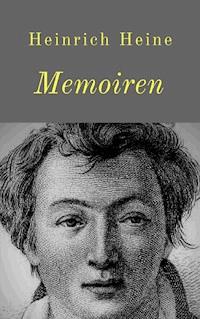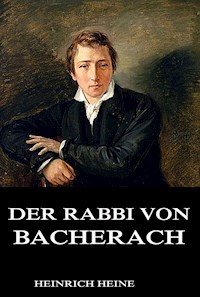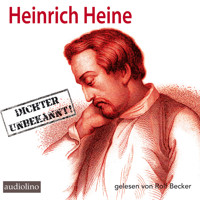Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Inhalt: "Die deutsche Literatur" Einleitung zu "Kahldorf über den Adel Verschiedenartige Geschichtsauffassung Vorrede zum ersten Band des "Salon" Die Götter im Exil Einleitung zum "Don Quixote" Über den Denunzianten Der Schwabenspiegel Schriftstellernöten Erklärung Ludwig Börne Shakespeares Mädchen und Frauen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays III: Aufsätze und Streitschriften
Heinrich Heine
Inhalt:
Heinrich Heine – Biografie und Bibliografie
»Die deutsche Literatur«
Einleitung zu »Kahldorf über den Adel
Verschiedenartige Geschichtsauffassung
Vorrede zum ersten Band des »Salon«
Die Götter im Exil
Einleitung zum »Don Quixote«
Über den Denunzianten
Der Schwabenspiegel
Schriftstellernöten
Erklärung
Ludwig Börne
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Shakespeares Mädchen und Frauen
[Einleitung]
Tragödien
Cressida
Kassandra
Helena
Virgilia
Portia
Cleopatra
Lavinia
Constanze
Lady Percy
Prinzessin Katharina
Johanna d'Arc
Margareta
Königin Margareta
Lady Grey
Lady Anna
Königin Katharina
Anna Boleyn
Lady Macbeth
Ophelia
Cordelia
Julie
Desdemona
Jessica
Porzia
Komödien
Miranda
Titania
Perdita
Imogen
Julie
Silvia
Hero
Beatrice
Helena
Celia
Rosalinde
Olivia
Viola
Maria
Isabella
Prinzessin von Frankreich
Die Äbtissin
Frau Page
Frau Ford
Anna Page
Katharina
[Schluß]
Essays III, Heinrich Heine
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849619756
www.jazzybee-verlag.de
Dieses Werk bzw. Inhalt und Zusammenstellung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. Die Details der Lizenz und zu der Weiterverwertung dieses Werks finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. Der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon wurden der TextGrid-Datenbank entnommen, wo der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon ebenfalls unter voriger Lizenz verfügbar sind. Eine bereits bestehende Allgemeinfreiheit der Texte bleibt von der Lizensierung unberührt.
Heinrich Heine – Biografie und Bibliografie
Berühmter Dichter und Schriftsteller, geb. 13. Dez. 1797 in Düsseldorf, gest. 17. Febr. 1856 in Paris, war der Sohn unbegüterter jüdischer Eltern, erhielt die ersten und wichtigsten politischen Eindrücke zu der Zeit, als die Rheinlande unter der antifeudalen Herrschaft Napoleons standen (1806–13), besuchte 1808–15 das Lyzeum (Gymnasium) und sollte dann Kaufmann werden. Nach verunglückten Versuchen in dieser Laufbahn (in Hamburg 1816–1819) widmete sich H. mit Unterstützung seines reichen Oheims Salomon H. (s. oben) 1819–24 den Rechtsstudien in Bonn, Göttingen und Berlin, doch besuchte er zugleich germanistische und philosophische Vorlesungen mit Eifer. Er trat 28. Juni 1825 zum Christentum über, promovierte 20. Juli d. J. in Göttingen und beabsichtigte hierauf, sich als Rechtsanwalt in Hamburg niederzulassen, unterließ dies jedoch wegen mannigfacher Anfeindungen und lebte abwechselnd in London, München (1828, als Redakteur von Cottas »Politischen Annalen«), Oberitalien, namentlich aber in Berlin und Hamburg, bis er, durch Verdruß und Enttäuschungen niedergedrückt, 1831 nach Paris übersiedelte, dem damaligen Mekka des Liberalismus. In dieser ersten Epoche waren die Herzenserlebnisse, die er durch die unglückliche Liebe zu seiner Cousine Amalie H. und später zu deren jüngerer Schwester Therese erfuhr, auf seine dichterische Entwickelung von tiefstem Einfluß. Seine lyrischen Bekenntnisse beruhen großenteils auf diesen Erfahrungen. Trotz gelegentlicher Sehnsucht nach Deutschland, die H. in Paris empfand, war es ihm nicht mehr möglich, wieder dauernd dahin zurückzukehren; er konnte es nur zweimal, im Herbst 1843 und im Sommer 1844, besuchen. Durch den berüchtigten Bundestagsbeschluß vom Dezember 1835, der alle Schriften des sogen. Jungen Deutschland, wozu auch H. gerechnet wurde, verbot, wurde seine finanzielle Lage sehr gefährdet. Sein Haupteinkommen bestand in einer jährlichen Pension von 4000, seit 1838 von 4800 Frank, die ihm sein Oheim Salomon, der Vater von Amalie und Therese, ausgesetzt hatte. In Paris trat H. seit Oktober 1834 in leidenschaftliche Beziehungen zu einer schönen, gutherzigen, aber ungebildeten und allzu lebenslustigen Französin, Eugenie Mirat (gest.19. Febr. 1883 in Passy bei Paris), mit der er sich 31. Aug. 1841 auch kirchlich trauen ließ. Infolge seiner großen Finanznot tat er 1836 oder 1837 den bedenklichsten Schritt seines Lebens, indem er sich um eine Staatspension aus dem geheimen Fonds der französischen Regierung bewarb, die ihm in der Höhe von 4800 Frank jährlich bis zum Sturz der Julimonarchie 1848 gewährt wurde. 1845 befiel ihn ein Rückenmarkleiden, das ihn seit dem Frühling 1848 bis zu seinem Tod an das Krankenlager, die »Matratzengruft«, fesselte. Trotz seines jammervollen körperlichen Zustandes bewahrte er aber eine bewundernswürdige Frische des Geistes, und manche seiner bedeutendsten Schöpfungen in Vers und in Prosa sind hier entstanden: sein Witz verließ ihn nicht, und seine Weltanschauung vertiefte sich unter der schweren Zucht der Leiden. Heines Grab auf dem Friedhof von Montmartre in Paris wurde 1901 mit einer Marmorbüste von Hasselrijs geschmückt, der auch auf Korfu für das Schloß Achilleion der Kaiserin Elisabeth von Österreich ein Denkmal des Dichters errichtet hatte. Dagegen wurde die Errichtung eines solchen in einer deutschen Stadt verhindert, und das von Herter entworfene Standbild fand 1896 in New York einen wenig günstigen Platz.
In die literarische Welt trat H. mit »Gedichten« (Berl. 1822) ein, denen bald darauf die »Tragödien mit einem lyrischen Intermezzo« (das. 1823) folgten. Die Gedichte fanden sofort von den hervorragendsten Stimmführern der damaligen Kritik, von Varnhagen, Immermann, die wärmste Anerkennung, aber noch viel mehr Erfolg hatten die zwei ersten Bände von Heines »Reisebildern« (Hamb. 1826–27), die später durch zwei neue Bände (das. 1830–31) vermehrt wurden. Hier hatte sich ein geniales Individuum, romantisch und revolutionär zugleich, mit ungebundenster Subjektivität und mit bis dahin unbekanntem souveränen Witz über alles, was die Zeit interessierte, ausgelassen und Naturbilder voll tiefster Poesie, Menschenbilder von plastischer Kraft entworfen. Die hier eingeflochtenen Lieder gab H. vereint mit den früher veröffentlichten und durch neue vermehrt im »Buch der Lieder« (Hamb. 1827) heraus, das, immer neu aufgelegt, als einer der größten Schätze deutscher Poesie bis auf die Gegenwart anerkannt ist. Nach seiner Übersiedelung nach Paris übernahm es H., zwischen den Deutschen und Franzosen geistig zu vermitteln. So entstanden die ausgezeichneten Beiträge »Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland« (Par. u. Leipz. 1833, 2 Bde.; neue Aufl. u. d. T. »Die romantische Schule«, Hamb. 1836); dann die »Französischen Zustände« (das. 1833), eine Sammlung seiner aus Paris für die »Allgemeine Zeitung« in Augsburg geschriebenen Aufsätze, mit einer gegen die Reaktion in Preußen gerichteten äußerst heftigen Vorrede, und »Der Salon« (das. 1835–40, 4 Bde.), in dem er sehr eigenartig über die Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland einerseits sowie bei allem Humor mit sittlichem Ernst über französisches Leben, Politik, Bühne und Kunst anderseits berichtete und humoristische Novellen, wie die »Memoiren des Herrn von Schnabelewopski« und die »Florentinischen Nächte«, veröffentlichte. In Paris lernte H. auch die Anfänge des Sozialismus in Saint-Simon und Enfantin kennen, für deren Lehren er sich erwärmte, und die er eigentümlich zu einer Theorie des heidnisch-lebensfreudigen Sensualismus im Gegensatz zum christlich-jüdischen Spiritualismus ausbildete. In den erwähnten Schriften über deutsche Literatur und Philosophie zeigen sich die deutlichsten Spuren hiervon. Nach der unbedeutenderen Arbeit über »Shakespeares Mädchen und Frauen« (Par. u. Leipz. 1839) gab H. die großen Skandal hervorrufende Denkschrift »Ludwig Börne« (Hamb. 1840) heraus, in der er seinen tiefen Gegensatz zum »spiritualistischen Nazarener« Börne am schärfsten äußerte. H. war bei all seinem Liberalismus doch geistiger Aristokrat und besaß für die hitzige Gesinnungstüchtigkeit Börnes nicht das geringste Verständnis. H. wendete sich in dieser Zeit auch in seinen Gedichten der Politik zu, zumal in den »Neuen Gedichten« (Hamb. 1844), deren vorzügliche Romanzen zu seinen besten Leistungen gehören. Als neuer Aristophanes, aber zugleich als alles vaterländischen Gefühles bar erwies er sich in dem satirischen Epos: »Deutschland, ein Wintermärchen« (Hamb. 1844), während sein »Atta Troll« (das. 1847) durch glänzende Schilderungen und gesunde, echt poetische Tendenz ausgezeichnet ist. Noch folgte aus Heines Krankenstube die berühmte Gedichtsammlung »Romancero« (Hamb. 1851), die seine schönsten Balladen und ergreifendsten Klagen enthält und in einem »Nachwort« des Dichters Rückkehr zum Theismus bekennt; ferner das phantastische Tanzpoem »Der Doktor Faust« (das. 1851) und »Vermischte Schriften« (das. 1854, 3 Bde.). Aus seinem Nachlaß erschienen »Letzte Gedichte und Gedanken« (Hamb. 1869) und viele Jahre nach seinem Tod ein nur die früheste Jugend schildern des Fragment seiner »Memoiren« (hrsg. von E. Engel, das. 1884); über das Schicksal des übrigen Teiles davon ist nichts Sicheres bekannt.
Heines Bedeutung ist schwer abzuschätzen; das Urteil über ihn ist durch der Parteien Haß und Gunst verzerrt. Seine dichterischen Gaben waren zweifellos sehr bedeutend; er besitzt die zarteste Innigkeit des Gefühls, berauschende Leidenschaft, große Anschaulichkeit der Phantasie, überraschende Einfälle und Gedankenblitze und vor allem einen zündenden, unerschöpflichen Witz; dabei verfügt er in Vers und Prosa über eine höchst einschmeichelnde und individuelle Sprache. Aber die Fehler, Schwächen und Unarten seines im Grunde doch gutmütigen Charakters zerrütteten sein Leben und zerfetzten seine Poesie, so daß durch die Vereinigung von hoher Begeisterung und niedriger Prosa, von Pathos und Gemeinheit eine durchgängige Disharmonie in Heines Werken anzutreffen ist. Sein Einfluß auf die weitere Entwickelung unsrer Literatur war und ist jedoch kaum zu ermessen, und selbst Geister von ganz abweichender Grundrichtung verraten die Abhängigkeit von ihm.
Die erste Gesamtausgabe der Werke Heines besorgte A. Strodtmann (Hamb. 1861–66, 21 Bde.), die beste kritische Ausgabe mit allen Lesarten, mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen Elster (Leipz. 1887–90, 7 Bde.). Heines Werke wurden wiederholt in alle Kultursprachen, auch ins Japanische, übersetzt. Er ist im Ausland einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Dichter. Aber aus der überaus großen Fülle der Übersetzungen können hier nur die »Œuvres« (Par. 1834–35, 6 Bde.) und die »Œuvres complètes« (das. 1852 ff., 14 Bde.) erwähnt werden, deren erste vollständig u. deren zweite bis zum 7. Band unter des Dichters Mitwirkung entstanden. Zahllos sind die Kompositionen Heinescher Gedichte, deren berühmteste die von Rob. Schumann. Aus der reichen Literatur über H. heben wir hervor: Alfred Meißner, Heinrich H. (Hamb. 1856); Strodtmann, Heinrich Heines Leben und Werke (Berl. 1867–69, 2 Bde.; 3. Aufl. 1884); Hüffer, Aus dem Leben Heinrich Heines (das. 1877); Karpeles, Heinrich H. und seine Zeitgenossen (das. 1887) und Heinrich H. Aus seinem Leben und seiner Zeit (Leipz. 1899); Bölsche, Heinrich H. Versuch einer ästhetisch-kritischen Analyse seiner Werke (das. 1887); Elster, Heines Buch der Lieder nebst einer Nachlese nach den ersten Drucken und Handschriften (Heilbr. 1887) und Zu Heines Biographie (in der »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte«, Bd. 4), ferner dessen Einleitung zur Pantheonausgabe des »Buchs der Lieder« (Berl. 1902); Keiter, Heinrich H. (in den Schriften der Görres-Gesellschaft, Köln 1891); Legras, Henri H. poète (Par. 1897); G. Brandes, Das junge Deutschland (Leipz. 1891).
»Die deutsche Literatur«
Von Wolfgang Menzel
2 Teile. Stuttgart, bei Gebrüder Franckh. 1828
»Wisse, daß jedes Werk, das da wert war zu erscheinen, sogleich bei seiner Erscheinung gar keinen Richter finden kann; es soll sich erst sein Publikum erziehen und einen Richterstuhl für sich bilden. – – Spinoza hat über ein Jahrhundert gelegen, ehe ein treffendes Wort über ihn gesagt wurde; über Leibniz ist vielleicht das erste treffende Wort noch zu erwarten, über Kant ganz gewiß. Findet ein Buch sogleich bei seiner Erscheinung seinen kompetenten Richter, so ist dies der treffende Beweis, daß dieses Buch ebensowohl auch ungeschrieben hätte bleiben können.«
Diese Worte sind von Johann Gottlieb Fichte, und wir setzen sie als Motto vor unsere Rezension des Menzelschen Werks, teils, um anzudeuten, daß wir nichts weniger als eine Rezension liefern, teils auch, um den Verfasser zu trösten, wenn über den eigentlichen Inhalt seines Buches nichts Ergründendes gesagt wird, sondern nur dessen Verhältnis zu anderen Büchern der Art, dessen Äußerlichkeiten und besonders hervorstehende Gedankenspitzen besprochen werden.
Indem wir nun zuvörderst zu ermitteln suchen, mit welchen vorhandenen Büchern der Art das vorliegende Werk vergleichend zusammengestellt werden kann, kommen uns Friedrich Schlegels Vorlesungen über Literatur fast ausschließlich in Erinnerung. Auch dieses Buch hat nicht seinen kompetenten Richter gefunden, und wie stark sich auch in der letzteren Zeit, aus kleinlich protestantischen Gründen, manche absprechende Stimmen gegen Friedrich Schlegel erhoben haben, so war doch noch keiner imstande, beurteilend sich über den großen Beurteiler zu erheben; und wenn wir auch eingestehen müssen, daß ihm an kritischem Scharfblick sein Bruder August Wilhelm und einige neuere Kritiker, z.B. Willibald Alexis, Zimmermann, Varnhagen v. Ense und Immermann, ziemlich überlegen sind, so haben uns diese bisher doch nur Monographien geliefert, während Friedrich Schlegel großartig das Ganze aller geistigen Bestrebungen erfaßte, die Erscheinungen derselben gleichsam wieder zurückschuf in das ursprüngliche Schöpfungswort, woraus sie hervorgegangen, so daß sein Buch einem schaffenden Geisterliede gleicht.
Die religiösen Privatmarotten, die Schlegels spätere Schriften durchkreuzen und für die er allein zu schreiben wähnte, bilden doch nur das Zufällige, und namentlich in den Vorlesungen über Literatur ist, vielleicht mehr, als er selbst weiß, die Idee der Kunst noch immer der herrschende Mittelpunkt, der mit seinen goldenen Radien das ganze Buch umspinnt. Ist doch die Idee der Kunst zugleich der Mittelpunkt jener ganzen Literaturperiode, die mit dem Erscheinen Goethes anfängt und erst jetzt ihr Ende erreicht hat, ist sie doch der eigentliche Mittelpunkt in Goethe selbst, dem großen Repräsentanten dieser Periode – und wenn Friedrich Schlegel, in seiner Beurteilung Goethes, demselben allen Mittelpunkt abspricht, so hat dieser Irrtum vielleicht seine Wurzel in einem verzeihlichen Unmut. Wir sagen »verzeihlich«, um nicht das Wort »menschlich« zu gebrauchen: die Schlegel, geleitet von der Idee der Kunst, erkannten die Objektivität als das höchste Erfordernis eines Kunstwerks, und da sie diese im höchsten Grade bei Goethe fanden, hoben sie ihn auf den Schild, die neue Schule huldigte ihm als König, und als er König war, dankte er, wie Könige zu danken pflegen, indem er die Schlegel kränkend ablehnte und ihre Schule in den Staub trat.
Menzels »Deutsche Literatur« ist ein würdiges Seitenstück zu dem erwähnten Werke von Friedrich Schlegel. Dieselbe Großartigkeit der Auffassung, des Strebens, der Kraft und des Irrtums. Beide Werke werden den späteren Literatoren Stoff zum Nachdenken liefern, indem nicht bloß die schönsten Geistesschätze darin niedergelegt sind, sondern indem auch ein jedes dieser beiden Werke ganz die Zeit charakterisiert, worin es geschrieben ist. Dieser letztere Umstand gewährt auch uns das meiste Vergnügen bei der Vergleichung beider Werke. In dem Schlegelschen sehen wir ganz die Bestrebungen, die Bedürfnisse, die Interessen, die gesamte deutsche Geistesrichtung der vorletzten Dezennien und die Kunstidee als Mittelpunkt des Ganzen. Bilden aber die Schlegelschen Vorlesungen solchermaßen ein Literaturepos, so erscheint uns hingegen das Menzelsche Werk wie ein bewegtes Drama, die Interessen der Zeit treten auf und halten ihre Monologe, die Leidenschaften, Wünsche, Hoffnungen, Furcht und Mitleid sprechen sich aus, die Freunde raten, die Feinde drängen, die Parteien stehen sich gegenüber, der Verfasser läßt allen ihr Recht widerfahren, als echter Dramatiker behandelt er keine der kämpfenden Parteien mit allzu besonderer Vorliebe, und wenn wir etwas vermissen, so ist es nur der Chorus, der die letzte Bedeutung des Kampfes ruhig ausspricht. Diesen Chorus aber konnte uns Herr Menzel nicht geben wegen des einfachen Umstandes, daß er noch nicht das Ende dieses Jahrhunderts erlebt hat. Aus demselben Grunde erkannten wir bei einem Buche aus einer früheren Periode, dem Schlegelschen, weit leichter den eigentlichen Mittelpunkt als bei einem Buche aus der jetzigsten Gegenwart. Nur soviel sehen wir, der Mittelpunkt des Menzelschen Buches ist nicht mehr die Idee der Kunst. Menzel sucht viel eher das Verhältnis des Lebens zu den Büchern aufzufassen, einen Organismus in der Schriftwelt zu entdecken, es ist uns manchmal vorgekommen, als betrachte er die Literatur wie eine Vegetation – und da wandelt er mit uns herum und botanisiert und nennt die Bäume bei ihren Namen, reißt Witze über die größten Eichen, riecht humoristisch an jedem Tulpenbeet, küßt jede Rose, neigt sich freundlich zu einigen befreundeten Wiesenblümchen und schaut dabei so klug, daß wir fast glauben möchten, er höre das Gras wachsen.
Andererseits erkennen wir bei Menzel ein Streben nach Wissenschaftlichkeit, welches ebenfalls eine Tendenz unserer neuesten Zeit ist, eine jener Tendenzen, wodurch sie sich von der früheren Kunstperiode unterscheidet. Wir haben große geistige Eroberungen gemacht, und die Wissenschaft soll sie als unser Eigentum sichern. Diese Bedeutung derselben hat sogar die Regierung in einigen deutschen Staaten anerkannt, absonderlich in Preußen, wo die Namen Humboldt, Hegel, Bopp, A. W. Schlegel, Schleiermacher etc. in solcher Hinsicht am schönsten glänzen. Dasselbe Streben hat sich, zumeist durch Einwirkung solcher deutschen Gelehrten, nach Frankreich verbreitet; auch hier erkennt man, daß alles Wissen einen Wert an und für sich hat, daß es nicht wegen der augenblicklichen Nützlichkeit kultiviert werden soll, sondern damit es seinen Platz finde in dem Gedankenreiche, das wir als das beste Erbteil den folgenden Geschlechtern überliefern werden.
Herr Menzel ist mehr ein enzyklopädischer Kopf als ein synthetisch wissenschaftlicher. Da ihn aber sein Willen zur Wissenschaftlichkeit drängt, so finden wir in seinem Buche eine seltsame Vereinigung seiner Naturanlage mit seinem vorgefaßten Streben. Die Gegenstände entsteigen daher nicht aus einem einzigen innersten Prinzip, sie werden vielmehr nach einem geistreichen Schematismus einzeln abgehandelt, aber doch ergänzend, so daß das Buch ein schönes, gerundetes Ganze bildet.
In dieser Hinsicht gewinnt vielleicht das Buch für das große Publikum, dem die Übersicht erleichtert wird und das auf jeder Seite etwas Geistreiches, Tiefgedachtes und Anziehendes findet, welches nicht erst auf ein letztes Prinzip bezogen werden muß, sondern an und für sich schon seinen vollgültigen Wert hat. Der Witz, den man in Menzelschen Geistesprodukten zu suchen berechtigt ist, wird durchaus nicht vermißt, er erscheint um so würdiger, da er nicht mit sich selbst kokettiert, sondern nur der Sache wegen hervortritt – obgleich sich nicht leugnen läßt, daß er Herrn Menzel oft dazu dienen muß, die Lücken seines Wissens zu stopfen. H. M. ist unstreitig einer der witzigsten Schriftsteller Deutschlands, er kann seine Natur nicht verleugnen, und möchte er auch, alle witzigen Einfälle ablehnend, in einem steifen Perückentone dozieren, so überrascht ihn wenigstens der Ideenwitz, und diese Witzart, eine Verknüpfung von Gedanken, die sich noch nie in einem Menschenkopfe begegnet, eine wilde Ehe zwischen Scherz und Weisheit, ist vorherrschend in dem Menzelschen Werke. Nochmal rühmen wir des Verfassers Witz, um so mehr, da es viele trockene Leute in der Welt gibt, die den Witz gern proskribieren möchten, und man täglich hören kann, wie Pantalon sich gegen diese niedrigste Seelenkraft, den Witz, zu ereifern weiß und als guter Staatsbürger und Hausvater die Polizei auffordert, ihn zu verbieten. Mag immerhin der Witz zu den niedrigsten Seelenkräften gehören, so glauben wir doch, daß er sein Gutes hat. Wir wenigstens möchten ihn nicht entbehren. Seitdem es nicht mehr Sitte ist, einen Degen an der Seite zu tragen, ist es durchaus nötig, daß man Witz im Kopfe habe. Und sollte man auch so überlaunig sein, den Witz nicht bloß als notwendige Wehr, sondern sogar als Angriffswaffe zu gebrauchen, so werdet darüber nicht allzusehr aufgebracht, ihr edlen Pantalone des deutschen Vaterlandes! Jener Angriffswitz, den ihr Satire nennt, hat seinen guten Nutzen in dieser schlechten, nichtsnutzigen Zeit. Keine Religion ist mehr imstande, die Lüste der kleinen Erdenherrscher zu zügeln, sie verhöhnen euch ungestraft, und ihre Rosse zertreten eure Saaten, eure Töchter hungern und verkaufen ihre Blüten dem schmutzigen Parvenü, alle Rosen dieser Welt werden die Beute eines windigen Geschlechtes von Stockjobbern und bevorrechteten Lakaien, und vor dem Übermut des Reichtums und der Gewalt schützt euch nichts – als der Tod und die Satire.
»Universalitätist der Charakter unserer Zeit«, sagt Herr Menzel im zweiten Teile S. 63 seines Werkes, und da dieses letztere, wie wir oben bemerkt, ganz den Charakter unserer Zeit trägt, so finden wir darin auch ein Streben nach jener Universalität. Daher ein Verbreiten über alle Richtungen des Lebens und des Wissens, und zwar unter folgenden Rubriken: »Die Masse der Literatur, Nationalität, Einfluß der Schulgelehrsamkeit, Einfluß der fremden Literatur, der literarische Verkehr, Religion, Philosophie, Geschichte, Staat, Erziehung, Natur, Kunst und Kritik.« Es ist zu bezweifeln, ob ein junger Gelehrter in allen möglichen Disziplinen so tief eingeweiht sein kann, daß wir eine gründliche Kritik des neuesten Zustandes derselben von ihm erwarten dürften. Herr Menzel hat sich durch Divination und Konstruktion zu helfen gewußt. Im Divinieren ist er oft sehr glücklich, im Konstruieren immer geistreich. Wenn auch zuweilen seine Annahmen willkürlich und irrig sind, so ist er doch unübertrefflich im Zusammenstellen des Gleichartigen und der Gegensätze. Er verfährt kombinatorisch und konziliatorisch. Den Zweck dieser Blätter berücksichtigend, wollen wir als eine Probe der Menzelschen Darstellungsweise die folgende Stelle aus der Rubrik »Staat« mitteilen:
»Bevor wir die Literatur der politischen Praxis betrachten, wollen wir einen Blick auf die Theorien werfen. Alle Praxis geht von den Theorien aus. Es ist jetzt nicht mehr die Zeit, da die Völker aus einem gewissen sinnlichen Übermut oder aus zufälligen örtlichen Veranlassungen in einen vorübergehenden Hader geraten. Sie kämpfen vielmehr um Ideen, und eben darum ist ihr Kampf ein allgemeiner, im Herzen eines jeden Volks selbst, und nur insofern eines Volks wider das andere, als bei dem einen diese, bei dem anderen jene Idee das Übergewicht behauptet. Der Kampf ist durchaus philosophisch geworden, so wie er früher religiös gewesen. Es ist nicht ein Vaterland, nicht ein großer Mann, worüber man streitet, sondern es sind Überzeugungen, denen die Völker wie die Helden sich unterordnen müssen. Völker haben mit Ideen gesiegt, aber sobald sie ihren Namen an die Stelle der Idee zu setzen gewagt, sind sie zuschanden geworden; Helden haben durch Ideen eine Art von Weltherrschaft erobert, aber sobald sie die Idee verlassen, sind sie in Staub gebrochen. Die Menschen haben gewechselt, nur die Ideen sind bestanden. Die Geschichte war nur die Schule der Prinzipien. Das vorige Jahrhundert war reicher an voraussichtigen Spekulationen, das gegenwärtige ist reicher an Rücksichten und Erfahrungsgrundsätzen. In beiden liegen die Hebel der Begebenheiten, durch sie wird alles erklärt, was geschehen ist.
Es gibt nur zwei Prinzipe oder entgegengesetzte Pole der politischen Welt, und an beiden Endpunkten der großen Achse haben die Parteien sich gelagert und bekämpfen sich mit steigender Erbitterung. Zwar gilt nicht jedes Zeichen der Partei für jeden ihrer Anhänger, zwar wissen manche kaum, daß sie zu dieser bestimmten Partei gehören, zwar bekämpfen sich die Glieder einer Partei untereinander selbst, sofern sie aus ein und demselben Prinzip verschiedene Folgerungen ziehen; im allgemeinen aber muß der subtilste Kritiker so gut wie das gemeine Zeitungspublikum einen Strich ziehen zwischen Liberalismus und Servilismus, Republikanismus und Autokratie. Welches auch die Nuancen sein mögen, jenes clair-obscur und jene bis zur Farblosigkeit gemischten Tinten, in welche beide Hauptfarben ineinander übergehen, diese Hauptfarben selbst verbergen sich nirgends, sie bilden den großen, den einzigen Gegensatz in der Politik, und man sieht sie den Menschen wie den Büchern gewöhnlich auf den ersten Blick an. Wohin wir im politischen Gebiet das Auge werfen, trifft es diese Farben an. Sie füllen es ganz aus, hinter ihnen ist leerer Raum.
Die liberale Partei ist diejenige, die den politischen Charakter der neueren Zeit bestimmt, während die sogenannte servile Partei noch wesentlich im Charakter des Mittelalters handelt. Der Liberalismus schreitet daher in demselben Maße fort wie die Zeit selbst oder ist in dem Maße gehemmt, wie die Vergangenheit noch in die Gegenwart herüberdauert. Er entspricht dem Protestantismus, sofern er gegen das Mittelalter protestiert, er ist nur eine neue Entwickelung des Protestantismus im weltlichen Sinn, wie der Protestantismus ein geistlicher Protestantismus war. Er hat seine Partei in dem gebildeten Mittelstande, während der Servilismus die seinige in den Vornehmen und in der rohen Masse findet. Dieser Mittelstand schmilzt allmählich immer mehr die starren Kristallisationen der mittelalterlichen Stände zusammen. Die ganze neuere Bildung ist aus dem Liberalismus hervorgegangen oder hat ihm gedient, sie war die Befreiung von dem kirchlichen Autoritätsglauben. Die ganze Literatur ist ein Triumph des Liberalismus, denn seine Feinde sogar müssen in seinen Waffen fechten. Alle Gelehrte, alle Dichter haben ihm Vorschub geleistet, seinen größten Philosophen aber hat er in Fichte, seinen größten Dichter in Schiller gefunden.«
Unter der Rubrik »Philosophie« bekennt sich Herr Menzel ganz zu Schelling, und unter der Rubrik »Natur« hat er dessen Lehre, wie sich gebührt, gefeiert. Wir stimmen überein in dem, was er über diesen allgemeinen Weltdenker ausspricht. Görres und Steffens finden als Schellingsche Unterdenker ebenfalls ihre Anerkennung. Ersterer ist mit Vorliebe gewürdigt, seine Mystik etwas allzu poetisch gerühmt. Doch sehen wir diesen hohen Geist immer lieber überschätzt als parteiisch verkleinert. Steffens wird als Repräsentant des Pietismus dargestellt, und die Ansichten, die der Verfasser von Mystik und Pietismus hegt, sind, wenn auch irrig, doch immer tiefsinnig, schöpferisch und großartig. Wir erwarten nicht viel Gutes vom Pietismus, obgleich Herr Menzel sich abmüht, das Beste von ihm zu prophezeien. Wir teilen die Meinung eines witzigen Mannes, der keck behauptet: unter hundert Pietisten sind neunundneunzig Schurken und ein Esel. Von frömmelnden Heuchlern ist kein Heil zu erwarten, und durch Eselsmilch wird unsere schwache Zeit auch nicht sehr erstarken. Weit eher dürfen wir Heil vom Mystizismus erwarten. In seiner jetzigen Erscheinung mag er immerhin widerwärtig und gefährlich sein; in seinen Resultaten kann er heilsam wirken. Dadurch, daß der Mystiker sich in die Traumwelt seiner innern Anschauung zurückzieht und in sich selbst die Quelle aller Erkenntnis annimmt: dadurch ist er der Obergewalt jeder äußern Autorität entronnen, und die orthodoxesten Mystiker haben auf diese Art in der Tiefe ihrer Seele jene Urwahrheiten wiedergefunden, die mit den Vorschriften des positiven Glaubens im Widerspruch stehen, sie haben die Autorität der Kirche geleugnet und haben mit Leib und Leben ihre Meinung vertreten. Ein Mystiker aus der Sekte der Essäer war jener Rabbi, der in sich selbst die Offenbarung des Vaters erkannte und die Welt erlöste von der blinden Autorität steinerner Gesetze und schlauer Priester; ein Mystiker war jener deutsche Mönch, der in seinem einsamen Gemüte die Wahrheit ahnte, die längst aus der Kirche verschwunden war; – und Mystiker werden es sein, die uns wieder vom neueren Wortdienst erlösen und wieder eine Naturreligion begründen, eine Religion, wo wieder freudige Götter aus Wäldern und Steinen hervorwachsen und auch die Menschen sich göttlich freuen. Die katholische Kirche hat jene Gefährlichkeit des Mystizismus immer tief gefühlt; daher, im Mittelalter, beförderte sie mehr das Studium des Aristoteles als des Plato; daher im vorigen Jahrhundert ihr Kampf gegen den Jansenismus; und zeigt sie sich heutzutage sehr freundlich gegen Männer wie Schlegel, Görres, Haller, Müller etc., so betrachtet sie solche doch nur wie Guerillas, die man in schlimmen Kriegszeiten, wo die stehenden Glaubensarmeen etwas zusammengeschmolzen sind, gut gebrauchen kann und späterhin in Friedenszeit gehörig unterdrücken wird. Es würde zu weit führen, wenn wir nachweisen wollten, wie auch im Oriente der Mystizismus den Autoritätsglauben sprengt, wie z.B. aus dem Sufismus in der neuesten Zeit Sekten entstanden, deren Religionsbegriffe von der erhabensten Art sind.
Wir können nicht genug rühmen, mit welchem Scharfsinne Herr Menzel vom Protestantismus und Katholizismus spricht, in diesem das Prinzip der Stabilität, in jenem das Prinzip der Evolution erkennend. In dieser Hinsicht bemerkt er sehr richtig unter der Rubrik »Religion«:
»Der Erstarrung muß die Bewegung, dem Tode das Leben, dem unveränderlichen Sein ein ewiges Werden sich entgegensetzen. Hierin allein hat der Protestantismus seine große welthistorische Bedeutung gefunden. Er hat mit der jugendlichen Kraft, die nach höherer Entwickelung drängt, der greisen Erstarrung gewehrt. Er hat ein Naturgesetz zu dem seinigen gemacht, und mit diesem allein kann er siegen. Diejenigen unter den Protestanten also, welche selbst wieder in eine andere Art von Starrsucht verfallen sind, die Orthodoxen, haben das eigentliche Interesse des Kampfes aufgegeben. Sie sind stehengeblieben und dürfen von Rechts wegen sich nicht beklagen, daß die Katholiken auch stehengeblieben sind. Man kann nur durch ewigen Fortschritt oder gar nicht gewinnen. Wo man stehenbleibt, ist ganz einerlei, so einerlei, als wo die Uhr stehenbleibt. Sie ist da, damit sie geht.«
Das Thema des Protestantismus führt uns auf dessen würdigen Verfechter, Johann Heinrich Voß, den Herr Menzel bei jeder Gelegenheit mit den härtesten Worten und durch die bittersten Zusammenstellungen verunglimpft. Hierüber können wir nicht bestimmt genug unseren Tadel aussprechen. Wenn der Verfasser unseren seligen Voß einen »ungeschlachten niedersächsischen Bauer« nennt, sollten wir fast auf den Argwohn geraten, er neige selber zu der Partei jener Ritterlinge und Pfaffen, wogegen Voß so wacker gekämpft hat. Jene Partei ist zu mächtig, als daß man mit einem zarten Galanteriedegen gegen sie kämpfen könnte, und wir bedurften eines ungeschlachten niedersächsischen Bauers, der das alte Schlachtschwert aus der Zeit des Bauernkriegs wieder hervorgrub und damit loshieb. Herr Menzel hat vielleicht nie gefühlt, wie tief ein ungeschlachtes niedersächsisches Bauernherz verwundet werden kann von dem freundschaftlichen Stich einer feinen, glatten hochadligen Viper – die Götter haben gewiß Herrn Menzel vor solchen Gefühlen bewahrt, sonst würde er die Herbheit der Vossischen Schriften nur in den Tatsachen finden und nicht in den Worten. Es mag wahr sein, daß Voß in seinem protestantischen Eifer die Bilderstürmerei etwas zu weit trieb. Aber man bedenke, daß die Kirche jetzt überall die Verbündete der Aristokratie ist und sogar hie und da von ihr besoldet wird. Die Kirche, einst die herrschende Dame, vor welcher die Ritter ihre Knie beugten und zu deren Ehren sie mit dem ganzen Orient turnierten, jene Kirche ist schwach und alt geworden, sie möchte sich jetzt eben diesen Rittern als dienende Amme verdingen und verspricht mit ihren Liedern die Völker in den Schlaf zu lullen, damit man die Schlafenden leichter fesseln und scheren könne.
Unter der Rubrik »Kunst« häufen sich die meisten Ausfälle gegen Voß. Diese Rubrik umfaßt beinah den ganzen zweiten Teil des Menzelschen Werks. Die Urteile über unsere nächsten Zeitgenossen lassen wir unbesprochen. Die Bewunderung, die der Verfasser für Jean Paul hegt, macht seinem Herzen Ehre. Ebenfalls die Begeisterung für Schiller. Auch wir nehmen daran Anteil; doch gehören wir nicht zu denen, die durch Vergleichung Schillers mit Goethe den Wert des letztern herabdrücken möchten. Beide Dichter sind vom ersten Range, beide sind groß, vortrefflich, außerordentlich, und hegen wir etwas Vorneigung für Goethe, so entsteht sie doch nur aus dem geringfügigen Umstand, daß wir glauben, Goethe wäre imstande gewesen, einen ganzen Friedrich Schiller mit allen dessen Räubern, Piccolominis, Luisen, Marien und Jungfrauen zu dichten, wenn er der ausführlichen Darstellung eines solchen Dichters nebst den dazugehörigen Gedichten in seinen Werken bedurft hätte.
Wir können über die Härte und Bitterkeit, womit Herr Menzel von Goethe spricht, nicht stark genug unser Erschrecken ausdrücken. Er sagt manch allgemein wahres Wort, das aber nicht auf Goethe angewendet werden dürfte. Beim Lesen jener Blätter, worin über Goethe gesprochen oder vielmehr abgesprochen wird, ward uns plötzlich so ängstlich zumute wie vorigen Sommer, als ein Bankier in London uns der Kuriosität wegen einige falsche Banknoten zeigte; wir konnten diese Papiere nicht schnell genug wieder aus Händen geben, aus Furcht, man möchte plötzlich uns selbst als Verfertiger derselben anklagen und ohne Umstände vor Old Bailey aufhängen. Erst nachdem wir an den Menzelschen Blättern über Goethe unsere schaurige Neugier befriedigt, erwachte der Unmut. Wir beabsichtigen keineswegs eine Verteidigung Goethes; wir glauben, die Menzelsche Lehre, »Goethe sei kein Genie, sondern ein Talent«, wird nur bei wenigen Eingang finden, und selbst diese wenigen werden doch zugeben, daß Goethe dann und wann das Talent hat, ein Genie zu sein. Aber selbst wenn Menzel recht hätte, würde es sich nicht geziemt haben, sein hartes Urteil so hart hinzustellen. Es ist doch immer Goethe, der König, und ein Rezensent, der an einen solchen Dichterkönig sein Messer legt, sollte doch ebensoviel Courtoisie besitzen wie jener englische Scharfrichter, welcher Karl I. köpfte und, ehe er dieses kritische Amt vollzog, vor dem königlichen Delinquenten niederkniete und seine Verzeihung erbat.
Woher aber kommt diese Härte gegen Goethe, wie sie uns hie und da sogar bei den ausgezeichnetsten Geistern bemerkbar worden? Vielleicht eben weil Goethe, der nichts als Primus inter pares sein sollte, in der Republik der Geister zur Tyrannis gelangt ist, betrachten ihn viele große Geister mit geheimem Groll. Sie sehen in ihm sogar einen Ludwig XI., der den geistigen hohen Adel unterdrückt, indem er den geistigen Tiers état, die liebe Mittelmäßigkeit, emporhebt. Sie sehen, er schmeichelt den respektiven Korporationen der Städte, er sendet gnädige Handschreiben und Medaillen an die Lieben Getreuen und erschafft einen Papieradel von Hochbelobten, die sich schon viel höher dünken als jene wahren Großen, die ihren Adel, ebensogut wie der König selbst, von der Gnade Gottes erhalten oder, um whiggisch zu sprechen, von der Meinung des Volkes. Aber immerhin mag dieses geschehen. Sahen wir doch jüngst in den Fürstengrüften von Westminster, daß jene Großen, die, als sie lebten, mit den Königen haderten, dennoch im Tode in der königlichen Nähe begraben liegen: – und so wird auch Goethe nicht verhindern können, daß jene großen Geister, die er im Leben gern entfernen wollte, dennoch im Tode mit ihm zusammenkommen und neben ihm ihren ewigen Platz finden im Westminster der deutschen Literatur.
Die brütende Stimmung unzufriedener Großen ist ansteckend, und die Luft wird schwül. Das Prinzip der Goetheschen Zeit, die Kunstidee, entweicht, eine neue Zeit mit einem neuen Prinzipe steigt auf, und seltsam! wie das Menzelsche Buch merken läßt, sie beginnt mit Insurrektion gegen Goethe. Vielleicht fühlt Goethe selbst, daß die schöne objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel gestiftet hat, notwendigerweise zusammensinkt, so wie die Kunstidee allmählich ihre Herrschaft verliert, und daß neue, frische Geister von der neuen Idee der neuen Zeit hervorgetrieben werden und gleich nordischen Barbaren, die in den Süden einbrechen, das zivilisierte Goethentum über den Haufen werfen und an dessen Stelle das Reich der wildesten Subjektivität begründen. Daher das Bestreben, eine Goethesche Landmiliz auf die Beine zu bringen. Überall Garnisonen und aufmunternde Beförderungen. Die alten Romantiker, die Janitscharen, werden zu regulären Truppen zugestutzt, müssen ihre Kessel abliefern, müssen die Goethesche Uniform anziehen, müssen täglich exerzieren. Die Rekruten lärmen und trinken und schreien Vivat; die Trompeter blasen –
Wird Kunst und Altertum imstande sein, Natur und Jugend zurückzudrängen?
Wir können nicht umhin, ausdrücklich zu bemerken, daß wir unter »Goethentum« nicht Goethes Werke verstehen, nicht jene teuern Schöpfungen, die vielleicht noch leben werden, wenn längst die deutsche Sprache schon gestorben ist und das geknutete Deutschland in slawischer Mundart wimmert; unter jenem Ausdruck verstehen wir auch nicht eigentlich die Goethesche Denkweise, diese Blume, die im Miste unserer Zeit immer blühender gedeihen wird, und sollte auch ein glühendes Enthusiastenherz sich über ihre kalte Behaglichkeit noch so sehr ärgern; mit dem Worte »Goethentum« deuteten wir oben vielmehr auf Goethesche Formen, wie wir sie bei der blöden Jüngerschar nachgeknetet finden, und auf das matte Nachpiepsen jener Weisen, die der Alte gepfiffen. Eben die Freude, die dem Alten jenes Nachkneten und Nachpiepsen gewährt, erregte unsere Klage. Der Alte! wie zahm und milde ist er geworden! Wie sehr hat er sich gebessert! würde ein Nicolaite sagen, der ihn noch in jenen wilden Jahren kannte, wo er den schwülen »Werther« und den »Götz mit der eisernen Hand« schrieb! Wie hübsch manierlich ist er geworden, wie ist ihm alle Roheit jetzt fatal, wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere xeniale, himmelstürmende Zeit erinnert wird oder wenn gar andere, in seine alten Fußtapfen tretend, mit demselben Übermute ihre Titanenflegeljahre austoben! Sehr treffend hat in dieser Hinsicht ein geistreicher Ausländer unseren Goethe mit einem alten Räuberhauptmanne verglichen, der sich vom Handwerk zurückgezogen hat, unter den Honoratioren eines Provinzialstädtchens ein ehrsam bürgerliches Leben führt, bis aufs kleinlichste alle Philistertugenden zu erfüllen strebt und in die peinlichste Verlegenheit gerät, wenn zufällig irgendein wüster Waldgesell aus Kalabrien mit ihm zusammentrifft und alte Kameradschaft nachsuchen möchte.
Einleitung zu »Kahldorf über den Adel
in Briefen an den Grafen M. von Moltke«
Der gallische Hahn hat jetzt zum zweiten Male gekräht, und auch in Deutschland wird es Tag. In entlegene Klöster, Schlösser, Hansestädte und dergleichen letzte Schlupfwinkel des Mittelalters flüchten sich die unheimlichen Schatten und Gespenster, die Sonnenstrahlen blitzen, wir reiben uns die Augen, das holde Licht dringt uns ins Herz, das wache Leben umrauscht uns, wir sind erstaunt, wir befragen einander: – Was taten wir in der vergangenen Nacht?
Nun ja, wir träumten in unserer deutschen Weise, d.h. wir philosophierten. Zwar nicht über die Dinge, die uns zunächst betrafen oder zunächst passierten, sondern wir philosophierten über die Realität der Dinge an und für sich, über die letzten Gründe der Dinge und ähnliche metaphysische und transzendentale Träume, wobei uns der Mordspektakel der westlichen Nachbarschaft zuweilen recht störsam wurde, ja sogar recht verdrießlich, da nicht selten die französischen Flintenkugeln in unsere philosophische Systeme hineinpfiffen und ganze Fetzen davon fortfegten.
Seltsam ist es, daß das praktische Treiben unserer Nachbaren jenseits des Rheins dennoch eine eigne Wahlverwandtschaft hatte mit unserem philosophischen Träumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche nur die Geschichte der französischen Revolution mit der Geschichte der deutschen Philosophie, und man sollte glauben: die Franzosen, denen soviel wirkliche Geschäfte oblagen, wobei sie durchaus wach bleiben mußten, hätten uns Deutsche ersucht, unterdessen für sie zu schlafen und zu träumen, und unsre deutsche Philosophie sei nichts anders als der Traum der französischen Revolution. So hatten wir den Bruch mit dem Bestehenden und der Überlieferung im Reiche des Gedankens, ebenso wie die Franzosen im Gebiete der Gesellschaft, um die Kritik der reinen Vernunft sammelten sich unsere philosophischen Jakobiner, die nichts gelten ließen, als was jener Kritik standhielt, Kant war unser Robespierre. – Nachher kam Fichte mit seinem Ich, der Napoleon der Philosophie, die höchste Liebe und der höchste Egoismus, die Alleinherrschaft des Gedankens, der souveräne Wille, der ein schnelles Universalreich improvisierte, das ebenso schnell wieder verschwand, der despotische, schauerlich einsame Idealismus. – Unter seinem konsequenten Tritte erseufzten die geheimen Blumen, die von der Kantischen Guillotine noch verschont geblieben oder seitdem unbemerkt hervorgeblüht waren, die unterdrückten Erdgeister regten sich, der Boden zitterte, die Konterrevolution brach aus, und unter Schelling erhielt die Vergangenheit mit ihren traditionellen Interessen wieder Anerkenntnis, sogar Entschädigung, und in der neuen Restauration, in der Naturphilosophie, wirtschafteten wieder die grauen Emigranten, die gegen die Herrschaft der Vernunft und der Idee beständig intrigiert, der Mystizismus, der Pietismus, der Jesuitismus, die Legitimität, die Romantik, die Deutschtümelei, die Gemütlichkeit – bis Hegel, der Orleans der Philosophie, ein neues Regiment begründete oder vielmehr ordnete, ein eklektisches Regiment, worin er freilich selber wenig bedeutet, dem er aber an die Spitze gestellt ist und worin er den alten Kantischen Jakobinern, den Fichtischen Bonapartisten, den Schellingschen Pairs und seinen eignen Kreaturen eine feste, verfassungsmäßige Stellung anweist.
In der Philosophie hätten wir also den großen Kreislauf glücklich beschlossen, und es ist natürlich, daß wir jetzt zur Politik übergehen. Werden wir hier dieselbe Methode beobachten? Werden wir mit dem System des Comité du salut public oder mit dem System des ordre légal den Kursus eröffnen? Diese Fragen durchzittern alle Herzen, und wer etwas Liebes zu verlieren hat, und sei es auch nur den eignen Kopf, flüstert bedenklich: Wird die deutsche Revolution eine trockne sein oder eine naßrote – –?
Aristokraten und Pfaffen drohen beständig mit den Schreckbildern aus den Zeiten des Terrorismus, Liberale und Humanisten versprechen uns dagegen die schönen Szenen der großen Woche und ihrer friedlichen Nachfeier; – beide Parteien täuschen sich oder wollen andere täuschen. Denn nicht weil die französische Revolution in den neunziger Jahren so blutig und entsetzlich, vorigen Juli aber so menschlich und schonend war, läßt sich folgern, daß eine Revolution in Deutschland ebenso den einen oder den anderen Charakter annehmen müsse. Nur wenn dieselben Bedingnisse vorhanden sind, lassen sich dieselben Erscheinungen erwarten. Der Charakter der französischen Revolution war aber zu jeder Zeit bedingt von dem moralischen Zustande des Volks und besonders von seiner politischen Bildung. Vor dem ersten Ausbruch der Revolution in Frankreich gab es dort zwar eine schon fertige Zivilisation, aber doch nur in den höheren Ständen und hie und da im Mittelstand; die unteren Klassen waren geistig verwahrlost und durch den engherzigsten Despotismus von jedem edlen Emporstreben abgehalten. Was aber gar politische Bildung betrifft, so fehlte sie nicht nur jenen unteren, sondern auch den oberen Klassen. Man wußte damals nur von kleinlichen Manövers zwischen rivalisierenden Korporationen, von wechselseitigem Schwächungssysteme, von Traditionen der Routine, von doppeldeutigen Formelkünsten, von Mätresseneinfluß und dergleichen Staatsmisere. Montesquieu hatte nur eine verhältnismäßig g'ringe Anzahl Geister geweckt. Da er immer von einem historischen Standpunkte ausgeht, gewann er wenig Einfluß auf die Massen eines enthusiastischen Volks, das am empfänglichsten ist für Gedanken, die ursprünglich und frisch aus dem Herzen quellen, wie in den Schriften Rousseaus. Als aber dieser, der Hamlet von Frankreich, der den zürnenden Geist erblickt und die argen Gemüter der gekrönten Giftmischer, die gleißende Leerheit der Schranzen, die läppische Lüge der Hofetikette und die gemeinsame Fäulnis durchschaute und schmerzhaft ausrief: »Die Welt ist aus ihren Fugen getreten, weh mir, daß ich sie wieder einrichten soll!«, als Jean-Jacques Rousseau halb mit verstelltem, halb mit wirklichem Verzweiflungswahnsinn seine große Klage und Anklage erhob; – als Voltaire, der Lukian des Christentums, den römischen Priestertrug und das darauf gebaute göttliche Recht des Despotismus zugrunde lächelte; – als Lafayette, der Held zweier Welten und zweier Jahrhunderte, mit den Argonauten der Freiheit aus Amerika zurückkehrte und die Idee einer freien Konstitution, das Goldne Vlies, mitbrachte; – als Necker rechnete und Sieyès definierte und Mirabeau redete und die Donner der Konstituierenden Versammlung über die welke Monarchie und ihr blühendes Defizit dahinrollten und neue ökonomische und staatsrechtliche Gedanken, wie plötzliche Blitze, emporschossen: – da mußten die Franzosen die große Wissenschaft der Freiheit, die Politik, erst erlernen, und die ersten Anfangsgründe kamen ihnen teuer zu stehen, und es kostete ihnen ihr bestes Blut.
Daß aber die Franzosen so teures Schulgeld bezahlen mußten, das war die Schuld jener blödsinnig lichtscheuen Despotie, die, wie gesagt, das Volk in geistiger Unmündigkeit zu erhalten gesucht, alle staatswissenschaftliche Belehrung hintertrieben, den Jesuiten und Obskuranten der Sorbonne die Bücherzensur übertragen und gar die periodische Presse, das mächtigste Beförderungsmittel der Volksintelligenz, aufs lächerlichste unterdrückt hatte. Man lese nur in Merciers »Tableau de Paris« den Artikel über die Zensur vor der Revolution, und man wundert sich nicht mehr über jene krasse politische Unwissenheit der Franzosen, die nachher zur Folge hatte, daß sie von den neuen politischen Ideen mehr geblendet als erleuchtet, mehr erhitzt als erwärmt wurden, daß sie jedem Pamphletisten und Journalisten aufs Wort glaubten und daß sie von jedem Schwärmer, der sich selbst betrog, und jedem Intriganten, den Pitt besoldete, zu den ausschweifendsten Handlungen verleitet werden konnten. Das ist ja eben der Segen der Preßfreiheit, sie raubt der kühnen Sprache des Demagogen allen Zauber der Neuheit, das leidenschaftlichste Wort neutralisiert sie durch ebenso leidenschaftliche Gegenrede, und sie erstickt in der Geburt schon die Lügengerüchte, die, von Zufall oder Bosheit gesät, so tödlich frech emporwuchern im Verborgenen, gleich jenen Giftpflanzen, die nur in dunklen Waldsümpfen und im Schatten alter Burg- und Kirchentrümmer gedeihen, im hellen Sonnenlichte aber elendig und jämmerlich verdorren. Freilich, das helle Sonnenlicht der Preßfreiheit ist für den Sklaven, der lieber im Dunkeln die allerhöchsten Fußtritte hinnimmt, ebenso fatal wie für den Despoten, der seine einsame Ohnmacht nicht gern beleuchtet sieht. Es ist wahr, daß die Zensur solchen Leuten sehr angenehm ist. Aber es ist nicht weniger wahr, daß die Zensur, indem sie einige Zeit dem Despotismus Vorschub leistet, ihn am Ende mitsamt dem Despoten zugrunde richtet, daß dort, wo die Ideenguillotine gewirtschaftet, auch bald die Menschenzensur eingeführt wird, daß derselbe Sklave, der die Gedanken hinrichtet, späterhin mit derselben Gelassenheit seinen eignen Herren ausstreicht aus dem Buche des Lebens.
Ach! diese Geisteshenker machen uns selbst zu Verbrechern, und der Schriftsteller, der wie eine Gebärerin während des Schreibens gar bedenklich aufgeregt ist, begeht in diesem Zustande sehr oft einen Gedankenkindermord, eben aus wahnsinniger Angst vor dem Richtschwerte des Zensors. Ich selbst unterdrücke in diesem Augenblick einige neugeborene unschuldige Betrachtungen über die Geduld und Seelenruhe, womit meine lieben Landsleute schon seit so vielen Jahren ein Geistermordgesetz ertragen, das Polignac in Frankreich nur zu promulgieren brauchte, um eine Revolution hervorzubringen. Ich spreche von den berühmten Ordonnanzen, deren bedenklichste eine strenge Zensur der Tagesblätter anordnete und alle edle Herzen in Paris mit Entsetzen erfüllte – die friedlichsten Bürger griffen zu den Waffen, man barrikadierte die Gassen, man focht, man stürmte, es donnerten die Kanonen, es heulten die Glocken, es pfiffen die bleiernen Nachtigallen, die junge Brut des toten Adlers, die École polytechnique, flatterte aus dem Neste mit Blitzen in den Krallen, alte Pelikane der Freiheit stürzten in die Bajonette und nährten mit ihrem Blute die Begeisterung der Jungen, zu Pferde stieg Lafayette, der Unvergleichliche, dessengleichen die Natur nicht mehr als einmal erschaffen könnte und den sie deshalb in ihrer ökonomischen Weise für zwei Welten und für zwei Jahrhunderte zu benutzen sucht – und nach drei heldenmütigen Tagen lag die Knechtschaft zu Boden mit ihren roten Schergen und ihren weißen Lilien; und die heilige Dreifarbigkeit, umstrahlt von der Glorie des Sieges, wehte über dem Kirchturm Unser Lieben Frauen von Paris! Da geschahen keine Greul, da gab's kein mutwilliges Morden, da erhob sich keine allerchristlichste Guillotine da trieb man keine gräßlichen Späße, wie z.B. bei jener famosen Rückkehr von Versailles, als man, gleich Standarten, die blutigen Köpfe der Herren von Deshuttes und von Varicourt voraustrug und in Sèvres stillhielt, um sie dort von einem Citoyen-Perruquier abwaschen und hübsch frisieren zu lassen. – Nein, seit jener Zeit schaurigen Angedenkens hatte die französische Presse das Volk von Paris für bessere Gefühle und minder blutige Witze empfänglich gemacht, sie hatte die Ignoranz ausgegätet aus den Herzen und Intelligenz hineingesät, die Frucht eines solchen Samens war die edle, legendenartige Mäßigung und rührende Menschlichkeit des Pariser Volks in der großen Woche – und, in der Tat! wenn Polignac späterhin nicht auch physisch den Kopf verlor, so verdankt er es einzig und allein den milden Nachwirkungen derselben Preßfreiheit, die er törichterweise unterdrücken wollte.
So erquickt der Sandelbaum mit seinen lieblichsten Düften eben jenen Feind, der frevelhaft seine Rinde verletzt hat.
Ich glaube mit diesen flüchtigen Bemerkungen genugsam angedeutet zu haben, wie jede Frage über den Charakter, den die Revolution in Deutschland annehmen möchte, sich in eine Frage über den Zustand der Zivilisation und der politischen Bildung des deutschen Volks verwandeln muß, wie diese Bildung ganz abhängig ist von der Preßfreiheit und wie es unser ängstlichster Wunsch sein muß, daß durch letztere bald recht viel Licht verbreitet werde, ehe die Stunde kommt, wo die Dunkelheit mehr Unheil stiftet als die Leidenschaft und Ansichten und Meinungen, je weniger sie vorher erörtert und besprochen worden, um so grauenhaft stürmischer auf die blinde Menge wirken und von den Parteien als Losungsworte benutzt werden.
»Die bürgerliche Gleichheit« könnte jetzt in Deutschland, ebenso wie einst in Frankreich, das erste Losungswort der Revolution werden, und der Freund des Vaterlandes darf wohl keine Zeit versäumen, wenn er dazu beitragen will, daß die Streitfrage »über den Adel« durch eine ruhige Erörterung geschlichtet oder ausgeglichen werde, ehe sich ungefüge Disputanten einmischen mit allzu schlagenden Beweistümern, wogegen weder die Kettenschlüsse der Polizei noch die schärfsten Argumente der Infantrie und Kavallerie, nicht einmal die Ultima ratio regis, die sich leicht in eine Ultimi ratio regis verwandeln könnte, etwas auszurichten vermöchten. In dieser trüben Hinsicht erachte ich die Herausgabe gegenwärtiger Schrift für ein verdienstliches Werk. Ich glaube, der Ton der Mäßigung, der darin herrscht, entspricht dem angedeuteten Zwecke. Der Verfasser bekämpft mit indischer Geduld eine Broschüre, betitelt:
»Über den Adel und dessen Verhältnis zum Bürgerstande. Von dem Grafen M. v. Moltke, königl. dänischem Kammerherrn und Mitgliede des Obergerichts zu Gottorff. Hamburg, bei Perthes und Besser. 1830.«
Doch wie in dieser Broschüre, so ist auch in der Entgegnung das Thema keineswegs erschöpft, und die Hin- und Widerrede betrifft nur den allgemeinen, sozusagen dogmatischen Teil der Streitfrage. Der hochgeborene Kämpe sitzt auf seinem Turnierroß und behauptet keck die mittelalterliche Zote, daß durch adlige Zeugung ein besseres Blut entstehe als durch gemein bürgerliche Zeugung, er verteidigt die Geburtsprivilegien, das Vorzugsrecht bei einträglichen Hof-, Gesandtschaft- und Waffenämtern, womit man den Adligen dafür belohnen soll, daß er sich die große Mühe gegeben hat, geboren zu werden, und so weiter; – dagegen erhebt sich ein Streiter, der Stück vor Stück jene bestialischen und aberwitzigen Behauptungen und die übrigen noblen Ansichten herunterschlägt, und die Walstätte wird bedeckt mit den glänzenden Fetzen des Vorurteils und den Wappentrümmern altadliger Insolenz. Dieser bürgerliche Ritter kämpft gleichsam mit geschlossenem Visier, das Titelblatt dieser Schrift bezeichnet ihn nur mit erborgtem Namen, der vielleicht späterhin ein braver nom de guerre wird. Ich weiß selbst wenig mehr von ihm zu sagen, als daß sein Vater ein Schwertfeger war und gute Klingen machte.
Daß ich selbst nicht der Verfasser dieser Schrift bin, sondern sie nur zum Druck befördere, brauche ich wohl nicht erst ausführlich zu beteuern. Ich hätte nimmermehr mit solcher Mäßigung die adligen Prätensionen und Erblügen diskutieren können. Wie heftig wurde ich einst, als ein niedliches Gräfchen, mein bester Freund, während wir auf der Terrasse eines Schlosses spazierengingen, die Besserblütigkeit des Adels zu beweisen suchte! Indem wir noch disputierten, beging sein Bedienter ein kleines Versehen, und der hochgeborene Herr schlug dem niedriggeborenen Knechte ins Gesicht, daß das unedle Blut hervorschoß, und stieß ihn noch obendrein die Terrasse hinab. Ich war damals zehn Jahr jünger und warf den edlen Grafen sogleich ebenfalls die Terrasse hinab – es war mein bester Freund, und er brach ein Bein. Als ich ihn nach seiner Genesung wiedersah – er hinkte nur noch ein bißchen –, war er doch noch immer von seinem Adelstolze nicht kuriert und behauptete frischweg: der Adel sei als Vermittler zwischen Volk und König eingesetzt, nach dem Beispiele Gottes, der zwischen sich und den Menschen die Engel gesetzt hat, die seinem Throne zunächst stehen, gleichsam ein Adel des Himmels. »Holder Engel«, antwortete ich, »gehe mal einige Schritte auf und ab« – er tat es – und der Vergleich hinkte.
Ebenso hinkend ist ein Vergleich, den der Graf Moltke in derselben Beziehung mitteilt. Um seine Weise durch ein Beispiel zu zeigen, will ich seine eignen Worte hersetzen: »Der Versuch, den Adel aufzuheben, in welchem sich die flüchtige Achtung zu einer dauernden Gestalt verkörpert, würde den Menschen isolieren, würde ihn auf eine unsichere Höhe erheben, der es an den nötigen Bindungsmitteln an die untergeordnete Menge fehlt, würde ihn mit Werkzeugen seiner Willkür umgeben, wodurch, wie sich dieses im Oriente so oft gezeigt, die Existenz des Herrschers in eine gefahrvolle Lage gerät. Burke nennt den Adel das korinthische Kapital wohlgeordneter Staaten, und daß hierin nicht bloß eine rednerische Figur zu suchen, dafür bürgt der erhabene Geist dieses außerordentlichen Mannes, dessen ganzes Leben dem Dienste einer vernünftigen Freiheit gewidmet war.«
Durch dasselbe Beispiel ließe sich zeigen, wie der edle Graf durch Halbkenntnisse getäuscht wird. Burken nämlich gebührt keineswegs das Lob, das er ihm spendet; denn ihm fehlt jene consistency, welche die Engländer für die erste Tugend eines Staatsmanns halten. Burke besaß nur rhetorische Talente, womit er in der zweiten Hälfte seines Lebens die liberalen Grundsätze bekämpfte, denen er in der ersten Hälfte gehuldigt hatte. Ob er durch diesen Gesinnungswechsel die Gunst der Großen erkriechen wollte, ob Sheridans liberale Triumphe in St. Stephan aus Depit und Eifersucht ihn bestimmten, als dessen Gegner jene mittelalterliche Vergangenheit zu verfechten, die ein ergiebigeres Feld für romantische Schilderungen und rednerische Figuren darbot, ob er ein Schurke oder ein Narr war, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, daß es immer verdächtig ist, wenn man zugunsten der regierenden Gewalt seine Ansichten wechselt, und daß man dann immer ein schlechter Gewährsmann bleibt. Ein Mann, der nicht in diesem Falle ist, sagte einst: »Die Adligen sind nicht die Stützen, sondern die Karyatiden des Thrones.« Ich denke, dieser Vergleich ist richtiger als der von dem Kapital einer korinthischen Säule. Überhaupt, wir wollen letzteren soviel als möglich abweisen; es könnten sonst einige wohlbekannte Kapitalisten den kapitalen Einfall bekommen, sich anstatt des Adels als korinthisches Kapital der Staatssäulen zu erheben. Und das wäre gar der allerwiderwärtigste Anblick.
Doch ich berühre hier einen Punkt, der erst in einer späteren Schrift beleuchtet werden soll; der besondere, praktische Teil der Streitfrage über den Adel mag alsdann ebenfalls seine gehörige Erörterung finden. Denn, wie ich schon oben angedeutet, gegenwärtige Schrift befaßt sich nur mit dem Grundsätzlichen, sie bestreitet Rechtsansprüche, und sie zeigt nur, wie der Adel in Widerspruch ist mit der Vernunft, der Zeit und mit sich selbst. Der besondere, praktische Teil betrifft aber jene siegreichen Anmaßungen und faktischen Usurpationen des Adels, wodurch er das Heil der Völker so sehr bedroht und täglich mehr und mehr untergräbt. Ja, es scheint mir, als glaube der Adel selbst nicht an seine eigne Prätensionen und schwatze sie bloß hin als Köder für bürgerliche Polemik, die sich damit beschäftigen möge, damit ihre Aufmerksamkeit und Kraft abgeleitet werde von der Hauptsache. Diese besteht nicht in der Institution des Adels als solchen, nicht in bestimmten Privilegien, nicht in Fron-, Handdienst-, Gerichts- und anderen Gerechtigkeiten und allerlei herkömmlichen Realbefreiungen; die Hauptsache besteht vielmehr in dem unsichtbaren Bündnisse aller derjenigen, die soundso viel Ahnen aufzuweisen haben und die stillschweigend die Übereinkunft getroffen haben, sich aller leitenden Macht der Staaten zu bemächtigen, indem sie, gemeinschaftlich die bürgerlichen Roturiers zurückdrängend, fast alle höhere Offizierstellen und durchaus alle Gesandtschaftsposten an sich bringen und solchermaßen die Völker durch ihre untergebenen Soldaten in Respekt halten und durch diplomatische Verhetzungskünste zwingen können, gegeneinander zu fechten, wenn sie die Fessel der Aristokratie abschütteln oder zu diesem Zwecke fraternisierend sich verbünden möchten.
Seit dem Beginn der französischen Revolution steht solcherweise der Adel auf Kriegsfuß gegen die Völker und kämpfte öffentlich oder geheim gegen das Prinzip der Freiheit und Gleichheit und dessen Vertreter, die Franzosen. Der englische Adel, der durch Rechte und Besitztümer der mächtigste war, wurde Bannerführer der europäischen Aristokratie, und John Bull bezahlte dieses Ehrenamt mit seinen besten Guineen und siegte sich bankerott. Während des Friedens, der nach jenem kläglichen Sieg erfolgte, führte Östreich das noble Banner und besorgte die Adelsinteressen, und auf jedem feigen Verträglein, das gegen den Liberalismus geschlossen wurde, prangt obenan das wohlbekannte Siegellack, und wie ihr unglücklicher Anführer wurden auch die Völker selber in strengem Gewahrsam gehalten, ganz Europa wurde ein Sankt Helena, und Metternich war dessen Hudson Lowe. Aber nur an dem sterblichen Leib der Revolution konnte man sich rächen, nur jene menschgewordene Revolution, die mit Stiefel und Sporen und bespritzt mit Schlachtfeldblut zu einer kaiserlichen Blondine ins Bett gestiegen und die weißen Laken von Habsburg befleckt hatte, nur jene Revolution konnte man an einem Magenkrebse sterben lassen; der Geist der Revolution ist jedoch unsterblich und liegt nicht unter den Trauerweiden von Longwood, und in dem großen Wochenbette des Ende Juli wurde die Revolution wiedergeboren, nicht als einzelner Mensch, sondern als ganzes Volk, und in dieser Volkwerdung spottet sie des Kerkermeisters, der vor Schrecken das Schlüsselbund aus Händen fallen läßt. Welche Verlegenheit für den Adel! Er hat sich freilich in der langen Friedenszeit etwas erholt von den früheren Anstrengungen, und er hat seitdem als stärkende Kur täglich Eselsmilch getrunken, und zwar von der Eselin des Papstes; doch fehlt es ihm immer noch an hinlänglichen Kräften zu einem neuen Kampfe. Der englische Bull kann jetzt am wenigsten den Feinden die Spitze bieten wie früherhin; denn der ist am meisten erschöpft, und durch das beständige Ministerwechselfieber fühlt er sich matt in allen Gliedern, und es ist ihm eine Radikalkur, wo nicht gar die Hungerkur verordnet, und das infizierte Irland soll ihm noch obendrein amputiert werden. Östreich fühlt sich ebenfalls nicht heroisch aufgelegt, den Agamemnon des Adels gegen Frankreich zu spielen; Staberle zieht nicht gern die Kriegsuniform an und weiß sehr gut, daß seine Parapluies nicht gegen Kugelregen schützen, und dabei schrecken ihn auch jetzt die Ungarn mit ihren grimmigen Schnurrbärten, und in Italien muß er vor jedem enthusiastischen Zitronenbaum eine Schildwache stellen, und zu Hause muß er Erzherzöginnen zeugen, um, im Notfall, das Ungetüm der Revolution damit abzuspeisen.
Aber in Frankreich flammt immer mächtiger die Sonne der Freiheit und überleuchtet die ganze Welt mit ihren Strahlen. – Aber sie dringt täglich weiter, die Idee eines Bürgerkönigs ohne Hofetikette, ohne Edelknechte, ohne Kurtisanen, ohne Kuppler, ohne diamantne Trinkgelder und sonstige Herrlichkeit. – Aber die Pairskammer betrachtet man schon als ein Lazarett für die Inkurablen des alten Regimes, die man nur noch aus Mitleiden toleriert und mit der Zeit ebenfalls fortschafft. – Seltsame Umwandlung! In dieser Not wendet sich der Adel an denjenigen Staat, den er in der letzten Zeit als den ärgsten Feind seiner Interessen betrachtet und gehaßt, er wendet sich an Rußland. Der große Zar, der noch jüngst der Gonfaloniere der Liberalen war, indem er der feudalistischen Aristokratie feindseligst gegenüberstand und gezwungen schien, sie nächstens zu befehden, eben dieser Zar wird jetzt von eben jener Aristokratie zum Bannerführer erwählt, und er ist genötigt, ihr Vorkämpfer zu werden. Denn ruht auch der russische Staat auf das antifeudalistische Prinzip einer Gleichheit aller Staatsbürger, denen nicht die Geburt, sondern das erworbene Staatsamt einen Rang erteilt, so ist doch auf der anderen Seite das absolute Zarentum unverträglich mit den Ideen einer konstitutionellen Freiheit, die den g'ringsten Untertan selbst gegen eine wohltätige fürstliche Willkür schützen kann: – und wenn Kaiser Nikolas I. wegen jenes Prinzip der bürgerlichen Gleichheit von den Feudalisten gehaßt wurde und obendrein als offner Feind Englands und heimlicher Feind Östreichs mit all seiner Macht der faktische Vertreter der Liberalen war, so wurde doch er seit dem Ende Juli der größte Gegner derselben, nachdem deren siegende Ideen von konstitutioneller Freiheit seinen Absolutismus bedrohen, und eben in seiner Eigenschaft als Autokrat weiß ihn die europäische Aristokratie zum Kampfe gegen das frank und freie Frankreich aufzureizen. Der englische Bull hat sich in einem solchen Kampfe die Hörner abgelaufen, und nun soll der russische Wolf seine Rolle übernehmen. Die hohe Noblesse von Europa weiß schlau genug das Schrecken der moskowitischen Wälder für ihre Zwecke zu benutzen und gehörig abzurichten; und den rauhen Gast schmeichelt es nicht wenig, daß er die Würde des alten, von Gottes Genade eingesetzten Königtums verfechten soll gegen Fürstenlästrer und Adelsleugner, mit Wohlgefallen läßt er sich den mottigen Purpurmantel mit allem Goldflitterkram aus der byzantinischen Verlassenschaft um die Schulter hängen, und er läßt sich vom eh'maligen deutschen Kaiser die abgetragenen heiligen römischen Reichshosen verehren, und er setzt sich aufs Haupt die altfränkische Diamantenmütze Caroli Magni. –
Ach! der Wolf hat die Garderobe der alten Großmutter angezogen und zerreißt euch armen Rotkäppchen der Freiheit!
Ist es mir doch, während ich dieses schreibe, als spritzte das Blut von Warschau bis auf mein Papier und als hörte ich den Freudejubel der Berliner Offiziere und Diplomaten. Jubeln sie etwa zu früh? Ich weiß nicht; aber mir und uns allen ist so bang vor dem russischen Wolf, und ich fürchte, auch wir deutschen Rotköpfchen fühlen bald Großmutters närrisch lange Hände und großes Maul. Dabei sollen wir uns noch obendrein marschfertig halten, um gegen Frankreich zu fechten. Heiliger Gott! Gegen Frankreich? Ja, hurra! Es geht gegen die Franzosen, und die Berliner Ukasuisten und Knutologen behaupten, daß wir noch dieselben Gott-, König- und Vaterlandsretter sind wie Anno 1813, und Körners »Leier und Schwert« soll wieder neu aufgelegt werden, Fouqué will noch einige Schlachtlieder hinzudichten, der Görres wird den Jesuiten wieder abgekauft, um den »Rheinischen Merkur« fortzusetzen, und wer freiwillig den heiligen Kampf mitmacht, kriegt Eichenlaub auf die Mütze und wird »Sie« tituliert und erhält nachher frei Theater oder soll wenigstens als Kind betrachtet werden und nur die Hälfte bezahlen – und für patriotische Extrabemühungen soll dem ganzen Volke noch extra eine Konstitution versprochen werden.
Frei Theater ist immerhin eine schöne Sache, aber eine Konstitution wäre auch so übel nicht. Ja, wir könnten zuzeiten ordentlich ein Gelüste danach bekommen. Nicht als ob wir der absoluten Güte oder dem guten Absolutismus unserer Monarchen mißtrauten; im Gegenteil, wir wissen, es sind lauter scharmante Leute, und ist auch mal einer unter ihnen, der dem Stande Unehre macht, wie z.B. Se. Majestät der König Don Miguel, so bildet der doch nur eine Ausnahme, und wenn die allerhöchsten Kollegen nicht seinem blutigen Skandal ein Ende machen, wie sie doch leicht könnten, so geschieht es nur, um durch den Kontrast mit solchem gekrönten Wichte noch menschenfreundlich edler dazustehen und von ihren Untertanen noch mehr geliebt zu werden. Aber eine gute Konstitution hat doch ihr Gutes, und es ist den Völkern gar nicht zu verdenken, wenn sie sogar von den besten Monarchen sich etwas Schriftliches ausbitten, wegen Leben und Sterben. Auch handelt ein vernünftiger Vater sehr vernünftig, wenn er einige heilsame Schranken baut vor den Abgründen der souveränen Macht, damit seinen Kindern nicht einst ein Unglück begegne, wenn sie auf dem hohen Pferde des Stolzes und mit prahlendem Junkergefolge allzu keck galoppieren. Ich weiß ein Königskind, das in einer schlechten adligen Reitschule schon im voraus die größten Sprünge zu wagen lernt. Für solche Königskinder muß man doppelt hohe Schranken errichten, und man muß ihnen die goldnen Sporen umwickeln, und es muß ihnen ein zahmeres Roß und eine bürgerlich bescheidnere Genossenschaft zugeteilt werden. Ich weiß eine Jagdgeschichte – bei Sankt Hubert! Und ich weiß auch jemand, der tausend Taler preußisch Kurant darum gäbe, wenn sie gelogen wäre.
Ach! die ganze Zeitgeschichte ist jetzt nur eine Jagdgeschichte. Es ist jetzt die Zeit der hohen Jagd gegen die liberalen Ideen, und die hohen Herrschaften sind eifriger als je, und ihre uniformierten Jäger schießen auf jedes ehrliche Herz, worin sich die liberalen Ideen geflüchtet, und es fehlt nicht an gelehrten Hunden, die das blutende Wort als gute Beute heranschleppen. Berlin füttert die beste Koppel, und ich höre schon, wie die Meute losbellt gegen dieses Buch.