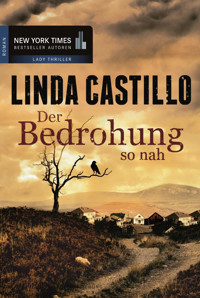9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Er war vom rechten Weg abgekommen. Er wusste, dass nur noch Gott ihm helfen konnte. Oder Kate Burkholder, Polizeichefin in Painters Mill. Seit zwei Jahren sitzt Joseph King wegen des Mordes an seiner Frau Naomi hinter Gittern. Er gilt als ein "gefallener" Amischer, einer der ständig mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Doch diese Tat hat er immer vehement bestritten. Jetzt ist er ausgebrochen, hat seine fünf Kinder als Geiseln genommen. Als Kate Burkholder die Kinder auf eigene Faust befreien will, wird sie von King überwältigt. Seine Forderung an sie lautet: Du kannst gehen, aber finde den Mörder meiner Frau! Als Kate diesen zwei Jahre alten Fall wieder aufgreift, ahnt sie noch nicht, wie gefährlich diese Ermittlung werden und welches Drama daraus entstehen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Linda Castillo
Ewige Schuld
Über dieses Buch
Sie sagen, ich sei vom rechten Weg abgekommen.
Sie glauben, dass jetzt nur noch Gott mir helfen kann.
Aber du, Kate Burkholder, wirst die Wahrheit finden.
Der neunte Fall für Polizeichefin Kate Burkholder reicht tief in ihre Vergangenheit.
Seit zwei Jahren sitzt Joseph King wegen des Mordes an seiner Frau Naomi hintner Frau Naomi hinter Gittern. Er gilt als ein »gefallener« Amischer, einer, der ständig mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Doch diese Tat hat er immer vehement bestritten. Jetzt ist er ausgebrochen, hat seine fünf Kinder als Geiseln genommen. Als Kate Burkholder die Kinder auf eigene Faust befreien will, wird sie von King überwältigt. Seine Forderung lautet: Du kannst gehen, aber finde den Mörder meiner Frau!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Bestseller, die immer auch auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Teil II
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Dank
Für meinen Mann Ernest
Immer
Prolog
Zwei Jahre zuvor
Er wartete, bis die Kinder schliefen. Es war sein letztes Geschenk für sie, ein paar Stunden Ruhe, bevor er ihnen das Liebste nahm. Bevor er ihre Arglosigkeit für immer zerstörte – und auch selbst etwas verlor, was er niemals zurückbekommen würde.
Er hatte keine andere Wahl. Die Entscheidung war schon vor Monaten gefallen. Nach Hunderten schlaflosen Nächten in schweißnassen Laken hatte er neben ihr gelegen und beschlossen, sie zu töten. Er hatte ihrem Atem gelauscht und ihren warmen Körper gespürt, und schon die Vorstellung, sie wieder nehmen zu können, hatte seine dunkle Seite erregt. Eine Seite, über die er schon vor so langer Zeit die Kontrolle verloren hatte, dass er nicht mehr wusste, wann das alles angefangen hatte.
Er parkte den Wagen hundert Meter vom Haus entfernt und ging den Rest zu Fuß. Der Duft von Regen hing in der Luft, es roch nach feuchter Erde und Pflanzen. In der Ferne Donnergrollen, das wie ein hungriges Ungeheuer näher kam, als wittere es Blut. Er lief durch das nasse Gras im seitlichen Garten, überquerte den Gehweg wie Tausende Male zuvor. Aber heute Nacht würde es das letzte Mal sein.
Er betrat das Haus durch die Hintertür, die nie abgeschlossen war, und stand im Vorraum. Regenwasser tropfte auf den Boden, Matsch und Steinchen hingen an seinen Stiefeln. Um ihn herum war es dunkel. In der Ecke brummte der petroleumbetriebene Kühlschrank. Alle im Haus schliefen.
Das Gewehr stand wie gewohnt an der Wand neben der Garderobe. Mit zittriger Hand griff er danach, klappte es auf und sah, dass es geladen war. Er ging zur Küche, in der noch der Geruch des Abendessens hing.
Als er das Wohnzimmer durchquerte, tauchte ein Blitz es in helles Licht. Die Momentaufnahme des Vertrauten. Wie oft hatte er auf dem verschlissenen Sofa gesessen, zwischen den selbstgenähten Kissen mit kitschigen Stickereien, die ihr so gefielen. Die Erinnerung setzte ihm zu, und der wohlbekannte Kummer pochte schmerzhaft in seiner Brust.
Leise schlich er über den Holzboden, stieg die knarrenden Treppenstufen hinauf in den ersten Stock, wo am Ende des Flurs mattes Licht durch ein Fenster fiel. Alle drei Schlafzimmertüren standen offen. Die Schritte vom Teppich gedämpft, ging er zur ersten Tür, hinter der die Jungen schliefen. Mit der behandschuhten Hand ergriff er den Knauf, drehte ihn und zog sie leise klickend zu. Dann schlich er zum Zimmer der Mädchen, stand in der Tür und lauschte dem gleichmäßigen Atem der schlafenden Kinder. Einen Moment lang verweilte er, von Gewissensnot gequält, denn nach dieser Nacht würde ihr Schlaf nie wieder so ruhig sein.
Doch diesem Gefühl durfte er sich nicht hingeben. Er hatte alle Optionen abgewogen und sich entschieden. Ihm blieb keine andere Wahl: entweder sie oder er. Er hatte sich für sein eigenes Leben entschieden, für seine eigene Zukunft. Ein dunkler Vorhang senkte sich auf seine Gefühle, brachte sie zum Schweigen. Er zog die Tür zu.
Ihr Schlafzimmer war am Ende des Flurs. Die Tür stand wie immer einen Spalt offen, damit sie die Kinder hören konnte, wenn sie mitten in der Nacht aufwachten. Dumme, ängstliche Frau. Mit der freien Hand schob er die Tür weiter auf, erkannte unter dem Fenster die Umrisse des Bettes. Für Einzelheiten war es zu dunkel, doch er hatte das Bild davon vor Augen: billiges, astiges Kiefernholz, vom Zahn der Zeit eingedunkelt; fadenscheinige Laken, die nach Waschmittel, Sonne und Frau rochen. Er sah sie vor sich, wie sie ihn anblickte, wenn er in ihr drin war. Wie sie seufzte, wenn er kam. Wie sie lachte, wenn es vorbei war …
Es fiel gerade genug Licht durchs Fenster, um ihren Körper unter dem Quilt zu erkennen. In der Luft hing ein schwacher Petroleumgeruch, der ihm sagte, dass sie wie immer bis spät in die Nacht gelesen hatte.
Ein weiterer Blitz erhellte das Zimmer, und in dem Moment sah er sie beide vor sich, ihre gebogenen Leiber ineinander verschlungen, und er musste die Gefühle zurückdrängen, die ihn zu ersticken drohten. Sein Gewissen sagte ihm, dass es auch anders ging. Dass sie eine Familie sein könnten, eine richtige Familie. Doch es war nur die Angst, die so sprach. Es stand zu viel auf dem Spiel, er hatte zu viel zu verlieren.
Bittere Galle kam ihm hoch, und er schluckte sie hinunter. Die Beklemmung in seiner Brust nahm ihm fast die Luft.
»Es tut mir leid, mein Schatz.« Sein Herz schlug so heftig, dass er nicht wusste, ob er die Worte nur gedacht oder sie tatsächlich ausgesprochen hatte.
Einen Meter vor dem Bett blieb er stehen und hob das Gewehr. Sein ganzer Körper bebte, als er den Kolben an die Schulter setzte und durchs Visier blickte. Seit dem dreizehnten Lebensjahr hantierte er mit Waffen, und zum ersten Mal im Leben zitterte die Mündung. Schweiß sammelte sich zwischen seinen Schulterblättern, als er ihren Oberkörper ins Visier nahm. Finger am Abzug. Tief einatmen, langsam ausatmen.
Ein lauter Donnerknall dröhnte in seinem Hirn, rüttelte seine Gedanken durcheinander und erschütterte seine Entschlossenheit. Ihr Körper zuckte, drehte sich leicht, das rechte Bein versteifte, erschlaffte wieder. Dann lag sie reglos da.
Lieber Gott, was hatte er getan?
Sein Herz raste, seine Gefühle zwangen ihn fast zu Boden. Es roch nach Blut, jenem Ur-Geruch, und er drohte daran zu ersticken. Er musste gehen und durfte niemals zurückblicken. Vergessen, wenn er konnte.
Er ließ das Gewehr sinken, wich zurück.
»Datt?«
Die Stimme traf ihn wie ein Blitz, der durchs Dach fuhr und jeden Nerv seines Körpers entzündete. Adrenalin durchflutete seine Adern, schoss glühend heiß in alle Gliedmaßen. Er wirbelte herum, hob das Gewehr.
»Was machst du da?«, fragte das Kind. Sein Mund ging auf, doch kein Ton kam heraus. Er starrte das kleine runde Gesicht an, nur einen Gedanken im Kopf: Sie macht alles kaputt.
Das Mädchen riss die Augen auf, und er wusste, dass sie zum Bett sah, wo ihre tote Mutter lag. »Ich will Mamm.«
Er senkte das Gewehr. »Sie ist krank. Geh zurück in dein Zimmer.«
»Ich hab Angst.«
»Es ist nur ein Gewitter.« Mit heftig zitternder Hand zeigte er zur Tür. »Geh jetzt.«
Sie drehte sich um und tappte barfuß wieder davon, eine winzige Gestalt in Weiß. Ein Engel mit Babyhaaren und drallen kleinen Händchen.
Er hob wieder das Gewehr, richtete es mit Tränen in den Augen auf ihren Rücken, legte den Finger an den Abzug. Ihm blieb keine andere Wahl. Lieber Gott hilf …
Er drückte ab.
Die Zündnadel klickte gegen die Patrone, kaum hörbar in dem trommelnden Regen auf dem Dach. Ungläubig ließ er das Gewehr sinken, starrte es fassungslos an. Wie konnte es ihn nur im Stich lassen?
Vage nahm er wahr, dass das Mädchen zurück in ihr Zimmer ging. Hörte, wie die Tür hinter ihr ins Schloss fiel.
Panik schloss sich wie unsichtbare Finger um seinen Hals, schnürte ihm die Kehle zu. Er stand da, kämpfte gegen das irre Lachen, das in ihm hochstieg und ihn zu ersticken drohte. Was sollte er jetzt tun? Ihm blieben nur wenige Möglichkeiten, er musste sich schnell entscheiden.
Ein letzter Blick zum Bett, dann wich er zurück, stieß gegen die Tür, ging raus aus dem Zimmer. Er stand im Flur, das Gewehr schlaff in der Hand. Er hatte es vermasselt.
Geh zurück, skandierte eine Stimme in seinem Kopf. Bring es zu Ende. Töte sie.
Als er zur Treppe kam, zitterte er am ganzen Leib. Sein Atem ging schwer wie nach einem Rennen. Die Stimme in seinem Kopf drängte ihn, zurück ins Schlafzimmer zu gehen und das Werk zu Ende zu bringen.
Feigling, flüsterte die vorwurfsvolle kleine Stimme. Feigling!
Er lief die Treppe hinunter, immer zwei Stufen auf einmal, durchs Wohnzimmer, durch die Küche, in den Vorraum. Als er das Gewehr zurückstellte, entschlüpfte seinem Mund ein gequälter Laut. Blitze flackerten vor dem Fenster auf.
Dann Donnergrollen, der Boden schwankte unter seinen Füßen. Er wusste, was er getan hatte – und was nicht.
Teil I
Mehr kann man nicht erwarten
vom Mensch diesseits des Grabes:
Sein Gutes ist – zu wissen, er ist schlecht.
Robert Browning, Der Ring und das Buch
1. Kapitel
Die überdachte Tuscawaras-Brücke ist ein Wahrzeichen von Painters Mill. Im Frühjahr und Sommer strömen Touristen die sonst kaum befahrene Landstraße entlang, um sie zu fotografieren, mit ihren Enkeln zu picknicken oder einfach über die alte Holzkonstruktion zu spazieren und sich vorzustellen, wie die Menschen hier vor einhundertfünfzig Jahren gelebt haben. An diesem Ort schlossen Paare den Bund fürs Leben, Kinder wurden gezeugt und Fotos fürs Highschool-Jahrbuch geschossen. Amische stehen regelmäßig mit ihrem Fuhrwerk auf dem Schotterplatz am Straßenrand, um Backwaren und frisches Gemüse an die Englischen zu verkaufen, die gern bereit sind, für eine Kostprobe des schlichten Lebens ein paar Dollar zu berappen.
Ich bin in den vergangenen Jahren schon unzählige Male über die Brücke gelaufen, habe ihre Konstruktion bewundert, ihre historische Bedeutung gewürdigt und auch nie vergessen, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt ist. Und welche Größenordnung er einnimmt, war klar und deutlich in der Stimme des Bürgermeisters, Auggie Brock, zu vernehmen, als er mich heute morgen anrief. In letzter Zeit ist die Brücke nämlich nicht mehr nur ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen, sie wird zunehmend auch von Graffitikünstlern und diversen anderen Leuten aufgesucht, die dort ihren illegalen Aktivitäten nachgehen. Ich weiß jetzt schon, dass mir der Stadtrat spätestens heute Abend im Nacken sitzt.
Ich parke mit meinem Dienstwagen am Straßenrand und nehme einen letzten Schluck aus meinem Kaffeebecher. Beim Aussteigen begrüßt mich der Gesang eines einsamen Kardinals in den Kronen der Bäume, die auf dem Grünstreifen entlang des Painters Creek stehen. Im dunstigen Licht der Sonne sehe ich den schmalen Pfad, der hinunter zum Flussufer führt.
Auf dem Weg zur Brücke knirscht Schotter unter meinen Füßen. Als ich sie betrete, werde ich von Schatten umhüllt. Die Gerüche von uraltem Holz, vom schlammigen Nass des Flusses darunter und vom frischen Frühlingslaub begleiten mich beim Gang zur anderen Seite. In den Dachsparren über mir gurren Tauben, ihre Exkremente verschandeln die Fensterbänke der sechs Fenster in der Holzkonstruktion.
Auf halbem Weg zur anderen Seite entdecke ich die Graffiti, und Empörung überkommt mich angesichts ihrer Hirnlosigkeit. Es ist der übliche Mist: Fick dich. Leck mich. Panthers sind scheiße (die Panthers sind das Highschool-Footballteam). Und sogar ein Hakenkreuz. Alles wahllos hingesprüht in Farben von Königsblau bis leuchtend Orange. Aber zu meiner Erleichterung keine Symbole von Gangs. Von dieser Form der Kriminalität ist Painters Mill trotz des kürzlichen Auftauchens eines blühenden Meth-Handels bislang verschont geblieben.
Ich gehe zum nächsten Fenster und blicke in den Fluss fünf Meter unter mir. Das moosgrüne Wasser mäandert sanft plätschernd Richtung Süden. Ein Sonnenbarsch blitzt silbern auf. Keinen Meter unter der Oberfläche schimmern Felsbrocken durch. In der Flussmitte ist das Wasser olivgrün und tiefer. Ich weiß das, weil ich vor achtzehn Jahren als Mutprobe aus diesem Fenster gesprungen bin. Als ich pitschnass und nach Flusswasser stinkend nach Hause kam, verstand meine Mamm zwar nicht, warum ich das gemacht hatte, aber ich durfte die Kleider wechseln, bevor mein Datt vom Feld zurückkam. Sie wusste, dass er Jugendsünden manchmal zu hart bestrafte.
Als ich das andere Ende der Brücke erreiche, fliegt eine Taube auf. Das aufgeregte Zischen ihres Flügelschlags fügt sich harmonisch in den Gesang der Vögel im Wald. Ich drehe mich um und sehe zurück. Der Explorer brät in der Sonne, der abkühlende Motor tickt, und heiße Luft steigt von der Motorhaube auf wie Dampf aus einer Kaffeetasse.
Eigentlich bin ich nicht überrascht, einen so idyllischen, ehrwürdigen Ort wie diesen mit Graffiti beschmiert vorzufinden. Denn obwohl ich als Amische aufgewachsen bin, war mir der Rest der Welt bei weitem nicht so fremd, wie meine Eltern es gern gehabt hätten. Ich habe selbst einigen Mist verzapft und gehörte für kurze Zeit auch zu jenen rücksichtslosen, wütenden Teenagern, die sich unbedingt hervortun wollten, auch wenn es destruktiv oder selbstzerstörerisch war.
Auf dem Weg zurück zur Brückenmitte blicke ich hoch zu den Dachsparren, wo ein riesiges rotes Hakenkreuz auf mich herabgrinst. Kopfschüttelnd stelle ich mir vor, wie ein besoffener Idiot mit einem Haufen Stroh im Hirn auf der Ladefläche seines Pick-ups steht mit einer Sprühdose in der Hand. Wer immer das war, hatte es nicht eilig. Er hat sich Zeit gelassen und Stellen ausgesucht, die nicht so leicht zu erreichen sind.
Ich gehe weiter und frage mich, was dieser Ort in den vielen Jahren wohl alles schon gesehen hat. Als ich ein Kind war, hatte mir meine Großmuder erzählt, dass es Orte gibt, die besondere Erinnerungen hervorrufen. Damals hatte ich keine Ahnung, wovon sie sprach, und es hatte mich auch nicht interessiert. Erst jetzt, als Erwachsene, weiß ich ihre Weisheit zu schätzen.
Als ich an einem der Fenster vorbeikomme, fällt mein Blick auf die vielen Dutzend Initialen, die in die uralten Balken und Bretter geritzt sind. Die meisten wurden mehrmals überritzt, und ein paar davon kenne ich. Irgendwo müssen auch meine eigenen Initialen und die meiner damals besten Freundin, Mattie, sein, aber ich kann sie nicht finden.
Die Ellbogen auf die Fensterbank gestützt, bin ich in meine Tagträume versunken, als ein Motorengeräusch mich zurück in die Gegenwart holt. Ich richte mich auf und sehe, wie das Cadillac-Coupé des Bürgermeisters hinter meinem Explorer hält. Die Fahrertür geht auf, der Bürgermeister hievt sich heraus und schlägt die Tür hinter sich zu.
Ich lasse die Vergangenheit hinter mir und gehe ihm entgegen. »Guten Morgen, Auggie.«
»Hallo, Chief.« Bürgermeister Auggie Brock ist ein korpulenter Mann mit Wangen wie ein Bluthund und Augenbrauen, die sein Friseur beharrlich ignoriert. Er trägt einen Anzug von JCPenney, ein lila, bereits zerknittertes Hemd und eine Krawatte, die ich niemandem antun würde.
»Tut mir leid, ich bin spät dran.« Einen Kaffeebecher aus LaDonna’s Diner in der Hand, betritt er die Brücke. »Hab in einer Stadtratssitzung festgesessen. Wir wären schon vor einer Stunde fertig gewesen, wenn Janine Fourman sich nicht wieder über das Graffiti-Problem ausgelassen hätte. Die Frau redet wie ein Wasserfall.«
Der Gedanke an Stadträtin Fourman lässt mich innerlich stöhnen. Wir haben über die Jahre schon öfter miteinander zu tun gehabt, und es war kein einziges Mal angenehm. »Sie haben mein ganzes Mitgefühl.«
Er bleibt neben mir stehen. Ich kann den Kaffee in seinem Becher riechen und das Aftershave von Polo, das er nach der morgendlichen Dusche aufgetragen hat. Er ist etwas kleiner als ich und wirkt wie ein Fuchs, der von Jagdhunden gehetzt wird.
»Die Vorsitzende vom Geschichtsverein war auch da, Kate. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass sie mit der Situation sehr unzufrieden ist.« Er sieht an mir vorbei und macht eine so ruckartige Handbewegung, dass Kaffee aus der Öffnung des Bechers schwappt. »Haben Sie sich das mal angesehen?«
»Es ist schwer zu übersehen.«
Er sieht mich an, als frage er sich gerade, ob ich ihn ernst nehme. Was ich durchaus tue. Normalerweise kann ich ihm ein Lächeln entlocken, auch wenn wir unangenehme Dinge oder Probleme besprechen, aber heute morgen scheint das aussichtslos.
»Himmelherrgott, ein Hakenkreuz?«, sagt er. »Wer schmiert denn so ein Zeug an die Wände?«
»Junge Leute mit zu viel Zeit.« Ich zucke die Schultern. »Die zu wenig Verantwortung tragen oder schlecht erzogen sind oder auch beides.«
»Haben Jugendliche denn heute keine Jobs mehr?« Er geht zum Fenster und zeigt auf eine besonders obszöne Schnitzerei. »Kate, wir haben gerade achttausend Dollar für den Anstrich der Brücke ausgegeben. Das war das zweite Mal in drei Jahren. Wir haben kein Geld, um sie schon wieder streichen zu lassen. Die Leute vom Geschichtsverein machen mir die Hölle heiß.«
»Verstehe«, sage ich diplomatisch.
»Wir müssen verhindern, dass hier weiter Graffitis gesprüht werden. Himmelherrgott, ganze Grundschulklassen machen Ausflüge hierher! Oder können Sie sich vorstellen, wie ein Lehrer sich fühlt, wenn er dieses vulgäre Wort hier sieht? Ich hab erst in der Armee begriffen, was es bedeutet. Wenn ein Sechsjähriger anfängt, so zu reden, haben wir ganz schnell eine Klage am Hals, und dann?«
»Auggie, vielleicht können wir ja ein paar Freiwillige dazu kriegen, die Sachen zu überstreichen«, schlage ich vor. »Einige meiner Leute wären bestimmt dazu bereit. Das schaffen wir schon.«
»Das waren bestimmt die kleinen Scheißer von der Maple-Crest-Siedlung«, knurrt er. »Diese Highschool-Kids haben einfach keinen Respekt. Wir sollten endlich mal was unternehmen, Kate. Eine gemeinsame Aktion, um sie zu erwischen.«
»Ich könnte Pickles auf sie ansetzen«, sage ich. Mein ältester Officer, Roland »Pickles« Shumaker, gilt als jemand, der bei allen unter dreißig hart durchgreift. Bis letztes Jahr trug sein Ruf zur allgemeinen Erheiterung bei, aber dann hat er einem zwölfjährigen Jungen Handschellen angelegt, weil er eine Flasche aus einem fahrenden Auto geworfen hatte. Der Junge war zufällig der Enkel von Stadträtin Fourman, die das überhaupt nicht witzig fand.
»Das ist nicht Ihr –«, beginnt er, merkt aber, dass ich einen Witz gemacht habe, und fängt jetzt auch an zu kichern. »Es freut mich, dass wenigstens Sie darüber lachen können.«
»Wir könnten öfter Patrouille fahren und Sheriff Rasmussen überreden, uns County-Unterstützung zu geben.«
»Das wäre zumindest ein Anfang, Kate. Wir müssen die Schmierfinken erwischen. Ich will, dass sie festgenommen werden. Vierzig Stunden gemeinnützige Arbeit sollten ihnen klarmachen, dass man so etwas nicht tut. Mal sehen, wie sie das finden, wenn sie hier jeden Samstag Hakenkreuze übermalen dürfen.«
Ich würde ihn gern darauf hinweisen, dass ich schon einmal einen Jungen erwischt habe, der die Brücke verunstaltet hat – er war Oberstufenschüler der Highschool und obendrein Footballspieler. Seine Eltern haben Beschwerde eingelegt, und am Ende wurde die Klage fallengelassen. Also verkneife ich es mir, denn so etwas gehört zum Beruf eines Polizisten in einer Kleinstadt dazu. Meine Arbeit ist es, Gesetzesbrecher festzunehmen, alles andere ist Aufgabe der Gerichte. Ich hab nur keine Lust, mich nach dem Motto »eine Hand wäscht die andere« in die Enge treiben zu lassen.
Verärgert geht Auggie zu einem alten Eichenbalken und schlägt mit der flachen Hand dagegen. »Können Sie sich vorstellen, dass Leute extra aus Columbus hierherkommen, um eine historische Brücke zu besichtigen, und dann sehen sie das hier?«
»An Wochenenden sind meistens viele Teenager hier draußen«, sage ich. »Wenn ich unten an der Straße, wo man wenden kann, einen Officer postiere, erwischen wir sie vielleicht auf frischer Tat und können an ihnen ein Exempel statuieren. Dann hört das bestimmt auf.«
Noch während ich das sage, ist mir klar, dass ich der Officer sein werde, der sich dort die Nacht um die Ohren schlägt. In meinem kleinen Polizeirevier sind wir nur vier Vollzeitpolizisten, ich eingeschlossen. Pickles ist über siebzig und arbeitet seit letztem Jahr Teilzeit. Zudem gibt es kein Budget für Überstunden. Und sollten wir Glück haben und einen der hohlköpfigen Künstler in flagranti erwischen, ist es gut möglich, dass Richter Siebenthaler den Schwanz einzieht, wenn die Eltern Beschwerde einlegen, weil ihr kleiner Liebling noch minderjährig ist.
Ich sehe Auggie durchdringend an. »Als Chief habe ich die Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass ein Budget für Überstunden nützlich wäre.«
Er macht ein Gesicht, aus dem ich nicht ganz schlau werde. »Ich weiß, dass Sie mit einem Rumpf-Team operieren, Kate, und Sie wissen, dass ich auf Ihrer Seite bin. Seit Jahren bearbeite ich den Stadtrat, Ihr Budget zu erhöhen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich die Erbsenzähler davon zu überzeugen versuche.«
Das mag ich an Auggie: Er ist zwar mit Haut und Haar Politiker, tritt aber auch für unsere Belange ein.
»In der Zwischenzeit«, sagt er, »sollten hier ein paar Freiwillige ans Werk.«
Ich nicke. »Ich könnte mir vorstellen, dass Jim vom Baumarkt die Farbe spendiert.«
»Gute Idee«, erwidert Auggie. »Jim und ich sind bei den Rotariern, ich kümmere mich darum.«
In dem Moment klingelt mein Telefon. Auf dem Display steht ODRC, was sofort meine Neugier weckt. Ohio Department of Rehabilitation and Corrections – das Gefängnis in Mansfield.
»Ich muss hier drangehen«, lasse ich Auggie wissen.
Er blickt auf seine Uhr. »Ich muss sowieso zu einem Meeting.«
»Vergessen Sie nicht, mit Jim zu reden.« Ich hebe zum Abschied die Hand, drehe mich um und nehme ab. »Burkholder.«
»Jerry Murphy. Ich bin stellvertretender Direktor in Mansfield.«
Die Strafvollzugsbehörde in Mansfield ist ein Hochsicherheitsgefängnis hundert Meilen nördlich von Painters Mill.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, frage ich.
»Letzte Nacht gab es hier eine Sicherheitspanne im Zusammenhang mit einem Insassen«, erklärt Murphy. »Sie stehen auf unserer Benachrichtigungsliste, Chief Burkholder.«
Eine Benachrichtigungsliste enthält die Namen der Personen – Polizisten, Justizpersonal, Zeugen, die vor Gericht ausgesagt haben, Familienmitglieder und Opfer –, die informiert werden müssen, wenn sich der Status eines Gefangenen ändert. Wenn zum Beispiel ein Insasse auf Bewährung freigelassen wird. Dieser Anruf hat vermutlich nichts mit einer regulären Entlassung zu tun.
»Wer?«, frage ich.
»Joseph King.«
Der Name versetzt mir so einen Schock, dass ich nach Luft schnappe. Ich war acht Jahre alt, als ich Joseph kennenlernte. Ein amischer Junge, der auf der Nachbarfarm wohnte. Jacob, mein älterer Bruder, manchmal auch meine Schwester Sarah und ich, haben nach der Erledigung unserer Pflichten oft mit Joseph und seinen zwei Brüdern zusammen gespielt. Zwischen unseren beiden Farmen lag ein Waldstück mit einem Bach – der ideale Tummelplatz für gelangweilte amische Kinder.
Joseph hatte nur Unfug im Kopf. Er liebte das Abenteuer, erzählte gern haarsträubende Geschichten, war witzig und streitlustig und für jeden Spaß zu haben. Obwohl wir viel auf der Farm mithelfen mussten, hatten wir immer auch freie Zeit. Wir spielten im Wald Cowboy und Indianer oder gingen im tiefen Teil des Bachs schwimmen. Als ich neun war, markierte Joe auf der Pferdekoppel ein Baseballfeld, und ich lernte, Baseball zu spielen. Im Winter liefen wir auf dem nahen Miller’s Pond Schlittschuh. Als ich zehn war, brachte Joe mir Hockeyspielen bei. Ich habe mich gern mit anderen gemessen, was für ein amisches Mädchen ungewöhnlich war und meinem Datt und meinem Bruder nicht besonders gefiel. Aber Joe fand es gut. Er mochte, dass ich ein halber Junge war, eine schlechte Verliererin, und einer Rauferei nie aus dem Weg ging.
Mit zwölf habe ich mich dann in ihn verliebt. Die harmlose Schwärmerei eines amischen Mädchens, aber für mich war es das Größte und Schönste überhaupt. Ich hatte niemandem davon erzählt, nicht einmal meiner besten Freundin. Es war ganz allein mein Geheimnis: Zum ersten Mal hatte ein Junge mir den Atem geraubt. Diese bittersüße Kostprobe von Liebe war überwältigend und prägend wie meine ersten Gehversuche.
Im Herbst desselben Jahres krachte ein betrunkener Autofahrer in den Buggy von Josephs Datt und tötete ihn. Von da an kam Joseph nicht mehr so oft zu uns herüber, und ich sah ihn kaum noch. Aber ich hörte die Geschichten. Die Gerüchte, dass er auf die schiefe Bahn geraten war; dass das Licht in seinen Augen erloschen und sein Herz nur noch eine finstere Grube war. Es hieß, er hätte seine Unbeschwertheit gegen ein grüblerisches Ich eingetauscht – und sei manchmal auch jähzornig.
Vor zwei Jahren erfuhr ich dann, dass Joseph King seine schlafende Frau in ihrem Haus erschossen hatte. Ich bin nicht leicht zu schockieren, aber es fiel mir schwer zu glauben, dass der Junge, den ich einst gut kannte, zu so etwas fähig war. Kurz hatte ich sogar überlegt, ihn zu besuchen, aber dann kam etwas dazwischen, und später vergaß ich es. Ich verfolgte die Berichterstattung in den Medien und hörte, dass er wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt worden war.
»Chief Burkholder? Sind Sie noch da?«
Die Stimme des stellvertretenden Gefängnisdirektors reißt mich aus meinen Gedanken. »Ja.« Ich murmele etwas über die schlechte Verbindung. »Was ist mit King passiert?«, frage ich.
»Er ist letzte Nacht irgendwann nach Durchzählung der Insassen geflohen, und wir konnten ihn bis jetzt nicht lokalisieren.«
Ich traue meinen Ohren kaum. Es passiert nicht oft, dass ein Insasse entkommt, dafür gibt es zu viele Sicherheitsvorkehrungen und zudem ein gut funktionierendes Kontrollsystem. Ohne Hilfe von außen ist eine Flucht so gut wie unmöglich.
»Ich stehe auf der Benachrichtigungsliste?«, frage ich.
»Ja. Er hat Verbindungen nach Painters Mill.«
Stimmt, fällt mir wieder ein. Nach Josephs Verurteilung waren seine fünf Kinder zunächst in die Obhut seiner Schwägerin hier in Painters Mill gekommen. Rebecca Beachy, die Schwester, und ihr Mann Daniel, haben sie später adoptiert.
»Da die Kinder in Ihrem Zuständigkeitsbereich wohnen, wollte ich Sie schon einmal vorwarnen, falls er versucht, sie zu kontaktieren. Das Sheriffbüro von Holmes County ist ebenfalls informiert.« Er hält inne. »Ich habe gehört, Sie gehören dort zur Amisch-Gemeinde.«
»Gehörte«, korrigiere ich ihn. »Ich weiß, wo die Beachys wohnen. Sie haben kein Telefon, ich fahre hin und sage ihnen Bescheid.«
»Das ist nett, danke.«
»Hat King irgendwelche Drohungen gegen sie ausgesprochen?«, frage ich. Wenn Kinder beteiligt sind, können Emotionen leicht hochkochen.
»Davon weiß ich nichts«, sagt er. »Was aber nicht heißt, dass er nicht versuchen wird, Kontakt mit ihnen aufzunehmen oder seinen Kindern oder der Familie etwas anzutun. Nach allem, was ich gehört habe, ist Joseph King absolut kaltblütig.«
Seine Worte verstören mich mehr, als sie sollten. Ich habe Joseph als einen freundlichen Jungen in Erinnerung, dem es schwerfiel, einen Fisch zu töten, den er gefangen hatte. »Die Suchmeldung ist draußen. Highway Patrol und Sheriffbüro von Richland County sind im Einsatz. Wir haben Hunde vor Ort, und das BCI ist wahrscheinlich auch mit dabei.«
Was bedeutet, dass mein Lebensgefährte, BCI-Agent John Tomasetti, auch angerufen wird.
»Können Sie mir ein neueres Foto von King mailen?« Ich gebe ihm meine Mailadresse durch.
»Wir schicken das Fahndungsfoto an sämtliche Polizeidienststellen in allen vier Countys, einschließlich Cuyahoga.«
»Danke, dass Sie mich informiert haben.«
»Kein Problem.«
Ich knipse das Gespräch weg und stecke das Handy zurück in die Tasche. Seit zwanzig Jahren habe ich Joseph King weder gesehen noch mit ihm gesprochen, allerdings waren mir beunruhigende Geschichten zu Ohren gekommen. Und nicht nur von den Amischen, auch von der Polizei. King hatte offensichtlich große Probleme: Seine Ehe war am Ende, die zahlreichen Kinder waren ungewollt, und von ehelicher Treue hielt er auch nicht viel.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich erfuhr, dass man seine Frau tot aufgefunden hatte und Joseph beschuldigt wurde, sie umgebracht zu haben. Es war mir unvorstellbar, dass der Junge aus meiner Kindheit – der mit dem breiten Grinsen und herzhaften Lachen – so etwas Entsetzliches getan haben konnte. Aber keiner weiß besser als ich, wie sehr das Leben einen Menschen verändern kann – und oft genug nicht auf positive Weise.
Ich wollte mit ihm sprechen, ihn fragen, warum er das getan hatte. Aber ich wusste, dass sich nur ein winziger Teil meines Herzens daran erinnerte, wie es war, dreizehn Jahre alt zu sein und das quälende Ende meiner ersten Schwärmerei zu erleben. Jener Teil, der grenzenlos loyal war und noch immer glaubte, alle Menschen wären grundsätzlich gut. Die Ermittlungen und Gerichtsverhandlung hatte ich dann aus der Ferne verfolgt. Joseph King, seine Frau und seine fünf Kinder lebten auf einer kleinen Farm nahe Middlefield, Ohio, etwa zwei Stunden nordöstlich von Painters Mill. King behauptete, in der Mordnacht am Eriesee angeln gewesen zu sein. Er blieb bei der Behauptung, dass jemand in ihr unverschlossenes Haus eingedrungen war, sein Gewehr genommen und seine Frau erschossen hatte, während die fünf Kinder auf der gleichen Etage in ihren Zimmern schliefen. Am nächsten Morgen hatten die Kinder den Leichnam ihrer Mutter entdeckt. Zwei Tage später wurde Joseph verhaftet und des Mordes angeklagt.
Vor Gericht beteuerte er hartnäckig seine Unschuld. Er behauptete, seine Frau zu lieben, und schwor, ihr niemals etwas zuleide getan zu haben. Doch kein Mensch glaubte ihm. Sein Jähzorn war stadtbekannt. Außerdem hatte er mehrere Vorstrafen, einschließlich zweier Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt. Seine Fingerabdrücke fand man auf dem Gewehr und den Patronen. An einer vor Ort gefundenen Jacke von ihm waren Schmauchspuren. Am Eriesee erinnerte sich niemand, King in der Hütte gesehen zu haben. Am Tatort wurden sowohl Indizien- als auch Tatsachenbeweise gefunden, und der Staatsanwalt präsentierte jedes pikante Detail.
Die Verhandlung dauerte drei Wochen und lockte wegen des Medienspektakels viele Touristen an, manche sogar aus New York. Am Ende wurde King wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Bis zuletzt, als er in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt wurde, beharrte er auf seiner Unschuld. Niemand glaubte ihm, auch ich nicht.
Der Fall hatte großes öffentliches Interesse hervorgerufen, zum einen, weil King amisch war, aber auch wegen der Brutalität der Tat und weil die Kinder zum Zeitpunkt des Mordes im Haus waren. Er führte allen vor Augen, dass häusliche Gewalt kultur- und religionsübergreifend passiert. Aber auch, dass aus irgendeinem Grund sämtliche Warnzeichen übersehen wurden, und zwar von der Polizei, von der Familie und von der Amisch-Gemeinde.
Naomi King war erst neunundzwanzig Jahre alt gewesen. Eine hübsche, amische Frau, deren Leben von einem eifersüchtigen, herrschsüchtigen und zeitweise gewalttätigen Ehemann beendet wurde. Zurück blieb eine zerstörte Familie und viele für immer beschädigte Leben – und wofür das alles?
Ich gehe zum Explorer, schiebe mich hinters Lenkrad und rufe mein Polizeirevier an. Das Graffiti-Problem kann warten.
Lois, die morgens in der Telefonzentrale arbeitet, meldet sich mit einem frechen: »Haben Sie Auggie von der Brücke geschmissen?«
Trotz meiner angeschlagenen Stimmung muss ich lachen, und die Wolke über mir verzieht sich. »Können Sie bitte alle Mitarbeiter zu einem kurzen Meeting einbestellen?«
»Geht es um Joseph King?«
Sie weiß schon Bescheid, was mich kaum überrascht, denn Neuigkeiten verbreiten sich schnell in einer kleinen Stadt. Und da meine Mitarbeiter in der Telefonzentrale den Polizeifunk hören, erfahren sie vieles oft schneller als ich.
»Meeting ist in einer Stunde.« Ich erzähle ihr von meinem Gespräch mit dem stellvertretenden Gefängnisdirektor. »Ich fahre noch schnell zu den Beachys, um sie über die neue Situation in Kenntnis zu setzen.«
»ODRC geht davon aus, dass er herkommt?«
»Glaube ich nicht, aber die Familie muss wissen, dass er draußen ist. Und wir müssen auf alles gefasst sein. Sicher ist sicher.«
2. Kapitel
Auf dem Weg zur Farm der Beachys rufe ich Sheriff Mike Rasmussen vom Holmes-County-Sheriffbüro an.
»Rufen Sie wegen Joseph King an?«, fragt er sofort.
»Können heute alle Gedanken lesen?«, murmele ich und sage: »Ich bin auf dem Weg zu Rebecca und Daniel Beachy.«
»Gut. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn Sie mit den beiden reden. Sie sprechen ihre Sprache und kennen sich auch sonst mit den Gepflogenheiten aus. Wenn ich dort bin, um ihnen etwas mitzuteilen, nicken sie immer nur und ignorieren dann alles, was ich gesagt habe.«
»Das liegt an der Trennung von Amischen und Englischen, Mike, nicht an der Sprache. Sie verstehen Sie ausgezeichnet.«
»Ziemlich praktisch.«
Ich lache. »Hat ODRC Ihnen gesagt, wie King entkommen ist? Ich habe vergessen, danach zu fragen, als ich den Gefängnisdirektor am Telefon hatte.«
»Ich hab gerade mit dem Sheriff in Richland County telefoniert. Soviel ich verstanden habe, hat King eine Eisenplatte durchgesägt, ist durch einen ungesicherten Rohrleitungstunnel hoch zum Dach gekrochen und hat sich von da mit einem Strick aus Bettlaken abgeseilt.«
»Man sollte die Macht der Erfindungsgabe nie unterschätzen«, sage ich und versuche, die Information einzuordnen. »Gehen die dort davon aus, dass er Hilfe von außen hatte?«
»Die Eisenplatte hat er jedenfalls nicht mit einer Zahnbürste zersägt.«
»Also jemand von drinnen?«
»Der Sheriff war nicht besonders mitteilsam.«
Er sieht es zwar nicht, aber ich verdrehe die Augen. »Postieren Sie einen Deputy draußen bei den Beachys?«
»Die Streife fährt jetzt öfter vorbei, Kate. Ich hab zurzeit nicht genug Leute, um die Farm rund um die Uhr zu bewachen.«
»Mike, mein Revier ist andauernd unterbesetzt.«
»Also, wenn mir eine lebenslange Gefängnisstrafe drohte, würde ich garantiert nicht nach Painters Mill kommen. Ich würde so weit wie möglich aus Dodge rauswollen.«
»Kanada?«, sage ich.
»Oder Mexiko.«
»Es sei denn, er will seine Kinder sehen.«
Rasmussen seufzt. »Stimmt, wenn es um ihre Kinder geht, sind Menschen empfindlich.«
Seine Worte sind wenig beruhigend. »Ich sage Ihnen Bescheid, wie es bei den Beachys war.«
»Gut, danke.«
»Und Sie lassen mich wissen, wenn es etwas Neues gibt, ja?«
»Mach ich.«
Rebecca und Daniel Beachy wohnen drei Meilen außerhalb von Painters Mill. Ihre Farm ist nur über eine unbefestigte Straße zu erreichen und liegt eingezwängt zwischen der hier baumreichen Flussaue des Painters Creek im Westen und den schachbrettartigen Soja-, Heu- und Maisfeldern im Osten.
Meine Sorge, dass Joseph King hierherkommt, hält sich in Grenzen. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis zu der hiesigen Amisch-Gemeinde, und King weiß bestimmt, dass er in Painters Mill keine Freunde hat, weder englische noch amische. Und da sämtliche Polizeidienststellen der Gegend in die Suche involviert sind, stehen die Chancen gut, dass er schnell wieder aufgegriffen wird. Trotzdem könnte Rasmussen mit seiner Bemerkung recht haben, dass die Leute empfindlich werden, wenn es um ihre Kinder geht. Vielleicht will King sie ja unbedingt sehen. Außerdem ist er amisch. Zwar wurde er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, aber das Bedürfnis, zu einem Ort zurückzukehren, den er kennt, könnte stark sein.
Auf der langsamen Fahrt über den Feldweg passiere ich ein überweidetes Feld zu meiner Linken und dunkle Wälder entlang des Flusses zu meiner Rechten. Die Farm liegt abgeschieden, für einen Mann auf der Flucht also günstig. Wahrscheinlich haben die Beachys kein Telefon. Wenn etwas passierte, könnten sie nicht einmal einen Notruf absetzen.
Nach einer Kurve erreiche ich die Rückseite des Hauses. Ich parke hinter einem uralten Gülleverteiler, der mit Sägespänen, Dung und Stroh überzogen ist. Weiter hinten steht eine baufällige Scheune mit abblätternder weißer Farbe und rostigem Blechdach. Daneben überragt ein massives Silo das Grundstück wie ein alternder Wächter. Im Garten neben dem Haus flattert in der Brise ein Sammelsurium an Kinderwäsche – Kleider, Hosen und Hemden – ordentlich aufgereiht an einer altmodischen Wäscheleine.
Ich steige aus dem Explorer und laviere mich zwischen einem Dutzend fetten rotbraunen Hühnern, die in der Erde rumpicken, durch zur Hintertür. Noch bevor ich klopfe, geht die Windfangtür auf, und ein kleiner Junge von etwa sechs Jahren sieht mich aus unglaublich blauen Augen an. Er stößt einen kurzen Schrei aus und rennt zur Scheune, dicht gefolgt von einem tapsigen Welpen.
»Levi! Geh und hilf deinem Bruder, den Hund zu baden!«, ruft eine weibliche Stimme aus dem Inneren des Hauses. »Er stinkt schlimmer als der alte Eber!«
Als ich das höre, muss ich lächeln. Meine Mamm hatte nur drei Kinder, aber wir waren schwierig – besonders ich –, und ihre Anweisungen hatte sie immer wie ein Feldmarschall gebrüllt. Ich fange die Tür schnell auf, bevor sie zufällt, und blicke plötzlich in zwei allzu vertraute braune Augen. Josephs Augen flüstert eine lange verschüttete Erinnerung. Doch sie gehören einem etwa acht- oder neunjährigen Jungen. Er steht im Vorraum, hat einen Strohhut auf, ein blaues Arbeitshemd an und Hosen, die bis zu den knochigen Knien hochgerollt sind und schmutzige nackte Füße offenbaren.
»Hi.« Ich lächele ihn an. »Ich heiße Kate. Sind deine Eltern zu Hause?«
Den Blick weiter auf meine Augen geheftet, ruft er: »Mamm! Mir hen Englischer bsuch ghadde!« Wir haben Besuch von einer Englischen.
Ich trete zur Seite, und er schießt an mir vorbei zur Tür hinaus.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Ich drehe mich zu der amischen Frau um, die in der Küchentür steht, ein rotweiß kariertes Geschirrtuch in der Hand. Sie ist etwa Mitte vierzig und trägt ein hellblaues Kleid, eine weiße Schürze und eine Kapp. Sie ist klein, kaum über einen Meter fünfzig groß und hat dunkelbraunes Haar und braune Augen. Ihre milchweiße Haut und die Stupsnase sind voller Sommersprossen.
»Ms Beachy?«
»Ja.« Sie blickt auf meine Uniform. »Was gibt es?«
Ich stelle mich vor, zeige ihr meine Dienstmarke und trete in den Vorraum. »Ich würde gern kurz mit Ihnen und Ihrem Mann sprechen. Darf ich hineinkommen?«
Sie macht ein sorgenvolles Gesicht und kommt auf mich zu. »Ist etwas passiert?«
»Es geht um Joseph King«, sage ich. »Ist Mr Beachy zu Hause?«
»Joseph? Ist er verletzt? Hat er –?«
Ein hochgewachsener amischer Mann in der typischen Kleidung – blaues Arbeitshemd, dunkle Hose mit Hosenträgern und flachkrempiger Strohhut – kommt aus der Küche und schneidet ihr das Wort ab. Ich schätze ihn auf um die vierzig.
»Was ist mit Joe passiert?«, will er wissen.
Als wäre seine Frau Luft, geht er an ihr vorbei und tritt vor mich, lächelt nicht.
Ich erzähle ihnen von dem Anruf des Gefängnisdirektors. Als ich fertig bin, stehen sie beide mit besorgter Miene schweigend da.
»Eah is am shpringa«, flüstert die amische Frau. Er ist auf der Flucht.
Ich nicke. »So ist es.«
»Und Sie glauben, er kommt her?«, fragt Daniel. »Sind Sie hier, um uns zu warnen?«
»Ich weiß nicht, was er vorhat«, sage ich. »Die Polizei sucht ihn. Aber Sie sollten wachsam sein und Ihre Familie beschützen.«
»Die Kinder.« Rebeccas Hand schnellt zum Kragen ihres Kleides. Ihre Finger streichen nervös über den Stoff. Die beiden werfen sich einen Blick zu.
Sie sind bestürzt. Zu Recht, nach allem, was ich über Joseph gehört habe.
»Können wir uns irgendwo hinsetzen und unterhalten?«, frage ich.
Daniel zeigt zur Tür. »Dess vayk.« Da entlang.
Rebecca führt uns in eine große Farmhausküche mit meerschaumgrünen Schränken, cremefarbenen Arbeitsplatten aus Resopal und einer verkratzten Porzellanspüle. Es ist eine klassische amische Küche, groß, schlicht und ausgestattet mit alltäglichen Haushaltsgegenständen. Auf dem Herd steht ein Schmortopf, umgedreht im Geschirrkorb ein altmodischer Kaffee-Perkolator, in einem Tontopf auf der Fensterbank blüht Rosmarin, daneben steht ein Glas mit Vitamintabletten. Um den rechteckigen Tisch mit der karierten Tischdecke und einer Laterne in der Mitte stehen acht Stühle.
Als wir sitzen, sagt Daniel: »Sie sind die Frau, die einmal amisch war.«
»Ja.« Die Missbilligung, die in seinen Augen aufblitzt, entgeht mir nicht. Aber sie ist nur flüchtig und gepaart mit Neugier. Wir sind nicht hier, um über mich zu reden oder meine Entscheidung, die Glaubensgemeinschaft zu verlassen. Ich wende mich Rebecca zu. »Naomi war Ihre Schwester?«
Sie nickt. »Sie war gerade erst achtzehn geworden, als sie Joseph geheiratet hat. Er war noch in der Rumspringa und sah sehr gut aus. Aber in ihm drin war auch etwas Dunkles, eine versteckte Wut, glaube ich. Ich habe versucht, Naomi zu warnen, aber sie war verrückt nach ihm. Sie wollte unbedingt heiraten und eine Familie gründen und ganz schnell Kinder haben. Sie hat sie so sehr geliebt …« Sie verstummt, schüttelt den Kopf.
»Sie und Ihre Schwester standen sich nahe?«, frage ich.
»Besonders in jungen Jahren. Nachdem sie geheiratet hat …« Sie zuckt die Schultern. »Ab dann … wurde alles anders.«
»Was hat sich verändert?«, frage ich.
»Wir waren nicht mit ihm einverstanden«, sagt Daniel geradeheraus. »Besonders später.«
Seine Frau presst die Lippen zusammen, fährt dann fort. »Daniel und ich haben sie so oft wie möglich besucht. Besonders nach der Geburt der Kinder. Und natürlich haben wir sie immer im Gottesdienst gesehen.«
»Wie war ihre Beziehung mit Joseph?«
»Am Anfang schien alles in Ordnung. Naomi sagte, er wäre ein guter Ehemann, und ich habe selbst gesehen, dass er die Kinder liebte. Er hat sie zwar oft angeschrien, aber … ich dachte, er wäre einfach nur streng.« Wieder Schulterzucken. »Manche Männer sind einfach so.«
»In Gegenwart von anderen hat er Naomi gut behandelt«, wirft Daniel ein.
Mein Blick ist weiter auf Rebecca geheftet. »Und wenn sie allein waren?«
»Dann gab es … Probleme«, erwidert Rebecca. »Joseph hat gern getrunken, und er war jähzornig.«
Keine gute Kombination, denke ich. »Hat er sie misshandelt?«
»Die Polizei hat ihn deswegen festgenommen«, antwortet Daniel.
»Hat er sie geschlagen?«, will ich wissen.
Die beiden blicken sich wieder an und schütteln den Kopf. »Er hat darauf geachtet, dass niemand diese Seite von ihm mitbekommt«, sagt Daniel.
»Aber wir glauben, dass er gemein zu ihr war.« Rebeccas Stimme versagt. »Grausam.«
Schweigen tritt ein. Durch das offene Fenster höre ich draußen die Kinder spielen. Der Welpe bellt, und irgendwo kräht ein Hahn.
»Hat einer von Ihnen beiden Joseph im Gefängnis besucht?«, frage ich schließlich.
Daniel schüttelt den Kopf. »Nach dem, was er Naomi angetan hat, wollten wir nichts mehr mit ihm zu tun haben.«
»Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?«
»Bei der Gerichtsverhandlung«, antwortet Daniel.
»Anfangs wollten wir ihm ja glauben«, sagt Rebecca. »Er schien am Boden zerstört. Aber … da waren einfach zu viele schlimme Dinge, die gegen ihn sprachen.«
»Er war ein leeyah.« Ein Lügner. Daniel verzieht das Gesicht. »Was passiert ist … war … gottlos. Welcher Mann will den Tod seiner eigenen Frau? Welcher Mann tötet so kaltblütig?«
»Bis zuletzt haben wir für ihn gebetet«, sagt Rebecca. »Wir wollten einfach nicht glauben, dass Joseph zu so etwas fähig ist.«
»Wir beten noch immer für seine Seele, aber wir sind fertig mit ihm«, sagt Daniel.
»Er is ganz ab«, flüstert Rebecca. Er ist verrückt.
»Hat er mit den Kindern Kontakt gehabt?«, frage ich.
»Nein«, erwidert Rebecca.
Ich sehe Daniel an. »Will er sie sehen?«
»Während des ganzen Prozesses«, sagt er, »hat Joseph immer behauptet, sie zu vermissen. Er schien verzweifelt und wollte sie sehen. Wir waren dagegen und haben immer eine Ausrede gefunden.« Der amische Mann zuckt die Schultern. »Nach allem, was er getan hat … Und sie hatten ja ihre tote Mutter gefunden. Es war so schlimm.«
»Wie geht es den Kindern?«, frage ich.
»Besser«, sagt Rebecca. »Natürlich fehlt ihnen ihre Mamm. Und obwohl es verrückt klingt, ihren Datt vermissen sie auch.«
»Verstehen sie, was passiert ist?«
Daniel schüttelt den Kopf. »Wir hielten es für das Beste, ihnen nichts zu sagen.« Er zuckt die Schultern. »Vielleicht, wenn sie älter sind.«
Tränen treten in Rebeccas Augen. »Können Sie sich das vorstellen? Dass Ihr Datt Ihre Mamm tötet? Mein Gott.«
»Sprich nicht darüber«, mahnt Daniel sie, als wüsste er, dass es sie emotional zu sehr mitnimmt. »Sie sind auf ihre Weise klargekommen. Wir beschäftigen sie so gut es geht, geben ihnen etwas zu tun. Und wir beten gemeinsam.«
»Sie sind glücklich bei uns, glaube ich.« Rebecca lächelt, doch in ihren Augen schimmern Tränen. »Bestimmt wacht Naomi im Himmel über sie. Passt auf uns alle auf.«
»Sie beide kennen Joseph wahrscheinlich besser als alle anderen.« Ich sehe von einem zum anderen. »Hat er jemals darüber gesprochen, dass er ausbrechen wollte?«
»Wie ich schon gesagt habe, seit dem Ende des Prozesses haben wir ihn nicht mehr gesehen.«
Da mir klar ist, dass Menschen manchmal etwas wissen, ohne dass es ihnen bewusst ist, versuche ich es auf einem anderen Weg. »Haben Sie irgendeine Idee, wohin er gehen könnte?«
Daniel presst die Lippen zusammen. »Vielleicht zur Hölle?«
»Glauben Sie, er könnte herkommen?« Als sie nichts sagen, formuliere ich die Frage konkreter. »Um die Kinder zu sehen?«
Als Daniel schließlich antwortet, ist seine Stimme ehrfürchtig und leise. »Sie sind amisch aufgewachsen, Kate Burkholder. Sie wissen, dass Vergebung zu unserem Glauben gehört.« Er zieht den Kopf ein, er ist nicht stolz auf das, was er gleich sagen wird. Doch es scheint ihm zu wichtig, um es zu verschweigen. »Kein Amischer hier würde auch nur einen Finger krümmen, um ihm zu helfen. Nicht nach dem, was er seiner Frau angetan hat. Seinen Kindern. Uns allen. Er hat keine Freunde unter den Amischen.«
»Und unter den Englischen?«, frage ich.
»Das kann ich nicht wissen«, sagt er.
Von draußen dringt Kinderlachen zu uns herein und füllt die Stille. Doch das unschuldige, sorglose Lachen erinnert uns nur daran, was ihnen genommen wurde und was gerade auf dem Spiel steht.
»Ich werde die Gegend vermehrt von Streifenwagen patrouillieren lassen, besonders rund um Ihre Farm. Das Sheriffbüro unterstützt uns. Nur für den Fall, dass Joseph herkommt. Ich will einfach sicherstellen, dass Ihnen nichts passiert.«
»Wir brauchen die englische Polizei nicht«, erwidert Rebecca. »Gott wird uns beschützen.«
Daniel sucht meinen Blick und nickt. »Ich hab nix dagege.«
Die Antwort auf meine nächste Frage kenne ich schon, doch ich stelle sie trotzdem. Ich muss zumindest dafür sorgen, dass sie darüber nachdenken.
»Besitzen Sie eine Waffe, Mr Beachy?«
»Ich habe einen alten Vorderlader«, erwidert Daniel. »Eine echte Antiquität, sie hat meinem Grossdaddi gehört.«
Wir blicken uns an. In diesem Moment verstehen wir uns wortlos. Mehr muss nicht gesagt werden. Ich weiß, dass die Amischen Pazifisten sind. Sie glauben, dass es eine Sünde ist, einem Menschen das Leben zu nehmen, egal unter welchen Umständen. Aber sie sind auch nur Menschen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Wille zu überleben – die Notwendigkeit, sich selbst und seine Liebsten zu beschützen – die Religion außer Kraft setzt.
»Tun Sie mir den Gefallen, und halten Sie ihn geladen griffbereit?«, frage ich.
Wieder ein kaum merkliches Nicken.
»Besitzt einer von Ihnen ein Handy?«, frage ich.
»So etwas brauchen wir nicht«, erklärt Rebecca.
»Die Telefonzelle in der Hogpath Road ist über eine Meile weit weg«, sage ich. »Wenn Joseph hier auftaucht, können Sie keine Hilfe holen.« Sie schweigen, und ich füge hinzu: »Sie müssen an die Kinder denken.« Ich greife in meine Jackentasche und hole ein billiges Handy heraus, das ich bei Walmart in Millersburg gekauft habe. »Für den Notfall«, sage ich. »Es wird sonst nicht benutzt. Meine Mobilnummer, der Notruf und die Nummer vom Sheriffbüro sind schon einprogrammiert.«
»Wir brauchen kein Telefon«, beharrt der amische Mann.
»Wenn Sie einen Moment nicht aufpassen, kann ich es aus Versehen hinten auf der Ablage liegenlassen oder in die Schublade legen. Sie können einfach vergessen, dass es da ist.«
Beide lächeln bei meinen Worten, doch sie schütteln auch den Kopf. »Gott wacht über uns«, wiederholt Rebecca. »Er wird für uns und unsere Kinder sorgen.«
Ich stehe auf, gehe zur Ablage und lege das Handy darauf. Dann reiche ich Rebecca und Daniel die Hand. »Danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.«
Auf dem Weg zum Wagen sitzt mir die Sorge um sie im Nacken wie ein juckender Ausschlag.
3. Kapitel
Ich sitze kaum hinterm Lenkrad, als in der Hosentasche mein Telefon vibriert. Beim Blick aufs Display muss ich lächeln. »Du hast also auch den Anruf bekommen?«, frage ich anstatt einer Begrüßung.
»Ich bin gerade auf dem Weg nach Mansfield«, erwidert John Tomasetti. »Wir leisten dem Sheriff in Richland County Amtshilfe bei der Suche nach King.«
Tomasetti ist Agent beim Ohio Bureau of Criminal Investigation, kurz BCI, und arbeitet in Richfield, Ohio, eine halbe Stunde nördlich von unserer Farm in Wooster. Wir haben uns vor fünf Jahren während meines ersten großen Falls – den sogenannten Schlächter-Morden – hier in Painters Mill kennengelernt. Obwohl die Ermittlungen Grauenhaftes zutage förderten, waren wir uns nähergekommen und sind seither ein Paar. Anfangs war unsere Beziehung schwierig, aber so ist das nun mal, wenn zwei beschädigte Menschen – obendrein Polizisten – während eines megastressigen Falls zueinanderfinden. Tomasetti hatte nicht lange zuvor seine Frau und zwei Kinder verloren, und meine Gemütsverfassung war nicht viel besser. Ich hatte einen persönlichen Bezug zu dem Fall – was mich um ein Haar zerstört und mich fast das Leben gekostet hätte. Doch irgendwie haben wir das alles hingekriegt.
Aber natürlich ist das Leben nie unkompliziert. Liebesbeziehungen im Dienst werden nie gern gesehen, und das Ohio Bureau of Criminal Investigation und mein kleines Polizeirevier bilden da keine Ausnahme. Wir arbeiten zwar nicht direkt zusammen, aber manchmal überschneiden sich unsere Zuständigkeitsbereiche, und dann müssen wir besonders vorsichtig sein.
»Wie ist der letzte Stand in der Sache mit King?«, frage ich und biege in die Hogpath Road ein.
Tomasetti wiederholt, was ich schon von Sheriff Rasmussen weiß. »Vor einer Stunde habe ich mit dem Wärter dort gesprochen. King war bei der Neun-Uhr-Zählung noch anwesend und muss irgendwann danach geflohen sein. Niemand weiß, wie er den Zaunalarm überwunden hat. Bei den Kontrollgängen auf dem Gelände hat keiner was gesehen. Die nächste Zählung der Insassen war erst um drei Uhr morgens, möglicherweise hat er also einen Vorsprung von sechs Stunden.«
»Gibt es Hinweise, in welche Richtung er verschwunden ist?«, frage ich.
»Laut Gefängnisdirektor hat es letzte Nacht heftig geregnet. Der Boden war aufgeweicht und matschig, in diesem Fall also günstig. Nachdem seine Flucht entdeckt wurde, hat man Spuren in Richtung Nordosten gefunden. Da ist ein Waldgebiet, wahrscheinlich hat King dort Schutz gesucht. Das Sheriffbüro von Richland County war mit Hunden dort, aber sie haben die Spur am Highway verloren.«
»Glaubst du, jemand hat ihn abgeholt?«
»Oder er hat ein Auto angehalten.«
»Wer soll denn einen Mann in Gefängniskleidung mitnehmen?«
»Ein Idiot«, murmelt er. »Oder jemand, der auf ihn gewartet hat.«
»Wenn er sich Werkzeug beschaffen konnte, war das mit den Klamotten sicher auch kein Problem. Oder jemand hat sie irgendwo für ihn deponiert.«
»Es gibt viele Möglichkeiten«, sagt er und seufzt.
»Welcher Highway ist das denn?«, frage ich.
»Im Osten ist die State Route 545 nur ein Stück vom Gefängnis entfernt und führt weiter Richtung Nordosten.«
»Also nach Cleveland«, sage ich.
»Ein guter Platz zum Untertauchen, wenn man will. Von da ist es nur ein kleiner Sprung bis zur kanadischen Grenze.«
»Tomasetti, wenn er ein Auto hat, kann er überall sein.«
»Ich an seiner Stelle würde mich erst mal so weit wie möglich vom Gefängnis entfernen und dann versuchen, an mein Ziel zu kommen.«
»Kann es sein, dass er Hilfe von drinnen hatte?«, frage ich. »Das versuchen wir gerade herauszufinden. Wir befragen alle Leute, die Kontakt mit ihm hatten, und sehen uns die Besucherliste an. King scheint ein geschickter Mann zu sein, hab ich gehört.«
»Das sind die meisten amischen Männer. Immerhin hat er es geschafft, eine Eisenplatte durchzusägen.«
»Er hat im Gefängnis in einer Werkstatt gearbeitet, die für Honda Autoteile reinigt und wieder aufbereitet. Ich weiß nicht, zu welchen Werkzeugen die Insassen Zugang haben, aber das finde ich noch heraus.«
»Dann kann es also sein, dass er dort Werkzeuge hat mitgehen lassen.«
»Oder jemand hat sie zu ihm reingeschmuggelt«, erwidert er. »Ein Besucher.«
»Oder ein Gefängniswärter.«
»Das werden wir alles überprüfen.«
Ich halte inne, um meine nächsten Worte mit Bedacht zu formulieren. »Tomasetti, ich habe Joseph King gekannt. Als wir Kinder waren, meine ich. Sie haben eine Weile auf der Nachbarfarm gewohnt.«
»Die Welt ist klein.«
»Besonders die der Amischen.«
»Hast du eine Idee, was in seinem Kopf vorgehen könnte? Wohin er will?«
»Es ist wirklich lange her. Ich hab über zwanzig Jahre nicht mehr mit ihm gesprochen.« Wir wissen beide, wie viel in so langer Zeit passieren kann – wie sehr ein Mensch sich verändern kann.
»Er war ein guter Junge«, sage ich. »Ein typisches amisches Kind, bis sein Datt bei einem Buggy-Unfall ums Leben kam. Ich glaube, da war er vierzehn oder fünfzehn.«
»Ein schwieriges Alter, um mit dem Verlust eines Elternteils klarzukommen.«
»Es hat ihn total verändert. Er geriet immer öfter in Schwierigkeiten. Kurz darauf ist seine Familie nach Geauga County gezogen, und ich hab ihn nie wiedergesehen.«
»Er soll auch Familie in Painters Mill haben.«
Ich gebe ihm eine Kurzfassung meines Gesprächs mit Rebecca und Daniel Beachy. »Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben.«
»Glaubst du ihnen?«
Ich habe selbst schon überlegt, ob sie mich vielleicht angelogen und Joseph in Wirklichkeit sogar geholfen haben. Oder ihm Unterschlupf bieten. Doch das glaube ich eigentlich nicht. »Amische sind zwar grundsätzlich nachsichtig, aber nach dem, was er getan hat … Er wird sich vermutlich denken können, dass er hier keinen einzigen Freund mehr hat.«
»Die große Frage ist aber, ob er Kontakt zu seinen Kindern sucht.«
»Ihm ist sicher klar, dass das keine gute Idee ist. Er wird von sämtlichen Polizeidienststellen im Staat gesucht.«
»Außerdem erfüllt er nicht gerade die Voraussetzungen zum ›Vater des Jahres‹.«
»Und was soll er mit fünf Kindern anfangen?«, sage ich. »Soll er sie auf die Rückbank setzen und mitnehmen? Eher unwahrscheinlich. Sie würden ihn auf der Flucht nur behindern.«
»Und die älteren Kinder wissen vielleicht genug, um ihn entweder zu hassen oder zu fürchten. Ich wette, er ist auf dem Weg nach Kanada.«
»Das wird ein interessanter Fall.«
»Es ist immer interessanter, wenn man persönlich involviert ist«, sagt er.
»Ich bin froh, dass du das so siehst.«
»Und ich wäre froh, wenn du Augen und Ohren offen hältst, solange der Kerl frei rumläuft.«
»Worauf du dich verlassen kannst.«
Zehn Minuten später betrete ich das Polizeirevier in Painters Mill. Lois sitzt mit dem Headset auf ihren malträtierten Locken vor der Telefonanlage, deren Lämpchen heftig blinken. Wie üblich, hat Mona eine Entschuldigung gefunden, um nach Ende ihrer Nachtschicht in der Telefonzentrale nicht gleich nach Hause zu gehen. Als ihre Vorgesetzte bin ich verpflichtet, ihr deswegen eine Strafpredigt zu halten. Doch heute bin ich im Stillen froh, dass sie noch da ist, denn ich habe eine Aufgabe für sie.
»Chief!« Lois unterbricht ihr Gespräch, springt auf und winkt mir mit einem Stapel rosa Telefonnachrichten in der Hand zu. »Man könnte glauben, Charles Manson wär entkommen.«
»Wahrscheinlich wird’s noch schlimmer, bevor es wieder ruhiger wird.« Als ich an ihrem Schreibtisch vorbeikomme, nehme ich ihr die Zettel aus der Hand.
»Darauf freue ich mich jetzt schon«, murmelt sie.
Mona geht neben mir her. »Die Jungs sind alle versammelt, Chief.«
Ich sehe sie von der Seite an. »Sie arbeiten ziemlich lange heute morgen.«