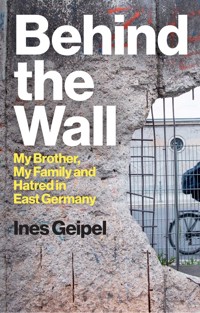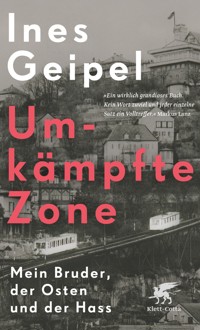22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine unverzichtbare Stimme zur Lage der Demokratie in Ost und West Der 9. November 1989. In Berlin fällt die Mauer. Es ist einer der glücklichsten Momente der deutschen Geschichte. Ines Geipel ist bereits im Sommer in den Westen geflüchtet und erlebt den Zeitriss, die Hoffnungen und Aufbrüche als Studentin in Darmstadt. 35 Jahre danach erinnert sie sich: Wie fühlte er sich an, dieser historische Moment des Glücks? Wie erzählen wir uns Ost und West und die Wiedervereinigung? Woher kommt all der Zorn, woher die Verleugnung, wenn es um den aktuellen Zustand des Landes geht? Mit großer Klarheit und Offenheit geht Ines Geipel in ihrem Buch »Fabelland« noch einmal zurück. Zurück in die politische Umbruchslandschaft nach 1989, in die eigene Familie, zurück in all die verstellten, besetzten Räume der Erinnerung, zurück zu den Verharmlosungen und Legenden, die die Gegenwart so vergiften. Ein fesselndes, nein, ein befreiendes Buch, das auf die Frage zuläuft: Können die Deutschen ihr Glück auch verspielen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Ähnliche
Ines Geipel
Fabelland
Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück
Über dieses Buch
Der 9. November 1989. In Berlin fällt die Mauer. Es ist einer der glücklichsten Momente der deutschen Geschichte. Ines Geipel ist bereits im Sommer in den Westen geflüchtet und erlebt den Zeitriss, die Hoffnungen und Aufbrüche als Studentin in Darmstadt. 35 Jahre danach erinnert sie sich: Wie fühlte er sich an, dieser historische Moment des Glücks? Wie erzählen wir uns Ost und West und die Wiedervereinigung? Woher kommt all der Zorn, woher die Verleugnung, wenn es um den aktuellen Zustand des Landes geht? Mit großer Klarheit und Offenheit geht Ines Geipel noch einmal zurück. Zurück in die politische Umbruchslandschaft nach 1989, in die eigene Familie, zurück in all die verstellten, besetzten Räume der Erinnerung, zurück zu den Verharmlosungen und Legenden, die die Gegenwart so vergiften. Ein fesselndes, nein, ein befreiendes Buch, das auf die Frage zuläuft: Können die Deutschen ihr Glück auch verspielen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ines Geipel, geboren 1960, ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. 1989 floh sie nach ihrem Germanistik-Studium von Jena aus nach Darmstadt und studierte dort Philosophie und Soziologie. Das zentrale Thema ihrer Arbeit als Autorin und Herausgeberin ist die deutsche Gewaltgeschichte sowohl des Nationalsozialismus als auch der DDR-Diktatur. 2011 erhielt Ines Geipel das Bundesverdienstkreuz am Bande, 2020 den Lessingpreis für Kritik, 2021 den Marieluise-Fleißer-Preis und 2023 den Erich-Loest-Preis, 2024 wurde sie für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. »Fabelland« ist ihr erstes Buch bei S. FISCHER.
Inhalt
Anfang ist Anfang
Dopplereffekte
Erinnerungstransfer
Salz und Tränen
Hier war ich nie
Schnittfolgen
Heimatcodes
Palmen-Deutschland
Die Vergangenheit hat Zeit
Körperpioniere
Fremdes Material
Mundsteine
Invasion von innen
Zeitspeicher
Etwas in Kaltsteppen
Glücksscham
Literaturverzeichnis
Dank
Anfang ist Anfang
Sofort, unverzüglich. Am Anfang war das Glück. Ruhig, selbstverständlich, auf seltsame Art bei sich. Etwas, von dem ich den Eindruck hatte, es war selbst ganz froh, endlich da zu sein. Das kleine Wort endlich. Still, andächtig, das nicht recht zu den späteren Euphorie-Bildern des Tages passen wollte. Es war wirklich der Anfang, denke ich. Die Abendschicht, die Gäste in der Darmstädter Weinstube, die gusseisernen Pfannen, die Schweinelenden in dicker Senfsoße, auf einmal die Hektik. Aber wieso Anfang? Am Ende meiner Ost-Zeit war das Glück. Ein Glück an und für sich. Die Lücke im Schicksal. Losgelöst von allem. Etwas Auftreibendes, das da war, um gleich wieder loszukommen. Immerhin war nicht recht klar, was in zwei Stunden sein würde. Die Rede ist vom 9. November 1989. Das ist nun 35 Jahre her. 35 Jahre.
Geht es um diesen Tag, habe ich den Film »Berlin – Die Sinfonie der Großstadt« von 1927 vor Augen. Minute 7.53: Es ist morgens um fünf Uhr. Die Stadt schläft noch. Auf einer leeren Straße rollt ein Weiß. Ein Stück Stoff, eine ausgewaschene Zeitung, eine Tüte, vielleicht eine Windel. Ich habe den Film ein paarmal gesehen, aber nie rausfinden können, worum es sich dabei handelte. Die Stadt ist völlig menschenleer, alles still, kein Wind. Der weiße Flecken trudelt den Asphalt entlang, wer weiß, von wem oder wodurch bewegt. Er bläht sich auf, überschlägt sich, bleibt liegen, nimmt erneut Fahrt auf. Was war das?
Der 9. November 1989. Über den sich was sagen lässt? War es Zufall, Intuition, ein historischer Seufzer, Müdigkeit, Schmerzmüdigkeit, der große Gegenalgorithmus? Hatte sich an dem Tag die Geschichte der Revolution ergeben, oder war es eher andersrum? Wollte sich die Revolution verbinden, einfach dazugehören, zu dem, was vorher gewesen war, sich bereits ereignet hatte, in einem Gestern, früher, vor sehr langer Zeit? Wollte sie sich schon mal anwesend machen, auf keinen Fall zu spät sein in dem, was demnächst, bald, in Kürze geschehen würde? Die weiße Geschichtstüte, die sechs Jahre vor Hitler an einem kalten, noch dunklen Morgen durch die Reichshauptstadt trudelte. Das Bild rollt in meinem Kopf. Ein harmloser, weißer Flecken. Nichtssagend, als Geschichte unerklärt, sich langsam nach vorn schiebend.
Der 9. November 1989. Dann der Ort: Internationales Pressezentrum der DDR. Dann die Zeit: 18.53 Uhr. Dann die Stimme, die wie aus dem Nichts sagte: »Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.« Dann das: »Ab sofort, unverzüglich.« Von der weißen Geschichtstüte im Berlin-Film bis zum Ort der Pressekonferenz dürften es nicht viele Schritte gewesen sein.
Der 9. November 1989. Das Wochenende stand bevor. Ich war erst Ende August nach meiner Flucht aus dem Osten in Darmstadt gelandet. Die Abendschicht in der Weinstube des Hotels Weinmichel, die um 17 Uhr begann. Sie würde lang werden. Das Reservierungsbuch war voll. Ich rauchte oben vor der Eingangstür noch eine Zigarette. Die Stämme der Platanen im Herrngarten gegenüber leuchteten mir zu. Der Herbst war erstaunlich mild. Ich lief die Treppe des Weinkellers hinunter, wischte die Tische ab, schnitt die Baguettes, verteilte sie in Brotkörbe, quatschte zwei, drei Minuten mit Ingo, dem Koch, zog auf der Toilette den Lidstrich nach, trank ein kleines Bier, zupfte die Mickerblumen aus den Tischsträußen. Um 19 Uhr lief ich die Treppe hoch, um die Weinstube zu öffnen. Es war alles vorbereitet. In Berlin fiel die Mauer.
Zeitschwebe. Dieser Donnerstag. Je weiter er der Vergangenheit angehört, umso stärker ragt er ins Jetzt. Im Grunde ist er mit jedem Jahr nähergekommen, als habe er vor, sich noch einmal zu ereignen. Will er sich an sich selbst erinnern, nicht übergangen werden? Wieso haben die Geschichte, die Welt, die Alliierten oder wer auch immer den Deutschen so viel Glück ermöglicht? Noch dazu an diesem deutschen 9. November? Sie hätten auch nein sagen, abwinken, mit dem Kopf schütteln können. Es war doch klar, dass es sich um ein großes, ja unwahrscheinliches Glück handeln würde. Eins, das es wohl nur an diesem Tag, genauer nur zu dieser Stunde geben konnte. Keinen Tag davor und auch nicht viel später.
Die flimmernden Platanenstämme im Herrngarten, ihre auf dem Boden liegenden Schalenhäute. Wie eingerollter Papyrus. Die Wärme des Novembers, die 35 Jahre. Als würde ich in einem Zeitfass hocken. Die Sache mit dem Nullpunkt. Es gibt ihn ja nie. Aber es gibt echte Anfänge. Und Darmstadt war einer. Das Gefühl, dass alles im Neuen neu war, unbeschrieben, unbesetzt. Zum ersten Mal Paris sehen, den ersten Champagner trinken, zum ersten Mal ins Theater nach Frankfurt fahren, den ersten Band René Girard in den Händen halten. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit öfter Sehnsucht nach Darmstadt habe, nach diesen vielen ersten Malen, dieser Aufgeregtheit, der Zeitschwebe. Nach dieser seltsamen Nullstadt, ihren sturzgeraden Straßen, ihrem glimmenden Nachkriegsbeton, ihren lichten, großen Himmeln. Nach meinem Anfangstaumel, meiner Naivität, meinem Staunen. Ich laufe nachts in Gedanken durch die quadratische Stadt. Die Zeit schien so gerade wie meine Wege – von der Studienzulassung in die Weinstube, von der Kunsthalle zum Phänomenologen Hermann Schmitz, der im Uni-Schloss seine Vorträge hielt. Was er sagte, war so neu für mich wie mein Anfang: dass Gefühle einem nie allein gehören. Dass sie etwas Räumliches haben. Dass es trotz allem so etwas wie einen Leib gebe. Die Sätze des hageren Mannes vorn am Pult wippten durch den Raum, während mein Kopf wie die weiße Geschichtstüte in die Kindheit zurücktrudelte, zu einem ihrer Kernbilder – der im Krieg zerbombten Dresdner Frauenkirche. Ihre verkohlten Sandsteinblöcke dösten wie ein großes Reptil mitten in der Stadt. Auf den ausgerissenen Fenstersimsen wuchs Gras. Als Kind dachte ich an Wimpern. Heute denke ich an die Wimpern der Geschichte.
Wie sehr beides zusammengehört: Dresden und Darmstadt. Es sind Spiegelszenen. Ost und West. Die Ruine und der Beton, das Zerschlissene und das Stillose, das Eingerutschte und das Versiegelte. Die hessische Stadt diente am Ende des Krieges der No. 5 Bomber Group der Royal Air Force als Probestadt für Dresden und wurde in einer Nacht de facto ausgelöscht. Frankfurt, Langen, Köln, Mannheim. Als ich dort ankam, wusste ich das nicht: wie zerstört diese Städte am Ende des Krieges waren. Die Bombenlöcher und der Nachkriegsbeton. Ich sah ihn, wenn ich durch Darmstadt lief. Und ich sah ihn nicht. Ich hatte kein Bild für das, was er verdeckte. Die Brandnächte, den großen Schatten.
Dieser eine Novemberdonnerstag und die Wochen danach. Die ersten Schritte im Neuen, die Hochstimmung, die Erwartung, das unsagbar Leichte. Ich kam gar nicht mehr runter. Das erste Kneipengeld und die Flüge nach Berlin, um die Freunde in der Stadt nun ohne Mauer wiederzutreffen. Die Berliner Unruhe und die Angst vor der Umkehr. Die Sorge, dass der Hammer noch einmal fallen, sich die Zeit zurückdrehen könnte. Dieses Novemberflattern, das vielleicht erst am 3. Oktober 1990 endete. Die Nachrichten, die sich überschlugen: Welcher Politiker wurde abgesetzt, wer war aufgeflogen, wer in Nacht und Nebel Richtung Starnberger See verschwunden? Die Szenen, von denen die Freunde berichteten: die Hektik an den Grenzübergängen, der Andrang an den Wechselstuben, die vielen Kinderwagen, an denen Bügeleisen und Bohrmaschinen baumelten. Als ob ganze Haushalte pausenlos von Ost nach West türmten. Unter dem wüsten Gerenne die Hoffnung, aus der mit jedem Schritt eine größere Unsicherheit wurde. Berlin als etwas Getriebenes. Das Rissige, Wunde, Aufgebrochene war seine Haut.
Darmstadt schien von all dem unbehelligt. Dort liefen die Dinge weiter wie bisher, dort waren die Tage auch ohne Revolution vollzählig, dort gab es den Beuys-Block im Landesmuseum, direkt gegenüber der Weinstube. Sein Fett bröselte, der Filz wirkte strapaziert, wie von den Verhältnissen überfordert. Dennoch zog es mich dahin. Als könne man bei Beuys noch mal durch die Antike laufen. Sie war fern, aber eindeutig. Sie staubte, aber sie strahlte Ruhe, irgendwie Gediegenheit aus. Dazu ihre feinen, hie und da unterbrochenen Linien, die es trotz allem schafften, die Spur zu halten. Auf einem der Schilder das Wort Essenz.
Der Dezember 1989, als ich endlich das Geld für meine ersten Westklamotten zusammenhatte. Der erste Mantel, das erste Paar Schuhe, der erste Pullover. Im Foyerspiegel des Weinmichel-Hotels sah ich aus wie eine, die endlich durchstarten würde, die richtig was vorhatte. Ich stand am Gate Nummer 18 des Frankfurter Flughafens, wie ich später an allerlei Gates stehen würde, und hatte nur einen Gedanken: Das hier war für dich nicht vorgesehen. Sydney, Cagliari, Yverdon. Das solltest du nicht sehen, dazu solltest du nicht gehören, das sollte nicht dein Leben sein. Ich hatte null Ahnung davon, was kommen würde. Ich hatte nichts. Vielleicht war das das Schönste.
Weggesacktes. Mein Interregnumsgefühl: etwas zwischen davor und danach, zwischen vorn und hinten, alt und neu, bange und euphorisch. Wenn ich von heute aus auf die Darmstadt-Zeit blicke, erscheint sie mir eigenartig separiert, wie ein Scherenschnitt in der Zeit, etwas Unanfechtbares, Herausgehobenes, eine seltsam stabile Größe. Dabei kamen mir die Wochen nach dem historischen November-Donnerstag doch eher wie Watte vor. Alles war in Frage gestellt, nichts lag mehr auf der Hand. Was also hat es auf sich mit meiner Sehnsucht nach dem alten Westen? Wieso denke ich bei Darmstadt zuerst ans Angekommensein, an etwas Gerades, Klares, an Fundament und Basis, obwohl die Welt in dem Moment komplett im Umbruch war, obwohl das Land, aus dem ich kam, gerade wegsackte wie ein Puffpilz, obwohl klar war, dass sich von nun an alles, aber auch alles verändern würde? Warum fühlt sich der Darmstädter Anfang noch heute völlig richtig an?
Mein Blickfeld des Anfangs: die Gesindestube, der Herrngarten, das Landesmuseum, das Uni-Schloss. Die Tagesgeräusche des Hotels, das Klappern der Teller, die Schritte und Stimmen, die sich im Hinterhof verfingen. Die Wörter des Anfangs: Ich hatte mit Hakki, meinem türkischen Chef der Weinstube, zu tun, mit Francesco, dem Kellner beim Italiener um die Ecke, sah am Frühstückstisch Eszter, meine ungarische Kollegin, die ihre Gesindestube neben meiner hatte, oder ging zu Said, der aus Marokko kam und im Hotel die Zimmer reinigte. Das Deutsch, das wir miteinander sprachen, nannte Hakki Bügeldeutsch. Ich habe ihn nie danach gefragt, was er damit meinte. Vielleicht dachte er an sorgsam zusammengelegte Wäschepacken, die wir uns herumreichten, an geglättete Schibboleths, die wie Spielsteine zwischen uns hin- und herwanderten, an gehütete Fundstücke. Wir redeten auf einer sehr schmalen Spur, die wir nicht verließen, da klar war, dass nichts schiefgehen durfte, dass nichts noch schwieriger werden durfte. Das hätte unsere Anspannung verraten, die unsere kleine Staatengemeinschaft zusammenhielt. Letztlich war unser Bügeldeutsch eine einfache Geometrie von Sätzen, die geschleudert, portioniert, zurechtgestutzt aus uns herausgestoßen wurde. Ich weiß gar nicht, ob man das, was wir uns mitteilten, als Gespräch bezeichnet hätte. Im Grunde sprach jeder für sich und warf höchstens hie und da seine Hackstücke aus, um die nötigen Wörterbojen zu setzen: Ich bin da. Ich kann nicht. Verstehst du? Komm schon. Lass uns einfach weitermachen. Wir redeten Bügeldeutsch, damit wir uns nicht in etwas verfangen mussten, das neben der Spur lag. Wir ahnten, dass wir es nicht hätten auflösen können.
Beim Verlassen des Hotels lief ich nach rechts, zum Langen Ludwig, dem Zentrum der Stadt. Das Fußläufige, Tuchfühlige. Es war alles anwesend, sichtbar, nah beieinander. Darmstadt – die Stadt der Wissenschaften, der Künste, der Beamten und Gerichte, der Forschung und modernen Tonmusik. Auf den ersten Blick schien es eine Stadt zu sein, die sich Zeit genommen hatte für sich. Reformschulen, feministische Buchläden, Alternativcafés, eine endlose Fahrrad-Armada. Sie wirkte parat und gut eingerichtet. Das Wort Anspruch lag über dem Beton. Der wiederum sollte leicht, pragmatisch, gewitzt daherkommen. Als habe man nicht vor, sich unnötig aufhalten zu lassen.
Und der zweite Blick? Für den würde es Zeit brauchen, spürte ich. Der lief nicht einfach so durch die Straßen oder blinkerte einem zu wie eine Leuchtreklame. Der kam verpuppter daher. Um den ausfindig zu machen, hätte ich am Ort bleiben müssen. Aber wollte ich das? Nicht mal das konnte ich sagen. Der ausgekippte Zustand, die rahmenlose Zeit. Wer ist man in diesem Nichtmehr und Nochnicht? Es müsste eine Handreichung für den Übergang geben, einen Dolmetscher, eine Orientierung, ein Skript. Wie sich durch das Gestrüpp des Anfangs schlagen? Was unbedingt liegen lassen, wo unbedingt abbiegen? Mein Interregnumsgefühl: Ich kann erstaunlich wenig darüber sagen. Wieso eigentlich nicht? Die Taumelwochen, der Watteboden, der Novemberpudding. Hinter mir das alte, weggebrochene Land, vor mir die Leere. Das Alte fragte, zottelte, lag quer. Das Neue sah aus wie etwas Planes, Unbetretenes, Unbetretbares. Ich war in einem Zustand zwischen überwach und benommen, angestrengt und todmüde. Was ich nicht vertrug, waren Ratschläge. Was ich überhaupt nicht vertrug, waren abgetragene Röcke und Blusen, die sich zusehends in meinem Zimmer stapelten. Ich wollte keine. Ich wollte kein Aschenputtel sein. War ich undankbar? Auf alle Fälle.
Zwei ostdeutsche Frauen und zwölf ostdeutsche Männer, die im September und Oktober 1989 in östlichen Grenzflüssen starben, fast alle in der Donau. Vierzehn Menschen, die nicht durch den Revolutionsstrudel kamen. Der unbedingte Wunsch, der Wille, eine andere, ein anderer zu werden, noch einmal ganz von vorn anzufangen. Wie sie ihren Rucksack gepackt und Abschied von ihrem alten Leben genommen haben. Worauf lag ihr letzter Blick? Was haben sie gedacht, mit wem zuletzt gesprochen? Sie fuhren los, in ihr neues Leben. Bis zur Donau, bis zum Cut.
Dopplereffekte
Upper West Side. Herbst 1989. Das Warten auf die Studienzulassung. Was bedeutete: von 5 bis 9 Uhr jobben auf der Post, von 11 bis 14 Uhr Crêpes drehen im Café Quartier Latin, zweimal in der Woche Arbeit in der Privatgalerie Netuschil, von 19 bis 2 Uhr Schicht in der Weinstube. Keine Ahnung, woher ich die Energie hatte. Ich hätte sie heute nicht mehr. Aber ich brauchte ein eigenes Zimmer, ich wollte raus aus dem Hotel, ich brauchte Bücher, ich brauchte Geld.
Über Mittag kam des Öfteren ein Mann ins Quartier Latin: um die 70, klein, hager, speckige Jeans, Karohemd, gelblicher, fädiger Bart, lange Haare, Pfeife im Mund. Er bestellte eine Cola und musste reden. Von seinen Erfindungen und Patenten. Er malte Maschinen auf Bierdeckel, die aussahen wie Bienenwaben. Er brachte Teile davon mit, die alle etwas mit Wiegen, Tabletten und der Darmstädter Firma Merck zu tun hatten. Ich musste mittags viele Crêpes machen, es war voll, es hatte schnell zu gehen. Der Cola-Mann saß auf seinem Hocker und bot viel Text. Ich hatte keine Zeit, ihm zuzuhören. Irgendwann legte er mir einen Umschlag auf den Tresen und sagte: »Nimm es an. Ich habe zu viel davon, zu viel Kohle, ich kann damit nichts anfangen.« Im Umschlag lagen zehn Tage New York: Flug, Hotel, Broadway, alles gebucht. Das annehmen? Nie und nimmer. Der Mann meinte, das brauche keine Begründung, es sei so. Keine Widerrede. Es ginge nur annehmen. Also annehmen? Er fuhr mich in seinem klapprigen VW-Käfer zum Flughafen. Er sah sich nicht um. Für ihn war das Ganze erledigt. Vermutlich können sich viele an etwas Unverhofftes in diesem Anfang erinnern. Der einen wurden die Zähne gratis gemacht, dem anderen wurde ein Auto geschenkt. Die Zeit war freundlich und glänzte sanftmütig vor sich hin.
April 1990. Das New York Marriott Marquis-Hotel mitten in Manhattan, 34. Stock mit Blick auf den Times Square. Ich musste unweigerlich an »Hannah und ihre Schwestern« denken, an den Film von Woody Allen, den wir noch als Studenten in der DDR gesehen hatten. Das war 1986. Die speckigen Sitze des Jenaer Palast-Kinos, der Zwanziger-Jahre-Swing, die New Yorker Straßen, die Opulenz der Gebäude, das Met, die Filmbüros und Plattenläden, die Wohnungen, das Familiäre, der Sound der Stadt. »Hannah und ihre Schwestern« war mein Bildkoffer für den Westen. Was wir zu sehen bekamen, entsprach ganz dem, was die Stadt in unserer Vorstellung ausmachte. Wir staunten, wir starrten auf die Leinwand, wir schauten uns den Streifen immer wieder an, ohne eine Sekunde daran zu zweifeln, dass das, was Woody Allen uns als New York präsentierte, die Realität sein würde. Wir fuhren in den knallgelben Taxis, liefen über die 5th Avenue, joggten durch den Central Park, feierten mit Hannah, Elliot, Holly und Lee Thanksgiving, nur um uns sagen zu können: New York gibt es. New York ist real.
Und das war gerade mal vier Jahre her? Ein frostiger Aprilabend des Jahres 1990. Ich lag in einem übergroßen Fenster eines New Yorker Hotels. Im Blickschlund der Times Square. Die Skyline der Stadt glitzerte in den Fensterfronten gegenüber, in den Straßen lag der letzte Schnee, die Leute hasteten dem Abend entgegen, die untergehende Sonne streute ihr Licht zwischen die Häuser, mein erster Amerika-Tag verglühte. Ich sah der Imagination dabei zu, wie sie in die Realität hinüberwechselte. Oder auch: Ich lief durch eine Filmkulisse, die sich anschickte, hinter dem Unwirklichen unentwegt neue Unwirklichkeiten zu entwerfen. Waren Mauerfall, Westen und Cola-Mann nicht schon heftig genug? In Jena hatte uns der Hannah-Film an die Welt angeschlossen. Jetzt war ich in ihr. Die Bilder im Kopf, die Bilder des Films, die Bilder der Realität. Was hatte es auf sich damit? Was gehörte wohin, wenn man gerade aus dem Einschluss kam? Ziehen Bilder dann einfach nur um, oder gibt es welche, die hinter ihren Oberflächen etwas versteckt halten, was man nicht ohne weiteres hin- und herschieben kann? Woran würde man die erkennen?
New York war New York und ich in einem Zustand, der schlicht zu groß für mich war. Noch in Darmstadt hatte ich mir das Hannah-Video ausgeliehen. Ich wollte eine Roadmap erstellen, um die Filmwege abzulaufen, die realen Schauplätze zu sehen, ich wollte einen Geländeabgleich welcher Art auch immer. Ich wollte dem Taubheitsgefühl des Übergangs auf die Schliche kommen, jener Zeit ohne Erinnerung. Vielleicht lag es an den Resten von Schnee, vielleicht an meinem Fremdblick, vielleicht an der Dimension der Häuserschluchten – New York war riesig, aber es war kein Labyrinth. Die Stadt wirkte wie eingehängt in ein System, das ich zwar nicht kannte, das mir aber in einem fort zuraunte: Geh los, du kannst nichts falsch machen hier, es wird schon. Ich verließ das Hotel und lief zwei Meilen am Central Park entlang zum Jackson Hole, der Burger-Legende, die auch bei Hannah auftauchte. Natürlich die Jogger, natürlich die Hunde. Mir fiel David ein, der Architekt, der im Film sagte: »Und das Auge wandert weiter, eingeschläfert durch Zufriedenheit.«
Vielleicht waren die Twin Towers oder das Empire State Building ja so etwas wie der Mont Blanc und das Matterhorn, dachte ich. Oben nah bei der Fahne stehen, um unten auf die sorgsam geordneten Bahnen zu schauen, auf eine entfernte, sehr übersichtliche Welt. Eine Frage der Relationen und der Druckverhältnisse. Die Höhe und die Ruhe im Tal, die Höhe und der sehr eigene Klang, der dadurch entstand. Man würde New York sofort an seinen Geräuschen erkennen. Oft sind es Nachgeräusche. Als müsste man erst mal drei Runden um die Ecken rennen oder eine Weile Fangen spielen, ehe die Töne zueinanderfinden. Als käme man aus dem Hohlen, aus einer Art Unterdruck. Jedenfalls war ich die ganze Zeit mit den Klängen beschäftigt, mit ihren Dopplereffekten. Mit dem Schlottern der Fahrstuhlseile, dem Trampeln der U-Bahnen, dem Gewinsel der Klimaanlagen, dem Kreischen der Schachtwände. Das viele Metall, das sich in die Schädeldecke der Stadt drückte.
In den Touristen-Shops fiel mir das Wort memory entgegen, in den Regalen stapelten sich Schneekugeln in allen Varianten und Größen. Ich kaufte eine vom Times Square. Der Schnee war pink und sah aus, als könne er klimpern. Die noble Upper West Side, das Guggenheim, die Graybar, die Columbia University, der Pageant Book and Print Shop. Der Hannah-Film warf sein Montage-Netz über mir aus. Ich lief es ab, um irgendwann festzustellen, dass ich unentwegt um den Central Park kreiselte. Er war das Zentrum, eine Idee, etwas Verborgenes, etwas Abwesendes vielleicht.
Am Klavier. Auf dem Rückflug nach Frankfurt zog der kalte Stadtsog noch immer durch mich durch. Das Metallische, Pulsierende, Hypnotische. Geräusche wie aus dem All. Aber was waren diese zehn New-York-Tage gewesen? Zum ersten Mal den Kontinent gewechselt, durch die Neue Welt gelaufen, Meryl Streep auf der Bühne gesehen, gute Drinks geschlürft, durch jede Menge Museen gelaufen, zehn Nächte lang von meinem Hotelfenster aus den Times Square im Blick gehabt, in Jazzbars rumgesessen, im Pageant Book and Print Shop die Bücher von Anne Sexton entdeckt, New-York-Stiefel gekauft. War das alles? Mein Eindruck war, dass das noch Rahmenlosere in dieser Stadt in der Lage war, dem Rahmenlosen einen Rahmen zu geben. Keine Ahnung, wie das funktionierte, aber es war so. Jedenfalls bin ich durchgekommen, New York hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Es war unwirklich, surreal, es war großartig. Hat sich etwas in mir geordnet? Zumindest war ich meinen Taumel losgeworden.
Die sonore Tonspur der Maschine über dem Atlantik, in die sich nach und nach ein paar Stimmen schoben. Es waren Hannah, Mickey, Lee, Elliott, Holly, Frederick. Stimmen aus dem Woody-Allen-Film. Eine sagte: »Die ganze Welt ist bedeutungslos.« Eine andere: »Es ist pechschwarz heute Nacht. Ich fühle mich so verloren.« Die dritte: »Wenn die aufhören zu singen, werden sie Geiseln nehmen.« Ich dachte an den Central Park, an das abwesende Zentrum. Ich dachte an Hannah, an die Ruhigste im Film, die am meisten beunruhigte. Sie war es, die das mit der Verlorenheit gesagt hatte und das mit dem Pechschwarzen. Aber was wurde hier eigentlich verhandelt? Wieso war mir das bisher nicht aufgefallen? Ich kannte den Film doch.
Die üppigen Interieurs, die prächtigen Schauplätze, das Übermaß an europäischer Kunst im Film. War von all dem so viel da, um die Ängste derer, die in dieser gebauten Welt lebten, irgendwie im Zaum zu halten? Ging es darum, etwas dermaßen anwesend zu machen, damit die flatternden Filmseelen etwas in die Hand bekamen, woran sie sich festhalten konnten? Den Hannah-Film hatte man weltweit als große Komödie beworben, als ein familiäres Verwirrspiel, als ultimative Liebeserklärung an New York. Ich flog von den Neuen Welt in die Alte zurück und dachte: Es ist anders. Die Geschichten um den Central Park sind etwas anderes. Sie handeln vom Knacks, von der Katastrophe, vom Verlorenen, vom Absturz, der Angst. Ich war in New York, um die Alte Welt wieder mit zurückzunehmen. Der Central Park war das Bild für etwas Abwesendes, die zittrige jüdische Geschichte.
Eine Ebene, die auch in Jena vollkommen unerwähnt geblieben war. Das Flugzeug war auf der Hälfte der Strecke. Es ruckte hart, ein Luftloch vielleicht. Kurz danach tauchten zwei Figuren auf, die im Film eher Statistenstatus innegehabt hatten: Vater und Mutter. Er saß am Klavier, neben der Partitur ein Weinglas, sang immer dasselbe, bekam ab und an einen Wutanfall, aber keine Geschichte ab. Sie lehnte, stand oder saß neben ihrem Mann, spielte die Rolle der unberechenbaren Narzisstin und prostete sich heftig dabei zu. Auch von ihr erfuhr man letztlich nicht viel. Die beiden wirkten wie Monumente, wie ein Bann ohne Worte. Das, was die Eltern-Szenen verband, war das Klavier. Spielte es, fand die Familie zusammen. Spielte es nicht, trat binnen Sekunden das Drama auf den Plan – die Verletzungen, die Aggressionen, der Verrat.
Es ging nicht anders, als in dieser Atlantiknacht an die beiden in Dresden zu denken. An Vater und Mutter. An den Mann am Blüthner-Klavier mit dem dunklen, runden Klang. Daran, dass er es nie geschafft hatte, seine Frau neben sich ans Klavier zu stellen. Zumindest kann ich mich an keinen Moment erinnern, in dem die beiden mal zusammen Musik gemacht hätten. Vielleicht hatte er es sich gewünscht. Und sie? Ich sehe beide ein Weihnachtsfest vorbereiten, höre ihre Stimmen in der Küche, ihre Schritte im Flur. Die Erinnerungskamera fährt über den Baum, die Kerzen, den großen Tisch. Die Atmosphäre füllt sich mit der gedimmten Patina-Farbigkeit des Ostens. Die Kamera fährt in Richtung Klavier, bleibt auf den Tasten hängen. Das Dresdner Elternbild bleibt leer.
Das Flugzeug über dem Atlantik, die Hannah-Bilder, dahinter Jena, Dresden, der Osten. Was ich vor 35 Jahren alles nicht wusste, nicht wissen konnte. Es ist einiges. Ich frage mich, wie das eigentlich mit der Neuen und der Alten Welt ist. Wer sich da auf wen zubewegt, welche Richtung beide haben und wieso man solche Begriffe benutzt, wenn ohnedies alles in einem fort in Bewegung ist. Zwei Millionen Jüdinnen und Juden, die in New York leben, deren Geschichten, Erinnerungen endlos um den Central Park kreisen. Es ist nicht genug zu sagen, dass das Bild, das dabei entsteht, nicht zu fassen ist. Es ist auch gar kein Bild. Aber was?
Ich landete in Frankfurt, das mir an diesem Morgen fremder vorkam als New York. Ich würde den Interregio nehmen. In Darmstadt würde ich nicht die Rheinstraße laufen, sondern die Mornewegstraße Richtung Zentrum. Ich würde in meiner Gesindestube als Erstes die neuen Stiefel anprobieren und für die Schneekugel vom Times Square den richtigen Platz finden. Ich würde kurz vor 17 Uhr über den Hotelhof laufen, die Tür der Weinstube aufschließen. Ingo, der Koch, würde mich mit seinem Hallo begrüßen. Ich würde ihm ein bisschen von New York erzählen.
Es muss schnell gehen jetzt, dachte ich. So bald wie möglich raus aus der Gesindestube, mit dem Studium anfangen, eine eigene Wohnung finden. Wieso dauerte das so lange? Die Behörden, die Studienzulassung. Was gab es denn zu prüfen? Die New-York-Reise hatte mich sicherer gemacht: in Darmstadt ankommen, nicht mehr in den Osten zurück. Dort waren die Freunde, aber da war kein Anfang. In Darmstadt waren keine Freunde, aber es würde schon gehen, es würde einen Weg geben, die Zulassung würde kommen, sie würde freundlich ausfallen, ich war mir sicher.
Ein paar Tage nach New York fuhr ich nach Berlin. Pia, mit der ich studiert hatte, feierte ihren 25. Geburtstag und bestand darauf, uns alle zu sehen, die komplette Seminargruppe. Wir saßen in großer Runde, wir rauchten viel, wir führten denkwürdige Gespräche. Richard erzählte von seinem Vater, einem Stasioffizier, der sich vor Jahren von der Familie verabschiedet hatte. Nun war er arbeitslos geworden und kehrte zurück. Das klang nicht gut. Auch die anderen erzählten, was sich im letzten halben Jahr in ihrer aufgebrochenen Welt ereignet hatte. Umbrüche, Ortlosigkeiten. Die Geschichten erzählten von etwas, was man nicht in den Medien las. Die Welt war offen, aber etwas schien sich nach innen zu verschieben.
Erinnerungstransfer
Beistehwörter. Die Tage, Wochen, Monate nach dem 9. November 1989. Eine Zeit, die hüpfte, quirlte, schäumte. Die den Atem nahm, verunsicherte, die Angst machte, überreizte, erschöpfte. Das Wort vielleicht und das Wort damals, das Wort opulent und das Wort einsam. Der Zeitriss und seine kollektive Biographie, ihr Haupttext. Gab es ihn? Das Beseelte, Erlöste, Glückliche. Die Enttäuschung, das Chaos, den Schock. Wie das einfangen, was nach 35 Jahren so beiläufig gemacht wirkt, so geschluckt, weggehalten, beiseitegestellt?
Herbst 1989 und die Geschichte der Träume. »Das wunderbare Jahr der Anarchie« heißt ein 2004 im Berliner Ch. Links Verlag erschienenes Buch: Im sächsischen Kurort Gohrisch erzwangen die Einwohner die Öffnung eines Bonzen-Gästeheims und stellten eine lokale Parallelregierung auf. Hunderte Menschen zogen zum Jagdsitz des einstigen Regierungschefs Willi Stoph und forderten die Abschaffung der Staatsjagd. Der kleine Ort Rüterberg im nördlichen Grenzgebiet an der Elbe erklärte sich zur freien Republik nach Schweizer Vorbild. Eine junge Frau bildete eine Untersuchungskommission, um dem Devisenmogul Alexander Schalck-Golodkowski auf die Schliche zu kommen. Im Zuchthaus Bautzen II traten die Häftlinge in den Hungerstreik und gründeten einen Gefangenenrat. In Frankfurt/Oder initiierten zwei Frauen den Widerstand gegen die Vernichtung der Stasiakten. Ein Gemüsehändler aus Erfurt setzte im Januar 1990 sein Recht auf Gewerbefreiheit durch und vollzog die Währungsunion von sich aus. Matrosen der Volksmarine unterwanderten die Befehlsgewalt und gründeten den »Ersten Matrosen- und Soldatenrat«. In Rostock ließ sich der Runde Tisch auf einen Machtkampf mit dem alten Regime ein und gewann. Oberbürgermeister und Stadtschulrat mussten zurücktreten. Naturschützern gelang es, in einem schier aussichtslosen Wettlauf mit der Zeit einmalige Landschaften und Nationalparks zu retten. Ein Berliner Lehrer gründete eine unabhängige Schule.[1]
Herbst 1989 und das Ende der Befehle. Das Ende des Wehrkunde- und Staatsbürgerunterrichts, der Fahnenappelle an den Schulen. Jungpioniere, Thälmannpioniere, FDJler gab es nicht mehr. Aber was war wirklich weg und was nur zum Schein? Der Kollaps im Äußeren und das, was sich im Inneren ereignete, in den Machtzentralen, in den Familien, im Einzelnen. Man müsste eine Stimme in einen leeren Raum setzen und sie noch einmal die andere Geschichte sprechen lassen. Nicht die öffentlichen Schlagwörter, die totgeredeten Sätze, all das Stilisierte, sondern das, was in diesen Monaten ad hoc ausbrach, das schlicht rausmusste. Das Ungefilterte, Unbearbeitete, Unverfälschte. Eine kleine Demoskopie des Freudestammelns, der Beistehwörter, des Ungläubigen, Verzweifelten. Es müsste noch einmal alles da sein dürfen. Vielleicht, dass wir was anderes bemerken würden, etwas, über das wir bislang hinweggeschaut haben.
Was für ein Glück das war, denke ich. Das Unwahrscheinliche, das dazu bestimmt war, das Unverrückbare zu sein. Aber das stimmte nicht. Millionen, die erlebten, wie das Unmögliche in die Möglichkeit kippte. Die dabei waren. Was auf einmal alles da sein durfte – leicht, selbstverständlich, wild, ungestört. Es gab kein Nein mehr. Vielleicht sind die Geschichten, die zu erzählen sind, ja eher die unplausiblen, unannehmbaren, inakzeptablen. Vielleicht sind diejenigen, die das erlebt haben, später vor allem dazu da, auf dieses Momentum zu beharren, in dem das Unmögliche ins Reale kippte. Vielleicht geht es immer noch darum, Jahr für Jahr und in aller Ruhe zu sagen: Das war’s. Mehr geht nicht. Es war das Wunder. – Der Mauerfall des Geruchs. Der Mauerfall in den Dingen, des Schmerzes in den Dingen, in den 17 Millionen Ost-Körpern. Was weiß man schon. Es ging alles so schnell. Aber hat der Westen nicht auch hinter seiner Mauer gelebt?
Eingekerbtes. 15. Juni 1990. Die Erklärung zur Regelung offener Vermögensfragen, die als zentrales Puzzlestück zu einer sich einkerbenden Meistererzählung gehören sollte. In den ersten Monaten nach dem November 1989 waren sich der Osten und der Westen durchaus freundlich begegnet, im Zauber der Erwartung und der großen Ereignisse. Aber ab Juni 1990 tauchte in den Medien das Bild des arroganten, geldgierigen Alteigentümers aus dem Westen und des naiven, übertölpelten Ostdeutschen auf. Es gab Berichte von vermeintlichen Altnazis, die in ihren dicken Schlitten aus Würzburg und Köln angerauscht kamen, um Häuser, Villen, Fabriken, Gutshöfe, um ihr Land im Osten einzusacken. Berichte von Jung-Erben, die durch Wälder stiefelten, als hätten die ihnen seit Ewigkeiten gehört. Keine Frage, Eigentum ist eine hochemotionale Angelegenheit. Viele Ostdeutsche haben unter schwierigsten Bedingungen und mit viel Zeit versucht, zu sanieren und zu erhalten. Tatsache ist: Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 sind in den neunziger Jahren mehr als zwei Millionen Restitutionsanträge gestellt worden. Das Ergebnis: 49 Prozent der Anträge wurden abgelehnt, 14 Prozent der Anträge zurückgenommen, nur 22 Prozent rückübertragen.[2] Oder auch: Die offenen Vermögensfragen sind eine verblüffende Erfolgsgeschichte der Ostdeutschen. Die Betroffenen – nicht selten ehemalige DDR-Eliten – gründeten Vereine, Bürgerinitiativen, einen Mieterbund, agierten lokal und landesweit, wurden ungemein öffentlich, wussten sich zäh durch die Instanzen zu klagen, erwiesen sich als auffällig fit im Hinblick auf die neuen Behörden sowie Gesetze und schafften es, damit ihre Vermögen zu verteidigen.[3]
Ähnliche Unstimmigkeiten fallen auf, wenn es um die Nacherzählung im Hinblick auf das DDR-Schulsystem geht. In der Umbruch-Studie ist zu lesen, dass »sich große Unterschiede zwischen den Aussagen in den Dokumenten und Texten, die 1990 entstanden, und den späteren, etwa 1995 oder 2018 formulierten Erinnerungen feststellen« lassen.[4] Gleich nach dem Mauerfall sei das Schulsystem im Osten erst einmal massiv in die Kritik geraten. Die generelle Politisierung, die Militarisierung, die ideologische Dauerbestrahlung, selbst in den Jugendorganisationen. Im Frühjahr 1990 äußerten Jugendliche im Kontext der Sächsischen Längsschnittstudie noch, dass die Polytechnische Oberschule (POS) sie zu wenig gefordert habe. Sie hätten zu wenig gelernt und seien deshalb schlecht auf die neuen Anforderungen vorbereitet.
Fast zwanzig Jahre später, im Jahr 2017, hieß es, der DDR-Unterricht sei besser strukturiert gewesen, man habe mehr Allgemeinbildung vermittelt bekommen und die soziale Selektion sei geringer ausgefallen. Was war passiert? Wie ist das zu erklären? In der Studie heißt es, dass die Diskrepanz in den Aussagen zwischen der unmittelbaren Umbruchszeit und den nachgereichten Statements überaus markant sei und ein generelles Muster aufweise: Je weiter der Befragungszeitpunkt vom eigentlichen Ereignis entfernt sei, desto diktaturfreundlicher falle die Erinnerung aus. Dies, so halten die Forscher fest, sei erklärungsbedürftig, jedoch nicht allein den Gesetzen der Erinnerung geschuldet. Der Einfluss medialer Diskurse über die Ostdeutschen sei dabei nicht zu unterschätzen.
Abartige Größen. Ein drittes, nicht weniger emotionales Thema in Sachen Erinnerungstransfer dürfte das DDR-Gesundheitssystem sein. Hatten Schulen und Universitäten den Auftrag, den Neuen Menschen zu formen, war das Gesundheitssystem die öffentliche Visitenkarte für das bessere, humanere Deutschland. Allen Ostdeutschen sollte ein einheitlicher, ergo gerechter Zugang zu gesundheitlichen Leistungen garantiert werden. Kostenlose Gesundheitsbetreuung, ambulante Versorgung in den Polikliniken, Standard-Routineuntersuchungen, verpflichtender Mutter-Kind-Schutz, diverse Impfprogramme verbuchte der Staatsmythos auf seiner Habenseite. Die Kehrseite: »Spätestens ab Mitte der 1970er Jahre wurde sichtbar, dass die DDR vor allem bei der medizinischen Ausstattung, der Arzneimittelversorgung und der Behandlung von chronisch kranken Menschen internationalen Standards nicht mehr entsprechen konnte«, schreibt die Soziologin Sabine Böttcher.[5] Darüber hinaus blieben im Gesundheitsbereich notwendige Investitionen aus, standen eine marode Bausubstanz sowie veraltetes Medizingerät beständig auf der Mängelliste, waren die Dienstzeiten vielfach überlang, flohen vor allem junge Ärztinnen und Ärzte bzw. konnten wegen Wohnungsmangel nicht eingestellt werden.[6]
Die medizinische Situation in der Endphase der DDR war schlichtweg desaströs. Ein Stasibericht von 1987 hielt »das gänzliche Fehlen von Verbrauchsmaterialien wie Spritzen, Katheter, Kanülen, Magen- und Nasensonden und Desinfektionsmitteln« fest.[7] In Neubrandenburg fehlte es an Mulltupfern und Gummihandschuhen, die nur in »abartigen Größen vorhanden« waren.[8] Die katastrophale Situation wurde allerdings öffentlich beschwiegen und konnte nur mittels Hilfen aus dem Westen aufgefangen werden. Noch 1990 wurden für diesen Bereich 500 Millionen DM in den Osten transferiert.[9] Der Unmut gegenüber den üblen Zuständen spiegelte sich auch in den ersten Transformationsberichten: »Im Mai/Juni 1990 waren 74 Prozent der Ostdeutschen der Meinung, dass die Verbesserung des Gesundheitssystems sehr dringlich und wichtiger als die Umstellung der DDR-Mark auf die D-Mark (70 %) oder die Verbesserung der Versorgungslage der Bevölkerung (66 %) sei.«[10] 24 Jahre später, im Jahr 2014, bescheinigten »66 Prozent dem Gesundheitssystem der DDR besondere Stärken«.[11] Wie ging das? Was war nach dem großen Revolutionszorn passiert?
Text-Schleusen.