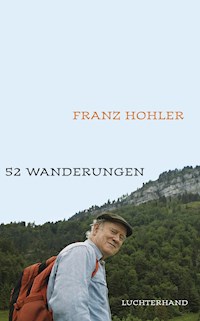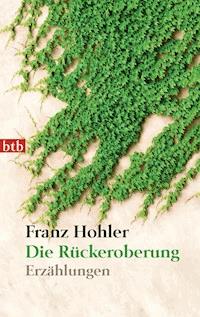9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Schreiben Franz Hohlers ist immer auch ein Reisen. Nicht selten entsteht es unterwegs, an Bahnhöfen oder Flughäfen, im Gehen oder Warten. "Fahrplanmäßiger Aufenthalt" versammelt die neueste Kurzprosa dieses großen Meisters der kleinen Form. Die Erzählungen führen in die Ferne, nach Sarajevo, Kenia, Odessa oder auf den Maidan nach Kiew. Sie führen aber auch in einen Wartesaal am Bahnhof Schwäbisch Hall oder zur Birke vor dem eigenen Haus. Brillant beiläufig und pointiert öffnen sie die Fenster in die Wirklichkeit - die fremde wie die eigene, oder gleiten unvermutet ins Fantastische. Sie erzählen davon, was sich in unserer immer kleiner werdenden Welt entdecken lässt, wenn man nur genau hinsieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Ähnliche
Über das Buch
Das Schreiben Franz Hohlers ist immer auch ein Reisen. Nicht selten entsteht es unterwegs, an Bahnhöfen oder Flughäfen, im Gehen oder Warten. »Fahrplanmäßiger Aufenthalt« versammelt die neueste Kurzprosa dieses großen Meisters der kleinen Form. Die Erzählungen führen in die Ferne, nach Sarajevo, Kenia, Odessa oder auf den Maidan nach Kiew. Sie führen aber auch in einen Wartesaal am Bahnhof Schwäbisch Hall oder zur Birke vor dem eigenen Haus. Brillant beiläufig und pointiert öffnen sie Fenster in die Wirklichkeit – die fremde wie die eigene, oder gleiten unvermutet ins Fantastische. Sie erzählen davon, was sich in unserer immer kleiner werdenden Welt entdecken lässt, wenn man nur genau hinsieht.
Über den Autor
FRANZ HOHLER wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit fünfzig Jahren im Luchterhand Verlag.
FRANZ HOHLER
Fahrplanmäßiger Aufenthalt
Luchterhand
Nach Europa
»Du musst ein Stück der Passstraße nach, und dann bei der Waldhütte rechts abbiegen«, sagt dir der bärtige Mann mit dem Hund an der Endstation des Postautos, nachdem du gefragt hast, wo es hier zum Bergsee geht. Du tust, wie er dich geheißen hat, steigst dann einen Fahrweg zu einem Maiensäss hinauf, der einmal durch einen alten Tunnel führt, nach dem Maiensäss wird der Pfad schmaler, ein Wanderweg, der über ein Band am Fuß einer schier endlosen Felswand führt, mit grandiosen Ausblicken in die Tiefe des Bergtals, aus dem du gekommen bist, oft fällt auch neben dem Pfad eine Felswand ab, und du hältst dich, mit Schwindel kämpfend, mit der linken Hand an einem fixen Seil, siehst vor dir eine Bergkette, über die langsam Gewölk aufzieht, gelangst endlich zum Ende der Felswand und steigst nun eine Schneise hoch mit uralten hohen Fichten, deren Wurzeln und Stämme mit Moos und Flechten überzogen sind, dazwischen wächst üppiges Gras, und du hörst auf einmal Glocken bimmeln, da muss also eine Alp in der Nähe sein, und einzelne Waldkühe drehen ihre Köpfe nach dir um, du blickst auf die Uhr und siehst, dass du vor kaum vier Stunden noch in der Stadt warst, im Morgengewühl eines Hauptbahnhofs, wirst dir auch bewusst, dass du seit dem bärtigen Mann mit dem Hund niemanden mehr gesehen hast, und denkst mit einem plötzlichen Glücksgefühl, das ist die Schweiz, das ist die Schweiz, steigst höher und höher, ohne die Alp zu erblicken, zu der die weidenden Kühe gehören, und stehst schließlich am einsamen Bergsee, über dem ein Nebel liegt, der das andere Ufer verhüllt, in Erwartung der Stille, die dir als Lohn für deine Wanderung zusteht, doch die wird gestört vom Knattern eines Motors und von wirren Rufen, und langsam taucht ein Schlauchboot auf, übervoll mit dunkelhäutigen Menschen, die dich ungläubig und hilfesuchend anschauen und mit den Händen fuchteln, von Strapazen gezeichnet, am Bug steht ein Mann in einem langen, weißen Gewand, wirft dir, als das Gefährt näherkommt, ein Seil zu, und du kannst nicht anders, als es mit beiden Händen zu packen, und du ziehst das schwer beladene Boot an Land, an dein Land, das mitten in Europa liegt.
Fahrplanmäßiger Aufenthalt
Ich sitze im Zug von Nürnberg nach Stuttgart. Er wird als »Regio-Express« geführt, hält aber bereits in Nürnberg Stein, dann an verschiedenen kleinen Bahnhöfen wie Dombühl, Schnelldorf, Eckartshausen–Ilshofen; und in Schwäbisch Hall–Hessental, wo er um 10 Uhr eintrifft, kündigt die Durchsage einen fahrplanmäßigen Halt bis 10.14 Uhr an. Da es im Zug weder ein Bistro-Abteil noch einen Minibarwagen gibt, steige ich aus und gehe durch die Unterführung zum Bahnhofgebäude, in der Hoffnung, dort zu einem heißen Tee zu kommen. Aber es gibt keine Bahnhofsgaststätte, nur einen leeren Wartesaal, und am Kiosk neben dem Bahnhof sind die Rollläden heruntergelassen, und wohl nicht erst seit gestern.
Eine kleine Tafel macht darauf aufmerksam, dass von diesem Bahnhof 1945 die KZ-Häftlinge von Hessental auf den Todesmarsch nach Dachau geschickt wurden; zur Gedenkstätte sei es 250 m, Pfeil nach rechts.
Von diesem Konzentrationslager habe ich noch nie etwas gehört. Die Zeit sollte reichen, denke ich, und folge dem Pfeil, und schon bald bin ich auf dem Gelände, auf dem früher Baracken standen, lese, dass hier ab 1944 etwa 800 Menschen untergebracht waren, die als Arbeitssklaven in einer nahen Flugzeugfabrik eingesetzt wurden. In einigen Rahmen sind Transparente mit Fotos von jungen Männern gespannt mit der Aufschrift: Im Lager Hessental war ich 22 Jahre alt, oder 25, oder 19. Ihre freundlichen, hoffnungsvollen Gesichter sind schwer erträglich. 182 von ihnen kamen während ihrer Gefangenschaft ums Leben, viele sind später auf dem grausamen Marsch gestorben. Jeder hat eine Stele mit seinem Namen bekommen, alle Stelen stehen in einer Gruppe beisammen, als wollten sie sich gegenseitig schützen. Wieso hat ihnen niemand geholfen? Hat ihnen niemand einen Tee gebracht? Wo hatten sich Mitleid und Menschenliebe verkrochen in dieser Zeit?
Als ich merke, dass es 10 nach 10 geworden ist, überquere ich verbotenerweise die Gleise, um auf den Bahnsteig zu gelangen, an dem mein Zug wartet, gehe mit schnellen Schritten bis zu meinem Wagen, den ich gerade noch erreiche, bevor sich der Regio-Express in Bewegung setzt und Hessental verlässt.
Rasches Altern
Ich möchte mein Konto bei einer Großbank auflösen und stelle mich in die Reihe vor dem Schalter. Als ich drankomme, gebe ich der jungen Frau mein Anliegen bekannt, das sie nickend zur Kenntnis nimmt, mit leichtem Bedauern, wie mir scheint, oder sogar mit etwas Mitleid, denn wie kann man auf ein Konto bei so einer erstklassigen Bank verzichten. Ich schiebe ihr mein Kärtchen über den Tresen, zusammen mit meiner Identitätskarte, und sie tippt meine Personalien in den Computer ein, fragt mich, ob die Adresse noch stimme, was ich bejahe, dann nimmt sie meine Identitätskarte in die Hand, schaut mich prüfend an und fragt mich, ob mein Geburtsdatum stimme.
»Sicher«, antworte ich, »warum?«
Bei ihr stehe ein anderes.
»Was für eines?«
Sie lächelt ein bisschen verlegen, blickt nochmals auf ihren Bildschirm und rückt dann mit meinem wahren Alter heraus:
»1. 1. 1901.«
Dann sei ich aber noch erstaunlich fit, sage ich, und als sie das richtige Datum eingetragen hat und ich das Formular unterschrieben habe und mit dem Restbetrag, der auf dem Konto noch vorhanden war, die Bank verlasse, sehe ich beim Aufstoßen der Glastür mein etwas verzittertes Spiegelbild und trete aufatmend hinaus, dankbar, dass ich mit meinen 116 Jahren immer noch furchtlos die Straße auf dem Fußgängerstreifen überqueren kann.
Passkontrolle
In der Schlange vor der Passkontrolle am Moskauer Flughafen stand vor mir ein Paar, eine große Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm, und ein noch größerer Mann, ein Hüne, und als wir näher zum Schalter vorrückten, küsste der Mann seine Frau auf die Stirn und das Kind ebenfalls. Dann trat sie aus der Reihe aus, der Mann ging zum Schalter und drehte sich etwas ab, und ich sah auch, warum. Er, der Hüne, fuhr sich mit der Hand immer wieder über die Augen, auch über Wangen und Mund, um sich etwas wegzuwischen, und was es wegzuwischen gab, waren seine Gefühle, und er wollte nicht, dass seine Frau sie sah, seine Frau, die angespannt wartete, ob er sich nochmals umdrehe, damit sie ihm ein letztes Mal winken könnte, aber der Hüne ging mit schwerem Schritt vom Schalter weg und verschwand in der Abflughalle, ohne ein einziges Mal zurückzublicken.
Daniil
ein Besuch
»Ulica Nekrassow«? frage ich einen großen Mann mit einer dunkelblauen Wollmütze. Er schüttelt ratlos den Kopf. Ich überquere mit meiner Frau die Majakowski-Straße, weil ich auf der andern Seite der Kreuzung ein Straßenschild sehe. Der Mann mit der blauen Wollmütze kommt zurück und sagt uns mit den Händen, Nekrassow sei weiter vorn, geradeaus.
Majakowski, Nekrassow, lauter Dichterstraßen. Da ist sie, die gesuchte, aber keine Tafel am Eckhaus, dass hier Daniil Charms gewohnt habe. Immerhin, schräg gegenüber, mit »Produkti« angeschrieben, der Lebensmittelladen, in dem er noch eingekauft haben soll.
Ich ziehe meinen Stadtplan hervor, bitte meine Frau, den Schirm zu halten, da es ununterbrochen regnet, und merke, dass ich mich getäuscht habe. Mein Kreislein liegt einen Centimeter weiter hinten, wir sind schon zu weit, kehren wieder um, und nun sehe ich das Graffitibild, das über drei Stockwerke geht und einer Skizze nachgebildet ist, die Charms von sich selbst gemacht hat. Eine Vortreppe führt zur Tür eines Restaurants, vor der eine Frau steht und raucht. »Dom Daniila Charmsa«? frage ich, stolz auf den Genitiv. Sie nickt lächelnd, tritt auch etwas zur Seite, als meine Frau von der andern Straßenseite mit ihrem Handy ein Foto von mir macht, wie ich winzig klein vor dem großen Haus mit dem Charmskopf stehe. Ich liebe seine verzweifelt absurden Kurzgeschichten, die allem zuwider liefen, was seine Zeit verlangte. Heute sind sie Kult. In St. Petersburg werden ganze Abende damit veranstaltet, aber zu Lebzeiten hat er bloß zwei Gedichte veröffentlichen können, wurde kurz vor der Belagerung der Stadt verhaftet, kam ohne Anklage ins Gefängnis und ist dort im Februar 1942, als ganz Petersburg hungerte, gestorben.
Im Gedenkpavillon bei den Massengräbern der Blockade, den wir am Tag zuvor besucht haben, hängen kleine Zettel eines Tagebuchs, das ein zwölfjähriges Mädchen führte. Sie hat jeden Tod in ihrer Familie darin aufgeschrieben. Die letzten drei Sätze heißen:
»Jetzt sind die Sawitschews tot. Alle sind tot. Übrig bleibt nur Tanja.«
Sie könnten von Charms sein.
Importzölle
In der ehemaligen Bally-Bandfabrik in Schönenwerd ist ein Museum untergebracht, in dem die Geschichte der Firma Bally dokumentiert wird und die verschiedensten Webstühle und Schuhfabrikationsmaschinen besichtigt werden können. Ich erinnere mich gut an die Gebäude, mein Großvater arbeitete dort als Webermeister und nahm mich vor etwa sechzig Jahren einmal mit. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er zwischen den ratternden Webstühlen, die er beaufsichtigen musste, hin und her geht, wie er mir erklärt, wie Zettel und Einschuss funktionieren und wie ihm die italienischen Arbeiterinnen zulächeln.
Heute werden wir bei einem Klassentreffen durch die Ausstellung geführt.
Der erste Bally, ein eingewanderter Vorarlberger, zog mit einem Kasten voller farbiger Bänder, den er sich auf den Rücken schnallte, im Auftrag des Aarauer Fabrikanten Meyer durch die Schweiz, um dessen Produkte zu verkaufen. Der Kasten mit den Bändermustern ist noch vorhanden, leicht zu tragen war er bestimmt nicht, jedenfalls beschloss der Hausierer bald, stattdessen mit einer eigenen Bandproduktion zu beginnen, war damit erfolgreich, und seine Söhne fuhren mit der fabrikmäßigen Herstellung von Bändern und später von Schuhen fort, die sie auch ins Ausland exportierten.
Als Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts hohe Importzölle für Bänder einführte, taten die Brüder Bally das, was man heute noch tut: sie verlegten einen Teil der Produktion ins Ausland. In Säckingen auf der deutschen Seite des Rheins errichteten sie eine Fabrik, in der etwa 1000 Weber und Weberinnen Arbeit fanden. Eine sehr genaue Zeichnung zeigt das ganze immense Fabrikgelände, und während der Museumsführer mit unserer Gruppe langsam weitergeht, bleibe ich vor der Zeichnung stehen.
In dieser Fabrik hat mein Großvater als junger Grenzgänger aus dem Fricktal gearbeitet, und nicht nur er, sondern auch meine Großmutter, und dort lernten sie sich kennen. Ich starre diese Abbildung an, die ich noch nie gesehen habe, und beim Gedanken, dass weder ich noch meine Söhne und unsere Enkelkinder auf dieser Welt wären, hätte Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht Importzölle auf Bänder erhoben, werde ich von einem leichten Schwindel ergriffen und muss mich einen Moment am Rahmen der Vitrine aufstützen.
»Ist dir nicht gut?« fragt mich ein Schulkamerad.
»Doch, doch«, sage ich, »sehr gut sogar«, und schließe mich der Gruppe wieder an, die gerade bei den frühesten Damenschuhen angelangt ist.