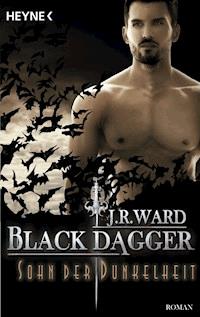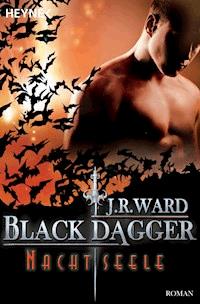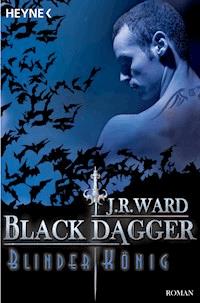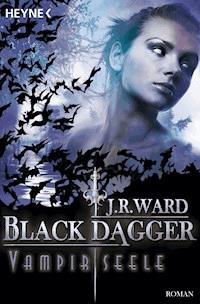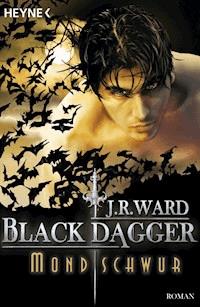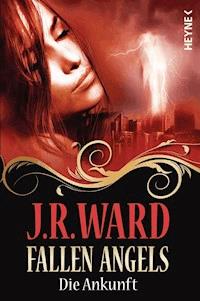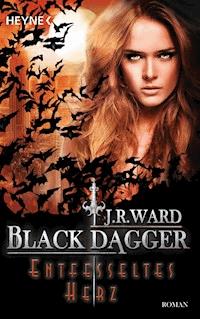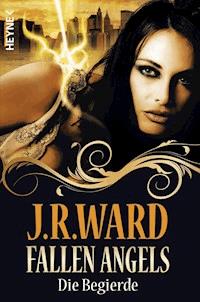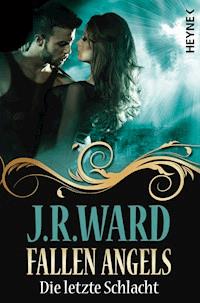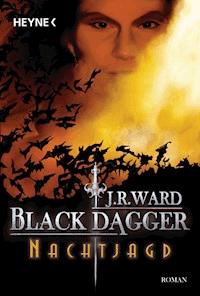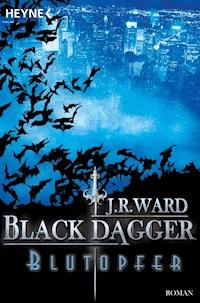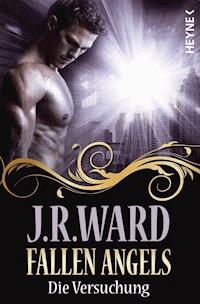
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: FALLEN ANGELS
- Sprache: Deutsch
Würdest du das Ende der Welt riskieren, um deine große Liebe zu retten?
Seit Anbeginn der Zeit herrscht Krieg zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis. Nun wurde ein gefallener Engel dafür auserwählt, den Kampf ein für alle Mal zu entscheiden. Sein Auftrag: Er soll die Seelen von sieben Menschen erlösen. Sein Problem: Ein weiblicher Dämon macht ihm dabei die Hölle heiß . . . Nach dem Bestsellererfolg BLACK DAGGER kommen J. R. Wards FALLEN ANGELS – atemberaubend düster und erotisch!
Es steht unentschieden zwischen dem gefallenen Engel Jim Heron und seiner Widersacherin, der ebenso attraktiven wie teuflischen Dämonin Devina. Bereits die nächste Seele könnte den Kampf um das Schicksal der Welt endgültig entscheiden: Cait Douglass – tough, sexy und mit gebrochenem Herzen – versucht, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und positiv in die Zukunft zu blicken. Womit sie allerdings nicht gerechnet hat, sind die beiden atemberaubend heißen Männer, die mit einem Mal in ihr Leben treten. Wem soll sie ihre Liebe schenken? Cait ist hin- und hergerissen zwischen den beiden, und sie ahnt nicht, dass ihre Entscheidung wahrlich eine über Leben und Tod ist. Einzig Jim Heron könnte Cait helfen, doch der gefallene Engel ist mehr als abgelenkt. Seine eigene große Liebe Sissy befindet sich in Devinas Klauen – im tiefsten Kreis der Hölle . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAS BUCH
Im Kampf um das Schicksal der Welt herrscht Gleichstand zwischen dem raubeinigen Engel Jim Heron und seiner Widersacherin, der ebenso schönen wie gerissenen Dämonin Devina. Und bereits die nächste Seele bringt einen von beiden dem Sieg einen entscheidenden Schritt näher.
Nach einer schmerzhaften Trennung beschließt die hübsche, junge Kunstprofessorin Cait Douglass ihr Leben radikal zu ändern: neue Frisur, neue Klamotten und am besten auch gleich ein neuer Freund. Wie es der Zufall so will, treten ausgerechnet jetzt gleich zwei unglaublich attraktive Männer in ihr Leben: der smarte Sänger G.B., der alle Frauenherzen höher schlagen lässt, und der wortkarge Duke, bei dem Cait zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt, was wahre Leidenschaft bedeutet. Einer der beiden Männer verbirgt jedoch ein dunkles Geheimnis, und Caits Entscheidung, für wen ihr Herz schlägt, ist wahrlich eine über Leben und Tod.
Der gefallene Engel Jim Heron könnte Cait den richtigen Weg weisen, doch er ist von seiner Liebe zu der bezaubernden Sissy Barten abgelenkt – so abgelenkt, dass er sogar bereit ist, für seine große Liebe das Ende der Welt zu riskieren …
DIE AUTORIN
J. R. Ward begann bereits während ihres Studiums mit dem Schreiben. Nach ihrem Hochschulabschluss veröffentlichte sie die BLACK-DAGGER-Serie, die in kürzester Zeit die Bestsellerlisten eroberte. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Golden Retriever in Kentucky und gilt seit dem überragenden Erfolg von BLACK DAGGER als neuer Star der romantischen Mystery.
J. R. WARD
FALLEN ANGELS
Die Versuchung
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Julia Walther
Titel der amerikanischen Originalausgabe
possession – a novel of the fallen angels
Deutsche Erstausgabe 06/2014
Redaktion: Julia Abrahams
Copyright © 2013 by Love Conquers All, Inc.
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Autorenfoto © by John Rott
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-12823-4
Für Dr. Morris M. Weiss,
Gentleman und wahres Universalgenie
Eins
»Okay … wo bin ich jetzt? Wo bin ich … wo …«
Cait Douglass beugte sich tief über das Lenkrad ihres kleinen Lexus Geländewagens, als würde das ihre Chancen erhöhen, den Friseursalon zu finden.
Wie bei einem Tennismatch wanderte ihr Blick zwischen der Straße vor ihr und der Reihe nobler Geschäfte linker Hand hin und her. Dann schüttelte sie den Kopf. »Die eigentliche Frage ist doch, was zum Teufel ich hier überhaupt mache.«
Inmitten dieser Luxusboutiquen fühlte sie sich vollkommen fehl am Platz. Französische Bettwäsche. Italienische Schuhe. Englische Schreibwaren. Offensichtlich war dieser Teil von Caldwell, New York, nicht nur sehr mondän, sondern es konnten sich dort auch Geschäfte der Marke Edel, Schick & Teuer halten.
Puh.
Könnte sich lohnen, das irgendwann mal genauer unter die Lupe zu nehmen – einfach nur, um zu sehen, wie die oberen Zehntausend so lebten. Aber dafür blieb heute keine Zeit. Sie war spät dran, und außerdem hatte jetzt um halb acht Uhr abends ohnehin schon alles geschlossen. Logisch. Vermutlich saßen die Reichen um diese Zeit in ihren Esszimmern zwischen allerlei Kristall und taten, was auch immer Bruce Wayne eben so tat, wenn er sein Batman-Kostüm ablegte.
Außerdem machte die Umgebung Cait irgendwie nervös. Jawohl, Lektion gelernt: Wenn sie sich das nächste Mal die Haare schneiden lassen wollte, würde sie nicht ihre Cousine, die mit einem Schönheitschirurgen verheiratet war, um einen Tipp bitten.
Cait bremste abrupt ab. »Na, wer sagt’s denn!«
Nachdem sie unerlaubterweise mitten auf der Straße gewendet hatte, stellte sie ihr Auto am Straßenrand neben einer Parkuhr ab, die nicht mit Münzen gefüttert werden wollte, und stieg aus.
»Brrr.« Fröstelnd zog sie den Mantelkragen enger zusammen. Ende April konnte es so weit im Norden immer noch so kalt werden wie an geografisch vernünftigeren Orten im Februar, und wie immer hielt sich der Winter tapfer – als wäre er ein Übernachtungsgast, der kein anderes Zuhause hat.
»Ich muss weiter in den Süden ziehen. Nach Georgia … oder Florida.« Vielleicht würde ein Ortswechsel den Höhepunkt ihres Jahres der Neuanfänge darstellen. »Oder noch besser Tahiti.«
Der Friseursalon stach als einziges immer noch geöffnetes Geschäft der Ladenzeile heraus, denn er war taghell erleuchtet – und doch schien sich niemand darin zu befinden. Als Cait durch die Glastür eintrat, wurde sie von einer Wolke süßlichen Parfüms mit leichter Chemikaliennote empfangen, und die schräge, pulsierende Musik war auch nicht wirklich ihr Ding.
Puh, nobel. Alles aus schwarzem und weißem Marmor, das gute Dutzend Frisierplätze war picobello, und die Waschbeckenreihe mit den nach hinten kippbaren Liberace-Style-Ledersesseln erinnerte an eine Lounge zum Powernappen in der Mittagspause. An den Wänden hingen überlebensgroße Porträtfotos von Models in coolen Posen, und der Fußboden glänzte wie ein Spiegel.
Auf dem Weg zum Empfangstisch gaben die Gummisohlen ihrer bequemen Treter ein lautes Quietschen von sich – als würde sich der Carrara-Marmor beschweren.
»Hallo?«
Sie rieb sich die Nase, die immer noch von der Kälte kribbelte. Konnte sie jetzt, verflixt noch mal, einfach niesen oder das Kitzeln Ruhe geben?
Jede Menge Spiegel überall steigerten Caits Unbehagen noch. Sie hatte sich nie gerne selbst betrachtet – nicht etwa, weil sie hässlich wäre oder so, sondern weil Eitelkeit dort, wo sie herkam, verpönt war.
Gott sei Dank lebten ihre Eltern im Westen der USA, wenn sie nicht gerade auf Reisen waren. So gab es keinen Grund, weshalb sie je erfahren mussten, dass ihre Tochter einen derartigen Schickimickiladen betreten hatte.
»Hallo?« Sie wagte sich ein Stück weiter vor, wobei ihr Blick auf die Arbeitsinsel in der Mitte fiel, wo offensichtlich die Haarfarben angerührt wurden. So viele Tuben mit Blond-, Brünett- und Rotschattierungen … außerdem welche, die eher an einen Malkasten erinnerten. Blaue Haare? Rosa?
Vielleicht sollte sie das Ganze doch abblasen.
Der Typ, der nun aus den hinteren Räumen auftauchte, war so schmal wie ein Schatten, und seine zahnstocherdürren Beine schienen hauptsächlich durch die wie angeschweißt sitzende Jeans aufrecht gehalten zu werden.
»Sind-e Sie-e die Cait Douglass?«, fragte er mit einem Akzent, den Cait weder einordnen noch richtig verstehen konnte.
»Äh, ja, die bin ich.«
Nun kniff er seine ungewöhnlich dunklen Augen zusammen und nahm ihre Haare ins Visier wie ein Arzt, der einen Rheumapatienten mustert – und obwohl er kaum wie ein Serienmörder aussah, weckte irgendetwas an ihm in Cait den Wunsch, auf der Stelle kehrtzumachen und aus dem Salon zu stürmen. Das Bedürfnis abzuhauen war wie ein Juckreiz, und diesmal hatte es nichts mit dem ultrachristlichen Wertesystem ihrer Familie zu tun.
»Mein e-Stuhl ist der da drüben-e«, verkündete er.
Zumindest glaubte sie, dass er das gesagt hatte – ja, tatsächlich, er zeigte auf einen der Frisierplätze.
Jetzt oder nie, dachte Cait und ließ noch einmal den Blick umherschweifen, in der Hoffnung, sich von irgendwo Mut holen zu können. Aber da war niemand sonst, und die psychedelische Elektromusik brachte ihr Gehirn ins Trudeln. Noch schlimmer, statt von den Fotos an den Wänden inspiriert zu werden, drängte sich ihr der Gedanke auf, dass die Menschen das, was auf ihren Köpfen wuchs, wirklich nicht so ernst nehmen sollten.
Halt, das war wieder die Stimme ihrer Mutter.
»Ja, vielen Dank«, sagte sie daher mit einem Nicken.
Auf sein Zeichen hin ließ sie sich in einen extrem bequemen Ledersessel sinken und wurde sogleich Richtung Spiegel herumgewirbelt. Automatisch senkte Cait den Blick. Dann zuckte sie erschrocken zusammen, als der Stylist seine überraschend starken Finger in ihrem Haar vergrub.
»Und, was denken Sie?«, fragte er. Was in etwa so klang: Ond-e, was tenken e-Sie?
Das hier ist gar keine gute Idee, tachte sie.
Cait zwang sich dazu, ihr Spiegelbild zu betrachten. Immer noch dieselben dunkelbraunen Haare. Dieselben blauen Augen. Dieselben fein geschnittenen Züge. Das Make-up auf ihrer blassen Haut war nach wie vor ungewohnt, aber wenigstens gab es ihr inzwischen nicht mehr das Gefühl, aufgebrezelt zu sein wie eine Kardashian. Auch ihr Körper war anders: Acht Monate hartes Training im Fitnessstudio hatten sich zwar nicht unbedingt auf der Waage bemerkbar gemacht, aber an ihren Kleidern spürte sie deutlich, dass sie schlanker und straffer geworden war. Mit der knallroten Handtasche auf ihrem Schoß hätte sie sich noch vor einem Jahr niemals blicken lassen.
Der Rest war natürlich immer noch grau und schwarz, denn die Klamotten hatten schon vor ihrem Jahr der Veränderungen im Kleiderschrank gehangen. Dafür gaben ihr die aufwendig lackierten Fingernägel das Gefühl … nun ja, einfach anders zu sein als früher.
»Ahlsoooo?«, hakte der Stylist nach, der inzwischen ihren Stuhl umrundet hatte und am Spiegel lehnte.
Wie er so mit verschränkten Armen und gesenktem Kinn dastand, erinnerte er sie irgendwie an jemanden, aber sie konnte nicht sagen, an wen.
Cait fuhr sich durch die Haare, wie er es zuvor getan hatte, in der Hoffnung, es würde sich dadurch eine Idee in ihrem Kopf formen. »Ich weiß auch nicht. Was meinen Sie denn?«
Als er die Lippen spitzte, stellte sie fest, dass er Lipgloss trug. »Plohnt.«
Plohnt? Was um alles in der Welt? »Meinen Sie blond?«
Als er nickte, gelang es Cait gerade noch, ihre spontane Reaktion halbwegs zu unterdrücken. Rote Accessoires waren eine Sache, Lady Gaga eine andere. Sie war bereit, mal einen Zeh ins kalte Friseursalonwasser zu tauchen, aber sie wollte ja nicht gleich darin untergehen.
»So was Extremes hatte ich eigentlich nicht im Sinn.«
Er streckte die Hand aus und wühlte wieder mit den Fingern in ihren Locken. »Nein, e-sanftes Plohnt – mit tunklen e-Akzenten.«
Tunkle e-Akzente? Wollte er seine seltsame Sprechweise auf ihre Haare übertragen?
»Ich weiß nicht mal, was das ist.«
»Vertrauen Sie e-mir.«
Cait begegnete wieder ihrem Blick im Spiegel und musste auf einmal an ihren Kleiderschrank denken, in dem alles nach Kategorien geordnet war. Sie hatte ihre Blusen, Hosen, Röcke und Kleider zudem nach Farben sortiert, aber es gab nun mal nur eine begrenzte Anzahl an Grauschattierungen.
Das Bild von einer blonden Perücke auf ihrem Kopf weckte sofort wieder den Fluchtinstinkt, aber gleichzeitig hatte sie ihr Mausbraun satt.
Man lebt nur einmal, sagte sie sich. Sie wurde nicht jünger. Und auch nicht schöner. Außerdem konnte einem niemand garantieren, dass es überhaupt ein Morgen geben würde.
»Plohnt, ja?«, flüsterte sie.
»Plohnt«, erwiderte der Stylist. »Und-e ein paar Stufen e-schneiden wir aaauch gleich. Die Umkleide ist-e da trüben.«
Cait blickte über die Schulter. Da trüben befand sich ein kleiner Flur mit vier Kabinentüren. Vermutlich war egal, welche man wählte. Wenn doch nur alle Entscheidungen so wenige Konsequenzen nach sich zögen.
»In Ordnung«, hörte sie sich selbst sagen.
Sie stand auf und eierte quietschend über den glänzenden Fußboden. Es kam ihr vor, als ginge sie über Wasser – aber nicht wie Jesus, denn das hier war kein göttliches Wunder, sondern bloß eine stinknormale Frau, die auf einem absolut festen Untergrund plötzlich ins Schwanken geriet.
Doch sie würde jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Durch die Tragödie, die erst kürzlich die Menschen von Caldwell erschüttert hatte, war Cait noch mehr aufgerüttelt worden, und sie würde keine Zeit mehr mit irgendwelchem feigen Mist vergeuden. Sie war lebendig und gesund, und das allein war bereits ein Geschenk.
Nach einem kurzen Moment des Zögerns entschied sie sich für die erste Tür auf der rechten Seite.
Wenn Duke Phillips den Gehweg entlangmarschierte, wichen ihm die anderen Passanten aus, obwohl es sich nach Einbruch der Dunkelheit hier um eines der eher zwielichtigen Viertel von Caldwell handelte. Wahrscheinlich lag es an Dukes Statur, groß und muskulös, die in beiden seiner Jobs von Vorteil war. Vielleicht war es auch sein Auftreten, denn statt den New Yorker Blickkontakt-Vermeidungs-Code zu befolgen, sah er den anderen Idioten direkt in die Augen, bereit zu allem.
Ja, fast schon auf Ärger aus.
Nur selten sah ihm jemand ebenfalls direkt in die Augen. Die meisten Typen, ob es nun Mitglieder einer Gang, Drogenhändler oder Partygänger auf dem Weg zu den Clubs waren, befolgten die Regeln, indem sie den Blick abwandten und es dabei auch beließen.
Wie schade. Er mochte Schlägereien.
Und was die Weiber betraf? Denen schenkte er keine Aufmerksamkeit. Er hatte schlichtweg keinen Bock, die unweigerlichen Anmachversuche abzuwehren; es lag nicht daran, dass sie ihm gefährlich werden konnten.
Weiß Gott, Frauen konnten ihn höchstens auf körperlicher Ebene berühren, und momentan hatte er kein Interesse an Sex.
Was er suchte, war eine lilafarbene Tür. Eine potthässliche, bescheuert angemalte lilafarbene Tür mit einem plakatgroßen Handabdruck darauf. Und wie es der Teufel so wollte, tauchte der gewünschte Eingang knapp fünfzig Meter weiter auf der rechten Seite auf. Beim Griff nach der Klinke hätte er das Ding am liebsten abgerissen, und der rote Neonumriss des Wortes Wahrsagerin entlockte ihm einen Fluch.
Er konnte selbst kaum fassen, dass er hierherkam. Schon wieder. Es passte einfach nicht zu ihm.
Als er plötzlich ein Flattern in seiner Brust spürte, fragte er sich, ob er vor lauter Wut womöglich Vorhofflimmern bekommen hatte, aber es war bloß der Vibrationsalarm seines Handys. Die Nummer auf dem Display kannte er auswendig.
»Braucht ihr mich?«, lautete seine Begrüßung, denn er hasste es, Zeit mit irgendeiner Art von »Hallo, wie geht’s, ist das Wetter in letzter Zeit nicht toll/schlecht/regnerisch/kalt« zu vergeuden.
Alex Hess’ Stimme war ziemlich tief für eine Frau, und ihre Worte so direkt wie die eines Mannes: »Ja. Kannst du für mich heute Abend eine Extraschicht übernehmen?«
Seine Chefin war vermutlich die einzige Frau, vor der Duke Respekt hatte. Andererseits war es auch nicht schwer, jemanden ernst zu nehmen, der vor den eigenen Augen einem ausgewachsenen Mann das Schienbein gebrochen hatte. Als Sicherheitschefin des Clubs Iron Mask hatte sie für Dealer auf ihrem Gelände wenig übrig, vor allem nicht für solche mit Gedächtnisverlust, die sie bereits verwarnt hatte. Bei Alex bekam man genau eine Chance. Danach war man froh, wenn der Schaden nur kosmetisch war und/oder sich mit einem Gips wieder beheben ließ.
Duke warf einen Blick auf seine alte Armbanduhr. »Ich kann in ungefähr fünfundvierzig Minuten da sein. Allerdings muss ich um zehn noch mal weg – dauert aber nur etwa eine halbe Stunde.«
»Abgemacht. Ich weiß es zu schätzen.«
»Kein Problem.« Duke legte auf und betrachtete wieder die violette Tür.
Angetrieben von einer Kraft, die er schon lange verabscheute und nie verstanden hatte, riss er das Ding mit solcher Wucht auf, dass die alten Holzbretter gegen die Wand knallten. Den Rückschlag bremste er mit der Faust ab, während sein Blick die Treppe hinaufwanderte, die sich über fünf Stockwerke im Zickzack in die Höhe schlängelte. Wie lange kam er jetzt schon hierher?
Einfach beknackt.
Und trotzdem trugen ihn seine schweren Stiefel zwei Stufen auf einmal nach oben, während seine kräftige Hand das eiserne Treppengeländer umklammerte, als wäre es eine Gurgel, und sein gesamter Körper angespannt war wie für einen Kampf.
Auf dem Schild oben stand: BITTE NEHMEN SIE PLATZ UND WARTEN SIE, BIS SIE AUFGERUFEN WERDEN. Als wäre das hier die Praxis eines Psychiaters oder so was.
Statt die Anweisung zu befolgen, tigerte Duke auf dem winzigen Treppenabsatz hin und her. Die beiden freien Stühle passten nicht zusammen und waren in knalligen Regenbogenfarben angemalt. Es roch nach den Räucherstäbchen, die drinnen abgebrannt wurden. Und der tibetische Teppich unter seinen Stiefeln war abgewetzt, was aber nicht an mangelnder Qualität lag.
Er hasste es generell zu warten. Und in dieser Situation verabscheute er es förmlich – ganz ehrlich, er hatte keine Ahnung, warum zum Teufel er immer wieder herkam. Es war, als wäre eine unsichtbare Stahlkette an seiner Brust eingehakt, die ihn immer wieder an diesen Ort zog. Dabei wusste er nur zu gut, was für eine Zeitverschwendung es war, und trotzdem kehrte er regelmäßig zurück.
»Ich habe Sie schon erwartet«, ertönte eine weibliche Stimme auf der anderen Seite der verschlossenen Tür.
Das machte sie immer so. Die Frau wusste es jedes Mal, wenn er hier auftauchte – und dabei hatte sie keine Videoüberwachung an der Decke montiert oder irgendetwas in der Art.
Andererseits waren seine Schritte vermutlich auch alles andere als leise gewesen. Dazu noch sein verärgertes Gemurmel.
Die Türklinke bestand aus einem alten Messingknauf, der von den unzähligen Händen, die ihn im Lauf der Zeit berührt hatten, glänzend poliert worden war. Während Duke nun zusah, wie das Ding sich drehte, beschlich ein seltsam unwirkliches Gefühl seinen Körper und seinen Geist. Als die Frau in den fließenden Roben sichtbar wurde, war er derjenige, der den Blick senkte, um eine Konfrontation zu vermeiden.
»Kommen Sie herein«, raunte sie.
Verdammt, wie er es hasste, ehrlich.
Als er über die Schwelle trat, fing drinnen eine Uhr an zu schlagen … achtmal. In seinen Ohren klang es wie ein Schrei.
»Sie brauchen Reinigung. Ihre Aura ist ganz schwarz.«
Duke vergrub die Hände in den Taschen seiner Jeans und ließ die Schultern kreisen. »Inwiefern ist das was Neues?«
»Ist es nicht.«
Eben. Scheiße. Wer sagte ihm, dass sie die Sache nicht schlimmer machte, statt besser, ihn verfluchte, statt ihn zu heilen.
»Setzen Sie sich.«
Er betrachtete den runden Tisch mit der Kristallkugel in der Mitte, den Tarotkarten und den weißen Kerzen. Genau wie die in weite Gewänder gekleidete Hellseherin selbst, waren auch die Wände ringsherum mit Stoffbahnen in allen erdenklichen Farben verhüllt, die sich auf dem Boden vereinigten. Es gab zwei Stühle, wovon einer groß genug war, um als Thron durchzugehen, während der andere eher prosaisch wie aus dem Büromöbelbedarf daherkam.
Am liebsten wäre Duke sofort wieder gegangen.
Stattdessen setzte er sich.
Zwei
Sechs … sieben …
Acht.
Jim Heron saß auf der Kante seines Bettes und wartete, ob die Standuhr draußen im Flur noch mehr zu sagen hatte. Als außer Stille nichts weiter an sein Ohr drang, nahm er einen Zug von seiner Zigarette. Er hasste diesen verdammten Zeitmesser – seinen Klang, das unablässige Gongen, und vor allem die Tatsache, dass er ab und zu dreizehn Schläge von sich gab.
Nicht, dass Jim abergläubisch wäre.
Überhaupt nicht.
Na gut, vielleicht ein kleines bisschen. Andererseits hatten ihn die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit in seinem Glauben erschüttert, dass es sich bei der Realität um eine einfache Dimension auf Basis dessen handelte, was man sehen, hören und anfassen konnte: Dank seines neuen Jobs als Erlöser der verdammten Welt wusste er mittlerweile, dass es den Teufel tatsächlich gab – und dass dieser Louboutins lieber mochte als Blahniks, außerdem lange Strandspaziergänge und Doggy-Style-Sex. Jim hatte auch einige Engel kennengelernt, war selbst zu einem geworden und hatte eine Version des Himmels besucht, die Downton Abbey ziemlich ähnlich sah.
Deshalb waren Uhren, die nicht aufgezogen werden mussten, an keine Ladestation angeschlossen waren und dann noch nicht mal richtig zählen konnten, überhaupt nicht lustig.
Er nahm einen weiteren Zug von seiner Zigarette, legte den Kopf in den Nacken und stieß langsam den Rauch aus. Während die Kringel emporstiegen, betrachtete Jim seine Bude. Verblasste viktorianische Tapete. Decke mit Fleck in der Ecke. Bleiglasfenster in alten Schieberahmen, die jedoch so farbverkrustet waren, dass man sie nicht mehr öffnen konnte. Ein Bett so groß wie ein Fußballplatz mit einem Kopfteil, das ihn immer an einen Horrorfilm mit Vincent Price erinnerte.
Im Haus gab es noch dreiunddreißig weitere Zimmer dieser Art.
Oder waren es vierunddreißig?
Er war auf der Suche nach einer günstigen Unterkunft gewesen, die etwas ab vom Schuss lag. Dabei hatte er nicht unbedingt einen baufälligen alten Kasten im Sinn gehabt, in dem die Elektrizität immer wieder ausfiel, es nur sporadisch fließendes Wasser gab, außerdem einen Herd, der Gas rülpste, und zugige Wände, die jede Menge kalte Luft hereinließen.
Perfekt. Wie aus Schöner Wohnen.
Die einzig positive Eigenschaft dieses herrschaftlichen Wohnsitzes war, zumindest Jims Ansicht nach, seine wenig einladende äußere Erscheinung. Die abgestorbenen Weinranken, die über die Fassade krochen, die schiefen Fensterläden und das gute Dutzend unterschiedlicher drohender Überhänge vermittelten den Eindruck, dass dort jemand wohnte, der einen bei lebendigem Leib verspeisen könnte. Außerdem bestand der Garten aus nichts als einigen Morgen Brombeerranken, Dornengestrüpp und giftigem Efeu, die es zu durchkämpfen galt.
Gegen Devinas Helfer würde das zwar nicht das Geringste bringen, aber zumindest hielt es dumme Teenager ab.
»Wo bist du …?« Jim starrte zur Zimmerdecke hinauf. »Zeig dich, du miese Schlampe.«
Seine dämonische Gegenspielerin war schließlich nicht gerade für ihre Geduld bekannt, und er wartete nun schon ziemlich lange auf eine Antwort von ihr.
Während er seine Kippe ausdrückte, erinnerte ihn die bunte Flagge gegenüber nur zu gut daran, dass sein jüngster Schachzug möglicherweise ein Reinfall gewesen war. In diesem Kampf zwischen Gut und Böse spielte er als Quarterback mit den sieben Seelen an Bord, während Devina, die Dämonenhure, und Nigel, der verklemmte Erzengel, als »Kapitäne« der Teams fungierten. Jim lag eindeutig vorne. Oder, besser gesagt, er hatte die Guten mit drei zu eins in Führung gebracht. Nun bräuchte es lediglich einen weiteren Sieg – noch eine weitere Seele, die sich am Scheideweg ihrer Existenz unter seinem sanften Einfluss für das Gute statt für das Böse entschied – dann hätte er nicht nur die Welt gerettet, sondern das Jenseits gleich noch dazu. Und, ja, der Sieg sah ziemlich genau so aus, wie man ihn sich vorstellte: Abgesehen davon, dass alle Menschen auf dem Planeten weiter in Ruhe ihrem Tagwerk nachgehen konnten, würden auch die gottesfürchtigen Moralprediger, die schon über Los gegangen waren, zweihundert Riesen eingestrichen hatten und in die Himmlische Herberge der Seelen eingezogen waren, bis in alle Ewigkeit sicher sein.
Dann dürfte zum Beispiel seine eigene Mutter, die vergewaltigt und ermordet worden war – möge sie in Frieden ruhen –, bleiben, wo sie war.
In Anbetracht all dieser Dinge sollte er eigentlich ziemlich zufrieden damit sein, wo er und sein verbliebener Kollege Adrian standen.
War er aber nicht.
Diese verfluchte Devina. Diese Dämonin besaß etwas, das er haben wollte, etwas, das in ihrem klebrigen Gefängnis der Verdammten nichts verloren hatte. Und dank seiner militärischen Ausbildung und Erfahrung hatte der Taktiker in ihm einen Plan entwickelt: Im Tausch gegen die unschuldige Seele würde er einen seiner Gewinne an die Dämonin abtreten. Ein fairer Deal – und im Rahmen der Spielregeln auch ganz legitim. Diese Siegesfahnen gehörten schließlich ihm, das hatte Nigel selbst gesagt. Und mit seinem persönlichen Eigentum konnte er machen, was er wollte.
Gäbe es sonst so was wie eBay oder Kleinanzeigen? Eben.
Er hatte damit gerechnet, dass Devina schimpfen und jammern würde, aber gleichzeitig war er sich absolut sicher gewesen, dass sie sich diese Gelegenheit letzten Endes nicht entgehen lassen würde. Ja, klar, laut Adrian war sie etwas eigen, was ihre Sachen betraf, aber das hier war schließlich Krieg. Sollte sie den Sieg davontragen, dann würde sie sowieso alles übernehmen. Das wäre dann buchstäblich die Hölle auf Erden.
Aber was war stattdessen passiert? Nachdem er ihr sein Angebot unterbreitet hatte, hatte sie ihm erklärt, sie werde darüber nachdenken. Als ginge es um ein verdammtes Paar Schuhe! Also wirklich. Was zum Teufel sollte das?
Jim stand auf und ging im Zimmer herum, wobei er die feine Staubschicht aufwirbelte, die den Dielenboden bedeckte. Als ihm das Knarren langsam auf die Nerven ging, begab er sich ins Bad draußen auf dem Gang.
Wenn das mal nicht dem Idealbild einer Horrorpension entsprach! Die Tapete mit dem Rosenmuster war so verblichen, dass nur noch ein Schatten der ursprünglichen Farbe geblieben war – was vermutlich besser war, denn von dieser ganzen östrogengetränkten Deko bekam er Ausschlag. Der verschnörkelte Spiegel über dem Waschbecken hatte einen Sprung und war voller Altersflecken, wodurch man beim Betrachten seines Spiegelbilds einen recht ordentlichen Eindruck davon bekam, wie man mit siebzig aussehen würde. Der Fußboden bestand aus einem zu vernachlässigenden Stück angeschlagenen Marmors.
Aber Jim hatte schon in weitaus schlechteren Verhältnissen geduscht.
Die klauenfüßige Badewanne hätte romantisch sein können, wenn man auf solchen Scheiß stand, was er nicht tat, und wenn sie innen vor lauter Kalkablagerungen nicht ganz gelb und außen durch die Kupferfüße grün angelaufen gewesen wäre. Und dann war da noch der Krach. Als Jim die einst vergoldeten Wasserhähne aufdrehte, entfuhr dem für das kalte Wasser ein Kreischen, als wären die Rohre gar nicht begeistert davon, eisige Flüssigkeit aus der Hauptleitung von der Straße hereinpumpen zu müssen.
Das Wasser, das schließlich aus dem verrosteten Duschkopf herabrieselte, bildete eher ein Tröpfeln als irgendeine Art von Strahl, aber während der vergangenen zwei Tage hatte es sich als ausreichend erwiesen, um sich einmal einschäumen und wieder abspülen zu können. Nachdem Jim die Hüllen hatte fallen lassen, stieg er unter das kalte Rinnsal und griff nach der Seife.
Sein Körper scherte sich nicht sonderlich um die Tatsache, dass es kein warmes Wasser gab. Während seiner Zeit bei den X-Ops hatte Jim ihn deutlich Schlimmerem ausgesetzt. Beim Einseifen fuhren seine Hände über alle möglichen Narben, von alten Stich- und Schusswunden über das Resultat von Granatsplitterhagel bis hin zu den Narben einiger Operationen, die in Kriegsgebieten vorgenommen worden waren – abgesehen von der einen, die in einem Pariser Schlafzimmer stattgefunden hatte.
»Wo bist du, Devina …?« Verdammt noch mal, die trieb ihn echt in den Wahnsinn.
Was eigentlich verrückt war. Man sollte doch meinen, dass er sich während seiner zwanzig Dienstjahre als Auftragskiller an solche Situationen gewöhnt hatte. Der Krieg besaß schließlich ebenfalls keinen festen Rhythmus. Dort gab es immer wieder lange Zeitspannen der Untätigkeit und des Wartens – unterbrochen von höchst explosiven Dramen der Marke Leben-oder-Tod sowie Haltet-zusammen-oder-geht-drauf.
Normalerweise kam er mit solchen Pausen besser klar.
Aber diese Zeiten waren offenbar vorbei.
Wobei man natürlich zugeben musste, dass hier wesentlich mehr auf dem Spiel stand, als jemals zuvor. Falls er gewann, war die Hölle nichts weiter als ein moralisches Lehrstück, für das es keine Bühne mehr gab.
Vielleicht hätte er also einfach eine weitere Runde lang die Füße still halten und einen vierten Sieg einheimsen sollen, denn dann wären die Unschuldigen sowieso frei gewesen und das Spiel wäre auf gute Weise ausgegangen.
Das Problem war nur, er wusste nicht, ob Sissy Barten das überleben würde. Die junge Frau steckte dort unten in dieser Wand fest – und falls die Hölle zerstört wurde, würde sie damit nicht auch puff! mit in die Luft gehen? Oder würde sie verschont werden, weil ihre Seele rein war?
Er wusste es nicht, und er konnte es sich nicht leisten, das Risiko einzugehen, deshalb wartete er auf Devinas Antwort.
Und fragte sich so langsam, was die Dämonin wohl ausbrütete.
Gleißendes Licht explodierte plötzlich im Badezimmer und blendete ihn so sehr, dass er die Seife fallen ließ, um sich die Augen zuzuhalten.
Er wusste, wer ihn da besuchte – noch bevor die Stimme mit dem piekfeinen englischen Akzent das kraftlose Plätschern der Dusche übertönte.
»Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?«, dröhnte der Erzengel Nigel.
Na toll. Genau das, was er jetzt brauchte.
Ein Gespräch mit dem Chef.
Adrians erster Hinweis darauf, dass in der Casa d’Angel nicht alles zum Besten stand, war das grelle Licht, das durch die Ritze zwischen Rahmen und Tür in sein Schlafzimmer drang. Es strahlte hindurch wie das Aufblitzen einer detonierenden Autobombe. Das ließ sich nur durch einen Besuch der Erzengelart erklären.
Entweder das, oder der beschissene Herd unten in der Küche war spontan explodiert.
Adrian erhob sich mühsam vom Bett, humpelte unbekleidet zur Tür und riss sie auf, um einen besseren Blick auf das Drama erhaschen zu können.
»… interessiert mich nicht – interessiert mich einen verdammten Scheiß …«
Jim kam mit einem Handtuch um die Hüften und triefend nassen Haaren aus dem Bad gestürmt. Seine Stimme war tief und unterdrückt wie das warnende Rasseln einer Klapperschlange.
Nigel zeigte sich wenig beeindruckt. Der werte Herr Chef von ganz oben folgte dem anderen Engel dicht auf den nackten Fersen, wobei der Dandy mit der britischen Näselstimme aussah, als wäre er gerade auf dem Weg in die Oper. Für die Standpauke, die er hier hielt, wirkte der Frack dann doch ein bisschen zu formell. Obwohl es immerhin schon dunkel war.
Immer dieses verdammte vornehme Getue.
Keiner von beiden schien zu bemerken, dass Ad an seinem Türpfosten lehnte und sich von der Show unterhalten ließ. Andererseits standen Zuschauer auf Jim und Nigels Prioritätenliste gerade auch ziemlich weit unten.
»… hast du geglaubt, du kannst einfach einen Sieg verschenken?«, keifte Nigel, als sie in Jims Zimmer verschwanden, wobei sein Akzent die einzelnen Silben messerscharf wetzte. »Dazu hast du nämlich kein Recht – Himmelherrgott, ist das etwa die Fahne?«
Adrian stieß einen leisen Pfiff aus. Wann hatte er das letzte Mal einen solchen Tonfall aus diesem sonst so vornehmen Mund gehört?
Als Eddie und er ein Jahrhundert oder zwei im Fegefeuer verbracht hatten.
Was für ein Spaß.
Nichtsdestotrotz schlug Jims Nadel auf dem Leck-mich-Barometer immer noch ziemlich hoch aus. »Mein Eigentum, richtig? Die Dinger gehören mir – das hast du selbst gesagt. Also kann ich …«
Das Klatschen, das durch die offene Tür zu hören war, ließ Ad zusammenzucken.
»Dieses eine Mal lasse ich dir das durchgehen«, knurrte Jim. »Beim nächsten Mal bringe ich dich um.«
»Ich bin nicht lebendig, du Idiot. Und du setzt hier alles aufs Spiel.«
»Woher willst du wissen, was ich mit der verdammten Fahne vorhabe?«
»Du gibst sie ihr. Aus irgendeinem für mich unerfindlichen Grund. Um ehrlich zu sein, begreife ich nicht, was wertvoller sein könnte als die Tatsache, dass du nur noch eine Seele vom Sieg entfernt bist.«
Adrian verlagerte das Gewicht auf sein gesundes Bein und schüttelte den Kopf. Soso. Ihm war nicht klar gewesen, dass Jim sich auf dieser Ebene in die Dinge einmischte. Aber zumindest wusste er, um wen es dabei ging.
Sissy Barten.
»Scheiße«, murmelte Ad, als die Puzzlestücke plötzlich einen Sinn ergaben. »Verdammte Scheiße.«
»Willkommen in der Realität, Nigel«, fauchte Jim. »Hier hast nämlich nicht du das Sagen.«
»Denkst du denn überhaupt nicht an deine Mutter!«
Es folgte eine kurze Stille. »Du glaubst, das ist dein Ass im Ärmel? Die Leine, die mich wieder in deinen Hof zurückzerrt?«
»Oh, verzeih, dass ich annahm, ihr ewiges Seelenheil könnte dir ein Anliegen sein.«
Während die beiden weiterstritten, sich Beleidigungen um die Ohren hauten und dabei immer wütender wurden, fing die Standuhr auf dem Treppenabsatz an zu schlagen.
Hatte die nicht gerade erst geläutet?
Eins, zwei, drei.
Das verfluchte Ding war Adrian echt nicht geheuer.
Vier, fünf, sechs.
Die beiden drüben im Nebenzimmer knurrten sich so feindselig an wie zwei sich umkreisende Wölfe. In der Zwischenzeit stand irgendwo in Caldwell eine neue Seele auf dem Spiel, und Devina wusste mit Sicherheit, um wen es sich dabei handelte.
Im Gegensatz zu Jim.
Adrian rieb sich die Augen und versuchte, wieder einen klaren Blick zu bekommen. Er hatte sich immer noch nicht ganz daran gewöhnt, nur noch die halbe Sehkraft zu haben, denn die zweidimensionale Landschaft versaute ihm die Tiefenschärfe, sein Gefühl für den Raum, in dem er sich bewegte, und die Verteilung seiner Gliedmaßen.
Sieben, acht, neun.
Diese Sache mit der Fahne war ein schlechtes Zeichen: Wenn Jim eine Siegestrophäe von der Wand nahm, ohne Nigel etwas davon zu sagen, dann konnte es dafür nur einen Grund geben: Der Kerl wollte sie gegen Sissys Seele eintauschen.
Hier war offensichtlich alles außer Kontrolle geraten. Diese ganze verdammte Geschichte war komplett aus dem Ruder gelaufen.
Zehn, elf, zwölf.
Adrian starrte die alte Uhr auf dem Treppenabsatz quer über den Flur an. »Na, komm schon, du beschissenes …«
Der dreizehnte Gongschlag fühlte sich gewaltig danach an, als hätte ihm das Teil den Stinkefinger gezeigt. Während der trauervolle Ton verklang, tobte das Streitgespräch drüben weiter, wobei Nigel und Jim inzwischen einen bühnenreifen Rhythmus gefunden hatten, bei dem keiner dem anderen mehr zuhörte.
Während sie hier ihre Energie verschwendeten, ging das Spiel weiter. Obwohl sich einige Parallelen zum Football ziehen ließen, gab es bei diesem Krieg zwischen Gut und Böse in sieben Runden keine Time-outs. Und in Anbetracht der Lage in Jims Zimmer hatte der Erlöser weder vor nachzugeben noch zur Vernunft zu kommen. Nein, er würde einfach genau das tun, was er verdammt noch mal wollte.
Seine Aufmerksamkeit war nicht auf den Krieg gerichtet. Sie war bei Sissy – und so würde es auch bleiben.
Und Nigel? Der würde Jim am liebsten ordentlich verdreschen.
Devina allerdings vollführte garantiert schon ihren ersten Zug, indem sie um die Seele kreiste, obwohl sie das eigentlich nicht durfte.
Die Lösung, die Ad sich schließlich überlegte, war radikal und hatte auch nur wenig Aussicht auf Erfolg, aber was blieb ihm anderes übrig?
Die beiden wichtigeren Spieler des Teams gingen sich gerade gegenseitig an die Gurgel, und was konnte dem Feind Besseres passieren, als dass sein Gegner nicht konzentriert bei der Sache war?
Also kehrte Ad in sein Zimmer zurück, zog sich an, setzte sich aufs Bett und umklammerte seine Knie. Mit geschlossenen Augen schickte er eine Anfrage ab, sozusagen ein paranormales Pagersignal.
Es dauerte ungefähr zwei Sekunden, bis er den gewünschten Ruf erhielt.
Was bedeutete, dass der Erzengel Colin genau wusste, weshalb Nigel zur Erde gekommen war, und davon ebenso wenig begeistert war wie Ad.
Drei
Victoria Beckham.
Mit der hatte der Stylist irgendwie Ähnlichkeit, dachte Cait plötzlich, während Pablo die Farbe aus ihren Haaren schamponierte. Und das war nicht als Beleidigung gemeint. Es lag an seinem schwarzen Haarschopf, den scharfkantigen Wangenknochen und den dünnen Beinen. Und an dieser leicht affektierten Körperhaltung mit der eingeknickten Hüfte, die er immer wieder einnahm.
»Sooo, sitzen Sie e-bitte schen auf.«
Cait folgte der Anweisung, indem sie ihren Kopf aus dem Waschbecken hob. Alle Nässe wurde sofort in einem Handtuchturban aufgefangen. Dann war sie unterwegs zum Frisierstuhl.
»Uund-e jetz werden-e Sie begaaaistert sei«, verkündete Pablo.
Vermutlich wollte er sagen, dass sie begeistert sein würde?
Das Seltsame an seinem Akzent war, dass er sich ständig veränderte, mal diese oder jene Vokale oder Konsonanten unterschiedlich verzerrt wurden. Die fehlende Beständigkeit legte nahe, dass er ihr entweder etwas vorspielte oder unter einer unregelmäßig auftretenden Sprachstörung litt.
Und was ihre Meinung anging …
Er löste das Handtuch, und die feuchten Strähnen fielen ihr auf die Schultern.
Es war unmöglich, irgendetwas Genaues zu erkennen. Klar, es gab einige hellere Stellen, aber in Anbetracht der vielen Folien, die zuvor ihren Kopf geschmückt hatten, hatte sie schon etwas mehr erwartet.
Pablo zog die oberste Schublade eines Schränkchens neben seinem Spiegel auf und nahm eine rechteckige Bürste von der Größe eines Schneidebretts heraus.
»Vir trocknen erst, un dann wir schnipp, schnipp, schnipp …«
Mannomann, seine Augen waren wirklich dunkel, während er sich an die Arbeit machte. Eher schwarz als braun.
Beim Anblick ihres Spiegelbilds krümmte sie sich wieder. Das war eine dermaßen bescheuerte Idee gewesen! Drei Farbschüsseln mit dazugehörigen Pinseln. Wer garantierte ihr, dass sie hier nicht in Rot, Weiß und Blau rauslief? Die Stunde, die es gedauert hatte, bis er diese Alufolienstreifen angemalt und dann wie Origami gegen ihre Kopfhaut gefaltet hatte, war auf jeden Fall futsch. Und was würde der ganze Spaß wohl kosten? Vierhundert Dollar?
Vielleicht war sie ihren Eltern doch ähnlicher, als ihr chronisch rebellisches Verhalten nahelegte. Denn dieser Ausflug in die Eitelkeit schien Vergeudung auf zu vielen Ebenen zu sein.
Außerdem würde sie diese Frisur ja auch irgendwie weiter pflegen müssen.
»Oh, wow«, staunte sie, als sie den Kopf drehte.
Die Partie, an der er gerade gearbeitete hatte, war … wirklich wunderschön. So getrocknet und glatt besaß ihr Haar dieselbe Farbe wie früher als Kind, nämlich hundert verschiedene Schattierungen von Blond, die sich zu dicken, glänzenden Strähnen verwoben.
»Hap ich e-Ihnen ja gesahgt«, meinte Pablo. Oder zumindest etwas in der Art.
Und je trockener ihre Haare wurden, umso schöner wurden sie. Allerdings hielt er nun eine Schere in der Hand …
»Sind Sie sicher, dass wir überhaupt schneiden müssen?«, erkundigte sie sich, während das Metall in der Deckenbeleuchtung aufblitzte.
»Oww, jah.«
Wow, sie konnte diesen Akzent wirklich nicht einordnen.
In diesem Moment legte er los: Seine Hände flogen um ihren Kopf herum, die scharfe Schere biss sich in ihre Haare, ganze Strähnen davon rieselten zu Boden wie Federn eines aufgescheuchten Vogels. Es sah aus, als würde er ihr einen Stufenschnitt verpassen und, o mein Gott, einen Pony! Sie hatte jetzt einen Pony.
Cait schloss die Augen. Die Farbe konnte sich zu Hause leicht mit etwas Garnier Nutrisse FarbSensation beheben lassen. Aber das hier? Es würde ein Jahr dauern, bis das rausgewachsen war. Das Problem war, sie saß fest – man konnte nicht mitten während einer Achterbahnfahrt aussteigen.
Was hatte sie sich da bloß angetan!
Etwas kitzelte sie auf dem Handrücken, und als sie die Augen einen Spaltbreit öffnete, sah sie, dass eine fast zehn Zentimeter lange Haarsträhne auf ihrem Handgelenk gelandet war, deren Ende sich ein klein wenig kringelte. Cait nahm sie zwischen die Finger und rieb die seidigen Haare aneinander.
Blond. Sehr blond.
Als Pablo etwas sagte, konnte sie nur nicken, denn die Gefühle, die in ihr aufwallten, lenkten sie von der Außenwelt ab. Die Züge der Verzweiflung, die dieses ganze Verwandlungstheater trug, ließen sich nicht länger ignorieren – nicht während sie dabei war, sich in Veronica Lake zu verwandeln. Nicht wenn sie so viel Geld für etwas ausgab, das rein oberflächlich war.
Unterm Strich war es nur eben leider viel einfacher, Mängel an der eigenen äußeren Erscheinung oder dem Auto oder der Wohnung zu beheben, als tief zu graben und sich die eigenen Entscheidungen, Irrtümer und Fehler genauer anzusehen.
Wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein Leben auf Nummer sicher in ein selbst erbautes Gefängnis führen konnte.
Das Musikstück endete abrupt, als hätten die Lautsprecher sich zum Feierabend ausgeschaltet, und in die Stille hinein tauschte Pablo seine Schere gegen etwas, das wie ein Lockenstab aussah, nur mit zwei erhitzten Zangenteilen.
Glätteisen nannte man das wohl. Und die Tatsache, dass Cait sich nicht wirklich sicher war, machte ihr umso mehr bewusst, wie isoliert von der Welt sie sich fühlte.
Mit rhythmischen Bewegungen zerrte Pablo diesen Stab immer und immer wieder an ihrem Haar herunter. Und während er auf diese Weise ihren ganzen Kopf bearbeitete, hatte Cait zu viel Gelegenheit zum Nachdenken, zu viel Zeit, die blonde Strähne zwischen ihren Fingern zu betrachten.
Als ihr die Tränen in die Augen stiegen, räusperte sie sich rasch. Wenigstens hatte die Polizei Sissy Bartens Leiche gefunden, denn nun konnten deren Eltern wenigstens etwas begraben.
Was für eine Verschwendung. Eine weitere Mahnung, das Leben zu genießen, solange man noch konnte – weil man nie wusste, wann die Fahrt zu Ende war.
»Un’nu sehn Sie e-sich ees mal an.«
Pablo schwenkte ihren Stuhl zum Spiegel herum, aber Cait konnte einen Moment lang die Augen nicht von ihrer Hand lösen. Dann jedoch hob sie langsam den Blick und …
»O … wow«, flüsterte sie.
Ihr Haar fiel in weichen, schimmernden Wellen herab, ganz ohne die übliche Krause, dafür mit den neuen hellen Strähnchen. Und in der Länge waren sie gar nicht so anders als vorher.
Pablos Akzent wurde irgendwie rollender, als er nun beschrieb, wo er Masse herausgenommen und ihr Haar befreit hatte, sodass es sich besser entfalten konnte. Bla, bla, bla – das waren bloß Wörter, die sie über sich hinwegspülen ließ. Stattdessen richtete sie ihre Aufmerksamkeit darauf, wie viel jünger sie aussah. Oder vielleicht war es auch … femininer? Lebendiger?
Auf jeden Fall war das ordentlicher Schmetterlingsscheiß, wie ihr Bruder es genannt hätte.
Wieder blickte sie auf die Haare zwischen ihren Fingern hinab und ließ sie schließlich zu Boden fallen. Es gab keine Rückspultaste, die man drücken konnte, keine Umkehr … immer nur vorwärts. Das war im ziemlich frühen Alter von zwölf Jahren ihre erste Lektion im Erwachsensein gewesen.
Und Sissys Tod hatte sie jüngst wieder an diese Tatsache erinnert.
»Meine Haare sind … perfekt«, hörte sie sich selbst sagen.
Wie aufs Stichwort lächelte Pablo breit.
Nachdem er den Umhang von ihren Schultern geschwungen hatte, ging sie zur Garderobe, um sich wieder komplett anzuziehen, und erlebte dabei ein zweites Wow: Ihre neue Frisur verwandelte ihre schwarze Hose und den schlichten Pullover in etwas, das aus dem Edelkaufhaus Saks stammen könnte. Sogar ihre rote Umhängetasche mauserte sich und wirkte auf einmal richtig italienisch.
Auf dem Weg zur Kasse hatte sie das Gefühl, Haare wie aus einer Fernsehwerbung zu haben, die bei jedem Schritt mitwippten, selbst bei schwacher Beleuchtung glänzten und Männer und Frauen gleichermaßen innehalten ließen.
Vorne am Tresen zückte sie ihr Scheckbuch und machte dann doch große Augen, obwohl sie ja eigentlich gewusst hatte, wie viel es kosten würde.
»Möchteen e-Sie fiehleicht gleich Ihren neehsten Termin e-ausmachen?«
Cait sah von den vielen Nullen auf, die sie gerade schrieb. Direkt hinter Pablo befand sich ein bodentiefer Spiegel, und über seine rechte Schulter hinweg erhaschte sie einen Blick auf ihren neuen Look.
Was für ein ausgezeichneter Marketingtrick, dachte sie, während sie ihr Spiegelbild anstarrte und zu nicken begann.
Fünf Minuten später verließ sie den Salon mit deutlich weniger Geld auf dem Konto und einem Erinnerungskärtchen an ihren Auffrischungstermin in sechs Wochen in der Tasche.
Als sie zu ihrem Lexus hinüberging, konnte sie immer noch kaum glauben, dass sie es durchgezogen hatte. Aber wenigstens wurde ihr das ungewohnte Gefühl von Veränderungen langsam vertraut. Verflixt, an ihr neues Auto hatte sie sich auch noch nicht gewöhnt – also, zumindest für sie war der Geländewagen »neu«. Bei CarMax hatte sie einen guten Deal für den Gebrauchten bekommen, und sie musste zugeben, dass es der beste Wagen war, den sie je gefahren hatte.
Aber ab und zu wurde ihr bei dem Gedanken immer noch ganz schwindelig.
Kaum hatte sie die Autotür geschlossen, riss sie auch schon den Rückspiegel zu sich herum und fuhr sich mit den Fingern durch die goldenen Strähnen. Ausgezeichnetes Timing, dachte sie – in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten abends noch mit jemandem traf.
Sie ließ den Motor an, bog auf die leere Straße ein und verließ diese gut betuchte Enklave über dieselbe Strecke, die sie gekommen war. Ihr »Date« war in Wahrheit ihre ehemalige Mitbewohnerin aus Collegezeiten.
Weil die Gedanken an die Vergangenheit ungefragt auftauchten, schaltete sie das Radio ein, um die Stille zu übertönen. Als sie an einer roten Ampel abbremsen musste, konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, noch einmal einen Blick in den Rückspiegel zu werfen.
»Ach, verdammt!«
Cait drehte den Kopf zur anderen Seite, obwohl das albern war. Aber wenigstens hatte sie nicht gleich beide Ohrringe verloren.
Der eine war vermutlich rausgefallen, als sie ihren Pullover mit dem engen Kragen wieder angezogen hatte. Die Verschlussstecker dieser kleinen goldenen Muscheln saßen immer etwas locker. Sobald die Ampel auf Grün schaltete, trat sie aufs Gas und befahl sich innerlich, es einfach dabei zu belassen.
Doch das funktionierte nicht lange.
Diese Ohrringe waren aus vierzehnkarätigem Gold, aber was viel wichtiger war: Sie hatte sie während eines Urlaubs auf den Bahamas direkt nach dem Collegeabschluss gekauft.
Mit einer heftigen Linksdrehung des Lenkrads wendete sie zum zweiten Mal an diesem Abend mitten auf der Straße, um sich zurückzuholen, was ihr gehörte.
Während Adrian im Himmel Gestalt annahm, summte er diesen Eric-Clapton-Song – und zwar richtig, denn es war niemand in der Nähe, den er mit seiner üblichen vorgetäuschten Unmusikalität hätte nerven können.
» … would you know my name …«
Der Rasen besaß die Farbe von frischem Frühlingsgrün, und der Himmel leuchtete so tiefblau wie das Buntglas eines Kathedralenfensters. Linker Hand erhoben sich die schützenden Mauern der Herberge der Seelen ähnlich massiv und hoch wie eine Bergkette. Die Zugbrücke war heruntergelassen und überspannte den Burggraben, dessen Wasser aus keiner offensichtlich erkennbaren Quelle gespeist wurde und im Sonnenlicht glitzerte.
Oben auf den Zinnen der Mauern flatterten behäbig zwei Siegesflaggen. Ein farbiges Banner fehlte.
Was zum Henker hatte Jim sich bloß dabei gedacht?
Adrian spazierte weiter. Zu seiner Rechten war neben einem aufgebauten Krocketspiel ein Tisch mit Damastdecke, Porzellan und Silber zum Tee gedeckt. Die vier Stühle ringsherum waren jedoch leer. Als er sich umsah, hatte er den untrüglichen Eindruck, dass er alleine war.
Aber das ergab keinen Sinn. Colin hatte ihn hierherzitiert, also musste der Erzengel auch da sein.
Der Pfiff war hoch und drang aus einiger Entfernung an sein Ohr. Adrian fuhr herum und blickte in Richtung Fluss, bevor er sich mit dem ungleichmäßigen Gang, an den er sich immer noch nicht ganz gewöhnt hatte, in Bewegung setzte. Schon komisch, ihm war noch nie aufgefallen, wie viel Gras es hier gab, aber mit seinem defekten Bein lernte er ständig aufs Neue, was Entfernungen wirklich bedeuteten.
Der Erzengel Colin war unten bei den Bäumen neben dem altmodischen englischen Feldlagerzelt, das seine Privatgemächer beherbergte. Er stand splitterfasernackt inmitten des rauschenden Baches, der sich um sein kleines Stückchen Himmelreich schlängelte und ihm bis zur Hüfte reichte.
»Bisschen langsamer unterwegs, Kumpel, was?«, meinte er, sobald Ad in Hörweite war.
Egal, sein Hinken war nicht der Grund, weshalb er gekommen war. »Wir haben ein verdammt großes Problem.«
Normalerweise lag Colin immer ein flotter Spruch auf den Lippen, doch an diesem Abend nicht. Der muskulöse, glänzende Körper des Erzengels tauchte aus den Fluten auf, und seine starken Beine trugen ihn zu der Stelle, an der er ein weißes Handtuch über einen Ast gehängt hatte.
»Wie schlimm ist es da unten?«, fragte er, während er sich einwickelte.
Ad ließ sich grunzend auf einen Stein sinken, dessen warme Oberfläche sich unter seinem schmerzenden Hintern gut anfühlte. »Du weißt also, wo Nigel steckt.«
»Klar doch.«
»Dann weißt du auch, warum ich hier keine Zeit verschwenden werde.« Ad hielt die Hände hoch, um das Oh-nein-das-könnte-ich-niemals abzuwehren. »Jim ist gerade links von der Straße auf den Grünstreifen abgebogen. Niemand da unten ist noch richtig im Rennen – außer Devina. Und weißt du was? So abgelenkt wie Jim jetzt schon ist, ist das noch nichts im Vergleich zu dem, was passieren wird, wenn die Dämonin ihm dieses Mädchen tatsächlich gibt.«
Als Antwort schüttelte Colin bloß den Kopf. Das reichte aber nicht.
Ad fluchte. »Jetzt mal im Ernst. Du musst eingreifen, bevor wir diese ganze Scheiße noch verlieren. Ich weiß schon, dass ich Nigel um nichts zu bitten brauche – er und ich sind wie Öl und Wasser, nur schlimmer.«
Colin schob sich die dunklen feuchten Haare aus dem kantigen Gesicht. »Ich hatte gehofft …«
Als er von sich aus nicht weitersprach, bohrte Ad genervt nach. »Was hattest du gehofft? Dass Jim in der Dusche ausrutscht und sich fest genug den Schädel anschlägt, um verdammt noch mal aufzuwachen? Verflucht, wenn dazu auch nur die geringste Chance bestünde, würde ich ihm selbst eins über die Rübe ziehen. Aber machen wir uns nichts vor: Der Erlöser spielt hier nicht länger mit, und ich glaube auch nicht, dass er zurückkommt – selbst wenn Nigel damit droht, ihn in Stücke zu reißen.«
Colin ballte die Hände zu Fäusten, als würde er selbst gerne ein paar Hiebe austeilen. »Jim ist der sine qua non. Wir können ihn nicht austauschen, falls es das ist, was du vorschlägst.«
»Glaubst du etwa, ich will den Job?« Ad lachte rau. »Willst du mich verarschen?«
»Warum bist du dann gekommen?«
»Ich will gewinnen. Das ist der einzige Grund, weshalb ich hier bin.«
Colin zog eine aristokratisch geschwungene Augenbraue hoch. »Du engagierst dich ja tatsächlich für diesen Krieg. Ganz schöne Kehrtwende für dich, was?«
»Wir dürfen nicht verlieren.«
»Wegen Eddie?« Als er keine Antwort bekam, runzelte der Erzengel die Stirn. »Man muss sich für die Loyalität gegenüber den Toten nicht entschuldigen, und ich werde mich sicher nicht darüber beklagen, wenn es dazu führt, dass du dich auf die Sache konzentrierst.«
»Gib mir den Namen der Seele, um die es geht. Mehr brauche ich nicht.«
Colin schien nicht überrascht, aber er war ja auch kein Idiot. Leider war er jedoch auch nicht bereit, die Regeln zu brechen. »Du weißt, dass ich das nicht kann.«
»Wir sagen einfach niemandem etwas.«
»Sei nicht albern. Und, nein, es ist nicht Nigel, um den ich mich sorge. Über den habe ich eine gewisse Macht. Es ist der Schöpfer, mein Junge.«
»Dann beweg deinen Hintern runter auf die Erde und greif selbst ein. Jim wird nichts unternehmen, und seine Besessenheit von diesem Mädchen wird uns noch alle umbringen. Wer ist so bescheuert, einen Sieg abzutreten?«
»Hast du nicht gewusst, was er mit der Flagge vorhat?«
»Natürlich nicht! Sonst hätte ich ihn davon abgehalten – Eddies Seele steht hier auf dem Spiel.«
»Ich hatte mich schon gewundert.«
Colin stützte die Hände in die Hüften und ging auf und ab, wobei seine nackten Füße im Sand des Flussufers ein Muster hinterließen.
»Sag mir, wer es ist«, drängte Ad, »und ich werde mich darum kümmern.«
»Du darfst dich da nicht einmischen, genauso wenig wie ich.«
»Na gut, dann gib mir wenigstens den Namen der Seele, und ich denke mir etwas aus, wie ich Heron auf ihre Spur bringen kann.«
Der alte Adrian hätte immer weiter in die Stille gedrängt, aber sein Vorschlag war logisch und sprach für sich. Colin war in ihrer Truppe der Rationale. Schon immer gewesen.
»Ich kann mich nicht einmischen«, murmelte er jetzt.
»Dann lass es mich tun.«
»Das geht nicht.«
Toll. »Was bleibt uns dann noch für eine Möglichkeit? Herumsitzen und zuschauen, wie Jim den Karren in die Scheiße fährt?«
Als er nichts als Schweigen erntete, fing er an, sich wirklich Sorgen zu machen. »Colin, du musst uns helfen. Ich will hier keinen auf Krieg der Sterne machen, aber du bist unsere einzige Hoffnung.«
»Krieg der Sterne?«
»Vergiss es. Aber … tu verflucht noch mal was. Bitte.«
Der Erzengel war lange sehr still. »Ich kann dich nicht bis ganz ans Ziel führen.«
»Musst du auch nicht. Weis mir einfach die Richtung – mehr brauch ich nicht. Aber eines sage ich dir: Wenn ihr Jungs hier oben euch weiterhin nicht die Hände schmutzig machen wollt, dann werden wir verlieren. Darauf verwette ich den Rest, der von meinen Eiern noch übrig geblieben ist.«
Vier
Alex Hess’ Büro im Iron Mask war genau wie die Frau selbst: auf das Zweckmäßigste reduziert, mit einer Menge harter Ecken und Kanten. Während Duke auf eine Antwort auf sein Klopfen wartete, zog er seine Jeans hoch.
Die Tür öffnete sich nach innen, und der Typ auf der anderen Seite war der Einzige, für den Duke je einen Schritt zurücktreten würde. Alex’ Ehemann war so groß wie ein Basketballspieler mit der Statur eines Boxers; er strahlte die Art von körperlichem Selbstvertrauen aus, wie sie nur ausgebildete Killer besaßen.
Mortal Kombat war für ihn nicht bloß ein Computerspiel, der Kampf auf Leben und Tod war für ihn Routine.
Als sie aneinander vorbeigingen, nickte Duke ihm zu, was John Matthew erwiderte – und das war’s auch schon. Niemand hatte den Hurensohn je ein Wort sagen hören, aber wer so gebaut war, musste vermutlich auch nicht reden.
»Tut mir leid, dass ich dich belästige«, meinte Duke, während Alex auf dem Stuhl hinter ihrem Schreibtisch Platz nahm. Ihr Blick war noch auf den entschwindenden Göttergatten gerichtet, und zwar auf einer Höhe, die nahelegte, dass sie seinen Hintern begutachtete. »Wo genau brauchst du mich? Ich kann Big Rob nirgends finden.«
»Vorne am Eingang.«
Dafür wurde er meistens eingeteilt, weiß Gott warum. Schließlich war er eher Stacheldraht als rote Empfangskordel.
»Irgendwelche besonderen Anweisungen?«
Nun sah sie ihn mit ihren dunkelgrauen Augen an. »Nein. Sei einfach du selbst.«
Was für ein Glück. Das war das Einzige, was er draufhatte.
Draußen auf dem Flur ging er durch die Nur-für-Personal-Tür, die in den eigentlichen Club führte. Das Gothic-Klientel ödete ihn an. Er hatte längst das Interesse an Frauen verloren, die auf Teufel komm raus wollten, dass sich Männer für sie interessierten: Nach zu vielen Push-up-BHs, Bustiers und hautengen Lederhosen bildeten die Zu-allem-Bereiten nur noch eine einheitliche Masse, die nach ›verzweifelt‹ und ›leicht-zu-haben‹ stank.
Aber sie mochten ihn. Ihre Blicke verfolgten ihn, so wie der von Alex ihrem Mann gefolgt war. Das war wohl das ewige Mysterium der Geschlechter: Mädels, die nach Aufmerksamkeit gierten, verzehrten sich nach Männern, die ihnen keine Beachtung schenkten. Der Vorteil an der Sache war vermutlich, dass es an Freiwilligen nie mangelte, wenn ihm doch mal der Sinn nach Sex stand.
Draußen bezog er neben einem Kerl namens Ivan Stellung, der gebaut war wie ein Geländewagen. Ihnen gegenüber hatte sich schon eine veritable Schlange von Gästen gebildet. Die Regel war, dass sie immer zu zweit sein mussten – weil man nie wusste, was passieren konnte. Und prompt:
»… meine Schwester gevögelt! Doch, das hast du! Du hast meine Schwester geknallt, du Schwanzlutscher!«
Genau.
»Ich kümmer mich drum.« Duke verließ seinen Platz und marschierte an den zappeligen, stampfenden, angetrunkenen, noch nicht zugedröhnten, durchgefrorenen Leuten vorbei.
»… sie nicht gevögelt! Sie hat mir einen geblasen …«
Krach!
Offensichtlich hatte der Bruder für den schmalen Grat zwischen Fellatio und Koitus nichts übrig.
Das war wohl das Stichwort, um in Hysterie zu verfallen. Die Dame, um die es hier ging, eine niedliche kleine Schönheit, die aussah wie Marilyn Manson, mit Pantomimen-Make-up und einer Garderobe wie von der netten Stripperin von nebenan, warf sich zwischen die Männer.
»Danny, hör zu! Ich …«
Bevor Duke sie erreichte, hatten sich die beiden Kerle schon am Wickel. Die Schwester wurde dabei nach hinten und auf die Straße geschubst; in ihren hochhackigen Stiefeln schlitterte sie über den Gehweg, stolperte über den Bordstein, keinen Halt findend …
Duke beachtete sie nicht weiter. Eines von zwei Dingen würde passieren: Entweder würde sie auf ihrem Arsch landen und sich den Rock zerreißen, oder ein Auto würde sie niedermähen. In beiden Fällen geschah es nicht auf dem Clubgelände und fiel deshalb auch nicht in sein Aufgabengebiet.
Was ihn jedoch sehr wohl etwas anging war die Tatsache, dass ihr Partner oder Fickfreund, oder was auch immer er für sie darstellte, mächtig auf Vergeltung aus war. Also hatte man jetzt zwei Kerle in Springerstiefeln von New Rocks, die sich gegenseitig herumschubsten, und zwar in einem Porzellanladen aus anderen Leuten, die sich hier ihre Ladung Drogen, Alkohol oder Sex abholen wollten.
Und deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach zurückschlagen würden.
Da Menschen einzeln schon ziemlich dumm waren, sich aber in einer Gruppe so richtig bescheuert verhalten konnten, musste er eingreifen. Also warf er sich zwischen die beiden Kerle und nahm sie links und rechts in den Schwitzkasten.
Bevor er zu seiner Rede ansetzen konnte, dass sie sich gefälligst zusammenreißen sollten, beschlossen die vier Typen hinter ihnen, sich in den Kampf einzumischen.
Ringsherum hagelte es nun Faustschläge, wovon einer ihn am Kopf traf.
Jetzt wurde nicht mehr geredet.
Duke übernahm die Kontrolle, er war Herr der Situation. Er packte Leute am Schlafittchen oder warf sie mit roher Gewalt zu Boden, rammte anderen den Ellbogen in die Brust und knockte jeden aus, der versuchte, ihn aufzuhalten. Die ganze Zeit, während Hände nach ihm griffen, er sich unter Hieben hinwegduckte und einem Messer auswich, blieb er absolut ruhig, ja geradezu unbeteiligt.
Es war ihm ehrlich egal, ob man ihn wegen Körperverletzung verhaften würde, ob er erstochen oder erschossen wurde. Und es kümmerte ihn auch einen Scheißdreck, ob er den Leuten, die er bearbeitete, bleibenden Schaden zufügte – ebenso wie es ihm egal gewesen war, ob diese Tussi als Kühlertrophäe endete oder nicht.
»Nee, lass ihn ruhig«, hörte er Big Rob über den Krach hinweg sagen. »Er braucht die Bewegung.«
Das Geräusch flatternder Klamotten und die gegrunzten Flüche der Menge, die er unter Kontrolle brachte, durchschnitten die Nachtluft, während die Leute versuchten, die Schlange rings um das Spektakel herum neu zu bilden, und überall Handys gezückt wurden. Zum Glück war der Vordereingang des Clubs nicht sonderlich hell erleuchtet, und das hier würde sowieso bald erledigt sein.
Was es dann auch war.
Unter denen, die im Iron Mask abhängen wollten, befanden sich eher wenige Martial-Arts-Kämpfer, daher besaßen die Männer, die sich hatten prügeln wollen, nicht gerade viel Durchhaltevermögen. Ein Faustschlag genügte normalerweise, um ihnen die Birne auszuknipsen – was eigentlich schade war. Duke genoss es, Hiebe auszuteilen, zu spüren, wie seine Fingerknöchel auf Fleisch trafen, zuzusehen, wie einer nach dem anderen zu Boden ging oder über die eigenen Füße stolperte.
ENDE DER LESEPROBE