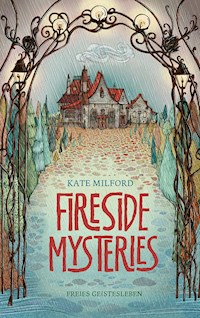
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mysteriöse Geschichten aus der Welt von Greenglass House Seit einer Woche regnet es sintflutartig, das Wasser des Flusses steigt unaufhörlich, überschwemmt Straßen und Wege, und die zwölf Gäste der Taverne »Zur blauen Ader« sitzen wie in einer Falle fest - unter ihnen ein Kapitän, zwei tätowierte Zwillingsbrüder, eine Musikerin, ein alter Kartenspieler, ein allein reisendes junges Mädchen … Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sich die Anwesenden Geschichten: mysteriöse Begebenheiten, sagenhafte, gespenstische oder skurrile Phänomene. Und was sie wiedergeben, scheint mehr von ihren verborgenen Verbindungen oder Vorhaben zu verraten, als sie zu enthüllen beabsichtigen. Wie hängen die Personen und ihre Geheimnisse mit ihren rätselhaften Geschichten zusammen? Als der Regen mit seinen unheimlichen Wassermassen immer weiter steigt, wird klar, dass die ganze Stadt in Gefahr ist - und nicht allein durch die Flut. Doch die Gäste haben nur ihre Erzählungen und sind aufeinander angewiesen. Wird das reichen, um gerettet zu werden? Gefährliche Geheimnisse, übernatürliche Verbindungen und die Kraft der Erzählungen treiben das fesselnde und rätselhafte Geschehen dieses fantastischen Romans voran. Nichts ist bloß so, wie es scheint, und jede Geschichte enthüllt mehr als nur das vordergründig Erzählte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
EINS DIE TAVERNE «ZUR BLAUEN ADER»
ZWEI DAS HAUS DER 1000 WEGEDie Geschichte des Folkloristen
DREI DIE FEDER AUS WALKNOCHENDie Geschichte des ersten Zwillings
VIER TEUFEL UND LUMPENSAMMLERDie Geschichte des zweiten Zwillings
FÜNF DIE KÖNIGIN DES NEBELSDie Geschichte der Sammlerin
SECHS DER WANDERER IN DEN NESSELNDie Geschichte der alten Dame
SIEBEN DER HOHLWARENMANNDie Geschichte des Schnitzers
ACHT DER KALTE WEGDie Geschichte des Narbenmannes
NEUN DIE TAVERNE BEI NACHT
ZEHN DIE BLAUE STUFE
ELF DIE STURMFLASCHEDie Geschichte des Kapitäns
ZWÖLF DER FÄHRMANNDie Geschichte des Glücksspielers
DREIZEHN DIE KALKULATIONDie Geschichte der Flammenhüterin
VIERZEHN DIE MILCHSUPPEDie Geschichte des Gastwirts
FÜNFZEHN DIE DREI KÖNIGEDie Geschichte der Tänzerin
SECHZEHN DIE METEORITENGÄRTNERINDie Geschichte des Handlungsreisenden
SIEBZEHN DIE ANRUFUNG DES KNOCHENSDie Geschichte des Waisenmädchens
ACHTZEHN DIE KREUZUNGDie Geschichte der Headcutterin
Für Lynne,
die jede Geschichte zum Strahlen bringt,
und für Tess, Griffin und Nathan,
denn jede Geschichte ist für euch.
DIE TAVERNE «ZUR BLAUEN ADER»
Seit einer Woche regnete es ununterbrochen, und die Straßen zur Taverne waren zu knöcheltiefen Bächen aus Morast geworden. Das behauptete zumindest Kapitän Frost, der gerade zur Tür hereingestapft kam, über und über mit dem für diesen Stadtteil so typischen gelben Schlamm bespritzt, und lautstark nach seinem Frühstück verlangte. Die anderen Gäste seufzten. Heute vielleicht, hatten sie gehofft. Vielleicht würde heute ihre Gefangenschaft enden. Aber der polternde Mann, der Eier und Toast bestellte, hatte ihnen gerade verkündet, dass der Regen und der Skidwrack und die neu entstandenen Flüsse, die einmal Straßen gewesen waren, die fünfzehn Insassen noch mindestens einen weiteren Tag festsetzen würden.
Sie verbrachten diesen Tag so wie den davor und die anderen Tage davor, bis schließlich der Gastwirt, Mr. Haypotten, das Abendessen ankündigte. Er entschuldigte sich für die Art der Mahlzeit und für die flackernde Beleuchtung, aber in einem recht sorglosen Ton. Mochten auch die Vorräte knapp werden, die Haypottens führten die Herberge und die Taverne am Ufer des Skidwracks seit einem Vierteljahrhundert und hatten schon so manche Flut erlebt. Sie waren gegen die Launen des Flusses gut gerüstet. Auch wenn das elektrische Licht flimmerte und das Heizungssystem nie richtig funktionierte, das die Vorbesitzer von einem fahrenden Kaufmann erworben hatten, als Mr. Haypotten noch in kurzen Hosen herumsprang, so erloschen doch die Feuerstellen des Gasthauses niemals, und die Räume wurden nie besonders kalt. «Sehen Sie das da?», fragte Mr. Haypotten gelegentlich und öffnete dann ein Fenster der Gaststube, sodass Kälte und Feuchtigkeit eindrangen, und deutete hinaus auf die Veranda, die sich um die halbe Taverne zog. Dort in der Treppe, die zum Fluss hinunterführte, befand sich eine blaue Stufe. «Bis dahin stieg der Fluss im Jahr ’fünfzehn. Näher heran wagt er sich nicht. Weiter als bis zu einer blauen Stufe wird das Wasser nicht kommen. Stimmt’s, Kapitän?»
«Stimmt, Marcus», nickte Kapitän Frost jetzt – wie jeden Tag –, denn Mr. Haypotten versorgte den Kapitän stets mit einem exzellenten Sherry. Aber als der Wirt den Gastraum verließ, um seiner Frau und der Küchenmagd bei der Zubereitung der Mahlzeit zur Hand zu gehen, schlug er einen anderen Ton an. Tiefe Falten hatten sich in die Haut rings um die Augen des Kapitäns gegraben, sein Gesicht war mahagonifarben gebräunt, und Haare wie Bart hatten nach Jahrzehnten auf dem Meer eine gelbliche Färbung angenommen, die an alte Knochen erinnerte. Er betrachtete sich – nicht zu Unrecht – als Experten in der Kunst der Wettervorhersage, und als Mr. Haypotten hinter der Küchentür verschwunden war, erklärte er leise, dass er in all seinen Jahren auf See noch nie so etwas Kindisches gehört habe. Wenn sich das Wasser im Zaum halten ließe, bloß weil etwas blau angemalt war, wieso hätten dann nicht alle Schiffe im Hafen einen himmelblauen Anstrich? Dann trank er seinen exzellenten Sherry aus, zog den Mantel an und stapfte durch die Diele zur Tür hinaus, um ein weiteres Mal nach dem Wetter und den Straßen zu sehen, wie bei jeder Umdrehung der leicht gesprungenen Halbstunden-Sanduhr, nach der er seine Zeit so minutiös einteilte, als wäre er noch an Bord eines Schiffs. Saß er am Tisch im Speiseraum, stand die Sanduhr stets neben seinem Arm, obwohl man deswegen Mühe hatte, bei den Mahlzeiten die Teller und Platten anständig abzustellen.
In der Schankstube waren jetzt nur noch vier Gäste. Jessamy Butcher, die neben dem Fenster gesessen hatte, wo sie sehen konnte, wie nah das Wasser schon an die viel diskutierte blaue Stufe gekommen war, stand auf, ging hinter die Bar und holte den Sherry des Kapitäns hervor. Sie goss sich ein Glas ein und hielt dann die Flasche mit ihrer dünnen, behandschuhten Hand fragend in die Höhe, ob sonst noch jemand einen Schluck haben wollte.
Der tätowierte junge Mann namens Negret lehnte ab und widmete sich wieder den Seiten, die er aus den Taschen seiner Tweedjacke gezogen hatte und nun ordentlich auf dem Tresen aufstapelte: eine bunte Sammlung von Flaschenetiketten, Zeitungsausschnitten, Tapetenschnipseln, Überbleibseln von streichholzähnlichen, zu langen Spänen gedrehten Papieren, die in jedem Raum in Vasen standen, damit das Zimmermädchen Lampen und Kaminfeuer in der Taverne entzünden konnte, und andere merkwürdige Reste. Als er sie so hergerichtet hatte, wie er sie haben wollte, holte er eine scharfe Ahle mit einem runden Griff aus einer Werkzeugrolle, die auf dem Tresen vor ihm lag, und drückte die Papiere mit einer Handfläche platt, während er entlang einer Seite des Stapels mit der Ahle Löcher in die Papiere bohrte.
Sein Bruder Reever jedoch nickte zustimmend zu Jessamys Angebot und bedankte sich murmelnd, als sie ihm ein Glas über den Tresen hinweg reichte. Jessamy überlegte zum wiederholten Male, ob die beiden KolophonBrüder mit ihrer blassen Haut und den backsteinroten Haaren unter ihrer Gesichtsdekoration wohl identisch aussahen oder nicht. Doch das war schwer zu sagen. Die Tätowierungen waren sehr ähnlich, aber nicht ganz gleich. Außerdem trug Negret seine Haare lang und in weichen Wellen, während die von Reever kurz geschoren und voller Wirbel waren. Überdies wollte sie nicht unhöflich erscheinen, indem sie die beiden zu lange anstarrte.
Jessamy wandte sich der vierten Person im Gastraum zu. «Mr. Tesserian?»
Auf der anderen Seite des Zimmers schaute Al Tesserian von dem halb fertigen Bauwerk aus Spielkarten auf, das sich vor ihm auf dem Tisch befand. «Ja, bei Gott, mit Vergnügen! Nein, meine Liebe, bemühen Sie sich nicht», setzte er hinzu, als Jessamy Anstalten machte, zu ihm zu kommen. «Bin … gleich … da.» Er legte eine Karte auf sein kunstvoll errichtetes Haus und erhob sich. Die anderen drei hielten unwillkürlich den Atem an, aber Tesserians Kartenhäuser fielen erst dann in sich zusammen, wenn er es ihnen erlaubte. Dazu rief er gewöhnlich Maisie zu Hilfe, die Jüngste der Gäste, der diese besondere Ehre zuteilwurde. Dann – und nur dann –, wenn Maisie eine Königin herausgezogen oder auf ein Ass gepustet hatte, stürzten sie auf spektakuläre Weise ein, wobei die Spielkarten in alle Richtungen davonstoben, als ob die Gesetze der Physik im Reich der Karten keine Macht besäßen.
Tesserian nahm sein Glas mit einer leichten Verbeugung entgegen und kehrte dann zu seinem Bauwerk zurück. Auf dem Weg dorthin blieb er stehen und sah Negret bei der Arbeit zu. «Binden Sie ein Buch?»
Negret nickte, während er den Papierstapel hochhob und die Kante, die er durchbohrt hatte, ins Licht hielt, um sich zu vergewissern, dass die Löcher in einer Linie waren.
«Das braucht noch einen Einband», bemerkte Tesserian. Er tastete in seinem Ärmel nach etwas, runzelte die Stirn und nahm dann den zerbeulten Hut mit der schmalen Krempe ab, den er außer zu den Mahlzeiten stets trug. Aus dem Innenfutter zog er zwei Asse und warf sie auf den Tresen. «Wie wäre es damit?»
Negret fügte die beiden Karten zu seinem Stapel hinzu, eine oben, eine unten. «Wunderbar. Wenn Sie die Karten entbehren können …»
Tesserian lachte. «Ein alter Kartenspieler hat immer irgendwo ein paar Asse stecken.»
***
In einem anderen Winkel des Gasthofs borgte sich währenddessen Petra, die von allen Gästen am längsten hier war, von dem Zimmermädchen einen Schlüssel aus und öffnete damit eine der zahlreichen Vitrinen, die überall entlang der Wände und in den Ecken der Räume standen. Sie holte eine von Mrs. Haypottens Spieldosen heraus und zog sie sehr vorsichtig auf, sodass sie und Maisie ein bisschen tanzen konnten.
Maisie Cerrajero war noch sehr jung. Sie reiste allein zu ihrer Tante, bei der sie wohnen sollte, und sie hatte nichts weiter dabei als einen alten Stoffbeutel, eine Art Sack mit einem flachen Boden, in dem sich alles befand, was sie besaß. Jeden Tag machte irgendjemand eine Bemerkung wie: «Wenn dein Tantchen kommt, wird sie bestimmt erleichtert sein, dass es dir gut geht, nicht wahr?» Meistens war dieser Jemand Mrs. Haypotten, die regelmäßig ihre Brille oder ihren Schlüsselbund oder ihre beste kleine Nähschere verlegte, und nie wusste sie so recht, was sie sagen sollte – außer «Dankeschön» –, wenn Maisie fast zwangsläufig das Gesuchte für sie fand, mochte es auch an den unwahrscheinlichsten Orten vergessen worden sein. Vor lauter Verblüffung fiel Mrs. Haypotten nichts anderes ein, als etwa zu betonen: «Wenn sie kommt, wird sich dein Tantchen bestimmt freuen, wenn sie sieht, was für ein nettes, höfliches und hilfsbereites Mädchen du bist, nicht wahr?»
Petra dagegen sagte nichts dergleichen, nicht einmal in dem Moment, als Maisie die Haarspange in Form einer Libelle aufspürte, die Petra vor zwei Tagen nach dem Frühstück abhandengekommen war. Sie hatte unter dem Saum eines Vorhangs im Esszimmer gelegen. Stattdessen holte Petra einen Schlüssel und eine Spieldose, denn die unausgesprochene Wahrheit war, dass Tantchen in Anbetracht des sintflutartigen Regens und des steilen Berghangs womöglich niemals kommen würde, wenn sie sich zum falschen Zeitpunkt auf den Weg gemacht hatte. Und Maisie war ja auch kein Dummkopf, sondern nur ein schutzbedürftiges Mädchen. Aber wenn dieses Mädchen tanzte, wenn ihr kurzes, glattes dunkles Haar flog und der Faltenrock ihres Trägerkleids um ihre Knie wehte, wich die Angst aus ihren Augen. Und Mrs. Haypotten verfügte über eine höchst beeindruckende Sammlung an Spieldosen – einundvierzig, wenn Petra und Maisie richtig gezählt hatten –, und alle spielten unterschiedliche Lieder. Jedenfalls hatten sie bislang noch keine zwei Spieldosen mit derselben Melodie entdeckt.
Heute steckte die Libelle wieder an ihrem üblichen Platz in Petras dunklen, kurz geschnittenen Locken, und die beiden entschieden sich für eine Spieldose aus der hohen Vitrine im Wohnzimmer, das genau wie der Gastraum Fenster zum Fluss hinaus hatte. Die Scheiben der Vitrine bestanden aus dickem, mit Luftblasen durchzogenem grünlichem Glas – dem einzigen, das man aus dem Sand von Nagspeake herstellen konnte –, und Mrs. Haypotten hatte ihnen erklärt, dass in dem Glasschrank einige ihrer liebsten Stücke standen, weshalb sie besonders vorsichtig waren. Maisie suchte eine Spieldose aus, die wie ein Flugdrachen geformt war und in der ein unglaublich zierlicher Porzellanschlüssel steckte. Behutsam drehte sie ihn und zog die Spieldose auf. Der eierschalenfarbene Schlüssel leuchtete vor dem braunen Hintergrund ihrer Finger. Als sie die Spieluhr absetzte und den Deckel hochhob, dauerte es einen Moment, bis die Töne zu der Melodie des Liedes «Zum Fluss» zusammenfanden. Maisie summte leise vor sich hin, während sie sich mit ausgebreiteten Armen um die eigene Achse drehte. Ihr Schal wehte hinter ihr her, sodass die aufgestickten Chrysanthemen durch die Luft flatterten.
Sullivan, der junge Mann, der die ganze Zeit in einem Sessel vor dem Feuer gesessen und mit verschleierten Augen hinauf zu der großen, alten Karte über dem Kamin geblickt hatte, sprang abrupt auf und stürmte aus dem Zimmer, wobei er im Vorbeigehen leicht stolperte, kurz Petras Handgelenk nahm und es wie zur Entschuldigung leicht drückte. Das war so ungewöhnlich, dass Petra ihm neugierig nachblickte. Denn in den sieben Tagen, die seit seiner Ankunft vergangen waren, hatte er stets eine beinahe unheimliche Grazie an den Tag gelegt. Seine Bewegungen waren so unfassbar elegant, und er selbst sah dermaßen fantastisch aus, dass man glauben konnte, er sei nichts weiter als eine Halluzination. Petra musste manchmal an sich halten, um ihn nicht hin und wieder mit einer Stecknadel zu piksen, wenn er durch einen Raum schritt, nur um zu sehen, ob er zu einem Fehltritt überhaupt in der Lage war.
Aber offensichtlich brauchte es dafür keine Nadel, sondern nur das Lied «Zum Fluss». Interessant.
Die alte Dame in der Ecke, die noch dünner war als Jessamy Butcher, bewegte ihren Schaukelstuhl leicht im Rhythmus der Melodie, während die Spieldose immer langsamer wurde. Die Frau war dunkelhäutig, genau wie Maisie und Petra, aber ihre Haut war an einigen Stellen rötlich, an anderen grau, uneben und leicht pockennarbig, während Maisies Haut so rein und vollkommen war wie die eines Kindes und Petra über den makellosen Teint eines Filmstars verfügte, der mindestens eine Stunde in der Maske gesessen hatte. Die Dame, die von allen Madame Grisaille genannt wurde, sprach wenig, aber sie summte das Lied mit, während sie sacht schaukelte. Und obwohl es kein lauter Ton war – wenn die Heizspulen in dem gusseisernen Kasten an der gegenüberliegenden Wand des Zimmers gerade zischten und gleichzeitig ein Windstoß an den Fenstern rüttelte, war das Summen der Frau kaum zu hören –, fühlten Petra und Maisie ihn beim Tanzen doch wie eine Trommel in ihren Knochen vibrieren. Es war, als ob der Klang durch die alte Dame hindurchfloss, bis hinein in die Bodendielen und bis in die Nägel, mit denen das Holz befestigt war, und wieder hinauf in Petras und Maisies Füße, sodass er sich mit ihnen im Kreis drehen konnte.
«Madame ist eine Tänzerin», hatte Maisie Petra zugeflüstert, als sie dieses Phänomen zum ersten Mal bemerkt hatte.
«Du meinst, sie war es, als sie jünger war?», hatte Petra ebenso leise gefragt. Das war vor drei Tagen gewesen, an dem Abend, als alle ins Esszimmer gingen, wo Madame stets als Erste ein Platz zugewiesen wurde, aus Respekt vor … ja, vor was eigentlich? Vielleicht vor ihrem Alter oder vor ihrer Haltung. Wenn man Sullivan betrachtete und glauben musste, ein Trugbild vor sich zu haben, das zu schön war, als dass es tatsächlich real sein konnte, dann musste man in Madame eine Königin sehen, die nur schlecht zu verbergen vermochte, was sie war: zu erhaben für ihre Mitmenschen, die neben ihr wie demütige Untertanen wirkten.
«Nein», hatte Maisie geflüstert. «Nicht nur, als sie jung war. Auch jetzt. Sie ist eine Tänzerin. Sie will mit uns tanzen, aber sie hält sich zurück.»
«Warum denn?»
«Ich weiß nicht.» Aber die Augen des Mädchens hatten angefangen zu leuchten. «Vielleicht ist es ein Geheimnis.»
«Es ist ein Geheimnis, dass sie eine Tänzerin ist?»
«Nein …» Maisie hatte Madame gedankenverloren betrachtet, wie sie Petra zu dem Sideboard folgte, auf dem das Büfett aufgebaut war und wo Maisie kurz zuvor einen Perlmuttknopf gefunden hatte, der zu Mrs. Haypottens Hauskleid gehörte. «Aber sie hat ein Geheimnis, deshalb tanzt sie nicht. Man kann nämlich nicht tanzen und gleichzeitig verbergen, wer man wirklich ist.»
Das war eine sehr kluge Beobachtung, hatte Petra gefunden, was sie ihrer jüngeren Gefährtin auch gesagt hatte. Und sie dachte noch, wenn Tanzen das wahre Gesicht eines Menschen zutage förderte, so tanzte Maisie wie jemand, der keine Geheimnisse hatte. Diese Vorstellung zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Aber sie hatte nichts gesagt, weil sie Maisie nicht in Verlegenheit bringen wollte. Denn manchmal schimmerte im Tanz des Mädchens etwas so glasklar auf wie eine Träne, etwas, das – wenn es ins Bewusstsein zurückgeholt würde – die Tänzerin sehr, sehr traurig machen würde. Und deshalb behielt Petra ihre Gedanken für sich.
Heute summte Madame Grisaille die Melodie von «Zum Fluss» und danach noch die von «Gaslicht», das Lied, das aus Maisies Lieblingsspieldose erklang; diese Spieldose sah aus wie eine Chrysantheme und passte ganz hervorragend zu Maisies blumengemustertem Schal. Und dann – als ob Sullivans ungelenke Flucht nicht genug gewesen wäre – geschah noch etwas Unerwartetes: Als die Sonne allmählich jenseits des Flusses unterging und die Chrysantheme die letzten, langsamen Töne spielte, hörte Madame auf zu schaukeln. Sie griff in den weißen Pelzmuff, den sie auch im Haus stets bei sich trug, und zog eine neue Spieldose heraus.
Diese wirkte auf den ersten Blick schlichter; es war eine runde, goldfarbene Dose mit einem Deckel aus bemaltem Porzellan. Madame legte einen Finger an ihre Lippen und fing an, die Spieldose aufzuziehen. Ihre Bewegungen hatten etwas so Verstohlenes, dass Petra sich unwillkürlich umsah, ob die Wohnzimmertür und die Glastür zur Veranda auch wirklich geschlossen waren und niemand sie belauschen konnte.
«Die ist aus meinem Zimmer», murmelte Madame. Ihre alte, rostige Stimme knirschte regelrecht. «Ich weiß nicht, ob Mrs. Haypotten damit einverstanden wäre, wenn sie wüsste, dass ich sie mit mir herumtrage, deshalb bleibt die Sache besser unter uns. Aber sie spielt ein wirklich bemerkenswertes Lied.»
Als sie die Spieldose fertig aufgezogen hatte, legte sie das kleine Ding auf ihre Handfläche und hob den Deckel hoch. Maisie verrenkte sich den Hals, um die gemalte Szene auf dem Deckel, die jetzt auf dem Kopf stand, erkennen zu können – zwei Leute, die an einem Wegweiser saßen? Aber nur für einen kurzen Moment schielte sie derart auf den Deckel, denn als die Melodie einsetzte, spürte das Mädchen, dass sie alles enthielt, was sich das Herz einer Tänzerin von einem Musikstück nur wünschen konnte. Sie erzählte von Freude und Liebe, von herrlichem Schmerz, von Gefahr und der Erregung des Abenteuers, von der Gewissheit der Niederlage und aufkeimender Hoffnung. Sie war Traum und Albtraum, sie war wie ein wilder Lauf, wie Winter und Sommer, Wasser und Stein, Metall und Feuer und Erde.
Und Maisie tanzte, wie sie zu tanzen vorher nie gewagt hatte.
Nach einer Weile reichte Madame die Spieluhr an Petra weiter, und jetzt endlich – vielleicht, weil sie nur zu dritt im Raum waren – gesellte sich die alte Frau zu dem jungen Mädchen, und sie tanzten Hand in Hand. Und plötzlich verstand Maisie, warum Madame sich bislang geweigert hatte zu tanzen. Nun kannte sie auch das Geheimnis der alten Frau, und sie erkannte das Geschenk, das in diesem Wissen lag, schlang ihre Arme darum und hüllte es in die wirbelnden, gestickten Chrysanthemen ihres Schals ein, während die beiden sich im Kreis drehten und tanzten wie Menschen, die keine Geheimnisse haben, getaucht in das goldene Licht, in das orangerote Licht, in das blutrote Licht des Sonnenuntergangs über dem Fluss. Über den Kopf des Mädchens hinweg fing Madame Petras Blick ein, und die beiden Frauen lächelten einander zu.
Mag sein, dass sich die Töne ihren Weg durch die Ritzen in den Fenstern bahnten, dass sie mit dem regnerischen Wind über die Veranda zogen, die sich entlang des Skidwracks erstreckte, und dann durch eine gesprungene Glasscheibe in einen anderen Raum des Gebäudes schlüpften. Mag sein, dass sie noch andere Möglichkeiten hatten, sich Gehör zu verschaffen. Wie auch immer – im Erdgeschoss, unterhalb der Treppe, jenseits der Diele, hörten auch die Menschen im Gastraum die Melodie. Zumindest zwei von ihnen.
Negret Kolophon, der an einer komplizierten Bindung für sein Papierfetzenbuch arbeitete, ließ überrascht die Ahle fallen, hob sie dann schnell wieder auf und tat so, als habe er nichts bemerkt. Jessamy Butcher dagegen, die mit Reever Kolophon am anderen Ende des Tresens in ein Gespräch vertieft war, hatte sich nicht in der Gewalt. Ihr Kopf fuhr so heftig herum, in die Richtung, aus der die Musik kam, dass es in ihrem Nacken und in ihren Schultern knackte. Die anderen hätten das Knacken vermutlich gehört, hätte sie nicht gleichzeitig mit ihren behandschuhten Händen das Sherryglas zerdrückt, sodass Splitter und Glaspulver nach allen Seiten spritzten.
Reever, der gerade überlegt hatte, ob er Miss Butcher nicht einladen sollte, ihr Gespräch in einer vertraulicheren Nische der Taverne fortzuführen, machte einen Satz rückwärts, als Glasscherben und Sherry sich über den Tresen ergossen. Doch Jessamy schien nicht einmal zu bemerken, was sie angerichtet hatte. «Erstaunlich», sagte sie mit leiser Verwunderung in der Stimme, wobei sie sowohl Reevers Blick als auch den von Negret ein paar Stühle weiter und den von Tesserian an seinem Tisch mit dem Kartenhaus ignorierte.
«Was ist los?», fragte Reever.
«Dieses Lied.» Jessamy atmete aus, wobei sie einen merkwürdigen Ton ausstieß, beinahe – aber nicht ganz – wie ein Seufzen.
Reevers Blick wanderte wieder zum Tresen, zu der Stelle zwischen ihnen, und er sah, dass sie immer noch Scherben des Glases festhielt, das sie zerdrückt hatte. Er nahm ihre Hände in seine eigenen und bog sanft ihre Finger von den Handflächen. Vorsichtig zog er einen Splitter nach dem anderen heraus, und kleine rote Blutstropfen breiteten sich auf ihren blitzsauberen rosafarbenen Handschuhen aus. Als er damit fertig war, hielt er ihre Hände noch einen Moment länger und musterte ihr Gesicht.
Sie schien nichts davon zu registrieren – und er konnte keine Melodie hören.
Nach einer Weile zog Jessamy ihre Hände aus seinem Griff und stand auf. Verlegen strich sie sich mit der Hand über die Frisur und hinterließ einen rosafarbenen Streifen auf der blassblonden Wasserwelle über ihrem Ohr. Sie ging aus der Gaststube, durch die Diele und hinein ins Wohnzimmer. Petra und Madame blickten erschrocken auf, aber als Jessamy die Tür hinter sich zuzog, entspannten sie sich wieder.
Aus einem unerfindlichen Grund war die Spieluhr noch nicht langsamer geworden. «Wollen Sie mittanzen?», fragte Maisie und griff nach der Hand der jungen Frau, wobei sie das Blut ignorierte, das wie bei einem Stigma durch den Handschuh drang.
Jessamy wirbelte Maisie an den Fingern herum, die ihre Hand gefasst hatten, aber sie selbst blieb reglos stehen und schüttelte den Kopf. «Ich tanze nicht», lächelte sie. «Aber ich kenne dieses Lied gut. Ich habe einmal versucht, es zu spielen, doch es ist schwieriger, als es den Anschein hat. Ich war Musikerin, musst du wissen, vor langer Zeit. In einem anderen Leben.»
Musikerin oder nicht, Miss Butcher ist auch eine Tänzerin, dachte Maisie, die jeden durchschauen konnte. Ich frage mich, was für ein Geheimnis sie hat.
In der Taverne «Zur blauen Ader» hielten sich außer den erwähnten Gästen noch sechs weitere Personen auf. Da waren natürlich die Haypottens und Sorcha, das Zimmermädchen, sechzehn Jahre alt, pummelig und schwarzäugig – und hoffnungslos in Negret Kolophon verschossen, was alle, die es bemerkten, mehr als verwunderte, denn immerhin musste er gegen Sullivan bestehen, dessen Antlitz so perfekt war, dass jeder geblendet worden wäre – wenn da nicht die winzige Narbe unter einem Auge gewesen wäre. Aber genau wie Maisie war Sorcha ein Mädchen, kein Dummkopf, und sie hatte das sichere Gefühl, dass hinter so viel Schönheit eine ernste Gefahr lauerte. Und obwohl man Mr. Negret nicht direkt gutaussehend nennen konnte, hatte er etwas ganz Besonderes an sich. Sein Gesicht war hinter den punktierten Wirbeln und Kreiseln der Tätowierungen verborgen, was dazu führte, dass sie unbedingt genauer hinschauen wollte. Und so kam es, dass sie jedes Mal, wenn sie ihm begegnete und bemerkte, wie er sich die Bücher auf den Regalen im Gastraum oder auf dem Kaminsims im Wohnzimmer betrachtete oder das Bücherregal auf dem Treppenabsatz zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock durchsah, verharrte, um ihn heimlich zu mustern. Und sie wusste auch ganz genau, dass er leise vor sich hin sang, wenn er dachte, dass niemand zuhörte, und er seine Papierfetzen zu kleinen, selbst gemachten Büchern band oder am Fenster stand und in dem Licht las, das es durch den Regen bis ins Haus geschafft hatte.
Aber natürlich ist in einer Taverne die Magd diejenige, die immer genau hinhört, und so manches Mal ertappte sich Sorcha dabei, dass sie am Abend, wenn alle zu Bett gegangen waren und sie ihren Rundgang durch die Zimmer machte, um frische Scheite auf die Glut in den Kaminen zu legen, die Gebetsworte des Feuerhüters, die sie von ihrem Großvater mütterlicherseits gelernt hatte, zu Negrets Melodien sang.
Die letzten drei Gäste befanden sich in der Bar im vorderen Bereich der Taverne, wo man rauchen durfte. Einer von ihnen war Antony Masseter, ein groß gewachsener Handlungsreisender, dessen rechtes Auge so grün leuchtete wie das einer Katze und dessen linkes von einer rostfarbenen Augenklappe verdeckt war. Auf Mr. Masseters Handfläche prangte eine runde, gefleckte Narbe, wie ein explodierendes Feuerwerk am Himmel, und er schien an Schlaflosigkeit zu leiden, die ihn dazu trieb, nachts durch die Gänge der Taverne zu wandern. Durch den Regen waren seine leisen Schritte kaum zu hören, aber Sorcha und ein oder zwei Gäste hatten ihn des Nachts schon gesehen, wenn sie von bösen Träumen, vom Durst oder der Dringlichkeit, die Toilette aufzusuchen, von der Angst, die Feuer in den Kaminen könnten ausgehen, oder von irgendetwas anderem zu nachtschwarzer Zeit aus ihren Zimmern getrieben worden waren.
Vor drei Nächten hatte Petra einen Blick auf Mr. Masseter erhascht; da hatte er sich durch Musik verraten. Als sie in ihr Zimmer zurückkehren wollte, hatte sie ganz schwach, wie aus weiter Ferne, das Klingeln von zarten Tönen aus dem Erdgeschoss der Taverne gehört und die Melodie von «Auf und davon» erkannt, dem Lied aus der Spieldose, die aussah wie ein rotes Kästchen und auf dem unteren Regal in der Vitrine im Wohnzimmer stand. Petra war im Türrahmen stehen geblieben und hatte überlegte, ob sie Sorcha den Schlüssel zurückgegeben hatte, nachdem sie und Maisie die Spieluhren am frühen Abend zurückgestellt hatten. Sie sah über die Schulter und bemerkte Sullivan, wie er in seiner offenen Tür stand und die Stirn runzelte. Ihre Blicke trafen sich. «Masseter», wisperte Sullivan so leise, dass nur die S-Laute hörbar waren. «Er ist immer so spät noch auf.» Er nickte zu der Tür rechts neben seiner. «Ich höre ihn, wenn er sein Zimmer verlässt.» Dann hatte er seine Finger an die Lippen gelegt – nicht ganz, aber doch so ähnlich wie bei einer Kusshand –, war in sein Zimmer gegangen und hatte die Tür geschlossen.
Sorcha hätte den anderen erzählen können, dass auch Sullivan nicht schlief. Denn sie war später in derselben Nacht auf dem Weg von ihrer eigenen winzigen Kammer zur Küche an seiner Tür vorbeigekommen und hatte ihn in seinem Zimmer auf und ab laufen gehört – als sie selbst beschlossen hatte, noch einmal nach dem Ofen zu sehen, ob die Glut noch schwelte, und das Feuerhütergebet zu singen. Sorcha hatte normalerweise einen gesunden Schlaf, aber dieser ganze Regen verursachte ihr Albträume. Der Hausierer, der ihnen vor einem halben Jahrhundert die Heizungsanlage verkauft hatte, hatte nicht alle Teile dabeigehabt, um sämtliche Räume des Gasthofs mit einer Heizung zu versehen, und er war in all den Jahren nie mehr wiedergekommen, um seine Arbeit fertigzustellen – ganz davon zu schweigen, dass die Anlage jeden Morgen sowieso immer wieder zum Laufen gebracht und unter Zischen und Klopfen geprüft werden musste, wie viel Wärme sie in denjenigen Räumen abstrahlte, die mit Heizspiralen ausgestattet waren. Sorchas Feuerstellen waren über Nacht gut versorgt, aber in letzter Zeit wachte sie vor lauter Angst, die Feuer könnten ausgehen, zweimal, manchmal sogar dreimal in der Nacht auf, und so band sie auch zweimal, manchmal sogar dreimal in der Nacht eine Schürze über ihr Nachthemd und ging durch die Taverne und überprüfte alle Kamine, die sie erreichen konnte, ohne die Gäste zu stören. Nein, Sullivan schlief nicht, aber wenigstens blieb er in seinem Zimmer – anders als Mr. Masseter, der sie fast zu Tode erschreckt hatte, als sie zum ersten Mal auf ihn stieß und sah, wie er vor einer von Mrs. Haypottens Vitrinen stand und hineinstarrte, als ob er keine Ahnung hatte, wie er dorthin gekommen war. Jetzt wusste sie zwar, dass sie ihm jederzeit in den dunklen Gängen begegnen konnte, aber das nahm dem Moment, wenn er mitten in der Nacht plötzlich vor ihr auftauchte, nicht seinen Schrecken. Er bewegte sich so geräuschlos wie eine Katze.
Bei Tage dagegen – sogar noch bei Sonnenuntergang – benahm sich Masseter ganz normal. Nachdem eben Mr. Haypotten den Kopf durch die Tür in die Bar gesteckt hatte, um das Abendessen anzukündigen, und dann wieder verschwunden war, hatte der Handlungsreisende ein Etui mit kleinen Zigarren aus der Tasche gezogen und den beiden anderen Gästen im Raum angeboten: Phineas Amalgam, ein Nachbar der Haypottens, ein Mann mit Sommersprossen und schwarz-grau gefleckten Haaren, der am Tag, als der Regen eingesetzt hatte, hereingekommen war, um sich eine Schachtel Streichhölzer zu besorgen, und hier mit den anderen Reisenden gestrandet war; und ein Kunstdrucker namens Gregory Sangwin, dessen Haare dunkelgrauer waren als die von Phineas Amalgam und dessen Hautfarbe guter Walnusstinte auf feinem Creswick-Papier glich. Er war ein Bekannter von Amalgam und hatte auf dessen Empfehlung hin in der Taverne Quartier bezogen.
Gewöhnlich bestand Sangwins Arbeit darin, zierliche, detailreiche Bilder und Illustrationen zu drucken, die aus Holzblöcken geschnitten wurden, und er vergnügte sich nun damit, kleine Tiere aus Holz herzustellen, die jeden Tag beim Abendessen ihren Weg zu Maisie fanden. Sorcha und er hatten ein gemeinsames Spiel daraus gemacht. Sie sammelte für ihn kleine Stücke und Splitter des Feuerholzes, und wenn er sie mithilfe seines perlmuttbesetzen Schnitzmessers in Tiere und Vögel verwandelt hatte, gab er sie Sorcha zurück. Beim Abendessen tauchten die Tierchen dann auf Maisies Teller auf, in ihrer Serviette, einmal sogar in ihrer Suppe, als Mr. Sangwin aus einem länglichen Stückchen Holz einen schwimmenden Drachen hergestellt hatte.
Der Kunstdrucker blinzelte mit schmalen Augen durch seinen Kneifer und betrachtete den winzigen Seevogel mit den ausgebreiteten Flügeln, den er heute aus einem Birnbaumholzsplitter schnitt. Das Tier für Maisie, ein Otter, saß bereits fix und fertig neben seiner Tasse. Mit dem Vogel wollte er sich gegenüber seiner Mitverschwörerin erkenntlich zeigen. Er blickte auf, blinzelte erneut und nahm eine von Masseters Zigarren. «Danke.»
«Ein Albatros?», fragte Masseter.
Sangwin nickte. «Für das Zimmermädchen. Sie ist ein netter Mensch, bringt der Kleinen jeden Abend die Tierchen an den Tisch.» Er achtete nicht weiter auf die Zigarre, sondern hob den kleinen Vogel hoch, kniff die Augen zusammen und setzte die Messerspitze in ein winziges Loch in einem der Flügel, um einen kaum sichtbaren Splitter wegzuschneiden. «Vielleicht hat Mrs. Haypotten ein Stück Band, an dem man ihn aufhängen kann.»
Phineas stand da und starrte auf das kleine Kartenhaus, das Al Tesserian am Vorabend auf einem der Bartische zusammengesetzt hatte und das immer noch dort stand. Er nahm eine Zigarre, steckte sie aber in seine Westentasche, anstatt sie gleich anzuzünden. «Ich gehe sie fragen, wenn Sie einverstanden sind.»
«Das wäre nett, Mr. A.», erwiderte Sangwin.
«Keine Ursache», winkte Amalgam ab. «Sorcha ist ein prächtiger Kerl. Ich kenne sie seit ihrer Kindheit, als sie noch ein kleines Dingelchen war.» Er bedankte sich mit einem Nicken bei Masseter und verließ die Bar. Als sie später alle in Richtung Speiseraum gingen, reichte er Sangwin ein blaues Samtband.
Mrs. Haypotten, die kurz darauf geschäftig hereinplatzte, blieb kurz stehen, legte die Hand an den Ellbogen des Druckers und murmelte: «Wie nett von Ihnen.» Und als Maisie den Otter entdeckte, der aus einem Brötchen lugte, und alle anderen sich lächelnd an der Freude des Mädchens ergötzten, schob Sangwin den Albatros samt Band in Sorchas Hand.
Nach dem Essen begaben sich die Gäste wie jeden Abend ins Wohnzimmer, um neben einem von Sorchas gut gehüteten Feuern eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken. Es war Phineas Amalgam, der an diesem Abend – dem siebten seit Beginn der Flut – die Idee mit den Geschichten hatte.
«Wenn sich Reisende an zivilisierten Orten zusammenfinden und die Wärme eines Feuers und eine Flasche Wein miteinander teilen, dann teilen sie manchmal auch etwas von sich selbst mit», sagte Phin zu den anderen und ließ sich in seinem Lieblingssessel nieder, einem von dreien, die vor dem Kamin standen. «Und dann – Wunder über Wunder – sind sie keine Fremden mehr, sondern Gefährten, die sich gemeinsam wärmen und gemeinsam trinken.»
Mr. Haypotten, der auf dem Sideboard den Kaffee bereitstellte, zwinkerte seiner Frau zu, die das Teeservice eindeckte. Der Folklorist Phineas Amalgam verdiente sich seinen Lebensunterhalt, indem er Geschichten sammelte und sie als Bücher herausgab, und vielleicht dachte der Gastwirt, dass der Vorschlag seines Nachbarn ein wenig eigensüchtig war. Und möglicherweise hatte er damit sogar recht. Trotzdem, es war immerhin eine kurzweilige Form, sich die Zeit zu vertreiben.
Wind und Regen rüttelten an den Fensterläden und den Balkontüren, während die Gäste, die sich im Wohnzimmer zusammengefunden hatten, einander musterten: das Mädchen in ihrem bestickten Seidenschal; die beiden Zwillingsbrüder mit den tätowierten Gesichtern; die hagere Frau mit den behandschuhten Händen, die sich ständig nervös bewegten; die andere Frau, noch hagerer und eingehüllt in zwei Schichten aus dicken Tüchern, unter denen hin und wieder rotbraune Haut aufblitzte, wenn sie sich bewegte und die Tücher sich verschoben. Der Glücksspieler mit seiner abgewetzten Melone, der vor dem Kamin auf dem Boden eine Burg aus unzähligen Würfeln und Karten baute und der für sein Kunstwerk mindestens sechs Kartenspiele einsetzte, die verirrten Asse und Buben noch nicht mit eingerechnet, die er im Ärmel oder an anderen Stellen seiner Kleidung stecken hatte. Der Kapitän, der am Sideboard stand, die Sanduhr dicht neben sich, die er zu gerne umgedreht hätte, es aber als unhöflich erachtete, Amalgam zu unterbrechen oder die Haypottens bei ihrer Arbeit zu stören. Der Drucker, der an einem Fenster lehnte, das auf den Fluss hinausging, und Masseters Zigarre rauchte. Der junge Mann auf dem Sofa, mit der vollkommenen Schönheit und der kleinen Narbe; und neben ihm die junge Frau mit der Libelle in ihren dunklen Locken – gerade weit genug von ihm entfernt, sodass sein Arm, der auf der Rückenlehne lag, sie nicht an der Schulter berühren konnte. Und zwischen ihnen die Lücke, wo Maisie gesessen hatte, ehe sie sich zu Tesserian auf den Boden gesellt hatte, um ihm beim Bau seiner Burg zu helfen. Das Zimmermädchen neben der Tür zur Diele muss unbedingt mitgezählt werden, denn eine Person, die zu gestohlener Musik Gebete singt, wenn sie das Feuer schürt, kann in einer Geschichte nicht bloß eine Statistin sein. Und der Handlungsreisende, der am Kaminsims lehnte und mit den Fingern über das Innenleben der Spieldose strich, die dort stand: ein aufgeklappter Kasten, etwa so groß wie ein Laib Brot, und in seinem Inneren ein wunderschöner Baum aus verschiedenen Metallen, dessen Wurzeln mit dem Mechanismus der Walze verbunden waren.
«Wenn alle einverstanden sind», sagte Phin und ließ die Flüssigkeit in seinem Glas kreisen, «dann werde ich die erste Geschichte erzählen. Vielleicht befinden Sie sie für wert, sie gegen eine andere einzutauschen, und bieten mir eine von Ihren an.»
«Hört, hört.» Mr. Haypotten reichte Amalgam eine Tasse Kaffee. «Es muss aber eine gute sein, Phin.»
«Können Sie die über das Haus zwischen den Kiefern erzählen?», fragte Petra.
Amalgam blickte sie erstaunt an.
«Ich habe sie in einem Ihrer Bücher gelesen», erklärte sie.
«Oh.» Der Folklorist hatte Hunderte von Geschichten in unzählige Bücher gepackt. Es war daher vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass ihm nicht auf Anhieb einfiel, dass diejenige, nach der Petra gefragt hatte, gar nicht in einem der Bände enthalten war. «Ja, warum nicht?»
Es ist nicht immer einfach, den Überblick über seine Geschichten zu behalten.
«Danke», sagte Petra.
Unfähig, sich noch länger zu beherrschen, drehte Kapitän Frost die Sanduhr um, und Phineas Amalgam sagte: «Dann hört zu.»
DAS HAUS DER 1000 WEGE
Die Geschichte des Folkloristen
Hört zu. Es gab eine Stadt, die sich nicht kartografieren ließ, und in dieser Stadt gab es ein Haus, das man nicht zeichnen konnte. Es stand am Fuß eines Hügels in einer Straße namens Fellwool, eher eine Gasse mit aufgerissenem Pflaster, auf der das Unkraut wucherte, und beschattet von uralten, knorrigen Kiefern. Es war ein Haus, das man in einfacheren Zeiten verzaubert, verwunschen oder verflucht genannt hatte. Solche Häuser tauchen hin und wieder in Städten und Ortschaften auf, in denen sie toleriert werden. Manchmal überleben sie. Manchmal nicht.
Dieses Haus, das Haus, in dem diese Geschichte spielt, hatte schon viele, viele Jahre überlebt. Die kupfernen Fallrohre bohrten sich wie Wurzeln in die Erde; das Holz der Rahmenkonstruktion hatte den Steinen, aus denen die Fassade errichtet war, beigebracht zu atmen und von ihnen wiederum die Kunst der Stärke gelernt; und das Eisen, das die Dachtraufe verkleidete, die Wände hinaufstieg und sich um die Fenster kräuselte, tanzte im Sonnenuntergang. Das Haus gestattete seinen Räumen, wie Katzen umherzustreifen.
Hin und wieder hatte es Bewohner akzeptiert, wenn es im endlosen Marsch der Jahre einsam geworden war, sie aber nie lange behalten. Es war ein kunstfertiges Gebäude, und es hatte stets gewusst, wie es Besucher, die seine Gastfreundschaft zu lange in Anspruch genommen hatten, wieder loswurde.
Es ist eine Tatsache – zumindest glaube ich das –, dass alles Außergewöhnliche auch Außergewöhnliches anzieht. Im Laufe der Jahre sammelte dieses einzigartige Haus nach und nach Dinge an, Löffel für Löffel, dann Tasse und Uhr, ein Regal, einen Schlüssel und einen verbeulten Hut nach dem anderen: Dinge, die bemerkenswert und merkwürdig waren, ungeheuerlich und unheimlich. War das Haus bewohnt, führte dieser Umstand gelegentlich zu … nun, nennen wir es Abenteuern, obwohl ich damit nicht nur die Ereignisse meine, die glücklich und mit einem Jubel enden. Wenn es leer stand, flüsterten das Haus und seine Sammlung wunderbarer und schrecklicher Einrichtungsgegenstände miteinander. Was ist diesmal passiert? Nun, ich werde es dir erzählen. Es war wunderbar. Oder: Es war schrecklich.
Manchmal traten Menschen ein, ohne dass sie eingeladen waren. Das Haus und sein Inventar gingen damit auf unterschiedliche Weise um. Die eingeschworene Hausgemeinschaft war zumeist eher neugierig als unwirsch, aber einige der Räume schätzten es nicht, gestört zu werden, oder waren schnell gekränkt – oder Schlimmeres –, und ein paar Möbelstücke verfügten über einen recht fragwürdigen Sinn für Humor, randalierten gerne oder waren schlicht und einfach nur boshaft. Mit der Zeit lehnte auch das Haus selbst jegliche Art von Besuchern ab, weil sie für zu viel Spannung zwischen den Räumen und Dingen sorgten, aus denen sich das Ganze zusammensetzte. Und schließlich fing es an, Eindringlinge regelrecht abzuwehren – weil es sie schützen und überdies den inneren Frieden wahren wollte.
Und weil es den Schaden begrenzen wollte. Manchmal herrschten Zustände wie nach einem Tornado, wenn die unfreundlicheren Räume und Gegenstände sich nicht mehr beherrschen konnten, und weder die Werkzeuge noch die Besen und Wischmopps hatten Lust, das Chaos und den Dreck anderer zu beseitigen.
Es war in einem Herbst, als ein Mann in die Stadt kam. Obwohl er von Beruf Handlungsreisender war, hatte er diesmal nicht vor, etwas zu verkaufen, sondern selbst etwas zu erwerben. Der Handlungsreisende hatte etwas verloren, das seinem Arbeitgeber gehörte, und man hatte ihm die beinahe unmögliche Aufgabe gestellt, die fragliche Vorrichtung zu ersetzen. Das erste der vielen mysteriösen Teile, die man für die erforderliche Rekonstruktion brauchte, war eins der wichtigsten: ein Schlüsselloch. Kein Schlüssel, kein Schloss, sondern die Aussparung, die zu einem ganz besonderen Gehäuse gehörte – eine Aussparung, die ein Zutrittstor bildete, ein etwas umständlicherer Ausdruck für etwas, das man auch als Portal oder Pforte bezeichnen könnte. Und damit war nicht nur irgendein Portal gemeint, sondern eines, das Zeit und Raum überbrücken konnte, denn die Vorrichtung, die der Handlungsreisende konstruieren wollte, musste in der Lage sein, diese beiden Dimensionen zu beeinflussen.
Der Handlungsreisende war weit herumgekommen, und unterwegs hatte er alles Mögliche über diese Art von Pforten gelesen: Zutrittstore, die in Kleiderschränken versteckt waren, in Spiegeln, in Uhren, in Brunnen oder Bettpfosten. Aber nicht jedes Gebäude akzeptierte Portalmöbel in seinen vier Wänden. Immerhin war es für gewöhnlich die Aufgabe von Gebäuden, die Welt draußen zu halten, und nicht, andere Welten einzulassen. Obwohl der Mann ein Ausländer war, kannte er Nagspeake gut, und wenn so etwas wie ein Zutrittstor überhaupt gefunden werden konnte, so dachte er, dann in dem merkwürdigen Haus in jener kieferbestandenen Straße.
Daher machte sich der Handlungsreisende auf die Suche nach einem Kind, denn während es für einen Erwachsenen sehr schwierig ist, ein Zutrittstor zu durchschreiten oder überhaupt eines zu finden, passiert es Kindern – besonders der richtigen Sorte Kinder – ständig, dass sie durch ein solches Portal in andere Welten fallen.
Es dauerte nicht lang, da begegnete er einem kleinen Jungen, der von einer Meute größerer Jungen eingekesselt und bedrängt worden war, die ihn – wirklich sehr passend! – als Feigling beschimpften. Der Handlungsreisende hatte nicht mitbekommen, womit der Junge namens Pantin eine solche Anschuldigung verdient haben sollte, aber er zögerte keine Sekunde, sondern eilte dem Kind zu Hilfe. «Ich wette, er ist mutiger als ihr», behauptete der Handlungsreisende und zerrte den lautesten der Rüpel am Kragen zur Seite. «Gebt ihm die Gelegenheit zu beweisen, dass er kein Feigling ist.»
«Wie denn?», knurrte der Rabauke, der erfolglos versuchte, sich aus dem Griff des Mannes zu winden.
«Ja, wie denn?», fragte Pantin neugierig.
Der Handlungsreisende schob den großen Jungen von sich. «Er soll eine Nacht in dem Haus in der Fellwool Street verbringen. Ich wette, keiner von euch anderen würde sich das trauen.»
Alle schreckten bei der Vorstellung zurück. Denn sie wussten, dass das Haus in der Fellwool Street verflucht war. Aber der arme Pantin saß in der Falle. Wenn er sich weigerte, würde ihn das ein für alle Mal als Feigling abstempeln. Andererseits … wenn er zustimmte, wäre er eine Legende. Und so ließ er sich darauf ein, denn obwohl alle kleinen Kinder mehr oder weniger gemein sein können, sind sie doch auch alle in der Lage, manchmal ungeheure Tapferkeit an den Tag zu legen.
An diesem Abend schlich sich Pantin mit einer Lampe und einem Beutel mit Vorräten aus dem Haus und traf sich mit den anderen Jungen an der Einmündung der Fellwool Street. Sie gingen über das aufgerissene Pflaster und zwischen den knorrigen Bäumen hindurch zu dem Haus, allen voran Pantin, der versuchte, jedes Quäntchen Mut zusammenzuraffen, das er aufbringen konnte. Im Näherkommen sahen sie Lichter in der schier undurchdringlichen Dunkelheit vor ihnen: Kerzen, die in den Fenstern des Hauses leuchteten. Der Handlungsreisende wartete bereits auf der Veranda. Eine Seite der doppelflügeligen Haustür stand offen, und dahinter sahen sie einen Stapel mit Lampen und Kerzenständern auf dem Tisch in der Mitte der Eingangshalle liegen.
Die anderen Jungen zogen sich zurück und ließen Pantin allein die Vordertreppe hinaufsteigen.
«Ich dachte, ich könnte dir ein bisschen unter die Arme greifen, schließlich habe ich dich ja in diese Sache reingeritten», sagte der Handlungsreisende. «Eine Nacht kann sich ziemlich in die Länge ziehen, es sei denn, man hat etwas, um sich die Zeit zu vertreiben.»
«Was denn zum Beispiel?», fragte Pantin, der wie magisch von den tanzenden Schatten im Haus angezogen wurde.
«Eine Schatzsuche», antwortete der Fremde, und jetzt endlich schaute Pantin ihn an. Seine Augen glänzten sogar in der Dunkelheit blau und kalt. «Und wenn du den Schatz findest und ihn mir herausbringst, wenn die Nacht vorbei ist, werde ich dich dafür bezahlen.»
Dem Jungen schlotterten die Knie. «Was ist das für ein Schatz?»
«In dem Haus», sagte der Mann, «befindet sich ein Zutrittstor. Ein … sagen wir mal, eine Art von Schrank oder Schrein, in dem sich, wenn man ihn öffnet, etwas anderes als bloß das gewöhnliche Innere eines Schranks oder Schreins befindet. Das ist das Zutrittstor. Es könnte tatsächlich jede Art von Gehäuse sein oder ein Teil davon, klein oder groß, alt oder neu. Vielleicht ist es verschlossen, weshalb du den hier brauchst.» Aus seiner Tasche zog er einen Dietrich. «Pass auf und lass ihn nicht fallen.»
Pantin nahm den Dietrich vorsichtig an sich. Er war aus einem hellen Material, hier und dort von roten und orangen Roststreifen überzogen, und er fühlte sich rau an, wie unglasiertes Porzellan.
«Wenn du den richtigen Schrank gefunden hast», fuhr der Handlungsreisende fort, «geh nicht hinein, egal, was du darin siehst. Der Schatz, den ich haben will, ist das Schlüsselloch dieses Schranks.» Er reichte Pantin ein zusammengerolltes Stück Wachstuch, in dem der Junge lange, dünne Gegenstände ertastete. «Die könnten nützlich sein. Oder vielleicht auch nicht.»
Pantin steckte den Dietrich und die Tuchrolle in seinen Beutel und holte ganz tief Atem. Dann trat er an dem Handlungsreisenden vorbei über die Schwelle. «Danke, dass Sie die Kerzen angezündet haben.»
Die kalte Zuversicht des Mannes geriet ins Wanken. «Das war ich nicht.»
Dann klappte die Tür zwischen ihnen zu, noch bevor der Junge etwas erwidern konnte. In dem Moment, in dem sie zuschlug, flackerten alle Lichter – die auf dem Tisch sowie die Kerze in Pantins Laterne – tiefblau auf. Dann erloschen sie, und er wurde von der Dunkelheit verschluckt.
Pantin tastete in seinem Beutel nach Streichhölzern, während er unsicher durch den Raum tapste. Er zündete eines an und griff nach einer Kerze, musste jedoch feststellen, dass die kleine Flamme ihr funzeliges Licht auf einen leeren Tisch warf, der von einer dicken Staubschicht überzogen war, als ob dort seit sehr langer Zeit nichts mehr gelegen hätte.
Aber er hatte ja noch die Kerze in seiner Laterne, die er mühelos entzündete und die mit einer ganz normalen Flamme brannte. Pantin schluckte seine Nervosität herunter, hob die Lampe mit zitternder Hand und machte sich daran, das Haus zu erkunden und nach dem geheimnisvollen Schrank des Handlungsreisenden zu suchen.
Irgendwo in der Dunkelheit hörte er das Ticken von Uhren, doch in der weitläufigen Eingangshalle standen außer dem staubigen Tisch keinerlei Möbelstücke. Der Eingangstür gegenüber zog sich eine Treppe in einem sanften Bogen hinauf in den ersten Stock. In jeder Wand befand sich eine einzige Türöffnung: die Eingangspforte, durch die er das Haus betreten hatte, und drei weite Durchgänge, die jeweils in Räume rechts, links und ihm gegenüber führten; der Durchgang vor ihm befand sich unter dem Bogen der breiten Treppe. Durch die halb geöffnete Schiebetür zu seiner Linken nahm er die Konturen von Möbeln wahr. Möglicherweise kam von dort auch das Ticken. Jenseits der Bogenöffnung rechts von ihm konnte Pantin, als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, die Schatten von großen, reglosen Tiergestalten ausmachen. Instinktiv hastete er auf den Torbogen unter der Treppe zu.
Er gelangte in ein Esszimmer, an dessen Ende eine Schwingtür in einen Gang führte, der ihn wiederum zur Küche brachte. Dort fand der Junge endlich ein paar Geschirrschränke, die er ausprobieren konnte. Einige waren leer, andere nicht, aber alles, was er darin fand – Besteck, Gläser, bunt zusammengewürfeltes Geschirr –, kam ihm völlig normal vor. Auch diejenigen, die leer waren, schienen einfach nur … leer.
Von der Küche gingen drei weitere Türen in andere Bereiche des Hauses. Pantin entschied sich für eine schmale, doppelflügelige Lamellentür, von der er vermutete, dass sich dahinter eine Speisekammer befand. Er öffnete eine Seite der Tür … und blickte wieder in die Eingangshalle, als ob er auf der Schwelle der Haustür stehen würde. Vor ihm stand der staubige Tisch, und dahinter zog sich die Treppe nach oben, mit der Tür zum Speisezimmer darunter.
Eigentlich unmöglich, und doch war es so. Pantin warf einen Blick über die Schulter. Wenn er tatsächlich wie durch ein Wunder wieder im Hauseingang stand, dann müssten doch hinter ihm, wenn er durch die Eingangstür sah, genauso wundersamerweise die Einfahrt und die Fellwool Street liegen. Aber nein – dort befand sich die Küche, durch die er eben gegangen war.
Verdutzt trat er in die Eingangshalle und zog die Tür hinter sich zu. Er drehte sich um und öffnete sie wieder – und statt in die Küche blickte er diesmal ins Freie, auf die kurvige Einfahrt, in deren Mitte die anderen Jungen ein Lagerfeuer entzündet hatten. Mit zitternden Fingern schloss Pantin die Tür wieder und lehnte sich schwer atmend gegen das hölzerne Türblatt. War es möglich, dass er den Schrank des Handlungsreisenden schon gefunden hatte? Er erinnerte sich nicht daran, ein Schlüsselloch in der Lamellentür gesehen zu haben. Aber er hatte auch nicht darauf geachtet.
Er lief wieder durch Eingangshalle und Esszimmer, aber diesmal führte der Gang dahinter nicht in die Küche, sondern zu einer schmalen, steilen Treppe, die nach den Gesetzen der Logik unweigerlich mit der großen, bogenförmigen Haupttreppe hätte kollidieren müssen. Und da oben war Licht … Pantin kehrte um – und stand plötzlich in einem Billardzimmer, wo eben noch das Esszimmer gewesen war.
Der Junge sackte zusammen, landete auf dem Hintern und schlug die Hände vor das Gesicht. Dann fing er an zu lachen. Führte jede Tür in diesem Haus gerade nicht an den Ort, der sich in Wirklichkeit dahinter befinden sollte? Wenn das so war, musste er dann überhaupt irgendein Schlüsselloch finden? Nach einer Weile verklang sein Gelächter, und Pantin flüsterte «Schränke» in seine Handflächen. Der Handlungsreisende wollte das Schlüsselloch eines Schranks oder Schreins haben, und dafür hatte Pantin die ganze Nacht Zeit. Er stand auf und wischte sich über das Gesicht.
In dem Raum, der jetzt zu einem Spielzimmer geworden war, gab es etliche Schränke und Behälter, die man untersuchen konnte: ein Sideboard mit staubigen Flaschen, ein flacher Kasten an der Wand, hinter dem sich eine Dartscheibe verbarg, eine Kiste mit trockenen und bröseligen Zigarren und eine andere mit duftenden Streichhölzern. Aber in keinem Möbelstück fand er irgendetwas Interessantes. Dann gab es noch ein paar Doppeltüren, die von Vorhängen verdeckt waren. «Weiter geht’s», murmelte Pantin und betrat einen hohen Wintergarten mit einer Glaskuppel, in dem sich lauter tote und verfaulende Pflanzen befanden.
An der Wand stand ein massives Bücherregal, dessen Fächer durch Glastüren geschützt waren, aber im Inneren fand sich nichts Außergewöhnliches, nur Gartengeräte, Papiertütchen mit getrockneten Samen, zwei Notizbücher und ein zerbrochener Bleistift. Neben der Tür hing eine Kuckucksuhr an der Wand. Pantin schleppte einen Stuhl hinüber, stieg darauf, nahm die Uhr ab und öffnete die rückseitige Wand. Er zuckte erschrocken zusammen, als ein lebendiger Vogel mit rot-grünem Gefieder heraushüpfte, die Flügel ausbreitete und dann aus dem Zimmer flog. Das war wahrhaftig merkwürdig, genauso merkwürdig wie die Tatsache, dass sich in dem Kasten kein Uhrwerk befand. Doch das Innere war eckig und aus Holz und sah genauso aus wie die Außenseite; außerdem gab es sowieso nirgends ein Schloss oder ein Schlüsselloch, nur einen einfachen Haken zum Verschließen der Tür.
Er hängte die Uhr wieder an die Wand, stieg von dem Stuhl hinunter und bahnte sich einen Weg durch Möbel aus Weidengeflecht und zerbrochene Blumentöpfe bis zu der verglasten Terrassentür auf der anderen Seite des Wintergartens. Er befeuchtete die verschmutzte Glasscheibe mit etwas Spucke, rieb mit seinem Ärmel ein Guckloch sauber und spähte hindurch. Draußen, jenseits der Hecken, die einen überwucherten Garten einfriedeten, sah er die Einfahrt, die zur Fellwool Street führte – was überhaupt keinen Sinn ergab, weil der Wintergarten vom Hauseingang aus nicht zu sehen gewesen war. Er hätte also eigentlich auf der Rückseite des Hauses liegen müssen, nicht auf der Vorderseite. Aber Pantin konnte klar und deutlich die anderen Jungen sehen, die um ihr Feuer saßen, und etwas weiter weg eine viel kleinere Glut, die aufflackerte und dann beinahe wieder erlosch: vielleicht eine Zigarre oder ein Zigarillo in der Hand des Mannes mit den kalten blauen Augen.
Er ging zu dem verglasten Regal und holte die Schreibutensilien, die er dort gesehen hatte. In einem der Notizbücher waren nur wenige Seiten beschrieben. Pantin überblätterte ein paar Pflanzenskizzen und die dazugehörigen Bemerkungen bis zu einer leeren Seite, und in dem halbherzigen Versuch, sich in den verwirrenden Räumen und Türen zurechtzufinden, setzte er an, einen Lageplan des Hauses zu zeichnen. Aber er fand keine Möglichkeit, auf der zweidimensionalen Fläche des Papiers eine auch nur annähernd logische Anordnung der Räume darzustellen, durch die er bereits gekommen war.
Er gab es auf und skizzierte stattdessen die Räume selbst, jeden auf einer eigenen Seite, zusammen mit den Eingängen und Ausgängen, die er entdeckt hatte, und die Richtung, in die sie führten. Dann steckte er das Notizbuch und den Bleistift in seinen Beutel, kehrte zu der Tür zurück, die auf den Garten und die Hecken hinausgegangen war, und trat hindurch. Aber statt im Freien stand er in der Küche, hinter sich die Türen zur Speisekammer. Und so verging die Nacht.
Pantin wusste nicht genau, ob er überall im Erdgeschoss gewesen war. Er durchsuchte jeden Raum, in den er gelangte: eine Bibliothek, ein Zimmer mit ausgestopften Tieren – bekannte und unbekannte –, ein Musikzimmer, ein Salon voller tickender Uhren, die ihm mit perfekt aufeinander abgestimmten Glockenschlägen weismachen wollten, dass er noch keine Viertelstunde in dem Haus verbracht hatte – was natürlich lächerlich war. Überall öffnete er alles, was sich öffnen ließ: Instrumentenkästen, Schreibpulte, Anrichten, Büffets, Wandschränke, Teekisten, Standuhren. Er fertigte von jedem Raum eine Zeichnung im Notizbuch des Gärtners an. Manchmal tauchte der rot-grüne Vogel auf, flatterte über ihn hinweg und verschwand durch irgendeine Tür. Manchmal, wenn er hinter einer Tür ein neues Zimmer vermutete, verfrachtete ihn das Haus wieder in den Gang am Fuß der schmalen Treppe, an deren oberem Ende ein schwaches Licht glomm.
Aber irgendwann bemerkte Pantin eine Art Muster: Die verschiedenen Ein- oder Ausgänge, die er benutzte, führten zu anderen ähnlichen Ein- oder Ausgängen. Ging er durch eine verglaste Tür, kam er auch hinter einer verglasten Tür wieder heraus, trat also zum Beispiel vom Wintergarten in die Speisekammer. Zum Spielzimmer gelangte man jeweils durch mit Vorhängen abgedunkelte Türen, in die Eingangshalle durch die Haustür. Offene Torbögen führten zu anderen offenen Torbögen, sodass er von der Eingangshalle aus zu jedem Raum gehen konnte, der ebenfalls mindestens einen offenen, türlosen Eingang besaß. Schiebetüren brachten ihn ausschließlich in Räume mit anderen Schiebetüren – wobei «schieben» hier weit gefasst war, wie Pantin feststellen musste, als er das Musikzimmer durch eine gewöhnliche Schiebetür verließ und gleich darauf aus einem Speiseaufzug in ein Schlafzimmer in einem oberen Stockwerk purzelte, durch dessen Fenster man auf den Wintergarten hinunterblickte.
Dieses Schlafzimmer setzte ihn abermals im Erdgeschoss ab, als er versuchte, den Raum durch die Tür zu verlassen. Daraus schloss der Junge, dass es weniger darauf ankam, in welcher Etage er sich befand, sondern eher, durch welche Art von Tür er ging.
Neun von zehn Türen führten in Räume, die er dahinter nicht erwartet hatte. Der Handlungsreisende hatte gesagt, er bräuchte das Schlüsselloch eines Schrankes, aber vielleicht reichte auch das Schlüsselloch einer Tür? Doch keine der Türen innerhalb des Hauses schien überhaupt einen Schließmechanismus zu haben.
Pantin fiel noch etwas anderes auf. Wenn er an einer Tür lauschte, bevor er hindurchging, konnte er erraten, was für eine Art von Zimmer er erblicken würde. Der Salon mit den Uhren war am leichtesten zu erraten, aber er hatte den Verdacht, dass jedes Zimmer über eine Art eigene Stimme verfügte. Das hölzerne Knarren des Musikzimmers wurde hin und wieder von musikalischen Tönen begleitet, die irgendwie schräg klangen, als ob auch die Instrumente knarren würden. Im Wintergarten klapperten leise ein paar lose Glasscheiben. Die Schwingtür in der Küche gackste in den Scharnieren, wenn sie von einem Luftzug leicht bewegt wurde. Dank der Geräusche und weil er wusste, welche Art von Tür er vor sich hatte, war Pantin immer besser in der Lage vorherzusagen, welchen Raum er betreten würde, vorausgesetzt, er hatte ihn bereits kennengelernt.
Die Stimme des Hauses und seine Notizen halfen ihm, sich zurechtzufinden – oder zumindest ein Stück weit zu ahnen, wohin das Haus ihn als Nächstes bringen würde. Aber Pantin hatte kein Gefühl dafür, wie die Zeit an diesem Ort verging – er wusste nur, dass sie verging. Und allmählich wurde er müde und nervös. Und trotzdem hielten ihn die Merkwürdigkeiten, die das Haus hinter jeder Ecke für ihn parat hatte, wach und ließen ihn auf der Hut sein, während die Nacht voranschritt – was ein Glück war, denn überall konnten die unwahrscheinlichsten Ereignisse lauern.
In dem Salon mit den ausgestopften Tieren etwa fiel gerade in dem Moment, als Pantin die dunkel gebeizte Tür zum Waffenschrank öffnete, ein Tierkopf von der Wand, und nur die offene Schranktür rettete ihn davor, von dem gedrehten Horn einer Antilope durchbohrt zu werden. Im Musikzimmer riss eine Saite in dem Flügel, der mit offenem Deckel in der Mitte des Raumes stand; sie peitschte mit einem misstönenden Ploing durch die Luft und traf seinen Hals nur deshalb nicht, weil Pantin genau in dem Moment seine Laterne hob, um ein fremdartiges Blechinstrument zu betrachten, das auf einem Stuhl lehnte. Die Wucht, mit der die Saite auf den Metallrahmen der Laterne klatschte, war so heftig, dass eine der Glasscheiben einen Riss bekam.
Nur einmal sah er sich einem Möbelstück gegenüber, das sich nicht öffnen lassen wollte: ein Terrarium im Uhrenraum, das wie eine kleine Glaskirche aussah und in dem ein kleiner Porzellanhase mit einer weißen Halskrause inmitten einiger trauriger Pflanzen hockte, zwischen den Pfoten eine winzige Glaskugel. Als er merkte, dass er den Deckel nicht abnehmen konnte, holte Pantin das Terrarium vorsichtig von dem Kaminsims, auf dem es stand, und stellte es auf einen Couchtisch. Er tastete nach dem hellen Schlüssel in seinem Rucksack, aber es gab kein Schloss an dem kleinen, zierlichen Glasgefäß, nur einen rostigen Überwurfhaken am Deckel. Pantin nahm die Werkzeuge des Handlungsreisenden und schob vorsichtig einen kleinen Schraubenzieher zwischen Deckel und Haken, bis er merkte, dass die Klammer nachgab.
Er hob den Deckel und schaute in das Gefäß – er sah genau dieselbe Szene vor sich wie von außen durch das staubige Glas, allerdings konnte er jetzt erkennen, dass sich in der winzigen Glaskugel eine aus Haarsträhnen geflochtene Blume befand und dass die Pflanzen durch irgendeine Magie aus Glas und Feuchtigkeit tatsächlich lebendig waren. Er öffnete seine Trinkflasche und träufelte etwas Wasser auf die Erde am Boden des Terrariums, bevor er den Deckel wieder verschloss. Die Messingglocke in dem gläsernen Uhrenturm läutete einmal, als er die kleine Kirche wieder an ihren Platz stellte.
Kurz darauf fand Pantin den Kartenraum.
Er stand im Gang, hatte sich gerade zum gefühlt hundertsten Mal von der schmalen Treppe abgewandt und wollte eben aufs Neue hinaus in die Eingangshalle gehen. Der Raum hinter dem rechten Torbogen hatte sich wieder einmal verändert. Und dann sah er Licht in diesem Zimmer – obwohl er nicht wusste, woher es kam –, gerade so viel, dass es verführerisch über einen seltsamen Schrank streifte, in dem eine ganze Reihe unterschiedlich großer Schubladen steckte, und auf dem Rand einer gerahmten Karte an der Wand über einem Ledersessel glänzte, in dem man es sich für ein kurzes Nickerchen gemütlich machen konnte. Das Zimmer war verlockend. Das Licht zwinkerte ihm fast zu.
Er verließ den Gang und trat hinaus in die Eingangshalle – aber das Haus beförderte ihn wieder geradewegs in den Gang, als ob sich die Welt ringsherum einmal um 180 Grad gedreht hätte. Pantin wandte sich um und versuchte abermals, den Raum zu betreten – mit demselben Ergebnis. Unsicher hielt er sich an der Wand fest, ehe er einen erneuten Versuch startete, den Gang zu verlassen, aber in dem Moment, als sein Fuß über die Schwelle trat, drehte sich das Haus ein weiteres Mal. Aus irgendeinem Grund wollte es ihn in dem Zimmer mit dem Ledersessel und der Karte nicht haben.
Er versuchte noch eine ganze Weile, einen Weg hineinzufinden, trotz der Bemühungen des Hauses, ihm den Eintritt zu verweigern. Der Kartenraum hatte einen türlosen Eingang, also zog er seine Skizzen zu Rate und ging durch jeden offenen Torbogen, den er finden konnte, aber jedes Mal spuckte ihn das Haus wieder an der schmalen Treppe aus, an deren oberem Ende das Licht schien und deren Anblick ihn anfangs schwindelig gemacht hatte, weil sie eigentlich denselben Raum wie die prächtige Bogentreppe in der Eingangshalle einnahm.


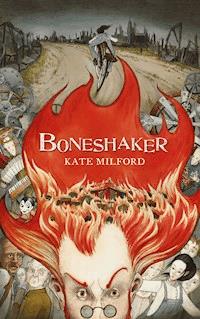













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












