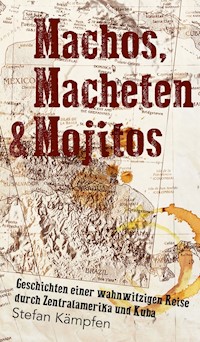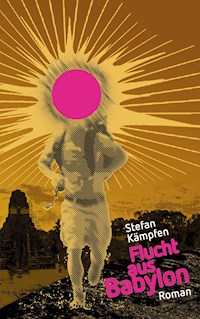
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der dreissigjährige Eddie Springer hat in seinem Leben noch nichts erreicht, ausser in möglichst viele Fettnäpfchen zu treten. Die einzige Konstante in seinem Leben ist sein Arbeitgeber, der ihm seit der Lehrzeit in regelmässigen Abständen kräftig in den Hintern tritt. Eines Morgens hat Eddie die glorreiche Idee, mit einem Weltrekord im Dauerfernsehen endlich durchzustarten. Aber statt Berühmtheit zu erlangen, wird er von seinem Chef auf die Strasse gesetzt. Zusammen mit »Puppe«, seiner besseren Hälfte, entschliesst Eddie sich daraufhin zu einer Weltreise, auf der er Kraft für ein neues, besseres Leben schöpfen will. Sie starten in Mexiko und finden sich in einer surrealen Welt wieder, die mit verqueren Desperados, korrupten Gesetzeshütern und gruseligen Hotels nur so gespickt ist. Das alles wäre ja noch recht amüsant, doch dann wird Eddie plötzlich ernsthaft krank...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Kämpfen wurde 1976 in Luzern, Schweiz, geboren. Schon als Kind fiel ihm auf, dass man nicht nur mit Spielsachen, sondern auch mit Sprache experimentieren kann. Fortan nützte er jede freie Minute, um sein Umfeld mit Berichten über Stars und Sternchen aus der Welt des Sports in selbst gebastelten Magazinen zu unterhalten. Geprägt wurde er vom Verschlingen Dutzender Jugendkrimis, die ihn motivierten, bereits früh selbst kriminalistische Kurzgeschichten zu schreiben. Auch als Erwachsener blieb er seiner Liebe zur Sprache treu, ließ sich in Deutschland mit Bestnote zum Werbetexter ausbilden und schreibt als Journalist für eine renommierte Schweizer Wochenzeitung. Wenn er nicht gerade an Texten feilt, erkundet der passionierte Globetrotter fremde Länder und Kulturen. Die gemachten Erfahrungen in mittlerweile fast 60 besuchten Staaten nehmen auch in seinen Geschichten eine gewichtige Rolle ein.
Mehr über den Autor und seine Bücher:
www.stefan-kaempfen.jimdo.com
Für:
Gabriella, Sergio, Theo (†)
Inhalt
Prolog
The Rocky Horror Picture Show
La Cucaracha
Eier legende Wollmilchsau
Der Spießrutenlauf
Kultur, Kaffee und K.o.
Der doppelte Kater
Weltrekordversuch
Die Rückkehr eines Teufels
Der ganz normale Wahnsinn
Viele, viele bunte Smarties …
Nur Fliegen ist schöner …!
Von Koks und Kalaschnikows
Don Quijote versus Fata Morgana
Mulegé
Walgesänge
Grenzgänger
Hotel California
Ein folgenschwerer Abstecher
Danksagung
It’s a long road out of Eden
Die verhängnisvollsten Wochen meines Lebens
Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.
– Rainer Maria Rilke –
Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere
Pläne zu machen.
– John Lennon –
Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das
Wunderbare zu sehen.
– Pearl S. Buck –
Prolog
Den einzig klaren Gedanken, den ich noch fassen kann, während mich mehrere kräftige Hände in ein wartendes Taxi bugsieren, gilt der Hoffnung, nicht in dieser scheußlichen Kloakenstadt zu sterben. Mein Organismus versucht, die kaum erträglichen Schmerzen mit eiligst ins System gestreuten Endorphin-Bomben zu vernebeln - leider ohne Erfolg.
Mein Magen fühlt sich an, als hätte ich ein riesengroßes Wollknäuel mit Tausend kleinen Nadeln geschluckt, die sich jetzt über die Blutbahnen im gesamten Körper verteilen. Ich fühle das brodelnde, pulsierende Epizentrum gleich hinter meinem Bauchnabel, das in den nächsten Minuten zu explodieren droht. Im Geiste wiederhole ich ein stummes Gebet, während der in den Reggae-Farben Rot, Gold und Grün gehaltene Busbahnhof von Belize City aus meinem Blickfeld verschwindet.
Das Taxi rumpelt an offenen Abwasserkanälen vorbei, direkt ins Herz des dunklen Sündenpfuhls, dessen Fassadenkonturen sich alles andere als verheißungsvoll in den nächtlichen Himmel erheben. Mein Schicksal liegt einzig und allein in den fürsorglichen Fingern von Julia, die sich vom Taxifahrer aus El Salvador ein günstiges, zentral gelegenes Hotel aufschwatzen lässt. Obwohl sich das vorgeschlagene Objekt mit dem Namen Downtown als übler Bretterverschlag entpuppt und stark an einen abgetakelten, alten Puff erinnert, nehmen wir das Angebot dankend an.
Schließlich haben wir keine Zeit zu verlieren: Ein Menschenleben steht auf dem Spiel! Mit keuchendem, schwerem Atem erklimme ich die ersten Stufen einer eierschalenfarbenen Holzveranda, die mit allerhand unästhetischen Eisenrohren und Wellglas bestückt ist. Ich bekunde größte Mühe, den sich scheinbar in tiefster Narkose befindenden Hund und die überall aufgestellten Vasen mit den überquellenden, fleischigen, giftgrünen Blättern zu überwinden.
Das Glockenspiel an der federleichten Eingangstüre scheucht eine gebürtige Chinesin, die sich uns als Miss Kenny vorstellt und die als eine Art Concierge fungiert, aus dem benachbarten Lebensmittelladen. Sie erkennt meine prekäre Situation sofort und nimmt mir den bleischweren, mit dunklen Schweißflecken gesprenkelten Rucksack ab, den ich vorher mit lautem Getöse hinter mir über die Veranda gezogen habe.
»Sie haben Glück, wil haben noch zwei Zimmel flei.« Mit einem Nicken ihres mondrunden Kopfes deutet sie uns an, die beiden Räume zu begutachten, die sich gleich zu Beginn eines langen Ganges gegenüberstehen. Das Zimmer zu unserer Linken ist ein dunkles Kabäuschen, das einem muffigen Kellerverlies ähnelt. Die etwa hundezwingergroße Kammer wird von einem roh gezimmerten, in die Höhe gebauten Doppelbett dominiert. Der Gang in der Breite eines Fahrradlenkers bietet gerade mal genug Platz, um uns beide und unsere Rucksäcke unterzubringen.
Das zweite Zimmer in Form eines Quadrats erfreut die desillusionierten Betrachter mit einer vernarbten Holzkommode, einem windschiefen Stuhl und einem breiten Bettrahmen ohne Matratze. Der Lattenrost beherbergt zwei ganze und eine gebrochene Leiste. Miss Kenny bemerkt unsere fassungslosen Blicke und versichert beflissen, sofort eine bequeme Matratze sowie das dazugehörende Bettzeug zu organisieren, sollten wir die Güte haben, uns für dieses Kleinod zu entscheiden. Wenig später liege ich, alle viere von mir gestreckt, auf dem neu arrangierten Bett wie eine aufgebahrte Leiche auf einem Katafalk. Die individuell gestaltete Pritsche mussten wir selber beziehen.
Die restliche Energie, die meinen verschwitzten, von Krämpfen heimgesuchten Körper durchströmt, brauche ich, um mit dem Schicksal zu hadern, das mir in der Stunde der Agonie einen solch unwürdigen Ort zum Sterben bereithält. Derweil versucht Julia mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die ominöse Krankheit, die mich so unvermittelt und heftig wie ein ausgerückter Bienenschwarm überfallen hat, in den Griff zu kriegen. Doch Aspirin, Wadenwickel und gutes Zureden helfen nicht weiter.
»Was hast du dir da nur eingefangen?«, murmelt sie in sich hinein. »Ist das die viel zitierte Rache des Montezuma?« Ich kann nicht antworten, da sich in diesem Moment ätzende, übel riechende Magensäfte daran machen, meine Speiseröhre zu fluten. Mit zittrigen Händen halte ich mir den Mund zu, um nicht zu einem menschgewordenen, orgiastisch spritzenden Springbrunnen zu mutieren.
Verzweifelt versuche ich, das zittrige Bündel, das einst ein gesunder Körper war, in die Senkrechte zu bringen, was mir nur mithilfe Julias kräftiger Arme gelingt. Ein paar Sekunden lang bleibe ich wie ein neugeborenes Fohlen auf meinen stelzenartigen Beinen stehen und setze mich dann mit der Geschmeidigkeit eines Marionetten-Pinocchios in Bewegung.
»Warte! Ich komm mit!«, ruft mir Julia hinterher, doch ich stolpere bereits wie ein wahnwitziger Nachtwandler durch den Flur und lehne meinen sackartigen Körper an die Tür der nahegelegenen Toilette. Ein ungefiltertes Duftgemisch aus Chlor, Industriereiniger und Pisse kreucht meine Nasenwände empor, was eindeutig inkontinenzfördernd ist. Mit einem lauten Schwall erbreche ich die scheußliche Bakterienbrühe in die Kloschüssel. Aus den Augenwinkeln erspähe ich eine daumengroße Kakerlake, die sich angesichts dieses bestialischen Gestanks in einen kleinen Spalt in der Täfelung verzieht.
In diesem Moment wünsche ich mir, mich in eine solche Schabe verwandeln zu können, denn die sind so robust, dass sie schon seit über 300 Millionen Jahren existieren und sogar Atombombentests überleben. Wenn das mit mir in diesem Stil weiterging, würde ich mich bald aus der Vogelperspektive im Bad stehen sehen, so gekrümmt und hässlich wie Gollum aus Herr der Ringe, und mich entweder vor lauter Schreck oder vor lauter Lachen gleich selbst ins Jenseits befördern. Die letzten 24 Stunden haben mich um Jahrzehnte altern lassen: Zurück in unserem Kämmerchen muss Julia mir wie einem Greis in die Schlafklamotten helfen.
Du bist noch zu jung für den Sterbeflanell, höhnt eine Stimme in meinem Kopf. Da das Erbrechen keine fühlbare Linderung gebracht hat, versuche ich, unter den besorgten Augen Julias, der vertrackten Situation mit einer von mir selbst verschriebenen Lese- und Schlaftherapie zu entkommen. Doch der Frieden ist nur von kurzer Dauer. Just in dieser Nacht beschließen die sonst nicht gerade an Arbeitswut leidenden Straßenarbeiter von Belize City, zwei Blocks weiter einen neuen Abschnitt der Hauptstraße mit ihren Teerwalzen und Bulldozern zu bearbeiten. Kurz nach 1 Uhr verstummen die Maschinen und was übrig bleibt, sind Einschlafschwierigkeiten und rote Kissenabdrücke an den Ohren.
Später in der Nacht rotten sich ganze Horden von Straßenkötern hinter unserem Gebäude zusammen und bellen sich die Hundeseele aus ihrem Leib. Die traumatische Bellorgie dauert bis in die frühen Morgenstunden und wird bei aufgehender Sonne von der Kakofonie schreiender Kinder in Schuluniform abgelöst, die sich mit brachialer Gewalt Zugang zur nahegelegenen Schule verschaffen. Tiefe, dunkle Augenringe haben sich in der Nacht um meine andauernd schreckgeweiteten Augen gebildet. Unfähig, mich zu bewegen und zu müde um einzuschlafen, starre ich gedankenleer einem neuen albtraumhaften Tag entgegen.
The Rocky Horror Picture Show
Auf unserem Planeten scheint die totale Langeweile ausgebrochen zu sein: überall grauer Alltagstrott und ewiges Spießertum. Zumindest haucht das gerade die Mittagsmoderatorin mit ihrer erotischen Stimme aus meinem roten zerbeulten Transistor-Radio in mein Ohr. Der Leiter der russischen Gesundheitsbehörde rät seinen trinkfreudigen Landsleuten, während der gesetzlichen Ferien nicht im Übermaß dem Alkohol zu frönen, da jenes Lieblingshobby der Zaren aus dem fernen Osten jedes Jahr 80 000 Todesopfer fordert.
Bei über 2 Millionen Alkoholkranken scheint hier der Wunsch Vater des Gedankens zu sein. Ein verschärfter Wodka-Entzug ist für einen hundsnormalen Russen ungefähr vergleichbar mit den Leiden eines Italieners, der gezwungen ist, auf seine geliebte Pasta zu verzichten - undenkbar! Wie auch immer, heute überschlagen sich die spannenden Räubergeschichten. Thema des Tages: die Schlafprobleme des Otto Normalverbrauchers. Frage des Tages: Ist Schnarchen wirklich gefährlich? Vor lauter Enthusiasmus ringe ich mir ein müdes Gähnen ab. Nicht die üblichen Nachrichten von zerstörerischen Verschiebungen der Kontinentalplatten, die verheerende Erdbeben in Indonesien auslösen, von Tsunamis, die über Sri Lanka rollen, von Ausbrüchen isländischer Vulkane, deren Namen kein vernünftiger Mensch aussprechen kann, kein Erdrutsch in Guatemala, keine Drogentoten in Kolumbien, keine Ölpest im Golf von Mexiko. Ja, sogar zwischen den Israelis und den Palästinensern wurde ausnahmsweise kein Geschirr zerschlagen.
Was ist nur los mit der Menschheit? Nicht mal einen Tunneldurchschlag haben die zu verzeichnen, obwohl das in letzter Zeit geradezu in Mode gekommen ist. Es müssen ja nicht gleich fünfzig Minenarbeiter verschüttet und wieder gerettet werden, aber an die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Mineure, habe ich mich mittlerweile gewöhnt.
Da kommen sie aus ihren dunklen Löchern gekrochen, die Heinzelmännchen der Unterwelt, die Maulwürfe der Finsternis, und werden für ein paar Minuten zu Stars über Tage. Während sie sich den Mörtelstaub von ihren gepeinigten Schultern schlagen, leuchten ihre Goldzähne im Blitzlichtgewitter der wartenden Journalistenbrut. Für diesen einen Moment der Aufmerksamkeit haben sie jahrelang, manchmal sogar jahrzehntelang im Granitfelsen gescharrt. Respekt! Inzwischen ist die Moderatorin bei der obligaten Quizfrage angelangt, die da lautet: »Welches europäische Land hat die höchste Rücklaufquote bei Glasverpackungen?« Interessant! Antwort: »Dänemark.« Aha, wieder was Essenzielles gelernt heute.
Ich warte darauf, dass die Nachrichtenredaktion mich noch mit weiteren Bombenmeldungen im Mark erschüttert, wie zum Beispiel diese, dass sich der Bundespräsident heute beim Rasieren beinahe in die Backe geschnitten hat. Stattdessen ertönt die audiotechnische Unterstreichung dieses faden Tages mit entsprechender Musik: Madonna trällert ihr Frozen genauso lustlos über den Äther wie wenig später Céline Dion ihren Titanic-Song.
Musik ist das Spiegelbild der Gesellschaft, deshalb spielen sie auf den gängigen Radiokanälen nur noch dieses für alle Ohren bestimmte, für alle Altersklassen taugliche, absolut einfältige und gleich tönende 08/15-Einheitsgedudel, das zum Ziel hat, die Hörnerven des mündigen Bürgers abzustumpfen und ihn für die wirklich guten Klänge unempfindlich zu machen. Die auf Geldmache ausgerichtete Gehirnwäsche scheint bei den meisten zu funktionieren.
Doch nicht mit mir! Zum Trotz stelle ich auf den hiesigen Jugendkanal um, der – von den brüchigen Mädchen- und Bubenstimmen einmal abgesehen – meist eine willkommene Abwechslung bietet. Ich werde auch heute nicht enttäuscht, denn eben hat das vierzehnjährige Mädchen mit piepsiger Stimme erklärt, dass wir unserem vermutlich letzten Sommer-Wochenende entgegensteuern. Heute sollen es noch einmal knackige 32 Grad werden, bevor der Herbst sein bleiernes graues Nebelkleid über die Landschaft hüllt.
Aber wann hatten wir eigentlich in diesem Zwergenland hinter den sieben Bergen den letzten Sommer? War es an einem Dienstag? Normalerweise herrscht in unseren Breitengraden zehn Monate lang ein Klima zwischen leichtem Nieselregen und Dauerfrost. In den verbleibenden zwei Monaten versucht der Sommer mit mäßigem Erfolg die Schneeschmelze voranzutreiben. Also mache ich heute das, was alle meine Landsleute an sonnigen Tagen wie diesem tun: ab ins Schwimm- oder Seebad!
–
Der für mich eigentlich geltende Vorsatz, an sonnigen Sommertagen auf keinen Fall motorisiert irgendwohin zu fahren, entpuppt sich spätestens jetzt als böse Vorahnung. Die spärlichen Parkplätze rund um das Strandbad Seerose sind zum Bersten voll. Nicht mal ein Bierdeckel hätte rund um das schmucke Anwesen Platz. Auch der kleine Parkplatz mit den gierigen Parkuhren in der Nähe ist total ausgebucht.
Die Sonnenanbeter und Wärmefanatiker kommen wie die Eidechsen alle gleichzeitig aus ihren Löchern. Vorbei an Joggern, Rollerbladern, Fahrradfahrern, Spaziergängern und leicht bekleideten Jugendlichen dränge ich meinen schwarzen Mazda auf einen kleinen asphaltierten Fleck zwischen Fahrrad- und Motorradparkzone. Die gelbe Parkverbotslinie ignoriere ich. Vielleicht habe ich ja einmal Glück, und die raffgierigen Polizisten verschonen mich mit dem Knöllchen zur Aufbesserung der Steuererträge.
Man wird in unserem Land das Gefühl nie ganz los, dass der uniformierte Freund und Helfer lieber im ertragsreichen Bußgeldsegment operiert, statt sich die Finger beim Aufdecken von Drogenkartellen, beim Zerschlagen von Waffenringen oder beim Kampf gegen die zunehmende Gewalt auf den Straßen zu verbrennen. Und das, obwohl die Polizei eigentlich bei der Umsetzung des jährlich festgelegten Mindestbetrags an Bußen sehr gut von ihren Radarfallen unterstützt wird, die dekorativ all jene Fahrbahnen zieren, die mindestens die Größe eines einspurigen Feldweges haben.
Aber jetzt nochmals nach Hause fahren und das Ganze in dieser Affenhitze mit dem Fahrrad wiederholen?
Und das mit meinen Plattfüßen und Hühneraugen? Nein, danke! Meine düsteren Gedanken verfliegen sofort, als ich durch die hölzerne Eingangspforte des Seebads schlendere. Wie immer lasse ich mir dabei Zeit und warte den richtigen Moment ab, um mich an der Kasse vorbeizuschleichen.
Eine kurze Unachtsamkeit der neu angestellten Thailänderin genügt, und schon bin ich links an ihr vorbeigehuscht und in Richtung Damenumkleidekabinen unterwegs. Der asphaltierte Weg ist mit beigen Leintüchern abgedeckt und bietet damit perfekten Sichtschutz. Diese ausgeklügelte Eintrittsstrategie habe ich mir an einem lauen Sommernachmittag eigens für die Seerose ausgedacht. Nicht, dass ich den Betreibern den kleinen Obolus nicht gönne, aber man sollte in der heutigen Zeit auf seinen Geldbeutel achten. Schließlich wetze ich die finanzielle Scharte mit meiner omnipräsenten Anwesenheit im Strandbad und mit meinem vorbildlichen Konsumverhalten an der gegenüberliegenden Bar wieder aus.
Ich platziere mich, strategisch geschickt, auf der plattgetretenen Wiese nahe des Mäuerchens, das den Durchgang zur großen Wiese flankiert. Hier habe ich den optimalen Überblick für meine Lieblingsbeschäftigung während der brütend heißen Sommertage, nämlich das Leutebeobachten. Überhaupt liebe ich dieses Old-School-Strandbad mit dem immer etwas muffig riechenden Seemannshaus aus altem, verschimmeltem Holz, das ein kleines Restaurant und eine große Terrasse beherbergt.
Auf der anderen Seite des Hauptgebäudes steht die kleine Bar mit dem wohlklingenden Namen La Cucaracha, auf deren sandigem Untergrund ein verfilzter Billardtisch und die dazu passenden Tische und Korbstühle stehen. Ihr Anblick erinnert mich immer ein wenig an Ferien am Meer. Besonders bei einem kühlen Blonden an der Minitheke – einem umgebauten Schiffsbug – und den dazu passenden Klängen von Jack Johnson oder Bob Marley beschleicht mich immer ein sentimentales Fernweh-Feeling.
Das Beste an der Seerose ist allerdings das gänzliche Fehlen von kinderfreundlichen Rutschbahnen und Sprungtürmen. Als einziges Extra schwimmt ein von Taubenscheiße übersätes Rundfloß im Wasser. Das bedeutet: kein Schulklassen-Mob, kaum herumschreiende Jugendliche und vor allem keine hyperventilierenden Eltern. Nein!
Wer die Seerose anvisiert, will vor allem eins: Ruhe. Es sind zu einem großen Teil nervlich Gebeutelte, an den Rand Gedrängte, unkonventionelle Lebenskünstler, Andersartige, philosophische Proleten und ruhelose Sinnsucher dieses Lebens, die hier ihresgleichen suchen. Genau das mag ich so an diesem Überbleibsel vergangener Tage, der letzten Bastion der Kreativen, die so gar nicht in das von sesselpupsenden Theoretikern entworfene Weltbild des Aalglatten, Sterilen und immer Gleichen passt, das jederzeit von jedermann ersetzt werden kann!
–
Ich beginne mit dem Studium der Badegäste und ihrer Sitzgewohnheiten. Zu den schlausten Taktikern zählen die Senioren, die mit ihren bunten, viel zu eng sitzenden Einteilern und ihren schwabbeligen Gliedmaßen gleich scharenweise einkehren. Sie können sich die mühselige Suche nach ihrem Wohlfühlplatz an der Sonne schenken, da sie ihre orangenhautüberzogenen Hinterteile sowieso seit Jahrzehnten immer am gleichen Ort absetzen. Oftmals sichern sie sich ihre Lieblingsplätzchen bereits dann, wenn noch morgendlicher Tau auf der Wiese liegt und der erste Hahn seinen Blues in die Welt hinausträgt.
Sie breiten stapelweise Klatschmagazine und Zeitungen auf der Fläche eines Flugzeugträgers aus und stellen behände einen Wall von überdimensionierten Klappsesseln und Liegestühlen auf, der sie vor dem gemeinen Fußvolk schützen soll.
Schnell ist auch ein bedauernswerter Trottel gefunden, der für sie den tonnenschweren Betonsockel für den Sonnenschirm in bester Lage platziert. Es wird so lange emsig parliert und schwadroniert, bis sich neue Gäste einfinden. In erstaunlicher Geschwindigkeit fallen sie dann, wie auf ein geheimes Zeichen hin, beinahe synchron in einen scheinbaren Tiefschlaf und ließen sich auch dann nicht stören, wenn die Erde auseinanderklaffen oder ein Feuerblizzard ausbrechen würde. Da haben es die zwanghaft Unzufriedenen bedeutend schwerer. Zuerst wird meist aus einer versteckten Ecke, die nur von einer Seite aus zugänglich ist, die Gesamtlage des Rasens gepeilt.
Wie Radarsonden vermessen ihre Augen das Gebiet Zentimeter für Zentimeter, um sich dann mit dem Partner über die geeignete Sitzfläche zu beraten.
Wichtige Koordinaten sind Sonnenlaufbahn, Baumlagen, Boden ebenheit, Müllvorkommen, Alter und Essverhalten der Badegäste, Anzahl Enten- und Schwanenfedern pro Quadratmeter sowie Windstärke und Windrichtung. Nachdem sie sich dann geeinigt haben, beginnen sie sich wie in Trance und möglichst unauffällig in Bewegung zu setzen. Die lästigen Mitstreiter immer aus den Augenwinkeln beobachtend legen sie die letzten Meter zum anvisierten Platz förmlich im Stechschritt zurück.
Kaum ist ihr Überlebenscamp mit dem extragroßen Beduinenzelt aufgestellt, grübelt es weiter in ihren sonnengegerbten Köpfchen: Haben wir vorher die laute Gruppe rauchender Jugendlicher übersehen? Weshalb lächelt die schrullige Nachbarin in ihrem aufgemotzten Liegestuhl so dümmlich? Muss der asoziale Typ mit der überweiten Badehose genau an meinem Kopfende seine behaarten Käseflossen in mein Gesicht strecken? Kann die überdrehte Tussi unter dem Baum nicht NOCH lauter telefonieren?
Ich schaue auf meine versilberte Supermarktuhr: Es ist bereits 16.15 Uhr. Die Sonne verliert allmählich ihre unbarmherzig stechende Kraft. Die Farben werden voller und weicher und das Licht legt sich wie ein goldener Schleier über die frühabendliche Landschaft. Ich lehne im Schneidersitz am Steinmäuerchen und lasse die sättigenden Eindrücke auf mich wirken.
Die Sonnenstrahlen streicheln die Wasseroberfläche und es scheint, als würden Milliarden von Diamanten auf dem Grund des Sees funkeln. Ich liebe diese Stimmung an Spätsommertagen. Wenn die Schatten länger werden, die Grillen zirpend den angehenden Abend einläuten und alles in scherenschnittartigen Mustern leuchtet, fühle ich mich eins mit der Natur.
In solchen Momenten weiß ich, dass es im Leben mehr als nur Brot und Käse gibt, und ich liebe das befreiende Gefühl, mich hier nicht vor anderen verstellen zu müssen: kein Gruppenzwang, keine Erwartungshaltung an mich selbst oder an andere.
Ein eingeölter Waschbrettbauch, ein abgeschlossenes Abitur und eine Samtbadehose von Gucci erregen hier genauso wenig öffentliches Interesse wie ein Buckel und Klumpfüße, gepaart mit einem doppelten Rittberger vom alten hölzernen Steg ins Wasser. Scheinbares Desinteresse und Teilnahmslosigkeit bilden die eigentliche Leichtigkeit des Seins: kein »sehen und gesehen werden«, kein Abschleppzirkus, keine plumpen Anmachsprüche und kein Wett-Rekeln an der Sonne, keine schlecht geratenen Kopien von David Hasselhoff und Pamela Andersson, die eingepfercht in knallengen Badeklamotten und in Super Slow Motion ein um Hilfe schreiendes Kind aus den Fluten retten.
Hier sieht man mehr Schweißfüße, Leberflecken, Bierbäuche und Speckrollen als einem lieb ist. Und niemand stört sich daran. Auffallend ist einzig die Unterschiedlichkeit zwischen den Generationen bezüglich Bademode und Körperbehaarung.
Der an mir vorbeistolzierende alte Mann – ein kapitaler Silberrücken – bietet ein hervorragendes Beispiel, um meinen Gedanken weiterzuspinnen. Die älteren Herren, aufgewachsen in der James-Bond-Generation, die Sean Connery oder Roger Moore zum Vorbild hatten, sind ausnahmslos stark behaart. Gewöhnlich tragen sie ihr Fell in einer Art Dauerwelle als Ganzkörperbehaarung gleichwohl auf Bauch und Rücken.
Die Haarfarbe (in der Regel ein Ton irgendwo zwischen Spanferkelblond und Aschgrau) spielt dabei eine ebenso untergeordnete Rolle wie der Grad der Kräuselung - Hauptsache, es IST gekräuselt. Schließlich wird damit das verlorene Haupthaar ersetzt. Da man die in früheren Zeiten trainierten Muskeln nur noch anhand der Fettkonturen erahnen kann, wird die zweifellos vorhandene männliche Eitelkeit mit einem dunkelbraunen Teint, einer fingerdicken Goldkette und einem String-Tanga, meist in der Farbe Rot und in der Größe eines Feigenblatts, bedient. Dabei dient das Vorzeigeobjekt Oberkörper als tragendes Element. Die zum Oberkörper unzureichend proportionierten kleinen, krummen Beinchen sind nur zur Fortbewegung gedacht und eignen sich höchstens bei geschwollenen Gichtknien als Gesprächsstoff. Was ältere Damen den vierten Frühling spüren lässt, löst bei jüngeren Semestern höchstens eine Gänsehaut aus. Die jungen Girls von heute stehen auf absolut reine, babyzarte und unbehaarte Haut - egal in welcher Körperregion.
Da kann schon der Hauch eines allmählich bahnbrechenden Flaumes auf der Oberlippe oder der Hühnerbrust eine Grundsatzdiskussion auslösen. Nicht selten werden dabei Langzeitbeziehungen von zwei bis drei Wochen unvermittelt und mitleidlos gekündigt. Ganz eklig finden die weiblichen Kids Achselbehaarung, einen haarigen Hintern oder einen kleinen Haarkranz um die Brustwarzen.
Liebe Jungmänner, lasst euch gesagt sein: Wenn ihr eines oder gleich mehrere dieser Merkmale vorzuzeigen habt, dann greift unmittelbar zum Kaltwachs oder lasst euch in ein Kloster einweisen!
–
Stunden später erwache ich spastisch zuckend und mit den Füßen strampelnd aus dem Tiefschlaf. Benommen schaue ich mich um und versuche das grelle Licht der Abendsonne wegzublinzeln. Ich sehe einen Himmel, der sich langsam von Azur- in Kobaltblau verwandelt. Es weht mir ein unfassbar ätzender, beißender Geruch um die Nasenflügel, der so penetrant stinkt wie die ausgeweideten Überreste eines seit Wochen dahinsiechenden Kadavers.
Der leere Schluckreflex geht in ein Würgen über. Nach einer Weile haben sich meine Geruchssensoren eingestellt und die Geschmacksknospen melden ein eindeutiges Resultat: menschliche Ausscheidungen. Es riecht jedoch nicht etwa nach diesen langen, dicken Würsten, die sich tagsüber langsam im Darm entwickeln und sich dann zu erstaunlicher Größe hochgären. Nein! Es riecht nach fiesem, feuchtem, hochprozentigem Stuhl, der unter Hochdruck in mehreren heftigen Stößen abgefeuert wurde: die berüchtigte Sprinklerfontäne!
Langsam drehe ich meinen Kopf gegen die Windrichtung zum Pool der negativen Gerüche. Seelenruhig reinigt eine junge Mutter mit Kopftuch den Allerwertesten ihres Babys und wickelt es neu.
Da verbieten sie Hundehaltern aus Hygienegründen den Zutritt ihrer Vierbeiner ins Seebad, aber diese Nasenfolter darf öffentlich an mir begangen werden! Ich überlege, ob ich mich bei der unverfrorenen Lady lauthals beschweren soll, lasse es dann aber doch sein.
Stattdessen trotze ich den heftigen Gerüchen und harre in derselben Position, während ich gleichzeitig versuche, einen möglichst entspannten Eindruck zu machen. In einem Reisemagazin habe ich kürzlich den Bericht einer kalifornischen Esoterikerin gelesen, die empfiehlt, bei Stress und seelischer Unruhe einen Baum zu umarmen. Ich entscheide mich aber in dem Moment für Ablenkung in Form eines Spiels auf meinem iPod.
Eine Runde Trivial Pursuit ist jetzt genau das Richtige für mein empfindliches Nervenkostüm.
Die erste Frage in der Kategorie Wissenschaft und Technik lautet: »Besteht das Horn eines Nashorns aus a) Haaren, b) Knochen oder c) Knorpel?« Falsche Antwort, nächste Frage: »Welche Farbe hat das Ei eines Emus?« Antwortmöglichkeiten: »a) Rot, b) Weiß oder c) Blau.« Langsam beginnt ganz tief in mir drin ein kleines Wutsüppchen zu köcheln.
Ich schmeiße den iPod in die Wiese. Haben die echt keine besseren Fragen mehr auf Lager?
Wie wäre es zum Beispiel mit der hier: »Welcher Gegenstand eignet sich am besten zum Stopfen eines menschlichen Anus? a) ein Korken, b) ein zusammengeknülltes Papiertaschentuch, c) eine kleine Duftspraypatrone.«
Lautes, nervöses Zeitungsrascheln unterbricht meine Gedanken und lenkt meine Neugierde in die entgegengesetzte Richtung zu einem vormals freien Platz zu meiner Linken. Ich lasse den neuen Beobachtungsprobanden in Ruhe ankommen und feure meinen unvergleichlichen Superman-Röntgenblick auf ihn hernieder. Seine Bewegungen haben beinahe etwas Traumatisches, so als täten ihm alle Muskeln weh.
Mit der Andacht und der Geschwindigkeit eines Faultieres rollt er sein plüschiges Badetuch neben mir aus.
In einer einzigen fließenden Bewegung klappt er seine Beine nach hinten, um sich wie ein fußlahmes Wüstenkamel zusammenzufalten; ein Mann wie ein zusammenbrechendes Kartenhaus. Sein düsteres Äußeres stimmt nicht gerade positiv. Mit seiner Hakennase und dem rabenschwarzen Haar, das in der Nachmittagssonne bläulich schimmert, sieht er aus wie Hexenmeister Gargamel von den Schlümpfen.
Es fehlt nur noch, dass er Kater Azraël aus seiner Baseballkappe zaubert! Statt ihn mit unflätigen Bemerkungen zu traktieren und ihn mit Schimpf und Schande aus meinem Gesichtsfeld zu vertreiben, erhasche ich kurz die Überschriften auf der Titelseite seiner Tageszeitung. Heute findet das Fußball-Länderspiel Schweiz gegen England statt. Das ist also der Grund für den ungemein großen Menschenauflauf. Ich beschließe spontan, mir das Spiel heute Abend im La Cucaracha anzuschauen.
La Cucaracha
La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar
Mit großen Schritten hechte ich durch den kühlen, finsteren Verbindungsgang in Richtung des ohrenbetäubenden Lärmpegels, der von den sich überschlagenden Reporterstimmen stammt, die sich gegenseitig zu übertönen versuchen. Vielleicht ist mir Fortuna einmal gnädig gestimmt und schenkt mir einen freien Platz direkt vor der Leinwand und den Zapfhähnen. Doch als ich mich der Türschwelle zur kleinen Bar nähere, zerplatzt meine Hoffnung jäh wie eine Seifenblase: Alles zum Bersten voll, die hinterste und letzte Sitzmöglichkeit bereits vergeben.
Die einzige Chance auf einen vernünftigen Platz ist meine Freundin Julia, die ihr Erscheinen telefonisch angekündigt hat, obwohl sie normalerweise Sportübertragungen im Allgemeinen und Fußballspielen im Speziellen abtrünnig den Rücken zukehrt.
Die Barbetreiber haben ganze Arbeit geleistet: Der kleine betonierte Platz rund um den Tresen und die Barhocker wurden seitlich mit Plastikplanen abgedeckt, damit die Sicht auf die Leinwand und die beiden Breitbildfernseher nicht durch einfallendes Licht eingeschränkt wird. Im hinteren Bereich wurde in Windeseile eine primitive dreistufige Holztribüne aufgebaut.
Normalerweise liegt da der große Sandkasten für Erwachsene und solche, die es gerne werden wollen. Es wird geschnattert, was das Zeug hält. Überall gut gelaunte, braun gebrannte, mehrheitlich junge Menschen, die sich gegenseitig an Lautstärke übertrumpfen wollen. Wirbelnde Hände, schwitzende Gesichter, schmatzende Flip-Flops, Stuhlgeschiebe, klirrende Gläser und die ersten bierseligen Sprüche.
Das Ganze eingehüllt in die bei solchen Anlässen üblichen Gerüche von abgestandenem Bier, getrockneter Sonnencreme, Essensresten, Zigarettenrauch, Achselhöhlen– und Fußschweiß, ranzigem Frittier-Öl und einigen undefinierbaren Gerüchen, über die ich nicht allzu detailliert nachdenken möchte.
Langsam lasse ich den Blick in einer 180-Grad-Drehung über die verschwitzten Köpfe schweifen und erblicke eine kleine gnomenhafte Gestalt, die wie ein boshafter Zwerg ungeduldig mit den Armen rudert.
Es ist Julia, die sich mitten in der Masse platziert hat und offenbar nur unter größter Anstrengung und mit hochrotem Kopf das lächerliche freie Plätzchen neben sich gegen die Eroberungsversuche ungehobelter Rohlinge verteidigen kann. Gerade verscheucht sie eine weitere von stumpfsinnigen Fleischbergen vorgetragene Angriffswelle, als sich unsere Blicke treffen.
Ich meine auf ihren Lippen den tonlosen Satz: »Schieb endlich deinen lahmen Hintern hierher.« oder dergleichen gelesen zu haben und forme mit meinem Mund den ebenfalls lautlosen Satz: »Ich hole uns nur schnell was zu trinken.« Daraufhin zieht Julia die für sie charakteristische Schnute, die ihre vollen Lippen zur Geltung bringt. Das und ihre großen, gütigen Augen, die wie Rosinen im Kopf eines Teigmännchens aussehen, verleihen ihrem Äußeren insgesamt etwas Kindlich-verspieltes, Jugendlich-wildes und Koboldhaftes.
Mit ihrem elfenhaft feinen Körper sieht sie aus wie ein bereits erwachsener Däumling, der sich aber behände durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens kämpft.
Nicht zuletzt verdankt sie ihre Robustheit den beiden erstaunlich kräftigen Armen, die ihren schlanken Oberkörper flankieren und als eine Art Ganzkörperpendel fungieren, um ihrem grazilen Wesen mehr Standhaftigkeit zu verleihen. Es war gar nicht so einfach, dem Gesamtkunstwerk einen passenden Kosenamen abzuringen, der nicht allzu profan daherkommt. Schließlich hat sich bei mir seit einigen Jahren »Puppe« als gerechtfertigtes Kosewort eingebürgert, das sich mittlerweile auch im nahen Umfeld immer größerer Beliebtheit erfreut.
Ich reihe mich beim kleinen Seiteneingang neben dem Tresen in die Schlange. Die Theke ist das Reich der stahlharten Uschi, die das Zepter fest in ihren sehnigen, muskulösen Händen hält. Die tätowierte Starkstromrockerin ist die einzige weibliche Person weit und breit, die es locker mit der brüllenden Horde von testosterongesteuerten Primaten aufnimmt.
Inzwischen schickt sich ein klägliches Orchester mit irgendeinem Startenor an, die Nationalhymnen anzustimmen. Die Menschentraube zu meinen Füßen scheint von dem drögen Gesangsvalium narkotisiert zu sein, denn sie bewegt sich mit der Geschwindigkeit und der Rasanz eines gehbehinderten Chamäleons. Allmählich werde ich ungeduldig, das Kribbeln in meiner Magengegend nimmt zu.
Vor mir in der Poleposition trippelt eine äußerst unschlüssig wirkende Frau mit beigefarbenem Minirock von einem Fuß auf den anderen. Nachdenklich mustert sie die einsilbigen Wortfetzen auf der Kreidetafel, als stünde sie vor der Aufgabe, die untergehende Welt zu retten. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, krieg ich Nesselfieber.
Das Spiel ist bereits angepfiffen, da beginnen sich die dünnen Lippen der Lady zitternd zu bewegen: »Ich hätte gerne drei gespritzte Weißweine, ein Bier, zwei Campari Soda, einen Latte Macchiato, vier Mineralwasser und einen Sundowner bitte!«
Am liebsten hätte ich die Frau für ihr respektloses Verhalten gegenüber einem wartenden Fan auf der Stelle erwürgt. Aber es hilft kein Zeter und Mordio: Sie steht wie eine Ein-Frau-Viererkette vor dem Tor mit den verheißungsvoll silbrig glänzenden Zapfhähnen und erstickt sämtliche Offensivaktionen im Keim. Nachdem alle bestellten Getränke fein säuberlich auf drei großen Tabletts bereitstehen und sich die Dame mit beleidigter Miene und hochgezogener Nase verdünnisiert hat, bestelle ich gleich vier Bier auf einmal.
–
Mit einer halben Gesäßbacke setze ich mich auf die harte Kante der Holzbank, die Puppe erfolgreich für mich frei gehalten hat. »Wieso hast du mich so lange hier bei den Spastis alleingelassen? Ich habe mir fast ein Loch in den Bauch gewartet und bin beinahe verdurstet!« Sie hatte schon immer einen Hang zum Dramatischen.
Da ich einfach froh bin, dass ich an einem halbwegs gescheiten Ort das bis dato äußerst ereignisarme Spiel verfolgen kann, halte ich meine Klappe und nippe am ersten Bier. Ich sitze sozusagen inmitten einer Zweiklassen-Gesellschaft: Da hätten wir zum einen die Hardcorefußballfans, die sich allesamt auf die enge Tribüne gequetscht und sich ausschließlich wegen des Spiels eingefunden haben.
Sie scheren sich einen Dreck um das schöne Wetter, die aktuelle Wassertemperatur oder die neuste Sommerkollektion von Yves Saint Laurent. Die Hautfarbe – irgendwo zwischen Papierweiß und Puterrot - unterstreicht ihre grundlegende Abneigung gegen den Aufenthalt im Freien, sportliche Betätigung oder gar gemeinsame Spaziergänge mit der Partnerin in der Natur.
Die lichtempfindlichen Wesen meiden das intensive Sonnenbad wie nachtaktive Fledermäuse, und wenn sie mal rausgehen, dann nur mit Sonnenschutzfaktor 150 aufwärts. Die überwiegend männliche Gruppe hat keine eigentliche Hackordnung oder Hierarchien.
Sie sind als Gruppe stark, ihr Credo ist die Unverwechselbarkeit ihrer Spezies. Gleich und gleich gesellt sich gern, und das gilt in diesen Cliquen schon fast als Gesetz. Andersartige Subjekte werden sofort identifiziert und mit Schimpf und Schande aus der brüderlichen Saufgemeinschaft verbannt. Der typische Vertreter der trivialen Unterhaltung und der niederen Triebe lässt sich in etwa so umschreiben: Ein Mann zwischen 16 und 45 Jahren mit lichtem oder kurz geschorenem Haar, auf dessen Kopf ein Baseball-Käppi mit dem Wappen seines bevorzugten Klubs oder seines favorisierten Landesverbandes thront. Aufgrund immensen Bierkonsums zeichnet er sich durch übermäßiges Schwitzen und ständigen Harndrang aus. Das Schnupfen von Tabak und das Rauchen von Zigaretten sind selbstverständliche Begleiterscheinungen und gehören ebenso zu seinen markanten Merkmalen wie die reihenweise dümmlichen Sprüche, die er bei jeder sich bietenden Gelegenheit vom Stapel lässt. Seinen schneeweißen wurstähnlichen Körper ziert in der Regel das Fußballtrikot seines Lieblingsvereins oder seines Lieblingslandes, im heutigen Fall jenes von England.
Ich ertappe mich dabei, wie ich Puppe die Schuld für unseren – gelinde gesagt eher bescheidenen - Standort in ihre Converse-Schuhe schiebe, denn vor uns hat sich offenbar schon vor Stunden das exemplarische Gegenteil von sachkundigem Fußballverstand auf den besten Plätzen ausgebreitet. Gleich mehrere kinderreiche Großfamilien versperren mit ihren übergroßen Kinderwagen, Milchschoppen, ausgepackten Windeln, Rasseln, Brettspielen, Gummischläuchen, Beiß- und Schwimmringen die Sicht. Allesamt Mode-Fans, die das eigentliche Spiel gar nicht interessiert und die hier einzig und allein wegen des Menschenauflaufs zugegen sind.
Fußball finden sie in etwa so spannend wie unsereins die Kunst des Glasblasens, die Feinheiten des fotolithografischen Flachdruckverfahrens oder die Ultraschallmessung akustischer Signale eines Kondensatabschneiders. Es gibt vor allem zwei grundlegend auffällige Verhaltensmuster, auf die es sich genauer einzugehen lohnt.
Erstens: Die Haltung. Fußball kann man sich sitzend, im Sofa liegend, stehend oder bisweilen auch im Radio hörend zu Gemüte führen, aber auf keinen Fall - ich betone - auf keinen Fall im Schneidersitz oder mit angezogenen Knien auf dem Betonboden einer Bar!
Zweitens: Das Getränk. Ich sage es nur ungern, aber das Gemisch eines Grundnahrungsmittels (Bier) mit einem Kindergetränk (Limonade) hat in meinen Augen an einem Fußball-Länderspiel keine Daseinsberechtigung. Gewiss, Anhänger werden kontern, dass es nichts vergleichbar Erfrischendes gibt, aber mal ehrlich: Ein Radler bei einer Open-Air-Livesport-Übertragung zu trinken, ist doch genauso absurd, wie als Mann mit einem Frauenfahrrad und einem auf dem Gepäckträger montierten Einkaufskorb durch die Gegend zu gondeln.
Komplett ohne jedes Bewusstsein parlieren die vier alternativ angehauchten, gegen die 40 laufenden Käuze, die zu unseren Füßen kauern, munter drauflos. Der eine ganz links sieht mit seinem überlangen Seidenpullover-Umhang aus wie ein peruanischer Dschungelmedizinmann. Neben ihm sitzt offenbar der Bruder von Mehmet Scholl und noch weiter rechts eine besonders schlecht geratene Alternative zu Johnny Knoxville.
Mein Interesse ist definitiv geweckt. Ich fahre meine Hörantenne aus, um die noch etwas undeutlichen Sprachfetzen zu einem Sinn bildenden Gespräch zusammenzusetzen. Leider hat auch Puppe die drei urkomischen Gestalten entdeckt und macht zu meinem Entsetzen Anstalten, sich in fachsimpelnder Manier in ihr Gespräch einzubringen.
Zuerst wird die Standard-Frage Nummer eins unter den Unwissenden gestellt, die da lautet: »Weiß eigentlich jemand von euch, welche Mannschaft in welcher Farbe spielt?«
Nachdem sich die Laien eine Zeit lang auf dem Holzweg befinden, wird die Lösung in einem gemeinsamen Brainstorming herbeigeführt.
Die Standard-Frage Nummer zwei lässt nicht lange auf sich warten: »Was bedeutet eigentlich Abseits?«
Betroffenes Schweigen allenthalben. Nach langem Drängeln und Trotzen von Seiten Puppes lasse ich mich nötigen, die drei Dilettanten aufzuklären. Nach einer Weile geht es in diesem Stile weiter.
Scholl: »Was passiert eigentlich, wenn das Spiel unentschieden bleibt? Sehen wir dann ein Elfmeterschießen?« Medizinmann: »Nee, ich glaub heute noch nicht! Meines Wissens gibt‘s zuerst noch ein Rückspiel, erst dann wird definitiv entschieden.«
Knoxville: »Was werden die eigentlich, wenn sie gewinnen? Cupsieger? Weltmeister?«
Medizinmann: »Ich hab keinen blassen Schimmer! Das ist doch die Champions-League, oder?«
Scholl: »Aber da spielen doch nur so Mannschaften gegeneinander, keine Länder. Auf jeden Fall gewinnt der Sieger einen Pokal oder eine Art Salatschüssel.«
Ich (denkend): Was für Knalltüten!
Leider hat nun auch Puppe das dringende Bedürfnis, ihren Senf dazuzugeben. »Für wen schlägt eigentlich euer Herz, Jungs? Also ich finde die Roten besser. Ihre Trikots sind viel cooler und außerdem sind die Spieler süßer …« Die drei unterbelichteten Dumpfbacken gehen tatsächlich auf das Gerede ein.
Knoxville: »Grundsätzlich bin ich immer für diejenigen, die schöner spielen. Mir gefallen die Weißen besser! Die sind irgendwie technischer drauf …«
Scholl: »Apropos Kleider: Wieso tragen die Torhüter eigentlich immer diese bescheuerten Handschuhe? Also mit diesen Riesenpflatschen könnt ich keinen Ball greifen!«
Bevor mich das große Heulen überkommt, entscheide ich mich für den akustischen Durchzug: Sämtliche Bilder, Eindrücke, Geräusche oder Bewegungen außerhalb des Spielfelds blende ich konsequent aus. Zwischen der 25. und der 40. Minute hätte mich nicht mal ein innig vorgetragener Heiratsantrag Puppes, das plötzliche Auftauchen von Nessie aus dem angrenzenden Seebecken oder die Drohung eines bis auf die Unterhose bewaffneten Selbstmordattentäters aus meiner Fokussierung werfen können.
In der archaischen Welt des Sports finde ich vorübergehend Trost. Da gibt es sie noch, die Blut und Wasser schwitzenden Gladiatoren, die keine Mühen und Schmerzen scheuen und leidenschaftlich für ihren Erfolg kämpfen!
Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit reißt mich Scholl dann doch jäh aus meiner Konzentrationsphase: »Hey, guck mal, das Spiel ist zu Ende. Du kannst dich wieder mit uns unterhalten.« Tatsächlich hat sich der jämmerliche Ballsportexperte vom Umstand blenden lassen, dass es einige Zuschauer offenbar für nötig hielten, aufzustehen, um einen verletzten Spieler, den vier Sanitäter auf einer Bahre aus dem Stadion tragen, mit Standing Ovations zu verabschieden.
Puppe zupft mich am Ärmel und macht ein mitleiderregendes Gesicht wie ein Kleinkind, das um einen Lolli bettelt. »Dann könnten die doch jetzt auf den Tatort umschalten, meinst du nicht auch Bärchi?«
Zum Glück pfeift der Schiri zur Halbzeit. Um die albernen Kommentare der drei Lachsäcke und jene von Puppe besser zu ertragen, stürze ich das zweite Bier in einem Zug hinunter. Die Quittung für diesen Akt der schieren Verzweiflung erhalte ich postwendend.
Mit brennender Blase wage ich den Gang auf die winzige Toilette, die nur Platz für einen sitzenden und einen stehenden Pinkler bietet. In Momenten wie diesen bereue ich meine Schlampigkeit in Bezug auf die Umsetzung von guten Ideen.
Vor Jahren hatte ich einmal im Sinn, einen kleinen handlichen Blasenkatheter für unterwegs patentieren zu lassen.
Schnell und praktisch um den Oberschenkel geschnallt wäre er das ideale Geschenk für den labilen, suchtgefährdeten und inkontinenten Mann von heute. Die rettende Glückseligkeit für alle Übergewichtigen, Gehfaulen, Kampftrinker und gebeutelten Ehefrauen.
Der Bonsai-Pinkelbaum ist nicht gerade eine spirituell erheiternde Wellness- und Wohlfühloase. Wenn es irgendwie geht, versuche ich, auch an brütend heißen Tagen äußerst wenig zu trinken, um das Pullern möglichst lange hinauszuzögern. Es muss ja nicht gerade aussehen wie auf der Privattoilette von Großmufti Abd al-Aziz bin Abdullah Al asch-Schaich, aber ein wenig mehr Hingabe bezüglich Gestaltung und Pflege des stillen Örtchens wäre wünschenswert.
Der chemisch-säuerlichen Ausdünstung nach zu urteilen, wird auch heute der normal verträgliche pH-Wert klar überschritten. Beim Eintreten in die heilige Ausscheidungshalle wird mir mit aller Deutlichkeit bewusst, dass ich barfuß bin.
Ich habe keine Lust, einen bakteriellen Infekt aufzulesen und schon gar nicht über meine Füße, aber zu spät! Als ich das linke Bein nachziehen will, bleibe ich beinahe auf den Fliesen kleben.
Eine kleine Gravur auf der Oberkante des Pissoirs belehrt mich, dass es sich bei diesem Fabrikat um ein sogenanntes Trockenurinal dänischer Herkunft handelt. Herrlich wie der warme dunkelgelbe Strahl mit Hochdruck auf die Plastikmembran knallt und ihr ein heftiges Zischen abringt.
Wie immer übermannt mich eine gewisse Kindlichkeit, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, treffsicher auf das an einer Spritzschutzmatte befestigte kleine Tor mit dem an der Latte baumelnden Ball zu zielen.
Etwas weiter oben an der gekachelten Wand befindet sich eine abgegriffene Plastikfolie, deren eingefasstes Papier darüber Auskunft gibt, dass Uschi diese Örtlichkeit vor zwei Tagen gereinigt haben soll. Fast noch gewagter als diese Aussage finde ich den Werbeslogan einer Garage, der mir aus einer kleinen Leuchtreklame auf dem oberen Kunststoffende des Urinals entgegenblinkt: »Spenglerei, Beulendrückerei, Spritzwerk.« Das nenne ich Situationskomik.
–
Wieder zurück in der Bar versuche ich in dem ganzen Tohuwabohu Puppe zu finden - vergeblich. Wie ein Scanner tasten meine Augen unauffällig die sich vor mir befindenden Umrisse ab, und ganz tief in mir drin kreuchen die ersten kleinen Panikschübe wie lange, dünne Spinnenbeinchen den Magentrakt hinauf. Nur feixende, von Schweiß und Körperfett triefende rotbäckige Gesichter, die sich mit der zunehmenden Wirkung des Alkohols zu Fratzen verzerrt haben, kiebitzen mir entgegen.
Ich laufe einmal um das ganze Backsteingebäude herum und entdecke Puppe bei drei kläglich nebeneinanderstehenden, in der zunehmenden Dunkelheit unbeachteten metallenen Stehtischchen, die sich ganz hinten links auf moosigen Abdeckplatten an der gemauerten Wand im feuchten Nirgendwo befinden. Schon von Weitem sehe ich, wie sie mit ihrer durchdringend piepsigen Sopranstimme eifrig in ihr Handy schwadroniert.
Ich schreite mit großen Schritten auf die Tische zu, reiße ihr das Mobiltelefon aus der Hand und blöke in die Sprechritze: »Es tut mir leid, die Teilnehmerin mit der von Ihnen gewählten Rufnummer ist wegen temporärer Differenzen während der nächsten 45 Minuten nicht mehr verfügbar.«
Puppe schaut mich an, als hätte ich vor ihren Augen ein Rehkitz mit einer Axt erschlagen.
»Bist du wahnsinnig? Das war Anna, du kannst sie doch nicht einfach so wegdrücken!« Ich lege das Handy ruhig auf das Stehtischchen, packe Puppe sanft an beiden Armen und schaue sie eindringlich an.
»Hör mal, Süße, hab ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass wir uns erst in der Halbzeitpause befinden?« Puppe nickt angesäuert.
»Und habe ich dir nicht auch gesagt, dass du unter keinen Umständen den Platz verlassen sollst, nicht mal wenn du an Leib und Leben bedroht würdest?« Puppe nickt wieder, diesmal zögerlich und etwas verschämt. Ich bleibe hartnäckig.
»Und kannst du mir verraten, wie wir aus dieser Distanz die Partie vernünftig verfolgen sollen?«
Auf diese Frage wissen wir beide keine Antwort. Sie schaut mit verschleiertem Blick in das Halbdunkel der Bar. Mit etwas gutem Willen kann man zwar die winzig kleinen Männeken auf den Minibildschirmen ausmachen, nicht aber Spielzüge und Torchancen erkennen, geschweige denn einen Ball.
So kann ich wenigstens einmal nachfühlen, wie sich ein bedauernswerter mexikanischer Fußballfan im Aztekenstadion in Reihe 2645 fühlen muss, der nicht mehr als einen Satz fetthaariger Hinterköpfe zu sehen bekommt. Puppe hat uns mit einem gekonnten Steilpass ins Abseits befördert. Eigentlich hätten wir die drei Pappnasen gleich mitnehmen sollen, dann wären sie hier leibhaftig in den Genuss der Abseits-Regel gekommen.
Ich lehne mich an die Mauer, nippe an einem weiteren Bier und versuche, mich zu entspannen. In der Zwischenzeit ist die Dämmerung einer Dunkelheit gewichen, die immer weiter die grasbewachsenen Hügel hinaufkriecht.
Es ist erstaunlich, wer sich trotz des Länderspiels und der einsetzenden Finsternis noch alles in und um das Wasser tummelt: eine Handvoll Halbwüchsige, die sich mit waghalsigen Sprüngen vom Holzsteg oder dem Schwimmfloß in die Fluten stürzen, Hobbysportler, die den mit Bojen abgesteckten Außenbereich der Bucht abschwimmen, und Dutzende von privaten Bootsbesitzern, die sich gegenseitig im Weg stehen und in einer Endlosschleife vergeblich um einen freien Anlegeplatz buhlen.
Im Sommer herrscht hierzulande auf dem Wasser genauso viel Verkehr wie auf den Straßen – nichts mit romantischem Candle-Light-Dinner zu zweit auf dem Deck des neuen Motorboots und anschließender Tuchfühlung mit der Angebeteten in der Kajüte.
Den letzten Ankerplatz der Seerose hat soeben ein noch junger Hobbykapitän mit seiner Nussschale in Beschlag genommen.
In typischer Yuppie-Seemannskluft, bestehend aus den Marken Lacoste und Tommy Hilfiger, steht er breitbeinig wie Bruce Lee hinter der Reling und guckt enorm wichtig zum biederen Proletenvolk herunter, um sich mit gekünstelt arrogantem Gesichtsausdruck über deren niedere Beweggründe zu amüsieren. Die grassierende Überbevölkerung nimmt immer verheerendere Formen an.
Das merkt man vor allem im Sommer, wenn auch die bleichsten, scheuesten Ratten ihre dunklen Behausungen verlassen und sich dem Menschenstrom anschließen, der Richtung Sonne pilgert.
Kaum hat das Thermometer einmal die 10-Grad-Marke überschritten, läuft der nördlich der Alpen lebende Mensch in Trägerhemdchen und Miniröcken durch die Gegend und saugt die noch jungfräuliche Wärme durch die Poren seiner schneeweißen Haut wie ein gieriges Solarpanel auf. Da nimmt manch einer gerne eine Nierenbeckenentzündung in Kauf!
Wie auch immer: Die Partie bietet auch in der zweiten Halbzeit äußerst magere Kost. Für heute habe ich genug ‒ sowohl von Fußball als auch von Vitamin D. Kurz entschlossen nehme ich Puppe an der Hand und verlasse das Gelände. Vielleicht schaffen wir es ja noch zur Auflösung des Tatort.
Eier legende Wollmilchsau
Wie jedes Mal, wenn ich den unförmigen dreistöckigen Betonklotz vor mir sehe, beschleicht mich ein unerklärbares Gefühl von Angst, das sich langsam von meinem Bauch her über den ganzen Körper ausbreitet. Es fühlt sich an, als hätte ich ein kleines tausendarmiges Tentakel verschluckt, das meinen Körper in kurzen Abständen mit Stromstößen zum Vibrieren bringt und sich dabei immer weiter durch mein Fleisch frisst.
Wenn das so weitergeht, wird es einmal so groß sein, dass ich es nicht mehr auskotzen kann, und meine Panikattacken zu einem dauerhaften Souvenir dieses Saftladens werden. Irgendwann in absehbarer Zeit werde ich mir einen neuen Job suchen MÜSSEN!
Unschlüssig stehe ich vor dem Gebäude der Tischlein deck dich AG und überlege mir an diesem lauen Montagmorgen, ob ich den vierschrötigen Ort des Grauens, diese Hölle auf Erden, betreten soll oder mich besser zum Flughafen chauffieren lassen sollte, um mich auf unbestimmte Zeit auf die Bahamas abzusetzen.
Viel Zeit zum Überlegen bleibt mir nicht, ansonsten werde ich noch vor dem Pausenkaffee von der zähnefletschenden Meute in der Luft zerrissen.
Schon mein halbes Leben lang stehe ich FREIWILLIG jeden Morgen auf, nur um mir unter dem Dach dieses Sektenclans ein Magengeschwür zu holen.
Ich habe schon meine Lehre hier gemacht und mittlerweile bin ich emotional und nervlich so abgestumpft, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie schön mein Leben eigentlich ohne diesen Job war.
Manchmal träume ich davon, ein großer Geschäftsmann zu sein, der so viel Geld und Macht besitzt, dass er seine Marionetten per Fingerschnippen dirigieren kann. Die prächtigsten Frauen dieser Welt würden mir zu Füßen liegen und sie würden Schlange stehen, nur um einen flüchtigen Blick auf meinen gestählten Waschbrettbauch werfen zu können (den freilich müsste ich mir zuerst noch antrainieren).
Ich würde den lieben langen Tag nichts anderes machen, als in der Welt herumzujetten und kleine Imperien aufzukaufen.
Meinen luxuriösen Lebensstil würde ich mit dem Reingewinn aus der Börse finanzieren. Stattdessen vergeude ich meine zweifellos vorhandenen Talente in diesem Milchbubi-Laden, einem Sammelbecken für Verlierer und Versager!
Es wird ein anstrengender Tag werden, der fließend in eine noch anstrengendere Woche übergehen und sich schließlich zu einem katastrophalen Winterhalbjahr manifestieren wird. So was hab ich im Urin! Wie ein gehetztes Reh, das von bissigen Bluthunden gejagt wird, haste ich in Richtung Haupteingang. Vor meinem geistigen Auge sehe ich das Intro des Horrorfilms Saw 7 wie ein riesengroßer Firmenslogan auf der grauen Außenfassade des Gebäudes stehen:
Es gibt kein Entkommen.
Das Spiel hat eine neue Dimension.
Angst.
Schmerzen.
Tod.
Ihr habt noch gar nichts gesehen.
Das wird mein Werk vollenden.
Die Firma, geführt von einem gewissen Richard H. Rosenthal, seines Zeichens Chief Executive Officer, wie er sich selbst neuenglisch betiteln lässt, verkauft nichts ahnenden, naiven Wiederverkäufern und Hoteliers alle Arten von Besteck, Gläser, Porzellangeschirr, verchromten Artikeln für den Service und die Speiseverteilung sowie Tischleuchten und Tischsets zu horrenden Preisen. Den gut betuchten und immer angestrengt vor sich hin lächelnden Herrn habe ich nur noch vage in Erinnerung, denn ich habe ihn während meiner vierzehnjährigen Bürokarriere nur ein einziges Mal vor die Augen bekommen.
Man munkelt, dass er im obersten Stockwerk über dem gemeinen Fußvolk thront und dieses zwar mit unsichtbarer, aber dennoch außerordentlich harter Hand führt. Ich bin der festen Überzeugung, dass der CEO schon beim Neubau dieses kubischen Blocks seine schmuddeligen Hände im Spiel hatte und die Baupläne nach seinem Gusto gestalten ließ. Das ganze Gebäude ist – genauso wie der darin beschäftige Filz – strikt hierarchisch gegliedert.
Ebenerdig werden proletarische Taugenichtse geduldet, die sich in der Spedition und im Post- und Reparaturbüro verdingen.
Im zweiten Stock befinden sich die Büros, die vermutlich nur deshalb hufeisenförmig angelegt sind, weil sich damit die Hoffnung verbindet, dass sich der Personalbestand nach Auseinandersetzungen – die hier so sicher wie das Amen in der Kirche sind – nicht plötzlich halbiert.
Arbeitsmäßig habe ich ganz tief in die Scheiße gegriffen. Ich musste lernen, dass der Begriff »Sekretär« sehr dehnbar ist, und mit den Jahren schlidderte ich immer mehr in die Rolle des Mädchen für alles.
Als gute männliche Fee fungiere ich inzwischen als betriebsinterner Seelsorger, Barkeeper und Coiffeur in Personalunion, der für die Probleme der gesamten Belegschaft ein offenes Ohr hat.
Ich bin sowohl Sprachrohr für die tyrannisierten Untergebenen wie auch für die verhassten Vorgesetzten, und damit liegt der schwarze Peter sowieso immer bei mir - einer Eier legenden Wollmilchsau mit dem Fleiß einer Ameise und dem Lohn eines Sozialhilfeempfängers.
Damit noch nicht genug: Für diesen Wahnsinnsjob gibt es nicht mal eine anständige Bezeichnung. Ich bin einfach nur Eddie Springer, der Sekretär. Heutzutage haben doch auch Blumenverkäuferinnen, Supermarktkassiererinnen und sogar Nutten wohlklingende englische Berufsbezeichnungen.
Dabei möchte ich erwähnen, dass ich diese zufällig genannten Berufe achte und keinesfalls werten oder gar verunglimpfen möchte. Auch beim Standort meines Büros habe ich die Arschkarte gezogen.
Das wird mir gerade wieder schmerzlich in Erinnerung gerufen, als ich in mein zugiges, fensterloses Kämmerchen starre, wo sich zwei in blaue Overalls gekleidete Männer an meinem abgewetzten Teppich zu schaffen machen. Fassungslos starre ich auf die kahlen betonierten Stellen auf meinem Boden.
»He, Ahmed, Alda! Reiß endlisch diese Bode auf, aber dalli, dalli!«
»Hastu voll die Panik, Yildiray? Du hast Teppichmessa verlore, ich schwör! Wege dir Arschloch muss ich Bode mit Hand aufreiße, hä!«
Bin ich im falschen Film gelandet? Ein handgeschriebener Fetzen Papier unter meiner Tastatur klärt mich darüber auf, dass ich für die nächsten Tage den Arbeitsplatz des Lernenden einnehmen soll.
Dieser sei zur Zeit wegen der Schule abwesend. Das Minipult von Tim, so heißt der Azubi mit bürgerlichem Namen, ist im benachbarten Büro der Buchhaltung untergebracht und wurde vermutlich bei der Geschäftseröffnung vor beinahe 40 Jahren aus einem Gebrauchtwarenladen gegraben.