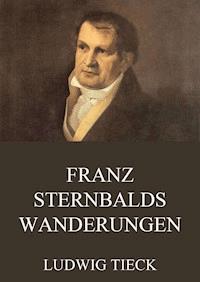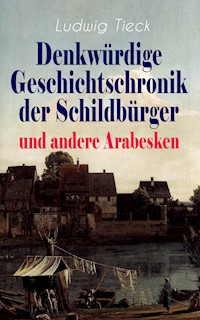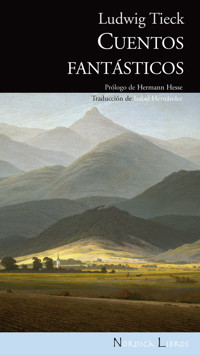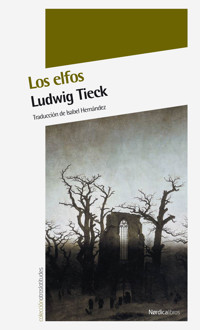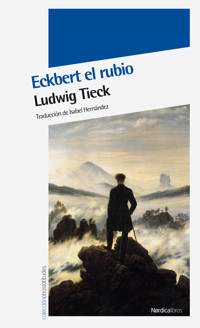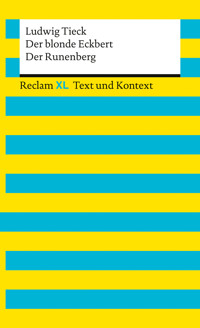Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Taschenbuch-Literatur-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Der junge Maler Franz Sternbald verlässt im Jahr 1520 seinen Meister Abrecht Dürer und geht auf Wanderschaft, die ihn u.a. nach Holland, Florenz, Straßburg und Rom führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kaapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Zweites Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kaapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Drittes. Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kaapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Viertes. Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kaapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Erstes Buch
Erstes Kapitel
»So sind wir denn endlich aus den Toren der Stadt«, sagte Sebastian, indem er stille stand und sich freier umsah.
»Endlich?« antwortete seufzend Franz Sternbald sein Freund. – »Endlich? Ach nur zu früh, allzu früh.«
Die beiden Menschen sahen sich bei diesen Worten lange an, und Sebastian legte seinem Freunde zärtlich die Hand an die Stirne und fühlte, daß sie heiß sei. – »Dich schmerzt der Kopf«, sagte er besorgt, und Franz antwortete: »Nein, das ist es nicht, aber daß wir uns nun bald trennen müssen.«
»Noch nicht!« rief Sebastian mit einem wehmütigen Erzürnen aus, »so weit sind wir noch lange nicht, ich will dich wenigstens eine Meile begleiten.«
Sie gaben sich die Hände und gingen stillschweigend auf einem schmalen Wege nebeneinander.
Jetzt schlug es in Nürnberg vier Uhr und sie zählten aufmerksam die Schläge, obgleich beide recht gut wußten, daß es keine andre Stunde sein konnte: indem warf das Morgenrot seine Flammen immer höher, und es gingen schon undeutliche Schatten neben ihnen, und die Gegend trat rundumher aus der ungewissen Dämmerung heraus; da glänzten die goldenen Knöpfe auf den Türmen des heiligen Sebald und Laurentius, und rötlich färbte sich der Duft, der ihnen aus den Kornfeldern entgegenstieg.
»Wie alles noch so still und feierlich ist«, sagte Franz, »und bald werden sich diese guten Stunden in Saus und Braus, in Getümmel und tausend Abwechselungen verlieren. Unser Meister schläft wohl noch und arbeitet an seinen Träumen, seine Gemälde stehn aber auf der Staffelei und warten schon auf ihn. Es tut mir doch leid, daß ich ihm den Petrus nicht habe können ausmalen helfen.«
»Gefällt er dir?« fragte Sebastian.
»Über die Maßen«, rief Franz aus, »es sollte mir fast bedünken, als könnte der gute Apostel, der es so ehrlich meinte, der mit seinem Degen so rasch bei der Hand war und nachher doch aus Lebensfurcht das Verleugnen nicht lassen konnte, und sich von einem Hahn mußte eine Buß- und Gedächtnispredigt halten lassen; als wenn ein solcher beherzter und furchtsamer, starrer und gutmütiger Apostel nicht anders habe aussehen können, als ihn Meister Dürer so vor uns hingestellt hat. Wenn er dich zu dem Bilde läßt, lieber Sebastian, so wende ja allen deinen Fleiß darauf und denke nicht, daß es für ein schlechtes Gemälde gut genug sei. Willst du mir das versprechen?«
Er nahm ohne eine Antwort zu erwarten seines Freundes Hand und drückte sie stark, Sebastian sagte: »Deinen Johannes will ich recht aufheben und ihn behalten, wenn man mir auch viel Geld dafür böte.« Mit diesen Reden waren sie an einen Fußsteig gekommen, der einen nähern Weg durch das Korn führte. Rote Lichter zitterten an den Spitzen der Halme und der Morgenwind rührte sich darin und machte Wellen. Die beiden jungen Maler unterhielten sich noch von ihren Werken und von ihren Planen für die Zukunft: Franz verließ jetzt Nürnberg, die herrliche Stadt, in der er seit zwölf Jahren gelebt hatte und in ihr zum Jüngling erwachsen war, aus diesem befreundeten Wohnort ging er heut, um in der Ferne seine Kenntnis zu erweitern und nach einer mühseligen Wanderschaft dann als ein Meister in der Kunst der Malerei zurückzukehren; Sebastian aber blieb noch bei dem wohlverdienten Albrecht Dürer, dessen Name im ganzen Lande ausgebreitet war. Jetzt ging die Sonne in aller Majestät hervor und Sebastian und Franz sahen abwechselnd nach den Türmen von Nürnberg zurück, deren Kuppeln und Fenster blendend im Schein der Sonne glänzten.
Die jungen Freunde fühlten stillschweigend den Druck des Abschieds, der ihrer wartete, sie sahen jedem kommenden Augenblick mit Furcht entgegen, sie wußten, daß sie sich trennen mußten und konnten es doch immer noch nicht glauben.
»Das Korn steht schön«, sagte Franz, um nur das ängstigende Schweigen zu unterbrechen, »wir werden eine schöne Ernte haben.«
»Diesmal«, antwortete Sebastian, »werden wir nicht miteinander das Erntefest besuchen, wie seither geschah; ich werde gar nicht hingehn, denn du fehlst mir und all das lustige Pfeifen- und Schalmeigetöne würde nur ein bittrer Vorwurf für mich sein, daß ich ohne dich käme.« Dem jungen Franz standen bei diesen Worten die Tränen in den Augen, denn alle Szenen, die sie miteinander gesehn, alles, was sie in brüderlicher Gesellschaft erlebt hatten, ging schnell durch sein Gedächtnis; als nun Sebastian noch hinzusetzte: »Wirst du mich auch in der Ferne noch immer lieb behalten?« konnte er sich nicht mehr fassen, sondern fiel dem Fragenden mit lautem Schluchzen um den Hals und ergoß sich in tausend Tränen, er zitterte, es war, als wenn ihm das Herz zerspringen wollte. Sebastian hielt ihn fest in seinen Armen, und mußte mit ihm weinen, ob er gleich älter und von einer härteren Konstitution war. »Komme wieder zu dir!« sagte er endlich zu seinem Freunde, »wir müssen uns fassen, wir sehn uns ja wohl wieder.«
Franz antwortete nicht, sondern trocknete seine Tränen ab, ohne sein Gesicht zu zeigen. Es liegt im Schmerze etwas, dessen sich der Mensch schämt, er mag seine Tränen auch vor seinem Busenfreunde, auch wenn sie diesem gehören, gern verbergen.
Sie erinnerten sich nun daran, wie sie schon oft von dieser Reise gesprochen hätten, wie sie ihnen also nichts weniger als unerwartet käme, wie sehr sie Franz gewünscht und sie immer als sein höchstes Glück angesehn habe. Sebastian konnte nicht begreifen, warum sie jetzt so traurig wären, da im Grunde nichts vorgefallen sei, als daß nun endlich der langgewünschte Augenblick wirklich herbeigekommen sei. Aber so ist das Glück des Menschen, er kann sich dessen nur freuen, wenn es aus der Ferne auf ihn zuwandelt; kömmt es ihm nahe und ergreift seine Hand, so schaudert er oft zusammen, als wenn er die Hand des Todes faßte.
»Soll ich dir die Wahrheit gestehn?« fuhr Franz fort; »du glaubst nicht, wie seltsam mir gestern abend zu Sinne war. Ich hatte meinen Gedanken so oft die Pracht Roms, den Glanz Italiens vorgemalt, ich konnte mich bei der Arbeit ganz darin verlieren, daß ich mir vorstellte, wie ich auf unbekannten Fußsteigen, durch schattige Wälder wanderte, und dann fremde Städte und niegesehene Menschen meinem Blicke begegneten; ach, die bunte, ewig wechselnde Welt mit ihren noch unbekannten Begebenheiten, die Künstler, die ich sehn würde, das hohe gelobte Land der Römer, wo einst die Helden wirklich und wahrhaftig gewandelt, deren Bilder mir schon Tränen entlockt hatten; sieh, alles dies zusammen hatte oft so meine Gedanken gefangengenommen, daß ich zuweilen nicht wußte, wo ich war, wenn ich wieder aufsah. ›Und das alles soll wirklich werden!‹ rief ich dann manchmal aus, ›es soll eine Zeit geben können, sie tritt schon näher und näher, in der du nicht mehr vor der alten, so wohlbekannten Staffelei sitzest, eine Zeit, wo du in alle die Herrlichkeit hineinleben darfst und immer mehr sehn, mehr erfahren, nie aufwachen, wie es dir jetzt wohl geschieht, wenn du so zuzeiten von Italien träumst; – ach, wo, wo bekömmst du Sinne, Gefühle genug her, um alles treu und wahr, lebendig und urkräftig aufzufassen?‹ – Und dann war es, als wenn sich Herz und Geist innerlich ausdehnten und wie mit Armen jene zukünftige Zeit erhaschen, an sich reißen wollten; und nun –«
»Und nun, Franz?«
»Kann ich es dir sagen?« antwortete jener – »kann ich es selber ergründen? Als wir gestern abend um den runden Tisch unsers Dürers saßen und er mir noch Lehren zur Reise gab, als die Hausfrau indes den Braten schnitt und sich nach dem Kuchen erkundigte, den sie zu meiner Abreise gebacken hatte, als du nicht essen konntest, und mich immer von der Seite betrachtetest; o Sebastian, es wollte mir ganz mein armes ehrliches Herz zerreißen. Die Hausfrau kam mir so gut vor, so oft sie auch mit mir gescholten, so oft sie auch unsern braven Meister betrübt hatte; hatte sie mir doch selbst meine Wäsche eingepackt, war sie doch gerührt, daß ich abreisen wollte. Nun war unsre Mahlzeit geendigt, und wir alle waren nicht fröhlich gewesen, sosehr wir es auch uns erst in vielen Worten vorgesetzt hatten. Jetzt nahm ich Abschied von Meister Albrecht, ich wollte so hart sein und konnte vor Tränen nicht reden; ach mir fiel es zu sehr ein, wie viel ich ihm zu danken hatte, was er ein vortrefflicher Mann ist, wie herrlich er malt, und ich so nichts gegen ihn bin und er doch in den letzten Wochen immer tat, als wenn ich seinesgleichen wäre; ich hatte das alles noch nie so zusammen empfunden, und nun warf es mich dafür auch gänzlich zu Boden. Ich ging fort und du gingst stillschweigend in deine Schlafkammer: nun war ich auf meiner Stube allein. ›Keinen Abend werd ich mehr hier hereintreten,‹ sagte ich zu mir selber, indem ich das Licht auf den Boden stellte; ›für dich, Franz, ist nun dieses Bette zum letzten Male in Ordnung gelegt, du wirfst dich noch einmal hinein und siehst diese Kissen, denen du so oft deine Sorgen klagtest, auf denen du noch öfter so süß schlummertest, nie siehst du sie wieder.‹ – Sebastian, geht es allen Menschen so, oder bin ich nur ein solches Kind? Es war mir fast, als stünde mir das größte Unglück bevor, das dem Menschen begegnen könnte, ich nahm sogar die alte Lichtschere mit Zärtlichkeit, mit einem wehmütigen Gefühl in die Hand und putzte damit den langen Docht des Lichtes. Ich war überzeugt, daß ich vom guten Dürer nicht zärtlich genug Abschied genommen, ich machte mir heftige Vorwürfe darüber, daß ich ihm nicht alles gesagt hatte, wie ich von ihm denke, welch ein vortrefflicher Mann er in meinen Augen sei, daß er nun von mir so entfernt werde, ohne daß er wisse, welche kindliche Liebe, welche brennende Verehrung, welche Bewunderung ich mit mir nähme. Als ich so über die alten Giebel hinübersah, und über den engen dunkeln Hof, als ich dich nebenan gehn hörte und die schwarzen Wolken so unordentlich durch den Himmel zogen, ach! Sebastian! wie wenn ihr mich aus dem Hause würfet, als wenn ich nicht mehr euer Freund und Gesellschafter sein dürfte, als wenn ich allein als ein Unwürdiger verstoßen sei, verschmäht und verachtet – so regte es sich in meinem Busen. Ich hatte keine Ruhe, ich ging noch einmal vor Dürers Gemach und hörte ihn drinnen schlafen, o ich hätte ihn gern noch einmal umarmt, alles genügte mir nicht, ich hätte mögen dableiben, an kein Verreisen hätte müssen gedacht werden und ich wäre vergnügt gewesen. – Und noch jetzt! sieh, wie die fröhlichen Lichter des Morgens um uns spielen, und ich trage noch alle Empfindungen der dunkeln Nacht in mir. Warum müssen wir immer früheres Glück vergessen, um von neuem glücklich sein zu können? – Ach! laß uns hier einen Augenblick stille stehen, horch, wie schön die Gebüsche flüstern; wenn du mir gut bist, so singe mir hier noch einmal das alte Lied vom Reisen.«
Sebastian stand sogleich still und sang, ohne alle Vorbereitung, folgende Verse: »Willt du dich zur Reis bequemen
Über Feld,
Berg und Tal,
Durch die Welt,
Fremde Städte allzumal,
Mußt Gesundheit mit dir nehmen.
Neue Freunde aufzufinden
Läßt die alten du dahinten,
Früh am Morgen bist du wach,
Mancher sieht dem Wandrer nach
Weint dahinten,
Kann die Freud nicht wiederfinden.
Eltern, Schwester, Bruder, Freund,
Auch vielleicht das Liebchen weint,
Laß sie weinen, traurig und froh
Wechselt das Leben bald so bald so,
Nimmer ohne Ach! und Oh!
Heimat bleibt dir treu und bieder,
Kehrst du nur als Treuer wieder,
Reisen und Scheiden
Bringt des Wiedersehens Freuden.«
Franz hatte sich ins hohe Gras gesetzt und sang die letzten Verse inbrünstig mit, er stand auf und sie kamen an die Stelle, wo Sebastian hatte umkehren wollen.
»Grüße noch einmal!« rief Franz aus, »alle, die mich kennen, und lebe du recht wohl.«
»Und du gehst nun?« fragte Sebastian; »muß ich denn nun ohne dich umkehren?«
Sie hielten sich beide fest umschlossen. »Ach nur eins noch!« rief Sebastian aus, »es quält mich gar zu sehr und ich kann dich nicht lassen.«
Franz wünschte den Abschied im Herzen vorüber, es war, als wenn sein Herz von diesen gegenwärtigen Minuten erdrückt würde, er sehnte sich nach der Einsamkeit, nach dem Walde, um dann von seinem Freunde entfernt seinen Schmerz ausweinen zu können. Aber Sebastian verlängerte die Augenblicke des Abschieds, weil er sich durch kein neues Leben, durch keine neue Gegend konnte trösten lassen, er kannte alles genau, wozu er zurückkehrte. »Willst du mir versprechen?« rief er aus.
»Alles! alles!«
»Ach Franz!« fuhr jener klagend fort, »ich lasse dich nun los und du bist nicht mehr mein, ich weiß nicht, was dir begegnet, ich kann dir nicht ins Gesicht sehen, und so setze ich deine Liebe, ja dich selbst auf ein ungewisses Spiel. Wirst du auch noch in der weiten Ferne an deinen einfältigen Freund Sebastian denken? Ach, wenn du nun unter klugen und vornehmen Leuten bist, wenn es nun schon lange her ist, daß wir hier Abschied genommen haben, willst du mich auch dann nie verachten?«
»O mein liebster Sebastian!« rief Franz schluchzend.
»Wirst du immer noch Nürnberg so lieben«, fuhr jener fort, »und deinen Meister, den wackern Albrecht? Wirst du dich nie klüger fühlen? O versprich mir, daß du derselbe Mensch bleiben willst, daß du dich nicht vom Glanz des Fremden willst verführen lassen, daß alles dir noch ebenso teuer ist, daß ich dich noch ebenso angehe.«
»O Sebastian«, sagte Franz, »mag die ganze Welt klug und überklug werden, ich will immer ein Kind bleiben.«
Sebastian sagte: »O wenn du einst mit fremden abgebettelten Sitten wiederkämst, alles besser wüßtest und dir das Herz nicht mehr so warm schlüge, wenn du dann mit kaltem Blute nach Dürers Grabstein hinsehn könntest und du höchstens über die Arbeit und Inschrift sprächest – o so möcht ich dich gar nicht wiedersehn, dich gar nicht für meinen Bruder erkennen.«
»Sebastian! bin ich denn so?« rief Franz heftig aus; »ich kenne ja dich, ich liebe ja dich und mein Vaterland, und die Stube worin unser Meister wohnt, und die Natur und Gott. Immer werd ich daran hangen, immer, immer! Sieh, hier, an diesem alten Eichenbaum versprech ich es dir, hier hast du meine Hand darauf.«
Sie umarmten sich und gingen stumm auseinander, nach einer Weile stand Franz still, dann lief er dem Sebastian nach und umarmte ihn wieder. »Ach, Bruder«, sagte er, »und wenn Dürer den Ecce homo fertig hat, so schreibe mir doch recht umständlich wie der geworden ist und glaube ja an die Göttlichkeit der Bibel, ich weiß, daß du manchmal übel davon dachtest.«
»Ich will es tun«, sagte Sebastian und sie trennten sich wieder, aber nun kehrte keiner um, oft wandten sie das Gesicht, ein Wald trat zwischen beide.
Zweites Kapitel
Als Sebastian nach der Stadt zurückkehrte und Franz sich nun allein sah, ließ er seinen Tränen ihren Lauf. »Lebe wohl, tausendmal wohl«, sagte er immer still vor sich hin, »wenn ich dich nur erst wiedersähe!« Die Arbeiter auf den Feldern waren nun in Bewegung, alles war tätig und rührte sich; Bauern fuhren ihm vorüber, in den Dörfern war Getümmel, hochbeladene Wagen mit Heu wurden in die Scheuren gefahren, Knechte und Mägde sangen und schäkerten laut. »Wie viele Menschen sind mir heute schon begegnet«, dachte Franz bei sich, »und unter allen diesen weiß vielleicht kein einziger von dem großen Albrecht Dürer, der mit seinen Werken meinen ganzen Kopf einnimmt, den zu erreichen mein einziges Trachten ist! Sie wissen vielleicht kaum, daß es eine Malerei gibt und doch fühlen sie sich nicht unglücklich. Ich kann es nicht einsehn, wie man so fortleben könnte, so einsam und verlassen: und doch treibt jeder emsig sein Geschäft, und es ist gut, daß es so ist und so sein muß.«
Die Sonne war indes hoch gestiegen und brannte heiß herunter, die Schatten der Bäume wurden kurz, die Arbeiter gingen zum Mittagsessen nach ihren Häusern. Franz dachte daran, wie sich nun Sebastian dem Albrecht Dürer gegenüber zu Tische setze und wie man von ihm sprechen würde. Er beschloß, auch im nächsten Gehölze still zu liegen, und seinen mitgenommenen Vorrat zu genießen. Wie erquickend war der kühle Duft, der ihm aus den grünen Blättern entgegenwehte, als er in das Wäldchen eintrat! Alles war still, und nur das Rauschen der Bäume schallte und säuselte in abwechselnden Gängen über ihm weg durch die liebliche Einsamkeit, in dem Getöne und Murmeln eines Baches, der entfernt durch das Gehölz hinfloß. Franz setzte sich auf den weichen Rasen und zog seine Schreibtafel heraus, um den Tag seiner Auswanderung anzumerken, dann holte er frischen Atem, und ihm war leicht und wohl; er war jetzt über die Abwesenheit seines Freundes getröstet, er fand alles gut, so wie es war. Er breitete seine Tafel aus, und aß mit Wohlbehagen von seinem mitgenommenen Vorrate, er fühlte jetzt nur die schöne Gegenwart, die ihn umgab.
Indem kam ein Wandersmann die Straße gegangen und grüßte Franzen sehr freundlich, es war ein junger rotbackiger Bursche, er schien müde und Franz bat ihn daher, sich neben ihn niederzusetzen und mit ihm vorliebzunehmen. Der junge Reisende nahm sogleich diesen Vorschlag an, und beide verzehrten gutes Muts ihre Mittagsmahlzeit und tranken den Wein, den Franz aus Nürnberg mitgenommen hatte. Der Fremde erzählte hierauf unserm Freunde, daß er ein Schmiedegeselle sei und eben auf der Wanderschaft begriffen, er gehe nun, die hochberühmte Stadt Nürnberg in Augenschein zu nehmen und da etwas Rechtes für sein Handwerk bei den kunstreichen Meistern zu lernen. »Und was treibt Ihr für ein Gewerbe?« fragte er, indem er seine Erzählung geendigt hatte.
»Ich bin ein Maler«, sagte Franz, »und bin heute morgen aus Nürnberg ausgewandert.«
»Ein Maler?« rief jener aus, »einer von denen, die für die Kirchen und Klöster die Bilder verfertigen?«
»Recht«, antwortete Franz, »mein Meister hat deren schon genug ausgearbeitet.«
»Oh«, sagte der Schmied, »was ich mir schon oft gewünscht habe, einem solchen Mann bei seiner Arbeit zuzusehn! denn ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer geglaubt, daß die Gemälde in den Kirchen schon sehr alt wären, und daß jetzt gar keine Leute lebten, die dergleichen zu machen verstünden.«
»Gerade umgekehrt«, sagte Franz, »die Kunst ist jetzt höher gestiegen, als sie nur jemals war, ich darf Euch sagen, daß man jetzt so malt, wie es die frühern Meister nie vermocht haben, die Manier ist jetzt edler, die Zeichnung richtiger und die Ausarbeitung bei weitem fleißiger, so daß die jetzigen Bilder den wirklichen Menschen ungleich ähnlicher sehen, als die vormaligen.«
»Und könnt Ihr Euch denn davon ernähren?« fragte der Schmied.
»Ich hoffe es«, antwortete Franz, »daß mich die Kunst durch die Welt bringen wird.«
»Aber im Grunde nützt doch das zu nichts«, fuhr jener fort.
»Wie man es nimmt«, sagte Franz, und war innerlich über diese Rede böse. »Das menschliche Auge und Herz findet ein Wohlgefallen daran, die Bibel wird durch Gemälde verherrliche, die Religion unterstützt, was will man von dieser edlen Kunst mehr verlangen?«
»Ich meine«, sagte der Gesell, ohne sehr darauf zu achten, »es könnte doch zur Not entbehrt werden, es würde doch kein Unglück daraus entstehen, kein Krieg, keine Teurung, kein Mißwachs, Handel und Wandel bliebe in gehöriger Ordnung; das alles ist nicht so mit dem Schmiedehandwerk der Fall, als worauf ich reise, und darum dünkt mich, müßt Ihr mit einiger Besorgnis so in die Welt hineingehn, denn Ihr seid immer doch ungewiß, ob Ihr Arbeit finden werdet.«
Franz wußte darauf nichts zu antworten und schwieg still, er hatte noch nie darüber nachgedacht, ob seine Beschäftigung den Menschen nützlich wäre, sondern sich nur seinem Triebe überlassen. Er wurde betrübt, daß nur irgend jemand an dem hohen Werte der Kunst zweifeln könne, und doch wußte er jetzt jenen nicht zu widerlegen. »Ist doch der heilige Apostel Lukas selbst ein Maler gewesen!« fuhr er endlich auf.
»Wirklich?« sagte der Schmied und verwunderte sich, »das hätt ich nicht gedacht, daß das Handwerk schon so alt wäre.«
»Möchtet Ihr denn nicht«, fuhr Franz mit einem hochroten Gesichte fort, »wenn Ihr einen Freund oder Vater hättet, den Ihr so recht von Herzen liebtet, und Ihr müßtet nun auf viele Jahre auf die Wanderschaft gehn, und könntet sie in der langen langen Zeit nicht sehen, möchtet Ihr denn da nicht ein Bild wenigstens haben, das Euch vor den Augen stände, und jede Miene, jedes Wort zurückriefe, das sie sonst gesprochen haben? Ist es denn nicht schön und herrlich, wenigstens so im gefärbten Schatten das zu besitzen, was wir für teuer achten?«
Der Schmied wurde nachdenkend und Franz öffnete schnell seinen Mantelsack und wickelte einige kleine Bilder aus, die er selbst vor seiner Abreise gemalt hatte. »Seht hieher«, fuhr er fort, »seht, vor einigen Stunden habe ich mich von meinem liebsten Freunde getrennt und hier trage ich seine Gestalt mit mir herum; der da ist mein teurer Lehrer, Albrecht Dürer genannt, gradeso sieht er aus, wenn er recht freundlich ist, hier habe ich ihn noch einmal, wie er in seiner Jugend gestaltet war.«
Der Schmied betrachtete die Gemälde sehr aufmerksam und bewunderte die Arbeit, daß die Köpfe so natürlich vor den Augen ständen, daß man beinahe glauben könnte, lebendige Menschen vor sich zu sehn. »Ist es denn nun nicht schön«, sprach der junge Maler weiter, »daß sich männiglich bemüht, die Kunst immer höher zu treiben und immer wahrer das natürliche Menschenangesicht darzustellen? War es denn nicht für die übrigen Apostel und für alle damaligen Christen herrlich und eine liebliche Erquickung, wenn Lukas ihnen den Erlöser, der nicht mehr unter ihnen wandelte, wenn er ihnen Maria und Magdalena und die übrigen Heiligen hinmalen konnte, daß sie sie glaubten mit Augen zu sehen und mit den Händen zu erfassen? Und ist es denn nicht auch in unserm Zeitalter überaus schön, für alle Freunde des großen Mannes, des kühnen Streiters, den wackern Doktor Luther trefflich zu konterfeien, und dadurch die Liebe der Menschen und ihre Bewunderung zu erhöhn? Und wenn wir alle längst tot sind, müssen es uns nicht Enkel und späte Urenkel Dank wissen, wenn sie dann die jetzigen Helden und großen Männer von uns gemalt antreffen? O wahrlich, sie werden dann Albrecht segnen und mich auch vielleicht loben, daß wir uns ihnen zum Besten diese Mühe gaben, und keiner wird dann die Frage aufwerfen: wozu kann diese Kunst nützen?«
»Wenn Ihr es so betrachtet«, sagte der Schmied, »so habt Ihr ganz recht, und wahrlich, das ist dann ganz etwas anders, als Eisen zu hämmern. Schon oft habe ich es mir auch gewünscht, so irgend etwas zu tun, das bliebe, und wobei die künftigen Menschen meiner gedenken könnten, so eine recht überaus künstliche Schmiedearbeit, aber ich weiß immer noch nicht, was es wohl sein könnte, und ich kann mich auch oft darin nicht finden, warum ich das gerade will, da keiner meiner Handwerksgenossen darauf gekommen ist. Bei Euch ist das auf die Art freilich etwas Leichtes, und Ihr habt dabei nicht einmal so saure Arbeit, wie unsereins. Doch warum, lieber Maler, sieht man nur immer Kreuze und Leidensgeschichten und Heiligen? Warum findet Ihr es denn nicht auch der Mühe wert, Menschen, wie wir sie in ihrem gewöhnlichen Wandel vor uns sehn, selbst mit ihren Possierlichkeiten und wunderlichen Gebärden abzuschildern? Aber freilich wird dergleichen wohl nicht gekauft; auch malt Ihr ja meistens für Kirchen und heilige Örter. Doch darin denkt Ihr gerade wie ich, ja, mein Freund, Tag und Nacht wollt ich arbeiten und mich keinen Schweiß verdrießen lassen, wenn ich etwas zustande bringen könnte, das länger dauerte wie ich, das der Mühe wert wäre, daß man sich meiner dabei erinnerte, und darum möcht ich gern etwas ganz Neues und Unerhörtes erfinden oder entdecken, und ich halte die für sehr glückliche Menschen, denen so etwas gelungen ist.«
Bei diesen Worten verlor sich der Zorn des Malers völlig, er ward dem Schmiedegesellen darüber sehr gewogen und erzählte ihm noch mancherlei von sich und Nürnberg; er erfuhr, daß der junge Schmied aus Flandern komme. »Wollt Ihr mir einen großen Gefallen tun?« fragte der Fremde.
»Gern«, sagte Franz.
»So schreibt mir einige Worte auf und gebt sie mir an Euren Meister und Euren jungen Freund mit, ich will sie dann besuchen und sie müssen mich bei ihrer Arbeit zusehen lassen, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, wie sich die Farben so künstlich übereinanderlegen: dann will ich auch nachsehen, ob Eure Bilder da ähnlich sind.«
»Das ist nicht nötig«, sagte Franz, »Ihr dürft nur so zu ihnen gehen, von mir erzählen und einen Gruß bringen, so sind sie gewiß so gut und lassen Euch einen ganzen Tag nach Herzenslust zuschauen. Sagt ihnen dann, daß wir viel von ihnen gesprochen haben, daß mir noch die Tränen in den Augen stehen.«
Sie schieden hierauf und ein jeder ging seine Straße. Indem es gegen Abend kam, fielen dem jungen Sternbald viele Gegenstände zu Gemälden ein, die er in seinen Gedanken ordnete und mit Liebe bei diesen Vorstellungen verweilte; je röter der Abend wurde, je schwermütiger wurden seine Träumereien, er fühlte sich wieder einsam in der weiten Welt, ohne Kraft, ohne Hülfe in sich selber. Die dunkelgewordenen Bäume, die Schatten die sich auf dem Felde ausstreckten, die rauchenden Dächer eines kleinen Dorfes und die Sterne, die nach und nach am Himmel hervortraten, alles rührte ihn innig, alles bewegte ihn zu einem wehmütigen Mitleiden mit sich selber.
Er kehrte in die kleine Schenke des Dorfes ein, begehrte ein Abendessen und eine Ruhestelle. Als er allein war und schon die Lampe ausgelöscht hatte, stellte er sich an das Fenster und sahe nach der Gegend hin, wo Nürnberg lag. »Dich sollt ich vergessen?« rief er aus, »dich sollt ich weniger lieben? O mein liebster Sebastian, was wäre dann aus meinem Herzen geworden? Wie glücklich fühl ich mich darin, daß ich ein Deutscher, daß ich dein und Albrechts Freund bin! ach! wenn ihr mich nur nicht verstoßt, weil ich eurer unwert bin.«
Er legte sich nieder, verrichtete sein Abendgebet und schlief dann beruhigter ein.
Drittes Kapitel
Am Morgen weckte ihn das muntre Girren der Tauben vor seinem Fenster, die manchmal in seine Stube hineinsahen und mit den Flügeln schlugen, dann wieder wegflogen und bald wiederkamen, um mit dem Halse nickend vor ihm auf und nieder zu gehen. Durch einige Lindenbäume warf die Sonne schräge Strahlen in sein Gemach und Franz stand auf und kleidete sich hurtig an; er sah mit festen Augen durch den reinen blauen Himmel und alle seine Plane wurden lebendiger in ihm, sein Herz schlug höher, alle Gefühle seiner Brust erklangen geläuterter. Er hätte jetzt mit der Farbenpalette vor einer großen Tafel stehn mögen und er hätte dreist die kühnen Figuren hingezeichnet, die sich in seiner Brust bewegten. Der frische Morgen gibt dem Künstler Stärkung und in den Strahlen des Frührots regnet Begeisterung auf ihn herab: der Abend löst und schmelzt seine Gefühle, er weckt Ahndungen und unerklärliche Wünsche in ihm auf, der Gerührte fühlt dann näher, daß jenseit dieses Lebens ein andres kunstreicheres liege, und sein inwendiger Genius schlägt oft vor Sehnsucht mit den Flügeln, um sich frei zu machen und hineinzuschwärmen in das Land, das hinter den goldnen Abendwolken liegt.
Franz sang ein Morgenlied und fühlte keine Müdigkeit vom gestrigen Wege mehr, er setzte mit frischen Kräften seine Reise fort. Das rege Geflügel sang aus allen Gebüschen, das betaute Gras duftete und alle Blätter funkelten wie Kristall. Er ging mit schnellen Schritten über eine schöne Wiese, und das Geschmetter der Lerchen zog über ihn hinweg, ihm war fast noch nie so wohl gewesen.
»Das Reisen«, sagte er zu sich selber, »ist ein herrlicher Zustand, diese Freiheit der Natur, diese Regsamkeit aller Kreaturen, der reine weite Himmel und der Menschengeist, der alles dies zusammenfassen und in einen Gedanken zusammenstellen kann: – o glücklich ist der, der bald die enge Heimat verläßt, um wie der Vogel seinen Fittich zu prüfen und sich auf unbekannten, schöneren Zweigen zu schaukeln. Welche Welten entwickeln sich im Gemüte, wenn die freie Natur umher mit kühner Sprache in uns hineinredet, wenn jeder ihrer Töne unser Herz trifft und alle Empfindungen zugleich anrührt. Ja, ich glaube, daß ich einst ein guter Maler sein werde, da mein ganzer Sinn sich so der Kunst zuwendet, da ich keinen andern Wunsch habe, da ich gern alles übrige in dieser Welt aufgeben mag. Ich will nicht so zaghaft sein, wie Sebastian, ich will mir selber vertrauen.«
Am Mittage ruhte er in einem Dorfe aus, das eine sehr schöne Lage hatte; hier traf er einen Bauer, der mit einem Wagen noch denselben Tag vier Meilen nach seinem Wohnort zu fahren gedachte. Der alte Mann erzählte unterwegs unserm Freunde viel von seiner Haushaltung, von seiner Frau und seinen Kindern. Er war schon siebenzig Jahr und hatte im Laufe seines Lebens mancherlei erfahren, er wünschte jetzt nichts so sehnlich, als vor seinem Tode nur noch die berühmte Stadt Nürnberg sehn zu können, wohin er nie gekommen war. Franz ward durch die Reden des alten Mannes sehr gerührt, es war ihm sonderbar, daß er erst am gestrigen Morgen Nürnberg verlassen hatte, und dieser alte Bauer davon sprach, als wenn es ein fremder wunderweit entlegener Ort sei, so daß er die als Auserwählte betrachtete, denen es gelinge, dorthin zu kommen.
Mit dem Untergange der Sonne kamen sie vor die Behausung des Bauers an; kleine Kinder sprangen ihnen entgegen, die Erwachsenen arbeiteten noch auf dem Felde, die alte Mutter erkundigte sich eifrig nach den Verwandten, die ihr Mann besucht hatte, sie wurde nicht müde zu fragen und er beantwortete alles überaus treuherzig. Dann ward das Abendessen zubereitet und alle im Hause waren sehr geschäftig. Franz bekam den bequemsten Stuhl um auszuruhen, ob er gleich nicht ermüdet war.
Das Abendrot glänzte noch im Grase vor der Tür und die Kinder spielten darin, wie niedergeregnetes Gold funkelte es durch die Scheiben, und lieblich rot waren die Angesichter der Knaben und Mädchen; knurrend setzte sich die Hauskatze neben Franz und schmeichelte sich vertraulich an ihn, und Franz fühlte sich so wohl und glücklich, in der kleinen beengten Stube so selig und frei, daß er sich kaum seiner vorigen trüben Stunden erinnern konnte, daß er glaubte, er könne in seinem Leben nie wieder betrübt werden. Als nun die Dämmerung einbrach, fingen vom Herde der Küche die Heimchen ihren friedlichen Gesang an, am Wasserbach sang aus Birken eine Nachtigall heraus, und noch nie hatte Franz das Glück einer stillen Häuslichkeit, einer beschränkten Ruhe sich so nahe empfunden.
Die großen Söhne kamen aus dem Felde zurück und alle nahmen fröhlich und gutes Muts die Abendmahlzeit ein, man sprach von der bevorstehenden Ernte, vom Zustande der Wiesen. Franz lernte nach und nach das Befinden und die Eigenschaften jedes Haustiers, aller Pferde und Ochsen kennen. Die Kinder waren gegen die Alten ehrerbietig, man fühlte es, wie der Geist einer schönen Eintracht sie alle beherrschte.
Als es finster geworden war, vermehrte ein eisgrauer Nachbar die Gesellschaft, um den sich besonders die Kinder drängten und verlangten, daß er ihnen wieder eine Geschichte erzählen solle; die Alten mischten sich auch darunter und baten, daß er ihnen wieder von heiligen Märtyrern vorsagen möchte, nichts Neues, sondern was er ihnen schon oft erzählt habe, je öfter sie es hörten, je lieber würde es ihnen. Der Nachbar war auch willig und trug die Geschichte der heiligen Genoveva vor, dann des heiligen Laurentius, und alle waren in tiefer Andacht verloren. Franz war überaus gerührt. Noch in derselben Nacht fing er einen Brief für seinen Freund Sebastian an, am Morgen nahm er herzlich von seinen Wirten Abschied, und kam am folgenden Tage in eine kleine Stadt, wo er den Brief an seinen Freund beschloß. Wir teilen unsern Lesern diesen Brief mit.
Liebster Bruder!
Ich bin erst seit so kurzer Zeit von Dir und doch dünkt es mir schon so lange zu sein. Ich habe Dir eigentlich nichts zu schreiben und kann es doch nicht unterlassen, denn Dein eignes Herz kann Dir alles sagen, was Du in meinem Briefe finden solltest, wie ich immer an Dich denke, wie unaufhörlich das Bild meines teuren Meisters und Lehrers vor mir steht. Ein Schmiedegeselle wird Euch besucht haben, den ich am ersten Tage traf, ich denke Ihr habt ihn freundlich aufgenommen um meinetwillen. Ich schreibe diesen Brief in der Nacht, beim Schein des Vollmonds, indem meine Seele überaus beruhigt ist; ich bin hier auf einem Dorfe bei einem Bauer, mit dem ich vier Meilen hiehergefahren bin. Alle im Hause schlafen, und ich fühle mich noch so munter, darum will ich noch einige Zeit wach bleiben. Lieber Sebastian, es ist um das Treiben und Leben der Menschen eine eigene Sache. Wie die meisten so gänzlich ihres Zwecks verfehlen, wie sie nur immer suchen und nie finden, und wie sie selbst das Gefundene nicht achten mögen, wenn sie ja so glücklich sind. Ich kann mich immer nicht darin finden, warum es nicht besser ist, warum sie nicht zu ihrem eigenen Glücke mit sich einiger werden. Wie lebt mein Bauer hier für sich und ist zufrieden, und ist wahrhaft glücklich. Er ist nicht bloß glücklich, weil er sich an diesen Zustand gewöhnt hat, weil er nichts Besseres kennt, weil er sich findet, sondern alles ist ihm recht, weil er innerlich von Herzen vergnügt ist, und weil ihm Unzufriedenheit mit sich etwas Fremdes ist. Nur Nürnberg wünscht er vor seinem Tode noch zu sehen und lebt doch so nahe dabei; wie mich das gerührt hat!
Wir sprechen immer von einer goldenen Zeit, und denken sie uns so weit weg, und malen sie uns mit so sonderbaren und buntgrellen Farben aus. O teurer Sebastian, oft dicht vor unsern Füßen liegt dieses wundervolle Land, nach dem wir jenseit des Ozeans und jenseit der Sündflut mit sehnsüchtigen Augen suchen. Es ist nur das, daß wir nicht redlich mit uns selber umgehen. Warum ängstigen wir uns in unsern Verhältnissen so ab, um nur das bißchen Brot zu haben, das wir darüber selber nicht einmal in Ruhe verzehren können? Warum treten wir denn nicht manchmal aus uns heraus und schütteln alles das ab, was uns quält und drückt, und holen darüber frischen Atem, und fühlen die himmlische Freiheit, die uns eigentlich angeboren ist? Dann müssen wir der Kriege und Schlachten, der Zänkereien und Verleumdungen auf einige Zeit vergessen, alles hinter uns lassen und die Augen davor zudrücken, daß es in dieser Welt so wild hergeht und sich alles toll und verworren durcheinanderschiebt, damit irgendeinmal der himmlische Friede eine Gelegenheit fände, sich auf uns herabzusenken und mit seinen süßen lieblichen Flügeln zu umarmen. Aber wir wollen uns gern immer mehr in dem Wirrwarr der gewöhnlichen Welthändel verstricken, wir ziehn selber einen Flor über den Spiegel, der aus den Wolken herunterhängt, und in welchem Gottheit und Natur uns ihre himmlischen Angesichter zeigen, damit wir nur die Eitelkeiten der Welt desto wichtiger finden dürfen. So kann der Menschengeist sich nicht aus dem Staube aufrichten und getrost zu den Sternen hinblicken und seine Verwandtschaft zu ihnen empfinden. Er kann die Kunst nicht lieben, da er das nicht liebt, was ihn von der Verworrenheit erlöst, denn mit diesem seligen Frieden ist die Kunst verwandt. Du glaubst nicht, wie gern ich jetzt etwas malen möchte, was so ganz den Zustand meiner Seele ausdrückte, und ihn auch bei andern wecken könnte. Ruhige fromme Herden, alte Hirten im Glanz der Abendsonne, und Engel die in der Ferne durch, Kornfelder gehn, um ihnen die Geburt des Herrn, des Erlösers, des Friedefürsten zu verkündigen. Kein wildes Erstarren, keine erschreckten durcheinandergeworfenen Figuren, sondern mit freudiger Sehnsucht müßten sie nach den Himmlischen hinschauen, die Kindlein müßten mit ihren zarten Händlein nach den goldnen Strahlen hindeuten, die von den Botschaftern ausströmten. Jeder Anschauer müßte sich in das Bild hineinwünschen und seine Prozesse und Plane, seine Weisheit und seine politischen Konnexionen auf ein Viertelstündchen vergessen, und ihm würde dann vielleicht so sein, wie mir jetzt ist, indem ich dieses schreibe und denke. Laß Dich manchmal, lieber Sebastian, von der guten freundlichen Natur anwehen, wenn es Dir in Deiner Brust zu enge wird, schau auf die Menschen je zuweilen hin, die im Strudel des Lebens am wenigsten bemerkt werden, und heiße die süße Frömmigkeit willkommen, die unter alten Eichen beim Schein der Abendsonne, wenn Heimchen zwitschern und Feldtauben girren, auf Dich niederkömmt. Nenne mich nicht zu weich und vielleicht phantastisch, wenn ich Dir dieses rate, ich weiß, daß Du in manchen Sachen anders denkst, und vernünftiger und eben darum auch härter bist.
Ein Nachbar besuchte uns noch nach dem Abendessen und erzählte in seiner einfältigen Art einige Legenden von Märtyrern. Der Künstler sollte nach meinem Urteil bei Bauern oder Kindern manchmal in die Schule gehn, um sich von seiner kalten Gelehrsamkeit oder zu großen Künstlichkeit zu erholen, damit sein Herz sich wieder einmal der Einfalt auftäte, die doch nur einzig und allein die wahre Kunst ist. Ich wenigstens habe aus diesen Erzählungen vieles gelernt; die Gegenstände, die der Maler daraus darstellen müßte, sind mir in einem ganz neuen Lichte erschienen. Ich weiß Kunstgemälde, wo der rührendste Gegenstand von unnützen schönen Figuren, von Gemäldegelehrsamkeit und trefflich ausgedachten Stellungen so eingebaut war, daß das Auge lernte, das Herz aber nichts dabei empfand, als worauf es doch vorzüglich abgesehn sein müßte. So aber wollen einige Meister größer werden als die Größe, sie wollen ihren Gegenstand nicht darstellen, sondern verschönern, und darüber verlieren sie sich in Nebendingen. Ich denke jetzt an alles das, was uns der vielgeliebte Albrecht so oft vorgesagt hat, und fühle wie er immer recht und wahr spricht. – Grüße ihn; ich muß hier aufhören, weil ich müde bin. Morgen komme ich nach einer Stadt, da will ich den Brief schließen und abschicken. – –
– Ich bin angekommen und habe Dir, Sebastian, nur noch wenige Worte zu sagen und auch diese dürften vielleicht überflüssig sein. Wenn nur das ewige Auf- und Abtreiben meiner Gedanken nicht wäre! Wenn die Ruhe doch, die mich manchmal wie im Vorbeifliegen küßt, bei mir einheimisch würde, dann könnt ich von Glück sagen, und es würde vielleicht mit der Zeit ein Künstler aus mir, den die Welt zu den angesehenen zählte, dessen Namen sie mit Achtung und Liebe spräche. Aber ich sehe es ein, noch mehr fühl ich es, das wird mir ewig nicht gegönnt sein. Ich kann nicht dafür, ich kann mich nicht im Zaume halten, und alle meine Entwürfe, Hoffnungen, mein Zutrauen zu mir geht vor neuen Empfindungen unter, und es wird leer und wüst in meiner Seele, wie in einer rauhen Landschaft, wo die Brücken von einem wilden Waldstrome zusammengerissen sind. Ich hatte auf dem Wege so vielen Mut, ich konnte mich ordentlich gegen die großen herrlichen Gestalten nicht schützen und mich ihrer nicht erwehren, die in meiner Phantasie aufstiegen, sie überschütteten mich mit ihrem Glanze, überdrängten mich mit ihrer Kraft und eroberten und beherrschten so sehr meinen Geist, daß ich mich freute und mir ein recht langes Leben wünschte, um der Welt, den Kunstfreunden, und Dir, geliebter Sebastian, so recht ausführlich hinzumalen, was mich innerlich mit unwiderstehlicher Gewalt beherrschte. Aber kaum habe ich nun die Stadt, diese Mauern, und die Emsigkeit der Menschen gesehen, so ist alles in meinem Gemüte wieder wie zugeschüttet, ich kann die Plätze meiner Freude nicht wiederfinden, keine Erscheinung steigt auf. Ich weiß nicht mehr, was ich bin; mein Sinn ist gänzlich verwirrt. Mein Zutrauen zu mir scheint mir Raserei, meine inwendigen Bilder sind mir abgeschmackt, sie werden mir so unmöglich, als wenn sie sich nie wirklich fügen würden, als wenn kein Auge Wohlgefallen daran finden könnte. Mein Brief verdrießt mich; mein Stolz ist beschämt. – Was ist es, Sebastian, warum kann ich nicht mit mir einig werden? Ich meine es doch so gut und ehrlich. – Lebe wohl und bleibe immer mein Freund und grüße unsern Meister Albrecht.
Viertes Kapitel
Franz hatte in dieser Stadt einen Brief an einen Mann abzugeben, der der Vorsteher einer ansehnlichen Fabrik war. Er ging zu ihm und traf ihn gerade in Geschäften, so daß Herr Zeuner den Brief nur sehr flüchtig las und mit dem jungen Sternbald nur wenig sprechen konnte, ihn aber bat, zum Mittagsessen wiederzukommen.
Franz ging betrübt durch die Gassen der Stadt, und fühlte sich ganz fremd. Zeuner hatte für ihn etwas Zurückstoßendes und Kaltes, und er hatte gerade eine sehr freundliche Aufnahme erwartet, da er einen Brief von seinem ihm so teuern Lehrer überbrachte. Als es Zeit zum Mittagsessen schien, ging er nach Zeuners Hause zurück, das eins der größten in der Stadt war; mit Bangigkeit schritt er die großen Treppen hinauf und durch den prächtig verzierten Vorsaal: im ganzen Hause merkte man, daß man sich bei einem reichen Manne befinde. Er ward in einen Saal geführt, wo eine stattliche Versammlung von Herren und Damen, alle mit schönen Kleidern angetan, nur auf den Augenblick des Essens zu warten schienen. Nur wenige bemerkten ihn, und die zufälligerweise ein Gespräch mit ihm anfingen, brachen bald wieder ab, als sie hörten, daß er ein Maler sei. Jetzt trat der Herr des Hauses herein, und alle drängten sich mit höflichen und freundlichen Glückwünschen um ihn her; jeder ward freundlich von ihm bewillkommt, auch Franz im Vorbeigehn. Dieser hatte sich in eine Ecke des Fensters zurückgezogen, und sah mit Bangigkeit und schlagendem Herzen auf die Gasse hinunter, denn es war zum ersten Male, daß er sich in einer solchen großen Gesellschaft befand. Wie anders kam ihm hier die Welt vor, die er von anständigen, wohlgekleideten und unterrichteten Leuten über tausend nichtswürdige Gegenstände, nur nicht über die Malerei reden hörte, ob er gleich geglaubt hatte, daß sie jedem Menschen am Herzen liegen müsse, und daß man auf ihn, als einen vertrauten Freund Albrecht Dürers, besonders aufmerksam sein würde.
Man setzte sich zu Tische, er saß fast unten. Durch den Wein belebt ward das Gespräch der Gesellschaft bald munterer, die Frauen erzählten von ihrem Putze, die Männer von ihren mannigfaltigen Geschäften, der Hausherr ließ sich weitläuftig darüber aus, wie sehr er nun nach und nach seine Fabrik verbessert habe und wie der Gewinn also um so einträglicher sei. Was den guten Franz besonders ängstigte, war, daß von allen abwesenden reichen Leuten mit einer vorzüglichen Ehrfurcht gesprochen wurde; er fühlte, wie hier das Geld das einzige sei, was man achte und schätze: er konnte fast kein Wort mitsprechen. Auch die jungen Frauenzimmer waren ihm zuwider, da sie nicht so züchtig und still waren, wie er sie sich vorgestellt hatte, alle setzten ihn in Verlegenheit, er fühlte seine Armut, seinen Mangel an Umgang zum erstenmal in seinem Leben auf eine bittere Art. In der Angst trank er vielen Wein und ward dadurch und von den sich durchkreuzenden Gesprächen ungemein erhitzt. Er hörte endlich kaum mehr darauf hin, was gesprochen ward, die groteskesten Figuren beschäftigten seine Phantasie, und als die Tafel aufgehoben ward, stand er mechanisch mit auf, fast ohne es zu wissen.
Die Gesellschaft verfügte sich nun in einen angenehmen Garten, und Franz setzte sich etwas abseits auf eine Rasenbank nieder, es war ihm, als wenn die Gesträuche und Bäume umher ihn über die Menschen trösteten, die ihm so zuwider waren. Seine Brust ward freier, er wiederholte in Gedanken einige Lieder, die er in seiner Jugend gelernt hatte, und die ihm seit lange nicht eingefallen waren. Der Hausherr kam auf ihn zu, er stand auf und sie gingen sprechend in einem schattigen Gange auf und nieder.
»Ihr seid jetzt auf der Reise?« fragte ihn Zeuner.
»Ja«, antwortete Franz, »vorjetzt will ich nach Flandern und dann nach Italien.«
»Wie seid Ihr grade auf die Malerkunst geraten?«
»Das kann ich Euch selber nicht sagen, ich war plötzlich dabei, ohne zu wissen, wie es kam; einen Trieb, etwas zu bilden, fühlte ich immer in mir.«
»Ich meine es gut mit Euch«, sagte Zeuner, »Ihr seid jung und darum laßt Euch von mir raten. In meiner Jugend gab ich mich auch wohl zuweilen mit Zeichnen ab, als ich aber älter wurde, sah ich ein, daß mich das zu nichts führen könne. Ich legte mich daher eifrig auf ernsthafte Geschäfte und widmete ihnen alle meine Zeit, und seht, dadurch bin ich nun das geworden, was ich bin. Eine große Fabrik und viele Arbeiter stehn unter mir, zu deren Aufsicht, so wie zum Führen meiner Rechnungen ich immer treue Leute brauche. Wenn Ihr wollt, so könnt Ihr mit einem sehr guten Gehalte bei mir eintreten, weil mir grade mein erster Aufseher gestorben ist. Ihr habt ein sichres Brot und ein gutes Auskommen, Ihr könnt Euch hier verheiraten und sogleich antreffen, was Ihr in einer ungewissen zukünftigen Ferne sucht. – Wollt Ihr also Eure Reise einstellen und bei mir bleiben?«
Franz antwortete nicht.
»Ihr mögt vielleicht viel Geschick zur Kunst haben«, fuhr jener fort, »aber was habt Ihr mit alledem gewonnen? Wenn Ihr auch ein großer Meister werdet, so führt Ihr doch immer ein kümmerliches und höchst armseliges Leben. Ihr habt ja das Beispiel an Eurem Lehrer. Wer erkennt ihn, wer belohnt ihn? Mit allem seinem Fleiße muß er sich doch von einem Tage zum andern hinübergrämen, er hat keine frohe Stunde, er kann sich nie recht ergötzen, niemand achtet ihn, da er ohne Vermögen ist, statt daß er reich, angesehen und von Einfluß sein könnte, wenn er sich den bürgerlichen Geschäften gewidmet hätte.«
»Ich kann Euren Vorschlag durchaus nicht annehmen«, rief Franz aus. »Und warum nicht? ist denn nicht alles wahr, was ich Euch gesagt habe?«
»Und wenn es auch wahr ist«, antwortete Franz, »so kann ich es doch so unmöglich glauben. Wenn Ihr das Zeichnen und Bilden sogleich habt unterlassen können, als Ihr es wolltet, so ist das gut für Euch, aber so habt Ihr auch unmöglich einen recht kräftigen Trieb dazu verspürt. Ich wüßte nicht, wie ich es anfinge, daß ich es unterließe, ich würde Eure Rechnungen und alles verderben, denn immer würden meine Gedanken darauf gerichtet bleiben, wie ich diese Stellung und jene Miene gut ausdrücken wollte, alle Eure Arbeiter würden mir nur ebenso viele Modelle sein: Ihr wärt ein schlechter Künstler geworden, so wie ich zu allen ernsthaften Geschäften verdorben bin, denn ich achte sie zu wenig, ich habe keine Ehrfurcht vor dem Reichtum, ich könnte mich nimmer zu diesem kunstlosen Leben bequemen. Und was Ihr mir von meinem Albrecht Dürer sagt, gereicht den Menschen, nicht aber ihm zum Vorwurf. Er ist arm, aber doch in seiner Armut glückseliger als Ihr. Oder haltet Ihr es denn für so gar nichts, daß er sich hinstellen darf und sagen: nun will ich einen Christuskopf malen! und das Haupt des Erlösers mit seinen göttlichen Mienen in kurzem wirklich vor Euch steht und Euch ansieht, und Euch zur Andacht und Ehrfurcht zwingt, selbst wenn Ihr gar nicht dazu aufgelegt seid? Seht, ein solcher Mann ist der verachtete Dürer.«
Franz hatte nicht bemerkt, daß während seiner Rede sich das Gesicht seines Wirts zum Unwillen verzogen hatte; er nahm kurz Abschied und ging mit weinenden Augen nach seiner Herberge. Hier hatte er auf seinem Fenster das Bildnis Albrecht Dürers aufgestellt, und als er in die Stube trat, fiel er laut weinend und klagend davor nieder und schloß es in seine Arme, drückte es an die Brust und bedeckte es mit Küssen. »Ja, mein guter, lieber, ehrlicher Meister!« rief er aus, »nun lerne ich erst die Welt und ihre Gesinnungen kennen! Das ist das, was ich dir nicht glauben wollte, sooft du es mir auch sagtest. Ach wohl, wohl sind die Menschen undankbar gegen dich und deine Herrlichkeit und gegen die Freuden, die du ihnen zu genießen gibst. Freilich haben Sorgen und stete Arbeit diese Furchen in deine Stirn gezogen, ach! ich kenne diese Falten ja nur zu gut. Welcher unglückselige Geist hat mir diese Liebe und Verehrung zu dir eingeblasen, daß ich wie ein lächerliches Wunder unter den übrigen Menschen herumstehn muß, daß ich auf ihre Reden nichts zu antworten weiß, daß sie meine Fragen nicht verstehen? Aber ich will dir und meinem Triebe getreu bleiben; was tut's, wenn ich arm und verachtet bin, was weiter, wenn ich auch am Ende aus Mangel umkommen sollte! Du und Sebastian, ihr beide werdet mich wenigstens deshalb lieben!«
Er hatte noch einen Brief von Dürers Freund Pirkheimer an einen angesehenen Mann der Stadt abzugeben. Er war unentschlossen, ob er ihn selber hintragen sollte. Endlich nahm er sich vor, ihn eilig abzugeben und noch an diesem Abend die Stadt, die ihm so sehr zuwider war, zu verlassen.
Man wies ihn auf seine Fragen nach einem abgelegenen kleinen Hause, in welchem die größte Ruhe und Stille herrschte. Ein Diener führte ihn in ein schön verziertes Gemach, in welchem ein ehrwürdiger alter Mann saß; er war derselbe, an welchen der Brief gerichtet war. »Ich freue mich«, sagte der Greis, »wieder einmal Nachrichten von meinem lieben Freunde Pirkheimer zu erhalten; aber verzeiht, junger Mann, meine Augen sind so schwach, daß Ihr so gut sein müßt, mir selber das Schreiben vorzulesen.«
Franz schlug den Brief auseinander und las unter Herzklopfen, wie Pirkheimer ihn als einen edlen und sehr hoffnungsvollen jungen Maler rühmte, und ihn den besten Schüler Albrecht Dürers nannte. Bei diesen Worten konnte er kaum seine Tränen zurückdrängen.
»So seid Ihr ein Schüler des großen Mannes, meines teuren Albrechts?« rief der Alte wie entzückt aus, »o so seid mir von Herzen willkommen!« Er umarmte mit diesen Worten den jungen Mann, der nun seine schmerzliche Freude nicht mehr mäßigen konnte, laut schluchzte und ihm alles erzählte.
Der Greis tröstete ihn mit liebevollen und verständigen Worten und beide setzten sich freundlich und vertraut nahe zueinander. »O wie oft«, sagte der alte Mann, »habe ich mich an den überaus köstlichen Werken dieses wahrhaft einzigen Malers ergötzt, als meine Augen noch in ihrer Kraft waren! Wie oft hat nur er mich über alles Unglück dieser Erde getröstet! O wenn ich ihn doch einmal wiedersehn könnte!«
Franz vergaß, daß er noch vor Sonnenuntergang die Stadt hatte verlassen wollen; er blieb gern, als ihn der Alte zum Abendessen bat. Bis spät in die Nacht mußte er ihm von Albrechts Werken, von ihm erzählen, dann von Pirkheimer und von seinen eigenen Entwürfen. Franz ergötzte sich an diesem Gespräch und konnte nicht müde werden, dies und jenes zu fragen und zu erzählen, er freute sich, daß der Greis die Kunst so schätzte, daß er von seinem Lehrer mit gleicher Wärme sprach.
Sehr spät gingen sie auseinander und Franz fühlte sich so getröstet und so glücklich, daß er noch lange in seinem Zimmer auf und ab ging, den Mond betrachtete, und an großen Gemälden in Gedanken arbeitete.
Fünftes Kapitel
Wir treffen unsern jungen Freund vor einem Dorfe an der Tauber wieder an. Er hatte einen Umweg durch das blühende Frankenland gemacht, um einige Meilen von Mergentheim seine Eltern zu besuchen. Er war als ein Knabe von zwölf Jahren zufälligerweise nach Nürnberg gekommen und auf sein inständiges Bitten bei Meister Albrecht in die Lehre gebracht; wenige Bekannte und wohlhabende weitläuftige Verwandte ließen ihm einige Unterstützung zufließen, die er aber kaum bei seinem großmütigen Meister bedurfte. Es war schon lange gewesen, daß er von seinen Eltern, schlichten Bauersleuten, keine Nachricht bekommen hatte.
Es war noch am Morgen, als er vor dem Wäldchen stand, das sich vor dem Dorfe ausbreitete. Hier war sein Spielplatz gewesen, hier hatte er oft in der stillen Einsamkeit des Abends voll Nachdenken gewandelt, indem die Schatten dichter zusammenwuchsen und das Rot der sinkenden Sonne tief unten durch die Baumstämme äugelte, und mit zuckenden Strahlen um ihn spielte. Hier hatte sich zuerst sein Trieb zur Kunst entzündet, und er trat in den Wald mit einer Empfindung, wie man einen heiligen Tempel betritt. Er hatte vor allen einen Lieblingsbaum gehabt, von dem er sich oft kaum hatte trennen können; diesen suchte er jetzt eifrig mit zunehmender Rührung auf. Es war eine dicke Eiche mit vielen weit ausgebreiteten Zweigen, welche Kühlung und Schatten gaben. Er fand den Baum, er war in seiner alten Schönheit, und der Rasen am Fuße desselben noch ebenso weich und frisch als ehemals. Wie vieler Gefühle aus seiner Kindheit erinnerte er sich an dieser Stelle! wie er gewünscht hatte, oben in dem krausen Wipfel zu sitzen und von da in das weite Land hineinzuschauen, mit welcher Sehnsucht er den Vögeln nachgesehn hatte, die von Zweig zu Zweig sprangen und mit den dunkelgrünen Blättern scherzten, die nicht wie er nach einem Hause rückkehrten, sondern im ewig frohen Leben, von glänzenden Stunden angeschienen, die frische Luft einatmeten und Gesang zurückgaben, die das Abend- und Morgenrot sahen, die keine Schule hatten und keinen strengen Lehrer. Ihm fiel alles ein, was er vormals gedacht hatte, alle kindischen Begriffe und Empfindungen gingen an ihm vorüber, reichten ihm die kleinen Hände und hießen ihn so herzlich willkommen, daß er heftig im Innersten erschrak, daß er nun wieder unter dem alten Baume stehe und wieder dasselbe denke und empfinde, er noch derselbe Mensch sei. Alle zwischenliegenden Jahre, und alles, was sie an ihm vermocht hatten, fiel in einem Augenblicke von ihm ab, und er stand wieder als Knabe da, die Zeit seiner Kindheit lag ihm so nahe, daß er alles übrige nur für einen vorüberfliegenden Traum halten wollte. Ein Wind rauschte herüber und ging durch die großen Äste des Baums, und alle Gefühle, die fernsten und dunkelsten Erinnerungen wurden mit herübergeweht, und wie Vorhänge fiel es immer mehr von seiner Seele zurück, und er sah nur sich und die liebe Vergangenheit.
Alle frommen Empfindungen gegen seine Eltern, der Unterricht, den ihm seine ersten Bücher gaben, sein Spielzeug fiel ihm wieder bei und seine Zärtlichkeit gegen leblose Gestalten.
»Wer bin ich?« sagte er zu sich selber und schaute langsam um sich her. »Was ist es, daß die Vergangenheit so lebendig in meinem Innern aufsteigt? Wie konnte ich alles, wie konnte ich meine Eltern so lange, fast, wenn ich wahr sein soll, vergessen? Wäre es möglich, daß uns die Kunst gegen die besten und teuersten Gefühle verhärten könnte? Und doch kann es nur das sein, daß dieser Trieb mich zu sehr beschäftigte, sich mir vorbaute und die Aussicht des übrigen Lebens verdeckte.«
Er stand in Gedanken, und die Malerstube, und Albrecht, und seine Kopien kamen ihm wieder in die Gedanken, er setzte seinen Freund Sebastian sich gegenüber und hörte schnell wieder durch, was sie nur je miteinander gesprochen hatten; dann sah er wieder um sich, und die Natur selbst, der Himmel, der rauschende Wald und sein Lieblingsbaum schienen Atem und Leben zu seinen Gemälden herzugeben, Vergangenheit und Zukunft bekräftigten seinen Trieb, und alles was er gedacht und empfunden, war ihm nur deswegen wert, weil es ihn dieser Liebe zugeführt hatte. Er ging mit schnellen Schritten weiter und alle Bäume schienen ihm nachzurufen, aus jedem Busche traten Erscheinungen hervor und wollten ihn zurückhalten, er taumelte aus einer Erinnerung in die andere, und verlor sich in ein Labyrinth von seltsamen Empfindungen.
Er kam auf einen freien Platz im Walde, und plötzlich stand er still. Er wußte selbst nicht, warum er innehielt, er verweilte, um darüber nachzudenken. Ihm war, als habe er sich hier auf etwas zu besinnen, das ihm so lieb, so unaussprechlich teuer gewesen sei; jede Blume im Grase nickte so freundlich, als wenn sie ihm auf seine Erinnerungen helfen wollte. »Es ist hier, gewißlich hier!« sagte er zu sich selber und suchte emsig nach dem glänzenden Bilde, das wie von schwarzen Wolken in seiner innersten Seele zurückgehalten wurde. Mit einem Male brachen ihm die Tränen aus den Augen, er hörte vom Felde herüber eine einsame Schalmei eines Schäfers, und nun wußte er alles. Als Knabe von sechs Jahren war er hier im Walde gegangen, auf diesem Platze hatte er Blumen gesucht, ein Wagen kam dahergefahren und hielt still, eine Frau stieg ab und hob ein Kind herunter, und beide gingen auf dem grünen Plane hin und her, dem kleinen Franz vorüber. Das Kind, ein liebliches blondes Mädchen, kam zu ihm und bat um seine Blumen, er schenkte sie ihr alle, ohne selbst seine Lieblinge zurückzubehalten, indes ein alter Diener auf einem Waldhorne blies, und Töne hervorbrachte, die dem jungen Franz damals äußerst wunderbar in das Ohr erklangen. So verging eine geraume Zeit, indem er das volle Antlitz des Kindes betrachtete, das ihn wie ein voller Mond anschaute und anlächelte: dann fuhren die Fremden wieder fort, und er erwachte wie aus einem Entzücken zu sich und den gewöhnlichen Empfindungen, den gewöhnlichen Spielen, dem gewöhnlichen Leben von einem Tage zum andern hinüber. Dazwischen klangen immer die holden Waldhornstöne in seine Existenz hinein und vor ihm stand glühend und blühend das holde Angesicht des Kindes, dem er seine Blumen geschenkt hatte, nach denen er im Schlummer oft die Hände ausstreckte, weil ihn dünkte, das Mädchen neige sich über ihn, sie ihm zurückzugeben. Er wußte und begriff nicht, warum ihm dieser Augenblick seines Lebens so wichtig und glänzend war, aber alles Liebe und Holde entlehnte er von dieser Kindergestalt, alles Schöne was er sah, trug er in des Mädchens Bild hinüber: wenn er von Engeln hörte, glaubte er einen zu kennen und sich von ihm gekannt, er war es überzeugt, daß die Feldblumen einst ein Erkennungszeichen zwischen ihnen beiden sein würden.
Als er so deutlich wieder an alles dieses dachte, als ihm einfiel, daß er es in so langer Zeit gänzlich vergessen hatte, setzte er sich in das grüne Gras nieder und weinte; er drückte sein heißes Gesicht an den Boden und küßte mit Zärtlichkeit die Blumen. Er hörte in der Trunkenheit wieder die Melodie eines Waldhorns, und konnte sich vor Wehmut, vor Schmerzen der Erinnerung und süßen ungewissen Hoffnungen nicht fassen. »Bin ich wahnsinnig, oder was ist es mit diesem törichten Herzen?« rief er aus. »Welche unsichtbare Hand fährt so zärtlich und grausam zugleich über alle Saiten in meinem Innern hinweg, und scheucht alle Träume und Wundergestalten, Seufzer und Tränen und verklungene Lieder aus ihrem fernen Hinterhalte hervor? O mein Geist, ich fühle es, strebt nach etwas Überirdischem, das keinem Menschen gegönnt ist. Mit magnetischer Gewalt zieht der unsichtbare Himmel mein Herz an sich und bewegt alle Ahndungen durcheinander, die längst ausgeweinten Freuden, die unmöglichen Wonnen, die Hoffnungen, die keine Erfüllungen zulassen. Und ich kann es keinem Menschen, keinem Bruder einmal klagen, wie mein Gemüt zugerichtet ist, denn keiner würde meine Worte verstehen. Daher aber gebricht mir die Kraft, die den übrigen Menschen verliehen ist, und die uns zum Leben notwendig bleibt, ich matte mich ab in mir selber und keiner hat dessen Gewinn, mein Mut verzehrt sich, ich wünsche was ich selbst nicht kenne. Wie Jakob seh ich im Traum die Himmelsleiter mit ihren Engeln, aber ich kann nicht selbst hinaufsteigen, um oben in das glänzende Paradies zu schauen, denn der Schlaf hat meine Glieder bezwungen, und was ich sehe und höre, ahnde und hoffe und lieben möchte, ist nur Traumgestalt in mir.«
Jetzt schlug die Glocke im Dorfe. Er stand auf und trocknete sich die Augen, indem er weiterging, und nun schon die Hütten und die kleine Kirche durch das grüne Laub schimmern sah. Er ging an einem Garten vorbei, über dessen Zaun ein Zweig voll schöner roter Kirschen hing. Er konnte es nicht unterlassen, einige abzubrechen und sie zu kosten, weil die Frucht dieses Baumes ihn in der Kindheit oft erfreut hatte; es waren dieselben Zweige, die sich ihm auch jetzt freundlich entgegenstreckten, aber die Frucht schmeckte ihm nicht wie damals. »In der Kindheit«, sagte er zu sich selber, »wird der Mensch von den blanken, glänzenden, und vielfarbigen Früchten und ihrem süßen lieblichen Geschmacke angelockt, das Leben liebzugewinnen, wie es die Schulmeister in den Schulen machen, die im Anbeginn mit Süßigkeiten dem Kinde Lust zum Lernen beibringen wollen; nachher verliert sich im Menschen dieses frohe Vorgefühl des Lebens, der Lehrer wird streng, die Arbeit fängt an, und die Lockung selbst verliert ihren Wohlgeschmack.«