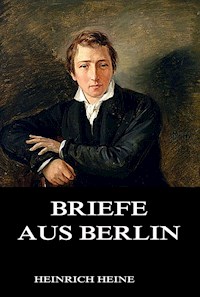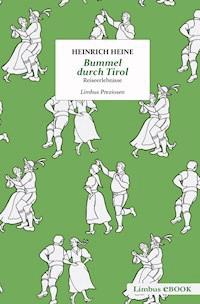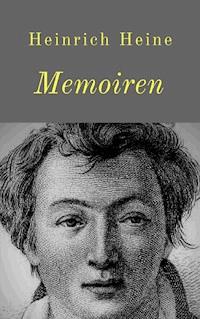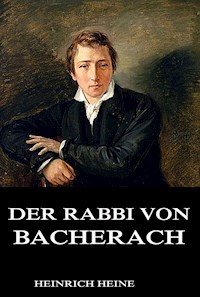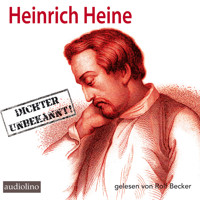Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Artikelserie die Geschichte schrieb! Heinrich Heine verfasste für eine deutsche Zeitung politische Berichte über Frankreich in den Jahren 1831 und 1832. Eine Zeit die geprägt war von der Revolution in Europa und der Zensur von Veröffentlichungen. Die Zeitungsartikel waren eine publizistische Neuheit und beeinflussten den modernen Journalismus maßgeblich. Nach der Publikation wurde die Artikelserie auch als eigenständiges Werk mit dem Titel "Französische Zustände" veröffentlicht. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Heine
Französische Zustände
Saga
Französische Zustände
Coverbild/Illustration: Eugène_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberté_guidant_le_peuple
Copyright © 1832, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997743
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Vorrede zur Vorrede
Wie ich vernehme, ist die Vorrede zu den »Französischen Zuständen« in einer so verstümmelten Gestalt erschienen, daß mir wohl die Pflicht obliegt, sie in ihrer ursprünglichen Ganzheit herauszugeben. Indem ich nun hier einen besondern Abdruck davon liefere, bitte ich mir keineswegs die Absicht beizumessen, als wollte ich die jetzigen Machthaber in Deutschland ganz besonders reizen oder gar beleidigen. Ich habe vielmehr meine Ausdrücke, so viel es die Wahrheit erlaubte, zu mäßigen gesucht. Ich war deshalb nicht wenig verwundert, als ich merkte, daß man jene Vorrede in Deutschland noch immer für zu herbe gehalten. Lieber Gott! was soll das erst geben, wenn ich mal dem freien Herzen erlaube, in entfesselter Rede sich ganz frei auszusprechen! Und es kann dazu kommen. Die widerwärtigen Nachrichten, die täglich über den Rhein zu uns herüberseufzen, dürfen mich wohl dazu bewegen. Vergebens sucht ihr die Freunde des Vaterlands und ihre Grundsätze in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, indem ihr diese als »französische Revolutionslehren« und jene als »französische Partei in Deutschland« verschreit; denn ihr spekuliert immer auf alles, was schlecht im deutschen Volke ist, auf Nationalhaß, religiösen und politischen Aberglauben und Dummheit überhaupt. Aber ihr wißt nicht, daß auch Deutschland nicht mehr durch die alten Kniffe getäuscht werden kann, daß sogar die Deutschen gemerkt, wie der Nationalhaß nur ein Mittel ist, eine Nation durch die andere zu knechten, und wie es überhaupt in Europa keine Nationen mehr gibt, sondern nur zwei Parteien, wovon die eine, Aristokratie genannt, sich durch Geburt bevorrechtet dünkt und alle Herrlichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft usurpiert, während die andere, Demokratie genannt, ihre unveräußerlichen Menschenrechte vindiziert und jedes Geburtsprivilegium abgeschafft haben will, im Namen der Vernunft. Wahrlich, ihr solltet uns die himmlische Partei nennen, nicht die französische; denn jene Erklärung der Menschenrechte, worauf unsere ganze Staatswissenschaft basiert ist, stammt nicht aus Frankreich, wo sie freilich am glorreichsten proklamiert worden, nicht einmal aus Amerika, woher sie Lafayette geholt hat, sondern sie stammt aus dem Himmel, dem ewigen Vaterland der Vernunft.
Wie muß euch doch das Wort »Vernunft« fatal sein! Gewiß ebenso fatal wie den Erbfeinden derselben, den Pfaffen, deren Reich sie ebenfalls ein Ende macht, und die in der gemeinschaftlichen Not sich mit euch verbündet.
Der Ausdruck »französische Partei in Deutschland« schwebt mir heute vorherrschend im Sinn, weil er mir diesen Morgen in dem neuesten Hefte des »Edinburgh Review« besonders auffiel. Es war bei Gelegenheit einer Charakteristik der Gedichte des Herrn Uhland, des guten Kindes, und der meinigen, des bösen Kindes, das als ein Häuptling »der französischen Partei in Deutschland« dargestellt wird. Wie ich merke, ist dergleichen nur ein Echo deutscher Zeitschriften, die ich leider hier nicht sehe. Kann ich sie aber jetzt nicht besonders würdigen, geschieht es ein andermal zum allgemeinen Besten. Seit zehn Jahren ein beständiger Gegenstand der Tageskritik, die entweder pro oder contra, aber immer mit Leidenschaft, meine Schriften besprochen, darf man mir wohl eine hinlängliche Indifferenz in betreff gedruckter Urteile über mich zutrauen; wenn ich daher, was ich bisher nie getan habe, solche Besprechungen jetzt manchmal erwähnen werde, so wird man hoffentlich wohl einsehen, daß nicht die persönlichen Empfindlichkeiten des Schriftstellers, sondern die allgemeinen Interessen des Bürgers das Wort hervorrufen. Leider sind jetzt, wie gesagt, außer den politischen Blättern sehr wenig deutsche Tageserzeugnisse in Paris sichtbar. Ich vermisse sie ungern, in jeder Hinsicht. Wahrlich, in dieser grandiosen Stadt, wo alle Tage ein Stück Weltgeschichte tragiert wird, wäre es pikant, sich manchmal gegensätzlich mit unserer heimischen Misere zu beschäftigen. Ein junger Mann hat mir jüngst geschrieben, daß er voriges Jahr einige Schmähungen gegen mich drucken lassen, welches ich ihm nicht übelnehmen möchte, da ihn meine antinationale Gesinnung in Leidenschaft gesetzt, und er im patriotischen Zorne seiner Worte nicht mächtig war; dieser junge Mann hätte auch so artig sein sollen, mir ein Exemplärchen seines Opus mitzuschicken. Er scheint zu der böotischen Partei in Deutschland zu gehören, deren Unmut gegen »die französische Partei« sehr verzeihlich ist; ich verzeihe ihm von Herzen. Es wäre mir aber wirklich lieb gewesen, wenn er mir das Opus selbst geschickt hätte. Da lob ich mir die sodomitische Partei in Deutschland, die mir ihre Schmähartikel immer selbst zuschickt, und manchmal sogar hübsch abgeschrieben, und, was am löblichsten ist, immer postfrei. Diese Leute hätten aber nicht nötig, so viele Vorsichtsmaßregeln zu nehmen, damit ihre Anonymität bewahrt bleibe. Trotz der verstellten Schreibweise erkenne ich doch immer die namenlosen Verfasser dieser namenlosen Niederträchtigkeiten, ich kenne diese Leute am Stil – »Cognosco stilum curiae romanae!« rief der edle Geschichtschreiber des tridentinischen Konziliums, als der feige Dolch des Meuchelmörders ihn von hinten traf.
Außer der sodomitischen und böotischen ist aber auch die abderitische Partei in Deutschland gegen mich aufgebracht. Es sind da nicht bloß meine französischen Prinzipien, was die meisten derselben gegen mich anreizt. Da gibt's zuweilen noch edlere Gründe. Z. B. ein Häuptling der abderitischen Partei, der seit vielen Jahren unaufhörlich in Schimpf und Ernst gegen mich loszieht, ist nur ein Champion seiner Gattin, die sich von mir beleidigt glaubt und mir den Untergang geschworen hat. Solcher Todeshaß schmerzt mich sehr, denn die Dame ist sehr liebenswürdig. Sie hat sehr viele Ähnlichkeit mit der mediceischen Venus, sie ist nämlich ebenfalls sehr alt, hat ebenfalls keine Zähne; ihr Kinn, wenn sie sich rasiert hat, ist ebenso glatt wie das Kinn jener marmornen Göttin; auch geht sie fast ebenso nackt wie diese, und zwar um zu zeigen, daß ihre Haut nicht ganz gelb sei, sondern hie und da auch einige weiße Flecken habe. Vergebens habe ich dieser liebenswürdigen Dame die versöhnlichsten Artigkeiten gesagt, z. B. daß ich sie beneide, weil sie sich nur zweimal die Woche zu rasieren braucht, während ich diese Operation alle Tage erdulden muß, daß ich sie für die tugendhafteste von allen Frauen halte, die keine Zähne haben, daß ich ihr Herz zu besitzen wünsche, und zwar in einer goldenen Kapsel – vergebens, hier half keine Begütigung! Die Unversöhnliche haßt mich zu sehr, und wie einst Isabella von Kastilien das Gelübde tat, nicht eher ihr Hemd zu wechseln, als bis Granada gefallen sei, so hat jene Dame ebenfalls geschworen, nicht eher ein reines Hemd anzuziehen, als bis ich, ihr Feind, zu Boden liege. Nun setzt sie alle Skribler gegen mich in Bewegung, namentlich ihren armen Gatten, den wahrlich das isabellenfarbige Hemd seiner Ehehälfte nicht wenig inkommodiert, besonders im Sommer, wo die Holde dadurch noch anmutiger als gewöhnlich duftet – so daß er manchmal, wie wahnsinnig, aus dem Bette springt, und nach dem Schreibtische stürzt, und mich schnell zugrunde schreiben will.
Das Brockhausische Konversationsblatt enthält im Sommer weit mehr Schmähartikel gegen mich als im Winter.
Verzeih, lieber Leser, daß diese Zeilen dem Ernste der Zeit nicht ganz angemessen sind. Aber meine Feinde sind gar zu lächerlich! Ich sage Feinde, ich gebe ihnen aus Courtoisie diesen Titel, obgleich sie meistens nur meine Verleumder sind. Es sind kleine Leute, deren Haß nicht einmal bis an meine Waden reicht. Mit stumpfen Zähnen nagen sie an meinen Stiefeln. Das bellt sich müd da unten.
Mißlicher ist es, wenn die Freunde mich verkennen. Das dürfte mich verstimmen, und wirklich, es verstimmt mich. Ich will es aber nicht verhehlen, ich will es selber zur öffentlichen Kunde bringen; daß auch von seiten der himmlischen Partei mein guter Leumund angegriffen worden. Diese hat jedoch Phantasie, und ihre Insinuationen sind nicht so platt prosaisch wie die der böotischen, sodomitischen und abderitischen Partei. Oder gehörte nicht eine große Phantasie dazu, daß man mich in jüngster Zeit der antiliberalsten Tendenzen bezichtigte und der Sache der Freiheit abtrünnig glaubte? Eine gedruckte Äußerung über diese angeschuldete Abtrünnigkeit fand ich dieser Tage in einem Buche, betitelt: »Briefe eines Narren an eine Närrin«. Ob des vielen Guten und Geistreichen, das darin enthalten ist, ob der edlen Gesinnung des Verfassers überhaupt, verzeih ich diesem gern die mich betreffenden bösen Äußerungen; ich weiß, von welcher Himmelsgegend ihm dergleichen zugeblasen worden, ich weiß, woher der Wind pfiff. Da gibt es nämlich unter unseren jakobinischen Enragés, die seit den Juliustagen so laut geworden, einige Nachahmer jener Polemik, die ich während der Restaurationsperiode mit fester Rücksichtslosigkeit und zugleich mit besonnener Selbstsicherung geführt habe. Jene aber haben ihre Sache sehr schlecht gemacht, und statt die persönlichen Bedrängnisse, die ihnen daraus entstanden, nur ihrer eigenen Ungeschicklichkeit beizumessen, fiel ihr Unmut auf den Schreiber dieser Blätter, den sie unbeschädigt sahen. Es ging ihnen wie dem Affen, der zugesehen hatte, wie sich ein Mensch rasierte. Als dieser nun das Zimmer verließ, kam der Affe und nahm das Barbierzeug wieder aus der Schublade hervor, und seifte sich ein und schnitt sich dann die Kehle ab. Ich weiß nicht, inwieweit jene deutschen Jakobiner sich die Kehle abgeschnitten; aber ich sehe, daß sie stark bluten. Auf mich schelten sie jetzt. Seht, rufen sie, wir haben uns ehrlich eingeseift und bluten für die gute Sache, der Heine meint es aber nicht ehrlich mit dem Barbieren, ihm fehlt der wahre Ernst beim Gebrauche des Messers, er schneidet sich nie, er wischt sich ruhig die Seife ab, und pfeift sorglos dabei, und lacht über die blutigen Wunden der Kehlabschneider, die es ehrlich meinen.
Gebt euch zufrieden; ich habe mich diesmal geschnitten.
Paris, Ende November 1832.
Heinrich Heine
Vorrede
»Diejenigen, welche lesen können, werden in diesem Buche von selbst merken, daß die größten Gebrechen desselben nicht meiner Schuld beigemessen werden dürfen, und diejenigen, welche nicht lesen können, werden gar nichts merken.« Mit diesen einfachen Vernunftschlüssen, die der alte Scarron seinem »Komischen Romane« voransetzt, kann ich auch diese ernsteren Blätter bevorworten.
Ich gebe hier eine Reihe Artikel und Tagesberichte, die ich, nach dem Begehr des Augenblicks, in stürmischen Verhältnissen aller Art, zu leicht erratbaren Zwecken, unter noch leichter erratbaren Beschränkungen, für die Augsburger »Allgemeine Zeitung« geschrieben habe. Diese anonymen, flüchtigen Blätter soll ich nun unter meinem Namen als festes Buch herausgeben, damit kein anderer, wie ich bedroht worden bin, sie nach eigener Laune zusammenstellt und nach Willkür umgestaltet oder gar jene fremden Erzeugnisse hineinmischt, die man mir irrtümlich zuschreibt.
Ich benutze diese Gelegenheit, um aufs bestimmteste zu erklären, daß ich seit zwei Jahren in keinem politischen Journal Deutschlands außer der »Allgemeinen Zeitung« eine Zeile drucken lassen. Letztere, die ihre weltberühmte Autorität so sehr verdient, und die man wohl die »Allgemeine Zeitung« von Europa nennen dürfte, schien mir eben wegen ihres Ansehens und ihres unerhört großen Absatzes das geeignete Blatt für Berichterstattungen, die nur das Verständnis der Gegenwart beabsichtigen. Wenn wir es dahin bringen, daß die große Menge die Gegenwart versteht, so lassen die Völker sich nicht mehr von den Lohnschreibern der Aristokratie zu Haß und Krieg verhetzen, das große Völkerbündnis, die Heilige Allianz der Nationen, kommt zustande, wir brauchen aus wechselseitigem Mißtrauen keine stehenden Heere von vielen hunderttausend Mördern mehr zu füttern, wir benutzen zum Pflug ihre Schwerter und Rosse, und wir erlangen Friede und Wohlstand und Freiheit. Dieser Wirksamkeit bleibt mein Leben gewidmet; es ist mein Amt. Der Haß meiner Feinde darf als Bürgschaft gelten, daß ich dieses Amt bisher recht treu und ehrlich verwaltet. Ich werde mich jenes Hasses immer würdig zeigen. Meine Feinde werden mich nie verkennen, wenn auch die Freunde im Taumel der aufgeregten Leidenschaften meine besonnene Ruhe für Lauheit halten möchten. Jetzt freilich, in dieser Zeit, werden sie mich weniger verkennen als damals, wo sie am Ziel ihrer Wünsche zu stehen glaubten und Siegeshoffnung alle Segel ihrer Gedanken schwellte; an ihrer Torheit nahm ich keinen Teil, aber ich werde immer teilnehmen an ihrem Unglück. Ich werde nicht in die Heimat zurückkehren, solange noch ein einziger jener edlen Flüchtlinge, die vor allzu großer Begeisterung keiner Vernunft Gehör geben konnten, in der Fremde, im Elend, weilen muß. Ich würde lieber bei dem ärmsten Franzosen um eine Kruste Brot betteln, als daß ich Dienst nehmen möchte bei jenen vornehmen Gönnern im deutschen Vaterlande, die jede Mäßigung der Kraft für Feigheit halten oder gar für präludierenden Übergang zum Servilismus, und die unsere beste Tugend, den Glauben an die ehrliche Gesinnung des Gegners, für plebejische Erbdummheit ansehen. Ich werde mich nie schämen, betrogen worden zu sein von jenen, die uns so schöne Hoffnungen ins Herz lächelten: »Wie alles aufs friedlichste zugestanden werden sollte, wie wir hübsch gemäßigt bleiben müßten, damit die Zugeständnisse nicht erzwungen und dadurch ungedeihlich würden, wie sie wohl selbst einsähen, daß man die Freiheit uns nicht ohne Gefahr länger vorenthalten könne – – –.« Ja, wir sind wieder Düpes geworden, und wir müssen eingestehen, daß die Lüge wieder einen großen Triumph erfochten und neue Lorbeeren eingeerntet. In der Tat, wir sind die Besiegten, und seit die heroische Überlistung auch offiziell beurkundet worden, seit der Promulgation der deplorabelen Bundestagsbeschlüsse vom 28. Junius, erkrankt uns das Herz in der Brust vor Kummer und Zorn.
Armes, unglückliches Vaterland! welche Schande steht dir bevor, wenn du sie erträgst, diese Schmach! welche Schmerzen, wenn du sie nicht erträgst!
Nie ist ein Volk von seinen Machthabern grausamer verhöhnt worden. Nicht bloß, daß jene Bundestagsordonnanzen voraussetzen, wir ließen uns alles gefallen: man möchte uns dabei noch einreden, es geschehe uns ja eigentlich gar kein Leid oder Unrecht. Wenn ihr aber auch mit Zuversicht auf knechtische Unterwürfigkeit rechnen durftet, so hattet ihr doch kein Recht, uns für Dummköpfe zu halten. Eine Handvoll Junker, die nichts gelernt haben als ein bißchen Roßtäuscherei, Volteschlagen, Becherspiel oder sonstig plumpe Schelmenkünste, womit man höchstens nur Bauern auf Jahrmärkten übertölpeln kann: diese wähnen damit ein ganzes Volk betören zu können, und zwar ein Volk, welches das Pulver erfunden hat und die Buchdruckerei und die »Kritik der reinen Vernunft«. Diese unverdiente Beleidigung, daß ihr uns für noch dümmer gehalten, als ihr selber seid, und euch einbildet, uns täuschen zu können, das ist die schlimmere Beleidigung, die ihr uns zugefügt in Gegenwart der umstehenden Völker.
Ich will nicht die konstitutionellen deutschen Fürsten anklagen; ich kenne ihre Nöte, ich weiß, sie schmachten in den Ketten ihrer kleinen Kamarillen und sind nicht zurechnungsfähig. Dann sind sie auch durch Zwang aller Art von Östreich und Preußen embauchiert worden. Wir wollen sie nicht schmähen, wir wollen sie bedauern. Früh oder spät ernten sie die bitteren Früchte der bösen Saat. Die Toren, sie sind noch eifersüchtig aufeinander, und während jedes klare Auge einsieht, daß sie am Ende von Östreich und Preußen mediatisiert werden, ist all ihr Sinnen und Trachten nur darauf gerichtet, wie man dem Nachbar ein Stück seines Ländchens abgewinnt. Wahrlich, sie gleichen jenen Dieben, die, während man sie nach der Hängstätte führt, sich noch untereinander die Taschen bestehlen.
Wir können ob der Großtaten des Bundestags nur die beiden absoluten Mächte Östreich und Preußen unbedingt anklagen. Wie weit sie gemeinschaftlich unsere Erkenntlichkeit in Anspruch nehmen, kann ich nicht bestimmen. Nur will es mich bedünken, als habe Östreich wieder das Gehässige jener Großtaten auf die Schulter seines weisen Bundesgenossen zu wälzen gewußt.
In der Tat, wir können gegen Östreich kämpfen und todeskühn kämpfen, mit dem Schwert in der Hand; aber wir fühlen in tiefster Brust, daß wir nicht berechtigt sind, mit Scheltworten diese Macht zu schmähen. Östreich war immer ein offener, ehrlicher Feind, der nie seinen Ankampf gegen den Liberalismus geleugnet oder auf eine kurze Zeit eingestellt hätte. Metternich hat nie mit der Göttin der Freiheit geliebäugelt, er hat nie in der Angst des Herzens den Demagogen gespielt, er hat nie Arndts Lieder gesungen und dabei Weißbier getrunken, er hat nie auf der Hasenheide geturnt, er hat nie pietistisch gefrömmelt, er hat nie mit den Festungsarrestanten geweint, geweint, während er sie an der Kette festhielt; – man wußte immer, wie man mit ihm dran war, man wußte, daß man sich vor ihm zu hüten hatte, und man hütete sich vor ihm. Er war immer ein sicherer Mann, der uns weder durch gnädige Blicke täuschte noch durch Privatmalicen empörte. Man wußte, daß er weder aus Liebe noch aus kleinlichem Hasse, sondern großartig im Geiste eines Systems handelte, welchem Östreich seit drei Jahrhunderten treu geblieben. Es ist dasselbe System, für welches Östreich gegen die Reformation gestritten; es ist dasselbe System, wofür es mit der Revolution in den Kampf getreten. Für dieses System fochten nicht bloß die Männer, sondern auch die Töchter vom Hause Habsburg. Für die Erhaltung dieses Systems hatte Marie Antoinette in den Tuilerien zum kühnsten Kampfe die Waffen ergriffen; für die Erhaltung dieses Systems hatte Maria Luisa, die als erklärte Regentin für Mann und Kind streiten sollte, in denselben Tuilerien den Kampf unterlassen und die Waffen niedergelegt. Kaiser Franz hat für die Erhaltung dieses Systems den teuersten Gefühlen entsagt und unsägliches Herzleid erduldet, eben jetzt trägt er Trauer um den geliebten glühenden Enkel, den er jenem Systeme geopfert, dieser neue Kummer hat tief gebeugt das greise Haupt, welches einst die deutsche Kaiserkrone getragen – dieser arme Kaiser ist noch immer der Repräsentant des unglücklichen Deutschlands!
Von Preußen dürfen wir in einem anderen Tone sprechen. Hier hemmt uns wenigstens keine Pietät ob der Heiligkeit eines deutschen Kaiserhaupts. Mögen immerhin die gelehrten Knechte an der Spree von einem großen Imperator des Borussenreichs träumen und die Hegemonie und Schirmherrlichkeit Preußens proklamieren. Aber bis jetzt ist es den langen Fingern von Hohenzollern noch nicht gelungen, die Krone Karls des Großen zu erfassen und zu dem Raub so vieler polnischer und sächsischer Kleinodien in den Sack zu stecken. Noch hängt die Krone Karls des Großen viel zu hoch, und ich zweifle sehr, ob sie je herabsinkt auf das witzige Haupt jenes goldgespornten Prinzen, dem seine Barone schon jetzt als dem künftigen Restaurator des Rittertums ihre Huldigungen darbringen. Ich glaube vielmehr, Se. Königl. Hoheit wird statt eines Nachfolgers Karls des Großen nur ein Nachfolger Karls X. und Karls von Braunschweig.
Es ist wahr, noch vor kurzem haben viele Freunde des Vaterlandes die Vergrößerung Preußens gewünscht und in seinen Königen die Oberherren eines vereinigten Deutschlands zu sehen gehofft, und man hat die Vaterlandsliebe zu ködern gewußt, und es gab einen preußischen Liberalismus, und die Freunde der Freiheit blickten schon vertrauensvoll nach den Linden von Berlin. Was mich betrifft, ich habe mich nie zu solchem Vertrauen verstehen wollen. Ich betrachtete vielmehr mit Besorgnis diesen preußischen Adler, und während andere rühmten, wie kühn er in die Sonne schaue, war ich desto aufmerksamer auf seine Krallen. Ich traute nicht diesem Preußen, diesem langen, frömmelnden Kamaschenheld mit dem weiten Magen und mit dem großen Maule und mit dem Korporalstock, den er erst in Weihwasser taucht, ehe er damit zuschlägt. Mir mißfiel dieses philosophisch christliche Soldatentum, dieses Gemengsel von Weißbier, Lüge und Sand. Widerwärtig, tief widerwärtig war mir dieses Preußen, dieses steife, heuchlerische, scheinheilige Preußen, dieser Tartüff unter den Staaten.
Endlich, als Warschau fiel, fiel auch der weiche, fromme Mantel, worin sich Preußen so schön zu drapieren gewußt, und selbst der Blödsichtigste erblickte die eiserne Rüstung des Despotismus, die darunter verborgen war. Diese heilsame Enttäuschung verdankt Deutschland dem Unglück der Polen.
Die Polen! Das Blut zittert mir in den Adern, wenn ich das Wort niederschreibe, wenn ich daran denke, wie Preußen gegen diese edelsten Kinder des Unglücks gehandelt hat, wie feige, wie gemein, wie meuchlerisch. Der Geschichtschreiber wird vor innerem Abscheu keine Worte finden können, wenn er etwa erzählen soll, was sich zu Fischau begeben hat; jene unehrlichen Heldentaten wird vielmehr der Scharfrichter beschreiben müssen – – – ich höre das rote Eisen schon zischen auf Preußens magerem Rücken.
Unlängst las ich in der »Allg. Zeitung«, daß der Geh. Regierungsrat Friedrich von Raumer, welcher sich unlängst die Renommee eines königl. Preuß. Revolutionärs erworben, indem er als Mitglied der Zensurkommission gegen deren allzu unterdrückungssüchtige Strenge sich aufgelehnt, jetzt den Auftrag erhalten hat, das Verfahren der preußischen Regierung gegen Polen zu rechtfertigen. Die Schrift ist vollendet, und der Verfasser hat bereits seine zweihundert Taler Preußisch Kurant dafür in Empfang genommen. Indessen, wie ich höre, ist sie nach der Meinung der uckermärkischen Kamarilla noch immer nicht servil genug geschrieben. – So geringfügig auch dieses kleine Begebnis aussieht, so ist es eben groß genug, den Geist der Gewalthaber und ihrer Untergebenen zu charakterisieren. Ich kenne zufällig den armen Friedrich von Raumer, ich habe ihn zuweilen in seinem blaugrauen Röckchen und graublauen Militärmützchen unter den Linden spazieren sehen; ich sah ihn mal auf dem Katheder, als er den Tod Ludwigs XVI. vortrug und dabei einige königl. Preuß. Amtstränen vergoß; dann habe ich in einem Damenalmanach seine »Geschichte der Hohenstaufen« gelesen; ich kenne ebenfalls seine »Briefe aus Paris«, worin er der Madame Crelinger und ihrem Gatten über die hiesige Politik und das hiesige Theater seine Ansichten mitteilt. Es ist durchaus ein friedlebiger Mann, der ruhig Queue macht. Von allen mittelmäßigen Schriftstellern ist er noch der beste, und dabei ist er nicht ganz ohne Salz, und er hat eine gewisse äußere Gelehrsamkeit und gleicht daher einem alten trockenen Hering, der mit gelehrter Makulatur umwickelt ist. Ich wiederhole, es ist das friedlebigste Geschöpf, das sich immer ruhig von seinen Vorgesetzten die Säcke aufladen ließ und gehorsam damit zur Amtsmühle trabte und nur hie und da stillstand, wo Musik gemacht wurde. Wie schnöde muß sich nun eine Regierung in ihrer Unterdrückungslust gezeigt haben, wenn sogar ein Friedrich von Raumer die Geduld verlor und rappelköpfisch wurde und nicht weitertraben wollte und sogar in menschlicher Sprache zu sprechen begann! Hat er vielleicht den Engel mit dem Schwerte gesehen, der im Wege steht, und den die Bileame von Berlin, die Verblendeten, noch nicht sehen? Ach! sie gaben dem armen Geschöpfe die wohlgemeintesten Tritte und stacheln es mit ihren goldenen Sporen und haben es schon zum dritten Male geschlagen. Das Volk der Borussen aber – und daraus kann man seinen Zustand ermessen – pries seinen Friedrich von Raumer als einen Ajax der Freiheit.
Dieser königl. Preuß. Revolutionär wird nun dazu benutzt, eine Apologie des Verfahrens gegen Polen zu schreiben und das Berliner Kabinett in der öffentlichen Meinung wieder ehrlich zu machen.
Dieses Preußen! wie es versteht, seine Leute zu gebrauchen! Es weiß sogar von seinen Revolutionären Vorteil zu ziehen. Zu seinen Staatskomödien bedarf es Komparsen von jeder Farbe. Es weiß sogar trikolor gestreifte Zebras zu benutzen. So hat es in den letzten Jahren seine wütendsten Demagogen dazu gebraucht, überall herum zu predigen: daß ganz Deutschland preußisch werden müsse. Hegel mußte die Knechtschaft, das Bestehende, als vernünftig rechtfertigen. Schleiermacher mußte gegen die Freiheit protestieren und christliche Ergebung in den Willen der Obrigkeit empfehlen. Empörend und verrucht ist diese Benutzung von Philosophen und Theologen, durch deren Einfluß man auf das gemeine Volk wirken will, und die man zwingt, durch Verrat an Vernunft und Gott sich öffentlich zu entehren. Wie manch schöner Name, wie manch hübsches Talent wird da zugrunde gerichtet für die nichtswürdigsten Zwecke. Wie schön war der Name Arndts, ehe er auf höheren Geheiß jenes schäbige Büchlein geschrieben, worin er wie ein Hund wedelt und hündisch, wie ein wendischer Hund, die Sonne des Julius anbellt. Stägemann, ein Name besten Klanges, wie tief ist er gesunken, seit er Russenlieder gedichtet! Mag es ihm die Muse verzeihen, die einst mit heiligem Kuß zu besseren Liedern seine Lippen geweiht hat. Was soll ich von Schleiermacher sagen, dem Ritter des roten Adlerordens dritter Klasse! Er war einst ein besserer Ritter und war selbst ein Adler und gehörte zur ersten Klasse. Aber nicht bloß die Großen, sondern auch die Kleinen werden ruiniert. Da ist der arme Ranke, den die preußische Regierung einige Zeit auf ihre Kosten reisen lassen, ein hübsches Talent, kleine historische Figürchen auszuschnitzeln und pittoresk nebeneinander zu kleben, eine gute Seele, gemütlich wie Hammelfleisch mit Teltower Rübchen, ein unschuldiger Mensch, den ich, wenn ich mal heurate, zu meinem Hausfreund wähle, und der gewiß auch liberal – dieser mußte jüngst in der Staatszeitung eine Apologie der Bundestagsbeschlüsse drucken lassen. Andere Stipendiaten, die ich nicht nennen will, haben Ähnliches tun müssen und sind doch ganz liberale Leute.
Oh, ich kenne sie, diese Jesuiten des Nordens! Wer nur jemals aus Not oder Leichtsinn das Mindeste von ihnen angenommen hat, ist ihnen auf immer verfallen. Wie die Hölle Proserpinen nicht losgibt, weil sie den Kern eines Granatapfels dort genossen, so geben jene Jesuiten keinen Menschen los, der nur das Mindeste von ihnen genossen hat, und sei es auch nur einen einzigen Kern des goldenen Apfels oder, um prosaisch zu sprechen, einen einzigen Louisdor; – kaum erlauben sie ihm, wie die Hölle der Proserpine, die eine Hälfte des Jahres in oberweltlichem Lichte zuzubringen; – in solcher Periode erscheinen diese Leute wie Lichtmenschen, und sie nehmen Platz unter uns andern Olympiern und sprechen und schreiben ambrosisch liberal; doch zur gehörigen Zeit findet man sie wieder im höllischen Dunkel, im Reiche des Obskurantismus, und sie schreiben preußische Apologien, Erklärungen gegen den »Messager«, Zensurgesetzentwürfe oder gar eine Rechtfertigung der Bundestagsbeschlüsse.
Letztere, die Bundestagsbeschlüsse, kann ich nicht unbesprochen lassen. Ich werde ihre amtlichen Verteidiger nicht zu widerlegen, noch viel weniger, wie vielfach geschehen, ihre Illegalität zu erweisen suchen. Da ich wohl weiß, von welchen Leuten die Urkunde, worauf sich jene Beschlüsse berufen, verfertigt worden ist: so zweifle ich keineswegs, daß diese Urkunde, nämlich die Wiener Bundesakte, zu jedem despotischen Gelüste die legalsten Befugnisse enthält. Bis jetzt hat man von jenem Meisterwerk der edlen Junkerschaft wenig Gebrauch gemacht, und sein Inhalt konnte dem Volke gleichgültig sein. Nun es aber ins rechte Tageslicht gestellt wird, dieses Meisterstück, nun die eigentlichen Schönheiten des Werkes, die geheimen Springfedern, die verborgenen Ringe, woran jede Kette befestigt werden kann, die Fußangeln, die versteckten Halseisen, Daumschrauben, kurz nun die ganze künstliche, durchtriebene Arbeit allgemein sichtbar wird: jetzt sieht jeder, daß das deutsche Volk, als es für seine Fürsten Gut und Blut geopfert und den versprochenen Lohn der Dankbarkeit empfangen sollte, aufs heilloseste getäuscht worden, daß man ein freches Gaukelspiel mit uns getrieben, daß man statt der zugelobten Magna Charta der Freiheit uns nur eine verbriefte Knechtschaft ausgefertigt hat.
Kraft meiner akademischen Befugnis als Doktor beider Rechte erkläre ich feierlichst, daß eine solche von ungetreuen Mandatarien ausgefertigte Urkunde null und nichtig ist; kraft meiner Pflicht als Bürger protestiere ich gegen alle Folgerungen, welche die Bundestagsbeschlüsse vom 28. Juni aus dieser nichtigen Urkunde geschöpft haben; kraft meiner Machtvollkommenheit als öffentlicher Sprecher erhebe ich gegen die Verfertiger dieser Urkunde meine Anklage und klage sie an des gemißbrauchten Volksvertrauens, ich klage sie an der beleidigten Volksmajestät, ich klage sie an des Hochverrats am deutschen Volke, ich klage sie an!
Armes Volk der Deutschen! Damals, während ihr euch ausruhtet von dem Kampfe für eure Fürsten und die Brüder begrubet, die in diesem Kampfe gefallen, und euch einander die treuen Wunden verbandet und lächelnd euer Blut noch rinnen saht aus der vollen Brust, die so voll Freude und Vertrauen war, so voll Freude wegen der Rettung der geliebten Fürsten, so voll Vertrauen auf die menschlich heiligsten Gefühle der Dankbarkeit: damals, dort unten zu Wien, in den alten Werkstätten der Aristokratie, schmiedete man die Bundesakte!
Sonderbar! Eben der Fürst, der seinem Volke am meisten Dank schuldig war, der deshalb seinem Volke eine repräsentative Verfassung, eine volkstümliche Konstitution, wie andere freie Völker sie besitzen, in jener Zeit der Not versprochen hat, schwarz auf weiß versprochen und mit den bestimmtesten Worten versprochen hat: dieser Fürst hat jetzt jene anderen deutschen Fürsten, die sich verpflichtet gehalten, ihren Untertanen eine freie Verfassung zu erteilen, ebenfalls zu Wortbruch und Treulosigkeit zu verführen gewußt, und er stützt sich jetzt auf die Wiener Bundesakte, um die kaum emporgeblühten deutschen Konstitutionen zu vernichten, er, welcher, ohne zu erröten, das Wort »Konstitution« nicht einmal aussprechen dürfte!
Ich rede von Sr. Majestät Friedrich Wilhelm, dritten des Namens, König von Preußen.
Monarchisch gesinnt, wie ich es immer war und wohl auch immer bleibe, widerstrebt es meinen Grundsätzen und Gefühlen, daß ich die Person der Fürsten selber einer allzu herben Rüge unterwürfe. Es liegt vielmehr in meinen Neigungen, sie ob ihrer guten Eigenschaften zu rühmen. Ich rühme daher gern die persönlichen Tugenden des Monarchen, dessen Regierungssystem oder vielmehr dessen Kabinett ich eben so unumwunden besprochen. Ich bestätige mit Vergnügen, daß Friedrich Wilhelm III. als Mensch die hohe Verehrung und Liebe verdient, die ihm der größte Teil des preußischen Volkes so reichlich spendet. Er ist gut und tapfer. Er hat sich standhaft im Unglück und, was viel seltener ist, milde im Glück gezeigt. Er ist von keuschem Herzen, rührend bescheidenem Wesen, bürgerlicher Prunklosigkeit, häuslich-guten Sitten, ein zärtlicher Vater, besonders zärtlich für die schöne Zarowa, welcher Zärtlichkeit wir vielleicht die Cholera und ein noch größeres Übel, womit erst unsere Nachkommen kämpfen werden, schönstens verdanken. Außerdem ist der König von Preußen ein sehr religiöser Mann, er hält streng auf Religion, er ist ein guter Christ, er hängt fest am evangelischen Bekenntnisse, er hat selbst eine Liturgie geschrieben, er glaubt an die Symbole – ach! ich wollte, er glaubte an den Jupiter, den Vater der Götter, der den Meineid rächt, und er gäbe uns endlich die versprochene Konstitution.
Oder ist das Wort eines Königs nicht so heilig wie ein Eid?
Von allen Tugenden Friedrich Wilhelms rühmt man jedoch am meisten seine Gerechtigkeitsliebe. Man erzählt davon die rührendsten Geschichten. Noch jüngst hat er 11 227 Taler 13 gute Groschen aus seiner Privatkasse geopfert, um den Rechtsansprüchen eines Kyritzer Bürgers zu genügen. Man erzählt, der Sohn des Müllers von Sanssouci habe aus Geldnot die berühmte Windmühle verkaufen wollen, worüber sein Vater mit Friedrich dem Großen prozessiert hat. Der jetzige König ließ aber dem benötigten Mann eine große Geldsumme vorstrecken, damit die berühmte Windmühle in dem alten Zustande stehen bleibe als ein Denkmal preußischer Gerechtigkeitsliebe. Das ist alles sehr hübsch und löblich – aber wo bleibt die versprochene Konstitution, worauf das preußische Volk nach göttlichem und weltlichem Rechte die eigentümlichsten Ansprüche machen kann? Solange der König von Preußen diese heiligste »Obligatio« nicht erfüllt, solange er die wohlverdiente, freie Verfassung seinem Volke vorenthält, kann ich ihn nicht gerecht nennen, und sehe ich die Windmühle von Sanssouci, so denke ich nicht an preußische Gerechtigkeitsliebe, sondern an preußischen Wind.
Ich weiß sehr gut, die literarischen Lohnlakaien behaupten, der König von Preußen habe jene Konstitution nur der eigenen Laune halber versprochen, ein Versprechen, welches ganz unabhängig von den Zeitumständen gewesen sei. Die Toren! ohne Gemüt, wie sie sind, fühlen sie nicht, daß die Menschen, wenn man ihnen vorenthält, was man ihnen von Rechts wegen schuldig ist, weit weniger beleidigt werden, als wenn man ihnen das versagt, was man ihnen aus bloßer Liebe versprochen hat; denn in solchem Falle wird auch unsere Eitelkeit gekränkt, indem wir sehen, daß wir demjenigen, der uns aus freiem Willen etwas versprach, nicht mehr so viel wert sind.
Oder war es wirklich nur eigne Laune, ganz unabhängig von den Zeitumständen, was den König von Preußen einst bewogen hätte, seinem Volke eine freie Konstitution zu versprechen? Er hatte also auch nicht einmal damals die Absicht, dankbar zu sein? Und er hatte doch so viel Grund dazu, denn nie befand sich ein Fürst in einer kläglicheren Lage, als die, worin der König von Preußen nach der Schlacht bei Jena geraten war, und woraus ihn sein Volk gerettet. Standen ihm damals nicht die Tröstungen der Religion zu Gebote, er mußte verzweifeln ob der Insolenz, womit der Kaiser Napoleon ihn behandelte. Aber, wie gesagt, er fand Trost im Christentum, welches wahrlich die beste Religion ist nach einer verlorenen Schlacht. Ihn stärkte das Beispiel seines Heilandes; auch er konnte damals sagen: »Mein Reich ist nicht von dieser Welt!«, und er vergab seinen Feinden, welche mit viermalhunderttausend Mann ganz Preußen besetzt hielten. Wäre Napoleon damals nicht mit weit wichtigeren Dingen beschäftigt gewesen, als daß er an Se. Majestät Friedrich Wilhelm III. allzuviel denken konnte, er hätte diesen gewiß gänzlich in Ruhestand gesetzt. Späterhin, als alle Könige von Europa sich gegen den Napoleon zusammenrotteten und der Mann des Volkes in dieser Fürsten-Emeute unterlag und der preußische Esel dem sterbenden Löwen die letzten Fußtritte gab: da bereute er zu spät die Unterlassungssünde. Wenn er in seinem hölzernen Käfig zu St. Helena auf und ab ging und es ihm in den Sinn kam, daß er den Papst kajoliert und vergessen hatte, Preußen zu zertreten: dann knirschte er mit den Zähnen, und wenn ihm dann eine Ratte in den Weg lief, dann zertrat er die arme Ratte.