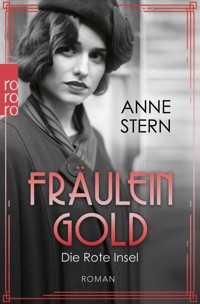
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Hebamme von Berlin
- Sprache: Deutsch
Hulda Gold ist Hebamme, Seelentrösterin, engagierte Kämpferin gegen das Unrecht. Aber wer hilft ihr in größter Not? Berlin, 1926. Hulda Gold ist in einer schwierigen Lage: ledig, schwanger und ohne Auskommen. Zum Glück bietet ihr die junge Ärztin Grete Fischer an, bis zur Niederkunft als Helferin in ihrer kleinen Praxis auf der Roten Insel einzuspringen. Dort behandeln sie vornehmlich Arbeiterfrauen und sehen in die Abgründe von Armut und Not. Bald bemerkt Hulda, dass es die Kollegin dabei mit dem Gesetz nicht so genau nimmt. Und dass Grete Kontakte zu einer kommunistischen Gruppe mit radikalen Ansichten pflegt, mit denen Hulda nicht übereinstimmt. In ganz Berlin nehmen die politischen Spannungen zu. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Kommunisten, Anhängern der Nationalsozialisten und den Ringvereinen. Auch auf der Roten Insel entlädt sich die brodelnde Stimmung in handfester Gewalt. Als ein Mord an einem Nachbarn verübt wird, taucht plötzlich der ehemalige Kommissar Karl North an Huldas Seite auf. Er verfolgt in dem Fall ganz eigene Interessen. Hulda gerät zwischen alle Fronten – und muss sich der größten Bewährungsprobe ihres Lebens stellen. Teil 5 der Erfolgsreihe: Jeder Band ein Spiegel-Bestseller. Jeder Band ein großes Lesevergnügen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anne Stern
Fräulein Gold: Die Rote Insel
Roman
Über dieses Buch
Das Beben der Welt
Berlin, 1926. Hulda Gold musste ihre Stelle als Hebamme in der Frauenklinik aufgeben und lebt nun in einem Arbeiterviertel fern von ihrem alten Kiez. Hier auf der sogenannten Roten Insel kann sie in der Praxis von Grete Fischer mitarbeiten. Gemeinsam kümmern sich die beiden Frauen um Menschen, die täglich gegen Armut und Not kämpfen – während in ganz Berlin die politischen Spannungen zunehmen. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Kommunisten, Anhängern der nationalsozialistischen Bewegung und den Ringvereinen.
Auch das Viertel auf der Roten Insel ist von den Unruhen geprägt. Grete, die einer kommunistischen Gruppe anhängt, scheint es mit dem Gesetz nicht so genau zu nehmen. Als sich die brodelnde Stimmung in handfeste Gewalt entlädt, gerät Hulda zwischen alle Fronten. Und sie muss sich der größten Bewährungsprobe ihres Lebens stellen.
Vita
Anne Stern wurde in Berlin geboren, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Sie ist promovierte Germanistin und arbeitete als Lehrerin und in der Lehrerbildung. Mit jedem Band ihrer historischen «Fräulein Gold»-Reihe landete sie einen Spiegel-Bestseller-Erfolg. Bereits erschienen sind die Romane «Schatten und Licht», «Scheunenkinder», «Der Himmel über der Stadt» und «Die Stunde der Frauen», weitere sind in Planung.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Karte © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Richard Jenkins
ISBN 978-3-644-01335-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Revolutionen kennen keine Halbheiten, keine Kompromisse, kein Schleichen und Sichducken.
Revolutionen brauchen offene Visiere, klare Prinzipien, entschlossene Herzen (…).
Rosa Luxemburg: Rote Fahne, 29.12.1918
Prolog
Berlin-Mitte, November 1918
Die Luft in dem überfüllten Raum schien zu kochen. Hunderte gingen hinein, doch über tausend waren gekommen, sodass sich draußen vor den Türen immer mehr Menschen drängten, die auf Zehenspitzen versuchten, jedes Wort der erstaunlich kleinen Rednerin zu hören. Sie lief auf der Bretterbühne hin und her und unterstrich ihre Sätze mit energischen Gesten.
Grete stand an der Fensterseite des Vortragsraums und war froh über den Randplatz, wo sie wenigstens etwas Sauerstoff schnappen konnte. Trotzdem hatte sie eine perfekte Sicht auf Rosa Luxemburg, von der sie schon so viel gehört und gelesen hatte – doch nichts hatte sie auf dieses Erlebnis heute vorbereiten können. Die geschriebenen Texte in der Roten Fahne und ihre Briefe aus dem Gefängnis waren erstklassig. Aber reden … reden konnte diese Frau mit den lebhaften dunklen Augen und dem dichten Haar wie keine Zweite! Ihre angenehme Stimme hatte eine Natürlichkeit, die von ihrem leichten polnischen Akzent noch zusätzlich reizvoll unterstrichen wurde. Und jedes Wort saß. Wobei nicht nur ihr Mund zu sprechen schien, sondern ihr ganzer Körper: Sie beugte sich vor, streckte sich förmlich zu ihren Zuhörern, stampfte, gestikulierte und bewegte ihren Leib wie eine Tänzerin über die Bühne. Und doch war sie durch und durch Intellekt. Stets trafen ihre klugen Sätze derart ins Schwarze, dass die Zuhörer ihr gebannt zuschauten und immer wieder an entscheidenden Stellen raunten, riefen und klatschten, aber nie zu lange, um nur ja nichts von dem Folgenden zu verpassen.
Gretes Wangen glühten ebenso wie die der anderen Menschen, die sich heute hier versammelt hatten, um dieser inspirierenden Frau zu lauschen. Auch sie schrie mit, reckte ihre Faust in die Luft und fühlte sich seit langer Zeit zum ersten Mal berauscht und eins mit sich und der Welt. Kurz dachte sie an ihren Vater und fragte sich, was der Medizinalrat Fischer aus dem schwäbischen Esslingen wohl sagen würde, wenn er jetzt seine Tochter sehen könnte. Umgeben von einfachen Frauen in Schürzen und mit verschmutzten Hauben, von schwitzenden Männern in Hemd und Hosenträgern und einigen Studenten, die alle der Wunsch nach Veränderung vereinte, im Schrei nach der Revolution. Grete biss sich auf die Lippen. Na, toben würde er, wüten und schimpfen. Und vor allem würde er sich schrecklich um sie, seinen Augenstern, sorgen. Doch das durfte jetzt nicht ihr Problem sein. Es wurde Zeit, dass die Bürgerlichen sich mit der Arbeiterklasse verbrüderten – die Reihen fest geschlossen! Nur dann konnte aus diesem schrecklichen Krieg, der in den letzten Zügen schien und dennoch alles überschattete, vielleicht noch etwas Gutes erwachsen. Jetzt war die Zeit! Und weder Gretes Vater noch die deutschen Offiziere und nicht einmal der Kaiser selbst konnten die Bewegung aufhalten.
Rosa Luxemburg dort oben auf der Bühne schien der gleichen Meinung zu sein. Woher nur nahm diese Frau ihre Kraft? Vor zwei Tagen erst war sie aus dem Gefängnis entlassen worden, wo sie schon so oft, manchmal sogar für mehrere Jahre eingekerkert gewesen war. Doch selbst in Haft hatte sie nicht aufgehört, für ihre Sache zu kämpfen, hatte publiziert und die Menschen jenseits der Mauern trotzdem erreicht und ihren Samen überall eingepflanzt. Und nun, kaum war sie draußen, stürzte sie sich wieder in den sozialistischen Kampf, von dem sie überzeugt war, dass er gewaltsam sein musste. Sie sagte es selbst, rief es in diesem Augenblick in den Saal, und ihre dunklen Augen funkelten.
«Ohne Bürgerkrieg werden wir den Klassenkampf nicht gewinnen können! Die Angst vor einem Bürgerkrieg ist eine ganz und gar kleinbürgerliche Illusion, und wir werden diese Illusion zerstören!»
Grete johlte mit den anderen. Es war so herrlich, die eigenen Gedanken laut zu hören, selbst wenn sie diese niemals so gewandt und mitreißend hätte vorbringen können wie Rosa Luxemburg. Doch jene innere Kraft, diesen Überschuss an Energie, den man der Rednerin in jeder Sekunde anmerkte, den kannte auch Grete nur zu gut. Sie hatte schon als Schulkind trotz ihres zarten Äußeren einen unbezwingbaren Willen gehabt, war die Beste beim Mädchenturnen gewesen, die Schnellste auf der Aschenbahn – trotz des verhassten Turnkleids, das sich beim Rennen immer wieder um die Fesseln der Mädchen wickelte. Aber Pumphosen, wie einige Radfahrerinnen sie trugen, waren verpönt, man hielt die jungen Mädchen mit unbeweglichen Stoffen gern im Zaum. Nichtsdestotrotz hatte Grete unter diesen Kleidern vor Stärke gestrotzt und schnell gedacht, dass es ihre Aufgabe war, sich für die einzusetzen, die weniger Glück hatten als sie selbst. Sie wollte sich um andere kümmern, ihre Fähigkeiten den vielen fremden Leben widmen, die ihrer Hilfe bedurften. Doch das alles war nur eine schwammige Vorstellung gewesen, ein Mädchentraum. Sie war ein Kind des Bürgertums, eine höhere Tochter, die sich nicht mit Proletariern verbündete – zumal sie kaum welche kannte.
Bei einem Ferienaufenthalt in der Schweiz zu Beginn des Krieges – die Familie Fischer fuhr jedes Jahr zur Erholung nach Davos, auch Grete, die bereits Medizin in Freiburg studierte – bekam sie jedoch ein Flugblatt in die Hände. Darauf forderte eine Frau namens Clara Zetkin die Frauen des arbeitenden Volkes auf, sich gegen den Krieg zu wenden und für den Frieden und ihre Rechte als Soldatenmütter und -töchter zu kämpfen. Heute erinnerte sich Grete mit heißem Frösteln an den Moment vor vier Jahren, da sie die Worte der Fremden auf dem zerknitterten Papier gelesen hatte. Sie hatten etwas in ihr entzündet – eine Aufregung, die sie zuvor nicht gekannt hatte und die nun das ganze Feuer, die ganze Fiebrigkeit ihrer Jugend aufsaugte und kanalisierte wie ein Fluss, in den viele kleine Gebirgsbäche mündeten, bis er brodelte und toste. Und auch eine tiefe Scham hatte sie damals verspürt, weil sie bis dahin ahnungslos gewesen war, dass es da eine ganze Bewegung von Frauen gab. Von Arbeiterinnen, aber auch von bürgerlichen Frauen wie sie selbst, die gemeinsam für die Verbesserung ihres Geschlechterstandes und letztlich der ganzen Menschheit kämpften. Sie las nun alles von Zetkin, was sie in die Hände bekam, und zog schließlich nach Berlin, um den wichtigen Ereignissen des Landes nah sein zu können. Sie immatrikulierte sich an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und kehrte der Beschaulichkeit ihrer Kindheit, die sie eingelullt hatte, den Rücken. Sie war auf dem besten Weg, Ärztin zu werden, und ging dem alten Doktor Rasch in seiner Praxis mehrere Tage in der Woche zur Hand, als sei sie es längst.
Und nun war heute der bisherige Höhepunkt ihrer Befreiung aus früheren Fesseln gekommen. Grete hob den Kopf und sah in die anderen Gesichter ringsum, die ihr eigenes Glück, ihren eigenen Taumel spiegelten. Sie waren alle eins, hier und jetzt! Instinktiv fasste sie nach der Hand des jungen Mannes neben ihr, ein muskulöser Kerl mit Schiebermütze und lustigen braunen Augen unter dem Schirm, der kurz überrascht aufsah, dann aber ihre Hand fest drückte und sie mit seiner hoch in die Luft reckte. So standen sie da, die Arme gemeinsam emporgerissen wie Boxchampions in einer begeisterten Menschenmenge und die vibrierende Luft um die Nasen. Sie blickten hinauf zu Rosa Luxemburg, die sich immer weiter in Rage redete, immer öfter ihre kleinen Hände in die Höhe warf und die Menge wie ein gewaltiges Orchester dirigierte.
Grete sah zu dem jungen Mann an ihrer Seite und war beinahe sicher, dass ihre Herzen im selben Takt schlugen – wie zwei Trommeln der Revolution.
1.
Freitag, 4. Juni 1926
«Halten Sie mal?»
Ehe Hulda wusste, wie ihr geschah, hatte sie das kleine Kind mit den seidigen blonden Haaren auf dem Arm. Ein verdutztes Gesichtchen mit Pausbacken starrte sie an, der winzige Mund öffnete sich, sodass ein Zähnchen aufblitzte – dann begann das Kind zu weinen. Hulda hielt es fest, wiegte es sacht hin und her und sah sich nach der Mutter um. Die Frau im schwarzen Kostüm und mit sehr hochhackigen Schuhen war noch einmal zum Taxi geeilt, das wartend am Straßenrand der Sedanstraße in Schöneberg stand, und holte gerade zwei Koffer heraus. Sie schleppte diese über das holprige Pflaster und stellte sie ächzend neben Hulda ab.
«Puh», sagte sie schwer atmend und streckte die Arme aus, «geben Sie mal schnell wieder her. Mein Hildchen ist fremde Leute nicht gewohnt.» Sie nahm das weinende Mädchen aus Huldas Armen und stutzte. «Ach du liebe Güte», sagte sie dann mit Blick auf Huldas Bauch, «verzeihen Sie bitte. Ich habe gar nicht gesehen, dass Sie da selbst eine ordentliche Last mit sich herumtragen.»
«Das macht nichts.» Hulda legte die Hände auf den dünnen Kleiderstoff über ihrem vorstehenden Bauch. «Bisher fühle ich mich hervorragend.»
Das war nur die halbe Wahrheit. Es stimmte, Hulda hatte ihre Schwangerschaft bisher mehr genossen, als sie selbst es je für möglich gehalten hätte. Nach der ersten Übelkeit waren die Monate problemlos verstrichen, der Bauch hatte sich gerundet, doch nicht allzu schnell – es war schließlich ihr erstes Kind, und man hatte es ihr lange nicht angesehen. Aber in den vergangenen Wochen hatte sich Hulda immer mehr wie ein Walfisch gefühlt, als hätte das Kind beschlossen, auf den letzten Metern sein Gewicht noch einmal zu verdoppeln. Der Bauch schien nun beinahe zu platzen, und Hulda musste die Seiten bei allen Kleidern und Röcken herauslassen und notdürftig mit Stoffresten erweitern – und das mit ihren linken Händen, zumindest was Handarbeiten anging. Jetzt sahen die einst hübschen Sachen eher aus wie Zelte, und Hulda vermied den Blick in den Spiegel und sagte sich, dass es ja nur ein vorübergehender Zustand war.
Doch zwei, drei Wochen musste sie wohl noch tapfer sein, dachte sie und blinzelte in die Junisonne, die die baumlose Sedanstraße beschien, als wollte sie ihr Mut machen. Den hatte sie auch dringend nötig, denn sosehr sie sich auf die Erlösung und das Kind freute, so sehr fürchtete sie den Moment, da ihr Leben noch ein ganzes Stück komplizierter würde.
«Sie sehen aber auch blendend aus», sagte die Fremde jetzt und widersprach damit Huldas eigenem Gefühl, «wie das strahlende Leben selbst. Wenn ich da an mich denke …» Sie schüttelte den Kopf und küsste den seidigen Scheitel ihrer Kleinen, die sich inzwischen beruhigt hatte und Hulda aus sicherer Entfernung an der Schulter der Mutter misstrauisch beäugte. «Beine wie ein Elefant!»
Hulda lachte. Sie konnte kaum glauben, dass diese elegante Frau vor nicht einmal einem halben Jahr – denn älter war das Kind nicht – etwas anderes als die schlanken Fesseln gehabt hatte, die sie jetzt an ihr sah. Sie war eine schöne Frau. Doch ihr Gesicht war verschattet, trotz des hellen Lichts dieses frühsommerlichen Vormittags, und wieder fiel Hulda die schwarze Kleidung auf.
«Machen Sie einen Verwandtenbesuch?», fragte sie vorsichtig.
Die Frau ächzte erneut. Ihre Augen wirkten plötzlich blank. «Wie man’s nimmt», sagte sie, «ich fürchte, wir bleiben länger. Vielleicht für immer.» Verstohlen wischte sie sich die Augen und presste ihr Kind noch enger an sich. «Ich komme aus Ulm. Mein Mann – wissen Sie, er verstarb kürzlich.»
Hulda nickte mitleidig, sie fühlte sich auf einmal mulmig. Mit dem Tod hatte sie im vergangenen Jahr auch Bekanntschaft gemacht. Johann und sie waren zwar nicht verheiratet gewesen, aber machte sie das weniger zu einer trauernden Witwe als diese Frau? Automatisch fühlte sie in ihrer Tasche nach, wo sie noch immer seinen Ring aufbewahrte, obwohl sie ihn nie gern am Finger getragen hatte. Doch nun fiel es ihr schwer, sich davon zu trennen.
«Mein Beileid», sagte sie freundlich und zwang sich, den Gedanken an Johann und ihre jüngste Vergangenheit beiseitezuschieben. Es zählte nur das Heute, das Hier und Jetzt, und natürlich das Morgen, obwohl sie versuchte, auch so wenig wie möglich an ihre unsichere Zukunft zu denken.
«Tja, nun muss ich wieder arbeiten gehen», sagte die Frau und schniefte. «Ich war Sekretärin, bevor Hildegard kam. Aber allein schaffe ich das alles nicht. Darum ziehen wir wieder zu meinen Eltern, hier in die Nummer 69.»
Sie deutete zu dem Haus, in dem auch Hulda seit einigen Monaten wohnte und arbeitete. Es war ein typisches Exemplar in der Sedanstraße, viergeschossig, mit strengen, geometrischen Stuckverzierungen und hintenraus ein Gewerbehof. Hinter einigen der Häuser befanden sich noch Ställe mit Vieh. Ein wenig schroff wirkten die Fassaden trotz ihrer Stuckaturen und Reliefs, so als wüssten sie, dass man hier jenseits der Bahn nichts zu verschenken hatte – weder Geld noch übertriebene Herzlichkeit.
«Wie schön», sagte Hulda und lächelte, «dann sind wir ja Nachbarn. Mein Name ist Hulda, Hulda Gold.»
«Sehr angenehm», sagte die Frau und nickte ihr in Ermangelung einer freien Hand zu. «Frieda Knef.»
«Dann kommen Sie aus Berlin, wenn Ihre Eltern noch hier leben?», fragte Hulda.
«Echtes Berliner Original!» Jetzt lachte Frau Knef zum ersten Mal. «Jetauft mit Berliner Kindl, sozusagen, und aufjewachsen hier uff der Roten Insel.» Sie fiel ein wenig ins Berlinerische, als wolle sie zeigen, dass sie wirklich eine von hier war.
«Na dann, willkommen zu Hause», sagte Hulda und fügte beinahe bedauernd hinzu: «Ich muss jetzt weiter, die Arbeit ruft, aber vorher brauche ich ein Mittagessen.»
«Was arbeiten Sie denn?», rief ihr Frau Knef hinterher, als Hulda schon ein paar Schritte weiter war.
Sie drehte sich noch einmal um. «Ich bin Arzthelferin hier in der Praxis bei Doktor Fischer», erklärte sie und winkte. «Kommen Sie jederzeit vorbei, egal, ob Sie Hustensaft brauchen oder eine Tasse Kaffee.»
Damit lief sie weiter die Straße hinunter, bog ab in Richtung Königin-Luise-Gedächtniskirche mit der Käseglocke als Dach und fand sich in der Gustav-Müller-Straße wieder. Die Krimlinden ringsum blühten herrlich, doch Hulda spürte eine Spur Unwillen. Immer noch kam ihr das Wort Arzthelferin nicht leicht über die Lippen, denn sie war schließlich Hebamme! War es immer gewesen, hatte all ihren Stolz und ihre Stärke aus dieser Arbeit bezogen: Kindern auf die Welt zu helfen, Familien beizustehen, die Welt in einer Nacht zu einem etwas besseren Ort zu machen, einfach dadurch, dass wieder ein neues, noch unbeschattetes Leben darin seinen Platz einnahm und ihnen allen, die bereits länger auf dieser Erde wandelten, Grund zur Hoffnung gab.
Aber dann war sie schwanger geworden und hatte ihren Verlobten an die tückischen Strömungen in der Havel verloren. Wenn sie daran dachte, spürte sie ein schmerzliches Ziehen. Und obwohl es über ein halbes Jahr her war, kamen ihr immer noch sofort die Tränen. Johanns Tod hatte ihre ganze Existenz bis auf die Grundfesten erschüttert. Sie war achtkantig aus der Frauenklinik geflogen, wo eine Hebamme unter den männlichen Medizinerkollegen ohnehin schon um ihre Rolle fürchten musste, eine ledige, schwangere Hebamme aber ein Ding der Unmöglichkeit war. Der neue Direktor Stoeckel hatte zwar kein Hehl daraus gemacht, dass er eine patente, erfahrene Arbeiterin wie sie ungern ziehen ließ, doch andererseits betonte er, dass sie ohnehin in wichtigen Dingen verschiedener Meinung gewesen seien.
«Fräulein», hatte er gesagt und das Wort dabei so betont, als sei es eigentlich eine Beleidigung, «besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.»
Dann hatte er gönnerhaft einen Extra-Monatslohn auf den Tisch gelegt. «Für das Kleine.» Und sie hatte das Geld mit schamesroten Wangen genommen, denn eine unverheiratete, arbeitslose Frau mit einem Kind im Bauch konnte sich falschen Stolz nicht leisten.
Zum Glück gab es Grete, dachte Hulda und lief erst am Uhrmacher Hermann Lüders vorbei, dann am Eisenwarengeschäft von Hugo Berger an der Ecke. Die junge Ärztin, mit der sie bereits oft zusammengearbeitet hatte und die sie seit vielen Jahren schätzte, hatte das zusätzliche Paar fachkundiger Hände gern angenommen und Hulda sogar noch die kleine Hausmeisterwohnung im Souterrain vermittelt. Dank Grete hatte Hulda nun ein Dach über dem Kopf und ein bescheidenes Einkommen – vorerst. Die Stelle war die Rettung gewesen, und Hulda vergaß das nie, auch dann nicht, wenn sie sich dabei ertappte, dass sie Sehnsucht hatte nach ihrer früheren Arbeit an einer der renommiertesten Kliniken der Stadt. Und nach ihrem alten Ich.
Vor ihr lag nun die breite Kolonnenstraße, das Herzstück der Schöneberger Insel, die deswegen so hieß, weil sie rundum durch Bahnschienen von der restlichen Stadt getrennt war – vier Brücken führten aufs Festland zurück nach Berlin. Und Hulda fand, dass es sich auch wirklich so anfühlte, als lebte man hier auf einer Insel – die der kleinen Leute, der Handwerker und, vor allem, der traditionellen KPD-Wähler.
Sie blieb einen Moment stehen und verschnaufte. Dabei musste sie beinahe lachen – wie oft hatte sie Frauen in ihrem Zustand gut zugeredet, alles langsamer anzugehen, sich in den letzten Wochen der Schwangerschaft nicht unnötig zu belasten? Und nun rannte sie selbst in ihrem üblichen Stechschritt durch das Sedanviertel, als sei sie einer der Füsiliere, die hier früher durchmarschiert waren, von der Kaserne an der Papestraße auf dem Weg zum Tempelhofer Feld. Man konnte eben nicht aus seiner Haut. Und noch viel weniger konnte man seine eigene Patientin sein – was sie selbst anging, war Hulda blind wie ein Maulwurf. Was, bei Lichte betrachtet, gut zu ihr passte, denn nichts anderes bedeutete ihr Name im Hebräischen: Maulwurf. Das jedenfalls hatte Bert, ihr guter alter Freund vom Winterfeldtplatz, ihr gerade neulich erst wieder bei einem ihrer selten gewordenen Besuche unter die Nase gerieben.
«Und was ist mit Ihrer alten Geschichte um diese geheimnisvolle Prophetin Hulda?», hatte sie spitz gefragt.
Bert hatte sein Sphinxlächeln gezeigt und abgewinkt. «Nichts hat nur eine Bedeutung», hatte seine kryptische Antwort gelautet. «Wir alle sind viele zugleich.» Dann war er in ein leises Lachen ausgebrochen und hatte ihren riesigen Bauch gemustert. «Und Sie, meine Liebe, sind im Moment mindestens zwei.»
Ach, sie vermisste ihn und seine liebevollen Unverschämtheiten. Vermisste es, jeden Tag als Erstes zu seinem Kiosk zu schlendern und sich von ihm mit Nachrichten und der stillschweigenden Gewissheit füttern zu lassen, dass da zumindest einer war, der für sie einstand. Stattdessen hatte Hulda dem Winterfeldtplatz, wo sie sich stets beobachtet fühlte, den Rücken gekehrt und lebte nun hier. Es war wirklich ein Inseldasein, als erreichte das echte Leben, das Leben, das Hulda früher gekannt hatte, sie hier hinter den Bahnschienen nicht mehr. Als sei sie ins Exil gegangen. Dabei war doch alles so ähnlich! Auch hier konnte sie beim Zeitungsjungen an der Ecke Hohenfriedbergstraße eine Mottenpost kaufen, auch hier gab es einen Eiermann, einen hohen Kirchturm und einen Bäckerladen, in dem die Schusterjungen sogar eine Spur knuspriger waren als auf dem Winterfeldtmarkt. Und doch hätte sie liebend gern weiter die etwas altbackeneren Erzeugnisse am Bäckerstand vor der Matthiaskirche gegessen, im Duft der Weißdornbüsche, nur ein paar Schritte entfernt von ihrer alten, lieb gewonnenen Mansarde bei Frau Wunderlich – wenn das nur bedeutet hätte, dass sie zu Hause war.
Beim Gedanken an ihre ehemalige Vermieterin stiegen Hulda doch wahrhaftig die Tränen in die Augen! Verärgert wischte sie sich mit dem Handrücken über die Wange und ging schnell weiter. Und als ihr drüben auf der anderen Straßenseite eine Patientin von Grete zuwinkte, zwang sich Hulda sogar zu einem Lächeln. Das durfte sie dem alten Drachen nicht erzählen, dass sie vor Sehnsucht nach den Kaffeekränzchen in ihrer Küche, die doch meistens eher einem Autodafé der spanischen Inquisition geglichen hatten, flennte. Schließlich war Hulda freiwillig gegangen, ihre Zimmerwirtin hatte sogar einen halbherzigen Versuch gemacht, sie zum Bleiben zu überreden. Aber Hulda wollte auf keinen Fall auf Margret Wunderlichs samtenem Kanapee mit einem Säugling niederkommen, einem Kind, das von einigen spitzen Zungen in ihrem Viertel bereits als Bastard bezeichnet wurde, wie Hulda, deren Ohren besser waren als je, sehr wohl gehört hatte. Nein, ihre Zeit als junge, ledige, unbeschwerte Frau war abgelaufen, die Duldung ihrer Albernheiten beendet. Es war Zeit gewesen, erwachsen zu werden und eine neue Bleibe zu finden, in der sie niemandem Rechenschaft über ihren Zustand ablegen musste. Doch diese Mauser, dieses Abwerfen des letzten schützenden Federkleids hatte Hulda mehr Kraft gekostet, als sie je geahnt hätte, so als sei sie jetzt erst wirklich, wirklich allein.
Schon von Weitem entdeckte Hulda den Wurstmann und lief quer über die Straße.
«Zwei heiße Knacker», bat sie Egon Kazorke, der hier an der Ecke stets um die Mittagszeit in gestreifter Schürze und mit einer großen Zange bewaffnet Würstchen aus seinem Umhängekessel an hungrige Passanten verkaufte.
«Tach, Hulda», sagte er, und sie zuckte wie immer bei dieser Anrede zusammen. Auf der Roten Insel ging es weniger formell zu als drüben auf dem Schöneberger Festland, wo man sie Fräulein rief. Hier war sie einfach nur Hulda. «Wie immer mit Mostrich?»
Sie nickte, und er fischte mit seiner Zange zwei Würste aus dem Kessel, legte sie zwischen zwei Scheiben Weißbrot und klatschte ordentlich Senf darauf.
«Wat macht Grete?», fragte er, als Hulda nach der dampfenden Klappstulle griff.
Es war seltsam, dachte Hulda, auch daran hatte sie sich noch nicht ganz gewöhnt: dass hier auf der Insel nicht sie, sondern Grete Fischer diejenige war, für die sich die Leute interessierten. Grete war die Ameisenkönigin in diesem kribbelnden Staat und Hulda allenfalls ein fleißiges Arbeiterinsekt. Dabei war Hulda nicht etwa neidisch, sie verstand es sogar, denn Grete war etwas Besonderes. Zart, schlank, mit rotblondem Haar wie ein Mädchen – doch hinter der lieblichen Fassade raubeinig und mit der schärfsten Zunge, die sie kannte. Hier im Kiez rund um die Sedanstraße gab es keinen, dem sie nicht schon einmal einen Gefallen getan hatte. Und die Menschen dankten es ihr mit Bewunderung. Eigentlich war sie Gynäkologin, aber seit Hulda in ihrer Praxis arbeitete, hatte sie verstanden, dass Grete auch die Funktion einer Hausärztin übernahm, wann immer das nötig war. Erst kamen die Frauen, dann brachten sie ihre verrotzten Kinder mit, und irgendwann schleppten sie auch ihre Männer in die Behandlungsräume der eifrigen Frau Doktor Fischer, damit diese sich ein Furunkel oder einen bösen Schnitt ansah, der nicht aufhören wollte zu eitern. Für die Anwohner war sie die ureigenste Frau Doktor, vom Firmament gefallen wie ein Stern, um den kleinen Leuten, den Arbeitern, zu leuchten.
«Alles paletti bei Grete», sagte Hulda und biss in die heißen Knacker. Es tropfte, und sie verbrannte sich ein wenig die Zunge – herrlich! Ihr Appetit war mit ihrem Bauchumfang gewachsen, vor allem der auf Herzhaftes, und Hulda sah nicht ein, weshalb sie die verbliebenen paar Wochen darben sollte. Leider musste sie jedoch ihr Geld zusammenhalten und durfte sich nicht allzu viel Luxus gönnen. «Seit es so schön warm ist, sind die Grippefälle endlich weniger geworden, das war ja schlimm diesen Winter!»
Der Wurstmaxe blickte in den wolkenlosen blauen Himmel. «Trotzdem sind einije da drüben uff den Zwölf-Apostel-Friedhof umjezogen», sagte er in bestem Berliner Humor und biss, als wollte er Hulda Gesellschaft leisten, ebenfalls in eine Wurst. «Man sollte dit Leben jenießen, solange es jeht, wa?»
Hulda lächelte und wollte schon weitergehen, da fügte Egon hinzu: «Sach mal Grete, sie soll ’n bisschen vorsichtiger sein. Nich allen passt dit, wat sie da im Lokal von Emil Potratz so treibt.»
Überrascht drehte Hulda sich um. Senf tropfte auf ihren vorstehenden Bauch, der irgendwie dauernd im Weg war und daher ständig bekleckert wurde. Notdürftig wischte sie den Kleiderstoff ab und leckte sich die Finger.
«Was meinen Sie?» Das Du mit dem Wurstmaxe ging ihr einfach noch nicht von den Lippen. Vielleicht musste sie dazu etwas länger hier leben als nur ein paar Monate.
«Hab von dem Kohlenhändler jehört, dass ’n paar Braunhemden hinter den Leuten her sind, die da ein und aus gehen», sagte er und aß ungerührt seine Wurst auf. «Und Grete is da ja mittenmang bei den Kommunisten, weeßte doch. Und ihr Theo noch viel mehr.»
«Und Sie nicht?»
«Icke?» Egon Kazorke schüttelte abwehrend den Kopf. «Bin bei der SPD, das andere ist mir zu dunkelrot. Ick bin für die Demokratie. Aber ick will nich, dass Grete wat passiert. Kann sie jut leiden.»
«Ich werde es ihr ausrichten.»
Hulda nickte noch einmal freundlich und ging tief in Gedanken weiter. Rechts von ihr bohrte sich der markante Turm des backsteinernen Bahnhofsgebäudes hoch in die Luft, darunter lag das Schienengewirr der Station Schöneberg. Zurück ging es über die Kolonnenstraße und links in die Sedanstraße, die hier am nördlichsten Ende begann.
Kazorke hatte ihre Sorgen um Grete aufgewühlt, die sie seit einiger Zeit umtrieben. Hulda hatte die politische Gesinnung der Ärztin immer gekannt, hatte sie auch dafür bewundert, eine so dezidierte Meinung zu vertreten und genau zu wissen, wofür – oder wogegen – sie kämpfte. Doch erst seitdem sie hier bei Grete lebte und arbeitete, war ihr die Dimension aufgegangen, in der Grete in die kommunistische Bewegung verstrickt war. Sie war nicht nur eine interessierte Teilnehmerin bei den Treffen in Potratz’ Lokal, sie war die treibende Kraft dort – zusammen mit ihrem Freund Theo Jeschke, einem charmanten, aber äußerst dickköpfigen Mann. Hulda war nicht nur einmal das Wort fanatisch durch den Kopf geschossen, wenn sie ihm mal wieder bei einer seiner Brandreden für den Kommunismus zuhörte. Und auch Grete, fand sie, neigte neuerdings zu radikalen Ansichten, die sie ihr nicht zugetraut hätte. Oder lag das daran, dass sie früher, als sie einander nur ab und zu geholfen hatten, nie viel miteinander geredet hatten, Hulda nun aber jeden Tag mit ihr zusammen war?
Plötzlich trat das Kind in ihrem Bauch sie in die Rippen, und Hulda blieb stehen, schnappte nach Luft und tastete nach den Füßchen unter ihrer Bauchdecke. «Du kleiner Schlawiner», flüsterte sie unhörbar und spürte, wie sich eine große Freude in ihr ausbreitete und den Anflug von Sorge vertrieb. Eine Straßenbahn fuhr bimmelnd an ihr vorbei Richtung Süden, und hinten im offenen Coupé stand ein kleiner Junge an der Hand seines Vaters. Der Mann, in offener Jacke und mit einer Kreissäge aus Stroh auf dem Kopf, blickte in eine andere Richtung, doch der Junge betrachtete Hulda, dann ihren dicken Bauch und hob die kleine Hand. Er winkte ihr zu, und Hulda, mit einem bittersüßen Ziehen im Magen, winkte zurück. Winkte immer weiter, so lange, bis die Tram auf dem sonnenüberglänzten Straßenpflaster nur noch so klein wie eine Spielzeugeisenbahn aussah – von der elektrischen Leitung am Himmel festgebunden wie an einem silbernen Fädchen.
2.
Freitag, 4. Juni 1926
«Nicht so schnell», sagte Grete, und Hulda, die sich gerade über ein kleines Mädchen im Hemd beugen wollte, das im Behandlungszimmer auf einem Stuhl saß, hielt inne und sah die Ärztin fragend an.
Grete reichte ihr einen Mundschutz aus weißem Stoff.
«Den solltest du immer tragen, vor allem jetzt, in deinem Zustand.» Sie deutete auf Huldas vorstehenden Bauch unter dem Schwesternkittel. Auch sie hatte sich einen Schutz vors Gesicht gebunden und desinfizierte sich jetzt gründlich die Hände.
Während Hulda die dünnen Bänder hinter den Ohren festknotete, betrachtete sie besorgt das Kind vor ihr: Rieke Malteser, neun Jahre alt, erster Besuch in der Praxis. Sie war stark untergewichtig, deutlich traten ihre Schlüsselbeine unter den vergilbten Trägern des Unterhemds hervor. Damit war sie zwischen den Kindern hier auf der Roten Insel zwar in bester Gesellschaft, doch bei ihr kamen noch weitere Symptome hinzu, die auf nichts Gutes schließen ließen. Sie war sehr blass, hohlwangig, und ihr Atem ging rasselnd. Prüfend betrachtete Hulda ihren Hautton: Auf den Wangen lag eine fiebrige Röte.
Riekes Mutter, eine stämmige Brünette in Kittelschürze, stand ein paar Meter entfernt bei der Tür und knetete nervös die roten, abgearbeiteten Hände.
«Isses dit, wat ick befürchte, Frau Doktor?», fragte sie mit leiser Stimme.
Grete trat neben Hulda, die eine Hand auf die knochige Schulter der Kleinen gelegt hatte. «Wir werden sehen», sagte sie, und wie schon öfter zuckte Hulda beim schroffen Ton der Ärztin zusammen. Grete Fischer arbeitete schon zu lange als Armenärztin in der Sedanstraße, um noch die Kraft für Süßholzraspeln aufzubringen. Manchmal wünschte Hulda dennoch, dass sie etwas sanfter mit ihren Patientinnen spräche. Denn die Frauen, die hierherkamen – ob mit eigenen Leiden oder denen ihrer Kinder –, hatten wirklich schon genug zu tragen und konnten ein paar freundliche Worte gebrauchen.
«Kennst du den kleinen Kerl hier?», fragte Hulda das Mädchen mit warmer Stimme und zog einen abgegriffenen Stoffhasen hervor, mit dem sie die Kinder in der Praxis zu beruhigen pflegte. Rieke war eigentlich schon etwas zu alt dafür, aber sie war so zart, dass sie Hulda viel jünger vorkam. Ihre dunklen Augen wirkten riesig in dem ausgezehrten Gesichtchen, doch beim Anblick des Stofftiers leuchteten sie kurz auf.
«Wie heißt er denn?», fragte sie heiser.
«Charlie», sagte Hulda feierlich. «Wie Charlie Chaplin. Siehst du die Hosenträger?» Sie ließ den Hasen kurz tanzen wie den berühmten Filmstar.
Rieke lächelte. Die Sommersprossen auf ihrer bleichen Stirn hoben sich dunkel ab.
«Charlie bittet dich, ein paar Mal kräftig zu husten.» Hulda hielt ihr den Hasen jetzt vors Gesicht und ließ seine Ohren wackeln.
Grete stellte sich mit dem Stethoskop neben sie und horchte Rieke am Rücken ab, während das Mädchen keuchend hustete und ein wenig Schleim in ein Näpfchen spuckte, das Hulda ihr vorsorglich in die Hände gedrückt hatte. Hulda und Grete wechselten einen Blick.
«Ihre Tochter muss so bald wie möglich ins Auguste-Viktoria-Krankenhaus zur genaueren Untersuchung», sagte Grete über die Schulter zu Frau Malteser und legte das Stethoskop zur Seite. «Wir müssen eine Röntgenaufnahme von ihrer Lunge machen. Die Symptome deuten leider alle darauf hin, dass sie ernsthaft krank ist. Schlaflosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsverlust – dazu dieser Husten und sehr deutliche Geräusche auf beiden Lungenflügeln.»
«Ins Krankenhaus?» Frau Malteser sah sie mit ängstlicher Miene an. «Wirklich? Können Sie ihr nich ’ne Medizin uffschreiben, Frau Doktor?»
«Leider gibt es gegen Tuberkulose immer noch keine geeigneten Medikamente», erklärte Grete, ihre Stimme war nun doch ein wenig freundlicher. «Dabei ist es schon über zwanzig Jahre her, dass Robert Koch das Tuberkelbakterium entdeckte. Aber es ist eine heimtückische, ansteckende Krankheit, die sich erfolgreich gegen ihre Ausrottung wehrt.» Grete blickte Frau Malteser eindringlich an. «Rieke sollte also unbedingt in einem eigenen Bett schlafen.»
Bei diesen Worten zuckte die Frau zusammen, ihre schwieligen Hände verkrampften sich ineinander wie zu einem stummen Gebet.
«Aber wat machen wir dann bloß mit der Göre?», fragte sie hilflos und deutete mit dem Kopf auf ihre Tochter, die das Gespräch stumm verfolgte, während sie die weichen Ohren des Stoffhasen streichelte. «Zu Hause hab ick noch dreie und nur eene Schlafstube.»
Hulda sah, wie es im Gesicht der Frau arbeitete. Sie wusste, dass sich die Kinder in den Hinterhofwohnungen hier auf der Insel oft ein Bett teilten und dass Gretes Forderung nach Isolierung der Kranken beinahe unmöglich umzusetzen sein würde.
«Umso wichtiger, dass Sie sich zu Hause an die Hygieneregeln halten», sagte Grete. «Regelmäßiges Händewaschen mit Seife, Husten nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Wenn Auswurf kommt, soll Rieke in ein eigenes Fläschchen oder Schüsselchen spucken. Und bitte, kochen Sie Frischmilch immer ab, besonders wenn Sie sie hier in der Gotenstraße aus den Höfen holen. Auch Kühe können Tuberkulose übertragen.»
Hulda strich Rieke sanft über den Rücken, nahm den Hasen wieder an sich und half dem Mädchen, den Kittel über das Unterhemd zu ziehen.
Währenddessen schrieb Grete etwas auf einen Überweisungsschein und hielt ihn der Mutter hin.
«Melden Sie sich, sobald es geht, bei Doktor Freisinger im AVK», sagte sie, «und bitten Sie um ein Röntgenbild. Seit letztem Jahr dürfen wir Ärzte erst dann eine Überweisung in die Beelitzer Heilstätten veranlassen, wenn der Befund durch ein Bildverfahren abgesichert ist. Ohnehin sind sie dort überbelegt und nehmen nur noch Frauen und Kinder auf.»
«Nach Beelitz soll se?», fragte Frau Malteser erschrocken und schlug sich die Hand vor den Mund. «So weit weg?»
«Es ist die einzige Hoffnung für Ihre Tochter», erwiderte Grete knapp, aber zum Glück so leise, dass Hulda hoffte, Rieke habe es vielleicht nicht gehört. Dennoch warf sie Grete einen scharfen Blick zu. Dann wandte sie sich ihrerseits an die Frau, zog ihren Mundschutz ein wenig herunter und bemühte sich um ein beruhigendes Lächeln. «Dort wird es Rieke sicher gut gehen», sagte sie. «Das Mädchen bekommt Ruhe, frische Luft, wohltuende Anwendungen und Bäder. Gerade bei einem leichten Verlauf können die Heilstätten viel bewirken.»
«Und wenn’s keen leichter Verlauf is?», fragte Frau Malteser mit aufgerissenen Augen.
Hulda fühlte, wie Hilflosigkeit sie überkam. Verstohlen betrachtete sie das kleine Gesicht von Rieke, die bläulichen Schatten unter ihren Augen, die schmale, eingefallene Brust. Nein, sie hatte keine einfache Antwort auf diese Frage. Und so griff sie zu einer Notlüge.
«Ich bin überzeugt, dass Rieke sich ganz wunderbar erholt», sagte sie und musste sich zusammenreißen, um nicht auch für Frau Malteser den Hasen tröstend tanzen zu lassen. Dann wandte sie sich zu dem kleinen Mädchen. «Und jetzt ist es Zeit für eine Belohnung, weil du so artig warst.» Sie griff in ein Bonbonglas auf dem Schreibtisch und hielt Rieke zwei süße Dragees hin. Die Kleine strahlte und schob sich eins in den Mund, das andere steckte sie in ihre ausgefranste Kitteltasche wie einen kostbaren Schatz.
Grete öffnete die Tür. «Guten Tag», sagte sie und trat ohne einen weiteren Blick auf die beiden ans Waschbecken.
Nachdem Mutter und Tochter das Behandlungszimmer verlassen hatten, zog Hulda sich den Mundschutz ganz herunter. «Du warst ziemlich hart», sagte sie, nachdem sie sicher war, dass die Tür wieder geschlossen war. «Sollten wir diesen armen Leuten nicht Mut machen?»
Grete zuckte nur die Schultern, wusch sich die Hände und bedeutete Hulda, es ihr gleichzutun. Gemeinsam standen sie am Waschbecken und schrubbten sich die Finger, bis sie gerötet waren. Nachdenklich sah Hulda dem Wasser zu, wie es gurgelnd in den Abfluss rann.
«Ich bin schon länger als du im Geschäft, Hulda», sagte Grete schließlich. «Ich weiß, dass es nichts hilft, die Dinge schönzureden. Diese Frau muss verstehen, dass es schlimm um ihre Tochter steht. Nur dann wird sie sich aufraffen, noch einen unbezahlten Arbeitstag freizunehmen, mit ihr ins Krankenhaus zu fahren und den Papierkrieg aufzunehmen, den es braucht, damit Rieke ein Bett in den vollkommen überfüllten Heilstätten ergattert. Das Leben ist ein Kampf, vor allem für die kleinen Leute hier auf der Insel.»
«Ich bin mindestens so lange im … Geschäft wie du», erwiderte Hulda. «Ich kenne mich aus mit der Armut in Schöneberg und –»
«Tja, da gibt es die Armut am Winterfeldtplatz», warf Grete spöttisch ein, «und dann eben die Armut hier, jenseits der Bahn. Du denkst, du hast schon alles gesehen? Dann bleib noch ein paar Jahre bei mir in der Praxis – und du wirst verstehen, was wirkliche Not ist.»
Grete hatte recht, dachte Hulda. Während sie bei ihrer Arbeit im bürgerlicheren Teil von Schöneberg immer wieder auch herrschaftliche Wohnungen von innen gesehen hatte, gab es hier in den Straßen innerhalb der vier Schöneberger Brücken viel mehr Elend als drüben. Es war ein reines Arbeiterviertel, und bei der politischen und wirtschaftlichen Lage bedeutete das leider nur allzu oft: Arbeitslosenviertel. Zwar war das tiefste Tal der Hyperinflation vor drei Jahren eigentlich durchschritten, doch davon bekamen die Ärmsten der Stadt wenig mit. Für sie herrschte weiterhin tiefste Depression in den engen, schmutzigen Wohnungen, in die kaum Licht fiel.
Nachdenklich band Hulda sich die Schürze ab, Rieke Malteser war die letzte Patientin für heute gewesen.
Noch ein paar Jahre, dachte sie – nun, wahrscheinlich würde ihr gar nichts anderes übrig bleiben. Dabei hatten sie und Grete bisher gar nicht im Detail darüber gesprochen, wie ihr neu geschaffenes Arbeitsbündnis weitergehen würde, wenn Huldas Kind auf der Welt wäre. Doch arbeiten musste sie ja! Und wenn nötig, dann eben mit Kind. Grete würde ihre Hilfe auch in Zukunft nicht ausschlagen, denn Hulda machte, wie sie selbst wusste, ihre Sache sehr gut. Vielleicht wäre es das Beste, sie würden einen kurzfristigen Ersatz für die Wochen nach der Geburt finden. Jemand, der Grete unterstützen konnte, bis Hulda hoffentlich bald wieder einsatzfähig wäre. Aber würde sie wirklich einen Säugling bei ihrer fordernden Arbeit in der Praxis dabeihaben können? Sie sollte unbedingt bald mit Grete darüber reden. Doch beide Frauen scheuten sich, das heikle Thema anzuschneiden. Grete musste wissen, was die drohende Erwerbsunfähigkeit für Huldas Leben bedeuten würde, doch sie konnte andererseits auch keine Almosen vergeben, das wusste Hulda.
Außerdem fragte sie sich, ob es wirklich das war, was sie wollte? Sie fühlte sich einfach nicht in ihrem Element in der Praxis, alles war durch Grete geprägt, auf ihre Vorgehensweise ausgerichtet, auf ihre Art, mit den Patienten zu sprechen, ihre strenge, effiziente Methode, unbürokratisch zu helfen und doch niemals persönlich zu werden.
Ja, dachte Hulda, während sie die Schürze weghängte und begann, mit langsamen Bewegungen das Behandlungszimmer aufzuräumen, es herrschte eine seltsame Kluft zwischen Gretes Bereitschaft, sich einerseits bis zur eigenen Erschöpfung aufzuopfern, sich selbst unüberschaubaren Risiken auszusetzen, wenn sie wieder einmal gegen das Gesetz und nur nach ihrem eigenen Gewissen handelte – und andererseits ihrem Unvermögen, empathisch mit den Menschen umzugehen, die sie behandelte. Es war, als schenkte sie ihnen durch ihre Behandlung alles an Kraft, das sie besaß, und als bliebe danach nichts übrig für Beiwerk wie ein freundliches Lächeln, echte Anteilnahme oder Trost. Doch für Hulda war genau das eben kein Beiwerk. Es war das, was für sie einen heilenden Beruf ausmachte: wirkliche Fürsorge, das Interesse an den Menschen, die Einfühlung in ihre Sorgen, Nöte, ja in ihre Seelen. Und damit, das wusste sie, würden Grete und sie nie ganz im Einklang arbeiten können.
Diese Überlegungen waren natürlich purer Luxus, dachte sie dann und kräuselte spöttisch die Lippen. Eine unverheiratete Frau mit Kind und ohne Ersparnisse durfte nicht wählerisch sein. Und wenn sie sich und ihren Sprössling mit der Arbeit in Gretes Praxis über die nächsten Jahre bringen konnte, würde sie einen Teufel tun und diesen Strohhalm aus falschen Ambitionen heraus loslassen. Nein, sie würde sich vielmehr daran klammern und eben Schritt für Schritt ihren Weg finden müssen. Ihren eigenen Platz in den kleinen Praxisräumen der Sedanstraße. Arbeit gab es genug.
«Kommst du?», fragte Grete und löschte das Licht. «Höchste Zeit, etwas zu essen und nachher früh schlafen zu gehen. Wer weiß, was uns heute wieder blüht.»
Das stimmte, es verging fast keine Nacht, in der nicht eine Frau in Not bei ihnen klingelte, weil sie blutig geprügelt worden war – ob von einem Freier oder ihrem eigenen Ehemann – und zusammengeflickt werden musste. Oder, was auch oft geschah, dass eine verzweifelte Schwangere zu ihnen kam und Grete anflehte, ihr Problem zu lösen. Sei es, weil sie das nächste Kind nicht mehr würde ernähren können, sei es, weil sich der Vater aus dem Staub gemacht und sie nun von Elend und Schande bedroht war. Grete half immer. Und Hulda, die bei den nächtlichen Behandlungen ein Schauder überkam, wenn sie an die möglichen Konsequenzen dachte, musste sich stets daran erinnern, dass sie selbst schon von Gretes Erbarmen profitiert hatte. Sowohl als sie selbst einmal vor Jahren kein Kind bekommen wollte als auch im vergangenen September, als Grete ein armes Dienstmädchen vor dem Verbluten retten konnte, das Hulda ihr in höchster Not angeschleppt hatte. Zwar war die Strafe, die auf Abtreibung stand, vor ein paar Monaten von Zuchthaus zu nur einer Gefängnisstrafe abgeschwächt worden, doch das vermochte keine der Frauen zu trösten. Außerdem hielt die Angst vor den Folgen auch keine davon ab, es zu tun – was in Huldas Augen nur noch ein weiteres Zeichen für die tiefe Verzweiflung war, in der die Frauen steckten.
Das Kind in ihr trat sie schmerzhaft in die Rippen, als wollte es seine Mutter daran erinnern, dass es noch da war. Lächelnd strich Hulda sich über die Seite und folgte Grete in die Küche. Dieses Kind würde geboren werden. Und egal, wie anstrengend Huldas Leben war und noch werden würde – sie bereute es keine Sekunde.
«Du hast wieder dieses mütterliche Grinsen im Gesicht.» Grete stand schon an der Anrichte, um Brot zu schneiden. Ob sie die Mundwinkel aus Freude oder aus Spott verzog, vermochte Hulda nicht zu sagen. «Eins muss ich dir neidvoll lassen – die Schwangerschaft steht dir.»
«Zieh mich nicht auf», sagte Hulda. «Ich weiß manchmal auch nicht, was mit mir los ist. Bin ich eine Närrin, weil ich mich so auf das Kind freue?»
«Da fragst du die Falsche», murmelte Grete und ließ sich mit einer Butterstulle in der Hand auf einen Küchenstuhl fallen. Sie pustete sich eine rotblonde Strähne aus der Stirn, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatte, und biss herzhaft ins Brot. «Aber ich bin froh, dass ich ausnahmsweise mal dabei helfen darf, dass ein Kind geboren wird und nicht andersherum.» Sie verschlang den nächsten Bissen. «Wenn ich geahnt hätte, was mir hier blüht, als ich die Praxis vor Jahren vom alten Doktor Rasch übernommen habe – wer weiß, ob ich eingewilligt hätte. Aber ich war jung und hungrig nach Arbeit. Hungrig danach, etwas zu bewirken in diesem Chaos.»
«Und heute?»
«Heute bin ich nur noch hungrig», sagte Grete lachend und stopfte sich das restliche Brot in den Mund. Sie kaute und fuhr mit vollem Mund fort: «Nein, aber mal ehrlich – ich fühle mich manchmal einfach müde. Dieser Kampf gegen Windmühlen laugt mich aus, mehr, als ich es mir als junge Ärztin im Praktischen Jahr hätte ausmalen können.» Sie schluckte und senkte die Stimme. «Weißt du eigentlich, dass ich nicht einmal meine Facharztausbildung zu Ende gebracht habe?»
Hulda sah sie erstaunt an. «Ich dachte, du seist Gynäkologin?»
Unbekümmert fegte Grete ein paar Krümel von ihrer Bluse. «Nun, streng genommen nicht», sagte sie, «aber verrate das den Leuten hier nicht. Obwohl ohnehin die wenigsten nach solchen Feinheiten fragen. Ich konnte es damals nicht abwarten, und als der alte Rasch mir diese Praxis sozusagen vor die Füße warf, da griff ich zu und schmiss den Facharzt. Niemand fragte je danach, und niemand anders wollte die Praxis weiterführen. Außerdem waren die Behörden froh, dass weiterhin jemand auf der Insel die Leute behandelte.» Sie blickte Hulda herausfordernd an. «Hältst du mich für dumm?»
«Nein», sagte Hulda, «ganz und gar nicht. Ich war ja selbst vor vielen Jahren deine Patientin. Du hast mir damals geholfen, ohne Fragen zu stellen, und ich war heilfroh, dass es dich gab.» Sie lächelte. «Ich bewundere dich, weil du schon früh so genau wusstest, was du wolltest. Ich dagegen habe mich nie getraut, mich überhaupt erst an einer Universität zu immatrikulieren.»
«Ich hatte es leichter», sagte Grete achselzuckend. «Mit Akademikern als Eltern und genug Geld in der Familie, das mich aufgefangen hätte. Aber ich hätte mir damals, als höhere Tochter, in meinen Weltrettungsfantasien niemals ausmalen können, wie wenig glorreich so ein Leben im Armenviertel ist.»
«Und trotzdem würdest du nicht tauschen», stellte Hulda fest, und Grete nickte grimmig.
«Niemals», sagte sie. «Immerhin das weiß ich. Mein Platz ist hier!»
«Und Theo?», fragte Hulda vorsichtig. Dennoch trat sofort ein abwartender Zug in Gretes Miene.
«Was soll mit ihm sein?»
«Ist dein Platz auch an seiner Seite? Bist du glücklich mit ihm?»
«Natürlich», sagte Grete schnell. «Er und ich, wir stehen auf derselben Seite. Auch er kämpft gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Ausbeutung der Arbeiter. Ich mit dem Stethoskop und er …»
«Mit den Fäusten», ergänzte Hulda automatisch – und sofort erkannte sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Gretes Gesicht verschloss sich.
«Keineswegs», sagte sie trotzig, «vor allem kämpft er mit Worten, mit Überzeugungskunst. Er schreibt all diese Flugblätter selbst, die bei Emil Potratz verteilt werden, weißt du? Und er hat so viele Kontakte in der ganzen Stadt, zu all den anderen Stellen der kommunistischen Partei … Theo ist ein echtes Talent!»
«Das glaube ich», sagte Hulda beschwichtigend. «Aber ich höre immer wieder, dass er und die jüngeren Genossen, die sich bei Emil treffen, nicht vor handfesten Auseinandersetzungen zurückschrecken. Macht dir das keine Sorgen?»
«Nein!» Gretes Augen blitzten. «Ohne Gewalt geht es eben nicht.»
Hulda sah sie überrascht an. Wieder dachte sie, wie verändert Grete wirkte. Rief sie wirklich zu einem gewaltsamen Umsturz auf?
Grete schien ihre Unsicherheit zu bemerken, sie stachelte sie nur noch mehr an. «Hast du jemals von einer Revolution gehört, bei der es nicht gewalttätig zuging? Die mit der Macht in der Hand geben diese nicht einfach so her. Wir müssen sie uns nehmen! Das Volk muss endlich der wahre Souverän im Staat werden.»
«Ich dachte, das sei schon längst so weit?» Hulda war ehrlich verblüfft. «Wir haben doch freie Wahlen seit 1919, oder nicht?»
Grete winkte ab. «Alles nur schöner Schein», sagte sie, und ihre Stimme klang gepresst vor unterdrücktem Ärger. «Die Zustände im Land haben sich doch kaum geändert! Die Arbeiter, die eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft ausmachen, pfeifen auf dem letzten Loch. Niemand kümmert sich um sie.» Sie sah Hulda mit brennendem Blick an. «Überleg doch mal, dieses kleine Mädchen eben, Rieke Malteser – warum wohl hat sie TBC? Wie kommt es denn, dass die Tuberkulose in der Stadt noch immer grassiert, dass sie sich ungehindert verbreitet? Weil die Menschen unter unwürdigen Bedingungen in Löchern hausen, die das Wort Wohnung nicht verdienen. Weil es für die Frauen kaum Möglichkeiten gibt, sich selbst, die Wäsche und die Wohnungen rein zu halten und genug zu lüften. Weil hier immer noch ganze Familien in den Ställen im Hof schlafen, dicht an dicht mit dem Vieh … weil es dort wärmer ist als in ihren Schlafkammern. Und daran ist die Regierung schuld!»
Hulda betrachtete die Kollegin. Grete hatte in vielem recht. Aber die Mittel, die sie guthieß, um etwas zu verändern, waren nicht Huldas Mittel. Es musste einen anderen Weg geben – nur leider hatte Hulda keine Ahnung, wie dieser aussehen sollte.
Wenn sie doch einmal wieder mit Bert reden könnte, dachte sie sehnsüchtig, und das wohlbekannte Heimweh überfiel sie. Vielleicht würde er ihr die Dinge erklären können, die in diesem hitzigen Gespräch mit Grete wie ein Puzzle in tausend Fragen zerfielen.
«Ich bitte dich einfach, sei vorsichtig», sagte sie sanft. «Lass nicht zu, dass Theo dich in etwas hineinzieht, das gefährlich werden kann.»
«Du kennst ihn nicht», erwiderte Grete düster. «Du kennst uns nicht, weißt nichts von uns. Niemals würde er Gefahr über mich bringen. Im Gegenteil, er hat schon oft …» Sie unterbrach sich und wurde rot. Hastig fuhr sie fort: «Manchmal wünschte ich, du wärst ein Teil von uns, ein Teil der Bewegung, aber ich fürchte, das würde nicht klappen. Dir fehlt einfach der Glaube.»
«Dann ist der Kommunismus also eigentlich eine Religion?», fragte Hulda. «Und ich dachte, er wolle genau diese abschaffen.» In dem Moment trat das Kind sie erneut, und sie stand auf und rieb sich die schmerzende Stelle.
Grete starrte sie an, Hulda konnte ihren Gesichtsausdruck nicht deuten. «Ich gehe ins Bett», sagte sie schließlich, obwohl draußen vor dem Küchenfenster die Dämmerung kaum begonnen hatte, sich über den zartblauen Himmel zu breiten. «Und du solltest das auch tun.»
Ohne ein weiteres Wort ließ sie Hulda in der Küche stehen. Ihre hastigen, beinahe wütenden Schritte marschierten bis ans Ende des Korridors, von dem das Zimmer abging, in dem sie schlief.
Nicht einmal eine eigene Bleibe hatte Grete, dachte Hulda. Diese ehemalige höhere Tochter, wie sie sich selbst immer wieder spöttisch nannte, hauste in der Praxis, lebte nur für ihre Arbeit und für die Bewegung. Und offenbar war sie noch fester an Theo Jeschke und seine Ideen von Aufruhr und Revolution geschmiedet, als Hulda geahnt hatte.
3.
Samstag, 5. Juni 1926
Es war ein typischer Berliner Frühsommertag, dachte Karl, als er an der Schultheiß-Patzenhofer-Brauerei vorbeilief und einen Blick an den Schornsteinen entlang in den Himmel riskierte. Er sehnte sich nach Wärme und Sonnenschein, doch er bekam nur knappe 19 Grad und ein graues Wolkenmeer über dem Kopf anstelle eines sommerlichen Badesees zu Füßen. Die Straßen waren noch feucht vom letzten Regenschauer.
In der Luft hing der süßliche Geruch nach Hopfen und Malz, und wie immer, wenn er hier an den Ziegelmauern der Brauerei entlangkam, verdrängte Karl den Gedanken an ein bis zum Rand gefülltes Bierglas mit aller Geistesmacht. Stattdessen versuchte er, vor seinem inneren Auge die Vision eines Kirschsafts heraufzubeschwören, als sei dieses Getränk eigentlich der Inbegriff seiner Sehnsucht. Oder nein, noch besser, ein heißer Kaffee. Kaffee ging immer und war ebenso unverfänglich wie Saft, schmeckte aber besser zur Zigarette.
Wie aufs Stichwort fuhr Karls Hand in die Innentasche seiner Jacke und beförderte ein zerdrücktes Päckchen Glimmstängel zutage. Er steckte sich im Gehen einen an und paffte genüsslich. Da er in seinem Detektivbüro in der Kastanienallee nicht rauchen konnte, ohne dass seine Sekretärin Fräulein Fink wie eine fleischgewordene Rachegöttin auf ihn herniederfuhr, musste er die Momente an der frischen Luft ausnutzen, um sein Laster auszuleben. Denn wenn er sich auch mit übermenschlicher Mühe das Trinken abgewöhnt hatte, so konnte er die Finger doch nicht von seinen heiß geliebten Junos lassen. Aber auf Fräulein Finks Meinung musste man hören, wenn man es sich nicht mit ihr verscherzen wollte. Mit ihr und Wolkow – denn für den hatte sie vor ihrer Tätigkeit bei Karl gearbeitet, und Karl wurde das Gefühl nicht los, dass ihre Loyalität noch immer zu einem großen Teil Antoni Wolkow galt, seinem Vater. Einmal, bei ihrer gemeinsamen Arbeit in der Detektei, hatte sie ihm erzählt, wie sie Wolkow begegnet war. Wie aus dem Nichts sei dieser schöne Mann – ihre Worte – nach dem Krieg in der Tresckowstraße aufgetaucht. Doch Eugenie Fink, die sich in der Welt auskannte, wie sie sagte, hatte nur einmal auf seine tätowierten Hände schauen müssen und sofort geahnt, woher er eigentlich gekommen war. Sie sprachen nicht über seine Vergangenheit, dafür umso mehr über die Zukunft. Er wollte die Kneipe, in der sie als Serviererin arbeitete, kaufen und etwas daraus machen – ein Varieté, wie er es großspurig nannte. Und er sah wohl etwas in der damals gut vierzigjährigen, alleinstehenden Eugenie Fink. Kein Wunder: Sie kannte jeden Stein in der Gegend, jede Spelunke und jedes pockenzerfressene Gesicht in den Straßen der Stadt. Wolkow schickte sie zu einem Maschinenschreibkurs, und da alles, was Eugenie anpackte, ihr auch glückte, stellte sich sofort heraus, dass sie ein ungeheures Schreibtalent war. Außerdem bezahlte er ihr einen Zahnarzt, der ihr neue, strahlend weiße Zähne anpasste, um die schwärzlichen Überreste in ihrem Mund – ein Erbe ihrer ärmlichen Kindheit – zu verdecken. Fortan führte sie Wolkows Geschäfte, jedenfalls so lange, wie diese überschaubar blieben. Aber auch während der Jahre, in denen Wolkow immer mal wieder verschwand, hielt sie die Stellung und kümmerte sich um das Varieté bis zu seiner Freilassung. Nach zwanzig Jahren gab er die Bürokratie schließlich in die Hände eines Kontors und entließ Eugenie nach treuen Diensten in einen gut bezahlten Ruhestand.
«Aber das war nichts für mich, Herr North», hatte sie kopfschüttelnd zu Karl gesagt und ihre übergroßen Zähne gebleckt. Sie sei der Typ Mensch, der arbeiten würde, bis er umfiele. Und so habe sie Wolkow gebeten, er möge sich nach einer neuen Tätigkeit für sie umsehen.
Am Wörther Platz mit seinen herrschaftlichen Stuckfassaden war gerade Markt, und Karl verlangsamte sein Tempo, schlenderte an den kleinen Ständen und Buden vorbei und ließ sich von einer jungen Verkäuferin eine Tüte Waldmeisterbonbons für zwei Groschen andrehen. Eigentlich machte er sich wenig aus Süßigkeiten, aber etwas an der Art, wie die Frau ihre graublaue Kappe zurechtrückte und ihn unter der Krempe spitzbübisch anlächelte, erinnerte ihn für einen Moment an Hulda. Hulda Gold, die er seit Monaten nicht gesehen hatte und die, wenn es nach ihm ginge, auch bleiben konnte, wo der Pfeffer – oder der Waldmeister – wuchs. Doch die Sekunde des Zögerns hatte ihm nun das Tütchen mit den giftgrünen Leckereien eingebrockt – und noch dazu ein nagendes Gefühl der Sehnsucht, das er auch nicht wieder loswurde, als er weiterging und die unbekannte Verkäuferin längst hinter den Buden verschwunden war.
Das letzte Mal, dass Hulda und er sich begegnet waren, dachte Karl, während er auf den Wasserturm zulief, hatte sie ihn in seiner Detektei besucht. Oder sollte er besser sagen, heimgesucht? Denn unter einem Vorwand war sie nach Prenzlauer Berg gekommen, hatte sich bei ihm eingeschlichen und ihn auf einen Fall angesetzt, bei dem es um ein verschwundenes Bild und eine alte, adlige Familie ging. Die Einzelheiten hatte er längst vergessen. Nicht jedoch den Moment, als Hulda und er einander in der abendlichen Dämmerung seines Vorzimmers in die Arme getaumelt waren – und sie ihn nach einer winzigen, wunderbaren Ewigkeit hatte stehen lassen. Angeblich war ihr schwindlig geworden. Doch warum hatte sie dann, kaum dass sie ihre Sinne wiedererlangte, fliehen müssen, als seien zehn Teufel hinter ihr her?
Allerdings war Karl auch nicht stolz darauf, dass er nach diesem Vorfall Fräulein Fink vorgeschickt hatte wie eine Nachtschattenschnepfe, um sich Hulda vom Hals zu halten. Er hatte ihr durch seine Sekretärin am Telefon ausrichten lassen, dass er sie nicht mehr zu sehen wünsche. Angeblich, weil er zu beschäftigt sei. Doch natürlich war ihm klar, dass sich Hulda keine Sekunde von dieser Ausrede hatte überzeugen lassen, sie wusste sicher, wie es um ihn stand. Nun, sie hielt sich seitdem von ihm fern, und er hatte sich den ganzen langen Herbst und Winter über nach Kräften bemüht, dies als etwas Gutes zu sehen. Ein wenig Seelenruhe, ein wenig Abstand würden ihm guttun, denn er hatte ja nicht umsonst schon so viel Kraft und Nachtschlaf verschwendet, um endlich von ihr loszukommen. Er wäre ein Narr, wenn er das für ein paar flüchtige Küsse wieder aufs Spiel setzen würde. Denn dass es ein Spiel für sie war, das hatte er längst verstanden. Und während Hulda stets im entscheidenden Moment ihre Trümpfe ausspielte, verlor er wieder und wieder seinen Einsatz. Doch damit war nun Schluss!
Eine Spur zu kräftig trat er nach einem Kieselstein, der quer über die Straße flog und spritzend in einer Pfütze landete. Eine kleine Horde jüdischer Schuljungen, alle in dunklen Anzügen und mit Schläfenlocken über den Ohren, kam an ihm vorbei, einige der Kinder kicherten, und ein Junge drehte ihm sogar eine lange Nase, als der Lehrer gerade nicht hinsah. Kurz war Karl empört und wollte dem Pennäler etwas Scharfes zurufen, doch dann hielt er inne und musste über sich selbst lachen. Was lief er hier auch so grimmig wie ein rauchender Kobold herum und trat nach Steinen, als seien sie seine Feinde? Er musste wirklich einen komischen Anblick bieten.
Die Kinder liefen weiter über die pfützenübersäte Straße in Richtung Synagoge, deren majestätisch gemauerte Bögen sich in der angrenzenden Rykestraße erhoben, und Karl setzte seinen Weg fort.
Die Tür zum Varieté Lilie war verschlossen, doch als Karl an die Scheibe des Lokals klopfte, öffnete sie sich sofort, und einer der Boys, die hier jeden Gast beäugten, ließ ihn ein und grüßte mit höflichem Tippen an die Mütze.
«Tag, Bruno», sagte Karl, «wie geht’s?»
«Kann nich klagen, Herr North», sagte der Junge und hielt grinsend die Hand auf, um ein glänzendes Markstück in Empfang zu nehmen. «Is aber noch nix los hier.»
«Wird schon noch», sagte Karl und ließ sich den Hut abnehmen, «es ist ja erst Nachmittag.»
«Och, in der Lilie jibt’s weder Tag noch Nacht», sagte der Boy und hängte Karls Hut an einen goldenen Haken. «Aber klar, je später der Abend, desto zahlreicher die Gäste. Und desto schöner.»
«Danke für die Blumen», sagte Karl, lächelte und ging zur Bar. «Machst du mir einen Kaffee, Jo?», fragte er den älteren Herrn mit Halbglatze, der dort gelangweilt herumstand und ein Glas polierte.
Jo nickte und stellte wortlos eine dampfende Tasse vor Karl hin. «Kaffee und Schluck?», fragte er.
Karl schüttelte den Kopf. «Den Schluck darfst du dir gern selbst genehmigen», sagte er. «Auf meine Rechnung».
«Also auf Wolkows.»
Karl zuckte zusammen. Es war eine Sache, dass er wusste, wie oft Wolkow für ihn aufkam, aber eine andere, es von den Mitarbeitern seines Vaters aufs Brot geschmiert zu bekommen. Jo schien den Moment zu genießen. Mit feinem Lächeln goss er sich zwei Fingerbreit hellgoldenen Schnaps in ein dickwandiges Glas, deutete einen Kratzfuß in Karls Richtung an und stürzte das Getränk hinunter.
«Prost», sagte er anschließend, leckte sich unter dem schmalen Bärtchen die Lippen und nahm das Polieren wieder auf. Aber trotz des Gratis-Schnapses blieb ein missmutiger Zug in seiner Miene. Für Jo kam es beinahe Majestätsbeleidigung gleich, wenn man einen guten Tropfen ablehnte. Doch daran sollte er sich bei Karl wirklich langsam gewöhnt haben.
Schulterzuckend griff Karl nach seiner randvollen Tasse und balancierte sie zu einem der weiß gedeckten runden Tische. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und schlürfte etwas Kaffee ab, dann zog er die Jacke aus und hängte sie über die Lehne. Er klopfte eine neue Zigarette aus der Packung und zündete sie sich an, schlug ein Bein über das andere und wippte mit dem Fuß. Das Licht war gedämpft, und tatsächlich konnte man, wie der Boy behauptet hatte, hier drinnen nicht genau sagen, um welche Tageszeit es sich gerade handelte. Die Wände waren mit dunkelrotem Samt bespannt, kristallene Lüster hingen von der Decke, brannten jedoch nicht. Nur kleine Wandleuchten tauchten den hohen Raum in schummriges, diffuses Licht. Rund dreißig Tische standen hier und warteten auf die schöneren Gäste, von denen Bruno gesprochen hatte. Weiter hinten im Saal erhob sich eine Bühne mit einem gerafften, knallroten Seidenvorhang, wo spätabends die eine oder andere Tänzerin ihre Beine in die Luft werfen würde.
Karl war inzwischen häufig zu Gast in der Lilie. Er mied jedoch die späten Abend- und Nachtstunden, wenn die Feierei und das Gesaufe losgingen, denn er hatte Angst, dass er dann nicht so einfach ums Trinken herumkommen würde wie jetzt. Die Freunde seines Vaters, die sich Brüder nannten, waren nicht zimperlich und drängten jedem die Schnapsgläser nur so auf. Nicht mitzutrinken, galt in diesem Kreis als verdächtig, und Karl hatte sich schon oft dumme Sprüche anhören müssen, die auf seine angeblich nicht vorhandene Männlichkeit abzielten. Doch bisher hatte Wolkow dem Ganzen stets mit einer einzigen Handbewegung Einhalt geboten.
Antoni Wolkow war hier im Varieté, ja im ganzen Wörther Kiez der König. Weshalb Karl trotz seines Rufs als Biedermann eben als Kronprinz galt. Und auch wer nicht direkt von der Verwandtschaft zwischen ihnen wusste, konnte es sofort sehen: Karl North war das jüngere Abbild seines Vaters – beide hatten hohe Wangenknochen, helle Haut und blitzende grüne Augen. War bei dem einen das Haar noch dunkelblond, so schimmerte das des Älteren bereits silbern – doch davon abgesehen, hätten sie auch Brüder sein können. Allerdings hatte Wolkow im Gesicht einen harten Zug, der Karl immer wieder irritierte und von dem er hoffte, dass er ihn nicht geerbt hatte.
Außer der auffallenden Ähnlichkeit bewog das Verhalten Wolkows viele dazu, seinem Sohn mit Respekt zu begegnen. Wo auch immer Karl hinkam, schienen ihm die Türen offen zu stehen. Er selbst erzählte zwar nicht herum, wie genau sie
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























