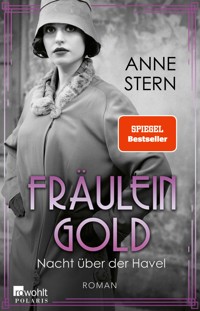
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Hebamme von Berlin
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1930: In der Stadt brodelt es gewaltig. Wirtschaftskrise und politische Instabilität rufen immer radikalere Kräfte auf den Plan. Auch Hulda spürt, dass die vermeintlich goldenen Jahre vorbei sind. Umso engagierter kümmert sie sich als Hebamme um die Belange von Frauen und Müttern. Als sie einer Schwangeren helfen will, stößt sie auf einen mysteriösen Todesfall im Dunstkreis der Familie: Die jüngere Schwester Jutta ist Teil einer Jugendgruppe, die sich nachts an der Havel trifft. Die Jugendlichen singen und feiern zusammen. Doch dann wird am Ufer ein Student tot aufgefunden. Er war der Anführer von Juttas Gruppe – und ihr heimlicher Schwarm. Aber war sein Tod wirklich ein Unfall bei einem nächtlichen Abenteuer? Bald ahnt Hulda, dass die Zusammenhänge größer sind als angenommen. Eine Jugend ohne Zukunft sucht in unruhigen Zeiten verzweifelt nach Halt. Und ist bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Stern
Fräulein Gold: Nacht über der Havel
Roman
Über dieses Buch
Wenn die Nacht am dunkelsten ist …
Berlin, 1930: In der Stadt brodelt es gewaltig. Wirtschaftskrise und politische Instabilität rufen immer radikalere Kräfte auf den Plan. Auch Hulda spürt, dass die vermeintlich goldenen Jahre vorbei sind. Umso engagierter kümmert sie sich als Hebamme um die Belange von Frauen und Müttern. Als sie einer Schwangeren helfen will, stößt sie auf einen mysteriösen Todesfall im Dunstkreis der Familie: Die jüngere Schwester Jutta ist Teil einer Jugendgruppe, die sich nachts an der Havel trifft. Die Jugendlichen singen und feiern zusammen. Doch dann wird am Ufer ein Student tot aufgefunden. Er war der Anführer von Juttas Gruppe – und ihr heimlicher Schwarm. Aber war sein Tod wirklich ein Unfall bei einem nächtlichen Abenteuer? Bald ahnt Hulda, dass die Zusammenhänge größer sind als angenommen. Eine Jugend ohne Zukunft sucht in unruhigen Zeiten verzweifelt nach Halt. Und ist bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen …
Vita
Anne Stern ist promovierte Germanistin und Historikerin und lebt in Berlin. Alle Bände der historischen «Fräulein Gold»-Reihe waren Spiegel-Bestseller. Weitere Bände sind in Planung.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Karte © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Richard Jenkins
ISBN 978-3-644-01838-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Die Straßen gähnen müde und verschlafen.
Wie ein Museum stumm ruht die Fabrik.
Ein Schupo träumt von einem Paragraphen,
Und irgendwo macht irgendwer Musik.
Die Stadtbahn fährt, als tät sie’s zum Vergnügen,
Und man fliegt aus, durch Wanderkluft verschönt.»
Mascha Kaléko: Sonntagmorgen, 1933
Prolog
Samstagnacht auf den 13. Juli 1930
Ein Käuzchen schrie im Zwielicht zwischen den Stämmen der Fichten und Kiefern, und Jutta spürte, dass Louise einen Moment stehen blieb und schmerzhaft ihre Hand umklammerte. Unter ihren Füßen knackten kleine Zweige und Kienäpfel, während sie sich weiter, Seite an Seite, durchs Dunkel tasteten. Louises Kleid schimmerte weiß im schwachen Lichtschein, ein halber Mond schaukelte hoch oben über den Tannenwipfeln und leuchtete ihnen notdürftig auf ihrem Weg. Wenn sie nur endlich die Hütte fänden, von der Joachim gesprochen hatte! Er hatte sie extra für die Gruppe gebaut, und nun mussten sie sie unbedingt aufspüren. Am besten, bevor die anderen es taten, denn es war schließlich ein Wettstreit.
Jutta hatte nicht viel für diese Abenteuer übrig, wie Joachim ihre nächtlichen Aktionen nannte. Doch sie wollte es um keinen Preis zugeben. Am Ende würde man sie aus der Wandervogel-Gruppe ausschließen – nein! Außerdem sollte sie nicht mehr dieses Wort benutzen, sondern von Bewegung sprechen, erinnerte sie sich, während sie mit pochendem Herzen Fuß vor Fuß setzte. So bläute Joachim es ihnen andauernd ein, er und die anderen älteren Studenten, die bei der Bündischen Jugend den Ton angaben. Nur dann würden die anderen Verbände – die Pfadfinder, die Adler und nicht zuletzt die Deutsche Freischar – ihre kleine Steglitzer Gruppe als gleichwertig anerkennen. Und das, obwohl ja in Steglitz die erste Wandervogelbewegung überhaupt gegründet worden war, anno 1896, wie Joachim stets hochmütig betonte. Doch daran erinnerten sich die anderen deutschen Jugendgruppen wohl nicht mehr.
Das alles interessierte Jutta nur sehr wenig. Ihr waren ganz andere Dinge wichtiger – das gemeinsame Singen, das Sitzen ums prasselnde Feuer, wenn die Sonne blutrot hinter dem Steglitzer Fichtenberg unterging, die Gemeinschaft mit ihren Freundinnen und Freunden. Und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie liebend gern auf die mitternächtlichen Abenteuer mit all ihren Schrecken und düsteren Ritualen verzichten können. Doch es ging nicht nach ihr. Als Allerletztes fragte man sie, das einzige jüdische Mädchen im Bund, nach ihrer Meinung zu den Dingen.
Etwas rauschte ohne Vorwarnung durch die Luft, und Jutta zuckte zusammen. Sie spürte, wie auch Louise neben ihr schauderte, als das Käuzchen, das eben geschrien hatte, plötzlich mit weiten Schwingen über ihre Köpfe hinwegflog. Doch keine von ihnen sagte ein Wort, sie schlichen weiter durch den dunklen Grunewald. Dort hinten, hinter dem undurchdringlichen Dickicht aus Bäumen, Sträuchern und Moos, musste die Havel liegen. Jutta meinte in einigen Momenten, wenn der Wind sich kurz legte, das Wasser der Wellen gegen den kleinen Strand schlagen zu hören.
Tagsüber war sie schon oft hier gewesen, zuletzt mit ihrer Klasse auf einem Badeausflug kurz vor den Sommerferien. Sie war mit ihren Mitschülerinnen aus der Auguste-Viktoria-Schule mit der neuen elektrischen Stadt-Schnellbahn hergefahren, in Begleitung von Fräulein Krugmacher und Fräulein Lustig, den Klassenlehrerinnen. Der Sand an der Badestelle war fein und weich gewesen, das Wasser klar, und der Ort hatte wie ein breites Fenster im Wald gewirkt, von dem aus man aufs Wasser hinaussehen konnte. Und als Jutta das bei einem ihrer Treffen mit Joachim erwähnt hatte, hatte er entschieden, dass dieser Schauplatz unbedingt für seine nächste nächtliche Aktion herhalten musste. Alle anderen – Louise, Hedi, Joachims jüngerer Bruder Günther, sogar Wolf – hatten sofort zugestimmt, wie beinahe jedes Mal, wenn Joachim etwas vorschlug. Es war eigentlich gar kein Vorschlag, wenn er etwas vortrug, sondern immer ein Befehl. Manchmal meinte Jutta, in den Gesichtern einiger anderer Mitglieder ihrer Gruppe ebenfalls eine leise Skepsis gegenüber dem Tonangeber zu lesen, doch nie erhob jemand das Wort gegen ihn. Und Jutta tat es ganz bestimmt nicht. Die wenigen Male, in denen sie erlebt hatte, wie Joachim auf Kritik reagierte, hatten ihr gereicht.
Es war ja auch eigentlich gar nicht so schlimm, nachts durch den Wald zu gehen, es hätte sogar ganz romantisch sein können. Auf jeden Fall war es eine Abwechslung zum sonstigen Trott in der Schule und daheim.
Jutta fasste Louises Hand fester, als die Freundin erneut stehen blieb, sie von der Seite ansah und flüsterte: «Meinst du, es ist noch weit?»
«Ich weiß es nicht», wisperte Jutta zurück. Das gehörte auch zu den nächtlichen Ausflügen – dass man alles nur im Flüsterton äußern durfte, um den Zauber des Abenteuers nicht zu zerstören. Dass man so tat, als wäre man wirklich auf geheimster Mission unterwegs, mit einem Auftrag, der staatsbedeutend war. «Als wir mit Fräulein Lustig hier bei Tag langliefen, sah alles so anders aus.»
«Aber die Richtung stimmt», sagte Louise und zog sie weiter. «Komm, vielleicht gewinnen heute einmal wir den Preis, das wär doch knorke!»
«Ich wette, Günther ist schneller als wir am Ziel», sagte Jutta und ließ sich mitziehen. Leiser fügte sie noch hinzu: «Ich mache mir ohnehin nichts aus Joachims Zigaretten und dem Schnaps.»
Louise kicherte. «Ich finde es toll», sagte sie. «Man fühlt sich nach ein paar Schlucken so herrlich leicht und frei. So, als könnte man alles wagen.»
Wieder warf Louise ihr einen Blick im Dunkeln zu. Jutta erkannte das Gesicht der Freundin nur schemenhaft, den Rest erschloss sie sich aus der Vertrautheit vieler gemeinsamer Schuljahre. Helles Haar umschloss die feinen Züge und die weichen Wangen. Louise war eine elfengleiche Schönheit, die sich dessen als Einzige nicht bewusst war. Sie hatte trotz ihrer siebzehn Jahre noch etwas Kindliches, über das Jutta, die nur wenige Monate älter war, manchmal lächeln musste.
«Joachim sieht sehr gut aus mit dem Schnurrbart, den er sich wachsen lässt, findest du nicht?», flüsterte sie jetzt und schlug sich kieksend eine Hand auf den Mund. «Wie Charlie Chaplin.»
Jutta schwieg, während sie langsam weitergingen. Ja, Joachim sah gut aus, sehr gut sogar mit seinem dunklen gescheitelten Haar und den markanten Zügen. Er hätte ohne Weiteres eine ebenso perfekte Figur auf der Kinoleinwand gemacht wie Louises Idol Chaplin. Joachim gefiel ihr. Und Jutta wusste, dass sie auch ihm gefiel. Manchmal berührte er sie an der Schulter oder strich ihr wie zufällig übers Haar, und dann bemerkte sie den eifersüchtigen Blick, den Louise ihr zuwarf. Doch sie zuckte unter Joachims Berührungen stets zurück. Etwas an ihm jagte ihr einen Schauder über den Rücken, wenn er ihr zu nahe kam. Es hatte mit seinen Augen zu tun, die immer seltsam kühl wirkten, und mit den Pupillen darin, die so groß und schwarz waren. Aber auch mit seiner Unberechenbarkeit, wenn er über einen Scherz erst überbordend lachte und dann mitten im Lachen abbrach und in kaltes Schweigen fiel.
Doch er war nun einmal der unangefochtene Anführer – noch vor Wolf, dem Zweitältesten der Gruppe –, und Jutta hatte nicht vor, es sich mit ihm zu verscherzen. Um nichts in der Welt hätte sie ihren Platz in der Mitte gefährdet. Was bliebe ihr denn noch, wenn man sie ausschlösse? Ihre Freundinnen im Lyzeum würden sie fortan schneiden, so, wie sie es schon mit Rosalind gemacht hatten, als deren Eltern ihr die Teilnahme an der Jugendgruppe verboten hatten. Jutta würde fortan jeden Nachmittag und auch am Wochenende zu Hause in der Steglitzer Wrangelstraße hocken und ihrer älteren Schwester, die bald ein Kind bekommen würde, zur Hand gehen müssen. Vorbei wäre es mit den Liederwettbewerben auf dem Fichtenberg, mit den Wanderungen im Elbsandsteingebirge, wohin sie regelmäßig mit der Bahn fuhren, mit den Lagerfeuern und Freundschaften. Eine nächtliche Suche nach einer Reisighütte und eine kreisende Schnapsflasche, an der sie eben nippen musste, waren da das kleinere Übel.
Und selbst Joachims kalte Finger, die ihr ab und an über den Arm strichen, würde sie weiterhin als Tausch dafür in Kauf nehmen.
Ein paar Meter vom Weg entfernt knackte plötzlich ein Zweig, und Jutta fuhr zusammen. Auch Louise schien erstarrt. Beide Mädchen wagten nicht, sich zu bewegen. Atemlos lauschten sie in die Finsternis hinein.
Vor den Mond hatte sich eine große Wolke geschoben, das Licht war beinahe ganz versiegt. Der Duft des Sommerwaldes stieg Jutta in die Nase, es roch nach dunkler Erde und feuchtem Moos, und sie horchte noch angestrengter in die Nacht. War da nicht ein Grunzen gewesen? Eine Schrecksekunde lang dachte sie, dass sie vielleicht ein Wildschwein aufgescheucht hatten oder sogar einen der Wölfe, die angeblich wieder in den Berliner Wäldern hausten. Dann brach etwas durch die Zweige des Gebüschs, jemand lief mit hocherhobenen Armen auf sie zu und jaulte lang gezogen. Die Gestalt brach in Lachen aus, und durch Juttas Adern schoss so tiefe Erleichterung, dass ihr die Knie weich wurden. Ein Wildschwein trug normalerweise keine Schiebermütze auf dem Kopf und schon gar nicht hatte es eine Gitarre mit einem breiten Flechtband auf den Rücken geschnallt.
«Günther!», japste sie und fiel dem jungen Mann lachend um den Hals. «Du hast mich zu Tode erschreckt.» Einen Moment lehnte sich Jutta an ihn und spürte seine Wärme, ehe sie sich von ihm löste.
«Das würde ich nie tun», sagte er mit seiner freundlichen Stimme. «Eine so feine Gefährtin wie dich? Ich müsste verrückt sein.»
«Du Armleuchter!» Nun lachte auch Louise und hielt sich an ihrem langen Zopf fest, den sie sich wieder und wieder ums Handgelenk schlang. «Warum heulst du denn hier herum wie ein mondsüchtiger Werwolf?»
«Kommt jetzt, Mädels», sagte Günther, anstatt zu antworten. «Gemeinsam schlagen wir die anderen noch. Ich habe nämlich eine Idee, wo Joachims geheimnisvolle Hütte versteckt sein könnte.»
«Tadellos», sagte Jutta und nickte.
Die drei schlangen einander die Arme um die Hüften und zogen weiter über den dunklen Waldweg, in vertrauter Einigkeit. Nichts als ihr Atem und das Knirschen des Reisigs unter ihren Sohlen war zu hören. Aber immer, wenn Günther sich unter einem Baum hinwegduckte und ein loser Zweig über die Gitarrensaiten strich, klang ein leiser und sehnsüchtiger Ton durch den nächtlichen Wald.
1.
Sonntag, 24. August 1930
«Frag doch mal deinen Vati, ob er dir eine Kugel Eis kauft», sagte der Verkäufer mit der rot-weiß gestreiften Mütze und beugte sich zu Meta hinab. Er zwinkerte ihr zu und nahm bereits eine frische Waffel aus dem Ständer. Dann lächelte er servil in die Richtung von Hulda und Max, die ein paar Meter weiter Arm in Arm auf dem gekiesten Weg des Botanischen Gartens standen und erstaunt die Szene beobachteten. Einen Augenblick waren sie abgelenkt gewesen, weil sie sich im Schatten einer Eibe einen verstohlenen Kuss gegeben hatten, und diese Sekunde hatte Meta offenbar genutzt, um zu entwischen und sich zum Eiswagen zu schleichen.
Hulda sah Max mit hochgezogenen Augenbrauen an, und wie auf Kommando setzten sich beide gleichzeitig in Bewegung, um Meta einzuholen.
«Das ist aber nicht mein Vati», sagte Meta gerade und bedachte den Verkäufer mit einem Blick, als zweifle sie an seiner Auffassungsgabe. Sie wirkte in ihrem blau-weißen Matrosenkleidchen – ein Geschenk der Wenckows aus Frohnau – bezaubernd. «Der ist nämlich tot.»
Über das runde, etwas einfältige Gesicht des Verkäufers lief eine verlegene Röte. «Ach!», sagte er und wusste nicht weiter.
«Das da ist doch bloß Max», sagte Meta belehrend, die nichts von der Pein des Eismannes zu spüren schien, und griff nach Max’ Hand, der jetzt mit Hulda ganz herangekommen war. «Er macht meiner Mama … den Hof.»
Sie strahlte, weil sie diesen seltsamen Ausdruck behalten und richtig wiedergegeben hatte. Dann zog sie die Stirn unter dem dunklen Pony kraus, und die Sommersprossen auf ihrer kleinen Nase tanzten vor lauter Anstrengung beim Nachdenken.
«Aber eigentlich heißt er Maximilian», erklärte sie gewichtig, «das bedeutet der Große.»
Sie überlegte noch einen Moment und betrachtete Max neben sich kritisch von unten nach oben. Dann erschien in ihrem Mundwinkel eine kleine rosa Zungenspitze, und endlich brachte sie ihren Gedanken zu Ende.
«Er ist eigentlich gar nicht so groß, nicht? Kaum größer als Mama.»
Hulda lachte heimlich, und sie sah, wie es auch in Max’ Gesicht zuckte. Der Eisverkäufer wirkte hilflos, lächelte aber immer noch das perfekte Verkäuferlächeln, die Eiswaffel unschlüssig in der Hand. Sie schwebte über den prall gefüllten Kübeln mit Erdbeer- und Schokoladeneis, als hätte ihr Besitzer vergessen, was man damit eigentlich anstellte. Hulda beschloss, den Mann zu erlösen.
«Dreimal Schokolade, bitte», sagte sie zu ihm und fischte nach ihrer Geldbörse. «Vati bezahlt heute mal nicht», fügte sie halblaut in Max’ Richtung hinzu und bemühte sich erneut, nicht zu lachen.
«Hier», sagte sie, als sie die Waffeln entgegengenommen hatte, und hielt den beiden anderen die Leckerei hin. «Das wahrscheinlich letzte Eis im Jahr 1930.»
«Das will ich nicht hoffen, Gnädigste», sagte der Verkäufer säuerlich und betrachtete sorgenvoll den wolkenlosen Himmel, als bräche gleich ein Schneesturm aus dem Hellblau hervor.
Während die nächsten Sonntagsausflügler an den Eiswagen traten, schlenderten die drei weiter, und Meta, die noch immer Max’ Hand hielt, schleckte glücklich an der kalten Herrlichkeit. Dann drängte sie sich zwischen sie, und Max und Hulda nahmen sie in die Mitte, fassten sie mit der freien Hand unter den Achseln und schleuderten sie hoch hinauf, sodass Meta hell juchzte. Immer wieder ließen sie das Engelchen fliegen, Meta hielt ihr Eis umklammert und lachte aus vollem Hals.
Ringsum blühten Rosen an hohen Hecken, und eine sanfte grüne Wiese schmiegte sich an den hellen Weg, an dem sich die gläsernen Gewächshäuser der botanischen Anlagen im Berliner Südwesten in den Himmel erhoben. In ihren unzähligen Scheiben brach sich vielfach die Augustsonne.
«Noch einmal!», verlangte Meta. «Nicht aufhören!»
Max und Hulda sahen sich lächelnd über Metas flatterndes Haar hinweg an. In Max’ Augen lag jetzt ein Ausdruck, den Hulda schon ab und zu darin gesehen hatte, und sie spürte eine ungeheure Zärtlichkeit für ihn. Nicht aufhören, dachte auch sie, nur nie wieder aufhören.
Für einen Moment richtete sie ihr Gesicht in die warmen Sonnenstrahlen des scheidenden Sommers und schloss die Lider. Sie setzte Fuß vor Fuß, nur noch geführt von Metas Lachen und dem Takt von Max’ gleichmäßigen Schritten neben sich auf dem Kies. Beinahe hatte sie das Gefühl, ein paar Zentimeter über dem Boden durch den Park zu schweben.
«Kann ich meine beiden Lieblingsdamen auch noch für eine kühle Limonade begeistern?», fragte Max.
Hulda öffnete die Augen. Sie waren bei dem Café mit der Terrasse angekommen, die sich entlang des Großen Palmenhauses erstreckte.
«Au fein», sagte Meta.
Hulda nickte und ließ sich von Max zu einem Tisch führen. «Für mich aber lieber einen Mokka», bat sie.
Es war ein heißer Spätsommertag, und sie hatte nichts dagegen, einen Moment zu sitzen. Während sie auf einen der zierlichen Gartenstühle sank, verschwanden Max und Meta im Café, um die Getränke zu holen. Hulda wischte sich ein wenig Schweiß von der Nase und genoss den Schatten des großen Sonnenschirms, der über ihr Gesicht fiel und ein wenig Abkühlung brachte.
Rundherum waren die meisten Tische besetzt. Die Besucher trugen leichte Sommergarderobe, einige Herren hatten die Hemdsärmel hochgekrempelt und die Strohhüte weit hinauf in die Stirn geschoben. Viele Frauen waren am Morgen angesichts der hohen Temperaturen in weich fallende, glockenförmige Röcke aus Baumwolle geschlüpft und trugen dazu kurzärmelige Blusen aus geblümten hellen Stoffen.
Aus den Augenwinkeln musterte Hulda die junge Frau, die am Nebentisch saß und ein äußerst elegantes blaues Seidenkleid trug, das in der Taille so eng saß, wie es die allerneueste Mode vorschrieb. Aus irgendeinem Grund musste sie an Helene Winter denken, die Gattin ihres Jugendfreunds Felix, die auch stets wie aus dem Ei gepellt und ähnlich wasserstoffblond war. Über der Stuhllehne der Dame hing eine leichte weiße Strickjacke mit rosa Stickerei am Kragen. Die Mode hatte sich in diesem Jahr verändert, das androgyne Modell der Zwanziger Jahre hatte augenscheinlich erst einmal ausgedient und war einer neu erblühten Weiblichkeit gewichen.
Hulda fuhr sich mit der Hand über ihr taillenloses Kleid, das noch aus der vorletzten Saison stammte. Es war aus Leinen und knitterte leicht, und die Säume waren bereits ein wenig ausgefranst. Doch ihr fehlte als allein lebende Mutter und kleine Angestellte noch immer das nötige Geld, um sich jede Saison eine neue Garderobe anzuschaffen. Wenn sie wenigstens etwas begabter gewesen wäre, was Handarbeit anging! In Zeitschriften wie Die Dame oder Die elegante Welt wurden immer öfter Schnittmuster abgedruckt, die der pfiffigen Hausfrau zeigten, wie man sich ganz leicht eins der Kleider nachschneidern konnte, die Greta Garbo oder Pola Negri bei einer Filmgala getragen hatten. Aber mit Nadel und Faden – außer wenn es um eine Geburtsverletzung ging, die genäht werden musste – war Hulda einfach hoffnungslos!
Die junge Frau in Blau hatte ihren Blick bemerkt und lächelte etwas hochmütig über den Tisch zu ihr. Hulda nickte ihr verlegen zu und sah dann weg. Es war eine Angewohnheit von ihr, immerfort Leute zu beobachten, die sie nur schwer ablegen konnte. Und wie Bert, ihr guter alter Freund vom Winterfeldtplatz, stets behauptete, ließ ihr Pokergesicht dabei leider nach wie vor zu wünschen übrig.
Der Begleiter ihrer Tischnachbarin kehrte zurück, mit einem voll beladenen Tablett, und setzte sich schnaufend zu ihr. Kaffeetassen klapperten, kleine Gäbelchen wurden sofort in dunkle, schokoladige Herrentorte versenkt.
«Warum hat das denn nur so lange gedauert, Willi?», fragte die junge Frau mit verdrießlicher Stimme zwischen zwei Bissen.
«So eine jüdische Mischpoke hat den Tresen gestürmt», brummte Willi, und Hulda zuckte zusammen. «Haben sich mit viel Hallo begrüßt, den ganzen Verkehr aufgehalten und am Ende fast nichts bestellt.» Er schüttelte unwillig den quadratischen Kopf mit dem Bürstenhaar. «Diese Leute sind überall, können unsereins nicht mal den Tag des Herrn in Ruhe genießen lassen. Haben die nicht ihren eigenen Sonntag?»
«Sabbat heißt das, Willi», sagte das blaue Fräulein und wischte sich geziert ein wenig Schokoladenstreusel von den Lippen. «Ja, man könnte meinen, dass sie uns Deutschblütige wenigstens an den Feiertagen unbehelligt ließen.»
«Das wird sich bald alles ändern», sagte ihr Begleiter und stürzte einen Schnaps herunter, der neben seiner Kaffeetasse auf dem Tablett gestanden hatte. «In ein paar Wochen ist die Reichstagswahl, und dann zeigen wir den Sozis und den verdammten Juden, wo der Hammer hängt.»
Hulda stand auf. Ihr Herz pochte wild. Sie tat so, als suchte sie jemanden, schlenderte ein paar Schritte weiter und fand schließlich einen anderen freien Tisch außer Hörweite des Paares.
Gerade kamen Max und Meta aus dem Café zurück auf die Terrasse, begleitet von drei Frauen, die Hulda nicht kannte. Eine war knapp fünfzig, die zwei anderen schienen ihre Töchter zu sein. Die ältere der beiden jungen Frauen war hochschwanger.
«Hulda …», sagte Max, als er sie entdeckt hatte, und kam näher. Mit fröhlicher Miene stellte er ein Tablett mit einer Limonadenflasche und zwei dampfenden Mokkatassen ab. «Das ist eine alte Bekannte von mir, darf ich vorstellen? Ursula Rosenzweig.» Er deutete auf die Frau neben sich, die ein Hütchen mit schwarzem Schleier und ein braunes Alltagskleid trug, das noch unmoderner war als Huldas Leinenfetzen. Ihr Gesicht mit den dunklen Augen wirkte müde und schmal. Die beiden jungen Frauen in ihrem Kielwasser lächelten Hulda höflich zu, blieben jedoch mit etwas Abstand stehen.
«Guten Tag», sagte Hulda, die einen verstohlenen Blick zu dem Paar mit der Herrentorte zurückwarf. Die Augen des Bürstenhaarschnitts trafen ihre, und Hulda konnte trotz der Entfernung erkennen, wie der Mann unwillig den Mund verzog. Schnell wandte sie sich wieder ab. Zum Glück schien niemand außer ihr etwas bemerkt zu haben. Meta in ihrem dunkelblauen Rock und mit dem weißen Kragen um den Hals hockte bereits auf einem Stuhl und schlürfte selig ihre Limonade.
«Ich bin Hulda Gold», sagte Hulda rasch und bemühte sich trotz ihres Ärgers über das belauschte Gespräch um einen freundlichen Ausdruck. «Setzen Sie sich doch zu uns.» Sie fuhr Meta übers Haar. «Und das ist übrigens meine Tochter Meta.»
«Wir hatten schon das Vergnügen», sagte Frau Rosenzweig mit einem herzlichen Lächeln, das ihr müdes Gesicht erleuchtete. Sie nahm neben Meta Platz. «Ein echter Diamant, den Sie da haben, Frau Gold.»
«Fräulein», berichtigte Hulda. «Ich bin nicht verheiratet.»
Sie und Max wechselten einen Blick.
Dann griff Hulda nach ihrer Tasse und trank einen Schluck von dem schwarzen, heißen, wohltuenden Gebräu. Max schob seiner Bekannten galant seine eigene Kaffeetasse hinüber, die er noch nicht angerührt hatte.
«Hulda und ich sind seit letztem Jahr … befreundet», sagte er zögernd. «Marlene und ich lassen uns scheiden.» Er räusperte sich. «Sie erinnern sich an meine … Frau, oder?»
«Natürlich», sagte Frau Rosenzweig, die für einen Moment überrascht gewirkt hatte, sich aber sofort wieder fing. «Ich hoffe, es geht der Familie trotz allem gut?» Sie nippte an ihrer Tasse, und ihre Wangen bekamen etwas Farbe.
«Alle sind wohlauf», beeilte sich Max zu versichern. «Und niemand hegt einen Groll.»
«Außer deine Söhne …», sagte Hulda leise, doch Frau Rosenzweig und Max überhörten den Einwand geflissentlich. Und Hulda war froh, dass sie die Stimmung nicht durch ihre unbedachte Bemerkung über Jona und Rafael verdorben hatte, die ihr nur herausgerutscht war. Es belastete sie zwar, dass die halbwüchsigen Sprösslinge von Max sie nach wie vor ablehnten, weil Hulda angeblich den Familienfrieden gestört hatte, aber im Alltag hatte sie nicht allzu viel mit den beiden zu tun. Solange Max und sie nicht zusammenlebten, konnte man sich aus dem Weg gehen.
Doch mit jedem Tag, der verging, wünschte sich Hulda, dass sie und Max mehr teilen könnten als Sonntagsspaziergänge, Kinobesuche oder gestohlene Nächte, wenn Meta bei den Großeltern war. Da sogar Wildfremde wie der Eisverkäufer vorhin sie für eine richtige Familie hielten, wäre es dann nicht endlich an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen? Bei diesem Gedanken hätte Hulda beinahe laut gelacht. War das wirklich sie, Hulda Gold, die so dachte? Hatte sie sich nicht immer ihre Unabhängigkeit bewahren wollen? Und nun, seit Max Dessauer in ihr Leben getreten war, sollte plötzlich alles anders aussehen?
«Ich bewundere Sie», sagte Frau Rosenzweig und riss Hulda damit aus ihrer Grübelei. «Eine ledige Mutter zu sein, ist nicht einfach.» Sie seufzte und deutete auf ihre Töchter, die untergehakt weitergeschlendert waren und zwischen den prächtigen Blumenrabatten entlang der Terrasse auf und ab gingen. «Ich bin selbst früh verwitwet und musste allein in unserem Dreimädelshaushalt schalten und walten. Und nun hat meine Tochter Hella ein ähnliches Schicksal ereilt – ihr Mann ist vor zwei Monaten bei einem Autounfall ums Leben gekommen.» Sie zog ein Taschentuch aus dem Ausschnitt und tupfte sich die Augen.
«Das tut mir leid», sagte Hulda hastig und leerte ihre Mokkatasse. Kurz überlegte sie, ob sie der Dame erzählen sollte, dass auch sie ihren Verlobten Johann während der Schwangerschaft mit Meta verloren hatte. Doch sie hielt sich zurück – sie kannte Frau Rosenzweig ja erst wenige Minuten. Und obwohl sie wusste, dass Max nicht eifersüchtig war, wollte sie nicht, dass Johann zu oft ihre Gespräche beherrschte. Nur mit Meta sprach sie viel von ihm, erzählte von seinen lustigen Augen, seinem Humor und den Sommersprossen, die ihre Tochter von ihm geerbt hatte. Sie hielt Johann im Gedächtnis der Kleinen so lebendig, wie sie konnte.
Auch Max wirkte betroffen, er legte Frau Rosenzweig einen Moment die Hand auf den Arm. «Wie furchtbar», sagte er.
Ursula Rosenzweig nickte bekümmert. «Wir machen gerade eine schwere Zeit durch», sagte sie und sah mit verhangenem Blick zu ihren beiden Töchtern hinüber. «Hellas Schwangerschaft ist natürlich von diesem schrecklichen Ereignis sehr belastet. Und Jutta …» Sie brach ab und presste die Lippen zusammen. «Meine Jüngste hat nur Flausen im Kopf», fügte sie dann hinzu. «Auch, wenn sie jetzt gerade so aussieht, als könnte sie kein Wässerchen trüben.» Wieder flog ihr Blick zu den beiden Frauen hinüber. «Sie ist in einem dieser Jugendvereine – die Wandervögel, Sie wissen schon.»
«Ich dachte, die Wandervögel gibt es gar nicht mehr?», fragte Hulda überrascht.
«Nun, heute heißt das Bündische Jugend», antwortete Frau Rosenzweig. «Aber es ist doch ganz ähnlich. Dauernd verschwinden die jungen Leute im Wald, übernachten in irgendwelchen Hütten, singen all diese Lieder, in denen es heißt, dass sie sich nichts verbieten lassen, dass sie die Autoritäten verlachen …» Hilfe suchend sah sie zu Hulda. «Sie sind ja selbst Mutter», sagte sie. «Was würden Sie davon halten, wenn Ihre Kleine», sie nickte zu Meta hinüber, die inzwischen am Grund ihrer Flasche angekommen war und versuchte, ihr auch noch den letzten Tropfen zu entlocken, «in ein paar Jahren andauernd nachts nicht mehr nach Hause käme? Und natürlich sind in dieser Bewegung Jungens und Mädchen zusammen, in wildem Durcheinander … Ich hoffe nur, dass ich nicht bald zwei vaterlose Säuglinge durchfüttern muss.»
«Ich bin sicher, Ihre Tochter ist vernünftig», sagte Hulda beruhigend. «Und frische Luft hat auch noch niemandem geschadet.»
«Ich hoffe, Sie haben recht», sagte Frau Rosenzweig. «Manchmal weiß ich einfach nicht, wohin mit meinen ganzen Sorgen. Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie damit behelligt habe, noch dazu an einem so herrlichen Sonntag.»
«Das macht nichts», sagte Hulda. Sie bemerkte, dass Meta sich langweilte. Doch Max kam ihr zuvor, er nickte ihr zu, klaubte die lachende Kleine mit den rutschenden weißen Strümpfen vom Stuhl und setzte sie auf seine Schultern. Hoppelnd und buckelnd wie ein Pferdchen trug er sie über die Terrasse zur grünen Wiese hinüber, während Meta sich jauchzend in seinem dichten Haar festkrallte.
Huldas Augen folgten den beiden, und sie spürte eine vertraute Wärme in sich aufsteigen, wie immer, wenn sie Zeugin wurde, wie liebevoll und selbstverständlich Max mit ihrer Tochter umging. Ihr Blick traf den von Frau Rosenzweig, und beide Frauen lächelten sich zu.
Dann beugte sich Frau Rosenzweig näher. «Wie bringen Sie denn Ihre Tochter eigentlich durch, wenn ich fragen darf?»
«Ich bin Hebamme», sagte Hulda. «Zurzeit arbeite ich in einer Beratungsstelle am Nollendorfplatz.»
Die Augen von Frau Rosenzweig weiteten sich. «Oh», sagte sie, «also, heute ist wirklich ein Tag der Zufälle.»
«Wieso?», fragte Hulda.
«Wissen Sie, die Hebamme, die meiner Tochter bei der Geburt beistehen wollte, ist kurzfristig ausgefallen», sagte sie, und in ihre Miene trat etwas Bittendes. «Jetzt suchen wir verzweifelt einen Ersatz. Es gibt einen furchtbaren Mangel in Ihrem Berufsstand, aber das wissen Sie ja sicher.»
«Allerdings», sagte Hulda und lachte ein wenig bitter. «Das liegt daran, dass unsere Profession immer undankbarer wird. Kaum jemand kann es sich noch leisten, als freie Hebamme zu arbeiten, seit die Klinikgeburten so stark zunehmen und unsereins noch schlechter bezahlt wird.»
«Ich würde es ja auch gern sehen, wenn Hella ins Krankenhaus ginge», sagte Frau Rosenzweig. «Aber sie sträubt sich mit Händen und Füßen dagegen. Beim letzten Mal, als sie eine Klinik betreten hat, musste sie Abschied von ihrem sterbenden Mann nehmen, wissen Sie? Und seitdem behauptet sie, Krankenhäuser seien Orte des Todes.»
«Das kann ich zwar nicht bestätigen», sagte Hulda, «aber es ist im Fall Ihrer Tochter nachvollziehbar.»
Sie überlegte. Schon so lange sehnte sie sich danach, wieder in ihrem alten Beruf zu arbeiten, endlich wieder einmal eine Geburt zu betreuen, ein Kind auf die Welt zu holen und ihre wirklichen Talente einsetzen zu können. In der Beratungsstelle drehte sich alles ums Stillen, um Tabellen, Aufklärungshandzettel und Geschlechtskrankheiten. Es war wichtig für den Bezirk, für Not leidende Frauen da zu sein, das wusste sie, aber es langweilte sie dennoch von Tag zu Tag mehr. Und dieses sehnsüchtige Gefühl verstärkte sich weiter, da Meta wuchs, sie beide seit Längerem wieder durchschliefen und die härtesten Jahre hinter ihr zu liegen schienen. Hulda spürte seit geraumer Zeit, wie ihre früheren Kräfte aus der Zeit vor ihrer Mutterschaft zurückkehrten. Manchmal hatte sie schier keine Ahnung, wie sie diese am besten einsetzen sollte. Trotzdem hatte sie den Sprung zurück ins kalte Wasser bisher nicht gewagt – auch wenn sie in dem Wasser hervorragend schwimmen konnte, wie sie wusste.
«Wo wohnen Sie denn?», fragte sie zögernd.
«In der Wrangelstraße», sagte Frau Rosenzweig und deutete über das Palmenhaus hinweg in Richtung Stadt. «Das herrliche Stadtpalais an der Ecke Rothenburgstraße – mein Mann hat uns damals glücklicherweise eine große Wohnung darin vererbt.» Ein verschmitztes Lächeln erschien in ihrem verhärmten Gesicht. «Sie können es gar nicht verfehlen, Fräulein Gold.»
«Ich kann nichts versprechen», sagte Hulda und erhob sich. «Aber ich werde auf jeden Fall vorbeikommen und einmal mit Ihrer Tochter sprechen, wenn Ihnen das weiterhilft.»
«Ungemein», sagte Frau Rosenzweig und stand ebenfalls auf. «Ich danke Ihnen, Fräulein Gold.»
Hulda schob ihren Stuhl an das Tischchen und verabschiedete sich. Sie entdeckte Max und Meta, die noch immer über die Wiese tollten, und streifte im Vorbeigehen die Töchter von Frau Rosenzweig mit einem Blick. Die schwangere Hella hatte eine Hand ins Kreuz gestützt und sah gedankenverloren in die Kronen der großen Kastanien, die entlang des Kiesweges im leisen Sommerwind rauschten. Die Jüngere dagegen – Jutta, erinnerte sich Hulda – erwiderte herausfordernd ihren Blick. Lag es nur daran, was Frau Rosenzweig über ihren Wildfang von Tochter gesagt hatte, oder war ihr Kinn wirklich vorgereckt? Das Funkeln in ihren Augen tatsächlich so ungestüm, wie es Hulda vorkam?
Jutta trug ein grün-weiß gestreiftes Baumwollkleid, das ihre hübsche Figur gut zur Geltung brachte, und Hulda schien es, als sei sich die junge Frau ihrer Wirkung auf die Vorübergehenden sehr bewusst. Ein fescher Kerl im Stresemann flanierte vorbei und verrenkte sich fast den Hals nach ihrer Erscheinung. Und Hulda kam sich gegen dieses kraftstrotzende vitale Mädchen mit den hellbraunen Locken auf einmal vor wie eine ältere Matrone – und nicht wie eine Frau von erst vierunddreißig Jahren.
Doch dann sah sie zu Max hinüber. Er stand mit Meta an der Hand im Hellgrün der saftigen Wiese, hemdsärmelig, mit erhitzten Wangen unter den kleinen Brillengläsern, und strahlte sie erwartungsvoll an, als sei nicht Jutta, sondern Hulda die eigentliche Erscheinung.
Nein, dachte sie und flog auf die beiden Menschen zu, die ihr Herz erfüllten, wer so angeschaut wurde wie sie in diesem Augenblick, konnte niemals alt werden.
2.
Mittwoch, 27. August 1930
«Ist es recht so, der Herr?», fragte der kleine Mann mit dem Spitzbart und blickte Bert fragend im Spiegel an, während er ihm mit einem Handtuch die Rasierschaumreste vom Kinn wischte. Dann schüttelte er geschickt das Tuch aus. Ein paar Härchen wirbelten durch die Luft, und die blonde Empfangsdame des Frisiersalons, die an einem Tischchen saß und lustlos in einer zerfledderten Ausgabe der Tempo blätterte, nieste herzhaft.
«Astrein», sagte Bert und befühlte vergnügt seinen Schnauzbart, der nach der Behandlung des Barbiers nun nicht mehr dem eines alternden Seehundes glich wie noch eine halbe Stunde zuvor, sondern wieder äußerst gepflegt wirkte. «Ein paar Minuten in Ihrem Geschäft wirken stets wie ein Jungbrunnen.»
Monsieur Ferdinand nahm Bert den Umhang ab, mit dem er dessen weißes Hemd während der Rasur geschützt hatte, und nickte zufrieden.
«Das höre ich gern», sagte er und fuhr sich rasch durch die schwarzen Locken, die er mit einer Menge Pomade gebändigt hatte. «Empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn es beliebt.» Er begann, sorgfältig den Rasierpinsel zu säubern, und wischte das scharfe Messer ab.
Bert schmunzelte und rückte sich die zimtbraune Mittwochsfliege aus Seide am Hals zurecht.
«Das dürften Sie nicht nötig haben», sagte er. «Ihnen rennt man doch seit Jahren die Bude ein, oder? Die Sage von Monsieur Ferdinands meisterhaftem Bubikopf geht um die Welt. Nun ja, … die Schöneberger Welt jedenfalls.»
Der Friseur wiegte sorgenvoll den Kopf und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die Glasscheibe seiner Ladentür auf den Winterfeldtmarkt, wo das morgendliche Markttreiben bereits in vollem Gange war.
«Die Geschäfte gehen heutzutage leider nicht besonders gut», murmelte er. «Sie kennen ja die Arbeitslosenzahlen. Kartoffeln und Brot sind in diesen Zeiten für viele Leute wichtiger als Mode. Und der Bubikopf …» Ein unzufriedener Zug legte sich um seine Mundwinkel. «Nun, das ist auch vorbei, lieber Bert. Sie sind wohl nicht ganz auf dem Laufenden. Fragen Sie mal Gesa.» Er deutete mit dem Kinn zu seiner blonden Mitarbeiterin hinüber.
Die Empfangsdame, die das Gespräch mit angehört hatte, kicherte und hielt die rosabräunliche Illustrierte hoch. Eine Fotografie zeigte einen ondulierten Frauenkopf mit sanften blonden Locken, die sich in den Kragen des Fotomodells ringelten. «Die jungen Frauen wollen kein sachliches Mädchen mehr sein», las Gesa den Männern mit spöttischem Tonfall aus dem begleitenden Artikel vor. «Die elegante, anschmiegsame Dame ist heute gefragter denn je.» Sie kicherte wieder, doch diesmal klang es bitter. «Bei denen piept’s wohl», sagte sie dann. «Nu gerade nich! Ich bleibe lieber sachlich, schönen Dank auch.»
Ehe Bert antworten konnte, klingelte das Glöckchen über der Tür, und eine hochgewachsene schmale Gestalt mit rabenschwarzen Haarspitzen unter einem roten Glockenhut eilte herein. Er erkannte Hulda Gold sofort. Sie hielt auf der Schwelle nicht eine Sekunde inne, sondern stürmte im Laufschritt am Empfangstisch vorbei auf die beiden Männer zu, eine große Ledertasche an sich gepresst.
«Haben Sie kurzfristig einen Termin frei?», fragte sie und riss sich den Hut vom Kopf.
«Sehen Sie», sagte Bert zu Monsieur Ferdinand amüsiert. «Der Bubikopf ist mitnichten ausgemustert, und hier weht der Wind gerade eins der hübschesten Exemplare zu uns herein.»
«Sprechen Sie von mir?», fragte Hulda etwas atemlos und knallte ihre Tasche auf einen freien Stuhl neben dem Waschbecken. «Guten Morgen, Bert», fuhr sie fort und nickte ihm etwas hochmütig zu, aber das kannte er schon an ihr. Ihre graublauen Augen mit dem kleinen Silberblick blitzten, und ihre Wangen leuchteten rot, als sei sie ein Stück gerannt. «Ich habe gerade Meta im Kindergarten abgegeben, und jetzt bleibt mir genau eine Stunde Zeit, ehe mein Dienst beginnt. Da dachte ich …»
«Fräulein Gold, für Sie habe ich immer einen Termin», sagte Monsieur Ferdinand und schnipste nach der Empfangsdame.
Gesa trottete herbei, nahm Huldas Sachen mit spitzen Fingern und stellte ihre Tasche am Garderobenständer ab. Den roten Hut ließ sie auf der Ablage zurück.
«Mach uns bitte einen starken Mokka, Gesa», sagte der Maestro zur Empfangsdame. «Und leg eine Platte auf, wir brauchen ein wenig Stimmung hier drinnen.» Dann rückte er den Stuhl näher an das Waschbecken heran und bedeutete Hulda, dass sie sich setzen sollte.
Gesa seufzte, als sei das Ansinnen ihres Chefs eine Zumutung. Ausgiebig zupfte sie sich vor dem Spiegel ihre kurzen blonden Strähnen in der Stirn zurecht, bevor sie eine Schellackplatte auf den Teller eines Grammophons legte.
Kurz darauf perlten die ersten Töne von I Can’t Give You Anything But Love aus dem goldenen Trichter. Die samtige Stimme der Sängerin mischte sich sehnsüchtig mit den Trompetenklängen, und Bert schmunzelte zufrieden. Ein Sonnenstrahl verirrte sich durch die Glasscheibe der Ladentür und legte sich sanft auf das gewienerte Parkett. Es roch nach Veilchenseife und teurer Bartwichse.
Nein, Bert hatte es nicht eilig, mit dem Arbeitstag zu beginnen, sein Kiosk wurde von dem Bengel bewacht, der ab und zu die Vertretung machte. Lieber würde er noch einen Moment hier neben Hulda sitzen bleiben und vielleicht einen Schluck Kaffee abstauben.
«Zwei Tassen, bitte, für unsere Gäste», sagte Monsieur Ferdinand zu Gesa, der Berts Ausdruck richtig gedeutet hatte. Sorgfältig hüllte er Huldas Oberkörper in einen Umhang, ehe er ihren Stuhl zur Seite schwenkte und ihren Kopf sanft vornüber ins Waschbecken drückte.
Gesa verschwand durch einen klimpernden Vorhang ins Hinterzimmer, und kurz darauf hörte man sie dort mit einem Wasserkessel hantieren.
Bert beugte sich vor. «Wie geht es Ihnen denn heute, Fräulein Hulda?», fragte er zu dem wirren dunklen Schopf im Waschbecken, doch in diesem Moment drehte der Friseur den goldenen Wasserhahn auf, und ihre Antwort ging in einem Gurgeln unter.
Monsieur Ferdinand ließ das warme Wasser aus der Mischbatterie über Huldas Kopf rinnen. Mit kräftigen Bewegungen verteilte er Shampoo in ihren Haaren und ließ es ordentlich aufschäumen. Erst nach längerem Kneten wusch er alles aus und half Hulda, sich wieder aufzurichten, während er ein Handtuch um ihren Kopf schlang.
«Mir geht es gut so weit», antwortete sie japsend und mit nun hochrotem Gesicht in Richtung Bert. Sie wischte sich ein paar Wassertropfen aus der Stirn. «Viel zu tun, wie immer.»
«Die Mütterberatungsstelle brummt also mehr als dieser Salon?», fragte Bert und erntete dafür einen säuerlichen Seitenblick des Friseurs, der Huldas Haare sorgfältig mit dem Handtuch frottierte.
Gesa erschien mit einem Tablett und drückte Bert und Hulda je eine geblümte Porzellantasse in die Hand, aus denen es verführerisch nach frischem Kaffee duftete.
«Allerdings», sagte Hulda und schlürfte einen Schluck ab, «aber wir haben dort ja auch keine zahlenden Kundinnen, die sich überlegen müssen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Die Stadt übernimmt die Kosten für Säuglingskurse und Mütterberatung, neuerdings sogar für die, die keine Krankenversicherung haben. Früher bekamen wir Hebammen für Geburten in ärmeren Familien gar kein Geld, stellen Sie sich das vor!» Sie schüttelte empört den Kopf. «Heute zahlt die Versicherung sogar Prämien für Mütter, damit sie ihre Kinder möglichst lange stillen. Nun, ob es daran liegt, weiß ich nicht, aber die Säuglingssterblichkeit geht stetig zurück und –» Sie unterbrach sich, und ein verlegenes Lächeln spielte um ihren Mund. Eins ihrer Augen schielte leicht. «Verzeihung», sagte sie, «ich lasse mich immer schnell von diesen Dingen mitreißen und vergesse, dass ich meine Umwelt damit nach Strich und Faden langweile.»
Als Monsieur Ferdinand ihre dunklen kurzen Haare mit einem Kamm bearbeitete, kniff sie schmerzverzerrt die Augen zu, weil das offensichtlich ziepte.
«Wie geht es Ihnen denn, lieber Bert?», fragte sie dann und öffnete die Augen wieder.
Jetzt betrachtete sie ihn, wie ihm schien, zum ersten Mal an diesem Morgen länger.
Ein Lächeln zuckte um ihre Mundwinkel. «Sie sehen sehr wohl aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.»
«Das bin ich tatsächlich», sagte Bert und schmunzelte. «Meine Gesundheit war in den letzten Jahren eher bescheiden zu nennen, aber dieser Sommer hat mich von meinen Zipperlein geheilt, wie es scheint.» Er wurde ernst. «Leider hat es aber jetzt Arnold erwischt», murmelte er düster. «Er liegt schon seit Tagen malade im Bett.»
«Sicher nur eine kleine Sommergrippe», sagte Hulda leichthin, «das geht schnell vorbei.»
«Wollen wir es hoffen.» Kurz wallte die Sorge um seinen Freund in Bert hoch, vor allem wenn er an Arnolds eingefallene Wangen und sein blasses Aussehen dachte, doch er ließ sie nicht die Macht über sich gewinnen. Später, wenn alle Zeitungen verkauft waren, würde er ihn in seiner Wohnung besuchen und ihm eine Suppe bringen.
Er trank seinen Mokka, das wohltuende warme Getränk war wie Medizin, und beobachtete Monsieur Ferdinand beim Zurechtkämmen von Huldas Haarspitzen.
«Wie immer?», fragte der Friseur, und als Hulda nickte, setzte er die Schere an. «Die kurzen Haare stehen Ihnen ausgezeichnet», sagte er, «und ich bin froh, dass wenigstens Sie meinen preisgekrönten Schnitt nicht verschmähen wie neuerdings so einige in der Damenwelt.»
«Wieso?», fragte Hulda und betrachtete ihr Gesicht kritisch im Spiegel. «Was passt den Kundinnen denn daran nicht mehr?»
«Man trägt das Haar jetzt offenbar wieder länger», sagte Monsieur Ferdinand und schnalzte geringschätzig mit der Zunge, während er Huldas Haare mit der klappernden Schere kürzte. «Zurück zu Mütterchens Zeiten, wenn Sie mich fragen. Haben Sie nicht gesehen, wie lang auch die Rocksäume auf einmal wieder sind? Das moderne Girl hat ausgedient, und das brave Gretchen kommt wieder zum Vorschein. Pah! Also, ich wüsste, welche ich vorzöge.» Er knurrte unzufrieden. «Fehlt nur noch, dass wir auch den Kaiser zurückbekommen.»
Bert stellte seine Tasse auf dem Frisiertischchen ab. «Nun, ein Kaiser ist der gestrenge Brüning sicher nicht», spottete er, «eher ein biederer Buchhalter mit seiner sauertöpfischen Miene.»
«Aber er regiert doch wie ein Autokrat», zischte Monsieur Ferdinand, «erlässt seit Kurzem Notverordnungen, als wäre er ein Cäsar, löst den Reichstag auf, wenn der nicht spurt, und buckelt selbst nur nach oben in Richtung Hindenburg.»
«Ein harter Mann», gab Bert zu, «dem die Freundlichkeit und Menschlichkeit eines Stresemanns völlig abgeht. Dabei hätten wir in diesem Land die Wärme einer liebenden Mutter nötiger als einen strafenden Hausvater. Die jetzige Stimmung schadet nur der Demokratie.»
«Welche Demokratie?», fuhr der Friseur auf. «Die letzte Notverordnung zur Arbeitslosenversicherung war ohne Zweifel verfassungswidrig. Denn obwohl der Reichstag nicht zugestimmt hat, wurde das Gesetz erlassen. Was sollen wir Bürger denn daraus lernen? Brüning und Hindenburg werden die Demokratie zerstören, wenn das so weitergeht. Nicht auszudenken, wie die Reichstagswahlen in ein paar Wochen ausgehen könnten!»
«Normalerweise würde ich Ihnen recht geben», sagte Bert, der wieder einmal feststellte, dass der Friseur sehr gut informiert war. «Aber ich habe trotzdem noch einen Rest Hoffnung, dass unsere Demokratie sich als stark genug erweisen wird. Auch, wenn Brünings Methoden wirklich zum Abgewöhnen sind.»
«Alles, was er tut, tut er mit Gewalt», sagte Monsieur Ferdinand aufgebracht und schnippelte verbissen an Huldas Frisur herum. «Hauptsache, er bekommt, was er will. Stets nach dem Motto: Operation gelungen, Patient tot.»
«Aua!», rief Hulda erschrocken und hielt sich das Ohr.
Wie vom Blitz getroffen ließ Monsieur Ferdinand die Schere sinken, sein Gesicht wurde blass.
«Oh, Fräulein Gold», jammerte er, «ich bin untröstlich.»
Ein kleiner Blutstropfen hing an Huldas Ohrläppchen, doch Bert sah zu seiner Erleichterung, dass es keine große Verletzung war.
Hulda wischte das bisschen Blut rasch mit dem Finger fort. «Halb so wild», brummte sie, «aber vielleicht könnten die Herren ihre aufregende Diskussion über Politik vertagen, bis die Schere weit genug entfernt von meinem Gesicht ist, ginge das?» Sie griff nach ihrer Tasse und stürzte den Rest Kaffee hinunter.
«Ja, das wäre wohl das Beste», gab der Friseur zerknirscht zu.
Ein paar Minuten herrschte Schweigen, man hörte nichts als das Klappern der Schere und die pulsierende Jazzmusik aus dem Grammophon. Mit souveränen Schnitten beendete Monsieur Ferdinand schließlich sein Werk.
Huldas Bubikopf saß jetzt astrein, fand Bert. Die längeren Haarspitzen, in welchen die Frisur vorne auslief, betonten ihre schmalen Wangen, und ihr Nacken reckte sich elegant aus dem Blusenkragen. Sie war schöner als je zuvor, dachte Bert, griff nach seinem halb ausgetrunkenen Kaffee und versteckte seinen Stolz in der Blümchentasse.
«Voilà!», sagte Monsieur Ferdinand sichtbar erleichtert. «Wie gefällt es Ihnen?»
«Sehr schön», erwiderte Hulda trocken. «Und zum Glück sind auch beide Ohren noch dran, was viel vorteilhafter aussieht.»
«Oh, liebes Fräulein Gold», begann der Friseur, der sich in Qualen wand, «es tut mir wirklich so furchtbar leid …»
«Vergessen Sie es», sagte Hulda gnädig und ließ sich huldvoll den Umhang abnehmen. Sie stand auf, holte ihre Tasche und klemmte sich den roten Hut unter den Arm. «Was schulde ich Ihnen?»
«Das geht aufs Haus», sagte Monsieur Ferdinand schwach, «das ist das Mindeste …»
«Kommt nicht in die Tüte!» Hulda kramte schon nach ihrem Portemonnaie. «Sie brauchen doch das Geld.» Sie warf einen erneuten raschen Blick in den Spiegel. «Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.»
Unter vielen Verbeugungen nahm der Friseur endlich Huldas Geld an und legte es in die eiserne Schatulle auf dem Empfangstresen.
Auch Bert war aufgestanden und trat nun neben Hulda und den Friseur. Von Gesa war nichts zu sehen, doch er hörte sie hinter dem Vorhang zur Trompetenmelodie pfeifen.
«Diese Platte ist hervorragend», sagte er und deutete zum Grammophon. «Früher war ich verrückt nach neuer Musik und bin durch die ganze Stadt gefahren, um sie zu finden. Die besten Läden gab es im Scheunenviertel.»
«Das ist heute noch so», bestätigte Monsieur Ferdinand, «aber auch hier in der Gegend müssen wir nicht bescheiden sein. Wobei …» Er runzelte die Stirn. «Das ist auch so etwas, was viele neuerdings gern verbieten wollen», sagte er mürrisch. «Zusammen mit den kurzen Kleidchen und Spaß am Leben würden sie am liebsten auch den Charleston wieder in die Mottenkiste verbannen. Zu undeutsch.» Er schüttelte sich. «Die SA und die Bengel von der Hitlerjugend machen in der ganzen Stadt Stimmung gegen den Jazz, es ist zum Mäusemelken! Und in Thüringen wurde Jazzmusik gleich ganz verboten.»
Bert nickte. «Kennen Sie Jake Smith, den Trompeter aus der Motzstraße?», fragte er. «Er hat mir neulich am Kiosk erzählt, dass immer weniger Bars ihn buchen. Wegen seiner Hautfarbe, vermutet er.»
«Ach, das macht mich krank», stöhnte Monsieur Ferdinand und schnalzte unzufrieden. «Wollen denn alle Kneipenbesitzer nur noch deutschen Schwof und Walzertakt? Ich bitte Sie, das hatten wir doch schon zur Genüge.»
«Da stimme ich Ihnen zu», sagte Bert und fuhr sich nachdenklich über den Schnauzbart. «Wissen Sie, ich habe bald … Geburtstag», sagte er verlegen und blickte zwischen dem Friseur und Hulda hin und her. «Und ich hatte da schon so eine Idee, aber ich würde gern Ihre Meinung hören.»
Hulda, die dem Gespräch nur mit halbem Ohr zugehört und in der Tempo geblättert hatte, horchte auf. «Ich habe noch nie etwas von Ihrem Geburtstag gehört», sagte sie verblüfft. «Werden Sie ihn dieses Jahr endlich einmal feiern, Bert?»
«Ganz recht», sagte er. «Bisher war ich nie besonders erpicht darauf, denn, wissen Sie, ich bin nicht einmal sicher, ob das Geburtsdatum so ganz stimmt.» Er räusperte sich. «Aber auf einmal kam mir der Gedanke – wann, wenn nicht jetzt?»
Monsieur Ferdinand nickte. «Wir sollten alle viel mehr feiern», sagte er. «Woran haben Sie denn gedacht?»
«Ich würde gern alle Freunde einladen, den Abend mit mir in einem netten Etablissement zu begehen», sagte Bert. «Und warum nicht auch mit der passenden Musik dazu? Ich trage mich mit dem Gedanken, Mr. Smith und seine Band zu engagieren und den Leuten hier im Kiez einmal zu zeigen, was eine richtige Party ist.»
«Oh! Das ist eine sehr gute Idee», sagte der Friseur eifrig. «Und Sie können auf mich zählen, wenn Sie Unterstützung bei der Vorbereitung brauchen.»
Bert strahlte und deutete eine Verbeugung an.
Hulda klatschte in die Hände. «Wie wunderbar!», rief sie. Dann hielt sie inne, und ihre Wangen färbten sich rosig. «Das heißt, wenn ich überhaupt eingeladen bin», murmelte sie. «Also, ich wollte nicht …»
«Fräulein Hulda, bitte», sagte Bert empört, nahm ihre Hand und küsste sie galant. «Beleidigen Sie mich nicht. Sie sind natürlich mein Ehrengast.»
Sie lächelte verlegen wie ein Mädchen, dann sah sie auf ihre Armbanduhr und zuckte zusammen. «Du liebe Güte!», rief sie. «Ich muss zur Arbeit. Frau Ludwig wird mich mit rauchenden Nüstern erwarten.»
«Ach, vor dem alten Drachen sollten Sie keine Angst haben», sagte Bert, der Huldas Vorgesetzte kannte. «Mit einer Frau Ludwig nimmt es eine Hulda Gold doch jederzeit auf.»
«Sie glauben immer mehr an mich als ich selbst», gab Hulda zurück und drückte einmal kurz seine Hand.
Gemeinsam verabschiedeten sie sich vom Friseur, der einen kleinen Diener machte und begann, die herumliegenden Haare mit einem Besen aufzukehren.
Dann scheuchte Bert Hulda durch die Ladentür hinaus in die Sonne und folgte ihr mit den Augen, wie sie, die Tasche fest in der Hand und den Filzhut noch immer unterm Arm, im Slalom an den Passanten auf dem Marktplatz vorbeieilte. Ihre kurzen Haare glänzten im Morgenlicht dunkel auf wie die Federn eines Raben, und auf einmal schien sie Bert im Nacken ein wenig schmaler als sonst.
Kopfschüttelnd ging er zu seinem Kiosk hinüber, wo eine Menschentraube lesend und schwatzend herumstand. Erst sorgte er sich um Arnold, nun auch noch um Hulda? Er sah heute wirklich Gespenster.
Um Hulda Gold musste sich niemand Sorgen machen! Das hatte sie in den vielen Jahren, in denen er sie bereits kannte, schließlich oft genug bewiesen.
3.
Freitag, 29. August 1930
«Was ist das denn für’n Zeug?», fragte Jutta skeptisch und betrachtete das Glas mit der grünlichen Flüssigkeit, das Joachim ihr hinhielt.
Die Gruppe saß rund um ein flackerndes Lagerfeuer am Großen Fenster der Havel, einer breiten Bucht, wo sich der Grunewald zum Wasser hin öffnete. Über ihnen streckte sich der dunkle Himmel, leise platschten kleine Wellen an den Strand. Seit sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal für ein Abenteuer hier gewesen waren, war es der Lieblingsplatz von Joachim, und sie verbrachten viele Sommerabende hier vor der Insel Schwanenwerder.
Durch die auf und nieder tanzenden Flammen sah Jutta verschwommen Günthers Gesicht, der auf der anderen Seite der brennenden Scheite zwischen Louise und Hedi saß. Und es schien ihr, dass er andauernd zu ihr herüberstarrte.
Noch mehr Jugendliche als sonst waren heute Abend da, eine Gruppe von etwa fünfzehn Leuten hatte sich hier versammelt, weil Joachim eine Feier im Wald verkündet hatte, die sie so noch nie erlebt hätten. Aus einem mitgebrachten Koffergrammophon erschollen schnelle Rhythmen und sehnsüchtige Trompetentöne. Der Feuerschein leuchtete märchenhaft auf all den Gesichtern, und grellrote Funken stoben in die schwarze Nacht und verglühten über dem Wasser.
«Wir trinken die grüne Fee», antwortete Wolf an Joachims Stelle und lachte meckernd. «Oder auch La fée verte, wie die Franzosen sagen.»
Der massige junge Mann stand am Feuer, sodass Jutta zu ihm aufsehen musste, um sein Gesicht zu erkennen. Er warf immer neue Stöcker ins Feuer, woraufhin es jedes Mal zischte und knallte, wenn das Holz noch feucht war.
«Kannst du mal normal reden?», fragte Jutta ärgerlich.
Wolfs Wichtigtuerei ging ihr auf die Nerven. In den letzten Wochen war seine und Joachims Geheimniskrämerei regelrecht unerträglich geworden. Ständig flüsterten sie miteinander, warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu und ließen die anderen der Gruppe in dem Gefühl zurück, sie planten etwas Ungeheuerliches. Doch anstatt damit herauszurücken, behielten sie ihr Wissen für sich.
Manchmal stritten sie aber auch miteinander. Jutta hatte sie gerade vorhin dabei beobachtet, wie sie sich an der kleinen Anlegestelle, an der ein Holzkahn vertäut lag, böse angezischt hatten. Doch worum genau es bei dieser jüngsten Streitigkeit ging, wusste sie nicht. Sie hatte nur wenige Sätze aufgeschnappt. Von Ostlandfahrern war die Rede gewesen und von einer Siedlungsbewegung im deutschen Osten, von der Wolf schwärmte und der sich ihre Gruppe anschließen sollte.
«Ich weiß schon, wer dir diesen völkischen Floh ins Ohr gesetzt hat», hatte Joachim geantwortet. «Aber nicht mit mir und meiner Gruppe, Wolf!»
Als Jutta sich von hinten an Joachim angeschlichen und ihm die Hände über die Augen gehalten hatte, war er zornig herumgefahren, hatte sie dann aber, als er sie erkannte, fest in seine Arme gezogen. Jutta hatte den kämpferischen Seitenblick, den er Wolf zuwarf, bemerkt, konnte sich aber keinen Reim darauf machen. Mochte Wolf sie etwa nicht? Hatte er womöglich etwas dagegen, dass Joachim und sie sich immer näher kamen?
Doch als Wolf, das feiste Gesicht missmutig verzogen, endlich abgedampft war, hatte Joachim sich vorgebeugt und Jutta lange auf den Mund geküsst.
«Das ist Absinth», sagte Joachim neben ihr jetzt lässig. Er trank einen großen Schluck aus seinem Glas und nickte ihr auffordernd zu. «Starkes Zeug, glaub mir. Danach siehst du die Welt mit anderen Augen.»
Unschlüssig betrachtete Jutta ihr Glas.
«Früher haben wir keinen Alkohol getrunken», gab sie zu bedenken. «Das ist nichts für die Wandervögel – hast du das nicht selbst einmal gesagt? Oder gilt das jetzt auf einmal nicht mehr?»
«Entspann dich», sagte Joachim, «wir machen in unserer Gruppe unsere eigenen Regeln. Man ist doch nur einmal jung, oder?»
Kurz entschlossen setzte Jutta ihr Glas an die Lippen und trank. Die Flüssigkeit schmeckte ein wenig bitter, aber auch süß wie Lakritze, die sie sehr gern mochte. Gleich nahm sie noch einen zweiten Schluck. Sie betrachtete Joachim aus den Augenwinkeln. Sein hübsches, markantes Gesicht und der dunkle Schnurrbart hoben sich in scharfem Umriss vom silbrigen Wasser der Havel ab. Jutta spürte, wie ihr wieder einmal ein Schauder über die Haut zog. Wie immer fühlte sie sich von Joachim gleichzeitig angezogen und ein wenig befremdet. In seiner Nähe schien die Luft zu brennen, und ihr Puls beschleunigte sich, wenn er da war. Doch was hieß das? Bedeutete es, wie ihre Schulfreundin Margot behauptete, dass Jutta in Joachim verliebt war?
Nein, dachte sie und trank noch mehr von der grünlichen Flüssigkeit, das glaubte sie nicht. Es war vielmehr so, dass sie einfach gern einmal erleben wollte, wie es war, mit einem Mann zusammen zu sein.
In allen Romanen schliefen Mädchen mit Männern, in allen Schlagern ging es nur um die Liebe, und Jutta spürte deutlich, dass diese Erfahrung dazugehörte, wenn man erwachsen sein und eine moderne junge Frau sein wollte. Sie brannte vor Neugier darauf, wie es sich anfühlen würde – und Joachims Kuss vorhin war wie ein Versprechen gewesen, dass sie es mit ihm herausfinden konnte.
Er hatte Erfahrung mit Frauen, da war sie sicher, und er besaß außerdem Macht über die anderen, wirkte immer souverän und obenauf. All das machte ihn anziehend. Nicht nur für sie selbst, wie sie sehr wohl wusste.
Ein wenig schuldbewusst sah Jutta durch die tanzenden Flammen zu Louise hinüber, deren blonde Locken durch die Nacht schimmerten. Louise liebte Joachim, das wusste Jutta, und sie kam sich ein wenig schäbig vor, dass sie trotz dieses Wissens und trotz ihres sicheren Gefühls, Joachim nicht wirklich zu lieben, seine Avancen erwiderte und Louise ausschloss. Waren sie nicht eigentlich Freundinnen?
Wieder erhaschte sie einen Blick von Günther, und ihr schlechtes Gewissen vertiefte sich. Er hatte sie gern, auch das war ihr seit Langem klar. Doch der gutmütige, musikalische Junge, dessen Freundschaft sie schätzte, war sicher nicht der Richtige, um derlei Dinge auszuprobieren, die ihr vorschwebten. Er war und blieb Joachims jüngerer Bruder.
Schnell sah sie zur Seite, hob ihr Glas und trank erneut. Langsam spürte sie die Wirkung des starken Alkohols. Zwischendurch verschwamm alles um sie herum, bis die Bilder umso farbenfroher wieder zurückkehrten, und jedes Mal erhob sich in ihr ein Wogen und Schwappen, als seien die kleinen Wellen der Havel auf einmal in ihr. Die roten Flammen des Feuers tanzten wie Derwische, und Jutta glaubte, in ihnen allerlei Fratzen und Monster zu sehen, die auf und ab waberten, hochschnellten und wieder in sich zusammenfielen. Sie konnte den Blick gar nicht mehr abwenden von diesem verrückten Spiel.
Plötzlich erklang ein Motorengeräusch durch den nächtlichen Wald, und alle sahen überrascht auf.
Das Knattern wurde lauter und erstarb dann in einem letzten Heulen, als der Motor jäh abgewürgt wurde.
Joachim stellte sein Glas auf den Waldboden und sprang auf. Doch Wolf war ihm schon vorausgeeilt. Man hörte Männerstimmen, dann ein helles Frauenlachen, und schon kam Wolf zwischen den Bäumen zurück, im Arm links und rechts zwei Unbekannte, einen Mann und eine Frau mit einer großen Tasche.
Der Mann, sah Jutta, als die drei näher kamen, war schon älter, vielleicht dreißig. Er trug Hemd und Lederweste und hielt eine Weinflasche in der Hand. Die Frau war in ein schillerndes Kleid mit kleinen silbernen Pailletten gehüllt. Sie hatte dieselbe Frisur wie Lilian Harvey, sanfte Locken, die ihre Ohren bedeckten und sich in ihren Nacken schmiegten.
Jutta hatte die Schauspielerin zusammen mit ihrer älteren Schwester in dem Film Liebeswalzer im Kino gesehen und sofort gedacht, dass Willy Fritsch, der den Sekretär Bobby spielte, ein wenig Ähnlichkeit mit Joachim besaß.
«Was machen die hier, Wolf?», fragte Joachim scharf in die Musikklänge hinein, die noch immer aus dem kleinen Trichter des Grammophons in die Dunkelheit perlten. Jutta hörte den Ärger in seiner Stimme.
«Sie wollen sich unsere Truppe mal aus der Nähe ansehen», sagte Wolf und ließ die beiden Neuankömmlinge los. Er schlug Joachim auf die Schultern. «Ist doch toll, oder? Sei kein Spielverderber», sagte er, «heute wollen wir feiern, oder etwa nicht?»
Der Mann ging auf Joachim zu und streckte lässig die Hand aus. «Wir haben uns schon ein paarmal gesehen», sagte er. «Martin Loos – erinnerst du dich?» Er blickte zu seiner Begleiterin, die bereits ans Lagerfeuer getreten war. «Und das ist Maleen.»
Joachim ließ sich zögernd von dem Mann die Hand schütteln und zog sie dann schnell zurück. «Eigentlich laden wir keine Außenstehenden ein», knurrte er, «aber wenn ihr schon mal hier seid, wollen wir nicht unhöflich sein.»
Martin nickte. «Wolf redet andauernd von euch und eurer Gruppe», sagte er.
Jutta spürte seine Blicke auf sich, als er die Jugendlichen rund um das Feuer musterte und beobachtete, wie sie tranken, sich unterhielten und zur Musik sangen.
«Mutig, abenteuerlustig, sportlich … Wie ich dir schon ein paarmal sagte, Joachim – das ist genau das, was wir brauchen.»
«Warum sollte es uns interessieren, was Sie brauchen?», fragte Joachim, doch Wolf zog ihn und Martin zum Feuer, eher dieser antworten konnte.
«Jetzt lasst uns doch erst mal feiern», sagte er. «Martin, zeig mal, was du mitgebracht hast!»
Der Mann reichte ihm die Weinflasche. «Das ist nur das Anstandsgeschenk», sagte er und lachte leise. «Ich habe für später noch was viel Besseres.» Vielsagend zog er die Nase hoch und grinste breit.
Jutta sah, wie Wolfs rundliches Gesicht aufleuchtete. «Auf dich ist Verlass», dröhnte er.
«Ich hoffe, das kann man von allen hier sagen», gab Martin zurück und schaute erneut in die Runde.
Jutta bemerkte, wie sein Blick an Joachim hängen blieb, der sich wieder neben sie gesetzt hatte. Seine Miene war düster.
«Aber wird hier denn gar nicht getanzt?», fragte Martin. «Ist das die viel besungene Kraft der deutschen Jugend – auf dem Boden hocken und fremdartige Musik hören?»
Er stieß einen leisen Pfiff aus, als würde er seinen Hund rufen, und die junge Frau, die in ihrem glitzernden Kleid mit etwas Abstand zum Feuer stehen geblieben war und sich gerade eine Zigarette anzündete, schlenderte zu ihm herüber. Sie hatte ihre Schuhe abgestreift und lief barfuß durch den Sand.
Jutta trank noch einen Schluck. Hatte Joachim ihr Glas aufgefüllt, ohne, dass sie es bemerkt hatte? Vor ihren Augen tanzten die Schatten immer schneller.
«Wollen wir denen hier mal zeigen, was gute Musik ist, Martin?», fragte Maleen mit rauchiger Stimme und zog eine Platte aus ihrer großen Tasche. Ohne auf eine Antwort zu warten, ging sie zum Grammophon, würgte die flotte Swingmusik ab und legte stattdessen ihre Platte auf den Teller. Die Nadel fand die erste Rille, und ein Schlager im Walzertakt ertönte. Einmal am Rhein, sang eine männliche Stimme näselnd, beim Gläschen Wein beim Mondenschein …
Martin wirkte zufrieden. «Zwar sind wir nicht am Rhein, aber die Havel ist auch nicht schlecht», erklärte er und ließ wieder das Lachen hören, das Jutta so unsympathisch war. «Hier haben schon die alten Germanen getanzt und gefeiert.» Er zog Maleen in die Arme und begann, sie im Walzertakt im Sand herumzuschwenken.
Einige aus der Gruppe standen auf, bildeten Paare und tanzten mit.
In Juttas Kopf drehte sich alles nur noch mehr. Doch auf einmal fühlte sie sich übermütig. Sie griff nach Joachims Hand.
«Willst du tanzen?», fragte sie. Und in einem weit entfernten Eckchen ihres Hirns dachte sie, dass es ihr gar nicht ähnlichsah, so forsch aufzutreten, doch zu ihrer Erleichterung sah sie Joachim nicken.
Sie ließ sich von ihm hochziehen und spürte, wie sich seine Arme eng um sie schlossen. Vorsichtig legte sie ihr Gesicht an seine Schulter, nahm die Wärme seines Körpers wahr und sog seinen Duft ein.
Die Härchen auf ihren Unterarmen stellten sich auf, als sie fühlte, wie er mit der Hand über ihre Haut strich. Sie schmiegte sich enger an ihn und überließ sich ganz der schleppenden Musik und ihren gemeinsamen Bewegungen im unebenen Sand.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























