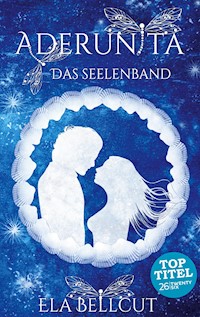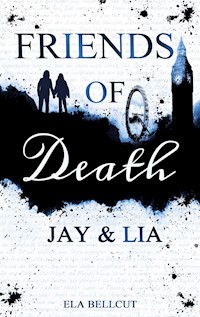
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist seine Hoffnung. Doch ist er ihr Untergang? London - für Lia die Stadt des Neuanfangs. Verfolgt von ihren Depressionen wünscht sie sich nur ihren Frieden. Die Arbeit auf der Krebsstation im Krankenhaus hilft ihr dabei. Als ihr jedoch der Geist eines Patienten erscheint und sie darum bittet, sich um dessen Bruder Jay zu kümmern, beginnen Lias Probleme. Einerseits will sie ihm helfen, andererseits sich emotional selbst schützen. Trotz aller guten Vorsätze, entwickelt sich eine Bindung zu Jay. Aber je näher sich die beiden kommen, desto größer ist die Gefahr, sich in Jays Trauer zu verlieren. (Triggerwarnung siehe Vorwort)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ela Bellcut ist ein laufendes kreatives Chaos. Mithilfe von diversen Notizbüchern und To-do-Listen versucht sie, ihren Alltag und ihre Projekte zu händeln. Am liebsten zieht sie sich ins Grüne zurück, verbringt Zeit mit ihrer Katze oder widmet sich ihren Ideen.
Ihre schriftstellerische Tätigkeit hat sie mit Gedichten, Kurzgeschichten und Texten als Filmkritikerin für eine Onlineplattform begonnen.
2019 erschien das erste Buch ihrer Fantasyreihe „Aderunita – Das Seelenband“ und wurde vom 26-Verlag zum „Top Titel“ und „Bestseller“ gekürt. Der zweite Teil „Die Lichtelfen“ folgte ein Jahr später.
Wenn ihr Näheres über sie erfahren wollt, besucht gern ihre Seiten:
www.elabellcut.de
www.instagram.com/ela.bellcut
www.twitter.com/ElaBellcut
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Mein Leben in London
Das Ende ist der Anfang
Die verlorene Zeit
Gleich & doch anders
Die Toilettenfarce
Die Dunkelheit in uns
Worte, alles nur Worte
Begangene Fehler
Ein Freundschaftsbesuch
Die Motivationstour
Welcome to Mr. G
Musik der Erinnerung
Last, but not least
Blick über London
Grenzen der Freundschaft
Bittere Wahrheiten
Verlust & Halt
Mein Fallschirm
Home, sweet home
Spuren der Monster
Zeit, die verfliegt
Das Mehr zwischen uns
Folge dem Gefühl
Drei Worte der Hölle
Vermisste Freunde
Die Fahrt ins Ungewisse
Vergangenes & Begrabenes
Bewunderung & Liebe
Leben ohne Geheimnisse
Illusion der Verzweifelten
Der Fall ins Nichts
Blick auf die ander Seite
Ohne Fallschirm keinen Halt
Die Friedhofserkenntnis
Have we gone mad?
Es ist Geisterstunde
Der letzte Schritt
Epilog: Das Fest der Liebe
Nachwort
Schön, dass dieses Buch den Weg in deine Hände gefunden hat. Solltest du den zweiten Teil meiner Fantasyreihe „Aderunita“ gelesen haben, kommt dir hier die Protagonistin vielleicht bekannt vor. Wenn du es nicht kennst, ist das nicht schlimm. Du erfährst alles über sie in „Friends of Death“. Doch bei „Die Lichtelfen“ wählte ich einen dramatischen Einstieg und ließ einer jungen Frau, die nur eine Randfigur in dem Buch ist, etwas passieren, was von Anfang an eine eigene Geschichte entwickelte. So entstand „Friends of Death“.
Hier geht es um Tod, Verlust, Depressionen und die Suche nach dem eigenen Halt. Ich möchte nicht vorweggreifen, aber sagen, dass Lias und Jays Geschichte nicht für jeden eine leichte Kost ist. Sollten dich die genannten Themen triggern, überlege dir bitte, ob du dieses Buch lesen willst. Ich weiß, wie schwer solch ein Thema ist, wenn man selbst Derartiges erlebt hat. Allein das Schreiben darüber war nicht immer leicht. Andererseits hoffe ich, dass das Buch dir, gerade wenn solche Themen dich betreffen, hilft. Dass es zeigt, wie man mit seinen melancholischen Gedanken umgehen kann, und dass manchmal der richtige Anstoß nötig ist oder Hilfe, um „dunkle“ Momente zu bewältigen. Entscheide daher, ob du der Geschichte eine Chance geben willst.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Buch fiktive Personen und Geschehnisse darstellt und keine professionelle Hilfe bietet. Solltest du welche benötigen oder einen Gesprächspartner brauchen, kann ich dir Telefonseelsorge.de ans Herz legen. Du kannst dort anrufen, mit Mitarbeiter*innen chatten, zu den deutschlandweiten Stationen gehen oder auch als Helfer*in tätig werden, wenn du dich emotional stabil genug dafür fühlst.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen, dass dich vor allem die positiven Tage in deinem Leben begleiten und freue mich auf dich im Nachwort.
Deine Ela
Es klingelte an der Wohnungstür. Nicht einmal eine Minute später hörte ich bereits, wie der Schlüssel im Türschloss umgedreht wurde.
Das kann doch nicht wahr sein.
„Sam, ich komme gleich!“, rief ich über die Schulter in den Flur hinein, während meine Tante die Wohnung betrat.
„Lilian, wir müssen los! Bist du noch nicht fertig?“
Ein frustrierter Laut kam über meine Lippen, ehe ich rief: „Sam, du sollst mich nicht mehr so nennen!“
„Verzeihung, Lia. Beeilst du dich trotzdem? Wir kommen sonst zu spät.“
Am liebsten hätte ich meine Zimmertür zugeschmissen, mich gar nicht erst angezogen und wäre zurück ins Bett gekrochen, anstatt mit meiner Tante zur Arbeit zu fahren.
Sie konnte einfach keine Ruhe geben und fing schon wieder an: „Hast du Gaia gefüttert?“
Sie sucht nur nach Fehlern!
„Nein, noch nicht. Ich bin gerade erst aus der Dusche raus. Ich mach’s gleich, wenn ich angezogen bin.“
Trotz meiner Worte hörte ich, wie Sam in der Küche herumhantierte, während ich vor dem Kleiderschrank stand und mich anzog. Ich trug schon eine schwarze Leggings und einen dünnen Pullover, über den ich nun einen langen Hoodie stülpte. Mein blaues, nasses Haar knotete ich schnell zu einem lockeren Dutt zusammen und verzichtete auf den Föhn.
Als ich mein Zimmer verließ, stand Sam wartend im Flur. Ihr graues, kurzes Haar war perfekt frisiert. Sie trug einen bequem aussehenden, schwarzen Hosenanzug, der ihre schlanke Figur betonte und zu schick für die Arbeit im Krankenhaus war. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass sie mit ihren fünfundfünfzig Jahren fit und elegant wirkte. Wenn sie mich nur nicht so genervt ansehen würde.
Sie streckte mir einen Thermobecher entgegen, als ich näher kam. „Hier, dein Kaffee. Gaia ist gefüttert. Wir können also los.“
„Ich hätte das noch gemacht.“
Sie nickte mit zusammengepressten Lippen und verließ wortlos die Wohnung.
Ich schloss die Tür hinter mir, folgte ihr durch den Hausflur und konnte er mir nicht verkneifen, sie auf das Offensichtliche aufmerksam zu machen: „Dir ist klar, dass ich mich nicht nach deinen Arbeitszeiten richten muss, oder? Im ehrenamtlichen Dienst kann man sich den Tag selbst einteilen!“
Sie warf einen kurzen Blick über ihre Schulter, ehe sie in ihrem üblichen strengen Tonfall sagte: „Ich weiß, Lia. Doch dein Leben braucht Struktur! So lange du weder zur Schule gehst, noch es für nötig hältst, dir einen Job zu suchen, beginnst du zeitgleich mit mir im Krankenhaus, um dir die Wohnung und deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Du bist alt genug, um zu lernen, wie es ist, auf eigenen Beinen zu stehen.“
Ich nahm einen vorsichtigen Schluck von meinem Kaffee und ersparte mir die Antwort.
Wie jeden Morgen drehten sich meine Gedanken um meine Möglichkeiten: In einer Londoner Schule den Abschluss machen? Kellnern? Einen anderen Job und dann was Eigenes – raus aus Sams Wohnung? Ich hatte das Gefühl, vom Regen in die Traufe gekommen zu sein.
Blödsinn!, ermahnte mich mein Gewissen. Du hast Glück, eine Tante wie sie zu haben, die dich bei sich aufgenommen hat! Mir wurde einmal mehr bewusst, wie ungerecht ich oft von ihr dachte. Dass die stillen Vorwürfe, die ich ihr wegen ihrer jahrelangen Abwesenheit machte, unfair waren. Mein Vater hatte England verlassen und den Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen. Trotzdem war Sam nun für mich da. Ich hatte jemanden, der sich wirklich um mich kümmerte. Das hatte ich so lange nicht gehabt, dass ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen sollte.
Sie will nur dein Bestes!
„Na komm, steig ein!“ Sams Worte rissen mich aus meinen Gedanken. Ich registrierte, dass ich ihr bis zur Straße gefolgt war, ohne die Umgebung bewusst wahrzunehmen. Ich stand vor ihrem Auto, indem sie längst saß und mich ungeduldig durch das offene Beifahrerfenster zu sich winkte. „Los! Was ist?“
Ich stieg in ihren Mini und sie fädelte sich schnurstracks in den Verkehr. Auch nach vier Monaten war es noch völlig skurril für mich, auf der linken Seite zu fahren.
„Hast du dir die Schulunterlagen angesehen, die ich dir in die Küche gelegt habe?“
Nur mit Mühe konnte ich mir ein Aufstöhnen verkneifen. „Nein, habe ich noch nicht.“
Werde ich auch nicht, fügte ich in Gedanken hinzu.
Ich sah an Sams angespannter Kiefermuskulatur, wie ihr die Antwort missfiel. Drei Atemzüge zählte ich, bis sie einen anderen Weg einschlug. „Lia, ich weiß, dass du eine schwere Zeit hinter dir hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, aus dem gewohnten Leben gerissen zu werden und in einer fremden Stadt neu anfangen zu müssen. Ich verstehe, dass du deine bisherigen Pläne und die Schule hier nicht einfach fortsetzen kannst. Aber denke an deine Zukunft. Du verbaust sie dir, wenn du so weitermachst. Seien wir ehrlich, das kann nicht ewig so weitergehen.“
Natürlich hatte sie recht. Doch sträubte sich bei dem Gedanken an Schule oder einen normalen Alltag alles in mir. Es fühlte sich wie ein bedrückender Zwang an. Ich wollte nicht aus meiner derzeitigen Situation gerissen werden, nicht aus meiner Zufriedenheit oder aus meinem fast erreichten inneren Gleichgewicht.
Anfang Juni hatte sich alles schlagartig geändert. Ich war von Hamburg nach London gezogen, hatte meine Schule aufgeben und meinen besten Freund Sian zurücklassen müssen. Hätte mir vor den vier Monaten jemand erzählt, ich würde bald in London leben, wäre es mir wie ein Traum vorgekommen. Aber jetzt konnte ich diesen Traum nicht richtig genießen.
Im Moment war ich planlos, lebte in den Tag hinein. Außer meiner Arbeit und dem Versorgen von Gaia, die nicht einmal meine Katze war, sondern wie die Wohnung Sam gehörte, tat ich nichts.
Vielleicht liegt da das Problem, überlegte ich. Ich habe nichts Eigenes. Weil ich nicht weiß, was ich will.
Mein Abitur, mein angestrebtes Kommunikationsdesignstudium, meine vorherigen Zukunftspläne – alles hatte ich in Hamburg zurückgelassen. Nur Leere war in mir zurückgeblieben. Leere und sich wiederholende Albträume. Zwar ging es mir allmählich besser, trotzdem konnte ich die Leere nicht mit neuen Zielen füllen. Egal, wie sehr ich mir den Kopf darüber zermarterte, wie oft ich mir wünschte, ich könnte normal weitermachen – der Gedanke daran lähmte mich.
Da ich bislang nichts erwidert hatte, ergriff Sam erneut das Wort: „Ist dir die Arbeit auf der Krebsstation zu viel? Belastet sie dich? Kannst du dich deswegen nicht auf die Schulsuche oder deine Zukunft konzentrieren?“ Ehrliche Anteilnahme war in ihrer Stimme zu hören.
Meine Gedanken schweiften zu meiner Arbeit. Sie verschaffte mir eine innere Ausgeglichenheit, nach der ich lange Zeit gesucht hatte. Wie auf Knopfdruck kam mir einer der Patienten in den Sinn: John.
Ich griff nach meinem Kettenanhänger in Form eines Lebensbaumes und hoffte sein Trick mit dem Ankern und dem Abrufen von Gefühlen würde funktionieren.
Tatsächlich fühlte ich mich prompt in meine Kindheit zurückversetzt: Mein bester Freund Sian stand mit mir Hand in Hand an der Elbe. Unsere Füße waren im warmen Sand vergraben. Die Sonne kitzelte auf meiner Haut. Über uns flogen vereinzelte Möwen, deren Schreie sich mit dem Rauschen des Wassers vermischten. Ich trug einen leuchtend gelben Badeanzug und hatte Schwimmflügel an meinen Armen. Hinter mir kicherte meine Mutter, während mein Vater eine seiner Geschichten erzählte. Ich drehte mich zu ihnen um. Beide sahen glücklich aus. Mutter nickte mir lächelnd zu. Dann blickte ich zu Sian, drückte kurz seine Hand, ehe wir uns in die Elbe stürzten.
Die Berührung des Anhängers gab mir Mut und Zuversicht. Daher schlug ich jetzt einen milderen Ton an: „Nein, Sam. Die Arbeit macht mir Spaß. Sie lenkt mich zwar ab, aber eher im positiven Sinn. Irgendwie ist es schwierig, über die Zukunft nachzudenken, wenn die Vergangenheit mich wie ein Scherbenhaufen umringt. Ich habe das Gefühl, dass ich damit erst abschließen muss, bevor ich über was Neues nachdenken kann.“
Meine Tante nickte und sah kurz zu mir. Ein Lächeln schlich sich auf ihre Lippen, weil ich mich ihr ein Stück weit geöffnet hatte. Seit ich Johns Tricks anwendete, fiel es mir immer leichter, dies zu tun.
„Das verstehe ich.“ Sie nickte noch einmal bekräftigend. „Gut, vielleicht solltest du dir die Auszeit für den Rest des Jahres gönnen. Wir behalten unser Arrangement bei, und du überlegst, was du möchtest. So hast du weniger Druck bei der Entscheidung. Wir können dann nächstes Jahr sehen, ob wir dich an einer Schule anmelden, du eine Ausbildung oder ein Studium anfängst. Bei uns suchen wir stets Leute. Du könntest Krankenschwester werden, wenn dir die Arbeit mit den Patienten Spaß macht.“
Ich stimmte ihr zu, obwohl ich wusste, dass Letzteres nie eine Option für mich wäre. Täglich sah ich, was die Schwestern leisteten. Ich hatte den größten Respekt vor ihrer Tätigkeit, doch ich könnte das nicht. Meine Arbeit als ‚Blue Angel‘ war etwas anderes, als die Patienten zu pflegen oder wirklich Tag für Tag mit Verletzungen und dem Tod konfrontiert zu werden.
„Dann ist es abgemacht. Bis zum – sagen wir Februar, kannst du dir ’ne grobe Tendenz überlegen, damit wir für nächstes Jahr die richtigen Schritte einleiten können. Okay?“ Sie lächelte mich abermals an.
„Mhm“, drang über meine Lippen. Doch nichts war okay. Möglicherweise wird es das aber werden, wenn ich dem Ganzen eine Chance gebe. Sicher liegt es an mir, dass meine Situation so stagniert.
Natürlich liegt es an dir!, sagte meine innere Stimme vorwurfsvoll. Und meine Finger umklammerten den Lebensbaumanhänger fester.
***
Wir kamen beim Krankenhaus an, parkten auf Sams Mitarbeiterparkplatz und gingen anschließend zum Gebäudekomplex hinüber. Meine Tante sah dabei sehr zufrieden aus. Offenbar tat es ihr gut, gewisse Meilensteine in unserer Beziehung festgesetzt zu haben, damit sie sich in den nächsten Monaten nicht um mich zu sorgen brauchte.
Wir betraten das mehrstöckige Haupthaus und fuhren mit dem Fahrstuhl nach oben. Im vierten Stock angekommen, ging ich ins Schwesternzimmer, während Sam sich in das der Stationsleitung begab, sodass ich für Minuten allein war. Ich stand vor meinem Spind, zog mir den Hoodie aus und dafür die blaue Dienstkleidung über den weißen Pullover und meine Leggings. Dann pinnte ich mir das Namensschild an die Brust, auf dem ‚Angel Lia‘ stand. Die Bezeichnung ist reine Ironie. Als würden wir die Patienten ins Himmelreich führen, statt ihnen das Leben hier erträglicher zu machen.
Doch ich vermutete, dass sie den Leuten auch Hoffnung gab. Sie konnten so an das Gute glauben. An Hilfsbereitschaft, Güte.
Ich leerte den Thermobecher mit meinem Kaffee in einem Zug, verstaute ihn im obersten Fach und griff nach dem Buch, das dort lag: ‚The Hobbit‘ von J.R.R. Tolkien. Meine Hand glitt über den alten Einband, der ebenso äußerlich eine Geschichte mit sich trug, so oft war das Buch gelesen worden.
Eigentlich gehörte es John. Er hatte es mir bei seinem letzten Aufenthalt geschenkt, da er es aufgrund der Chemotherapie nicht mehr lesen konnte. Er hatte weder die Zeit noch die Konzentration dafür.
Prompt spürte ich einen Kloß im Hals.
Heute kommt er zurück!
Ich blickte auf, sah zu dem kleinen Spiegel, der sich an der Innenwand meines Spindes befand, und versuchte mich an einem Lächeln. Mein Spiegelbild glich einer Fratze. Das nennst du lächeln? Ich schüttelte den Kopf und gab den kläglichen Versuch auf. Bleib bei deinem I-AaH-Gesicht, damit läufst du eh besser.
Also verließ ich das Schwesternzimmer und machte mich auf zum Informationstresen, um mich nach John zu erkundigen.
Kaum war ich auf den Flur getreten, hörte ich schon seine Begrüßung von links: „Hey, my Angel!“
Ich drehte mich um und stockte. Blinzelte.
Vor zwei Wochen hatte ich Johnny zuletzt gesehen, trotzdem fiel es mir schwer, die vertraute Stimme mit dem Mann vor mir in Einklang zu bringen.
An meinem ersten Tag hier im Krankenhaus hatte er wie mein Idol Kurt Cobain ausgesehen. Seine blonden Haare hatten sein markantes Gesicht umrahmt. Doch seit der ersten Operation waren sie fort. Seine blauen Augen hatten mich damals belustigt angesehen, hatten mein Herz rasen lassen. Heute war sein Lächeln zwar noch da, aber es erreichte nicht mehr seine Augen. Zudem überzog ein dünner Schweißfilm seine Haut. Seine Wangen waren eingefallen, als hätte er lange nichts gegessen oder alles, was er zu sich genommen hatte, wieder erbrochen.
Wenn ich meine erste Erinnerung von ihm mit seiner jetzigen Erscheinung verglich, war es, als wären der John von vor vier Monaten und dieser hier verschiedene Personen. Sie hatten noch eine gewisse Ähnlichkeit miteinander, aber dass so wenig Zeit ausreichte, um einen Menschen auszuzehren, erschreckte mich.
Bei jedem Besuch hatte John mehr abgebaut. Der kahl geschorene Kopf für die Operation war damals schon schlimm gewesen. Aber bei jedem folgenden Zyklus hatte sich die Chemotherapie mehr durch seinen Körper gefressen, ihn zerstört und ihm jetzt sogar seine Fröhlichkeit geraubt.
Wegen seines Anblicks hätte ich fast vergessen, etwas zu erwidern: „Schön, dich zu sehen, Johnny. Ich hoffe, es bleibt bei unserer Abmachung?“
Ich hob das Buch in die Höhe, als seine Mutter sich hinter ihm vom Informationstresen abwandte und zu uns trat. Sie war eine rundliche Frau Mitte vierzig, mit rotblondem Haar, welches schon einige graue Strähnen aufwies und mit einem so herzlichen Lächeln, das ich prompt erwidern musste. „Guten Morgen, Lia.“
„Guten Morgen, Mrs. Grays.“
„Wir sind im Raum 412. Nach den Untersuchungen und dem Arztgespräch muss ich zur Arbeit. Du kannst also am Nachmittag vorbeikommen. Ich weiß ja, dass ihr lieber unter euch seid.“ Mit diesen Worten legte sie eine Hand auf Johns Rücken, um ihn zum Weitergehen zu animieren.
„Bis später, my Angel“, sagte dieser zwinkernd.
Sie gingen an mir vorbei. Mein Blick folgte ihnen, bis sie im besagten Zimmer verschwunden waren. Für Sekunden verharrte ich, hielt das Buch an mich gedrückt, Johns Lächeln vor Augen, das heute so anders ausgesehen hatte.
Jedes Mal begrüßte er mich mit ‚My Angel‘, immer lächelnd, nie mit einer Miene des Schmerzes, der Wut oder der Trauer. Mit allem hatte ich hier gelernt umzugehen, aber dieses Lächeln hatte mich seit unserem ersten Treffen verfolgt. Es war bewundernswert. Faszinierend und erschreckend zugleich. Denn es ließ mich an mir zweifeln. Ich war kerngesund, hatte wahrscheinlich ein langes Leben vor mir. Trotzdem hätte ich nicht eine Minute lächeln können wie er.
***
Ich stand vor Johnnys Zimmer. Mit der rechten Hand drückte ich ‚The Hobbit‘ an meinen Oberkörper. Mit der linken umklammerte ich den Lebensbaumanhänger an meinem Hals und holte tief Luft. Dann griff ich zur Türklinke und wagte den Schritt in den Raum.
„Da bist du ja, my Angel“, begrüßte mich John fröhlich und prompt schnürte sich etwas in meiner Brust zusammen. Trotzdem ging ich zu seinem Bett hinüber und nahm den üblichen Platz neben ihm auf einem Stuhl ein. Dann schlug ich ‚The Hobbit‘ auf und setzte wie sonst an: „Na, wo sind wir stehen geblieben?“
„Weißt du, was ich an dir mag, Lia?“
Ich hob den Kopf und zuckte gleichzeitig mit den Schultern. „Nein. Was?“
„Du fragst mich nie, wie es mir geht.“ Er starrte auf das Buch, mit einem Blick voller Traurigkeit.
Blöde Floskeln fielen mir ein. Gefühle aus meiner Vergangenheit schwappten in mir hoch. Erinnerungen. Immer diese hohle Frage: Wie geht’s dir?
Und immer meine Antwort: Gut.
Es war nie die Wahrheit gewesen. Denn wer wollte schon die Wahrheit wissen? Wer wollte wissen, wie schlecht es einem ging? Dass in einem Monster waren, die einem zuflüsterten. Die einem sagten, wie überflüssig man in der Welt war. Wie armselig. Hässlich. Schwach. Wer wollte wissen, dass man sich die meiste Zeit in seinem Leben kaum selbst ertrug?
„Ich möchte nicht, dass du dich gezwungen fühlst, mich anzulügen, Johnny“, erwiderte ich, da ich wusste, dass auch er mir nie sagen würde, wie schlecht es ihm wirklich ging.
Ein Moment verstrich, bis sich sein Mund auf der rechten Seite zu einem amüsierten Ausdruck verzog. „Vielleicht möchtest du nur nicht, dass ich den Regeln der Höflichkeit folge und dir ebenfalls die Frage stelle, sodass du dich gezwungen fühlst, mich anzulügen.“
Sein Blick bohrte sich durch mich hindurch. Nie hatte mich jemand so durchschaut. Mir fehlten die Worte. Ich konnte nur nicken, schaute zu dem Buch in meinen Händen und blätterte ziellos darin herum.
„Lia, ich möchte nicht, dass du heute vorliest.“
„Oh, wieso?“ Enttäuschung machte sich in mir breit.
„Weil ich mich nicht darauf konzentrieren könnte.“
„Warum? Was hat die Untersuchung ergeben?“ Meine Sorge schwang in meiner Stimme mit.
„Wir werden keinen neuen Zyklus starten. Stattdessen wollen sie es nochmals mit einer OP versuchen.“
„Eine OP?“, stieß ich aus und ahnte Schlimmes.
„Der Tumor ist wieder gewachsen, zudem hat er gestreut und es …“ Ihm versagte die Stimme.
Prompt schnellte meine Hand zu meinem Anhänger.
Mut und Zuversicht.
Johns Blick folgte meiner Handbewegung. „Ich hätte mir für den Notfall auch ein paar gute Gefühle ankern sollen“, sagte er mit dem Blick auf meine Kette.
„Wieso tust du es nicht noch?“, schlug ich vor.
Er schüttelte den Kopf. „Da ist nichts mehr, Lia.“
Ich schluckte. „Wie meinst du das?“
„Ich kann das Positive in mir nicht abrufen.“
Es war wie ein Schwall kaltes Wasser in mein Gesicht. Plötzlich waren unsere Rollen vertauscht. Nach Johns erster Operation, hatte er mir erzählt, dass man Gefühle abspeichern könnte, um in schlechten Momenten davon zu zehren und nicht in seiner Lethargie unterzugehen. Damals hatte ich den Satz gesagt.
„Johnny“, begann ich und griff nach seiner Hand.
„Nein, Lia, schon gut. Ich weiß, was du sagen willst. Ich kenne die Floskeln, die Methoden. Ich habe sie dir anfangs selbst gesagt. Und jetzt, erst jetzt, wo ich in dieser Scheißsituation bin, erkenne ich, wie hohl solche Worte sind. Wie sinnlos.“
„Sie sind nicht sinnlos“, flüsterte ich und räusperte mich dann. „Das Ankern, das Erden und die abendliche Reflexion des Tages haben mir sehr geholfen! Ich wüsste gar nicht, was ich ohne deine Tipps gemacht hätte, wie es mir jetzt gehen würde.“
„Es freut mich, dass dir die Methoden helfen.“ Er sah aus, als würde er in Gedanken abdriften.
Ich wartete. Es war leichter, als etwas zu sagen. Wenn er weiterreden wollte, würde er es tun.
„Danke“, sagte er unvermittelt und ich sah ihn verwundert an. „Danke, Lia, dass du mich ohne diese aufgesetzte Heiterkeit ansiehst, die ich seit der Diagnose erlebe. Du sitzt bei mir und bist mir eine Freundin, die ich hier nie erwartet hätte zu bekommen. Durch dich kann ich meiner Familie gegenüber stark sein. Sodass sie mich mit einem Lächeln in Erinnerung behalten und nicht als diesen Schatten, der ich geworden bin.“
Ich schluckte hart, aber John grinste.
„Immerhin muss ich nichts bereuen, sollte das mit dem Tumor nicht besser werden.“
„Nichts? Du willst nichts mehr sehen oder tun?“, war das Einzige, was ich sagen konnte, in der Hoffnung, so das Thema auf etwas Positives zu lenken.
Er zuckte mit den Schultern. „Eigentlich nicht.“
Kurz dachte er nach. „Vielleicht ein Tattoo stechen lassen, aber sonst … ich hätte zwar gern mein Studium beendet und als Arzt praktiziert, aber das ist jetzt unwichtig. Das Einzige, was noch zählt, ist mein Bruder.“
Die blauen Augen, denen alle Fröhlichkeit abhandengekommen war, richteten sich auf mich. „Ich hab’s dir bislang nie erzählt, aber Jay setzen meine Chemo und die Möglichkeit meines Todes enorm zu.“
John hatte seinen Zwillingsbruder oft erwähnt. Dessen Kreativität, sein Schreibtalent, seinen Humor und dass er eine feste Stütze, während der Chemotherapie für ihn gewesen war. Trotzdem hatte ich Jay nie im Krankenhaus gesehen. Nur ihre Mutter. Weswegen ich mich fragte, ob er wirklich dieser fantastische Bruder war, von dem John immer erzählte.
„Weißt du, Lia, ich habe Angst, dass wenn ich bald sterbe …“
Ich ließ ihn nicht weiterreden. „Du wirst nicht bald sterben! Die erste OP lief doch gut. Auch wenn der Tumor erneut gewachsen ist, die heutige Medizin ist schon so weit und …“
„Nein, Lia. Machen wir uns nichts vor. Ich kenne die Statistiken von Gehirntumorpatienten. Viele überleben nicht mal die ersten paar Jahre. Ich bin ein zum Tode Verurteilter, der seinen dreiundzwanzigsten Geburtstag nicht mehr erleben wird.“
Ich fühlte mich wie vor den Kopf gestoßen. Natürlich wusste ich, dass Krebs zu Depressionen führte. Dass Patienten sich von ihrem Körper verraten fühlten. Sich fragten, warum ihnen so etwas passierte. Jeder hatte solche Tiefs. Es war normal. Doch solche Worte mit dieser festen Überzeugung von Johnny zu hören, erschreckten mich. Leitsätze blinkten wie Neonschilder in meinem Kopf auf. Methoden, die man bei so einem Verhalten anwendete. Worte, die man in solch einer Situation sagte. Motivierendes. Hoffnungsvolles.
Gleichzeitig sah ich in Johns Augen, sah die Hoffnungslosigkeit. Ließ meinen Blick über seinen Körper schweifen, sah die Wahrheit. In meinem Kopf manifestierte sich ein Weg mit Abzweigungen. Ich wusste nicht, welche ich von ihnen einschlagen sollte, um ihm zu helfen, um ihm Linderung oder Hoffnung zu verschaffen. Um ihm zu zeigen, dass ich für ihn da war. Alles, wirklich alles, kam mir im Moment wie eine Lüge vor. Ich wollte ihn nicht anlügen. Nicht John. Es wäre nur ein Versuch, sich an einem Strohhalm festzuhalten. Es ergab keinen Sinn.
Während in mir Chaos herrschte, drückte ich seine Hand fester.
„Lia, ich würd dich gern um was bitten“, begann er.
„Ja, natürlich. Was?“
Ein trockenes Lachen brach aus ihm heraus, was in einen schlimmen Husten überging. Ich streckte ihm ein Glas Wasser entgegen und er trank dankbar einen Schluck. Dann räusperte er sich. „Du solltest dir die Bitte erst anhören, bevor du zusagst.“
Ein Schmunzeln erschien auf seinen Lippen, doch die Fröhlichkeit erreichte nicht seine Augen. „Es geht um Jay. Ich habe Angst, dass er an meiner Krankheit zerbricht. Mich so zu sehen, meinen Tod mitzuerleben … Ich weiß nicht, was ich tun soll. In den letzten Tagen hat mich die Chemo alles gekostet. Ich konnte schon in letzter Zeit nicht für ihn da sein, ihm helfen. Und jetzt … Ich hatte gehofft, du könntest dich mit ihm treffen, mit ihm reden. Ihm die Tipps geben, die ich dir gab. Oder Jay erzählen, was dir geholfen hat.“
Unzählige Gedanken und Fragen tauchten in meinem Kopf auf, aber nur eine kam mir über die Lippen: „Du meinst, ausgerechnet ich kann ihm helfen?“
„Lia, du bist stärker, als du denkst.“ John lächelte abermals. Ein Funke Zuversicht schaffte es in seinen Blick, ehe er wie eine Sternschnuppe am Nachthimmel verglühte, als mein Kopf sich wie von selbst hin und her bewegte.
Er sah mich an, schien mit sich zu ringen.
„Jemand muss ihm helfen“, sagte er zögerlich.
„Aber wieso ich?“, platzte es aus mir heraus.
„Ich weiß, du bist hier nur für die Patienten da, um Besorgungen zu erledigen oder dich mit ihnen zu unterhalten. Und dass das, worum ich dich bitte, was völlig anderes ist. Doch während der letzten Wochen ist mir klar geworden, wie notwendig Hilfe für einen selbst ist. Wie notwendig sie für Jay sein wird. Ich kann ihm nicht mehr helfen, meine Familie ebenso wenig. Doch du kennst die Abgründe einer Depression. Du kannst das, was dir hilft, an ihn weitergeben.“
Wieso habe ich ihm von meiner Vergangenheit erzählt?
Es war eine einmalige Sache gewesen und das hatte ich jetzt davon, mich jemandem geöffnet zu haben. Es traf mich, dass er mich damit konfrontierte und Erwartungen an mich hegte.
Daher sprach ich aus, was sich als Warnmeldung in meinem Kopf manifestierte: „Du weißt, dass ich nicht mal ansatzweise mein eigenes Gleichgewicht erreicht habe, Johnny. Wie soll ich da jemandem helfen?“
„Lia, du bist die Einzige, die ich fragen kann. Jay würde nie einen Therapeuten oder eine der Selbsthilfegruppen für Krebsangehörige aufsuchen. Du hingegen gehst ganz offen mit der Schwere deiner Gefühle um. Du arbeitest, seit deine Mutter euch verlassen hat, daran. Ich glaube, dass du zu ihm durchdringen kannst.“
Johns verzweifelter Blick ließ mich schlucken. Seine Hand verkrampfte sich in meiner. Ich wollte ihm so gern seinen Wunsch erfüllen, aber ich konnte es nicht. „Es tut mir leid, Johnny, doch das, was du in mir zu sehen glaubst, ist nicht wahr. Ich bin nicht stark.“
John schüttelte den Kopf. „Wenn du dich mal durch meine Augen sehen könntest, Lia. Du bist so viel mehr, als du dir selbst zutraust. Allein, dass du hier diese Arbeit machst.“ Er seufzte. „Aber du hast recht, es ist eine dumme Idee, dir das aufzubürden. Ich glaube, ich habe jetzt doch Lust auf ‚The Hobbit‘.“
„Johnny, ich …“
„Nein, Lia. Ist okay. Würdest du bitte vorlesen? Wir müssen das Buch doch beenden! Zuletzt waren wir den Verliesen des Elfenkönigs entkommen, wenn ich mich nicht täusche.“
Die verwitterte Parkbank, auf der ich saß, ließ mich frösteln. Die Ruhe, die im Hyde Park herrschte, ließ mich meine Einsamkeit noch deutlicher spüren, als ich durch die eben erhaltene Nachricht sowieso schon empfand. Tolkiens ‚The Hobbit‘ lag schwer in meinen Händen. Es war das Einzige, was ich mir geschnappt hatte, ehe ich aus dem Krankenhaus geflüchtet war. Jetzt schlug ich das Buch auf, blätterte zu der Stelle, wo ich mit John aufgehört hatte.
Meine Finger verkrampften sich in den Seiten. Für eine Sekunde wollte ich das Buch am liebsten zerreißen, wollte jede einzelne Seite herausreißen und von mir schleudern. Doch meine Hände taten nicht das, was mein Herz verlangte.
Einen Moment später war ich froh darüber.
Stattdessen schlug ich das Buch zu und strich über den Einband. In meinem Kopf wiederholten sich der letzte Tag mit Johnny und seine Worte: Sodass sie mich mit einem Lächeln in Erinnerung behalten und nicht als diesen Schatten, der ich geworden bin.
Ich saß wie betäubt da, versuchte, seine Worte zu verarbeiten. Diesen Schatten. Ich war mit einem Schatten befreundet gewesen, nie mit einer Person. Dabei hatte er mir so geholfen.
Und das soll nicht er selbst gewesen sein?
Meine Gedanken drehten sich um den Satz. Zerrten an ihm. Zerhackten ihn. Bis ich zu einer Frage kam: Was bin ich? John war viel mehr als ich gewesen. Wenn er ein Schatten war: Was bin dann ich? Eine leere Hülle?
Meine Gedanken kreisten umher, fanden keinen Halt, sondern nur Bedauern. Er hatte die Operation nicht überlebt. Schon gestern hatte er es irgendwie geahnt. Meine Gedanken wanderten zu seiner letzten Bitte, zu seinem Bruder. Wie es Jay wohl geht?
Wenn er wirklich so war, wie Johnny erzählt hatte, musste es ihm dreckig gehen.
Prompt dachte ich an die Zeit vor London, in der ich Angst hatte, nach Hause zu gehen, und diese Ängste hatte betäuben wollen. Nur die Freundlichkeit eines Menschen und unsere gemeinsamen Interessen hatten mich davon abgehalten, einen anderen Weg einzuschlagen. Sian, damals mein bester Freund.
Trotzdem hatte ich mich schon vor London von ihm distanziert. Nur weil ich nicht wollte, dass er nach all den Jahren die Wahrheit erfuhr. Weil ich dachte, es wäre besser, alles allein durchzustehen. Seit John wusste ich, dass das nicht stimmte.
Manchmal braucht man einen Freund.
Meine Finger griffen nach meinem Smartphone und wählten routiniert Sians Nummer, als wären bisher nicht mehrere Monate und einige Katastrophen vergangen. Als würde nicht ein kilometerweiter Graben zwischen uns liegen, der uns bislang daran gehindert hatte, Kontakt zueinander aufzunehmen. Doch bevor ich auf den grünen Hörer tippte, hielt ich inne.
Wie soll ich erklären, warum ich in London lebe?
Ich schaute mich um, in der Hoffnung, ich könnte im Park das finden, was mir fehlte. Träge Sekunden vergingen, bis ich realisierte, wie dunkel es geworden war. Zudem regnete es. Bis eben war mir nicht einmal das aufgefallen. Aber es ließ mich mein Vorhaben vergessen. Stattdessen erhob ich mich von der Parkbank, um den Weg nach Hause einzuschlagen, und machte dabei einen Umweg zur Straße ‚Piccadilly‘. Ich brauchte die Betriebsamkeit und den Lärm Londons, die Ablenkung all der Eindrücke um mich herum.
Der Regen wurde stärker. Ich presste das Buch unter meinem Mantel an meine Brust und für einen Moment flutete mich eine Vertrautheit, als wäre Johnny bei mir. Mein Blick glitt über die Umgebung und blieb an einer Person auf der anderen Straßenseite hängen. Diese hatte die gleiche Größe wie John, den gleichen abgemagerten Körper, keine Haare. Mit erhobenem Kopf sah er zu mir, als würde der prasselnde Regen ihm nichts ausmachen. In mir verkrampfte sich etwas.
Bilde ich ihn mir ein? Ist er es?
Vielleicht belog ich mich selbst, aber für den Moment wollte ich, dass Johnny genau dort stand und zu mir sah. Dass unsere gemeinsame Zeit nicht vorbei war, sondern über den Tod hinaus existierte. Als würde er nur auf der anderen Straßenseite warten, damit ich das Buch hervorholte und wir unsere Reise zusammen beenden könnten.
Sein Anblick zog mich an. Ich lief weiter auf ihn zu, ging ihm entgegen. Den Blick nur auf ihn gerichtet.
Das Geräusch von quietschenden Reifen zerriss die Luft. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht sah ich mich um. Ein Auto. Adrenalin schoss durch meine Adern, doch es war zu spät für eine rettende Bewegung. Der Aufprall schleuderte mich nach hinten. Unsäglicher Krach erklang dabei. Mein blaues Haar wirbelte vor meinen Augen herum wie tanzendes Wasser.
Dann schlug ich hart auf dem Boden auf.
Schleppende Sekunden des Schocks vergingen, bis ich probierte, mich zu bewegen.
Da war kein Schmerz.
„Lia?“ Ich kannte die Stimme.
Irritiert wandte ich meinen Kopf und sah John über mich gebeugt. Er wirkte verschwommen, von einem dunklen Schleier umgeben, aber das Gesicht und die Stimme waren unverkennbar.
Seine Statur war noch ausgemergelter als zuvor. Wie der Tod auf zwei Beinen, schoss es mir durch den Kopf, während mein Blick über ihn glitt und überall Tattoos entdeckte, die bei unserer letzten Begegnung nicht da gewesen waren. Wieso hat er Tattoos?
„Bist du es wirklich?“, krächzte ich.
„Ja. Komm!“ Er streckte mir eine Hand entgegen und ich ergriff sie zögernd. Mit einem sanften Ruck zog er mich in die Senkrechte.
Verwirrt sah ich mich um. Es war ein komischer Anblick. Nicht lustig-komisch, sondern nicht-zu-glauben-komisch. Meine Umgebung sah aus, als hätte sich ein grauer Schleier über die Welt gelegt. Eine Art Nebel. Oder so, als hätte jemand ein Foto geschossen und es danach mit dem Weichzeichnungsfilter zu gut gemeint. Alles wirkte verschwommen. Ohne richtige Kontur.
„Lia?“
„Hm?“ Zu mehr war ich nicht fähig. Mein Blick glitt umher und ich erkannte das Auto von eben. Die Front war eingedrückt. Der Fahrer lag bewusstlos über dem ausgelösten Airbag. Ich versuchte zu begreifen, was vorgefallen war, während John Worte sagte, die ich nicht verstand. Er zeigte auf etwas zu meinen Füßen. Mein Blick folgte seiner Geste. Dort lag ich. Oder vielmehr mein Körper.
„Was ist das?“, keuchte ich.
Meine Beine zitterten. Ich war kurz davor zusammenzubrechen. Doch bevor ich fiel, hielten mich zwei Arme fest, deren Tattoos zu tanzen schienen.
„Das ist nicht von Dauer für dich, keine Sorge!“ Er schaute mich durchdringend an.
„Was meinst du damit? Bin ich tot?“
Er presste die Lippen aufeinander, widerlegte aber nicht meine Angst.
„Was ist das hier, Johnny? Was tust du hier?“
„Lia, weißt du noch, was ich dir wegen Jay sagte?“
„Ja, natürlich.“ Ich nickte.
Sein Gesicht hellte sich auf. Er drückte leicht meine Unterarme. Prompt schaute ich zu der Stelle, sah die Tattoos, die seine Haut verzierten. Zeilen aus Songtexten, Vinylplatten, Musiknoten, zwei Hände, die einander umfassten. Mein Blick wanderte umher und blieb bei einem Nudelteller mit zwei Kindersilhouetten auf seinem Schlüsselbein hängen.
Während mich die schwarze Tinte gefangen hielt, hörte ich dumpf Johns Stimme. Er wiederholte meinen Namen, rüttelte an meinem Körper. Irritiert sah ich zu ihm auf, konzentrierte mich auf seine Lippen, die permanent Worte herauspressten, bis sie endlich in mein Bewusstsein drangen: „Lia, wir haben keine Zeit. Hörst du? Du musst zu Jay. Sobald du aufwachst, geh zu unserem Pub in Camden. Du bist seine einzige Chance!“
„Johnny, wovon redest du?“
„Du wirst es sehen, Lia. Geh zum ‚The Grays‘! Finde ihn und rette ihn!“
Mein Blick glitt über seinen Oberarm. Ein geschwungenes ‚Memento mori‘ stand dort. Das gleiche Tattoo, das auch auf meiner Haut verewigt war.
Alles drehte sich. Benommen sah ich zu meinem bewusstlosen Körper am Boden, sah nochmals zu John, der mit diesen Tattoos vor mir stand. „Was geht hier vor? Wieso bist du hier?“, stammelte ich.
„Das ist die Schattenwelt, Lia. Du bist nicht tot, aber ich. Und ich möchte, dass du auf Jay aufpasst. Bitte! Er darf nicht sterben!“
„Wieso wird dein Bruder sterben?“
„Weil ich gestorben bin.“
Ich hatte nur in unseren Pub gewollt, um der Stille zu Hause zu entkommen. Dieser erdrückenden Leere, die mir meinen Verlust lauthals entgegengeschrien hatte. Die Rockmusik sollte meine Gedanken hinfort tragen, stattdessen saß ich hier und musste mir eine politische Anekdote nach der anderen anhören. Poetry Slam. Hipster, die humoristisches Geplänkel vortrugen, von dem die Zuhörerschaft sicher nur die Hälfte verstand. Ich fühlte mich fehl am Platz. Wie ein trostloser Fleck in einer fröhlichen Welt.
Meine Stirn sank auf den Tresen.
„Das Übliche, Jay?“
Ohne aufzusehen, streckte ich den Daumen nach oben und mit einem leisen Klong stellte Chris Minuten später einen Scotch mit Eiswürfeln vor mich hin. Ich umfasste das Glas, hoffte, etwas zu fühlen. Allerdings schien die Kälte in meiner Hand, lediglich die in meinem Inneren zu nähren.
Ich seufzte, hob träge meinen Kopf und nahm einen großen Schluck, während ich die Umgebung durch den Spiegel hinter den Spirituosenregalen beobachtete. Ein Stück hinter mir sah ich eine Person. Johnny?
Abrupt drehte ich mich um.
Natürlich bist du nicht hier! Die Erkenntnis der Wahrheit traf mich, zerriss mich. Erinnerungen folgten, die ich vergessen wollte. Allein der Pubgeruch riss die Wunden weiter auf. Chris an dem Platz zu sehen, wo Johnny oft gestanden hatte, machte mich rasend. Am liebsten wäre ich hinter die Theke gesprungen, hätte alles kurz und klein geschlagen. Hätte jede einzelne Flasche, jedes Glas durch den verdammten Raum geworfen, der mir ohne meinen Bruder so fremd vorkam. So falsch. Doch ich hatte nicht die Kraft dazu. Stattdessen stand mein Ausweg vor mir und hieß Scotch.