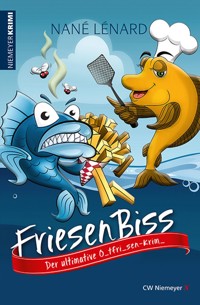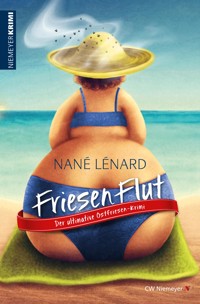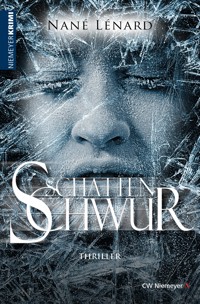7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Messer voll Blut. Ein Geist im Wasser. Aber: keine Leiche? Wat 'n Moordsspaaß, Neuharlingersiel … Bei Wikingerausgrabungen wird ein Meuchelwerkzeug entdeckt. Nichts Außergewöhnliches? Doch, denn die rostige Klinge steckte erst kürzlich in ihrem Opfer. Ob Mensch oder Tier kann nur Rechtsmediziner Enno klären. Aber diese besonderen Umstände rufen sofort die legendäre Oma Pusch auf den Plan. Sie weiß: Das Böse schläft nie! Es muss stets von Neuem überlistet werden. Und während sie längst mit ihrer Freundin Rita ermittelt, glaubt manch einer noch an Spuk, denn es gibt weder einen Toten, noch einen Vermissten. Ja, es ist diesmal tatsächlich zum Haare raufen … ... doch wer zuletzt lacht, lacht am besten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Alles darf nicht so ernst genommen werden!
Im Verlag CW Niemeyer sind bereits folgende Bücher der Autorin erschienen:SchattenHautSchattenWolfSchattenGiftSchattenTodSchattenGrabSchattenSchwurSchattenSuchtSchattenGierSchattenZornSchattenQualSchattenSchuldSchattenSchneeFriesenNerzFriesenGeistFriesenSpielFriesenLustFriesenSchmutzFriesenFlutKurzKrimis und andere SchattenSeiten
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2022 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8351-4
Nané LénardFriesenWitz
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Für Micha
Prolog
Es wütete heftig über Neuharlingersiel. Fast so, als hätten sich die uralten Götter verschworen, ihren Unmut über dem Ort auszugießen. Sintflutartige Regenfälle wurden vom Wind landeinwärts gepeitscht, und Thor sendete unbändigen Donner als Sahnehäubchen dazu. Ein schauriger Frühlingstag. Wie gemacht für jemanden, der etwas loswerden und dabei nicht gesehen werden wollte, denn wer ging bei so einem Schietwetter schon raus? Eine sichere Sache eigentlich. Für den Mörder konnte es also gar nicht schlimm genug sein da draußen.
Wieder zerriss ein Blitz den Morgenhimmel. Die dunkle, gebückte Gestalt hatte viel zu tun. Nicht nur die Leiche musste versteckt werden, sondern ebenso Tatwaffe und Tatort. Keine leichte Aufgabe, wenn man sich mit so etwas überhaupt nicht auskannte. Es sollte so aussehen, als sei rein gar nichts geschehen. Denn wenn nichts passiert war, würde auch niemand Fragen stellen oder gar nach etwas oder jemandem suchen.
Manchmal aber ereignen sich unvorhersehbare Dinge, die einen Stein ins Rollen bringen, der sich nie wieder anhalten lässt. Wenn also eine gewisse ältere Dame namens Oma Pusch von etwas Wind bekam, das an der Küste merkwürdig war, dann gnade dem Täter Gott. Ihr stieg nämlich der Geruch von Verbrechen und Mord derart stechend in die Nase, dass sie nicht aufgab, bis sie dessen Ursache ermittelt hatte.
Während also der eine mit der Vertuschung seiner Angelegenheiten beschäftigt war, sehnte sich unsere Hobbyermittlerin beim Blick auf die tosende Nordsee nach etwas Spannung in ihrem Leben. Direkt aus ihrem Küchenfenster über dem „Dattein“ konnte sie die Schaumkronen der peitschenden Wellen sehen. Da draußen war wesentlich mehr los als in ihrem einsamen Dasein. Sie vermisste das Schnacken mit den Menschen. Heute hätte der Tag sein sollen, an dem sie ihren Kiosk wieder aufschloss. Endlich, nach der langen Winterzeit, aber der Himmel hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie konnte sie ahnen, dass der es eigentlich gut mit ihr meinte und längst wieder einen Fall für sie bereithielt.
Schietwetter de luxe
Auch Hinnerk starrte aus dem Fenster seiner Dachgeschosswohnung in Richtung Deich und hätte heulen können, denn er hatte ein Problem.
Der alte, hinkende Fischer war unsterblich in die Witwe Lina Hansen verliebt. Nach dem Tod ihres Mannes Fiete, den man im Gewächshaus unter seinen eigenen Radieschen begraben hatte, lebte sie allein. Aber das war nun schon ein paar Jahre her.
Längst glaubte er, dass die Angebetete seine Zuneigung erwidern könnte. Und gerade heute hatte er sie auf seinem kleinen Motorboot mit nach Spiekeroog nehmen wollen. Dort draußen, wo er in seinem Element war, ja, mitten auf dem Meer, da wollte er sie zum ersten Mal küssen. Es musste ein besonderer Ort sein. Da war er sich sicher. Sonst würden seine Versuche, sie für sich zu gewinnen, niemals gelingen.
Gegen Mittag hörte zumindest der Regen auf, an eine Ausfahrt mit dem Boot war jedoch wegen des Sturms nicht zu denken. Eine Alternative musste her. Aber wie immer war Hinnerk vollkommen ratlos, wenn es um diese zwischenmenschlichen Dinge ging. Also rief er den einzigen Menschen an, dem er zutraute, ihm aus der Patsche zu helfen: Oma Pusch – denn sie wusste immer Rat – sei es bei Mord oder Problemen aller Art.
Charlotte, besser gesagt Lotti Esen alias Oma Pusch, war das Juwel der Küste. Ein ungeschliffener allerdings, denn sie hatte durchaus ihren eigenen Kopf und ganz gewiss Ecken und Kanten. Als Kioskbesitzerin, Tratschtante und Hobbyermittlerin in schweren Mordfällen war sie mittlerweile in ganz Ostfriesland bekannt. Bösewichte zitterten, wenn sie sich einschaltete. Ihr Neffe Eike Hintermoser von der Kripo auch, aber eher vor Wut, weil sie ihre Nase immer in seine Angelegenheiten steckte. Darum musste sie ihn gelegentlich mit einem ihrer berühmt-berüchtigten Rollmopsbrötchen besänftigen. Und die waren wirklich legendär. Manch einer machte allein deshalb Urlaub in Neuharlingersiel. Nur sie konnte sie auf diese leckere Art zubereiten, und zwar mit einem heimlichen Pfiff, indem sie einen Klacks Honig auf den Fisch spritzte. Doch davon später mehr. Jetzt war sie nur Helfer in der Not und hatte auch für den ollen Hinnerk den passenden Vorschlag parat. Sie riet ihm, doch mit seiner Lina zu der Ausgrabungsstätte in der Nähe der Werdumer Kirche zu fahren, wo Archäologen – warum auch immer – nach Wikingerschätzen gruben. So eine lütte Schnalle konnte doch nicht so ein Tamtam in Gang setzen, da war sich Oma Pusch sicher, aber für Hinnerk und Lina könnte es ein Abenteuer werden, wenn man die passende Geschichte darum herum erfand. Und Seemannsgarn spinnen, ja, das konnte der olle Döskopp wohl.
Hinnerk war sofort Feuer und Flamme gewesen. Wo er sich doch so hervorragend mit Strandgut auskannte, war das DIE Lösung. Immerhin sammelte er jeden Morgen alle leeren Pfandflaschen ein, die dort angespült wurden. Tja, und da fand er auch jede Menge anderen Kram. Manches davon hob er auf. Eine ganze Kiste voller Kuriositäten hatte er mittlerweile gehortet, aber das hieß ja nicht, dass man nicht auch wieder etwas davon im Sand vergraben könnte. Er würde eine Schatzsuche für Lina veranstalten. Bei der steifen Brise sollte sich dort auch keiner von diesen schlauen Leuten aufhalten, die da sonst herumgruben. Bestimmt war es verboten, dort direkt auf dem Terrain zu buddeln. Hinnerk beschloss also, es etwas abseits der abgesteckten Felder zu versuchen.
In eine Stofftasche gab er ein buntes, abgegrabschtes Pferdchen aus Holz, einen Metallbecher und einen Lederbeutel. Sogar die goldene Kette hielt er kurz in der Hand, ließ sie dann aber wieder in die Kiste gleiten. Alles zu seiner Zeit. Auf die Geste kam es an. Nachher wollte sie nichts von ihm und behielt nur die Kette. Was für eine Verschwendung! Als Alternative riss er den runden Nippel von seiner letzten Bratheringsdose ab. Den würde er für sie neben den anderen Kleinigkeiten in einem unbeobachteten Moment vergraben und ihr später als Freundschafts- oder sogar als Verlobungsring präsentieren. Etwas Besseres in Ringform hatte er leider nicht zur Hand. Seine Rente war schmal, und es ging wie gesagt um die Geste. Das war das Wichtigste.
Zwei Stunden später folgte ihm Lina neugierig auf das Ausgrabungsgelände, wobei das nicht so einfach war. Sie hatten sich da etwas Größeres, Pompöseres vorgestellt und standen ratlos auf dem Feld. Linas Kopftuchzipfel flatterte in der steifen Brise.
„Du, ich glaube, da hinten ist etwas“, rief Hinnerk seiner Angebeteten zu und hielt die Hand über die Augen, als sitze er im Ausguck eines Schiffes.
„Dann lass uns da mal hingehen“, schrie Lina gegen den Wind.
Als sie ankamen, dachte Hinnerk, es sei ein schlechter Witz. Ein Scherz von jemandem, der sich wichtigmachen wollte. Hier war nichts – außer einem Gestell aus Holz mit einer Plane oben drüber und an den Seiten. An einem der Pfosten hing das Bild zweier Metallstücke, die ebenso gut Krempel vom Strand hätten sein können. Wahrscheinlich hätte Hinnerk sie nicht mal eingesammelt, so unscheinbar waren die. Immerhin gab es auch eine notdürftige Holzbank, auf die sich Lina etwas ernüchtert setzte, bevor sie ihre Thermoskanne aus dem Beutel zog. Sie hatte Tee und Kuchen mitgebracht.
Diese Gelegenheit ergriff Hinnerk beim Schopf.
„Du, ich seh mich mal kurz um, Lina. Ist das in Ordnung?“, fragte er direkt in ihr Ohr. Er musste doch noch die Sachen verstecken.
Sie nickte. „Ich gieß schon mal ein.“ Sie war froh, dass sie nicht mitgehen musste. Über ihr knatterte die Plane im Takt der Böen.
Gemütlich war es hier nicht, dachte Hinnerk und starrte auf zwei mickrige Areale, die mit Schnüren abgegrenzt waren. Falls da jemand gebuddelt hatte, war längst wieder alles zugeweht. Er ließ die Felder links liegen, denn er musste jetzt dringend mit seinem Schatz punkten, sonst war alles dahin. So schnell er konnte, vergrub er die Kleinigkeiten aus seiner Tasche, ganz in der Nähe der Ausgrabungsquadranten, wo der Bauer schon gepflügt hatte. Dann kehrte er zu Lina zurück, die ein wenig schlotternd auf der Bank hockte und sich ihre Finger am Tee wärmte. Bevor er sich näherte, setzte er einen aufgeregten Blick auf.
„Lina, komm, ich glaub, ich hab da was Buntes aus dem Boden ragen sehen!“, sprudelte es aus ihm heraus.
„Bestimmt Plastik“, erwiderte Lina und winkte ab, „aber Hauptsache keine Leiche. Grab du man ruhig, ich bleib hier sitzen.“
Das war nun gar nicht in Hinnerks Sinn. Die Sache drohte nach hinten loszugehen.
„Du, nee, das will ich nur mit dir zusammen machen“, versuchte Hinnerk sein Glück. „Stell dir mal vor, da liegt was Wertvolles. Dann brauche ich jemanden, der bezeugen kann, dass ich das hier aus der Erde rausgeholt habe. Von wegen der Belohnung und so. Die teilen wir natürlich.“
Widerstrebend stand Lina auf. Sie wollte keine Spaßbremse sein. Wenn ihr Kumpel schon unbedingt Schatzsuche spielen musste, konnte sie ihn schlecht hängen lassen.
Hinnerk führte sie zu der Stelle, wo ein Bein des orangenen Pferdchens aus der Erde ragte. Dort drückte er ihr eine kleine Schaufel und einen Pinsel in die Hand.
„So macht man das“, erklärte er. „Habe ich im Fernsehen gesehen. Vorsichtig buddeln und fegen.“
„Ist doch alles nass, wie soll ich da fegen? Ich kann auch erst mal dran ziehen“, schlug Lina vor und ergriff das Bein. Zack, hielt sie ein mit sandiger Erde verschmutztes Holztier in der Hand und staunte nicht schlecht. „Hinnerk, guck mal! Ist das wohl ein Spielzeug?“
Fachmännisch nahm der alte Fischer das Stück in die Hand und besah es sich von allen Seiten. „Mensch, du, das könnte das Pferd eines Wikingerkindes gewesen sein“, antwortete er ergriffen. „Wer weiß, was hier noch liegt?“
„Soll ich weiterbuddeln?“, erkundigte sie sich, ganz aus dem Häuschen.
„Auf jeden Fall, du scheinst ein Händchen für die Archäologie zu haben“, bewunderte Hinnerk sie.
Kurze Zeit später lagen Metallbecher und Lederbeutel vor der aufgeregten Lina, die alles um sich herum vergessen hatte: Kälte, Sturm und beinahe auch Hinnerk.
„Wir sind reich“, freute sie sich. „Wir haben den Wikingerschatz gefunden, glaube mir. Ich weiß es!“
„Ein Teil fehlt aber noch“, beteuerte Fischer Hinnerk und korrigierte sich sofort bei Lina Hansens argwöhnischem Blick. Mist, fast hätte er sich verraten. „Ich meine, was wäre ein Wikinger ohne Axt oder Schwert? Nur das würde doch beweisen, dass wir richtigliegen.“ Er hoffte so sehr, dass sie endlich das Ringlein von der Blechdose finden würde, damit er sich offenbaren konnte.
Lina tat, wie ihr geheißen, und grub. Mit einem Mal förderte sie zu Hinnerks Verwunderung ein feucht-fleckiges Tuch zutage, in dem etwas Längliches zu stecken schien.
„Ich hab das Schwert, glaube ich“, rief sie erfreut und wunderte sich, dass der Stoff so gut erhalten war, wenn auch ein wenig rostig eingefärbt. Und noch bevor Hinnerk sein „Dat lass mi maal maken!“ über die Lippen bringen konnte, hatte sie den Gegenstand schon ausgewickelt und war bei dessen Anblick in Ohnmacht gefallen.
Vor den Augen des alten Fischers lag also nicht nur Lina, sondern auch ein langes, mit Blut beschmiertes Messer, das mit Sicherheit noch nicht allzu lange unter der Erde war.
Im Dilemma
Und da saß er nun, der Senior auf Freiersfüßen. Er hielt zwar seine Holde im Arm, aber eben nicht auf die Weise, die er sich vorgestellt hatte. Noch während er mit der freien Hand Oma Pusch anrief und an Linas Haar schnupperte, schlug sie zum Glück schon wieder die Augen auf. Schnell versteckte er den Dolch hinterrücks in seinem Hosenbund und quiekte beim Aufstehen, weil ihn die Spitze in den Allerwertesten pikste. Wäre das Tuch nicht noch drum rum gewesen, steckte er jetzt vielleicht im Fleisch. Er musste vorsichtig vorgehen. Sonst schnitt er sich noch was ab.
„Moin, Hinnerk“, meldete sich Oma Pusch. Er hörte sie anzüglich kichern. „Ist dir dein Fischlein ins Netz gegangen?“
„Ähm, äh“, stotterte er. „Wie man’s nimmt.“ Er war im Dilemma. Jetzt, wo Lina wieder wach war, konnte er weder über sie selbst noch über den blutigen Dolch sprechen.
Oma Pusch stutzte. „Seid ihr gar nicht an der Ausgrabungsstätte?“
„Doch, doch“, erwiderte er.
„Ick hebb de Schatt funnen!“, krähte Lina stolz dazwischen. „Wi sünd riek!“
„Echt?“, fragte Oma Pusch erstaunt. „Das ist ja krass.“
„Erzähle ich dir später“, lenkte Hinnerk ab. „Ich muss erst Lina nach Hause bringen. Sie ist ohnmächtig geworden und liegt auf dem nassen Boden. Nicht dass sie sich erkältet.“
„Okay“, sagte Oma Pusch verwundert. Hinnerk fand alle naselang so manches, aber noch nie hatte er sie deswegen angerufen. Entweder war von ihm tatsächlich etwas Spektakuläres aus der Wikingerzeit entdeckt worden oder es befanden sich ein paar Knochen jüngeren Datums unter seinen Fundstücken. Trotzdem blieb es schleierhaft, wieso er nicht mit der Sprache rausgerückt war. Sie musste abwarten. Das war nicht ihre leichteste Übung. Vor allem nicht an so einem Tag wie diesem. Ihr war langweilig. Notgedrungen hatte sie mit ihrer Freundin Rita vereinbart, den Kiosk am Hafen heute nicht zu öffnen. Bei diesem Sturm und den kalten Duschen zwischendurch blieben die Leute lieber zu Hause und genossen ihren Tee in der eigenen guten Stube. So ein Schietweer, wie man auf Platt sagte, konnte echt niemand gebrauchen.
Gedankenverloren starrte Oma Pusch aus dem Küchenfester auf die tobende Nordsee und wurde von einem lauten Schrei fast zu Tode erschreckt.
„Saftladen!“, schimpfte es auf sächsisch. „Isch wärr misch beschwären! Nu sitz isch schon e halbe Stunde mit den Wickeln aufm Kopp rum!“
Wider Willen musste Oma Pusch lachen. Es war Ronny, ihr haarloser Papagei, der dort auf dem Käfig krähte und dem augenscheinlich auch langweilig war. Er hatte seinerzeit wohl zu lange im Frisiersalon ihrer Cousine Miezi gesessen und einiges aufgeschnappt. Die Vorstellung von Lockenwicklern auf seinem Kopf war schräg, vor allem weil ihm aufgrund einer Stoffwechselerkrankung bis auf ein paar Flusen kein Federkleid gewachsen war, was ihn jedoch selbst nicht störte. Im Gegenteil. Er genoss die Freiheit des fehlenden Gefieders und pflegte seine makellose Haut mit dem Schnabel. Jäckchen jeder Art, die ihm jemand aus Mitleid gestrickt, genäht oder gehäkelt hatte, waren von ihm gnadenlos in alle Einzelteile zerlegt worden. Ronny liebte wie viele andere aus der ehemaligen DDR die Freikörperkultur. Es gab kaum so glückliche Graupapageien wie ihn, den gebürtigen Sachsen, erst recht seitdem er sein Dasein bei Oma Pusch verbringen durfte, die ihn eigentlich nur wegen Miezis Umzug nach Bensersiel beherbergt hatte. Aber da war er eben irgendwie bei ihr hängen geblieben.
„Na, willst du etwa eine Knabberstange, mein Lieber?“, fragte Oma Pusch. Unter den neugierigen Blicken des Piepmatzes holte sie eine für ihn aus der Schublade, was Ronny mit lautem Juchzen und Pfeifen kommentierte. Voller Freude wippte er auf dem Käfigdach und gab ihr ein Küsschen auf die Nase. Dann kletterte er ins Innere, nachdem sie den Leckerbissen dort mit einem Draht festgebunden hatte.
Der ist erst mal beschäftigt, dachte Oma Pusch und sah seufzend an sich herab. Sie hätte vielleicht auch gerne ein Rollmopsbrötchen oder ein Stück Käsekuchen gegessen. Nicht dass sie dick war, aber sie war eben auch kein Hungerhaken. Man konnte sie vielleicht als vollschlank bezeichnen, was mit schlank leider auch nicht wirklich etwas zu tun hatte. Es war ein ständiger Kampf mit der Waage, den sie zeitlebens schon ausgefochten hatte, nur eben mit wechselndem Kampfgewicht. Ihre Freundin Rita hatte einmal zu ihr gesagt, dass man sich irgendwann im Leben als Frau entscheiden müsse: Kuh oder Ziege! Na ja, sie war auf keinen Fall eine Ziege geworden. Warum eigentlich kein Schaf? Zum Beispiel eins mit wechselwolligem Haarkleid. Das konnte man bei Bedarf schlank scheren. Sie grinste, weil sie überlegen musste, ob Rita vielleicht eins war. Blöken konnte sie auf jeden Fall.
Unerwarteter Besuch
Es donnerte. Das war das einzig Aufregende an diesem schrecklich langweiligen Tag. Nicht einmal Hinnerk hatte eine Leiche gefunden, seufzte sie, sonst hätte er es doch gesagt. Na ja, und Linas Gefasel von dem Schatz nahm sie sowieso nicht ernst. Es war ja ihre Idee gewesen, dass der liebeskranke Fischer etwas für Lina verstecken sollte.
Als es plötzlich an ihrer Wohnungstür Sturm klingelte, war es für Oma Pusch wie eine Erlösung.
„Ruhe!“, kreischte Ronny, der sich bei seinem Gaumenschmaus gestört fühlte. „Isch wärr gleisch aus der Haut fahr’n!“
Lieber nicht, dachte Oma Pusch, während sie zur Tür ging und durch den Spion blinzelte, den ihr Enno hatte sicherheitshalber einbauen lassen. Dann hätte der arme Vogel gar nichts mehr an.
Sie öffnete.
Vor ihr stand Hinnerk, verschwitzt, völlig außer Atem und total von der Rolle. In seiner Hand hielt er eine Tüte, und genau die streckte er als Erstes durch die Tür.
„Da, nimm!“, keuchte er. „Ich will damit nichts zu tun haben.“
„Was ist denn das um alles in der Welt?“, fragte Oma Pusch erstaunt und nahm die Henkel mit spitzen Fingern. Wer konnte schon ahnen, was der spinnerte Kerl so alles mit sich herumtrug.
„Ist von der Ausgrabungsstelle“, sprach er weiter. „Also von dicht darbi, du versteihst?“
„Aber nix von den Plünnen, die du da für Lina verbuddelt hast?“, hakte sie nach.
Hinnerk schüttelte den Kopf.
„Wat isses denn?“ Noch immer hielt sie die Tasche ein Stück von sich weg. Schließlich hatten hier im vergangenen Jahr Leichenteile an der Küste rumgelegen. Wer wollte so etwas schon in der eigenen Wohnung haben.
Der alte Fischer sah sich um, obwohl niemand da war. „En Knief“, flüsterte er vor Aufregung auf Platt, „lang und scharp, mit Blood dran.“
„Komm erst mal rein“, sagte Oma Pusch und zog ihn ins Innere. Dann schnupperte sie an ihm, aber er roch nicht nach Alkohol. „Ist vielleicht auch alt“, vermutete sie.
Hinnerk schüttelte vehement den Kopf.
„Oder vom Schlachten“, fuhr sie fort.
Doch Hinnerk tippte sich an die Stirn. „Wieso sollte das dann jemand vergraben?“
Oma Pusch musste ihm recht geben. Das war wirklich merkwürdig.
„Warte“, sagte sie und ging in die Küche. Mit einer alten Zeitung kehrte sie zurück. Die breitete sie auf dem Wohnzimmertisch aus. Dann holte sie das feucht-blutige Stück Stoff aus dem Beutel und wickelte den harten Inhalt aus. Es war tatsächlich ein langes, fleckiges Messer. Der Griff schien aus Holz zu sein, beim Metall tippten sie auf Eisen, denn es waren rostige Stellen daran. Man konnte erkennen, dass das Messer oft benutzt worden war, weil die Klinge schon dünn geschliffen war. Sie ging in einem Stück durch den gesamten Griff. Das Holz, glatt und speckig vom jahrelangen Gebrauch, umhüllte sie nur. Wären die Verfärbungen im Stofftuch nur durch das rostige Eisen gekommen, hätten sie geringer und vor allem gleichfarbig ausfallen müssen, überlegte Oma Pusch, während sie mit Hinnerk auf das vermeintliche Corpus Delicti starrte. Außerdem waren da durchaus noch schwärzliche Krusten auf der Klinge, die die Vermutung nahelegten, Reste alten Blutes zu sein.
„Was machen wir damit?“, fragte Hinnerk unglücklich. Dass auch gerade immer er in solche Situationen geriet.
„Sag mir erst mal, wie es Lina geht“, bestimmte Oma Pusch, die etwas Zeit zum Nachdenken brauchte.
„Die liegt zu Hause auf dem Sofa“, erklärte Hinnerk. „Das Messer hat sie längst vergessen. Ich habe ihr einen Eierlikör eingeschenkt. Wahrscheinlich betrachtet sie ihre Wikingerschätze. Denkst du, der Dolch da könnte eine Mordwaffe sein?“
„Ich denke an nichts anderes“, gab Oma Pusch zu, „aber es ist natürlich Wunschdenken. Hier ist ja momentan echt nichts los. Bei diesen andauernden Tiefs mit kühlem Schietwedder kommen auch keine Touris hier hoch an die Küste. Meine Rollmöpse schwimmen bald ins Meer zurück, wenn ich keine Brötchen mehr verkaufen kann.“
„Soll ich das Dingens einfach wieder vergraben und Schwamm drüber?“, schlug Hinnerk vor.
„Bist du verrückt!“, rief Oma Pusch. „Wir müssen unbedingt wissen, ob das da Menschenblut ist. Wenn nämlich ja, dann könnte es sein, dass das Messer in wem gesteckt hat, der …“
„Oder es hat sich schlichtweg wer geschnitten“, wandte Hinnerk ein. „Muss ja nicht alles immer gleich mit Mord zu tun haben.“
„Stimmt, auch über diesen unwahrscheinlichen Fall muss man nachdenken, wenn man gründlich ist“, gab Oma Pusch zu. „Aber: Kiek mol! Das Blut da, diese Kruste ist ganz oben am Schaft. Schneidet man sich da? Oder steckte es etwa ganz tief wo drin?“
„Vielleicht in einem Schwein“, überlegte Hinnerk.
Oma Pusch grinste. „Eben, dann wissen wir immer noch nicht, ob Mensch oder Tier.“
Hinnerk stutzte kurz, begriff dann aber, was sie gemeint hatte, und klopfte ihr auf die Schulter.
„Weißt du was, Lotti. Ich schenk ihn dir. Mach damit, was du willst, aber erwähn meinen Namen nicht. Haste ihn eben selbst ausgebuddelt in deiner Neugier. Und wenn das nur ein Schlachtemesser ist, dann kiek mol, ob de das wieder flottkriegst. Liegt gut in der Hand, finde ich. So, und nun will ich schnell wieder abzwitschern. Ich frier nämlich wie ein alter Seebär im Polarmeer.“
Oma Pusch nickte und war mit ihren Gedanken längst ganz woanders, als sie Hinnerk zur Tür brachte.
Ein nicht alltägliches Hobby
Gundula Kiesel-von Hohlenkaff, in manchen Kreisen auch Gunda Garstig genannt, vereinte zwei Seelen in ihrer Brust. In der einen arbeitstechnischen beim Bauamt genehmigte sie gerne frivol große Klötze auf manchmal noch unberührtem Terrain, doch hobbytechnisch musste sie deren Bau gelegentlich stoppen und auf Eis legen, weil sie altes Kulturgut ausgegraben hatte. Gunda Garstig war Hobbyarchäologin und das mit Leib und Seele. Warum? Sie hatte weiter nichts. Wasserballspielen ging wegen kaputter Knie nicht mehr. Der Sohn war längst ausgezogen, den Ehemann hatte sie Hals über Kopf vor Jahrzehnten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen, und der Lebensgefährte, für den sie dies getan hatte, war ihrer endgültig überdrüssig geworden. Nicht mal das Mitleid hatte Karli bewogen, bei der Endfünfzigerin zu bleiben. Er wollte sich schließlich nicht auch noch das Alter von ihr versauen lassen. Okay, zugegeben, er war ein bisschen spät aufgewacht und hatte plötzlich bemerkt, dass sie tatsächlich nur an sich dachte. Grund des Weckrufs war zugegebenerweise Irmi aus Süderbrarup gewesen, in die er sich holterdiepolter verliebt hatte und die alles für ihn tat, was ihn zunächst verwirrte. So etwas kannte er gar nicht. Kurzum: Er versetzte Gunda einen Fußtritt, durch den sie in einer kleinen Wohnung bei Husum landete. Die allerdings konnte sie vom Gehalt ihrer Halbtagsbeschäftigung kaum bezahlen, weswegen sie sich im Internet einen alten Sack mit Kohle suchte, der sie gelegentlich aushielt. Doch der Senior war lebenserfahren und darüber hinaus nicht auf den Kopf gefallen. Eine Win-win-Situation hätte er sich noch vorstellen können, aber Gunda Garstig war eben garstig, unbequem und egoistisch und damit keinesfalls das anschmiegsame Kuschelkätzchen, dass sich ein älterer Herr mit großzügiger Brieftasche für seinen Lebensabend erhofft hatte.
Also ackerte Gunda. Halbtags im Bauamt, den Rest der Zeit auf dem Acker. Die Schnellste war sie allerdings nie gewesen.
Und natürlich hatte das Heimweh sie schon längst nicht mehr in Husum gehalten. Sie wollte zurück zu ihren Wurzeln. Gemäß ihres früher erklärten Lebenswunsches, immer den Werdumer Kirchturm von ihrer Wohnstätte aus sehen zu können, hatte sie sich vorübergehend auf einem Hof in Nordwerdum eingemietet. Ein Zimmer unter dem Dach mit Blick nach Süden. Dort wartete sie. Sie wartete auf bessere Zeiten, und zwar genau auf den Moment, in dem ihr Sohn nebst Anhang endlich dort auszog, wo sie eigentlich hingehörte. Er blockierte die Wohnung im Haus ihrer Mutter, die ihr zustand.
Man konnte also sagen, dass Gunda Garstigs Lebensentwurf nicht aufgegangen war. Hätte er es gewusst, hätte sich der Ex-Ehemann eins gekichert, vor allem wenn er erfahren hätte, dass sie nun online mithilfe ihrer Schwestern nach eben so einem Partner suchte wie ihm. Ihm, den von ihr Geschiedenen, den sie damals herzlos zurückgelassen hatte und der plötzlich allein geblieben war, ohne Frau, ohne Kind, ohne Auto und bald darauf auch schon ohne Haus. Hier hätte sich der Kreis für den armen Cornelius schließen können. Er hätte der so schmählich Gestrandeten, wieder nach Ostfriesland Zurückgespülten vielleicht verzeihen können – wie gesagt, wenn er es denn gewusst hätte …
Wie meist, wenn in ihrem Leben etwas nicht rund lief, war Gunda schlecht gelaunt. Heute war es die Erkenntnis, dass sich der Hausbau ihres Sohnes doch länger hinziehen würde als geplant. Darüber grummelte sie schon den ganzen Tag. Eine lapidare SMS hatte er ihr als Antwort auf ihre drängende Frage geschrieben. Wird wohl doch erst im Juni was, hatte sie auf ihrem Smartphone gelesen. Kein Wort zu viel, kein Bedauern, keine Entschuldigung, fauchte sie innerlich. Dieses Warten lähmte sie. Missmutig starrte sie auf ihren Bildschirm im Bauamt und hoffte, dass die Arbeitsstunden schnell vorbeigingen. Den Kopf hatte sie heute sowieso nicht frei. Schon gar nicht für diese beschissenen Bauanträge, die sie bearbeiten musste.
Gegen halb eins packte sie ihre Sachen. Gummistiefel hatte sie bereits im Auto, ebenso ihre Ausrüstung. Sie brauchte dringend frische Luft. Luft in Werdum, Luft zum Atmen, ja, zum Aufatmen. Gunda hoffte, dass ihr notdürftig errichteter Unterstand nicht durch den Sturm weggeweht war. Das Buddeln in der Erde würde ihr gut tun. Immer schon war die Archäologie neben dem Wasserball ihre große Leidenschaft gewesen. Darum hatte sie den Acker in der Nähe der Mühle gepachtet. Hier konnte sie ihrem Hobby ganz ungestört nachgehen – und sie konnte den Werdumer Kirchturm sehen.
Aber was war das? Der ganze Boden neben ihrem Grabungsareal war aufgewühlt worden. Es sah fast so aus, als sei dort eine Horde Wildschweine auf Nahrungssuche gewesen. Doch wo sollten die hergekommen sein? Sie musste bei der Gemeinde anrufen. Diese Viecher konnten alles zunichtegemacht haben. Mist, dieser Tag war sowieso schon so scheiße verlaufen, und jetzt auch noch das! Hier musste jetzt dringend ein Stromzaun her. Aber wenn dann das Amt für Denkmalpflege etwas hiervon mitbekam, würden sie vielleicht überhaupt keine wissenschaftlichen Ausgrabungen mehr vornehmen. Was für eine Katastrophe. Besser, sie hielt erst mal die Klappe und sagte nichts zu irgendwem. Es ging um Schadensbegrenzung. Aus ihrem Wagen holte sie ihre Gartenwerkzeuge. Mit einem Rechen glättete sie die aufgeworfene Erde, dann fuhr sie zum Friedhof, holte zwei Kannen Wasser und goss das Sandgemisch des Bodens wieder glatt. Der Wind würde den Rest erledigen. Es sah fast so aus, als sei nie etwas geschehen. Zufrieden ließ sie ihren Blick über das gesamte Areal wandern und ahnte nicht, dass sie beobachtet worden war.
Enno muss her
Wenn es in rechtsmedizinischen Dingen etwas zu klären oder herauszufinden gab, dann war Doktor Enno Esen der richtige Ansprechpartner. Seinen Beruf als Modearzt für Schickimicki-Klunker-Damen, die an der Küste Urlaub machten und seine Dienste auch anderweitig in Anspruch nehmen wollten, hatte er an den Nagel gehängt. Allerdings nur dem Anschein nach freiwillig, denn ihm war schmerzvoll bewusst geworden, dass sein Körper das junge Gemüse nicht mehr anzog. Nur noch die alten, zu bunten, meist hohlen Schachteln wollten sich gerne von ihm auspacken lassen, aber da streikte er. Damit konnte er doch nicht seinen Tag verbringen. Ihn dürstete es nach einem intelligenten Austausch, wenn er schon in Bezug auf das Körperliche hinter seinen damaligen Möglichkeiten zurückbleiben musste.
Welkes, aufgespritztes oder gestrafftes Fleisch lag heutzutage bestenfalls noch schlaff vor ihm, denn er war inzwischen als Rechtsmediziner in Esens tätig. Der große Vorteil der Dahingeschiedenen war, dass sie nicht mehr sprachen und ihn also weder mit ihrem Schwachsinn volllabern noch dumme Fragen stellen konnten. Denn eins hatte er in den Jahren gelernt: Je bunter, schriller und klotziger der Auftritt, desto kleiner das Hirn.
Bei ihm waren sie nun alle gleich, ganz egal, wie viel sie an ihrem Körper herummanipuliert hatten. Sie waren tot und würden vergehen. Doch bevor das geschah, konnte ihm so mancher noch eine interessante Geschichte erzählten. Lautlos sozusagen. Ein Geheimnis, das er ihnen erst entlocken musste. Das war die Art von Zwiegespräch, die ihm schmeckte und sein Dasein bereicherte, umso mehr wenn er die Erkenntnisse mit einer besonderen Dame teilen konnte. Ja, seine Lotti war wirklich eine Dame. Sie war natürlich in Haut und Haar geblieben, hatte Grips und wusste, was sie wollte. Dass sie ihn für sich wollte, hätte er am liebsten gehabt, aber so ganz hatte sie ihn noch nicht erhört. Er konnte wohl behaupten, dass es da eine gewisse beidseitige Sympathie gab, war sich aber manchmal nicht sicher, ob die von ihrer Seite aus eher beruflicher oder privater Natur war. Lotti Esen, auch Oma Pusch genannt, war nämlich ein Ass in allen Bereichen der unkonventionellen Mördersuche und darum immer vor allem dann an ihm interessiert, wenn er eine rätselhafte Leiche hatte. Leider konnte er ihr derzeit nicht damit dienen und fühlte daher eine schmerzliche Sehnsucht nach „seiner“ Lotti. Gelegentlich linderte er die mit einem Rollmopsbrötchen an ihrem Kiosk, jedes Mal in der Hoffnung, dass sie auf seine Abendeinladungen einging oder ihn selbst zu sich bat. Doch ohne Leiche schien bei ihr nichts zu laufen.
Desto mehr freute er sich, als er ihre Rufnummer auf dem Handydisplay sah.
Chaos hoch drei
Ganz andere Probleme hatte Heino Sievers. Er wusste nie, wo ihm der Kopf stand, denn er hatte gleichzeitig von allem zu viel und zu wenig. Bauernhaus und Grundstück waren pflegetechnisch kaum zu bewältigen, aber fast schon zu klein für die vielen Menschen und Tiere, die darin wohnten. Sein Halbtagsjob in der Krankenhausverwaltung war anstrengend, warf aber nicht genug ab. Das galt in gewisser Weise auch für seine Frau Ava, wenn man es genau nahm. Sie raubte ihm mit ihrer Präsenz alle Kraft und forderte ständig seine Aufmerksamkeit. Darüber hinaus machte sie viel Dreck, war unordentlich und hatte zwei Gesichter. An guten Tagen war sie eine unterhaltsame, anschmiegsame Partnerin, an schlechten litt er unter ihren Beleidigungen und der Distanz, die plötzlich herrschte. Warum er trotzdem bei ihr blieb? So richtig wusste er es selbst nicht. Es musste wohl Liebe sein, entgegen aller Vernunft. Eine toxische Beziehung mit einem sogenannten Energievampir. Darüber hinaus war es auch die Angst, erneut zu versagen.
Heino hatte eine steile Frauenkarriere hinter sich. Auf die grundsolide, aber emotionsarme Manuela, mit der er den inzwischen erwachsenen Sohn Piet hatte, war Hanna gefolgt. Kitesurferin, Extremsportlerin und vor allem Quasselstrippe, der es eher gefiel, unter ihresgleichen bei einem Wein zu hocken als zu Hause. Auf dem Wasser mit ihren Weibern oder im Clubhaus am Strand, da war es schöner. Er war ihr zunehmend egal geworden. Das war kein schönes Gefühl. Heino suchte eigentlich nur Liebe und Nähe. Bei Manu und Hanna war er aus unterschiedlichen Gründen in der Beziehung „verhungert“. Während ihn die erste Partnerin kaum berührte und umarmte, war die nächste noch nicht einmal im Alltag für ihn da, sondern lieber auf den Wellen bei ihren Surferfreunden. Auch die Geburt der gemeinsamen Tochter änderte nichts. Sie lud die Kleine einfach bei ihm ab und ging nach wie vor ihren Hobbys nach. Resigniert kehrte Heino irgendwann nach der Trennung von Hanna mit Piet und Jule von Sylt nach Dunum zurück, wo er von Onkel und Tante ein altes Fischerhaus zur Verfügung gestellt bekam. Es gehörte zum allgemeinen Erbe der Großfamilie Peters und stand seit Jahren ungenutzt auf einem der Grundstücke am Isweg. Heino, der ein geborener Peters war, sollte endlich zur Ruhe kommen. Aufatmen in der Heimat sozusagen. So zumindest hatte es sich die Sippe vorgestellt. Doch der Teufel hatte es anders gewollt.
Vom Teufel wusste die alte Marga eine ganze Menge. Sie war weit in den Neunzigern, aber noch reichlich plietsch in der Birne, wie sie selbst fand. Ein Umstand, den sie jedoch nicht immer durchblicken ließ. Wenn es geschickter war, stellte sie sich ein bisschen plemplem oder tat, als sei sie dement. So erreichte sie stets, was sie wollte. Dass die ganzen lüttjen Lüü den Teufel unterschätzten, darin war sich Marga sicher. Die heutigen Menschen waren so naiv, wenn es um das Böse ging. Also hatte sie es sich auf die Fahne geschrieben, den Düvel, soweit es ihr möglich war, im Auge zu behalten, wo immer er sich zeigte. Als sie von Heinos Rückkehr nach Dunum hörte, seufzte sie tief und schüttelte den Kopf. De Jung war längst im Visier des Leibhaftigen. Eine wehrlose Seele, die er regelmäßig aussaugte wie eine Zecke, aber noch am Leben ließ, weil sie sich immer wieder aufrappelte. Und wenn Heino dachte, dass es nun bergauf gehe, dass er Liebe gefunden habe, biss sich der Teufel wieder fest und sog alles Glück aus ihm heraus.
Zurück in Dunum geriet Heino also während der Umbauarbeiten am alten Fiskerhuus in die Fänge von Restauratorin Freda. Die Mittvierzigerin war zwar weder schlank noch überaus gut aussehend, aber sie war ein energiegeladener Vamp und floss wie Balsam in Heinos ausgetrocknete Seele. Allerdings nur für geraume Zeit. Dann machte sie sich rar und verbrachte ihre Feierabende lieber mit Schwarzarbeit in alten Gemäuern. So sagte sie zumindest. Das Salär, von was oder wem auch immer, steckte sie sich in die eigene Tasche. Auch dann noch, als sie längst gemeinsam mit Heino im Isweg wohnte. Die Hoffnung, ein gemeinsames Kind könnte Freda etwas stärker an ihn und ihr schönes Zuhause binden, bestätigte sich in den Folgejahren nicht, denn Freda wurde niemals schwanger, weil sie heimlich verhütete. Irgendwann roch Heino den Braten, konfrontierte sie mit seinem Verdacht und erkannte, dass sie ihn längst an der Nase herumführte. Das war das Ende gewesen.
Während der Teufel seinen Griff also kurzfristig lockerte, atmete die Familie Peters auf. Eine weitere Mesalliance war überstanden. Man fragte sich nur, wen er als Nächste an seiner Seite präsentieren würde, wobei man jedoch sicher war: schlimmer konnte es nicht kommen.
Marga hätte es besser gewusst, denn der Teufel tarnte sich immer. Zugegebenerweise war es bei Ava nicht gleich ersichtlich gewesen. Aber man musste es wohl doch als gewagt bezeichnen, dass Heino sie so schnell nach der Sendung „Bauer sucht Frau“ heiratete. Da war die Katze nämlich noch nicht aus dem Sack, wie man so schön sagt.
Für Heino war die Situation mittlerweile brisant geworden, denn nach und nach hatte er bemerkt, dass Ava nicht so war, wie er sie sich erhofft hatte. Auf gute Phasen im Ehealltag folgten katastrophale. Er konnte kaum glauben, dass er es mit demselben Menschen zu tun hatte.
Der Teufel forderte ihn sozusagen wieder zum Tanz auf, aber diesmal hatte er sich geschworen, nicht aufzugeben, nicht wieder zu scheitern. Also musste er sich auf den Reigen einlassen. Doch wie heißt es in dem Lied von Dreiviertelblut: „Wannst du mim Deife danzt, dann brachst guate Schua!“ Und Heino hatte Stiefel mit Sporen …
Das Artefakt
„Moin, Ennolein“, war das Erste, was Oma Pusch in den Hörer flötete. „Wie geht es dir?“
Auf der anderen Seite der Leitung grinste der Rechtsmediziner. Wenn sie so anfing, dann wollte sie was von ihm. Das war eine gute Voraussetzung, denn er befand sich definitiv in der besseren Position, wenn sie ihm was schuldig war.
„Och, mir geht es hervorragend“, sagte er scheinbar gelangweilt, „aber es wundert mich, dass dich das interessiert. Ich habe seit Wochen nichts mehr von dir gehört.“
Fieberhaft überlegte sie, was sie als triftigen Grund angeben könnte. In der Eile fiel ihr nur Mist ein.
„Nicht böse sein, Ennolein, Rita hatte eine depressive Phase, weil das Wetter so schlecht war und der Frühling einfach nicht kommen wollte. Selbst heute stürmt es noch. Guck mal raus. Da kann einem das Lachen schon vergehen.“
Enno grinste. Sie konnte ihn zum Glück nicht sehen. „Ach, da werde ich mal in meinen Medizinschrank gucken. Ich habe bestimmt noch was Aufmunterndes, was ich ihr geben kann. So einen kleinen Stimmungsaufheller aus Johanniskraut. Ist auch rein pflanzlich. Den bringe ich ihr mal vorbei.“
„Ach nee, du, lass mal!“, versuchte Oma Pusch sich herauszuwinden. „Das wäre ihr bestimmt peinlich. Aber wo wir gerade so schön schnacken: Ich hätte da was für dich. Also, denke ich zumindest. Könnte interessant sein.“
„Du sprichst in Rätseln. Schweinebraten?“
„Nee.“
„Leichenteile?“
„Quatsch!“, erwiderte sie. „Hatten wir erst letztes Jahr.“
„Du willst mit mir essen gehen?“
„Nicht die Bohne!“
„Na los, dann raus mit der Sprache, Lotti, oder wie lange möchtest du mich noch hinhalten?“, erkundigte sich Enno.
„Ich hätte da ein Messer“, begann Oma Pusch, „aber frag nicht, wo ich’s herhabe.“
„Was interessiert mich eins deiner Messer?“ So langsam wurde Enno ärgerlich. Hielt sie ihn zum Narren? Vielleicht, weil ihr ohne aktuellen Mordfall langweilig war?
„Es ist nicht mein Messer“, erklärte Oma Pusch, „sondern eins aus der Erde mit Blut dran. Aber wir wissen nicht, ob es Menschenblut ist.“
„Wer ist wir?“, wollte Enno wissen. „Und wo ist es her? Wenn du mir das jetzt nicht ganz ehrlich sagst, lege ich sofort auf. Also?“
„Warte“, lenkte Oma Pusch ein. Sie sah ihre Felle davonschwimmen. „Hinnerk hat es mir gebracht.“
„Dachte ich es mir doch“, sagte Enno. „Er hätte damit sofort zur Polizei gehen müssen.“
„Du kennst ihn ja“, lenkte Oma Pusch ein. „Davon hält er seit dem Fall mit dem Friesennerz überhaupt nichts.“
„Nur weil sie ihn ein bisschen ausgequetscht und seinen Kaffee nicht bezahlt haben“, lachte Enno. „Das Weichei!“
„Wie dem auch sei“, fuhr Oma Pusch fort. „Was machen wir jetzt mit dem Messer?“
„Wir machen gar nichts damit. Du bringst es zur Polizei. Das ist doch wohl klar, und zwar schleunigst. Dein Neffe Oberkommissar wird dir schon nicht den Kopf abreißen“, antwortete Enno. „Wo ist es denn her?“
„Ach, das interessiert dich jetzt?“, wunderte sich Oma Pusch. „Ich werde den Teufel tun und das Artefakt nach Esens aufs Kommissariat bringen, bevor ich nicht weiß, ob es sich bei dem Blut um Menschen- oder Tierblut handelt. Ich mache mich doch nicht zum Affen. Das kannst du nicht von mir verlangen.“
Stille auf der anderen Seite der Leitung.
„Enno, bist du noch da?“
„Ja, ja“, brummte er. „Ich überlege.“
„Das kann man nicht hören“, wandte Oma Pusch ein.
Enno seufzte. Es war fast ein Stöhnen. Aber dann dachte er, dass ihm das Schicksal hervorragende Karten in die Hand gespielt habe. Jetzt gab es endlich einen guten Grund, Lotti zu besuchen.
„Was? Könntest du dich mal äußern? Gedanken lesen kann ich nicht“, meckerte Oma Pusch.
„Das ist natürlich bedauerlich“, gab Enno zu. „Trotzdem bin ich ganz froh darüber, dass du nicht auch noch in mein Gehirn schauen kannst. Aber bei deinem Problem kann ich dir vielleicht helfen. Ich könnte leicht herausfinden, ob es sich um Menschenblut handelt oder nicht.“
„Ach ja? Wie denn?“, hakte Oma Pusch nach.
„Mit dem Uhlenhuth-Test. Hat man als guter Rechtsmediziner immer parat“, erklärte er. „Dabei nimmt man …“
„Ja, ja, schon gut“, unterbrach sie ihn. „Die Details interessieren mich nicht. Ich will nur wissen, ob du das zweifelsfrei bestimmen kannst.“
„Sicher“, sagte Enno. „Ein Kinderspiel. Soll ich vorbeikommen?“
„Aus der Ferne wird es ja wohl kaum gehen“, grummelte Oma Pusch in sich hinein. Er wollte doch glatt, dass sie ihn darum bat. Aber wenn sie was erreichen wollte, musste sie zu Kreuze kriechen. „Also bitte, sei so lieb und komm doch eben just mit deinem Testköfferchen rum“, sagte sie jetzt so laut, dass er es verstehen konnte. „Oder hast du wen auf dem Tisch?“
„Nee, momentan ist alles ruhig, kein Mord, keine Leiche, wenigstens bis jetzt. Keine Ahnung, wozu das führt, was du jetzt da in petto hast. Ich hoffe nur, du und Hinnerk, ihr habt da nicht alle dran rumgegrabbelt, wegen der Spuren, falls … na, dann will ich mich mal ins Auto schwingen, mein liebes Lottchen. Bis gleich!“
Noch bevor Oma Pusch etwas erwidern konnte, legte er auf. Unverschämtheit! Und was sollte das? Mein Lottchen? Sie war nicht SEIN Lottchen. Jedenfalls nicht richtig. Und nicht im Geringsten offiziell. Was erlaubte er sich? Man konnte nie wissen, ob jemand mithörte. Sie seufzte. Eine Sache musste sie vorab noch dringend erledigen: ihre Freundin Rita informieren. Es war gar nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn diese spektakuläre Neuigkeit schlichtweg an ihr vorbeiginge. Oder wenn sich Hinnerk zufällig verplappern würde. Seit Jahren schnappten sie die Mörder immer gemeinsam. Also wählte sie Ritas Nummer.