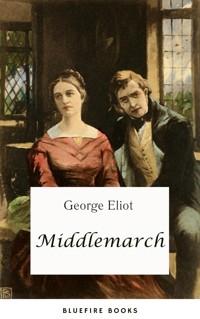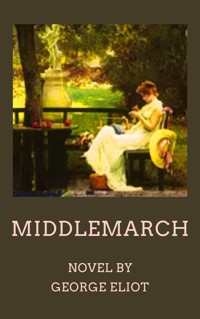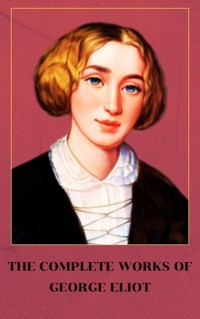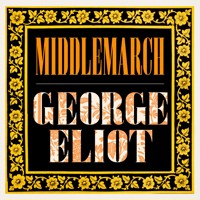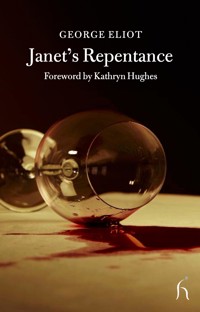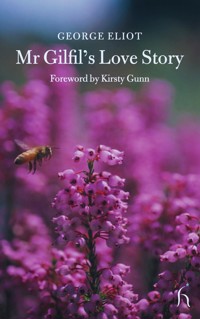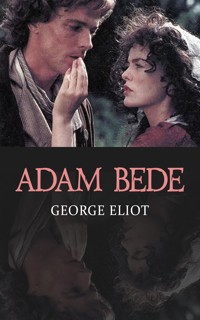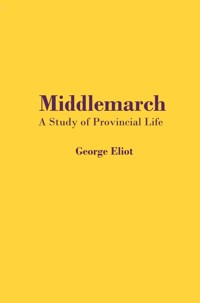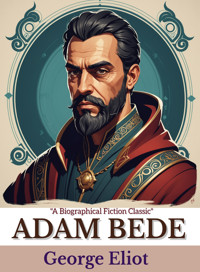Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
George Eliot: Middlemarch | Vollständige deutsche eBook-Neuausgabe (2022) mit über 180 verlinkten Fußnoten und Anmerkungen. | George Eliots psychologischer Großroman ist ein Panoptikum der englischen Gesellschaft während des Übergangs vom landwirtschaftlichen zum industriellen Zeitalter (die Handlung spielt zwischen 1829 und 1832). Alte Ordnungen zerbröckeln, neue haben sich noch nicht etabliert. Spiegelgleich werden auf individueller Ebene die Protagonisten durcheinandergewirbelt wie Dominosteine. Die Spielorte des Romans sind die fiktive Stadt Middlemarch, die sie umgebenden reichen, herrschaftlichen Landgüter und die schäbigen Hüttendörfer der armen Landbevölkerung. Doch das Setting der Handlung ist der Autorin bemerkenswert egal, sie klebt nicht an der Epoche, denn es geht um zeitlose psychologische Mechanismen. Ein Tenor des Werks ist das Scheitern der Protagonisten, das, wie man meinen könnte, eine negative Grundstimmung erzeugen würde. Das tut es deshalb nicht, weil jedes Scheitern als Aufbruch gezeichnet wird, als Anfang mit neuen Chancen. Um es mit einem Wort von heute auszudrücken: es ist ein Roman der Resilienz, wie kaum ein anderer. Damit eine Kraftquelle für den Leser. Im Jahr 2015 wählten 82 internationale Literaturkritiker und -wissenschaftler das Werk zum bedeutendsten britischen Roman aller Zeiten. | © Redaktion eClassica, 2022
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1744
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Vorwort des Herausgebers
Präludium
Erstes Buch: Dorothea Brooke
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Zweites Buch: Alt und Jung
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Drittes Buch: In Erwartung des Todes
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Viertes Buch: Drei Liebesprobleme
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Fünftes Buch: Das Kodizill
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Sechstes Buch: Die Witwe und die Ehefrau
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Siebtes Buch: Zwei Versuchungen
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Achtes Buch: Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Finale
Impressum
Fußnoten
Vorwort des Herausgebers
George Eliots psychologischer Großroman ist ein Panoptikum der englischen Gesellschaft während des Übergangs vom landwirtschaftlichen zum industriellen Zeitalter (die Handlung spielt zwischen 1829 und 1832, also rund 40 Jahre, bevor Eliot das Werk schrieb). Überall entsteht Neues, vergeht Altes; alte Ordnungen zerbröckeln, neue haben sich noch nicht etabliert. Spiegelgleich werden auf individueller Ebene die Protagonisten durcheinandergewirbelt wie Dominosteine.
Die Spielorte des Romans sind im Wesentlichen die fiktive Stadt Middlemarch, die sie umgebenden reichen, herrschaftlichen Landgüter und die schäbigen Hüttendörfer der armen Landbevölkerung. Doch das Setting der Handlung ist Eliot bemerkenswert egal, sie klebt nicht an der Epoche, im Gegenteil legt sie kaum Wert darauf. Darum ist der Roman, als psychologische Studie – worauf bereits der Untertitel hinweist – zeitlos wie kaum einer, und mutet zu allen Zeiten des Umbruchs (so auch heute) wie ein Spiegelkabinett an.
Ein Grundmotiv des Werks ist das Scheitern der Protagonisten, das, wie man meinen könnte, eine negative Grundstimmung erzeugen würde. Das tut es deshalb nicht, weil jedes Scheitern als Aufbruch gezeichnet wird, als Anfang mit neuen Chancen und neuen Möglichkeiten. Um es mit einem Wort von heute auszudrücken: es ist ein Roman der Resilienz, wie kaum ein anderer. Damit eine Kraftquelle für den Leser.
George Eliot ist ein Pseudonym der Mary Anne Evans (1819–1880), sie war Schriftstellerin, Übersetzerin (u. a. Spinoza, Feuerbach) und Journalistin, und zählt zu den erfolgreichsten Autoren des viktorianischen Zeitalters. Neben der Tatsache, dass sie professionelle Schreiberin war (etwa Chefredakteurin des liberalen Magazins ›The Westminster Review‹ in London) verfügte sie über exorbitantes Allgemeinwissen, und auch Spezialwissen auf den Gebieten der Medizin, Biologie, Juristik, Finanzwirtschaft und Politik – was im Roman ›Middlemarch‹ auch in den häufigen faktenbasierten Einschüben geradezu Melville’scher Art zum Tragen kommt.
Hinzu kommt das Stilmittel der Ironie, das Mary Anne Evans auf brillante Weise einsetzt wie kaum ein anderer Schriftsteller. Verschont ist davon niemand; auch die Hauptprotagonisten, die der Autorin nahestehen, bekommen regelmäßig sarkastische Dolchstöße ab. Dieses subtil eingesetzte Mittel stellt Übersetzer des Buches vor gewaltige Aufgaben.
In Summe breitet Eliot mit ihrer enormen Bildung und ihrem Humor einen »Kosmos des Weltwissens« aus, auf eine zwar anspruchsvolle, aber »äußerst unterhaltsame Weise«, schreibt der Literaturkritiker und Historiker Gustav Seibt im Dezember 2019 in der ›Süddeutschen Zeitung‹. Nebenbei spiegeln alleine die den einzelnen Kapiteln vorangestellten Motti (insgesamt 86), die in dieser eBook-Ausgabe in der jeweiligen Originalsprache – meist Englisch – wiedergegeben sind, eine bemerkenswerte Belesenheit quer durch die Literaturgeschichte.
Alles in allem ist Middlemarch ein »gewaltiges Buch« (Seibt), und Mary Anne Evans eine gewaltige Autorin. Im Jahr 2015 wählten 82 internationale Literaturkritiker und -wissenschaftler das Werk zum bedeutendsten britischen Roman aller Zeiten.
© Redaktion eClassica, 2022
Präludium
Wer von allen, denen daran gelegen ist, sich mit der Geschichte des Menschen bekannt zu machen und zu erforschen, wie dieses geheimnisvolle Wesen sich unter den mannigfachen Einwirkungen der Zeit entwickelt hat, hätte nicht einmal, wenn auch nur flüchtig, bei dem Leben der heiligen Therese verweilt und hätte nicht mild gelächelt bei dem Gedanken an das kleine Mädchen, das sich eines Morgens Hand in Hand mit seinem noch kleineren Bruder aufmachte, um nach dem Land der Mauren zu gehen und dort ein Märtyrertum aufzusuchen? Fort trippelten sie von dem wilden Avila, die Augen weit geöffnet und hilflos aussehend wie zwei scheue Rehe, aber mit menschlich fühlenden Herzen, die bereits für eine große Idee schlugen, bis ihnen die raue Wirklichkeit in Gestalt eines Oheims entgegentrat, welcher sie von der Ausführung ihres Vorhabens zurückhielt. Diese kindliche Pilgerfahrt war für Therese ein angemessener Beginn ihrer Lebenslaufbahn. Ihre leidenschaftliche, ideale Natur verlangte nach einem tatenreichen Leben. Was konnten ihr vielbändige Ritterromane, was die gesellschaftlichen Erfolge, welche sie als glänzend begabtes Mädchen zu erwarten hatte, bieten? Die in ihr lodernde Flamme hatte so leichte Nahrung bald aufgezehrt und dürstete, von innen genährt, nach einer schrankenlosen Befriedigung, nach einem Lebenszweck, welcher, jede Erschöpfung ausschließend, die Verzweiflung der Seele an sich selbst durch das entzückende Bewusstsein eines über die Beschränktheit des eigenen Ich’s hinausragenden Lebens überwinden würde. Sie fand das Epos ihres Lebens in der Reform eines geistlichen Ordens.
Diese spanische Frau, welche vor dreihundert Jahren lebte, war gewiss nicht die letzte ihrer Art. Viele Theresen sind seitdem geboren, welche kein Leben für sich fanden, das ihnen zu unausgesetzter Entfaltung ihrer Tatkraft Gelegenheit gegeben hätte; – vielleicht nur ein Leben voll Enttäuschungen, wie sie aus dem unglücklichen Zusammentreffen einer gewissen Seelengröße mit der Kleinheit der Verhältnisse hervorgehen, vielleicht ein tragisch verfehltes Leben, welches keinen heiligen Sänger fand und unbeweint in Vergessenheit versank. Mit trüber Geisteshelle und in verwickelten Verhältnissen versuchten sie es, ihre Gedanken und ihre Handlungen in harmonischen Einklang zu bringen; den Augen gewöhnlicher Sterblicher erschien aber ihr Ringen nur als unzusammenhängend und gestaltlos. Denn diesen später geborenen Theresen stand kein einigendes Band eines gesellschaftlichen Glaubens und Ordens, welches für die glühend strebende Seele das Wissen hätte ersetzen können, helfend zur Seite. Die Glut ihrer Seele schwankte zwischen einem vagen Ideal und dem gemeinen Verlangen der weiblichen Natur unsicher hin und her, sodass das Eine als Extravaganz missbilligt und das Andere als Fehltritt verurteilt wurde.
Manche haben geglaubt, dass diese in unsicherem Schwanken irrend verbrachten Existenzen ihren Grund in der unklaren Unbestimmtheit haben, mit welcher es dem höchsten Wesen gefallen hat, die weibliche Natur auszustatten. Wenn es ein Niveau weiblicher Unzulänglichkeit gäbe, das so scharf präzisiert wäre, wie die Fähigkeit, drei zu zählen und nicht weiter, so möchte sich das gesellschaftliche Los der Frauen mit wissenschaftlicher Sicherheit behandeln lassen. Aber die unklare Unbestimmtheit ist da, und die Grenzen, innerhalb deren dieselbe hin- und herschwankt, sind in der Tat viel weiter gesteckt, als diejenigen sich träumen lassen, die nur an die Gleichmäßigkeit weiblicher Frisuren und an die beliebten Liebesgeschichten in Prosa und in Versen denken. Dann und wann wird ein junger Schwan zu seinem eigenen Unbehagen unter den jungen Enten im trüben Teich auferzogen und findet nie den lebendigen Strom, auf dem er in Gesellschaft der ruderfüßigen Genossen seines Geschlechts dahinschwimmen könnte. Von Zeit zu Zeit wird eine heilige Therese geboren, die nichts gründet, deren bebende Herzschläge und Seufzer nach einer unerreichten Tugend sich schwankend an störenden Verhältnissen verzehren, anstatt sich in einer dauernden Tat zu konzentrieren.
Erstes Buch: Dorothea Brooke
Kapitel 1
Since I can do no good because a woman,Reach constantly at something that is near it.
(Beaumont and Fletcher: The Maid’s Tragedy)1
Dorothea Brooke gehörte zu jenen Schönheiten, denen eine dürftige Kleidung zur Erhöhung ihrer Reize zu dienen scheint. Ihre Hand und ihr Handgelenk waren so schön geformt, dass sie getrost Ärmel tragen konnte, welche ebenso stillos waren, wie die, in welchen die heilige Jungfrau den alten italienischen Meistern erschien, und ihr Profil sowohl, wie ihre ganze Gestalt und ihr Habitus, schienen durch ihre einfache Kleidung nur an Würde zu gewinnen, sodass ihre ganze Erscheinung inmitten der Modedamen der Provinz den Eindruck eines schönen Zitats aus der Bibel – oder aus einem alten Dichter – in einem Zeitungsartikel machte.
Man bezeichnete sie allgemein als sehr gescheit, fügte aber regelmäßig hinzu, dass ihre Schwester Celia mehr gesunden Menschenverstand habe. Gleichwohl trug Celia kaum mehr Besatz an ihren Kleidern, und nur sehr scharfe Beobachter nahmen wahr, dass ihre Kleidung sich doch in Etwas von der ihrer Schwester unterschied und mit einer Nuance von weiblicher Koketterie arrangiert war; denn die einfache Toilette Dorothea Brooke’s hatte ihren Grund in verschiedenen Ursachen, von denen die meisten auch für ihre Schwester maßgebend waren.
Das stolze Bewusstsein, Ladies zu sein, war eine dieser Ursachen: die Familie der Brooke’s war, wenn auch nicht gerade eine aristokratische, doch unstreitig eine sehr gute; wenn man ihrer Herkunft eine oder zwei Generationen weit nachging, so fand man unter den Voreltern keine Handwerker oder Detaillisten, sondern nichts Geringeres als einen Admiral und einen Geistlichen; und wenn man den Stammbaum noch weiter zurückverfolgte, so kam man auf einen puritanischen Gentleman, der unter Cromwell gedient, sich aber später wieder der Staatskirche angeschlossen und sich als Eigentümer eines respektablen Grundbesitzes allen politischen Verfolgungen zu entziehen gewusst hatte. Junge Damen von solcher Herkunft, welche in einem ruhigen Haus auf dem Lande lebten und eine Dorfkirche besuchten, die kaum größer war, als ein Wohnzimmer, betrachteten natürlich allen Putz als den Gegenstand des Ehrgeizes einer Hökerstochter2. Ferner bestand in guten Familien damals noch eine Ökonomie, welche die Toilette als denjenigen Ausgabeposten betrachtete, welcher sich am ersten zu einer Einschränkung eigne, wenn es notwendig erschien, gerade im Interesse der gesellschaftlichen Stellung das Budget durch Vergrößerung anderer Ausgaben zu belasten.
Diese und ähnliche Gründe würden, ganz abgesehen von religiösen Gefühlen, hingereicht haben, eine einfache Toilette zu erklären; in Dorothea Brooke’s Fall aber würde die Religion allein ein genügendes Motiv gewesen sein, und Celia schloss sich allen Empfindungen ihrer Schwester in ihrer milden Weise an, nur dass sie dieselben mit jenem gesunden Menschenverstand durchdrang, welcher sich bedeutungsvolle Doktrinen ohne jede exzentrische Aufregung anzueignen weiß.
Dorothea wusste viele Stellen aus Pascal’s ›Pensées‹ und aus Jeremy Taylor3auswendig; und die Bestimmung der Menschheit, wie sie dieselbe im Licht des Christentums ansah, ließ ihr das Interesse für weibliche Moden als eine tollhäuslerische Beschäftigung erscheinen. Sie vermochte die Bekümmernisse eines Seelenlebens, bei denen es sich um Folgen für die Ewigkeit handelte, nicht mit den nichtigen Sorgen für die Raffinements einer modernen Toilette in Einklang zu bringen. Die Richtung ihres Geistes war eine theoretische und ihre Natur verlangte nach einer einheitlichen und bedeutenden Auffassung der Welt, in welcher das Kirchspiel Tipton4 und die Art ihres Lebens in demselben ungezwungen einen Platz finden möchten; sie hatte eine leidenschaftliche Vorliebe für alles Große und Gewaltige, und ihre Sympathie war sofort Allem, was dieser Neigung zu entsprechen schien, gewonnen; sie war sehr geneigt, ein Märtyrertum zu suchen, dann ihre schnell gefassten Meinungen zu widerrufen und schließlich ein Märtyrertum da zu finden, wo sie es gar nicht gesucht hatte.
Solche Elemente in dem Charakter eines heiratsfähigen Mädchens waren gewiss geeignet, auf ihr Schicksal entscheidend einzuwirken und zu verhindern, dass dasselbe, der bestehenden Sitte gemäß, durch ein hübsches Gesicht, durch Eitelkeit und durch eine rein sinnliche Zuneigung bestimmt werde. Bei alledem war sie, die ältere der beiden Schwestern, noch nicht zwanzig Jahre alt und beide hatten, seit sie vor etwa acht Jahren ihre Eltern verloren, nach einem ebenso beschränkten, wie unklaren Plan, zuerst in einer englischen Familie und später in einer Schweizer Familie in Lausanne, eine Erziehung genossen, welche nach der Auffassung ihres ledigen Onkels und Vormundes die Nachteile ihrer Elternlosigkeit ausgleichen sollte.
Es war kaum ein Jahr her, seit sie aus der Schweiz zurückgekehrt waren und auf ›Tipton-Hof‹ mit ihrem Onkel, einem fast sechzigjährigen Mann von nachgiebigem Charakter, wechselnden Ansichten und unsicherem Urteil, lebten. In seinen jüngeren Jahren war er gereist und hatte sich, wie die Leute meinten, bei jenen Reisen die Unentschlossenheit des Wesens angeeignet, welche ihn charakterisierte. Seine Entschlüsse vorauszusagen war so schwer, wie das Wetter im Voraus zu bestimmen; alles, was man mit einiger Sicherheit vorhersagen konnte, war, dass er sich bei seinen Handlungen von wohlwollenden Absichten leiten lassen und bei ihrer Ausführung möglichst wenig Geld ausgeben werde. Denn selbst Gemüter von der zähesten Unentschlossenheit hegen doch einige harte Gewohnheiten und man erzählt von einem Mann, der, von der äußersten Gleichgültigkeit gegen alle seine eigenen Interessen, nur seine Schnupftabaksdose mit argwöhnischer Wachsamkeit und eifersüchtiger Engherzigkeit hütete.
Herrn Brooke war die erbliche puritanische Energie offenbar abhanden gekommen; aber bei seiner Nichte Dorothea durchdrang dieselbe Alles, ihre Fehler und ihre Tugenden; diese Energie äußerte sich bisweilen als Ungeduld gegen die Reden ihres Onkels oder gegen seine Art, die Dinge auf seinem Gut gehen zu lassen, und ließ sie nur um so sehnlicher die Zeit ihrer Volljährigkeit herbeiwünschen, wo sie über einige Mittel zur Ausführung großherziger Lieblingspläne gebieten würde. Sie galt für eine Erbin; denn nicht nur, dass beide Schwestern von ihren Eltern jede eine Jahresrente von siebenhundert Pfund Sterl. geerbt hatten, sondern, falls Dorothea sich verheiraten und einen Sohn bekommen sollte, würde dieser Sohn Herrn Brooke’s Gut erben, welches auf einen jährlichen Ertrag von dreitausend Pfund Sterl. geschätzt wurde. Eine solche Einnahme aber galt damals als Reichtum in den Augen der in der Provinz lebenden Familien, welche Robert Peels5kürzliches Benehmen in Betreff der Katholiken-Emanzipation diskutierten, und noch keine Ahnung von der künftigen Entdeckung der Goldfelder und von jener prachtliebenden Plutokratie hatten, welche die Bedürfnisse eines fashionablen Lebens so maßlos steigern sollte.
Und warum sollte ein so schönes Mädchen mit so glänzenden Aussichten nicht heiraten? Nichts konnte sie daran hindern, als ihre Liebe zu Extremen und ihre entschiedene Neigung, das Leben nach Ideen zu gestalten, welche wohl geeignet waren, einen vorsichtigen Mann stutzig zu machen, bevor er ihr seine Hand anböte, oder welche sie gar dahin bringen konnten, schließlich alle Anträge abzulehnen. Eine junge Dame von guter Herkunft und einigem Vermögen, welche gelegentlich an der Seite eines kranken Arbeiters plötzlich auf einem steinernen Fußboden niederkniete und inbrünstig betete, als ob sie sich in die Zeiten der Apostel zurückversetzt glaube, und welche die sonderbare Grille hatte, zu fasten wie eine Papistin und Nächte hindurch bei der Lektüre alter theologischer Schriften aufzusitzen, – bei einer solchen Frau hätte der Mann darauf gefasst sein müssen, dass sie ihn eines schönen Morgens mit einem neuen Plan für die Verwendung ihres Vermögens aufwecken würde, der sich mit den Grundsätzen einer gesunden Nationalökonomie und dem Halten von Reitpferden schlecht vertragen möchte; jeder Mann würde sich voraussichtlich zweimal besinnen, bevor er das Wagnis einer solchen Verbindung unternähme. Man hielt damals dafür, dass Frauen schwache Gemüter haben müssten und betrachtete es als eine Gewähr für die Erhaltung der Gesellschaft und des Familienlebens, dass man nicht nach bestimmten Ansichten handele. Verständige Leute machten es wie ihre Nachbarn, sodass, wenn einzelne Irrsinnige frei herumliefen, man sie kennen und ihnen ausweichen konnte.
Die allgemeine Meinung der ländlichen Bevölkerung, selbst der kleinen Leute, sprach sich zu Gunsten Celias aus, weil sie so liebenswürdig und freundlich sei, während die großen Augen der älteren Schwester, gleich ihrer religiösen Überzeugung etwas zu Ungewöhnliches und Auffallendes hätten. Die arme Dorothea! Im Vergleich zu ihr war die unschuldig aussehende Celia erfahren und weltklug; so wahr ist es, dass das Innere des Menschen unendlich viel feiner ist, als die äußere Erscheinung, die als eine Art von Ziffernblatt des Innern betrachtet wird.
Und doch fanden die, welche sich Dorotheen mit dem durch jene Meinung hervorgerufenen Vorurteil näherten, dass ihr Wesen einen unerklärlichen, mit jenem Vorurteil unvereinbaren Reiz habe. Die meisten Männer fanden sie bezaubernd, wenn sie zu Pferde saß. Sie liebte die frische Luft und die Aussichten, die sich ihr bei weiteren Ausflügen darboten, und wenn ihre Augen und Wangen von verschiedenen angenehmen Empfindungen glühten, sah sie einer Frömmlerin sehr wenig ähnlich. Reiten war ein Vergnügen, das sie sich, gelegentlicher Gewissensskrupel ungeachtet, gestattete; sie fühlte, dass sie sich diesem Genuss mit einer heidnisch sinnlichen Empfindung hingab, und dachte immer daran, demselben zu entsagen.
Sie war offen, feurig und nicht im Mindesten von ihrem eigenen Wert erfüllt; ja, es war anmutig zu beobachten, wie ihre Einbildungskraft ihrer Schwester Celia viel größere Reize, als deren sie sich selbst erfreute, andichtete; und wenn einmal ein Herr aus einem anderen Grund nach Tipton-Hof zu kommen schien, als um Herrn Brooke zu sehn, so hielt Dorothea es für ausgemacht, dass er in Celia verliebt sein müsse. So war es z. B. mit Sir James Chettam, bei welchem sie fortwährend daran dachte, ob es gut für Celia sein würde, seine Bewerbung anzunehmen. Ihn als einen Bewerber um ihre eigene Hand anzusehen, würde ihr als eine lächerliche Verkehrtheit erschienen sein. Dorothea hatte bei all ihrem eifrigen Streben, die Wahrheit des Lebens zu ergründen, sehr kindliche Ideen über die Ehe. Sie hielt sich überzeugt, dass sie dem scharfsinnigen Hooker6, wenn sie früh genug auf die Welt gekommen wäre, um ihn vor jenem unglücklichen Missgriff, den er bei seiner Ehe beging, zu bewahren, oder John Milton nach seiner Erblindung, oder irgendeinem anderen großen Mann, dessen sonderbare Gewohnheiten zu ertragen ihr als ein rühmlich frommes Werk erschienen wäre, die Hand gereicht haben würde. Aber wie konnte ein liebenswürdiger hübscher Baronet, der alle ihre Bemerkungen, selbst wenn dieselben der Unsicherheit ihres Urteils Ausdruck gaben, mit einem ›vollkommen richtig‹ beantwortete, ihr den Eindruck eines ernstlichen Bewerbers um ihre Hand machen? Als das Ideal einer Ehe erschien ihr die, in welcher ihr Gatte eine Art von väterlichem Freund sein würde, der sie, wenn sie es wünschen sollte, selbst im Hebräischen unterweisen konnte.
Diese Sonderbarkeiten in Dorotheen’s Charakter ließen es den benachbarten Familien nur um so tadelnswerter erscheinen, dass Herr Brooke nicht eine Dame von mittleren Jahren als erfahrene Gesellschafterin für seine Nichten engagiere. Aber er selbst fürchtete die Art von überlegenen Frauen, zu welchen eine für eine solche Stellung geeignete Dame mutmaßlich gehören würde, so sehr, dass er sich gern von Dorotheen’s Einwänden bestimmen ließ und in diesem Fall den Mut hatte, dem Urteil der Welt, d. h. dem Urteil der Frau Cadwallader, der Gattin des Pfarrers, und der kleinen Gruppe von Landedelleuten im nordöstlichen Winkel von Loamshire, mit welchen er verkehrte, zu trotzen. Dorothea Brooke stand daher dem Haushalt ihres Onkels vor und fand an dieser neuen Würde mit den Huldigungen, welche derselben dargebracht wurden, Gefallen.
Heute sollte Sir James Chettam mit einem anderen Herrn, welchen die Mädchen noch nie gesehen hatten, welchem aber Dorothea mit einer verehrenden Erwartung entgegensah, auf Tipton-Hof zu Mittag essen. Das war der Ehrwürdige Edward Casaubon, welcher in der Grafschaft in dem Ruf eines Mannes von tiefer Gelehrsamkeit stand und von welchem man wusste, dass er seit vielen Jahren an einem großen Werk über Religionsgeschichte arbeite, ein Mann, dessen Wohlhabenheit seiner Frömmigkeit einen besonderen Glanz verlieh und welcher eigentümliche Ansichten hatte, über die man durch die Veröffentlichung seines Werkes genauere Aufschlüsse erhalten solle. Schon sein bloßer Name ›Casaubonus‹ erweckte eine Vorstellung von Gelehrsamkeit, freilich nur bei denen, welche in der Gelehrtengeschichte bewandert waren.
Schon früh am Tag war Dorothea aus der Warteschule, die sie im Dorf gegründet hatte, nach Hause zurückgekehrt und hatte ihren gewöhnlichen Platz in dem hübschen Wohnzimmer, welches zwischen den beiden Schlafzimmern der Schwestern lag, eingenommen, um der Beendigung der Pläne für einige Gebäude, deren Entwerfung ihre Lieblingsbeschäftigung ausmachte, obzuliegen, als Celia, welche sie schon eine Zeit lang mit der Absicht, ihr etwas vorzuschlagen, zaghaft beobachtet hatte, zu ihr sagte:
»Liebe Dorothea, wenn Du nichts dagegen hast, wenn Du nicht sehr beschäftigt bist, – was meinst Du, wenn wir uns heute einmal Mamas Juwelen ansähen und sie unter uns teilten. Es sind heute gerade sechs Monate her, seit Onkel sie Dir gegeben hat, und Du hast sie noch nicht einmal angesehen.«
Auf Celias Zügen malte sich bei diesen Worten ein leiser Schatten von zürnendem Ausdruck, während das volle Hervorbrechen eines Vorwurfs durch eine zur Gewohnheit gewordene Ehrfurcht vor Dorotheen und ihren Grundsätzen zurückgehalten wurde, zwei Empfindungen, aus welchen eine unvorsichtige Berührung leicht einen geheimnisvollen elektrischen Funken herausschlagen konnte. Zu Celias Beruhigung blickte Dorothea freundlich lachend auf.
»Was Du für ein vortrefflicher kleiner Kalender bist, Celia! Sind es sechs Kalendermonate oder sechs Mondmonate?«
»Heute schreiben wir den letzten September, und wir schrieben den ersten April, als Onkel Dir die Juwelen gab. Du weißt, dass er damals sagte, er habe sie bisher vergessen. Ich glaube, Du hast seit jener Zeit, wo Du den Schmuck hier in den Schrank verschlossest, gar nicht wieder an denselben gedacht.«
»Nun, liebes Kind, wir dürften ja doch nie etwas davon tragen.«
Dorothea sprach diese Worte in einem vollen herzlichen Ton, mit einem halb zutunlichen, halb erklärenden Ausdruck. Sie hatte ihren Bleistift in der Hand und zeichnete eben kleine Nebenpläne auf den Rand ihres Papiers.
Celia errötete und sah sehr ernst aus. »Ich denke, liebe Dorothea, wir würden dem Andenken Mamas zu nahe treten, wenn wir die Juwelen weglegten und gar nicht beachteten. Und,« fügte sie zaudernd mit einem halbunterdrückten Seufzer hinzu, »Halsbänder sind etwas ganz Gewöhnliches, und selbst Madame Poinçon, die in einigen Dingen noch strenger war als Du, pflegte Schmuck zu tragen. Und im Himmel gibt es gewiss christliche Frauen, welche auf Erden Juwelen getragen haben.« Celia war sich einer gewissen geistigen Stärke bewusst, sobald sie sich einmal ernsthaft aufs Argumentieren verlegte.
»Du möchtest sie tragen?!« rief Dorothea, mit dem Ausdruck des höchsten Erstaunens und mit einer dramatischen Gebärde, die sie eben jener Madame Poinçon, welche Schmuck zu tragen pflegte, abgesehen hatte. »Gewiss, lass sie uns hernehmen. Warum hast Du mir das nicht früher gesagt? Aber die Schlüssel, wo sind die Schlüssel?« Dabei presste sie die Hände gegen die Seiten ihres Kopfes, als verzweifle sie an ihrem Gedächtnis.
»Hier sind sie«, erwiderte Celia, welche diese Auseinandersetzung lange geplant und vorbereitet hatte.
»Bitte, öffne die große Schublade des Schranks und nimm den Juwelenkasten heraus.«
Der Kasten stand bald genug offen vor ihnen und die verschiedenen Juwelen lagen wie ein buntes Blumenbeet an dem Tisch vor ihnen ausgebreitet. Es war keine große Auswahl, aber einige von den Schmucksachen waren von wirklich seltener Schönheit; unter ihnen fielen zwei, ein Halsband von dunkelvioletten, höchst elegant in Gold gefassten Amethysten und ein Kreuz von Perlen mit fünf Brillanten, sofort als die schönsten in die Augen. Dorothea nahm das Halsband in die Hand und band es ihrer Schwester um den Hals, den es fast so eng wie ein Armband umschloss; aber dieses enge Halsband passte gerade zu dem Henriette-Marien-Stil7 von Celias Kopf und Hals, und dass dem so war, konnte sie selbst in dem gegenüberstehenden Spiegel sehen.
»Siehst Du, Celia, das kannst Du mit Deinem weißen Musseline-Kleid tragen. Aber das Kreuz passt zu Deinen dunklen Kleidern.«
Celia bemühte sich, ein freudiges Lächeln zu unterdrücken.
»O Dora, das Kreuz musst Du für Dich behalten.«
»Nein, nein, liebes Kind«, sagte Dorothea, indem sie mit der Hand eine nachlässig abwehrende Bewegung machte.
»Ja wohl, ja wohl, Du musst; es würde Dir bei Deinem schwarzen Kleid gut stehen«, erwiderte Celia dringend. »Du kannst es getrost tragen.«
»Nein, nicht um Alles in der Welt. Ein Kreuz ist das letzte, was ich als Schmuck tragen möchte.« Dabei durchfuhr Dorothea ein leichter Schauer.
»Dann findest Du es wohl sträflich von mir, es zu tragen«, entgegnete Celia unbehaglich.
»Nein, liebes Kind, nein«, sagte Dorothea, indem sie ihrer Schwester die Wange streichelte, »auch die Seelen haben ihre Physiognomie; was sich für die Eine schickt, schickt sich nicht für die Andere.«
»Aber vielleicht möchtest Du es um Mamas Willen behalten.«
»O nein, ich habe andere Dinge von Mama, ihren Kasten von Sandelholz, den ich so sehr liebe, – eine Menge anderer Dinge. Die Juwelen sollen alle Dir gehören, liebes Kind. Wir brauchen also darüber nicht länger zu verhandeln. Komm, nimm Dein Eigentum zu Dir.«
Celia fühlte sich ein wenig verletzt. Es lag etwas von anmaßender Überlegenheit in dieser puritanischen Toleranz, die für das leichte Blut der weniger überspannten Schwester kaum minder empfindlich war als puritanische Verfolgungssucht.
»Aber wie kann ich Schmucksachen tragen, wenn Du, die ältere Schwester, nie dergleichen tragen willst?«
»Nein, Celia, es ist zu viel verlangt, dass ich Schmuck tragen soll, um Dir Gesellschaft zu leisten. Wenn ich ein solches Halsband tragen müsste, so würde mir zu Mute sein, als wenn ich Ballet tanzen sollte. Alles würde sich mit mir im Kreise herumdrehen, und ich würde nicht mehr aufrecht stehen können.«
Celia hatte das Halsband wieder abgenommen und – sagte mit einiger Genugtuung: »Es würde für Deinen Hals etwas zu eng sein; etwas Herabhängendes würde besser für Dich passen.« Das aus allen Gesichtspunkten vollkommen Unpassende des Halsbandes für Dorothea ließ Celia dasselbe um so lieber annehmen. Dann öffnete sie einige Kasten mit Ringen, unter denen ein schöner Smaragd mit Diamanten um so prächtiger erglänzte, als die eben hinter einer Wolke hervorbrechende Sonne den Ring mit einem hellen Strahl beleuchtete.
»Wie schön diese Edelsteine sind«, sagte Dorothea, in welcher der Sonnenstrahl plötzlich neue Empfindungen erweckt zu haben schien. »Es ist sonderbar, wie tief wir von Farben wie von Gerüchen beeindruckt werden. Ich denke mir, darum kommen in der ›Offenbarung Johannis‹ Edelsteine als Embleme der Seele vor. Sie muten uns an, wie Bruchstücke des Himmels. Mir scheint, der Smaragd da ist der schönste von allen.«
»Und da«, sagte Celia, »ist ein Armband, das dazu passt und welches wir vorhin gar nicht bemerkt haben.«
»Sie sind reizend«, sagte Dorothea, indem sie den Ring und das Armband über ihren Finger und ihr schön geformtes Handgelenk gleiten ließ und ihre Hand auf einer Höhe mit ihren Augen gegen das Fenster hielt. Gleichzeitig war sie innerlich bemüht, ihr Gefallen an den schönen Farben dadurch vor sich selbst zu rechtfertigen, dass sie dieselben in ihre mystisch religiöse Ekstase verwebte.
»Diese Steine würden Dir doch gefallen, Dorothea«, sagte Celia mit etwas zitternder Stimme, indem sie staunend zu bemerken glaubte, dass ihre Schwester nicht frei von Schwäche sei, während sie andererseits dachte, dass Smaragde für ihren Teint noch besser passen würden als Amethyste.
»Wenn Du auch sonst nichts willst, den Ring und das Armband musst Du behalten. Aber sieh doch, auch die Achate sind sehr hübsch und haben etwas so Ruhiges.«
»Ja«, erwiderte Dorothea, »ich will diesen Ring und das Armband behalten.« – »Aber«, fuhr sie, indem sie ihre Hand auf den Tisch fallen ließ, in einem anderen Ton fort. »Was sind es doch für unglückliche Menschen, die solche Dinge auffinden und verkaufen.« Sie hielt abermals inne, und Celia dachte, ihre Schwester werde nun wieder auf die Schmucksachen verzichten, wie sie es konsequenterweise hätte tun müssen. »Ja, liebste Celia«, nahm Dorothea in einem ganz entschlossenen Ton wieder auf, »ich will diese beiden Sachen behalten; aber nimm alles Übrige mitsamt dem Kasten an Dich.« Sie nahm ihren Bleistift wieder zur Hand, ohne jedoch die Juwelen, welche sie noch immer ansah, zu entfernen. Sie dachte daran, wie sie dieselben oft vor sich haben möchte, um ihre Augen an diesen kleinen Quellen reiner Farben zu weiden.
»Wirst Du die Sachen in Gesellschaft tragen?« fragte Celia, welche wirklich neugierig darauf war, was Dorothea damit tun würde. Diese warf ihrer Schwester einen raschen Blick zu. Durch all das verklärende Licht, in welchem ihre Phantasie ihr Alle erscheinen ließ, die sie liebte, fuhr doch bisweilen blitzartig ein scharfes Urteil. Wenn Dorothea jemals zu einer vollkommenen Milde ihres Wesens gelangen sollte, so würde nicht Mangel an innerem Feuer diese Umwandlung bewirken.
»Vielleicht,« erwiderte sie in etwas hochmütigem Ton. »Ich kann nicht voraussagen, wie tief ich noch einmal sinken werde.«
Celia errötete und fühlte sich unglücklich. Sie sah, dass sie ihre Schwester verletzt hatte, und wagte es nicht einmal, etwas Freundliches über die ihr überlassenen Schmucksachen zu sagen, sondern legte dieselben schweigend wieder in den Kasten und nahm sie fort.
Dorothea ihrerseits fühlte sich gleichfalls unglücklich, als sie wieder an ihren Bauplänen zeichnete, indem sie sich zweifelnd fragte, ob ihre Gefühle und ihre Worte bei dem Auftritt, dem jener kleine Zornesausbruch ein Ende gemacht hatte, ganz rein gewesen seien.
Celias Bewusstsein sagte ihr, dass sie durchaus nicht im Unrecht gewesen sei; es war ganz natürlich und durchaus zu rechtfertigen, dass sie jene Frage getan hatte, und sie fand noch immer, dass Dorothea inkonsequent sei: entweder hätte sie ihren vollen Anteil an den Juwelen für sich nehmen oder nach der Art, wie sie sich geäußert hatte, ganz auf dieselben verzichten müssen.
»Ich wenigstens glaube zuversichtlich«, sagte sich Celia, »dass das Tragen eines Halsbandes mich nicht in meinen Gebeten stören wird und ich sehe nicht ein, warum ich mich jetzt, wo wir Gesellschaften besuchen werden, durch Dorotheen’s Ansichten gebunden fühlen sollte, wenn sie selbst auch natürlich durch dieselben gebunden ist. Aber Dorothea ist nicht immer konsequent.« Das waren Celien’s Gedanken, als sie den Kopf auf ihre Stickerei gesenkt wieder dasaß, bis sie sich von ihrer Schwester gerufen hörte.
»Komm, Kitty, sieh Dir einmal meinen Plan an; ich werde mich für eine große Architektin halten, wenn ich nicht unmögliche Treppen und Kamine angelegt habe.«
Als Celia sich, dieser Aufforderung entsprechend, über das Blatt neigte, lehnte Dorothea liebkosend ihre Wange an den Arm ihrer Schwester. Celia verstand den Sinn dieser Liebkosung. Dorothea hatte eingesehen, dass sie Unrecht gehabt habe, und Celia verzieh ihr. Solange sie denken konnte, hatte in der Stimmung Celias gegen ihre ältere Schwester eine Mischung von Ehrfurcht und Kritik gelegen. Die jüngere Schwester hatte stets ein Joch getragen; aber es gibt kein Geschöpf, welches ein Joch trüge, ohne wenigstens in seinen Ansichten seine Freiheit zu behaupten.
Kapitel 2
»›Dime; no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro?‹ ›Lo que veo y columbro‹, respondio Sancho, ›no es sino un hombre sobre un as no pardo como el mio, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra‹. ›Pues ese es el yelmo de Mambrino‹, dijo Don Quijote.« – Miguel de Cervantes
»›Seest thou not yon cavalier who cometh toward us on a dapple-grey steed, and weareth a golden helmet?‹ ›What I see‹, answered Sancho, ›is nothing but a man on a grey ass like my own, who carries something shiny on his head‹. ›Just so‹, answered Don Quixote: ›and that resplendent object is the helmet of Mambrino.‹« – Miguel de Cervantes
»Mit Sir Humphrey Davy«, sagte Herr Brooke bei der Suppe in seiner behaglich lächelnden Weise, indem er an die Bemerkung Sir James Chettam’s, dass er mit dem Studium von Davys Agrikulturchemie beschäftigt sei, anknüpfte, »mit Sir Humphrey Davy habe ich vor Jahren bei Cartwright gegessen, und Wordsworth8war auch da – Sie wissen der Dichter Wordsworth. Das war nun sonderbar. Ich hatte zugleich mit Wordsworth in Cambridge studiert und hatte ihn dort nie getroffen, und nun saß ich zwanzig Jahre später bei Cartwright mit ihm zu Mittag. Es passieren doch oft eigentümliche Dinge! Also Davy war da, und er war auch ein Dichter; oder, richtiger würde ich wohl sagen: Wordsworth war der Poet Nummer eins und Davy der Poet Nummer zwei. Das ist in jedem Sinne wahr.«
Dorothea fühlte sich bei diesen Reden ihres Onkels noch etwas unbehaglicher als gewöhnlich. Gerade im Anfang des Mittagessens bei einer so kleinen Gesellschaft, wo es noch still im Zimmer war, machten sich die Ergüsse des Herrn Brooke gar zu bemerklich. Sie fragte sich, wie wohl solche Trivialitäten auf einen Mann, wie Herrn Casaubon wirken müssten. Sein Wesen machte ihr einen sehr würdigen Eindruck. Sein stahlgraues Haar und seine tiefen Augenhöhlen ließen ihn dem Porträt Locke’s9 ähnlich erscheinen. Seine Magerkeit und seine Blässe verkündeten den Gelehrten. Alles in Allem bildete er den schärfsten Gegensatz zu Sir James Chettam, welcher ein echter Repräsentant der Gattung blühender, rotbärtiger Engländer war.
»Ich studiere die Agrikulturchemie«, sagte der vortreffliche Baronet, »weil ich im Begriff stehe, die Bewirtschaftung eines meiner Pachthöfe selbst zu übernehmen, um zu sehen, ob ich nicht durch Herstellung einer Musterwirtschaft auf meine Pächter wirken kann. Halten Sie das für richtig, Fräulein Brooke?«
»Sehr verkehrt, Chettam«, schaltete Herr Brooke ein. – »Ich halte es für ganz verkehrt, Ihre Elektrizität und mehr dergleichen Geschichten in Ihren Boden hinein zu praktizieren und einen Salon aus ihrem Kuhstall zu machen. Ich tue so etwas nicht. Ich habe mich seiner Zeit selbst sehr viel mit der Wissenschaft beschäftigt, aber ich habe eingesehen, dass die Sache nicht geht. Wenn man einmal mit dem Experimentieren anfängt, so ist gar kein Ende abzusehen. Nein, nein, achten Sie nur darauf, dass Ihre Gutsleute Ihr Stroh nicht verkaufen und was dergleichen mehr ist; und geben Sie ihnen Drainier-Röhren10, wissen Sie. Aber mit Ihrer Musterwirtschaft ist es nichts, das ist das teuerste Spielzeug, das Sie sich anschaffen können; dafür können Sie sich eine Meute Hunde halten.«
»Es ist aber doch sicherlich besser«, bemerkte Dorothea, »Geld für Versuche auszugeben, die man anstellt, um zu erproben, wie die Menschen den Boden, der sie alle ernährt, am ergiebigsten machen können, als für Hunde und Pferde, die diesen Boden nur zerstampfen. Es ist keine Sünde, sich bei der Anstellung von Versuchen zum Wohle aller arm zu machen.«
Sie drückte sich energischer aus, als man es von einer so jungen Dame erwartet haben würde, aber Sir James hatte sich ja direkt an sie gewendet. Er tat das gewöhnlich, und sie hatte schon oft daran gedacht, dass sie ihn zu vielen guten Handlungen würde bewegen können, wenn er erst ihr Schwager wäre.
Herr Casaubon heftete seine Blicke sehr fest auf Dorothea, während sie sprach, und schien sie aufs Neue zu beobachten.
»Junge Damen verstehen nichts von Nationalökonomie, wissen Sie«, sagte Herr Brooke, indem er Herrn Casaubon zulächelte. »Ich erinnere mich noch sehr wohl der Zeit, wo wir alle Adam Smith lasen, das ist ein Buch! Ich nahm seiner Zeit alle die neuen Ideen in mich auf, die menschliche Vervollkommnungsfähigkeit, wissen Sie. Aber einige behaupten, dass die Geschichte einen Kreislauf beschreibe, eine Behauptung, für welche sich gewiss sehr viel sagen lässt. Ich habe mich selbst zu dieser Ansicht bekannt. Die menschliche Vernunft lässt uns wirklich gar zu leicht über das Ziel schießen, wirklich gar zu leicht. Ich habe mich auch seiner Zeit zu weit von ihr hinreißen lassen, aber ich sah ein, dass es damit nicht geht, ich zog die Zügel noch rechtzeitig an, aber nicht zu heftig. Ich bin immer ein Freund von ein wenig Theorie gewesen. Wir können die Ideen nicht entbehren, sonst würden wir uns bald wieder in die finsteren Zeitalter zurückversetzt sehen. Aber da wir einmal von Büchern reden. Da ist Southey’s ›Krieg in Spanien‹. Ich lese das des Morgens. Kennen Sie Southey?«
»Nein«, antwortete Herr Casaubon, welcher mit Herrn Brooke’s sprudelndem Vortrag nicht Schritt zu halten vermochte und nur an das Buch dachte. »Es fehlt mir gerade jetzt an Muße für die Lektüre derartiger Bücher. Ich habe meine Augen letzthin bei der Entzifferung von alten Lettern sehr anstrengen müssen und suche jetzt einen Vorleser für die Abende, aber ich habe ein sehr empfindliches Ohr und würde es nicht ertragen können, mir mangelhaft vorlesen zu lassen. Das ist in mehr als einer Beziehung ein Unglück für mich; es macht auch, dass ich zu viel grüble und mich zu viel mit der Vergangenheit beschäftige. Mein Geist gleicht gewissermaßen dem abgestorbenen Geist eines Alten, der die Welt durchwandert und sie trotz aller Ruinen und verwirrenden Veränderungen zu rekonstruieren sucht, wie sie einstmals war. – Aber ich bin auf die äußerste Schonung meiner Sehkraft angewiesen.«
Es war das erste Mal, dass Herr Casaubon sich etwas ausführlicher ausgesprochen hatte. Er drückte sich mit großer Präzision aus, wie wenn er aufgefordert wäre, öffentlich etwas zu konstatieren; seine wohlerwogene monotone Redeweise, welche er mit einer gleichmäßigen Kopfbewegung begleitete, frappierte um so mehr, als sie den schärfsten Gegensatz zu der unordentlich abspringenden Manier des guten Herrn Brooke bildete. Dorothea dachte bei sich, Herr Casaubon sei der interessanteste Mann, der ihr noch je vorgekommen, selbst Herrn Liret, einen Waadtländischen Geistlichen, welcher in Lausanne Vorlesungen über die Waldenser gehalten hatte, nicht ausgenommen. Eine vergangene Welt im Hinblick auf die höchsten Zwecke der Wahrheit zu rekonstruieren – das war eine Arbeit, bei welcher zugegen und, – wäre es auch nur durch das Halten der Lampe – behilflich sein zu dürfen, des höchsten Preises wert erschien.
Dieser erhebende Gedanke brachte sie auch über den Verdruss hinweg, den es ihr bereitete, mit ihrer Unwissenheit in der Nationalökonomie, dieser unergründlichen Wissenschaft, welche wie ein Auslöscher auf ihr ganzes geistiges Bewusstsein wirkte, geneckt zu werden.
»Sie reiten gern, Fräulein Brooke«, sagte Sir James gleich darauf, bei einer sich darbietenden Gelegenheit. »Ich hatte gehofft, Sie würden auch an dem Vergnügen der Jagd Geschmack finden. Wollen Sie mir nicht erlauben, Ihnen meinen Braunen zu schicken, um ihn einmal zu versuchen? Er ist darauf trainiert, von Damen geritten zu werden. Vorigen Sonnabend sah ich Sie die Anhöhe auf einem Gaul hinanreiten, der Ihrer nicht würdig war. Mein Reitknecht kann Ihnen den Corydon jeden Tag herbringen, wenn Sie nur die Güte haben wollen, die Zeit zu bestimmen.«
»Ich danke Ihnen, Sie sind sehr gütig. Aber ich will das Reiten ganz aufgeben. Ich will gar nicht mehr reiten«, erwiderte Dorothea, die sich zu diesem brüsken Entschluss durch einen kleinen Verdruss darüber gedrängt fühlte, dass Sir James es versuchte, ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, während sie dieselbe ganz Herrn Casaubon zuzuwenden wünschte.
»Nein, das wäre zu hart«, entgegnete Sir James in einem Ton des Vorwurfs, der von einem lebhaften Interesse zeugte. »Ihre Schwester gefällt sich in Selbstquälerei, nicht wahr?« fuhr er fort, indem er sich an Celia wandte, welche an seiner rechten Seite saß.
»Ich glaube ja«, antwortete Celia, mit allerliebstem Erröten ängstlich besorgt, nichts zu sagen, was ihrer Schwester nicht angenehm sein möchte. »Sie liebt es, Dinge aufzugeben.«
»Wenn das wahr wäre, Celia, so wäre ja mein Aufgeben eine Nachgiebigkeit gegen mich selbst und keine Selbstquälerei. Aber es kann sehr gute Gründe geben, sich zu entschließen, etwas sehr Angenehmes nicht zu tun«, sagte Dorothea.
Zu gleicher Zeit sprach auch Herr Brooke; aber Herr Casaubon war augenscheinlich ganz in die Beobachtung Dorotheen’s vertieft, was dieser keineswegs entging.
»Vollkommen richtig«, erwiderte Sir James auf die letzte, Bemerkung Dorotheen’s. »Sie geben die Dinge aus edlen und großen Motiven auf.«
»Nein, das ist doch nicht ganz richtig. Das habe ich keineswegs von mir behauptet«, entgegnete Dorothea errötend.
Anders als Celia errötete sie nur selten und nur, wenn sie entzückt oder zornig war. In diesem Augenblick war sie entrüstet über Sir James’ zudringliche Verbindlichkeit. Warum machte er nicht Celien den Hof und ließ sie in Ruhe Herrn Casaubon zuhören? – Wenn dieser gelehrte Mann nur selbst reden wollte, anstatt sich von ihrem Onkel etwas vorreden zu lassen, der ihm eben jetzt auseinander setzte, dass man sich bei dem Wort ›Reformation‹ etwas oder nichts zu denken habe, dass er selbst zwar mit Leib und Seele Protestant, dass aber der Katholizismus eine Tatsache sei und dass, wenn es sich frage, ob jemand Recht tue, einen Acker seines Landes für eine römisch-katholische Kapelle zu verweigern, man bedenken müsse, dass alle Menschen des Zügels der Religion, welche genau genommen die Furcht vor dem Jenseits bedeute, bedürften.
»Ich habe mich auch einmal sehr ernst mit Theologie beschäftigt«, sagte Herr Brooke, wie wenn er sich über den Erwerb der eben kundgegebenen tiefen Einsicht von dem Wesen der Religion, ausweisen wollte. »Ich bin so ziemlich über die Lehren aller theologischen Schulen unterrichtet. Ich habe Wilberforce11 in seiner besten Zeit gekannt. Kennen Sie Wilberforce?«
Herr Casaubon verneinte die Frage.
»Nun Wilberforce war vielleicht kein großer Denker, aber wenn ich je in’s Parlament eintreten sollte, wie ich es zu tun gebeten worden bin, würde ich, wie Wilberforce es seinerzeit tat, meinen Platz auf der Seite der Unabhängigen einnehmen und für philanthropische Zwecke wirken.«
Herr Casaubon verneigte sich zustimmend und bemerkte, das sei ein sehr weites Gebiet.
»Gewiss«, erwiderte Herr Brooke, behaglich lächelnd, »aber ich kann mich auf Dokumente stützen. Seit Jahren habe ich mir eine Sammlung von Dokumenten angelegt – Sie müssen nur noch geordnet werden. – So oft mich eine Frage frappiert hat, habe ich deswegen an jemanden geschrieben und immer eine Auskunft erhalten; ich kann mich also auf Dokumente stützen; aber sagen Sie mir doch, wie ordnen Sie Ihre Dokumente?«
»Teilweise in Fächern«, erwiderte Herr Casaubon mit einem mühsam unterdrückten Ausdruck der Verwunderung.
»Ach, mit Fächern geht es nicht. Ich habe es mit Fächern versucht; aber in Fächern kommt alles durcheinander. Ich weiß nie, ob ein Papier in Fach [X] oder in Fach Z liegt.«
»Ich wollte, Du ließest mich Deine Papiere für Dich ordnen, Onkel«, sagte Dorothea. »Ich würde sie alle mit Buchstaben versehen, und dann ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der in den Papieren behandelten Gegenstände anlegen.«
Herr Casaubon gab durch ein feierliches Lächeln seine Zustimmung zu erkennen und sagte zu Herrn Brooke: »Sie sehen, Sie haben einen vortrefflichen Sekretär zu Ihrer Verfügung.«
»Nein, nein«, entgegnete Herr Brooke kopfschüttelnd, »ich kann junge Mädchen nicht über meine Papiere lassen. Junge Mädchen sind zu flüchtig.«
Dorothea fühlte sich verletzt. Musste nicht Herr Casaubon glauben, dass ihr Onkel besondere Gründe zu seiner letzten Äußerung habe, während doch diese Bemerkung unter all den übrigen im Geist des Herrn Brooke abgelagerten Gedankensplittern nicht schwerer wog als ein geknickter Insektenflügel, den ein zufälliger Luftzug gerade ihr zugeführt hätte.
*
Als die beiden jungen Mädchen nach Tische allein im Wohnzimmer saßen, sagte Celia:
»Wie hässlich ist Herr Casaubon.«
»Celia! ich habe kaum je einen Mann mit einem bedeutenderen Gesicht gesehen. Er sieht Locke’s Bild merkwürdig ähnlich.«
»Hatte Locke auch zwei solche mit Haaren besetzte Muttermale?«
»Sehr möglich, für die Augen gewisser Leute«, antwortete Dorothea, indem sie sich abwandte.
»Herr Casaubon hat eine so fahle Gesichtsfarbe.«
»Desto besser. Du bewunderst wohl Männer, welche so rosig aussehen wie ein Mutterschweinchen.«
»Dora«, rief Celia, Dorotheen erstaunt nachsehend, »in meinem Leben habe ich Dich noch keinen solchen Vergleich machen hören.«
»Vermutlich weil ich bis jetzt keine Veranlassung dazu hatte. Der Vergleich ist sehr gut, er passt vortrefflich.«
Offenbar vergaß sich Dorothea in diesem Augenblick und das entging Celia keineswegs.
»Ich begreife nicht, warum Du die Sache persönlich nimmst, Dorothea!«
»Es verstimmt mich, Celia, dass Du menschliche Wesen nur wie angezogene Tiere betrachtest und keinen Sinn für den Ausdruck einer großen Seele im Gesicht eines Mannes hast.«
»Hat Herr Casaubon eine große Seele?« fragte Celia, bei der gelegentlich eine Regung von naiver Malice12zum Vorschein kam.
»Allerdings hat er die, nach meiner Ansicht«, antwortete Dorothea im Ton der vollsten Überzeugung. »Jeder Zug seines Wesens, wie es mir erscheint, entspricht dem Bild, welches man sich von dem Verfasser der Schrift über biblische Kosmologie macht.«
»Er spricht sehr wenig«, bemerkte Celia.
»Weil niemand da ist, mit dem er sich unterhalten könnte.«
Celia dachte bei sich: Also von Sir James Chettam denkt Dorothea ganz gering, ich glaube nicht, dass sie einen Antrag von ihm annehmen würde. Celia fand das sehr schade; denn sie hatte sich nie darüber getäuscht, für welche von ihnen Beiden der Baronet sich in Wahrheit interessiere. Bisweilen war es ihr freilich so vorgekommen, als ob Dora einen Mann vielleicht nicht glücklich machen würde, der nicht ihre Art, die Dinge anzusehen, teilte, und im tiefsten Inneren ihres Herzens schlummerte der Gedanke, dass ihre Schwester sich zu ausschließlich in religiösen Ideen bewege, um für das Familienleben gemacht zu sein. Religiöse Ideen und Gewissensskrupel erschienen ihr wie verschüttete Nadeln, aus Furcht vor welchen man sich scheut, auf den Fußboden zu treten, sich niederzusetzen und selbst zu essen.
Als die Herren sich zum Tee wieder zu den Damen gesellten, setzte sich Sir James, welcher Dorotheen’s Art, ihm zu antworten, durchaus nicht als verletzend empfunden hatte, zu ihr. Warum sollte er auch. Er schmeichelte sich mit der Hoffnung, dass Dorothea ihn gern habe, und wenn wir jemandem eine vorgefasste, sei es günstige oder ungünstige Meinung, entgegenbringen, so muss das Benehmen desselben schon sehr prononciert sein, wenn unsre Meinung in dem einen oder dem andern Sinn dadurch erschüttert werden soll. Er fand sie durchaus liebenswürdig gegen ihn; aber natürlich sah er sich doch veranlasst, über seine Neigung ein wenig nachzudenken.
Er war eine durchaus gesunde Natur und hatte die seltene Eigenschaft der Selbsterkenntnis. Er war sich vollkommen bewusst, dass er mit seinen Talenten, auch wenn er sie zur vollsten Geltung bringen könnte, nichts in der Welt ausrichten würde. Daher lächelte ihm die Aussicht auf den Besitz einer Frau, zu der er sagen könnte: »Was sollen wir in dieser oder jener Angelegenheit tun«, welche ihrem Mann mit Argumenten aushelfen und diesen Argumenten durch ihr Vermögen den gehörigen Nachdruck geben könnte.
Was das von den Leuten gegen Dorothea erhobene Bedenken religiöser Exzentrizität betraf, so hatte er eine sehr vage Vorstellung von dem Wesen dieser Exzentrizität und hielt dafür, dass dieselbe sich in der Ehe ganz verlieren würde. Kurz, er glaubte sich sagen zu dürfen, dass der Gegenstand seiner Neigung ganz für ihn gemacht sei, und war vollkommen darauf gefasst, sich in der Ehe von seiner Frau ein gut Teil Herrschaft gefallen zu lassen, die ja ein Mann doch am Ende jederzeit wieder abschütteln könne.
Aber es schien Sir James völlig unmöglich, dass er je in den Fall kommen könnte, sich der Herrschaft dieses schönen jungen Mädchens, dessen Geist ihn entzückte, entziehen zu wollen. Warum auch? Der Geist eines Mannes, mag er übrigens beschaffen sein, wie er will, hat doch immer den Vorzug, männlich zu sein, – wie die kleinste Birke immer einer höheren Gattung angehört als eine noch so hoch in die Lüfte strebende Palme, – und selbst seine Unwissenheit hat doch immer etwas Gesünderes.
Sir James würde vielleicht nicht von selbst auf diese Würdigung seiner Persönlichkeit gekommen sein, aber die gütige Vorsehung versieht auch die Schwächsten an Geist mit einem kleinen Halt in Gestalt von überkommenen Vorstellungen.
»Ich darf doch wohl hoffen, Fräulein Brooke«, sagte ihr beharrlicher Bewunderer, »dass Ihr Entschluss in Betreff des Pferdes nicht unwiderruflich ist. Ich versichre Sie, Reiten ist die gesündeste Körperbewegung.«
»Das weiß ich«, erwiderte Dorothea kalt. »Ich glaube, es würde für Celia sehr gut sein.«
»Aber Sie sind eine so vorzügliche Reiterin.«
»O nein, ich habe sehr wenig Übung gehabt und Ihr Pferd würde mich sehr leicht abwerfen.«
»Das wäre ja nur ein Grund mehr für Sie, sich zu üben. Jede Dame sollte eine perfekte Reiterin sein, um ihren Mann auf seinen Ausflügen zu Pferde begleiten zu können.«
»Sehen Sie nur, wie weit unsere Ansichten auseinandergehen, Sir James. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es sich für mich nicht schicken würde, eine perfekte Reiterin zu sein, und so würde ich Ihrem Muster einer Dame niemals entsprechen können.«
Dorothea sagte das, indem sie gerade vor sich hinblickte, in einem kalten schroffen Ton und sah dabei in ergötzlichem Kontrast zu der beflissenen Liebenswürdigkeit ihres Bewunderers wie ein trotziger Junge aus.
»Ich möchte wohl Ihre Gründe für diesen grausamen Entschluss kennen. Unmöglich können Sie doch das Reiten für etwas Unrechtes halten.«
»Es ist gar nicht unmöglich, dass ich es für mich als etwas Unrechtes betrachte.«
»Warum denn das?« fragte Sir James in einem zärtlich vorwurfsvollem Ton.
Inzwischen war Herr Casaubon, seine Teetasse in der Hand haltend, an den Tisch herangetreten und hörte dem Gespräch zu. »Wir dürfen den Motiven von Handlungen nicht zu neugierig nachforschen«, bemerkte er jetzt in seiner gemessenen Weise. »Fräulein Dorothea weiß, dass Motive leicht schwach erscheinen, wenn sie ausgesprochen werden: ihr Duft vermengt sich dann mit der gröberen Luft. Wir müssen daher den Keim unserer Handlungen sorgfältig vor dem Licht der Außenwelt schützen.«
Dorothea errötete vor Vergnügen und blickte dankbar zu Herrn Casaubon auf. Das war ein Mann, der ein höheres inneres Leben zu verstehen im Stande war und mit welchem ein geistiger Verkehr möglich erschien, ja ein Mann, welchem das reichste Wissen zur Unterstützung seiner Prinzipien zu Gebote stand, – ein Mann, dessen Wissen so umfassend war, dass es ihm fast für alles, was er glaubte, die Beweise an die Hand gab. Dorotheen’s Schlüsse mögen gewagt erscheinen, aber ohne diese Kühnheit der Schlussfolgerungen, welche das Eingehen von Ehen in den verwickelten Verhältnissen der Zivilisation so sehr erleichtert haben, würde das Leben zu allen Zeiten gestockt haben.
»Gewiss«, stimmte der gute Sir James bei. »Ich will Fräulein Dorothea nicht drängen, ihre Gründe anzugeben, sie zieht es vor, dieselben zu verschweigen. Ich bin überzeugt, sie würden ihr, wenn sie sie ausspräche, nur zur Ehre gereichen.«
Er war durchaus nicht eifersüchtig auf das Interesse, mit welchem Dorothea zu Herrn Casaubon aufgeblickt hatte, es kam ihm nicht in den Sinn, dass ein Mädchen, welchem er seine Hand anzubieten dachte, ein anderes Interesse an einem etwa fünfzigjährigen vertrockneten Bücherwurm nehmen könne, als das einer Art frommer Hochachtung für einen ausgezeichneten Geistlichen.
Als sich indessen Fräulein Dorothea in eine Unterhaltung über die Geistlichkeit des Waadtlandes mit Herrn Casaubon vertieft hatte, zog Sir James es vor, sich zu Celia zu begeben und sich nun mit dieser über ihre Schwester zu unterhalten; er sprach von einem Haus in London und fragte Celia, ob Dorothea etwas gegen London habe. Von ihrer Schwester entfernt, sprach Celia ganz zwanglos, und Sir James dachte bei sich, das zweite Fräulein Brooke sei doch ein ebenso angenehmes wie hübsches Mädchen, wenn auch nicht, wie einige Leute behaupteten, gescheiter und verständiger als ihre ältere Schwester. Er war überzeugt, die in jeder Beziehung bedeutendere von beiden Schwestern gewählt zu haben, und welcher Mann wäre nicht darauf bedacht, sich die Beste zu sichern.
Kapitel 3
Say, goddess, what ensued, when Raphael,The affable archangel ... EveThe story heard attentive, and was filledWith admiration, and deep muse, to hearOf things so high and strange.(Milton: Paradise Lost)
Wenn Herr Casaubon wirklich an Dorothea als an eine für ihn passende Frau dachte, so kam ihm bei dieser eine Geneigtheit entgegen, deren Motive schon ursprünglich in ihrer Seele wurzelten, und am nächsten Tag hatte diese Geneigtheit bereits Knospen und Blüten getrieben. Denn am Morgen dieses Tages hatten sie eine lange Unterhaltung miteinander gehabt, während Celia, welche die Gesellschaft des Herrn Casaubon mit seinen Muttermalen und seiner fahlen Gesichtsfarbe nicht liebte, nach dem Pfarrhaus entflohen war, um dort mit den schlecht beschuhten, aber lustigen Kindern des Pfarrers zu spielen.
Dorothea hatte bei dieser Gelegenheit einen tiefen Blick in den unergründlichen Geistesquell des Herrn Casaubon getan und hatte dort in unendlich gesteigertem Maß jede Eigenschaft widergespiegelt gefunden, welche sie selbst mitbrachte; sie hatte ihm viel von ihren eigenen inneren Erfahrungen mitgeteilt und hatte sich von ihm den Zweck seines großen Werkes, welches von einer für sie unendlich anziehenden labyrinthischen Ausdehnung war, erklären lassen.
Denn er war dabei so instruktiv gewesen wie Miltons ›leutseliger Erzengel‹ und hatte ihr in einer des Erzengels nicht unwürdigen Weise mitgeteilt, wie er zu zeigen unternommen habe, – was freilich schon vor ihm nachzuweisen unternommen worden sei, aber nicht mit der Gründlichkeit und Korrektheit der Vergleiche und der Klarheit der Darstellung, welche er anstrebe –, dass alle mythischen Systeme oder vereinzelten mythischen Fragmente der Welt, korrumpierte Traditionen einer ursprünglich geoffenbarten Idee seien. Nachdem er einmal den richtigen Standpunkt gewonnen und festen Fuß auf demselben gefasst habe, sei ihm das weite Gebiet mythischer Konstruktionen verständlich, ja, durch das von analogen Erscheinungen auf sie fallende Licht vollkommen klar geworden.
Aber die richtige Auswahl aus dieser großen Ernte der Wahrheit zu treffen, sei keine leichte und rasch zu bewältigende Arbeit. Schon seine Notizen füllten eine ganze Reihe von Bänden; aber die eigentliche Aufgabe werde nun darin bestehen, diese massenhaften, noch immer im Wachsen begriffenen Resultate seiner Studien derartig zusammenzudrängen, dass sie auf einem kleinen Bücherbrett Platz finden würden.
Bei dieser Erklärung, welche er Dorothea gab, drückte sich Herr Casaubon fast so gelehrt aus, wie er es einem Fachgenossen gegenüber getan haben würde; ihm stand eben nur eine Ausdrucksweise zu Gebot. Allerdings verfehlte er nicht, so oft in seinem Vortrag ein lateinisches oder griechisches Zitat vorkam, mit der gewissenhaftesten Sorgfalt die Übersetzung hinzuzufügen; das würde er aber wahrscheinlich auch jedem anderen Hörer gegenüber getan haben. Ein gelehrter Provinzialgeistlicher ist gewohnt, sich seine Bekannten ›als Lords, Ritter und andere edle und würdige Männer‹, die des Lateinischen nur wenig kundig sind, zu denken.
Dorothea war von der Tiefe und Weite dieser Konzeption ganz hingenommen. Das war doch etwas Anderes als die Seichtigkeiten einer für die Lektüre junger Mädchen berechneten Literatur. Hier stand ein neuer Bossuet13 vor ihr, dessen Werk gründliche Gelehrsamkeit mit inniger Frömmigkeit in Einklang bringen würde, ein moderner Augustinus, welcher die Ruhmeskränze eines Gelehrten und eines Heiligen auf seinem Haupt vereinigte.
Die Heiligkeit schien bei ihm nicht weniger klar erkennbar als die Gelehrsamkeit, denn als Dorothea sich gedrängt fühlte, sich gegen ihn über gewisse Themata auszusprechen, über welche sie mit niemandem in Tipton reden konnte, namentlich über die untergeordnete Bedeutung kirchlicher Formen und Glaubensartikel im Vergleich zu jener Religion der Seele, jener Versenkung des Ich’s in die Gemeinschaft mit der göttlichen Vollkommenheit, deren Ausdruck sie in den besten christlichen Büchern der verschiedensten Zeiten enthalten glaubte, – fand sie in Herrn Casaubon einen Zuhörer, der sie sofort begriff, der sie versicherte, dass er selbst mit dieser Ansicht, sofern sie nur durch eine weise Annäherung an die Kirche moderiert erscheine, übereinstimme, und ihr historische Belege anführen konnte, die ihr bisher unbekannt gewesen waren.
»Er denkt wie ich«, sagte Dorothea sich, »oder vielmehr er lebt in einer ganzen Welt von Gedanken, die sich in meinen Gedanken nur wie in einem elenden Taschenspiegel widerspiegeln. Und auch seine Gefühle, seine ganze Erfahrung – sind sie nicht ein See im Vergleich mit meinem kleinen Teich?«
Dorothea war mit ihren Folgerungen aus Worten und Stimmungen anderer nicht weniger rasch bei der Hand als andere junge Mädchen ihres Alters. Symptome sind kleine messbare Dinge; die Deutung aber ist unbegrenzt, und bei Mädchen von zärtlichem und feurigem Naturell ist jedes Symptom geeignet, eine Welt von Wunder, Hoffnung und Glauben heraufzubeschwören, in welcher ein Fingerhut voll Wissen die ganze Substanz bildet. Nicht immer sind sie dabei allzu gröblichen Täuschungen ausgesetzt; denn Sindbad selbst kann durch einen glücklichen Zufall auf eine richtige Beschreibung verfallen, und falsches Räsonnement führt arme Sterbliche bisweilen zu richtigen Schlüssen; wenn wir auch weit vom richtigen Ausgangspunkt anfangen und uns in Sprüngen oder im Zickzack fortbewegen, gelingt es uns doch bisweilen, am richtigen Ziel anzulangen.
Wenn Dorothea in ihrem unbedingten Vertrauen zu rasch zu Werke ging, so ist damit noch keineswegs gesagt, dass Herr Casaubon dieses Vertrauens unwürdig war. Es bedurfte, um ihn zu bewegen, etwas länger auf ›Tipton-Hof‹ zu verweilen, als er beabsichtigt hatte, nur einer freundlichen Aufforderung des Herrn Brooke, der ihm als Lockung nichts anderes zu bieten hatte, als seine Dokumente über das Treiben der Arbeiter, über das Zerstören von Maschinen oder das Verbrennen von Heuschobern. Herr Brooke forderte Herrn Casaubon auf, sich diese auf einem Haufen liegenden Dokumente in der Bibliothek anzusehen. Hier nahm sein Wirt bald das eine, bald das andere derselben zur Hand, um es in seiner abspringenden und unruhigen Weise, mit welcher er von einem unvollendeten Satz zu einem andern mit einem »Ja!« – »Und nun!« – »Aber hier!« übersprang, vorzulesen, bis er die Dokumente schließlich alle beiseite schob, um das Tagebuch seiner in der Jugend auf dem Kontinent gemachten Reisen zu öffnen.
»Sehen Sie, hier ist alles über Griechenland. Rhamnos, die Ruinen von Rhamnos, Sie sind ja ein großer Grieche. Ich weiß nicht, ob Sie sich auch viel mit der griechischen Topographie beschäftigt haben. Ich habe eine unendliche Zeit auf das Studium dieser Dinge verwandt. Da ist z. B. der Helikon. Sehen Sie hier! – am nächsten Morgen brachen wir nach dem Parnassos auf – dem Parnassos mit dem verteufelt spitzen Gipfel! Dieser ganze Band, wissen Sie, behandelt Griechenland.«
Dabei hielt Herr Brooke das Buch vor sich und fuhr mit dem Rücken des Daumens über den Rand desselben hin.
Herr Casaubon gab eine würdige, wiewohl etwas melancholische Zuhörerschaft ab; bei geeigneten Stellen verneigte er sich und vermied es so viel wie möglich, irgendetwas, das einem Dokument ähnlich sah, anzusehen, hütete sich jedoch, durch irgendein Zeichen Nichtachtung oder Ungeduld zu verraten; denn er bedachte wohl, dass die Oberflächlichkeit des Herrn Brooke mit den Institutionen des Landes zusammenhänge, und dass der Mann, der ihm diese geistige Marter bereite, nicht allein ein liebenswürdiger Wirt, sondern auch ein Gutsbesitzer und Archivar der Friedensgerichts-Protokolle sei.
Fühlte er sich in seinem geduldigen Ausharren auch durch die Erwägung bestärkt, dass Herr Brooke Dorotheen’s Onkel sei? Augenscheinlich war er mehr und mehr darauf bedacht, sie zum Reden zu bringen, sich, wie Celia beobachtete, mit ihr allein zu unterhalten. Wenn er sie ansah, überflog sein Gesicht oft ein Lächeln, das dem Sonnenschein eines kalten Wintertages glich.
Bevor er am nächsten Morgen Tipton verließ, benutzte er noch einen angenehmen Spaziergang mit Dorothea längs der mit Kies bedeckten Terrasse dazu, ihr zu sagen, dass er sehr unter seiner Einsamkeit leide und das Bedürfnis der heiteren Gesellschaft, mit welcher die Jugend auf die ernsten Arbeiten des reiferen Alters belebend und anregend wirke, sehr lebhaft empfinde; und er entledigte sich dieser Angaben mit einer so sorgfältigen Präzision des Ausdrucks, als wenn es sich um einen diplomatischen Auftrag gehandelt hätte, bei welchem jedes Wort von entscheidendem Gewicht gewesen wäre.
In der Tat war Herr Casaubon nicht gewohnt, seine Mitteilungen praktischer oder persönlicher Natur zu wiederholen oder nochmals in Betracht zu ziehen. Wenn er am 2. Oktober wohlüberlegter Weise gewisse Neigungen ausgesprochen hatte, so würde er es später für genügend halten, an diese Kundgebung durch Erwähnung des Datums zu erinnern; da er auch bei anderen sein eigenes Gedächtnis voraussetzte, das einem umfangreichen Buch glich, in welchem ein ›Siehe Oben‹ statt aller Wiederholung dienen kann, und nicht einem viel benutzten Löschbuch, das nur die Spuren vergessener Schriftzüge aufbewahrt. Aber im vorliegenden Fall war Herrn Casaubon’s Zuversicht kaum in Gefahr, getäuscht zu werden; denn Dorothea nahm alles, was er sagte, mit dem Eifer einer frischen jungen Natur in sich auf, für welche jede neue Erfahrung eine Lebensepoche bildet.
*
Es war drei Uhr Nachmittags an einem schönen frischen Herbsttag, als Herr Casaubon nach seinem nur eine Stunde von Tipton entfernten Pfarrhaus in Lowick abfuhr, während Dorothea mit Hut und Shawl längs der Gebüschwege und durch den Park dahineilte, um sich in dem Grenzwäldchen ohne andere sichtbare Gesellschaft als die Monk’s, des großen St. Bernhard-Hundes, welcher die jungen Damen auf ihren Spaziergängen immer behütete, zu ergehen. Vor ihr war die Vision einer Verwirklichung des Traumes aller Mädchen von einer möglichen Zukunft aufgestiegen; dieser Zukunft blickte sie mit hoffnungsvollem Zittern entgegen, und sie fühlte das Bedürfnis, noch ferner ungestört in dieser Vision zu verweilen. Munter schritt sie in der frischen Luft dahin, ihre Wangen färbten sich höher, und ihr Strohhut – den wir heutzutage mit neugierig prüfenden Blicken wie eine veraltete Form eines Korbes betrachtet haben würden – fiel ihr ein wenig in den Nacken.
Als charakteristisch für ihre Erscheinung dürfen wie nicht unerwähnt lassen, dass sie ihr braunes Haar schlicht geflochten und im Nacken aufgesteckt trug, so dass die Umrisse ihres Kopfes scharf hervortraten, und das zu einer Zeit, wo die allgemein herrschende Ansicht eine Verhüllung der Magerkeit der Natur durch hohe Barrikaden, gekräuselte Locken und Haarschleifen, wie sie von keinem großen Volk außer vielleicht von den Bewohnern der Fidji-Inseln überboten worden sind, gebieterisch erheischte. Das war ein Zug von Dorotheen’s asketischer Natur. In ihren lebhaften hellen Augen aber lag nichts von asketischem Ausdruck, als sie vor sich hinblickend die feierliche Pracht des Herbstnachmittages mit seinen langen Lichtstreifen zwischen den in der Ferne sichtbaren Reihen von Linden, nicht eigentlich mit Bewusstsein sah, aber als Element ihrer gehobenen Stimmung in die Tiefe ihrer Seele aufnahm.
Alle Leute jung oder alt (d. h. alle Leute in jenen Tagen vor der Reform14) würden sie als einen des Interesses würdigen Gegenstand betrachtet haben, wenn sie geglaubt hätten, die Glut ihrer Augen und Wangen auf die regelmäßig bei jeder jungen Liebe erwachenden Vorstellungen zurückführen zu dürfen. Die Illusionen, denen sich Chloe in ihrer Liebe zu Strephon15