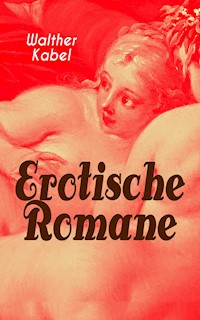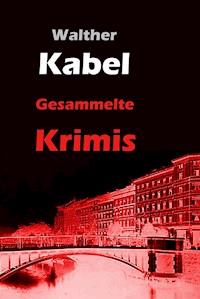
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ideenbrücke Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Krimi-Spezialist Kabel erwarb sich in den 920ern den Ruf eines deutschen Edgar Wallace. Lange war er einer der meistgelesenen deutschen Autoren, bis er von den Nazis mit einem Publikationsverbot belegt wurde. Kabel schrieb auch unter anderen Namen. Inhalt: Das graue Gespenst Das Geheimnis eines Lebens Das Dogmoore-Wappen Der Schlingensteller Der Ring der Borgia Spuren im Neuschnee Der hüpfende Teufel Der Tempel der Liebe Das Haus am Mühlengraben Die Liebespost Das Gift des Vergessens Im Schatten der Schuld Der Universal-Erbe Die Stimme des Blutes Das Haus des Hasses Die blaue Königin Der Doppelgänger Der Kobrakopf Der Obstkahn am Elisabethufer Der Stein der Wangerows Der Tote in der Burgruine Die Antenne im fünften Stock Irrende Seelen Kursfürstendamm Nummer 304 Das stille Haus Die Hand des Toten Der tote Missionar Harald Harst Krimis: Zwei Taschentücher Das Geheimnis des Czentowo-Sees Die Rätselbrücke Die Rose von Rondebosch Der Piratenschoner Der Spangenschuh der Lady Broog Das Geheimnis der Kabine 24 Die Steinhütte am Buarbrä Das Rätsel der Trollhätta-Insel Der Obstkahn am Elisabeth-Ufer Der Wolfshund des Herrn Krabarty Die Motorjacht ohne Namen Die Insel der Seligen Die große Null Der Sultan von Padagoa Der Fakir ohne Arme Das Kranichnest Das Kreuz auf der Stirn Der Spiritistenklub Die drei Päckchen Der rätselhafte Gast Lydia Salnavoors Testament Dämon Rache Die schwarzen Katzen Der neue Graf von Monte Christo Das Eiland der Toten Wie Doktor Amalgi starb Die Millionenerbin Doktor Amalgis Vermächtnis Timitri, das Leichenschiff Robbenfang Fürst Spinatri Die Geheimnisse der Prinz Albert-Berge Pension Dr. Buckmüller Vier Tote Moderne Verbrecher Dämon Chanawutu Wer?! Salon Geisterberg Die Talmifabrik Das Tor des Todes Ein Glaubensfanatiker Der Stern von Kabinur Der alte Gobelin Banditen des Olymp Der weiße Maulwurf Das alte Fräulein Födösy Die weiße Schlange Allan Garps letzte Stunde ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 8266
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Krimis: Mehr als 100 Kriminalromane und Detektivgeschichten in einem E- Buch
Das Katzenpalais / Das graue Gespenst / Das Haus am Mühlengraben / Die Liebespost / Der Ring der Borgia / Der Doppelgänger / Irrende Seelen / Die Rätselbrücke / Der Piratenschoner und viele mehr
Inhaltsverzeichnis
Kriminalromane
Das graue Gespenst
1. Kapitel Der Basuto-Speer
Über Kimberley, der südafrikanischen Minenstadt, lagerte die Gluthitze eines sonnenklaren Maitages. Trotzdem drängte sich jetzt in der Mittagsstunde ein lebhafter Verkehr von ausgesprochen internationalem Gepräge durch die breiten Straßen, alle begriffen auf der Jagd nach dem Götzen Gold, der nirgends so sehr wie gerade in der »Diamantenstadt« die Gemüter erregt und Geist und Körper zu den unerhörtesten Anstrengungen anspornt.
Vor dem hochragenden Börsenbau herrschte heute eine ungewöhnliche Aufregung unter den Herren, die teils in der breiten Eingangstür, teils auf der Freitreppe standen.
Auf der anderen Straßenseite, gegenüber der Börse, stand eine dichtgedrängte Menge Neugieriger, – meist Minenarbeiter, Handwerker und hier und da auch ein Farbiger. Etwas wie Schadenfreude war in den Gesichtern dieser einfachen Leute zu lesen, und wenn man genau hinhörte, konnte man Ausrufe verstehen, die von einem geheimen Hasse gegen die Großkaufleute sprachen.
Zwischen den über den Fahrdamm hin und her rasselnden Wagen aller Art schlüpften kleine, halbnackte Kerlchen hindurch – Zeitungsjungen, die ihre Extrablätter hinausbrüllten.
»Die Zerstörung der Hurley-Mine!« – »Kampf mit der Miliz!« – »Achtzig Tote, zweiundfünfzig Verwundete!« – »Kauft das Allerneueste – kauft –«
An der Brüstung der Börsentreppe lehnte einsam ein Mann, dessen blaue Augen mit verächtlichem Ausdruck auf die Menge gerichtet waren, die mit schadenfrohen Gesichtern auf die erregten, geängstigten Großkaufleute blickte und oft ihre höhnischen Bemerkungen hinüberrief.
Ein dicker, aufgeschwemmter Herr, dessen Finger mit blitzenden Ringen besteckt waren, gesellte sich jetzt zu dem Einsamen, der offenbar unter all diesen Millionen-Magnaten eine hochgeachtete Stellung einnahm.
»Master Wendel, ich begreife Ihre Ruhe nicht,« sagte er, sich vor dem blonden Deutschen aufpflanzend. »Ihre Mine liegt zunächst dem Randbache, und schreitet die schwarze Bande zum Angriff, so wird Ihr Werk als das erste vom Erdboden verschwinden.«
»Meinen Sie, Brauwarey?!«
Selbstbewußter Spott lag in dieser Antwort.
Der dicke Brauwarey, der bisher selbst gegen viertausend Neger beschäftigt hatte, starrte Wendel aus seinen glasigen Fischaugen staunend an.
Kopfschüttelnd sagte er: »Wirklich, ich begreife Sie nicht –« Er wollte noch mehr hinzufügen, aber der Deutsche, ein stattlicher Mann Anfang der fünfziger, hatte sich aufgerichtet und schaute einem eleganten Auto entgegen, das sich eben durch die Straße wand und vor der Börse Halt machte.
Dem Auto entstieg jetzt eilig ein schlanker Mann mit sonnverbranntem Gesicht. Es war der erste Buchhalter der Barbu-Mine, die Wendel seit einigen zwanzig Jahren gehörte.
»Pelletan – hierher!« rief der Deutsche mit dröhnender Stimme.
Pelletan keuchte die Treppe empor.
»Master Wendel – die Schwarzen kommen –«
Das genügte. Mit drei Sätzen war Wendel in seinem Auto, Pelletan sprang hinterher, die Tür knallte zu, und fauchend flog das Gefährt davon.
Die Barbu-Mine, deren Baulichkeiten durch einen hohen Holzzaun mit einer Verlängerung von starkem Stacheldraht eingeschlossen wurde, lag etwa zwei Kilometer vor der Stadt auf einer kleinen Anhöhe. Ein fester, gutgehaltener Weg gestattete dem Auto die Höchstgeschwindigkeit einzuschlagen, so daß Wendel in knappen acht Minuten vor dem Haupteingang seines Werkes anlangte. Dort empfing ihn Master Pareawitt, der Oberingenieur, mit einem Gesicht, das nichts Gutes ahnen ließ.
»Wie steht’s, Pareawitt? Alles vorbereitet?!« rief der Deutsche und war mit einem Satz aus dem Wagen. »Was treibt die schwarze Gesellschaft? Schon in der Nähe?«
»Brennen zur Zeit Halburgs Store nieder,« antwortete der Oberingenieur mit verbissener Wut. »Werden aber wohl bald hier sein.«
Wendel winkte und verschwand mit den beiden Männern hinter dem schweren Tor, dessen Flügel der Pförtner sofort wieder schloß.
Zehn Minuten später. Wie ein kribbelndes Ameisenheer, dicht gedrängt, unaufhaltsam, schob sich die Masse der wütenden Neger auf der Straße vorwärts. Der Besitzer der Barbu-Mine beobachtete diese dunkle Masse vom Fenster der ersten Etage des Verwaltungsgebäudes aus wie ein Feldherr. Mit jener zielbewußten Energie, die aus dem armen Handlungsgehilfen im Verlaufe von Jahrzehnten einen einflußreichen, millionenschweren Minen-Magnaten gemacht hatte, waren von ihm noch schnell die getroffenen Verteidigungsmaßnahmen ergänzt worden.
»Bin neugierig, was sie beginnen werden,« sagte er jetzt zu dem neben ihm stehenden Oberingenieur.
Pareawitt lehnte sich zum Fenster hinaus.
»Die Bande verhält sich auffallend still,« meinte er besorgt.
»Schlechtes Zeichen!« erklärte Wendel, und fügte hinzu: »Kein Zweifel, die Hauptmasse bewegt sich auf das Eingangstor zu. Machen wir, daß wir hier fortkommen. Ich werde einmal hinausgehen und der Rotte Vernunft predigen. Hoffentlich hilft’s was. Wenn nicht – na, dann fließt eben Blut, aber nicht das unsrige, so wahr ich Albert Erich Wendel heiße!«
Der blonde Hüne, den Panamahut weit ins Genick geschoben, drückte sich durch den Torspalt und schritt furchtlos der heranrückenden Menschenmauer entgegen. Soweit das Auge reichte, nichts als dunkle Menschenkörper, wollige Negerköpfe. Im Nu bildete sich um Wendel ein weiter Halbkreis bewaffneter Gestalten. Die Hintenstehenden drängten nach, neugierig, was der weiße Baas (Herr) ihnen wohl zu sagen hätte, der jetzt so gebieterisch den Arm ausstreckte. So kam es, daß der Kreis um den deutschen Riesen sich immer enger schloß.
Und nun begann der unerschrockene Millionär mit einer Stimme, die weithin über die glänzenden, schwarzen Gesichter schallte:
»Boys, ich warne Euch! Kehrt an eure Arbeit zurück! Ihr wißt nicht, wie wir euch empfangen werden, wenn ihr wagen solltet, eure unverständliche Wut an unserem Eigentum auszulassen.«
Er sprach in jenem mit holländischen Brocken vermischten Englisch, wie es in Transvaal von jedem Nigger verstanden wird.
»Boys!« fuhr er fort, »wißt ihr, was Maschinengewehre sind?! Ihr habt – oder wenigstens meine Arbeiter – die blanken Kanonen in meinem Schuppen stehen sehen! Bevor auch nur einer von euch meine Umzäunung erklettert hätte, würden hunderte von euch niedergeknallt sein, wie die Springböcke bei der Treibjagd! Boys! Denkt an die Maschinengewehre! Macht kehrt und haltet Frieden! Das rate ich euch wohlmeinend, ich, der weiße Baas, der stets verstanden hat mit seinen Leuten auf friedlichem Fuße zu leben!«
Ein Murren, wie ein Windstoß, der durch Tannenwälder fährt, anzuhören, erhob sich.
»Boys, wenn ihr mir nicht glaubt, schickt eine Zahl von euch in meinen Hof, damit sie sich die blanken, eisernen Menschenfresser ansehen können. Ich will nichts, als –«
Albert Wendel sollte in diesem Leben kein beruhigendes Wort mehr an diese blutdürstige, zur Rachsucht aufgestachelte Masse richten.
Ein Basutospeer mit breiter Spitze war weit hinten aus der Masse von geübter Hand geschleudert worden und fuhr ihm von oben wie ein Blitzstrahl in die Brust. Die Wucht der gut zwei ein halb Meter langen Lanze war so groß, daß er taumelnd hintenüberschlug. Der Hut fiel ihm vom Kopf, rollte seitwärts. Vergebens suchte der riesige Körper sich wieder aufzurichten.
Pareawitt, der Oberingenieur, und drei weiße Angestellte brachten blitzschnell den Schwerverwundete zurück in den Schutz des hohen Zaunes.
»Verfl… heimtückische Bande, das sollt ihr mir bezahlen!« knurrte Pareawitt und rief den Leuten, die bei den Maschinengewehren standen, einige Worte zu.
Man hatte den Baas, dem der Speer sofort aus der Brust gezogen war, auf ein Brett gelegt und trug ihn so nach dem Krankenzimmer des Verwaltungsgebäudes. Ein schauriges Glockengeläut begleitete den traurigen Zug – die blitzschnell aufeinander folgenden Schüsse der stählernen Menschenfresser! – Tack, Tack, Tack, so ging’s unaufhörlich, unaufhörlich.
Und jetzt draußen ein Gebrüll wahnsinniger Angst. Die Schüsse, so niedrig gezielt, daß sie nur die Beine der Schwarzen trafen, ernüchterten die angriffslustigen Nigger im Handumdrehen. Schreiend, tobend, einander niederstoßend, nur um schneller aus dieser Hölle fortzukommen, zerstreuten sich die Tausende, fluteten zurück.
In dem Krankenzimmer lag der von dem Arzt der Barbu-Mine schnell verbundene deutsche Baas und rang mit dem Tode.
Mit erlöschender Stimme hauchte er jetzt:
»Lesen Sie vor, Pelletan, was Sie geschrieben haben. – Es eilt, ich fühl’s –«
Und der Buchhalter las:
In dem Bewußtsein, daß der Tod mir nahe ist, diktierte ich in Gegenwart von drei Zeugen, die diese Urkunde mit unterzeichnen werden, meinen letzten Willen.
Ich setze zu meinem Erben den nächsten meiner Verwandten ein, gleichgültig, wie alt dieser ist, ob Mann oder Weib. Es leben Verwandte von mir in Deutschland und zwar in Danzig. Seit zwanzig Jahren habe ich nichts von ihnen gehört. Mein Testamentsvollstrecker wird meine Erben zu finden wissen.
Der, der für die Erfüllung meines letzten Willens sorgen wird, ist mein Oberingenieur Hektor Edward Pareawitt. Er soll meine Besitzungen sämtlich verkaufen. Für seine Mühewaltung erhält er 5000 Sterling.
Falls meine Verwandten sämtlich vor mir gestorben sein sollten, fällt mein Vermögen, das ich auf drei Millionen nach deutschem Gelde schätze, an das deutsche Reich, mit der Bestimmung, daß die Zinsen im Interesse meines alten Vaterlandes verwendet werden.
Unter allen Umständen sind an meine Beamten und Arbeiter Legate auszuzahlen in der Weise, daß jeder ein volles Jahresgehalt erhält.
Dieses Testament ist bei dem deutschen Generalkonsul in Kapstadt niederzulegen, den ich bitte, meinen Vertrauten Pareawitt nach Möglichkeit zu unterstützen.«
Pelletan schwieg.
»Gut so,« erklärte der Sterbende mit letzter Kraft. »Eine Feder –«
Pareawitt stützte ihn, als er unterschrieb.
Es war die höchste Zeit gewesen. Mit einem dumpfen Ächzen sank Albert Wendel zurück. Seine Finger schlossen und öffneten sich krampfhaft. Dann ging’s wie ein Ruck durch den massigen Leib.
»Das Ende,« sagte der Arzt leise.
Pareawitt zerdrücke eine Träne.
Der Buchhalter Pelletan aber murmelte unhörbar vor sich hin »Merken wir’s uns! In Danzig!«
2. Kapitel Das graue Gespenst
Drei Monate nach diesen Ereignissen finden wir Hektor Edward Pareawitt in der Hauptstadt des Deutschen Reiches und zwar bei dem Inhaber des Detektivbureaus »Argus« wieder.
»Womit kann ich Ihnen dienen, Mr. Pareawitt?«
Der Oberingenieur, der die schlanke Figur und das markante Gesicht des berühmtesten Detektivs Berlins mit wohlgefälligen Blicken gemustert hatte, sagte mit leichter Verbeugung:
»Sie sind mir durch einen Freund, der hier in Berlin wohnt, empfohlen worden, Mr. Schaper. Man rühmt Ihnen ganz ungewöhnliche Fähigkeiten als Detektiv nach. Als Einleitung will ich Ihnen eine kleine Episode aus dem Minenleben Südafrikas erzählen.«
Der Oberingenieur berichtete nun ausführlich über Albert Wendels trauriges Ende und fügte dann hinzu:
»Nach dem prunkvollen Begräbnis meines Herrn und Freundes wurde vom Gericht eine Kommission von drei Vertrauensmännern eingesetzt, die den Besitz Albert Wendels, dessen Wunsch entsprechend, zu Geld machen sollten. Zu dieser Kommission gehörte auch der erste Buchhalter der Barbu-Mine, ein Mann namens Charles Pelletan. Dieser Pelletan, ein Franzose, hat nun die auf ihn gesetzten Hoffnungen, daß er infolge seiner Geschäftstüchtigkeit sich recht nützlich erweisen würde, schwer getäuscht, indem er bald nach meiner Abreise versuchte, allerlei Vermögenswerte der Erbschaftsmasse beiseite zu schaffen. Sein Raub konnte ihm noch rechtzeitig abgejagt werden. Er selbst entfloh. Die von der Polizei sofort aufgenommene Verfolgung blieb resultatlos. All diese Dinge meldete man mir gestern erst durch eine Depesche. Infolgedessen sehe ich mich genötigt, meinen Aufenthalt hier in Deutschland abzukürzen.«
Pareawitt machte eine kurze Pause.
»Was mich nach Deutschland geführt hat,« begann er dann wieder, »werden Sie bereits ahnen, Mr. Schaper. Ich wollte hier den Erben Albert Wendels ausfindig machen. Mein verstorbener Chef hatte in dem kurz vor seinem Tode errichteten Testament über seine Verwandten nur angegeben, daß diese seiner Zeit in Danzig gelebt hätten. Mir selbst war über diesen Punkt, aus gelegentlichen Gesprächen mit Wendel, der mir stets sein vollstes Vertrauen geschenkt hat, noch einiges andere bekannt. Fraglos ist Albert Wendel vor nunmehr einundzwanzig Jahren nach Südafrika irgend einer dunklen Geschichte wegen ausgewandert. Was ihn aus der Heimat vertrieben hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Andeutungen, die er mir gegenüber machte, ließen jedoch, soweit ich daraus kombinieren konnte, darauf schließen, daß ein Bruder von ihm hierbei irgend eine Rolle spielte, ferner eine Liebesaffäre, die ihn dann auch zu dem ausgesprochenen Weiberfeind werden ließ, als der er in Kimberley bekannt war. – Gleich nach seinem Ableben hatte ich mich nun mit einer hiesigen Annoncenexpedition in Verbindung gesetzt und in fast sämtliche deutschen Zeitungen einen Aufruf einrücken lassen, in dem Verwandte des vor Jahren nach Afrika ausgewanderten Albert Erich Wendel ersucht wurden, sich beim Generalkonsul in Berlin in einer wichtigen Angelegenheit zu melden.«
»Und auf Ihren Aufruf hin hat sich niemand gemeldet?« fragte der Detektiv, um die Unterredung nicht zu sehr in die Länge zu ziehen.
»Niemand – leider. Und dabei habe ich einen ganzen Monat täglich die Annonce bringen lassen, was eine nette Summe Geldes kostete.«
»Mit einem Wort, auf diese Weise kommen Sie nicht ans Ziel, Mr. Pareawitt, und nun soll ich helfen,« sagte der Detektiv offen.
»Stimmt! Ich habe Ihnen schon alles mitgebracht, was nötig ist. Hier sind Abschriften der bei Albert Wendel gefundenen Legitimationspapiere, ein paar photographische Gruppenaufnahmen, die aus seiner Jugendzeit stammen und auf denen er mit abgebildet ist, sowie zwei Briefe, vergilbt und befleckt, die in der gleichen Mappe mit den Legitimationen lagen. Mehr Material vermag ich Ihnen nicht zu liefern. Sehen Sie zu, was Sie damit ausrichten.«
»Danke. Es wird wohl genügen,« meinte Schaper, indem er die Sachen, die Pareawitt ihm reichte, auf den Schreibtisch legte. »Und was gedenken Sie selbst zu tun?« fragte er sodann.
»Ich kehren mit dem nächsten Dampfer nach Südafrika zurück, wo ich, wie gesagt, dringend zu tun habe, nachdem Pelletan das Weite gesucht hat. Damit wäre das Geschäftliche erledigt,« meinte der Oberingenieur etwas zögernd. »Wenn es Ihre Zeit erlaubt, möchte ich nun noch gern eine Auskunft von Ihnen haben, und zwar hinsichtlich jenes Sensationsfalles, den die Presse der ganzen Welt unter dem Titel »Die Mumie der Königin Semenostris« behandelte.«
»Bitte – fragen Sie nur,« sagte Schaper liebenswürdig, obwohl er wußte, daß draußen im Vorzimmer noch ein halbes Dutzend Klienten wartete.
»Dank’ Ihnen! – Dann also – jener Amerikaner, den man zu den eigenartigsten Verbrechertypen der modernen Zeit rechnen muß, starb durch Gift, nicht wahr? Und weiter, hatte er eigentlich irgend welche Anverwandten, die sich nach seinem Tode meldeten?«
»Ihre erste Frage kann ich bejahen. Der Mann endete durch ein Gift, das der Wissenschaft bisher unbekannt war. In seinem Nachlaß fand ich am Morgen nach seinem Tode eine Art Testament, in dem er die Behörden im Falle seines plötzlichen Endes bat, sofort einen gewissen Thomas Shepperley von seinem Hinscheiden zu benachrichtigen. Dieser Shepperley wohnte seit einiger Zeit in Berlin, legitimierte sich als alter Freund des Amerikaners und erhielt dessen Leiche nach deren Freigabe durch die Polizei zur Beerdigung ausgehändigt. Der Tote wurde dann in aller Stille auf dem Kirchhof der Berliner Fremdenkolonie beigesetzt. Sonst hat sich niemand um den grauenvollen Menschen gekümmert, der ohne Zweifel ein hochbegabter Chemiker von immensem Wissen gewesen sein und über Kenntnisse verfügt haben muß, die unseren Gelehrten noch ein Buch mit sieben Siegeln sind.«
Pareawitt nickte nachdenklich mit dem Kopf.
»Ja, ein merkwürdiges Genie war es wirklich, das muß man sagen! Ich habe mich wahrhaftig nie um Kriminalfälle gekümmert; aber diese Sache, die jetzt ein reichliches halbes Jahr zurückliegt, haftet noch ganz genau in meinem Gedächtnis. Nur der Ausgang des Dramas war mir entfallen. – So, nun vielen Dank. Leben Sie wohl, Mr. Schaper. Und – wenn Sie eine Spur von dem Erben entdecken sollten, geben Sie mir telegraphisch Nachricht.«
Nachdem der Detektiv dann die übrigen Klienten abgefertigt hatte, nahm er ein Kursbuch zur Hand und suchte sich den passendsten Zug nach Danzig heraus. Sodann klingelte er nach seinem Bureauvorsteher.
»Lemke, ich fahre heute abend 10 Uhr 58 Minuten nach Danzig,« sagte er seinem treuen Mitarbeiter Bescheid. »Es liegt eine ziemlich »fette« Sache vor – Millionenerben werden gesucht. Da möchte ich persönlich die nötigen Nachforschungen anstellen.«
Lemke nickte. »Die übrige Arbeit, die wir augenblicklich haben, ist ja auch nichts Aufregendes. Alles Durchschnittssachen,« meinte er. »Damit werden schon unsere Leute fertig. Nur – hm, ja –«
»Nur –? Was wollen Sie mit diesem Wörtchen sagen? – Zieren Sie sich nicht! Heraus mit der Sprache!«
»Der Brief, der gestern eintraf, Herr Schaper, an den denke ich. Sie scheinen das –«
»Donner und Doria!« rief der Detektiv temperamentvoll. »Sie haben recht. Das habe ich vergessen. Bringen Sie mir doch einmal den Brief her. Ich will ihn nochmals durchsehen und mich dann entschließen, welche Schritte zunächst zu tun sind.«
Schaper, der den gestern eingetroffenen Brief nur flüchtig durchgesehen hatte, da wichtigere Dinge ihn gerade beschäftigten, las jetzt in Ruhe das in mehrfacher Beziehung recht merkwürdige Schreiben nochmals Wort für Wort. Die Handschrift zeigte keine Besonderheiten, war vielmehr etwas unbeholfen, fast kindlich.
Der Inhalt lautete folgendermaßen:
Bevor ich Ihnen, geehrter Herr Schaper, die Einzelheiten des Falles, den ich Ihrer Findigkeit anvertrauen möchte, mitteile, muß ich Ihnen offen bekennen, daß ich in den bescheidensten Vermögensverhältnissen lebe und nur ein geringes Honorar, etwa 300 Mark, zahlen könnte. Ich schicke dies voraus, damit Sie auch in dieser Hinsicht genau informiert sind und mir nicht den Vorwurf machen können, Ihnen dies verheimlicht zu haben. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar. Sollten Sie daher für die angegebene Summe die Sache nicht erledigen können, so bitte ich diesen Brief zu verbrennen. Erhalte ich in einer Woche keine Nachricht, so entnehme ich daraus, daß Sie diesen Auftrag ablehnen. Jedenfalls aber müßte ich darauf bestehen, daß Sie persönlich meine Angelegenheit in die Hand nehmen, da ich der festen Überzeugung bin, daß eine Hilfskraft Ihres Instituts, und sei es die tüchtigste, hier nicht ausreicht.
Nun kurz den Sachverhalt. Vor einem halben Jahre etwa mietete ich von dem Kaufmann Wernicke, Gauben, die in der Nähe dieses Städtchens liegende sogenannte Mönchsabtei, ein altes, in einem Garten gelegenes Gebäude, in dem früher Karthäuser Mönche gehaust haben sollen. Ich bin ein alter Mann, dem das Leben übel mitgespielt hat und der hier fern dem Getriebe der Welt, die mich nur enttäuscht hat, seine Tage beschließen wollte. Ein langjähriger Diener teilt meine Einsamkeit, nebenbei ein Mann, der mein vollstes Vertrauen verdient und auf den keine Spur von Verdacht fallen kann, daß er etwa bei den rätselhaften Vorgängen, die Sie sofort hören werden, irgendwie mitbeteiligt ist. – Meine Hoffnung, hier in der Mönchsabtei in Ruhe und Frieden leben zu können, hat sich leider nicht bestätigt. Gleich nach meinem Einzug, in der zweiten Woche des Februar, stürzte mein Diener schreckensbleich eines Abends in mein Arbeitszimmer. Nach vieler Mühe erst brachte ich den vor Angst halb Bewußtlosen zum Reden. Er erzählte mir dann folgendes, und die späteren Vorfälle haben gezeigt, daß er leider nicht phantasierte, sondern seine Schilderung auf voller Wahrheit beruhte. Er war gegen neun Uhr noch ein wenig im Garten auf und abgegangen, da das milde, prächtige Wetter geradezu zum längeren Aufenthalt im Freien verlockte. Auf seiner Promenade hatte er sich ganz absichtslos auch in die Nähe der sogenannten Prior-Kapelle begeben, die abseits von dem Hauptgebäude steht und fraglos früher einmal tatsächlich zur Abhaltung von Gottesdiensten genutzt worden ist, worauf sowohl die Form als auch die Innenausschmückung der jetzt halbzerfallenen und von Efeu überwucherten kleinen Baulichkeit schließen läßt. Hier war es, wo mein treuer Hartung plötzlich einer grauen Gestalt ansichtig wurde, die mit langschleppenden Gewändern aus einer Seitenallee hervorkam und langsam auf die Kapelle zuschritt. Hartung, ein Mann in den besten Jahren, dabei mutig und völlig frei von Aberglauben, rief die Erscheinung an und näherte sich ihr gleichzeitig, wobei ihn jedoch plötzlich ein so starkes Gefühl des Grauens überkam, daß er es nicht wagte, direkt auf die wie ein Schatten lautlos dahingleitende Gestalt loszuspringen. Jedenfalls blieb sein Anruf ohne Erfolg, und der Unbekannte – falls es sich eben um einen Menschen handelt, verschwand in der längst aus den Angeln gefallenen Tür der Prior-Kapelle. Inzwischen hatte mein Diener seine Anwandlung von Furcht überwunden und drang nun, indem er einen am Boden liegenden Spaten als Waffe aufgriff, und das Flämmchen seines Taschenfeuerzeugs als Leuchte benutzte unerschrocken in die Ruine ein. Im Innern fand er einige trockene Zweige, die er schnell zu einer primitiven Fackel vereinte, bei deren Licht er die Kapelle gründlich durchsuchte. Diese besteht aus zwei Räumen. Durch die Tür gelangt man in die eigentliche Kapelle, die vielleicht sechs Meter lang und vier Meter breit ist. An der gegenüberliegenden Wand führt ein schmales Pförtchen in einen Anbau, eine Art Sakristei, die jetzt ebenso leer ist wie der Hauptraum und in der ebenfalls nur Ratten, Mäuse und Spinnen ihr Wesen treiben. Einen zweiten Ausgang gibt es nicht, worauf ich besonders aufmerksam mache. Die Fenster, zwei Meter über dem zertrümmerten Steinplattenboden gelegen, sind mit noch verhältnismäßig gut erhaltenen Ziergittern versehen.
Hartung entdeckte auch nicht eine Spur von der seltsamen Erscheinung, die in der Kapelle verschwunden war, obwohl er jeden Winkel, fast jede Mauerritze ableuchtete. Nachdenklich, von einem gewissen Unbehagen befangen, wollte er durch die Tür gerade wieder ins Freie hinaustreten, als eine unsichtbare Hand ihm die noch brennenden und inzwischen ergänzten Zweige aus der Hand riß und in die dünne, winterliche Schneedecke des Gartens schleuderte. Hartung, der augenblicklich herumfuhr um den Attentäter, den er hinter sich vermutete, zu erwischen, sah und hörte nichts. Totenstill lag der Innenraum der Kapelle da. Kein Wunder, daß meinen Diener unter diesen Umständen abergläubische Angst packte und er wie ein von Furien Gejagter davonstürzte. In diesem Zustande langte er in meinem Zimmer an.
Ich will Ihre Zeit nicht durch weitschweifige Ausführungen in Anspruch nehmen. Ich selbst habe die Erscheinung in den inzwischen verflossenen Monaten nicht weniger als acht Mal gesehen, sie angerufen und bin ihr ebenfalls in die Prior-Kapelle gefolgt. Stets tauchte sie in jener Allee auf, die von Lebensbäumen eingerahmt ist und an deren einer Seite sich ein altes Grabmal mit einer mächtigen Steinplatte darauf befindet. Die Natur dieses grauen, bis zum Kopf in wallende Tücher gehüllten Geschöpfes zu ergründen, ist mir nicht gelungen. Nur ein Mal sah ich etwas von dem Gesicht dieses – sagen wir ruhig – Gespenstes. Ein blasses, bartloses Antlitz, anscheinend das eines Mannes, war’s. Und ein andermal wieder, an jenem Abend, als ich mir den Besitzer der Mönchsabtei, den Kaufmann Wernicke, gleichsam als Zeugen eingeladen hatte, damit er sich von der Wahrheit meiner Angaben vergewissere, wagte ich es, der Erscheinung sogar den Weg zu vertreten. Da es eine stockdunkle Nacht war, hatte ich mir eine helleuchtende Acetylenlaterne mitgenommen. Und was geschah?! Mit einer geradezu hoheitsvollen Gebärde streckte das Gespenst mir den Arm entgegen. Meine Füße waren in demselben Moment wie gelähmt, die Laterne verlöschte ohne jede äußere Ursache, und – ruhig schritt »der Graue« , wie wir den unheimlichen Wanderer längst getauft haben, in die Kapelle hinein.
So stehen hier die Sachen. Wernicke, der sein Anwesen gern verkaufen möchte, hat mich flehentlich gebeten, über meine Beobachtungen zu schweigen, da er die Mönchsabtei sonst niemals veräußern kann. Jeder Käufer würde ja durch die Geistererscheinung abgeschreckt werden. Nunmehr hat er darein gewilligt, daß ich Ihnen die unheimliche Geschichte anvertraue. Er will auch die Hälfte der Kosten tragen, was schon sehr viel bedeutet, da der Mann sehr sparsam, fast geizig ist. – Mit einem Wort: Drei einwandfreie Zeugen, nämlich Wernicke, mein Diener und ich, haben die Erscheinung beobachtet. An ihrer Existenz ist mithin nicht zu zweifeln. Und da ich als aufgeklärter Mensch an übernatürliche Dinge nicht glauben kann, anderseits aber eine Erklärung für das Geschaute nicht zu finden vermag, bitte ich Sie der Sache auf den Grund zu gehen.
»Daß diesen Bericht ein Privatgelehrter verfaßt hat, merkt man,« brummte Fritz Schaper vor sich hin, nachdem er mit der Lektüre fertig war. »Gerade das, worauf es ankommt, fehlt. – Nun, sehen wir zunächst einmal nach, wo dieses Nest mit dem schönen Namen Gauben liegt. Denn – der Fall interessiert mich. Ich rieche förmlich das Außergewöhnliche. In dieser Beziehung habe ich mich noch nie getäuscht.«
Er holte das Kursbuch wieder hervor, schlug die Eisenbahnkarte von Ostdeutschland auf und:
»Holla! Da haben wir’s ja schon. Also an der Bahnlinie Stettin-Danzig, unweit von Stolp, das paßt ja vorzüglich. Die Sache wird gemacht.«
Er klingelte und befahl dem eintretenden Lemke, sofort ein Antwortschreiben für Friedrich Müller aufzusetzen des Inhalts, daß er in den nächsten Tagen in Gauben eintreffen würde.
3. Kapitel Die gescheiterte Brigg
Auf die drei furchtbaren Sturmtage mit ihren anhaltenden Regengüssen war endlich wieder ein sonnenklarer Tag gefolgt. Noch grollte die See, warf noch immer den weißen Gischt ihrer sich überstürzenden Wogen bis zu dem hölzernen Bootssteg hinauf, der bei jedem Anprall der Wasserberge zitterte, stöhnte und ächzte wie ein gepeinigtes, gereiztes Tier.
Mit dem Nachlassen des Orkans und unter den scheinbar die Natur zum Frieden mahnenden, besänftigenden Strahlen des heute vom wolkenlosen, blauen Augusthimmel herableuchtenden Tagesgestirns beruhigten sich die aufgepeitschten Wogen zusehends, wurden kleiner, zahmer, sodaß bereits mehrere Boote des holsteinischen Fischerdorfes es gewagt hatten, nach der großen Brigg hinauszurudern, die dort draußen, den Bug hochaufgerichtet und ihrer gesamten Takelage beraubt, auf der etwa fünfhundert Meter vom Strande entfernten Sandbank inmitten der schäumenden Brandung lag, jetzt ein hilfloses Wrack, und vor drei Tagen noch ein schmucker Segler, den erst der verhängnisvolle Sturm in regenfinsterer Nacht aus seinem Kurs gegen die gefährliche Westküste von Holstein getrieben hatte.
Doktor Heinz Gerster, der neben Frau Käti Deprouval auf der Spitze des Bootssteges stand, ließ soeben das Fernglas sinken, mit dem er bis eben nach dem gestrandeten Fahrzeug hinübergeschaut hatte.
»Ein Boot kommt bereits zurück. Da werden wir bald näheres über das Schiff erfahren, gnädige Frau,« sagte er interessiert.
»Ob denn wirklich die ganze Besatzung den Tod in den Wellen gefunden haben mag?« meinte die schlanke, blasse Dame mit ihrer müden, aber selten wohlklingenden Stimme.
»Leider besteht sehr wenig Hoffnung, daß sich auch nur ein einziger von der Bemannung gerettet hat,« erwiderte Doktor Gerster.
Frau Deprouval schauderte wie fröstelnd zusammen.
»Die armen, armen Leute,« sagte sie leise.
Wieder führte jetzt Doktor Gerster sein Fernglas an die Augen.
»Keine dreihundert Meter sind sie noch entfernt,« erklärte er ganz aufgeregt.
Und nach einer Weile:
»Wirklich, ich täusche mich nicht. Sie haben einen sechsten Mann im Boot. Das ist kein Fischer. Vielleicht, nein, was rede ich – bestimmt ist’s einer der Besatzung.«
Immer mehr näherte sich das auf den Wogen auf und abtanzende kleine Fahrzeug dem Stege. Jetzt konnte man schon mit bloßen Augen die Gesichter erkennen.
Da – was bedeutet das? – Wahrhaftig, das Boot wandte plötzlich und kehrte mit schnellen Ruderschlägen zu dem Wrack zurück.
»Begreifen Sie diese hastige Umkehr?« fragte Heinz Gerster, das Fernglas absetzend.
Keine Antwort. Unwillkürlich blickte er auf seine Nachbarin. Weshalb schwieg sie so hartnäckig?
Doktor Gerster fuhr erschreckt zusammen. Ein Blick in Frau Kätis Gesicht klärte ihn auf – denn leichenblaß, die Augen halb geschlossen, lehnte sie schwer, wie mit einer Ohnmacht kämpfend, am Geländer des Steges.
»Käti – Käti, was haben Sie, was fehlt Ihnen?«
Ängstliche Sorge lag im Ton seiner Stimme. Und ganz unbewußt hatte er die vertraute Anrede gebraucht, zu der nichts, nichts ihn berechtigte, die im Gegenteil dieser Frau gegenüber nichts als eine Verletzung der schuldigen Achtung war.
Mit aller Kraft raffte sie sich auf. Und es gelang ihr wirklich, etwas wie ein Lächeln mühsam hervorzuquälen.
»Eine momentane Schwächeanwandlung – nichts weiter,« sagte sie mit leisem Seufzer.
Er hatte vorhin, um sie zu stützen, die Hand um ihre Taille gelegt. So lehnten sie jetzt dicht aneinander, ganz dicht. Keiner von ihnen regte sich, keiner sprach ein weiteres Wort. Und doch fühlten sie nur zu deutlich, wie ein Strom unaussprechlicher Seligkeit von Herz zu Herzen floß, wie ihre Pulse schneller und schneller jagten.
Der Augenblick, den sie beide nach diesen vier Wochen, die sie, nur auf sich angewiesen, in dem kleinen Fischerdorfe verlebt hatten, so sehr fürchteten, war da.
Endlich erwachte sie wie aus einem wunderbaren Traume. Ihre Augen füllten sich mit Tränen; zaghaft machte sie sich von ihm los und sagte mit ihrer weichen, süßen Stimme:
»Seien wir verständig, mein Freund. Wir wissen, daß wir einander nie angehören können, nie! Und – ich danke Ihnen, Heinz, danke Ihnen aus vollem Herzen dafür, daß Sie diese Minute stillen Selbstvergessens nicht ausgenutzt haben – nicht das taten, was ein wenig ehrenhafter Charakter vielleicht gewagt hätte. Unsere Lippen sind rein geblieben, damit auch unsere Freundschaft. Und die wollen wir uns erhalten – bitte – bitte.«
Mit festem Druck fügten sich ihre Hände ineinander.
Heinz Gersters Kehle war wie zugeschnürt, jeder Nerv bebte an ihm. Alles in ihm bäumte sich auf gegen das Schicksal, das sie trennte, das ihre Wege nie zusammenführen würde, nie.
Da sprach sie schon weiter, gab seinen Gedanken eine andere Richtung:
»Lieber Freund, Sie haben mich schon so oft gebeten, Ihnen meine Lebensgeschichte zu erzählen. Vielleicht tue ich’s heute. Kommen Sie nachmittags zu mir in das kleine Gärtchen unter der breitästigen Linde. Sie sollen sehen, daß ich Vertrauen zu Ihnen habe. Das soll mein Dank sein. – Und noch etwas anderes. Bleiben Sie jetzt bitte hier und geben Sie acht, ob wirklich einer der Schiffbrüchigen gerettet ist. Nachher erzählen Sie mir alles, nachher. Auf Wiedersehen.«
Leicht, federnden Schrittes ging sie über die Planken der Bootsbrücke hin. Versonnen schaute Doktor Gerster ihr nach.
Ein tiefer, qualvoller Seufzer entrang sich seiner Brust.
»Warum kann es nicht so sein, warum?« dachte er, mit dem Geschicke hadernd, das ihn gerade hier in dem kleinen Fischerdorfe zufällig das Weib kennenlernen ließ, daß er niemals, niemals vergessen würde.
Frau Käti war inzwischen in die Dünen einbogen, wo im Schatten eines größeren, zur Reparatur an Land geschleppten Kutters neben einem jungen, weiß gekleideten Mädchen ein etwa sechs Jahre alter Knabe im Sande spielte. Der Kleine, eine wahre Ausgeburt von Häßlichkeit, mit einem übergroßen Kopf und krankhaft verzerrten Zügen, streckte beim Anblick der Mutter die dünnen Ärmchen aus und rief mit seiner schrillen, quäkenden Stimme:
»Ricki, Kuchen – Kuchen – Kuchen –«
Unaufhörlich wiederholte er das letzte Wort und zeigte dabei mit einem freudigen Lächeln, das sein mißgestaltetes Antlitz noch mehr verzerrte, auf verschiedene Sandtürmchen, die er mit Hilfe von Holzformen hergestellt hatte.
Bei dieser Begrüßung, die der bedauernswerten Frau so recht wieder die ganze Größe ihres Unglücks vor Augen führte, vermochte Käti Deprouval die heißen Tränen gerade in ihrer jetzigen Stimmung nicht mehr zurückzuhalten.
Wildes Schluchzen ließ ihren zarten Körper wie im Krampf erbeben. Achtlos setzte sie sich nieder, vergrub das tränenfeuchte Gesicht in beide Hände und gab sich ihrem Schmerze zügellos hin.
Das junge Mädchen, die Erzieherin des kleinen Richard, redete ihr tröstend zu. Alles vergeblich. – Schließlich nahm sie mit sanfter Gewalt die Fassungslose in ihre Arme und streichelte ihr beruhigend über das blonde, nur von einem dünnen Schleier verdeckte Haar. Das half. – Langsam versiegten die Tränen, die Hände gaben das feine Gesichtchen frei.
»Aber liebe, liebe Frau Deprouval, woher nur wieder dieser Anfall wilder Verzweiflung?« sagte Rita Meinas leise und nahm Kätis Hände tröstend in die ihren.
Frau Käti nickte traurig vor sich hin.
»Wenn Sie wüßten,« sagte sie leise und preßte die Finger des jungen Mädchens mit fast schmerzhaftem Druck. »Oh dieses Entsetzen, wenn so plötzlich die Vergangenheit vor einem wieder auftaucht, wenn Erinnerungen wachwerden, die mich mit Abscheu und Grauen erfüllen –«
Und plötzlich, ganz unvermittelt, sprang sie dann auf und sagte hastig:
»Kommen Sie, Rita, wir wollen gehen. Es ist zu heiß hier am Strande.«
In demselben Augenblick näherte sich wieder eines der Fischerboote, die nach der Brigg hinausgefahren waren, dem Stege. Fluchtartig eilte Frau Käti davon, indem sie ihr unglückliches, schwachsinniges Kind mit sich zog.
Heinz Gerster hatte den alten Fischer Iversen bei Seite genommen und suchte von ihm zu erfahren, weswegen sie so plötzlich wieder umgekehrt und nach dem gestrandeten Fahrzeug zurückgerudert waren.
»Ja, sehen Sie, Herr Doktor,« sagte der Alte, »das war nu ’ne dolle Sach’. Also, wir fanden da drüben an Bord einen einzigen Mann, einen Passagier der »Karola« . So heißt nämlich die Brigg. Die andern, ja, die hat alle die See verschlungen – alle. Die Leichen werden wohl bald an den Strand getrieben werden. Aber ob grad’ hier bei uns, ist fraglich. Der Mann von der »Karola« packte denn nu seinen Koffer in unser Boot, und wir stießen ab. Mit ’en Mal, dicht an ’en Bootssteg, bückt er sich und sagt so recht barsch: »Augenblicklich umkehren. Ich hab’ was vergessen. Zehn Mark gibt’s, wenn Ihr Euch beeilt.« – Na, zehn Mark!! Wir taten’s. Dann kletterte er wieder allein auf die »Karola« zurück. Wir warten und warten. Er kommt nicht wieder. Und dann steckt er plötzlich den Kopf über die Reling und ruft »Achtung!« und dann ist er auch schon unten im Boot. – Was, denken Sie, hat er geholt? Eines der Schiffsfernrohre, Herr Doktor! Ne komische Sach’, nicht wahr?! Und, während wir dann an Land paddeln, läßt er das Glas nicht von den Augen, sucht damit immer den Strand ab.
»Einsame Küste hier,« meint er zu mir.
»Freilich, Herr. Auf zehn Meilen ist unser Dorf das einzige,« sag ich.
»Habt Ihr auch Badegäste?« fragt er nach ’ner Weile.
»Waren gegen hundert hier, sind aber schon wieder weg,« sag ich zu ihm. »Nur vier haben bis jetzt ausgehalten,« setzt’ ich hinzu.
»So. Wohl Herren alles?« fragt er wieder.
»Nee – das gerade nich. Eine Münchner Dame mit ihrem Kinde und eine Erzieherin und der Doktor Gerster,« geb’ ich zur Antwort.
Da wurde er ganz still. Und mit einem Mal verlangt er, wir sollen ihn nicht am Bootssteg, sondern weiter unten am Strand absetzen.
Nu, wir taten ihm den Gefallen. Und dann mußte ihm Johann Petersen gleich einen Wagen bestellen. Er wollte sofort nach Schülp zum Herrn Landrat fahren, dem er wichtiges mitzuteilen habe. Nachher würd’ er denn zurückkommen und dem Gemeindevorsteher seine Aussage zu Protokoll geben, nämlich über die Strandung. Das muß so sein, Herr Doktor. Seinen Koffer ließ er hier. Und dann fuhr er mit des Kreuzwirts Wagen davon. Abends sei er wieder zurück, sagt er noch.«
Heinz Gerster schlenderte darauf sehr nachdenklich seiner Sommerwohnung zu, die er bei dem Pfarrer des Dorfes gemietet hatte.
Nach dem Mittagessen legte er sich in dem schattigen Garten in seine Hängematte und versuchte die Zeit bis zum Kaffee zu verschlafen.
Endlich konnte er sich auf den Weg zu der Frau Käti Deprouval machen.
Er fand das Nest leer.
»Plötzlich abgereist,« sagte ihr Wirt achselzuckend. »Hier – diesen Brief soll ich Ihnen geben, Herr Doktor.«
Heinz Gerster riß den Umschlag auf und las – las – –
In unser beider Interesse halte ich es für das Beste, ohne langen Abschied von Ihnen zu gehen. Suchen Sie mich zu vergessen! Es muß sein. Und – nochmals danke ich Ihnen für alles das, was Sie mir gegeben haben durch Ihre zarte, vornehme Aufmerksamkeit, Ihre sorgende Freundschaft.
Leben Sie wohl! Auf ewig!
Heinz Gerster atmete schwer. Ihn fröstelte plötzlich. Und dann eilte er seinem Heime zu. Ohne rechts oder links zu blicken schritt er hastig dahin. Käti hatte recht. Er mußte vergessen! – Sie war ja nicht frei, hatte einen Gatten, ein Kind! Und dies Vergessen sollte ihm seine Arbeit bringen. Schon so oft war diese seine beste Trösterin gewesen.
4. Kapitel Die Spur des Anderen
Fritz Schaper hatte seinen Entschluß, sofort nach Danzig zu fahren, ausgeführt. Angelangt, frühstückte er zunächst auf dem Bahnhof, brachte seinen äußeren Menschen in Ordnung und begab sich dann sofort auf das Einwohnermeldeamt, wo er erfuhr, daß Albert Wendel einen Bruder gehabt habe, der vor sieben Jahren unter Zurücklassung eines einzigen Kindes, einer Tochter, gestorben sei. Diese Tochter habe inzwischen Danzig verlassen. Ihr neuer Wohnsitz sei unbekannt. Weitere Verwandte besitze der verstorbene Minenbesitzer offenbar nicht, meinte der Beamte, mit dem der Detektiv verhandelte.
Schaper bedankte sich für die freundliche Auskunft und wollte schon das Büro verlassen, als der gefällige Herr ihn nochmals heranwinkte.
»Sie sind jetzt der zweite, der sich nach der Familie Wendel erkundigt,« sagte er mit schlauem Augenzwinkern. »Das hängt wohl mit dem Aufruf zusammen, der in den Zeitungen stand, nicht wahr?«
»Der Zweite?« meinte Schaper mit schnell erwachtem Argwohn. »Ich weiß nur, daß der Bevollmächtigte jenes Albert Wendel hier in Danzig telegraphisch nach Verwandten des Verstorbenen angefragt hat.«
»Gestern war schon ein Herr hier,« erklärte der Beamte wichtig. »Er fragte genau dasselbe wie Sie. Nur legitimiert hat er sich nicht. Er sagte, er sei ein Freund des Minenbesitzers. – Nicht wahr, Herr Schaper, hier spielt wohl einen Erbschaft mit? In dem Aufruf stand ja nichts davon. Aber – man kombiniert sich doch so allerlei zusammen.«
»Ich vermag Ihnen über diesen Punkt nichts bestimmtes anzugeben,« erwiderte der Detektiv vorsichtig. »Ich habe nur den Auftrag erhalten in der Form, wie ich es Ihnen mitteilte, d. h. ich soll feststellen, wer noch von der Familie Wendel lebt. Alles andere geht mich auch nichts an.«
Eine Viertelstunde später schickte Fritz Schaper dem Vorsteher des Standesamtes seine Karte hinein. Worauf er sofort vorgelassen wurde. Und hier bekam er schon genaueren Aufschluß.
Der Holzkaufmann Markus Albert Erich Wendel hatte zwei Söhne gehabt. Der Ältere, Albert Erich Wendel, war unvermählt geblieben. Der Jüngere, Markus Gottlieb Wendel, hatte sich im Jahre 1892 verheiratet. Aus dieser Ehe war nur eine Tochter entsprossen, die am 2. Februar 1893 geborene Charlotte Marie Gertrud Wendel. Markus Wendel jun. hatte zuletzt Breitgasse Nr. 14 gewohnt und war dort auch verstorben.
Schaper notierte sich all dies genau. Dann wandte er sich noch mit einer letzten Frage an den Standesbeamten.
»War gestern vielleicht schon jemand hier, der sich ebenfalls nach der Familie, die mich so sehr interessiert, erkundigte?«
»Allerdings. Der Betreffende stellte sich als alter Freund des Minenbesitzers vor und erklärte, er wolle den Angehörigen des Verblichenen dessen letzte Grüße übermitteln.«
Schaper war über diese Antwort nicht weiter erstaunt. Er hatte sie eigentlich vorausgesehen. Also verfolgte noch ein jemand anderes dasselbe Ziel wie er. Wer konnte dies aber sein? Fraglos doch niemand, der von dem Oberingenieur Pareawitt beauftragt war?! – Der Detektiv überlegte. Er mußte klarsehen.
»Würden Sie so liebenswürdig sein und mir den Herrn beschreiben,« bat er den Beamten.
»Aber gern, Herr Schaper,« beeilte sich der Standesbeamte zu erwidern. »Der Betreffende war etwa fünfunddreißig Jahre alt, hatte ein frisches, gebräuntes Gesicht, kleines, dunkelblondes Bärtchen und noch dunkleres, gescheiteltes Haar, schmale, feingeformte Nase – und das fiel mir auf – selten schmale, zarte Hände.«
»Irgend ein besonderes Kennzeichen merkten Sie nicht?« forschte Schaper weiter, indem er alles in sein Notizbüchlein eintrug.
Der Gefragte zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, ob’s Ihnen wichtig erscheint, Herr Schaper. Jedenfalls hatte der Herr auf dem – ja, es war der linke – also auf dem linken oberen Eckzahn eine Goldkrone, die beim Sprechen deutlich sichtbar wird.« –
Der Detektiv winkte, als er sich wieder auf der Straße befand, eine gerade vorüberfahrende Taxameterdroschke heran und rief dem Kutscher die Adresse zu, die er vorhin von dem Standesbeamten erfahren hatte.
Das Haus Breitegasse Nr. 14 war eines jener alten, schmalen Häuser, deren eigenartiger Baustil in der Architektur direkt mit »Danziger Patrizier-Form« bezeichnet wird.
Der Besitzer, ein pensionierter Steuerrat, bewohnte die Hochparterre-Gelegenheit. Fritz Schaper hatte Glück. Der alte Herr, ein redseliger Junggeselle, war zu Hause. Auch ihm gegenüber wies sich der Detektiv durch seine Papiere aus, worauf der Steuerrat ihn höflich zum Platznehmen einlud.
»Dürfte ich einige Fragen an Sie richten, Herr Rat?« begann Schaper die Unterredung.
»Bitte. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.«
»Wie lange sind Sie schon Besitzer dieses Hauses?«
»Seit achtzehn Jahren.«
Schaper atmete auf. Hier befand er sich also an der richtigen Quelle. Mit wenigen Worten brachte er nun sein Anliegen vor.
Der alte Herr nickte freundlich.
»Was ich weiß, sollen Sie erfahren. – Die Wendels sind eine alteingesessene Danziger Familie und gehörten früher mit zu den reichsten der Danziger Patrizier-Geschlechter. Vielleicht ist Ihnen das in die Mauer eingelassene Schild über der Haustür in die Augen gefallen. Es ist ein Wappen, das der Familie Wendel, die als eine der wenigen Danziger Familien zur Führung eines solchen berechtigt ist. Mit Markus Wendel, dem Vater der »feindlichen Brüder« , – Sie werden bald verstehen, weshalb ich diesen Ausdruck gebrauche, – begann der Niedergang des Geschlechts. Die Wendels bewohnten damals noch dieses ganze Haus. Ihre Gastfreundlichkeit war berühmt, nicht minder ihre an Verschwendungssucht grenzende üppige Lebensweise. Doch dann, mit einem Wort: Das Holzgeschäft, das bis dahin glänzend gegangen war, verkrachte plötzlich, und die Wendels standen buchstäblich vor dem Nichts. Hätten nicht gute Freunde sie unterstützt, so wären sie ganz untergegangen, obwohl die beiden erwachsenen Söhne den Eltern nach Möglichkeit halfen. Doch die beiden alten Wendels überlebten den Schicksalsschlag nicht lange. Es kann so um das Jahr 1890 gewesen sein, als sie kurz hintereinander starben. – Ich muß an dieser Stelle nachholen, daß die beiden Brüder, die nicht sehr gut miteinander standen, in demselben Geschäft, einer Zuckerexportfirma, tätig waren. Wie es leider schon öfter geschehen ist, wollte es ein unglücklicher Zufall, daß sie sich bald nach dem Tode der Eltern in dasselbe junge Mädchen verliebten, eine ziemlich begüterte Waise, die jedoch lange schwankte, wem von ihren beiden so nahe verwandten Verehrern sie den Vorzug geben sollte. Da passierte plötzlich eine Geschichte, die wohl nie völlig aufgeklärt werden wird, zumal inzwischen mehr denn zwanzig Jahre verstrichen sind. Bei der Zuckerfirma, die die Brüder als Korrespondenten beschäftigte, wurde eines Tages eine größere Geldsumme aus dem zufällig offenstehenden Geldschrank gestohlen. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich auf den Älteren, auf Albert Wendel. Er wurde auch verhaftet, mußte aber bald wieder aus Mangel an Beweisen freigelassen werden. Albert Wendel zog aus diesen Ereignissen die einzig richtige Konsequenz, als er merkte, daß alle Welt ihm aus dem Wege ging: er wanderte aus. Lange Jahre hat niemand etwas von ihm gehört. Erst durch den Aufruf in den Zeitungen erfuhren die Danziger, daß ihr Landsmann nach Südafrika gegangen war. – Vor der Abreise des älteren Wendel soll es zwischen den Brüdern zu einer erregten Aussprache, beinahe zu Tätlichkeiten, gekommen sein. Es wird erzählt, Albert habe seinem Bruder Markus geradezu vorgeworfen, selbst den Diebstahl begangen und nur deswegen den Verdacht auf ihn gelenkt zu haben, um ihm das Herz des von beiden umworbenen Mädchens abspenstig zu machen.«
»Eine Zwischenfrage, Herr Steuerrat,« unterbrach der Detektiv den liebenswürdigen Alten. »Hat diese Aussprache denn einen Zeugen gehabt?«
»Bestimmt weiß ich das nicht. Die Wendels hatten eine Haushälterin, und die soll die Streitenden, als der Lärm ihr zu groß wurde, getrennt und – vorher wohl so ein wenig gelauscht haben.«
»Lebt die Frau noch?« meinte Schaper interessiert.
»Ja. Im städtischen Altenheim. Sie ist inzwischen ein steinaltes Mütterchen geworden, dabei aber geistig und körperlich noch recht rüstig. Helene Anton heißt sie. Ich kenne sie persönlich, da ich ja von dem jüngeren Wendel später dieses Haus kaufte und sie ihm damals noch die Wirtschaft führte.«
»Danke, Herr Steuerrat. Das Weitere reime ich mir schon selbst zusammen. Markus Wendel heiratete die junge Dame, und beider Kind ist Charlotte Wendel.«
Der alte Herr lächelte. »Na, so alles wissen Sie doch noch nicht, Herr Schaper. Über Markus Wendel ist nämlich noch so manches zu berichten.«
Und nach einer kleinen Pause begann er wieder: »Den jungen Eheleuten, hauptsächlich aber wohl der Ehemann, gefielen sich nicht mehr in diesem alten Hause;« begann er wieder. »Sie zogen nach Neugarten in einen der modernen Prachtbauten, während ich das Wendelsche Palais, wie die Danziger es großartig nennen, erwarb. Die Ehe der Wendels war keine glückliche. Bald drang so allerlei an die Öffentlichkeit, was auf den jüngeren Wendel kein gutes Licht warf. Er spielte, trieb sich in allerlei fragwürdigen Lokalen die Nächte über umher und – brachte es fertig, daß er nach zehn Jahren nicht nur das Vermögen seiner Frau vergeudete, sondern auch seine Anstellung verloren hatte und nun als von allen früheren Bekannten nach Möglichkeit gemiedener Versicherungsagent kärglich sein Leben fristen mußte. Bald nach diesem pekuniären Zusammenbruch starb seine Frau, und er blieb mit dem damals etwa zwölfjährigen Töchterchen allein zurück. Vielleicht über sein verfehltes Dasein gebrochen, gewöhnte er sich nur allzuschnell das Trinken an. Trotzdem arbeitete er mit bewundernswerter Energie weiter. Als er dann fünf Jahre später starb, hinterließ er seinem Kinde wenigstens soviel, daß Charlotte Wendel, ein selten hübsches, kluges Mädchen, ihre Studien weiter fortsetzen und das Lehrerinexamen machen konnte. Danach verschwand sie aus Danzig. Wohin, weiß niemand. Jedenfalls dürfte sie aber den Namen Wendel abgelegt haben. Sonst hätte die Polizei, die nach ihrem Verbleib eifig geforscht hat, sie auffinden müssen.«
Schaper waren gerade die letzten Sätze besonders interessant.
»Daß sie den Namen ihres Vaters nicht mehr führt, ist wohl nur eine Vermutung, Herr Steuerrat,« meinte er mit einem forschenden Blick auf den alten Herrn.
Dieser rückte verlegen sein Sammetkäppchen zurecht.
»Ich spreche über diese Sache nicht gern,« sagte er nun zögernd. »Wenn ich wüßte, daß ich der jungen Dame durch eine kleine Indiskretion nützen könnte, würde ich sie ja schon auf mich nehmen.«
»Sie nützen ihr bestimmt,« erklärte Schaper ernst. »Mein Wort zum Pfande!«
»Hm, das hat der Herr, der gestern bei mir war, auch gesagt. Und hinterher hat mir meine Offenheit doch leidgetan –«
Der Detektiv horchte hoch auf. – Wieder der andere, der ihm zuvorgekommen war! Wer in aller Welt konnte dieser Mensch nur sein?! Und – welche Zwecke verfolgte er?! Dieser Sache auf den Grund zu gehen, hielt Fritz Schaper für seine Pflicht.
Und so wandte er sich denn in freundlich überredendem Ton an den Steuerrat, der mißmutig vor sich hinschaute.
»Das, was Sie einem Manne, der sich bei Ihnen nur als Freund des verstorbenen Albert Wendel eingeführt hat, erzählt haben, können Sie mir, der Ihnen seine Legitimationen vorwies, doch erst recht anvertrauen. – Offenheit gegen Offenheit, Herr Rat. Charlotte Wendel winkt eine Millionenerbschaft. Das ist der Kernpunkt dieser Angelegenheit. Nur muß ich um Ihre strengste Verschwiegenheit bitten.«
Der alte Herr lächelte zufrieden.
»Nun denn: Die Wahrheit ist, daß das junge Mädchen der Frau Anton, ihrer ehemaligen Amme und späteren Vertrauten, kurz vor ihrem Verschwinden aus Danzig erzählt hat, daß ihr Vater ihr auf dem Sterbebett ein Geheimnis gebeichtet habe, welches so furchtbar gewesen sei, daß sie den mit so traurigen Erinnerungen zusammenhängenden Namen für alle Zeit von sich werfen wolle und in der Fremde unerkannt sich ein neues Leben aufzubauen gedenke.«
Schaper schloß in scharfem Nachdenken halb die Augen. Er wußte nun, was Markus Wendel seinem Kinde gebeichtet hatte. Der Schuldige an dem Diebstahl war also tatsächlich nicht der ältere sondern der jüngere der Brüder gewesen.
»Herr Rat, das, was Sie mir soeben mitteilten, hat Ihnen die alte Frau berichtet, nicht wahr?« fragte er jetzt.
»Ja. Und ich glaube kaum, daß bisher noch ein dritter davon wußte. Die Anton ist mir zu Dank verpflichtet. Ich habe ihr den Platz im Altenheim besorgt, als es ihr sehr schlecht ging.«
»Den jetzigen Namen oder den neuen Aufenthaltsort Charlotte Wendels kennen Sie nicht?« Der Detektiv beobachtete bei dieser Frage genau das Gesicht des vor ihm Sitzenden.
»Nein, wirklich nicht. Möglich, daß die Anton Bescheid weiß. Es ist aber schwer etwas aus ihr herauszulocken, wenn sie nicht sprechen will.« –
Schaper verabschiedete sich. Der Steuerrat geleitete ihn noch bis in den Flur hinaus, wo sich die Beiden mit freundlichem Händedruck trennten.
5. Kapitel Zum ersten Mal in Gauben
Eine ganze Stunde hatte sich der Detektiv mit der alten Frau in der guten Stube des Vorstehers des Altenheims unterhalten. Diese Unterredung war wieder einmal eine von denen gewesen, bei der Fritz Schaper mit allen Mitteln seines scharfen Verstandes gekämpft hatte. Daß die Greisin tatsächlich geistig noch vollkommen frisch war, merkte er bereits nach den ersten Antworten, die sie ihm mit größter Zurückhaltung und recht unfreundlich gab.
Sie wisse nichts, garnichts – dabei blieb sie.
So hatte der Detektiv den andere Saiten aufgezogen. Er fühlte geradezu, daß die Alte, die sich weinerlich immer wieder auf ihr schwaches Gedächtnis berief, von irgend einer Seite beeinflußt worden war. Sofort hatte er an den Herrn gedacht, dessen Spuren er schon an allen in Betracht kommenden Stellen begegnet war. Und daher sagte er der Greisin dann sehr energisch auf den Kopf zu, daß der Herr, der gestern bei ihr gewesen sei, sie durch ein Geldgeschenk zum Schweigen verpflichtet habe.
Die Anton spielte recht geschickt die Erstaunte. Es wäre niemand zu ihr gekommen, alles wäre reiner Unsinn. – Worauf Schaper zu dem Vorsteher ging, der dann auch bestätigte, daß am Tage vorher kurz nach dem Mittagessen ein Fremder ebenfalls eine längere Unterredung mit der Anton gehabt habe.
Als der Detektiv dann der Alten wieder gegenübertrat und ihre Lüge nachwies, bekam es die Greisin mit der Angst.
Sie gab alles zu. Der Fremde hätte ihr zwanzig Mark geschenkt unter der Bedingung, daß sie seinen Besuch möglichst verheimliche. Und wie ihr Schaper nun sozusagen als Pflaster für die eben ausgestandene Angst noch ein Goldstück in die Hand drückte, da hatte er in wenigen Sekunden auch daß Letzte erfahren, was er wissen wollte.
Charlotte Wendel, die Millionenerbin, befand sich seit zwei Jahren als Erzieherin bei einer Familie in München unter dem Namen … Rita Meinas. Straße und Hausnummer konnte die Greisin jedoch nicht angeben, da das junge Mädchen ihrer Vertrauten in der Zwischenzeit nur einmal geschrieben und ihr in dem Briefe aufs strengste anbefohlen hatte, diesen sofort zu verbrennen, was die treue Person auch pflichtschuldigst getan hatte, ohne sich die Adresse irgendwie zu merken.
Diese Angaben hatten so sehr den Stempel der Wahrheit getragen, daß Fritz Schaper an ihrer Richtigkeit auch nicht einen Moment zweifelte.
Fraglos wäre er noch befriedigter von der jetzt wieder ganz vergnügten Alten geschieden, wenn nicht eben auch … der Andere, dieser Fremde mit den Frauenhänden und der goldenen Zahnkrone, dieselben Erfolge bei seinen Nachforschungen gehabt hätte wie er selbst. – –
Von dem Altenheim begab sich Schaper ungehindert nach der Post und ließ folgendes Telegramm an seinen Bürochef Lemke befördern:
»Hiller sofort nach München. Rita Meinas Erzieherin bei Familie feststellen und sperren. Auf mein Eintreffen warten. Nachricht Hauptpost.«
»Sperren« war ein bei dem Detektivinstitut »Argus« eingeführtes Geheimwort und bedeutete: Lebensweise, Verkehr, Gewohnheiten des Betreffenden feststellen und ihn nicht aus den Augen lassen. –
In aller Behaglichkeit nahm Schaper hierauf in dem berühmten Danziger Ratskeller eine reichliche Mahlzeit ein. Der Personenzug nach Stolp in Pommern, der auch in Gauben hielt, ging ja erst um 3 Uhr nachmittags ab.
Gegen 7 Uhr abends traf der Bummelzug in dem Städtchen ein. Dieses lag, wie der Detektiv schon unterwegs von einem Mitreisenden erfahren hatte, beinahe zwei Kilometer vom Bahnhof entfernt, so daß Schaper kurz entschlossen den einzigen Hotelwagen benutzte. Sehr zu des Kutschers Erstaunen kletterte er jedoch nicht in das Innere des schon recht klapprigen Marterkastens, sondern suchte sich den luftigeren Platz neben dem Rosselenker aus.
»Den köstlichen Augustabend genieße ich lieber in der freien Luft als in Ihrer stickigen Glaskusche,« sagte er freundlich zu dem biederen Pommern, indem er ihm aus seiner Zigarrentasche drei Exemplare »mit Binden« hinreichte.
Bald befanden sich die beiden auf dem Bock in recht lebhafter Unterhaltung. Und als der Wagen vor dem sauberen Hotel »Zu den drei Kronen« hielt, hatte Schaper aus dem harmlosen Menschen alles hervorgeholt, was dieser nur über die Mönchsabtei und ihren Bewohner wußte.
Eine Stunde später machte sich der Detektiv, der sich in das Fremdenbuch als Franz Schneider, Güteragent, Berlin eingetragen hatte, auf den Weg zu dem Kaufmann Wernicke, dessen Kolonialwarengeschäft sich gerade gegenüber am Markt befand.
Ernst Wernicke saß mit seiner besseren Hälfte in dem Vorgärtchen auf der weißgestrichenen Bank.
Nachdem er den Gast in sein Privatkontor geleitet und zum Platznehmen aufgefordert hatte, hielt es Schaper für angebracht sein Inkognito zu lüften.
»Ich habe Sie eben ein bißchen beschwindelt, Herr Wernicke,« meinte er gemütlich. »Ich bin nämlich alles andere als Güteragent und heiße auch nicht Franz Schneider. Mein wahrer Name ist Fritz Schaper, Privatdetektiv, Berlin.«
Der Kaufmann riß ordentlich die wässrigen Augen auf. Dann kam ihm die Sache aber anscheinend äußerst spaßig vor und er lachte, daß ihm ordentlich die Weste wackelte.
»Ne, können Sie aber schwindeln, Herr Schaper … Ich hätte meinen Kopf gewettet, daß Sie so ein Berliner Landräuber sind, wie wir die Agenten hier nennen. Sie erzählen ja auch gleich große Geschichten von Ihren Absichten auf größere Terrains … Ne, so was …!«
»Das geschah alles nur Ihrer Frau Gemahlin wegen, Herr Wernicke. Hier darf nämlich niemand meinen Beruf ahnen, – ich sage: niemand, auch Ihre Gattin nicht! Verstehen Sie mich …?«
»Freilich Herr Schaper. Auf mich können Sie sich in dieser Beziehung wirklich verlassen.«
Der Detektiv nickte dem Kaufmann freundlich zu.
»Ich sehe, wir verstehen uns, Herr Wernicke. Und nun an die Arbeit. Wie verhält sich die Sache nun eigentlich mit diesem famosen grauen Gespenst …?«
Der Kaufmann hob wie warnend die Hand.
»Sie sollten nicht spotten …!« sagte er ernst. »Die Geschichte ist wirklich mehr als unerklärlich. Wenn ich die Erscheinung nicht selbst gesehen hätte, so würde ich auch darüber lachen. So aber …«
Schaper hatte schon eine ironische Bemerkung auf der Zunge, unterdrückte sie aber noch im letzten Moment. Statt dessen sagte er:
»Der Bericht, den Ihr Mieter Herr Müller mir eingeschickt hat, ist recht unvollständig. – Ist das Gespenst z. B. erst nach dem Einzuge des Privatgelehrten in die Mönchsabtei aufgetaucht oder schon vordem gesehen worden?«
»Am besten, ich erzähle Ihnen im Zusammenhang, was ich darüber weiß, Herr Schaper. – Ich kaufte das alte Klostergrundstück vor sechs Jahren. Daß die Leute schon immer erzählten, daß es dort umgehe, störte mich nicht. Schon als Kind – ich bin geborener Gaubener – kannte ich die Geschichte des Abtes, der in seinem Grabe in der Lebensbaum-Allee keine Ruhe finden soll und der von Zeit zu Zeit zu nächtlicher Stunde, gehüllt in ein graues, schleppendes Gewand, durch den Garten wandelt.
Als Herr Müller dann vor etwa einem halben Jahre nach Gauben kam, sagte ich ihm ehrlich die Wahrheit, weswegen das alte Gebäude bisher leer gestanden habe. Er lächelte sehr überlegen und … zog ein. Bald darauf ließ er mich durch seinen Diener nach der Abtei bitten und erzählte mir, auf welche Weise er sich überzeugt habe, daß das Gespenst wirklich vorhanden sei.«
»Das hat er mir geschrieben,« unterbrach Schaper ihn hier. »Bitte schildern Sie mir nun, was Sie selbst gesehen haben.«
»Ja – ich habe die Erscheinung geschaut. Auf meine Augen kann ich mich verlassen,« meinte Wernicke mit Nachdruck. »Ich hatte mit Herrn Müller verabredet, daß ich gelegentlich zu ihm kommen wolle, damit wir gemeinsam im Garten aufpassen könnten. Es war am 28. Mai. Das Datum werde ich so leicht nicht vergessen. Gegen 9 Uhr abends wanderte ich nach der Abtei hinaus. Ich traf es insofern schlecht an, als der Diener Hartung mit einem Erkältungsfieber zu Bett lag. Der Kranke, den ich ebenfalls begrüßen ging, wollte nun durchaus aufstehen, um sich bei der Wache beteiligen zu können. Aber Müller ließ das nicht zu. Und so mußten wir beide allein in der finsteren Nacht in den großen Garten hinabschleichen. Wir setzten uns im Schatten einer Linde mit weitüberhängenden Ästen auf eine Bank und warteten. Nach einer Stunde etwa – es mag gegen elf Uhr gewesen sein – packte Müller plötzlich meinen Arm und flüsterte ganz heiser … »da … da …« – Der Mond war gerade von Wolken entblößt, und in dieser Dämmerung erblickte ich ganz deutlich eine hohe Gestalt, die beinahe feierlich langsam auf die Kapelle zuschritt.«
»Danke. Das übrige hat mir Ihr Mieter genau mitgeteilt. Die Acetylen-Laterne verlöschte plötzlich, Müller stand wie festgebannt und der Geist verschwand in der Kapelle. – Und was taten Sie währenddessen, Herr Wernicke?«
»Ich … ich saß an allen Gliedern zitternd auf der Bank, vermochte mich nicht zu rühren, war wie gelähmt,« stotterte der dicke Herr, »und hätte nimmer gewagt der Erscheinung gegenüberzutreten wie Herr Müller dies riskierte,« fügte er ehrlich hinzu.
Fritz Schaper strich sich nachdenklich über das Kinn. Und erst nach einer geraumen Weile fragte er …:
»Herr Müller hat Ihnen wohl mitgeteilt, daß ich den Fall hier übernehmen will?«
»Ja. Gestern schickte er Hartung zu mir. Er selbst ist nämlich krank.«
»Krank? Seit wann denn?«
»Seit fünf Tagen, soweit ich mich erinnere. Gesichtsreißen und Gicht, sagte Hartung.«
Wieder schaute der Detektiv grübelnd vor sich hin.
»Haben Sie den Geist noch ein zweites Mal gesehen, Herr Wernicke?« fragte er darauf.
»Nein. Verspüre auch keine Lust dazu. Ich war froh, als ich wieder daheim in meinem Bett lag.«
Schaper erhob sich. »Dann will ich nicht weiter stören. Grüßen Sie bitte Herrn Müller von mir. Leider muß ich morgen früh schon weiterreisen. Aber in einigen Tagen komme ich wieder her.«
Wernicke machte ein sehr enttäuschtes Gesicht.
»Ich hoffte, Sie würden die Sache nun sofort aufklären,« meinte er.
»Geht beim besten Willen nicht. Ich muß zunächst eine andere sehr dringende Sache erledigen.«
»Und Sie kommen wirklich wieder?«
Schaper lachte. »Denken Sie etwa, ich fürchte das graue Gespenst …? Nein, bester Herr Wernicke! Ich bin schon mit anderen, gefährlicheren Geistern fertig geworden. – Auf Wiedersehen also …!«
Wenn der Kaufmann aber gedacht hätte, daß der Detektiv jetzt behaglich in den »Drei Kronen« einen Abendschoppen trinken würde, so täuschte er sich gründlich. Nur dazu, um mit Herrn Ernst Wernicke eine Stunde zu verplaudern, war Fritz Schaper wahrlich nicht nach Gauben gekommen. Im Gegenteil. Keine zwei Stunden später, nachdem es völlig dunkel geworden war, schwang sich eine schlanke Gestalt über die hohe, verwitterte Mauer der Mönchsabtei in den Garten hinab und schlich lautlos auf das düstere Gebäude zu, durch dessen Fensterladen nur im Erdgeschoß ein einzelner schmaler Lichtstreif zu erkennen war.