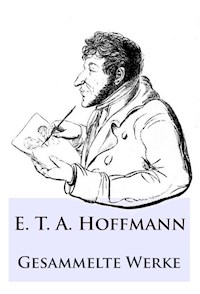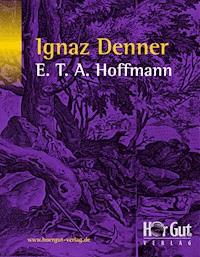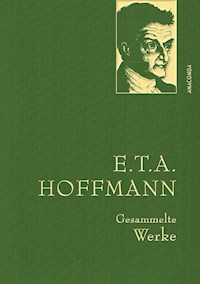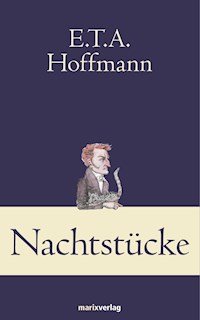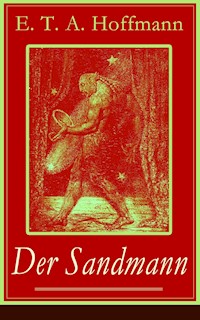Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
E. T. A. Hoffmann's 'Gesammelte Werke' ist eine faszinierende Sammlung von Erzählungen und Phantasiestücken, die die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen. Hoffmanns literarischer Stil zeichnet sich durch eine Mischung aus Romantik, Groteske und psychologischer Tiefe aus, die seine Leser in eine Welt der Doppelgänger, Geister und übersinnlichen Ereignisse entführt. Diese Sammlung spiegelt Hoffmanns vielseitiges Talent und seine Fähigkeit wider, komplexe Charaktere und Handlungsstränge zu entwickeln, die das Publikum gleichermaßen faszinieren und erschrecken. Die Geschichten reflektieren auch die romantische Literaturtradition des 19. Jahrhunderts und bieten einen tiefgründigen Einblick in Hoffmanns eigene Gedankenwelt und Ängste. E. T. A. Hoffmann, ein deutscher Schriftsteller, Komponist und Musikkritiker, war bekannt für seine dunklen und fantastischen Werke, die einen einzigartigen Beitrag zur deutschen Romantik leisteten. Sein Interesse an der menschlichen Psyche und der Verbindung zwischen Traum und Realität prägte sein Schreiben und führte zu einer Vielzahl von zeitlosen Werken. Hoffmanns eigene Erfahrungen als Anwalt und Richter spiegeln sich in seinen Erzählungen wider, die oft die Abgründe der menschlichen Natur erforschen und dabei düstere Szenarien und unheimliche Begegnungen aufzeigen. Sein Einfluss auf die Literaturgeschichte ist unbestreitbar und macht ihn zu einem der bedeutendsten Schriftsteller seiner Zeit. Fans von dunkler Romantik, phantastischen Erzählungen und psychologischer Literatur werden von E. T. A. Hoffmanns 'Gesammelten Werken' begeistert sein. Diese Sammlung bietet eine einzigartige Kombination aus Spannung, Fantasie und tiefgreifenden Charakterstudien, die Leser jeden Alters fesseln werden. Tauchen Sie ein in die Welt des Unheimlichen und der übernatürlichen Phänomene, die von einem Meister des Genres geschaffen wurden, und lassen Sie sich von Hoffmanns Geschichten in den Bann ziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 5997
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Werke von E. T. A. Hoffmann
Books
Inhaltsverzeichnis
Fantasiestücke in Callots Manier (Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten)
Erster Teil
Vorrede
Diese Vorrede zu dem nachfolgenden Buche, um welche ich ersucht worden, kleid' ich vielleicht mit Vorteil in eine Rezension ein, besonders, da die eigenen Vorreden der Verfasser ordentlicherweise nichts sind, als offene Selberrezensionen. Auch dem Hrn. Verfasser dieses Werks wird es gefallen, daß auf diesem Wege die Rezension fast noch früher – vielleicht um neun und mehrere Blätter früher – erscheint als das Buch selber, während andere Autoren Gott und den Literaturzeitungen schon danken, wenn die Rezensionen endlich eintreffen, nachdem die Bücher längst abgegangen, entweder mit Tod oder durch Absatz. Hier ist nun die Rezension selber abzuschreiben.
J e n a i s c h e Allgemeine Literaturzeitung. Dezember 1823. Schöne Wissenschaften.
Fantasie-Stücke in Callots Manier.Mit einer Vorrede von Jean Paul. 8°. Bamberg bei C. F. Kunz. 2 Teile.
Wir wollen die Verspätung unserer Anzeige nicht weitläufig entschuldigen, denn wer das Buch gelesen, dem hat sie nichts geschadet, und er bekommt jetzo nur zu seinem Urteile ein fremdes dazu; wer es aber nicht gelesen, kann nun froh sein, daß wir ihn zum Lesen bringen und zwingen. Deutsche Literaturzeitungen und Blätter dürften überhaupt etwas treuer das Gesetz im Auge haben, – wie Autoren mit der Herausgabe ihrer Werke, – ebenso mit der Anzeige zurückzuhalten, wenn auch nicht immer Horazische neun Jahre. Was das deutsche Publikum dabei gewinnt, weiß es selber am besten und schlägt die Verzugzinsen an. Gute Schriftsteller, die längst vergessen, lernt es kennen bei solcher Gelegenheit auf der kritischen Poste restante und vergißt sie nicht mehr; denn wenn nach D'Alembert das leichte Behalten der Verse ein Zeichen von deren Güte, so noch mehr das Behalten eines ganzen Buches in dem weniger eisernen als quecksilbernen Gedächtnisse des Publikums. Dieses läßt fast, wie Cicero von Cäsar rühmt, daß er nichts vergesse, außer Beleidigungen, auf eine ähnlich schöne Weise nichts so leicht aus dem Gedächtnis fahren als Bücher; eben als die wahren Beleidigungen, welche so viele hundert Schreiber jährlich zweimal dem Publikum antun. Überhaupt werden wenige Menschen so oft beleidigt als recht viele auf einmal; und ein Volk häufiger und gröber als dessen Fürst.
Um aber das Verspäten der Rezension nicht durch die Rechtfertigung desselben noch länger fortzusetzen, machen wir sogleich über den Titel die Bemerkung, daß er richtiger sein könnte. Bestimmter würde er Kunstnovellen1 heißen; denn Callots Maler – oder vielmehr Dicht-Manier herrscht weder mit ihren Fehlern noch, einige Stellen ausgenommen, mit ihren Größen im Buche. Der Verfasser hat selber im ersten Aufsatze am schönsten über diesen malenden Gozzi und Farben-Leibgeber gesprochen; und Callot scheint – wie Humor über dem Scherze – so über dem prosaischen Hogarth als poetischer Zerrbildner und romantischer Anagrammatiker der Natur zu stehen.
Unserem Verfasser dürfen wir ein Lob anderer Gattung erteilen. In seiner dunkeln Kammer (camera obscura) bewegen sich an den Wänden heftig und farbenecht die koketten Kleister- und Essigaale der Kunst gegeneinander und beschreiben schnalzend ihre Kreise. In rein ironischer und launiger Verkleinerung sind die ekeln Kunstliebeleien mit Künsten und Kunstliebhabern zugleich gemalt; der Umriß ist scharf, die Farben sind warm, und das Ganze voll Seele und Freiheit. Am dichtesten läßt der Verfasser seinen satirischen Feuerregen auf die musikalische Schöntuerei niederfallen, zumal in der trefflichen Nro. III. »Kreisleriana«. Da die Musik eigentlich die allgemeinste Kunst und Volks-Kunst ist, und jeder wenigstens singt, z.B. in der Kirche und als Bettler, die einzige ins Tierreich hinübersteigende – und da man diese Kunst, wenn man seine Kehle oder seine Finger bei sich führt, in jedem Besuchzimmer in jeder Minute auspacken kann, um durch seine Kunstausstellung auf eigne Hand die Preise aller derer zu gewinnen, welche Tee mittrinken, so ist keine Narrheit natürlicher, verzeihlicher und häufiger als die, daß die Gefallsucht, besonders die weibliche, ihre musikalischen Pfauenräder in Modestädten vor jedem schlägt, der Augen hat zu sehen, wie Kunst und Künstlerin zu einer Schönheit verschmelzen. Was den wahren Virtuosen, wie hier den Kapellmeister Kreisler, dabei so ingrimmig auf dieses Stuben-Chariwari macht, ist vielleicht weniger die Beleidigung der Kunst, als die des Künstlers selber, welchen man in vornehmen Residenzhäusern als Musikdirektor zum Platzkommandanten musikalischer Abc-Schützen anstellt. »Könnte man nicht«, denkt der zum Freudenmeister heruntergesetzte Musikmeister laut genug und schreibt es vielleicht hin, »ohne Kosten meiner Ohren vielen Hohen und Schönen schmeicheln? Und soll«, fährt er noch hitziger fort, »von weiblichen Paradiesvögeln den Männern noch das Kunstparadies entführt oder verspottet werden, und sie stellen sich dann als Engel davor und bewachen es treu? O Teufel und deren Großmutter!« beschließt er dann wild genug. Ein Künstler kann leicht genug – beispielshalber sei es unser Verfasser – aus Kunstliebe in Menschenhaß geraten und die Rosenkränze der Kunst als Dornenkronen und Stachelgürtel zum Züchtigen verbrauchen. Inzwischen bedenk' er doch sich und die Sache! Die durch Kunstliebe einbüßende Menschenliebe rächt sich stark durch Erkältung der Kunst selber; denn Liebe kann wohl der Meßkünstler, Denkkünstler, Wappenkünstler entbehren, aber nicht der Künstler selber, er sei einer, in welchem Schönen er's wolle. Liebe und Kunst leben gegenseitig ineinander wie Gehirn und Herz, beide einander zur Wechselstärkung eingeimpft. Manches jetzige Kunstpantheon ist deshalb ein durchsichtiger, reiner, blinkender Eispalast – mit allen erdenklichen Gerätschaften aus Eis versehen – sogar mit einem Brautbett und Ofen, in welchem letzten gar ein Naphthaflämmchen ohne Schaden der Eiskacheln brennt.
Wir kehren zu unserem Verfasser, den wir mit dem Vorigen nun sattsam geärgert, und zu seinem Zorne über die schreienden Sünden an der Tonkunst zurück und gehen mit ihm zu den stummen der Leibkunst der neueren historischen und mythologischen Gliedermänninnen über, welche ihre Figur zu einem Wachsfigurenkabinett auseinander zu prägen wissen, um ihre Leiber noch vor der Auferstehung zu verklären. Gegen solche, insofern sie den Zaubershawl nur zu Schminklappen verwenden und die Schöpferin mit dem Geschöpfe anputzen, ist der Herr Verfasser in Nro. V. gut genug auf- und losgefahren. Sein Feuereifer gegen gemißbrauchte Kunst ist recht; das Schöne und Ewige sei nie Schminke des Unschönen und Zeitlichen, und das Heiligenbild verziere keinen unheiligen Körper. Der Gefallsucht verzeiht man lieber eine schöne Flucherin, als eine schöne Beterin, denn mit dem Teufel kann man spaßen, aber nicht mit Gott.
Nicht ohne Vergnügen haben wir auch in diesem Werke wieder wahrgenommen, daß seit einigen Jahrzehenden die deutsche Satire und Ironie und Laune, ja der Humor häufiger den britischen Weg einschlägt, und daß Swifts und Sternes herübergetragne Loretto-Häuschen oder Studierzimmer zu Gradierhäusern unsers komischen Salzes geworden. Den jetzigen Salzgeist, auch in den Flug- und Tagblättern, in den Aufsätzen des »Morgenblattes«, der »eleganten Zeitung«, der »Heidelberger Jahrbücher«, der Literaturzeitungen etc. würden wir schwerlich gegen die breiten dicken Salzpfannen der Bahrdte mit ihren Ketzeralmanachen, der Kriegsrat Kranze, der Vademekumer, der Wetzel, der allg. deutsch. Bibliothekare u.s.w. vertauschen wollen. Aber natürlicherweise ist das Lichten des komischen Stils darum noch nicht zugleich Anwuchs des komischen Witzes.
Bei Nro. V. »Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza«, merkt der Herr Verf. bloß an, daß er eine Fortsetzung der beiden Hunde Scipio und Berganza in Cervantes' Erzählungen gebe. Er gibt etwas Gutes, und seinen Hund benützt er zum Gespräche mit einem Menschen, oft humoristischer als selber Cervantes. Sein Hund fällt, richtig geleitet und angehetzt, tief genug in die verschiedenen Waden der Schauspielherren (Regisseurs), welche den Dichter verstümmeln, um die Spieler (ja die Hörer) zu ergänzen, und die an ihren Gestalten, wie die Türken von den Bildsäulen, die Nasen abschlagen, damit sie nicht lebendig werden. Wer nicht verlängern könnte, sollte nicht zu verkürzen wagen: kaum ein Goethe würde Schillern durch Nehmen zu geben suchen: hingegen die Verschnittenen der Kunst verschneiden keck die Künstler und lassen unverschämt die Bühne zwischen Kanzel und Pranger des Genius wechseln. Wir gestehen, wären wir selber Trauer- oder Lustspielschreiber, ärger als jeden Nachdrucker würden wir theatralische Umdrucker und Sabbatschänder unserer heiligsten Sonntags- und Musenstunden verfolgen und beschimpfen, mit welchen letzten wir so schön und wohltuend auf die Nachwelt in Parterre und Paradies einzugreifen rechnen gedurft.
Höflich wär' es vom Herrn Verfasser gewesen, wenn er die Anspielungen auf Cervantes' Erzählung, wenigstens nur mit einer Note, hätte erklären wollen. Aber Verfasser sind jetzo nicht höflich. Denn weil Goethe zuweilen seine Mitwelt für eine Nachwelt ansieht, um deren künftige Unwissenheit sich ein Unsterblicher nicht zu bekümmern braucht, so wie Horaz sich nicht ad usum Delphini mit notis variorum ans Licht stellte – so wollen ihn die übrigen Goethes (wir dürfen ihre Anzahl rühmen) darin nichts zuvorlassen, sondern tausend Dinge voraussetzen, wie z.B. Tieck die nötigsten Erklärungen in seinem altdeutschen Roman: »Frauendienst«. Überhaupt ist man jetzo grob gegen die halbe Welt, wenn anders die Lesewelt so groß ist; Verzeichnisse des Inhalts – (oft der Druckfehler) – Kapitel – erläuternde Noten – Anführungen nach Seitenzahlen – Registerfache ohnehin – auch Vorreden (z.B. diesem Buche) und Absätze (wie hier) fehlen neuerer Zeiten gewöhnlich, und der Leser helfe sich selber, denn sein Autor ist grob.
Da die Grenzen des Instituts jedes ausführlichere Urteil uns verbieten, so tragen wir nur flüchtig das Nötigste nach. Nach dem gewöhnlichen kritischen Herkommen, welchem zufolge der namenlose Rezensent den Namen jedes Autors anzugeben hat, der seinen verschwiegen, berichten wir denn, daß der Herr Verfasser Hoffmann heißt und Musikdirektor in Dresden ist. Kenner und Freunde desselben und die musikalische Kenntnis und Begeisterung im Buche selber versprechen und versichern von ihm die Erscheinung eines hohen Tonkünstlers. Desto besser und desto seltener! denn bisher warf immer der Sonnengott die Dichtgabe mit der Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit auseinander stehenden Menschen zu, daß wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und setzt.
Weiter hinzuzutun haben wir schließlich nichts, als daß die Vorrede zum Buche von fremder, indes bekannter Hand gefertigt worden; doch wollen wir über sie aus Rücksichten, welche jeder Zarte von selber errät, nichts sagen, als nur dies: Die Manier ihres Verfassers ist bekannt genug.
Frip
Auch ich weiß nichts weiter hinzuzutun, als den Wunsch, daß ich möge eine solche Vorrede geliefert haben, wie Frip eine Rezension; und dann kann die Welt zufrieden sein. Ihr und mir wünsch' ich noch die versprochene baldige Fortsetzung in Callots kühnster Manier.
Baireuth, den 24. Nov. 1813.
Jean Paul Friedr. Richter
Fußnoten
1 Doch spielt Nr. VI. »Der Magnetiseur«, in einem andern Gebiete; eine mit kecker Romantik und Anordnung und mit Kraftgestalten fortreißende Erzählung.
Jaques Callot
Warum kann ich mich an deinen sonderbaren phantastischen Blättern nicht sattsehen, du kecker Meister! – Warum kommen mir deine Gestalten, oft nur durch ein paar kühne Striche angedeutet, nicht aus dem Sinn? – Schaue ich deine überreichen, aus den heterogensten Elementen geschaffenen Kompositionen lange an, so beleben sich die tausend und tausend Figuren, und jede schreitet, oft aus dem tiefsten Hintergrunde, wo es erst schwer hielt, sie nur zu entdecken, kräftig und in den natürlichsten Farben glänzend hervor. –
Kein Meister hat so wie Callot gewußt, in einem kleinen Raum eine Fülle von Gegenständen zusammenzudrängen, die, ohne den Blick zu verwirren, nebeneinander, ja ineinander heraustreten, so daß das Einzelne, als Einzelnes für sich bestehend, doch dem Ganzen sich anreiht. Mag es sein, daß schwierige Kunstrichter ihm seine Unwissenheit in der eigentlichen Gruppierung sowie in der Verteilung des Lichts vorgeworfen; indessen geht seine Kunst auch eigentlich über die Regeln der Malerei hinaus, oder vielmehr seine Zeichnungen sind nur Reflexe aller der phantastischen wunderlichen Erscheinungen, die der Zauber seiner überregen Phantasie hervorrief. Denn selbst in seinen aus dem Leben genommenen Darstellungen in seinen Aufzügen, seinen Bataillen u.s.w. ist es eine lebensvolle Physiognomie ganz eigner Art, die seinen Figuren, seinen Gruppen – ich möchte sagen etwas fremdartig Bekanntes gibt. – Selbst das Gemeinste aus dem Alltagsleben – sein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie Vögelein in den Bäumen sitzen, – erscheint in dem Schimmer einer gewissen romantischen Originalität, so daß das dem Phantastischen hingegebene Gemüt auf eine wunderbare Weise davon angesprochen wird. – Die Ironie, welche, indem sie das Menschliche mit dem Tier in Konflikt setzt, den Menschen mit seinem ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, wohnt nur in einem tiefen Geiste, und so enthüllen Callots aus Tier und Mensch geschaffene groteske Gestalten dem ernsten, tiefer eindringenden Beschauer alle die geheimen Andeutungen, die unter dem Schleier der Skurrilität verborgen liegen. – Wie ist doch in dieser Hinsicht der Teufel, dem in der Versuchung des heiligen Antonius die Nase zur Flinte gewachsen, womit er unaufhörlich nach dem Mann Gottes zielt, so vortrefflich – der lustige Teufel Feuerwerker sowie der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ braucht, um seinem Instrumente den nötigen Atem zu geben, auf demselben Blatte sind ebenso ergötzlich.
Es ist schön, daß Callot ebenso kühn und keck, wie in seinen festen, kräftigen Zeichnungen, auch im Leben war. Man erzählt, daß, als Richelieu von ihm verlangte, er solle die Einnahme seiner Vaterstadt Nancy gravieren, er freimütig erklärte, eher haue er sich seinen Daumen ab, als daß er die Erniedrigung seines Fürsten und seines Vaterlands durch sein Talent verewige.
Könnte ein Dichter oder Schriftsteller, dem die Gestalten des gewöhnlichen Lebens in seinem innern romantischen Geisterreiche erscheinen, und der sie nun in dem Schimmer, von dem sie dort umflossen, wie in einem fremden, wunderlichen Putze darstellt, sich nicht wenigstens mit diesem Meister entschuldigen und sagen, er habe in Callots Manier arbeiten wollen?
Ritter Gluck (Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809)
Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage. Die Sonne tritt freundlich aus dem Gewölk hervor, und schnell verdampft die Nässe in der lauen Luft, welche durch die Straßen weht. Dann sieht man eine lange Reihe, buntgemischt – Elegants, Bürger mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, Geistliche, Jüdinnen, Referendare, Freudenmädchen, Professoren, Putzmacherinnen, Tänzer, Offiziere usw. durch die Linden nach dem Tiergarten ziehen. Bald sind alle Plätze bei Klaus und Weber besetzt; der Mohrrübenkaffee dampft, die Elegants zünden ihre Zigarros an, man spricht, man streitet über Krieg und Frieden, über die Schuhe der Mad. Bethmann, ob sie neulich grau oder grün waren, über den geschlossenen Handelsstaat und böse Groschen usw., bis alles in eine Arie aus »Fanchon« zerfließt, womit eine verstimmte Harfe, ein paar nicht gestimmte Violinen, eine lungensüchtige Flöte und ein spasmatischer Fagott sich und die Zuhörer quälen. Dicht an dem Geländer, welches den Weberschen Bezirk von der Heerstraße trennt, stehen mehrere kleine runde Tische und Gartenstühle; hier atmet man freie Luft, beobachtet die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von dem kakophonischen Getöse jenes vermaledeiten Orchesters: da setze ich mich hin, dem leichten Spiel meiner Phantasie mich überlassend, die mir befreundete Gestalten zuführt, mit denen ich über Wissenschaft, über Kunst, über alles, was dem Menschen am teuersten sein soll, spreche. Immer bunter und bunter wogt die Masse der Spaziergänger bei mir vorüber, aber nichts stört mich, nichts kann meine phantastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Violine und Flöte und des Fagotts schnarrenden Grundbaß allein höre ich; sie gehen auf und ab, fest aneinanderhaltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden, und unwillkürlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, ruf ich aus:
»Welche rasende Musik! die abscheulichen Oktaven!« – Neben mir murmelt es:
»Verwünschtes Schicksal! schon wieder ein Oktavenjäger!«
Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, daß, von mir unbemerkt, an demselben Tisch ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet und von dem nun mein Auge nicht wieder loskommen kann.
Nie sah ich einen Kopf, nie eine Gestalt, die so schnell einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hätten. Eine sanft gebogene Nase schloß sich an eine breite, offene Stirn, mit merklichen Erhöhungen über den buschigen, halbgrauen Augenbraunen, unter denen die Augen mit beinahe wildem, jugendlichem Feuer (der Mann mochte über fünfzig sein) hervorblitzten. Das weichgeformte Kinn stand in seltsamem Kontrast mit dem geschlossenen Munde, und ein skurriles Lächeln, hervorgebracht durch das sonderbare Muskelspiel in den eingefallenen Wangen, schien sich aufzulehnen gegen den tiefen, melancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte. Nur wenige graue Löckchen lagen hinter den großen, vom Kopfe abstehenden Ohren. Ein sehr weiter, moderner Überrock hüllte die große hagere Gestalt ein. Sowie mein Blick auf den Mann traf, schlug er die Augen nieder und setzte das Geschäft fort, worin ihn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen hatte. Er schüttete nämlich aus verschiedenen kleinen Tüten mit sichtbarem Wohlgefallen Tabak in eine vor ihm stehende große Dose und feuchtete ihn mit rotem Wein aus einer Viertelsflasche an. Die Musik hatte aufgehört; ich fühlte die Notwendigkeit, ihn anzureden.
»Es ist gut, daß die Musik schweigt«, sagte ich; »das war ja nicht auszuhalten.«
Der Alte warf mir einen flüchtigen Blick zu und schüttete die letzte Tüte aus.
»Es wäre besser, daß man gar nicht spielte«, nahm ich nochmals das Wort. »Sind Sie nicht meiner Meinung?«
»Ich bin gar keiner Meinung«, sagte er. »Sie sind Musiker und Kenner von Profession…«
»Sie irren; beides bin ich nicht. Ich lernte ehemals Klavierspielen und Generalbaß, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört, und da sagte man mir unter anderm, nichts mache einen widrigern Effekt, als wenn der Baß mit der Oberstimme in Oktaven fortschreite. Ich nahm das damals auf Autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden.«
»Wirklich?« fiel er mir ein, stand auf und schritt langsam und bedächtig nach den Musikanten hin, indem er öfters, den Blick in die Höhe gerichtet, mit flacher Hand an die Stirn klopfte, wie jemand, der irgendeine Erinnerung wecken will. Ich sah ihn mit den Musikanten sprechen, die er mit gebietender Würde behandelte. Er kehrte zurück, und kaum hatte er sich gesetzt, als man die Ouvertüre der »Iphigenia in Aulis« zu spielen begann.
Mit halbgeschlossenen Augen, die verschränkten Arme auf den Tisch gestützt, hörte er das Andante; den linken Fuß leise bewegend, bezeichnete er das Eintreten der Stimmen; jetzt erhob er den Kopf – schnell warf er den Blick umher –, die linke Hand mit auseinandergespreizten Fingern ruhte auf dem Tische, als greife er einen Akkord auf dem Flügel, die rechte Hand hob er in die Höhe: es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des andern Tempos angibt – die rechte Hand fällt, und das Allegro beginnt! – Eine brennende Röte fliegt über die blassen Wangen; die Augenbraunen fahren zusammen auf der gerunzelten Stirn, eine innere Wut entflammt den wilden Blick mit einem Feuer, das mehr und mehr das Lächeln wegzehrt, das noch um den halbgeöffneten Mund schwebte. Nun lehnt er sich zurück, hinauf ziehen sich die Augenbraunen, das Muskelspiel auf den Wangen kehrt wieder, die Augen erglänzen, ein tiefer, innerer Schmerz löst sich auf in Wollust, die alle Fibern ergreift und krampfhaft erschüttert – tief aus der Brust zieht er den Atem, Tropfen stehen auf der Stirn; er deutet das Eintreten des Tutti und andere Hauptstellen an; seine rechte Hand verläßt den Takt nicht, mit der linken holt er sein Tuch hervor und fährt damit über das Gesicht. – So belebte er das Skelett, welches jene paar Violinen von der Ouvertüre gaben, mit Fleisch und Farben. Ich hörte die sanfte, schmelzende Klage, womit die Flöte emporsteigt, wenn der Sturm der Violinen und Bässe ausgetobt hat und der Donner der Pauken schweigt; ich hörte die leise anschlagenden Töne der Violoncelle, des Fagotts, die das Herz mit unnennbarer Wehmut erfüllen; das Tutti kehrt wieder, wie ein Riese hehr und groß schreitet das Unisono fort, die dumpfe Klage erstirbt unter seinen zermalmenden Tritten. –
Die Ouvertüre war geendigt; der Mann ließ beide Arme herabsinken und saß mit geschlossenen Augen da, wie jemand, den eine übergroße Anstrengung entkräftet hat. Seine Flasche war leer; ich füllte sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er seufzte tief auf, er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nötigte ihn zum Trinken; er tat es ohne Umstände, und indem er das volle Glas mit einem Zuge hinunterstürzte, rief er aus: »Ich bin mit der Aufführung zufrieden! das Orchester hielt sich brav!«
»Und doch«, nahm ich das Wort – »doch wurden nur schwache Umrisse eines mit lebendigen Farben ausgeführten Meisterwerks gegeben.«
»Urteile ich richtig? – Sie sind kein Berliner!«
»Ganz richtig; nur abwechselnd halte ich mich hier auf.«
»Der Burgunder ist gut, aber es wird kalt.«
»So lassen Sie uns ins Zimmer gehen und dort die Flasche leeren.«
»Ein guter Vorschlag. – Ich kenne Sie nicht, dafür kennen Sie mich aber auch nicht. Wir wollen uns unsere Namen nicht abfragen: Namen sind zuweilen lästig. Ich trinke Burgunder, er kostet mich nichts, wir befinden uns wohl beieinander, und damit gut!«
Er sagte dies alles mit gutmütiger Herzlichkeit. Wir waren ins Zimmer getreten; als er sich setzte, schlug er den Überrock auseinander, und ich bemerkte mit Verwunderung, daß er unter demselben eine gestickte Weste mit langen Schößen, schwarzsamtne Beinkleider und einen ganz kleinen, silbernen Degen trug. Er knöpfte den Rock sorgfältig wieder zu.
»Warum fragten Sie mich, ob ich ein Berliner sei?« begann ich.
»Weil ich in diesem Falle genötigt gewesen wäre, Sie zu verlassen.«
»Das klingt rätselhaft.«
»Nicht im mindesten, sobald ich Ihnen sage, daß ich – nun, daß ich ein Komponist bin.«
»Noch immer errate ich Sie nicht.«
»So verzeihen Sie meinen Ausruf vorhin; denn ich sehe, Sie verstehen sich ganz und gar nicht auf Berlin und auf Berliner.«
Er stand auf und ging einigemal heftig auf und ab; dann trat er ans Fenster und sang kaum vernehmlich den Chor der Priesterinnen aus der »Iphigenia in Tauris«, indem er dann und wann bei dem Eintreten der Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Verwundern bemerkte ich, daß er gewisse andere Wendungen der Melodien nahm, die durch Kraft und Neuheit frappierten. Ich ließ ihn gewähren. Er hatte geendigt und kehrte zurück zu seinem Sitz. Ganz ergriffen von des Mannes sonderbarem Benehmen und den phantastischen Äußerungen eines seltenen musikalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile fing er an:
»Haben Sie nie komponiert?«
»Ja; ich habe mich in der Kunst versucht; nur fand ich alles, was ich, wie mich dünkte, in Augenblicken der Begeisterung geschrieben hatte, nachher matt und langweilig; da ließ ich’s denn bleiben.«
»Sie haben unrecht getan; denn schon, daß Sie eigne Versuche verwarfen, ist kein übles Zeichen Ihres Talents. Man lernt Musik als Knabe, weil’s Papa und Mama so haben wollen; nun wird darauf los geklimpert und gegeigt; aber unvermerkt wird der Sinn empfänglicher für Melodie. Vielleicht war das halb vergessene Thema eines Liedchens, welches man nun anders sang, der erste eigne Gedanke, und dieser Embryo, mühsam genährt von fremden Kräften, genas zum Riesen, der alles um sich her aufzehrte und in sein Mark und Blut verwandelte! – Ha, wie ist es möglich, die tausenderlei Arten, wie man zum Komponieren kommt, auch nur anzudeuten! – Es ist eine breite Heerstraße, da tummeln sich alle herum und jauchzen und schreien: ›wir sind Geweihte! wir sind am Ziel!‹ – Durchs elfenbeinerne Tor kommt man ins Reich der Träume; wenige sehen das Tor einmal, noch wenigere gehen durch! – Abenteuerlich sieht es hier aus. Tolle Gestalten schweben hin und her, aber sie haben Charakter – eine mehr wie die andere. Sie lassen sich auf der Heerstraße nicht sehen, nur hinter dem elfenbeinernen Tor sind sie zu finden. Es ist schwer, aus diesem Reiche zu kommen; wie vor Alzinens Burg versperren die Ungeheuer den Weg – es wirbelt – es dreht sich – viele verträumen den Traum im Reiche der Träume – sie zerfließen im Traum – sie werfen keinen Schatten mehr, sonst würden sie am Schatten gewahr werden den Strahl, der durch dies Reich fährt; aber nur wenige, erweckt aus dem Traume, steigen empor und schreiten durch das Reich der Träume – sie kommen zur Wahrheit – der höchste Moment ist da: die Berührung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen – Schaut die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Akkorde, Sternen gleich, herabschießen und Euch mit Feuerfaden umspinnen. – Verpuppt im Feuer liegt Ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne.« –
Bei den letzten Worten war er aufgesprungen, warf den Blick, warf die Hand in die Höhe. Dann setzte er sich wieder und leerte schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich nicht unterbrechen mochte, um den außerordentlichen Mann nicht aus dem Geleise zu bringen. Endlich fuhr er beruhigter fort:
»Als ich im Reich der Träume war, folterten mich tausend Schmerzen und Ängste! Nacht war’s, und mich schreckten die grinsenden Larven der Ungeheuer, welche auf mich einstürmten und mich bald in den Abgrund des Meeres versenkten, bald hoch in die Lüfte emporhoben. Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht, und die Lichtstrahlen waren Töne, welche mich umfingen mit lieblicher Klarheit. – Ich erwachte von meinen Schmerzen und sah ein großes, helles Auge, das blickte in eine Orgel, und wie es blickte, gingen Töne hervor und schimmerten und umschlangen sich in herrlichen Akkorden, wie ich sie nie gedacht hatte. Melodien strömten auf und nieder, und ich schwamm in diesem Strom und wollte untergehen; da blickte das Auge mich an und hielt mich empor über den brausenden Wellen. – Nacht wurde es wieder, da traten zwei Kolosse in glänzenden Harnischen auf mich zu: Grundton und Quinte! sie rissen mich empor, aber das Auge lächelte: ›Ich weiß, was deine Brust mit Sehnsucht erfüllt; der sanfte, weiche Jüngling Terz wird unter die Kolosse treten; du wirst seine süße Stimme hören, mich wieder sehen, und meine Melodien werden dein sein.‹« –
Er hielt inne.
»Und Sie sahen das Auge wieder?«
»Ja, ich sah es wieder! – Jahrelang seufzt ich im Reich der Träume – da – ja da! Ich saß in einem herrlichen Tal und hörte zu, wie die Blumen miteinander sangen. Nur eine Sonnenblume schwieg und neigte traurig den geschlossenen Kelch zur Erde. Unsichtbare Bande zogen mich hin zu ihr – sie hob ihr Haupt – der Kelch schloß sich auf, und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen. Nun zogen die Töne wie Lichtstrahlen aus meinem Haupte zu den Blumen, die begierig sie einsogen. Größer und größer wurden der Sonnenblume Blätter – Gluten strömten aus ihnen hervor – sie umflossen mich – das Auge war verschwunden und ich im Kelche.« –
Bei den letzten Worten sprang er auf und eilte mit raschen, jugendlichen Schritten zum Zimmer hinaus. Vergebens wartete ich auf seine Zurückkunft; ich beschloß daher, nach der Stadt zu gehen.
Schon war ich in der Nähe des Brandenburger Tores, als ich in der Dunkelheit eine lange Figur hinschreiten sah und alsbald meinen Sonderling wiedererkannte. Ich redete ihn an:
»Warum haben Sie mich so schnell verlassen?«
»Es wurde zu heiß, und der Euphon fing an zu klingen.«
»Ich verstehe Sie nicht!«
»Desto besser.«
»Desto schlimmer, denn ich möchte Sie gern ganz verstehen.«
»Hören Sie denn nichts?«
»Nein.«
»– Es ist vorüber! – Lassen Sie uns gehen. Ich liebe sonst nicht eben die Gesellschaft; aber – Sie komponieren nicht – Sie sind kein Berliner.« –
»Ich kann nicht ergründen, was Sie so gegen die Berliner einnimmt. Hier, wo die Kunst geachtet und in hohem Maße ausgeübt wird, sollt ich meinen, müßte einem Manne von Ihrem künstlerischen Geiste wohl sein!«
»Sie irren! – Zu meiner Qual bin ich verdammt, hier wie ein abgeschiedener Geist im öden Raume umherzuirren.«
»Im öden Raume, hier, in Berlin?«
»Ja, öde ist’s um mich her, denn kein verwandter Geist tritt auf mich zu. Ich stehe allein.«
»Aber die Künstler! die Komponisten!«
»Weg damit! Sie kritteln und kritteln – verfeinern alles bis zur feinsten Meßlichkeit, wühlen alles durch, um nur einen armseligen Gedanken zu finden; über dem Schwatzen von Kunst, von Kunstsinn und was weiß ich – können sie nicht zum Schaffen kommen, und wird ihnen einmal so zumute, als wenn sie ein paar Gedanken ans Tageslicht befördern müßten, so zeigt die furchtbare Kälte ihre weite Entfernung von der Sonne – es ist lappländische Arbeit.«
»Ihr Urteil scheint mir viel zu hart. Wenigstens müssen Sie die herrlichen Aufführungen im Theater befriedigen.«
»Ich hatte es über mich gewonnen, einmal wieder ins Theater zu gehen, um meines jungen Freundes Oper zu hören – wie heißt sie gleich? – Ha, die ganze Welt ist in dieser Oper! Durch das bunte Gewühl geputzter Menschen ziehen die Geister des Orkus – alles hat hier Stimme und allmächtigen Klang – Teufel, ich meine ja ›Don Juan‹! Aber nicht die Ouvertüre, welche Prestissimo, ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wurde, konnt ich überstehen; und ich hatte mich bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiß, daß der Euphon von diesen Massen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht!«
»Wenn ich auch eingestehen muß, daß Mozarts Meisterwerke größtenteils auf eine kaum erklärliche Weise hier vernachlässigt werden, so erfreuen sich doch Glucks Werke gewiß einer würdigen Darstellung.«
»Meinen Sie? – Ich wollte einmal ›Iphigenia in Tauris‹ hören. Als ich ins Theater trete, höre ich, daß man die Ouvertüre der ›Iphigenia in Aulis‹ spielt. Hm – denke ich, ein Irrtum; man gibt diese Iphigenia! Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, womit die ›Iphigenia in Tauris‹ anfängt, und der Sturm folgt. Zwanzig Jahre liegen dazwischen! Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete Exposition des Trauerspiels geht verloren. Ein stilles Meer – ein Sturm – die Griechen werden ans Land geworfen, die Oper ist da! – Wie? hat der Komponist die Ouvertüre ins Gelag hineingeschrieben, daß man sie wie ein Trompeterstückchen abblasen kann, wie und wo man will?«
»Ich gestehe den Mißgriff ein. Indessen, man tut doch alles, um Glucks Werk zu heben.«
»Ei ja!« sagte er kurz und lächelte dann bitter und immer bittrer. Plötzlich fuhr er auf, und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war im Augenblicke wie verschwunden, und mehrere Tage hintereinander suchte ich ihn im Tiergarten vergebens. – –
Einige Monate waren vergangen, als ich an einem kalten regnichten Abende mich in einem entfernten Teile der Stadt verspätet hatte und nun nach meiner Wohnung in der Friedrichsstraße eilte. Ich mußte bei dem Theater vorbei; die rauschende Musik, Trompeten und Pauken, erinnerten mich, daß gerade Glucks »Armida« gegeben wurde, und ich war im Begriff hineinzugehen, als ein sonderbares Selbstgespräch, dicht an den Fenstern, wo man fast jeden Ton des Orchesters hört, meine Aufmerksamkeit erregte.
»Jetzt kömmt der König – sie spielen den Marsch – o paukt, paukt nur zu! – ‘s ist recht munter! ja, ja, sie müssen ihn heute eilfmal machen – der Zug hat sonst nicht Zug genug. – Haha – maestoso - schleppt euch, Kinderchen. – Sieh, da bleibt ein Figurant mit der Schuhschleife hängen. – Richtig, zum zwölftenmal! und immer auf die Dominante hinausgeschlagen. – O ihr ewigen Mächte, das endet nimmer! Jetzt macht er sein Kompliment – Armida dankt ergebenst. – Noch einmal? – Richtig, es fehlen noch zwei Soldaten! Jetzt wird ins Rezitativ hineingepoltert. – Welcher böse Geist hat mich hier festgebannt?«
»Der Bann ist gelöst«, rief ich. »Kommen Sie!«
Ich faßte meinen Sonderling aus dem Tiergarten – denn niemand anders war der Selbstredner – rasch beim Arm und zog ihn mit mir fort. Er schien überrascht und folgte mir schweigend. Schon waren wir in der Friedrichsstraße, als er plötzlich stillstand.
»Ich kenne Sie«, sagte er. »Sie waren im Tiergarten – wir sprachen viel – ich habe Wein getrunken – habe mich erhitzt – nachher klang der Euphon zwei Tage hindurch – ich habe viel ausgestanden – es ist vorüber!«
»Ich freue mich, daß der Zufall Sie mir wieder zugeführt hat. Lassen Sie uns näher miteinander bekannt werden. Nicht weit von hier wohne ich; wie wär es…«
»Ich kann und darf zu niemand gehen.«
»Nein, Sie entkommen mir nicht; ich gehe mit Ihnen.«
»So werden Sie noch ein paar hundert Schritte mit mir laufen müssen. Aber Sie wollten ja ins Theater?«
»Ich wollte ›Armida‹ hören, aber nun –«
»Sie sollen jetzt ›Armida‹ hören! kommen Sie!« –
Schweigend gingen wir die Friedrichsstraße hinauf; rasch bog er in eine Querstraße ein, und kaum vermochte ich ihm zu folgen, so schnell lief er die Straße hinab, bis er endlich vor einem unansehnlichen Hause stillstand. Ziemlich lange hatte er gepocht, als man endlich öffnete. Im Finstern tappend, erreichten wir die Treppe und ein Zimmer im obern Stock, dessen Türe mein Führer sorgfältig verschloß. Ich hörte noch eine Türe öffnen; bald darauf trat er mit einem angezündeten Lichte hinein, und der Anblick des sonderbar ausstaffierten Zimmers überraschte mich nicht wenig. Altmodisch reich verzierte Stühle, eine Wanduhr mit vergoldetem Gehäuse und ein breiter, schwerfälliger Spiegel gaben dem Ganzen das düstere Ansehn verjährter Pracht. In der Mitte stand ein kleines Klavier, auf demselben ein großes Tintenfaß von Porzellan, und daneben lagen einige Bogen rastriertes Papier. Ein schärferer Blick auf diese Vorrichtung zum Komponieren überzeugte mich jedoch, daß seit langer Zeit nichts geschrieben sein mußte, denn ganz vergelbt war das Papier, und dickes Spinnengewebe überzog das Tintenfaß. Der Mann trat vor einen Schrank in der Ecke des Zimmers, den ich noch nicht bemerkt hatte, und als er den Vorhang wegzog, wurde ich eine Reihe schön gebundener Bücher gewahr mit goldnen Aufschriften: »Orfeo«, »Armida«, »Alceste«, »Iphigenia« usw., kurz, Glucks Meisterwerke sah ich beisammenstehen.
»Sie besitzen Glucks sämtliche Werke?« rief ich.
Er antwortete nicht, aber zum krampfhaften Lächeln verzog sich der Mund, und das Muskelspiel in den eingefallenen Backen verzerrte im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr den düstern Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der Bücher – es war »Armida« – und schritt feierlich zum Klavier hin. Ich öffnete es schnell und stellte den zusammengelegten Pult auf; er schien das gern zu sehen. Er schlug das Buch auf, und – wer schildert mein Erstaunen! ich erblickte rastrierte Blätter, aber mit keiner Note beschrieben.
Er begann: »Jetzt werde ich die Ouvertüre spielen! Wenden Sie die Blätter um, und zur rechten Zeit!« – Ich versprach das, und nun spielte er herrlich und meisterhaft, mit vollgriffigen Akkorden, das majestätische Tempo di Marcia, womit die Ouvertüre anhebt, fast ganz dem Original getreu; aber das Allegro war nur mit Glucks Hauptgedanken durchflochten. Er brachte so viele neue geniale Wendungen hinein, daß mein Erstaunen immer wuchs. Vorzüglich waren seine Modulationen frappant, ohne grell zu werden, und er wußte den einfachen Hauptgedanken so viele melodiöse Melismen anzureihen, daß jene immer in neuer, verjüngter Gestalt wiederzukehren schienen. Sein Gesicht glühte; bald zogen sich die Augenbraunen zusammen, und ein lang verhaltener Zorn wollte gewaltsam losbrechen, bald schwamm das Auge in Tränen tiefer Wehmut. Zuweilen sang er, wenn beide Hände in künstlichen Melismen arbeiteten, das Thema mit einer angenehmen Tenorstimme; dann wußte er auf ganz besondere Weise mit der Stimme den dumpfen Ton der anschlagenden Pauke nachzuahmen. Ich wandte die Blätter fleißig um, indem ich seine Blicke verfolgte. Die Ouvertüre war geendet, und er fiel erschöpft mit geschlossenen Augen in den Lehnstuhl zurück. Bald raffte er sich aber wieder auf, und indem er hastig mehrere leere Blätter des Buchs umschlug, sagte er mit dumpfer Stimme:
»Alles dieses, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus dem Reich der Träume kam. Aber ich verriet Unheiligen das Heilige, und eine eiskalte Hand faßte in dies glühende Herz! Es brach nicht; da wurde ich verdammt, zu wandeln unter den Unheiligen wie ein abgeschiedener Geist – gestaltlos, damit mich niemand kenne, bis mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu dem Ewigen. – Ha – jetzt lassen Sie uns Armidens Szene singen!«
Nun sang er die Schlußszene der Armida mit einem Ausdruck, der mein Innerstes durchdrang. Auch hier wich er merklich von dem eigentlichen Originale ab; aber seine veränderte Musik war die Glucksche Szene gleichsam in höherer Potenz. Alles, was Haß, Liebe, Verzweiflung, Raserei in den stärksten Zügen ausdrücken kann, faßte er gewaltig in Töne zusammen. Seine Stimme schien die eines Jünglings, denn von tiefer Dumpfheit schwoll sie empor zur durchdringenden Stärke. Alle meine Fibern zitterten – ich war außer mir. Als er geendet hatte, warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepreßter Stimme: »Was ist das? Wer sind Sie?« –
Er stand auf und maß mich mit ernstem, durchdringendem Blick; doch als ich weiterfragen wollte, war er mit dem Lichte durch die Türe entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte beinahe eine Viertelstunde gedauert; ich verzweifelte, ihn wiederzusehen, und suchte, durch den Stand des Klaviers orientiert, die Türe zu öffnen, als er plötzlich in einem gestickten Galakleide, reicher Weste, den Degen an der Seite, mit dem Lichte in der Hand hereintrat.
Ich erstarrte; feierlich kam er auf mich zu, faßte mich sanft bei der Hand und sagte, sonderbar lächelnd: »Ich bin der Ritter Gluck!«
Kreisleriana (Nr. 1-6)
Wo ist er her? – Niemand weiß es! – Wer waren seine Eltern? – Es ist unbekannt! – Wessen Schüler ist er? Eines guten Meisters, denn er spielt vortrefflich, und da er Verstand und Bildung hat, kann man ihn wohl dulden, ja ihm sogar den Unterricht in der Musik verstatten. Und er ist wirklich und wahrhaftig Kapellmeister gewesen, setzen die diplomatischen Personen hinzu, denen er einmal in guter Laune eine von der Direktion des …r Hoftheaters ausgestellte Urkunde vorwies, in welcher er, der Kapellmeister Johannes Kreisler, bloß deshalb seines Amtes entlassen wurde, weil er standhaft verweigert hatte, eine Oper, die der Hofpoet gedichtet, in Musik zu setzen; auch mehrmals an der öffentlichen Wirtstafel von dem Primo Huomo verächtlich gesprochen und ein junges Mädchen, die er im Gesange unterrichtet, der Prima Donna in ganz ausschweifenden, wiewohl unverständlichen Redensarten vorzuziehen getrachtet; jedoch solle er den Titel als Fürstlich …r Kapellmeister beibehalten, ja sogar zurückkehren dürfen, wenn er gewisse Eigenheiten und lächerliche Vorurteile, z. B. daß die wahre italienische Musik verschwunden sei usw. gänzlich abgelegt, und an die Vortrefflichkeit des Hofpoeten, der allgemein für den zweiten Metastasio anerkannt, willig glaube. – Die Freunde behaupteten, die Natur habe bei seiner Organisation ein neues Rezept versucht und der Versuch sei mißlungen, indem seinem überreizbaren Gemüte, seiner bis zur zerstörenden Flamme aufglühenden Phantasie zu wenig Phlegma beigemischt und so das Gleichgewicht zerstört worden, das dem Künstler durchaus nötig sei, um mit der Welt zu leben und ihr Werke zu dichten, wie sie dieselben, selbst im höhern Sinn, eigentlich brauche. Dem sei, wie ihm wolle – genug, Johannes wurde von seinen inneren Erscheinungen und Träumen wie auf einem ewig wogenden Meer dahin – dorthin getrieben, und er schien vergebens den Port zu suchen, der ihm endlich die Ruhe und Heiterkeit geben sollte, ohne welche der Künstler nichts zu schaffen vermag. So kam es denn auch, daß die Freunde es nicht dahin bringen konnten, daß er eine Komposition aufschrieb oder, wirklich aufgeschrieben, unvernichtet ließ. Zuweilen komponierte er zur Nachtzeit in der aufgeregtesten Stimmung; – er weckte den Freund, der neben ihm wohnte, um ihm alles in der höchsten Begeisterung vorzuspielen, was er in unglaublicher Schnelle aufgeschrieben – er vergoß Tränen der Freude über das gelungene Werk – er pries sich selbst als den glücklichsten Menschen, aber den andern Tag – lag die herrliche Komposition im Feuer. – Der Gesang wirkte beinahe verderblich auf ihn, weil seine Phantasie dann überreizt wurde und sein Geist in ein Reich entwich, wohin ihm niemand ohne Gefahr folgen konnte; dagegen gefiel er sich oft darin, stundenlang auf dem Flügel die seltsamsten Themas in zierlichen kontrapunktischen Wendungen und Nachahmungen, in den kunstreichsten Passagen auszuarbeiten. War ihm das einmal recht gelungen, so befand er sich mehrere Tage hindurch in heiterer Stimmung, und eine gewisse schalkhafte Ironie würzte das Gespräch, womit er den kleinen gemütlichen Zirkel seiner Freunde erfreute.
Auf einmal war er, man wußte nicht wie und warum, verschwunden. Viele behaupteten, Spuren des Wahnsinns an ihm bemerkt zu haben, und wirklich hatte man ihn mit zwei übereinander gestülpten Hüten und zwei Rastralen, wie Dolche in den roten Leibgürtel gesteckt, lustig singend zum Tore hinaushüpfen gesehen, wiewohl seine näheren Freunde nichts Besonderes bemerkt, da ihm gewaltsame Ausbrüche, von irgendeinem innern Gram erzeugt, auch schon sonst eigen gewesen. Als nun alle Nachforschungen, wo er geblieben, vergebens und die Freunde sich über seinen kleinen Nachlaß an Musikalien und andern Schriften berieten, erschien das Fräulein von B. und erklärte, wie nur ihr allein es zukomme, diesen Nachlaß ihrem lieben Meister und Freunde, den sie keineswegs verloren glaube, zu bewahren. Ihr übergaben mit freudigem Willen die Freunde alles, was sie vorgefunden, und als sich auf den weißen Rückseiten mehrerer Notenblätter kleine, größtenteils humoristische Aufsätze, in günstigen Augenblicken mit Bleistift schnell hingeworfen, befanden, erlaubte die treue Schülerin des unglücklichen Johannes dem treuen Freunde, Abschrift davon zu nehmen und sie als anspruchslose Erzeugnisse einer augenblicklichen Anregung mitzuteilen.
1. Johannes Kreislers, des Kapellmeisters, musikalische Leiden
Sie sind alle fortgegangen. – Ich hätt’ es an dem Zischeln, Scharren, Räuspern, Brummen durch alle Tonarten bemerken können: es war ein wahres Bienennest, das vom Stocke abzieht, um zu schwärmen. Gottlieb hat mir neue Lichter aufgesteckt und eine Flasche Burgunder auf das Fortepiano hingestellt. Spielen kann ich nicht mehr, denn ich bin ganz ermattet; daran ist mein alter herrlicher Freund hier auf dem Notenpulte schuld, der mich schon wieder einmal, wie Mephistopheles den Faust auf seinem Mantel, durch die Lüfte getragen hat, und so hoch, daß ich die Menschlein unter mir nicht sah und merkte, unerachtet sie tollen Lärm genug gemacht haben mögen. – Ein hundsföttischer, nichtswürdig vergeudeter Abend! Aber jetzt ist mir wohl und leicht. – Hab ich doch gar während des Spielens meinen Bleistift hervorgezogen und Seite 63 unter dem letzten System ein paar gute Ausweichungen in Ziffern notiert mit der rechten Hand, während die Linke im Strome der Töne fortarbeitete! Hinten auf der leeren Seite fahr ich schreibend fort. Ich verlasse Ziffern und Töne, und mit wahrer Lust, wie der genesene Kranke, der nun nicht aufhören kann zu erzählen, was er gelitten, notiere ich hier umständlich die höllischen Qualen des heutigen Tees. Aber nicht für mich allein, sondern für alle, die sich hier zuweilen an meinem Exemplar der Johann Sebastian Bachschen Variationen für das Klavier, erschienen bei Nägeli in Zürich, ergötzen und erbauen, bei dem Schluß der 30. Variation meine Ziffern finden und, geleitet von dem großen lateinischen Verte (ich schreib es gleich hin, wenn meine Klageschrift zu Ende ist), das Blatt umwenden und lesen. Diese erraten gleich den wahren Zusammenhang; sie wissen, daß der Geheime Rat Röderlein hier ein ganz charmantes Haus macht und zwei Töchter hat, von denen die ganze elegante Welt mit Enthusiasmus behauptet, sie tanzten wie die Göttinnen, sprächen französisch wie die Engel und spielten und sängen und zeichneten wie die Musen. Der Geheime Rat Röderlein ist ein reicher Mann; er führt bei seinen vierteljährigen Dinés die schönsten Weine, die feinsten Speisen, alles ist auf den elegantesten Fuß eingerichtet, und wer sich bei seinen Tees nicht himmlisch amüsiert, hat keinen Ton, keinen Geist und vornehmlich keinen Sinn für die Kunst. Auf diese ist es nämlich auch abgesehen; neben dem Tee, Punsch, Wein, Gefrornen etc. wird auch immer etwas Musik präsentiert, die von der schönen Welt ganz gemütlich so wie jenes eingenommen wird. Die Einrichtung ist so: nachdem jeder Gast Zeit genug gehabt hat, eine beliebige Zahl Tassen Tee zu trinken, und nachdem zweimal Punsch und Gefrornes herumgegeben worden ist, rücken die Bedienten die Spieltische heran für den älteren, solideren Teil der Gesellschaft, der dem musikalischen das Spiel mit Karten vorzieht, welches auch in der Tat nicht solchen unnützen Lärm macht und wo nur einiges Geld erklingt. – Auf dies Zeichen schießt der jüngere Teil der Gesellschaft auf die Fräuleins Röderlein zu; es entsteht ein Tumult, in dem man die Worte unterscheidet: Schönes Fräulein, versagen Sie uns nicht den Genuß Ihres himmlischen Talents – o singe etwas, meine Gute. – Nicht möglich – Katarrh – der letzte Ball – nichts eingeübt. – O bitte, bitte – wir flehen etc. Gottlieb hat unterdessen den Flügel geöffnet und das Pult mit dem wohlbekannten Notenbuche beschwert. Vom Spieltisch herüber ruft die gnädige Mama: »Chantez donc, mes enfants!« Das ist das Stichwort meiner Rolle; ich stelle mich an den Flügel, und im Triumph werden die Röderleins an das Instrument geführt. Nun entsteht wieder eine Differenz: keine will zuerst singen. »Du weißt, liebe Nanette, wie entsetzlich heiser ich bin.« – »Bin ich es denn weniger, liebe Marie?« – »Ich singe so schlecht.« – »O Liebe, fange nur an etc.« Mein Einfall (ich habe ihn jedesmal!), beide möchten mit einem Duo anfangen, wird gewaltig beklatscht, das Buch durchblättert, das sorgfältig eingeschlagene Blatt endlich gefunden, und nun geht’s los: »Dolce dell’ anima etc.« – Das Talent der Fräulein Röderlein ist wirklich nicht das geringste. Ich bin nun fünf Jahre hier und viertehalb Jahre im Röderleinschen Hause Lehrer; für diese kurze Zeit hat es Fräulein Nanette dahin gebracht, daß sie eine Melodie, die sie nur zehnmal im Theater gehört und am Klavier dann höchstens noch zehnmal durchprobiert hat, so wegsingt, daß man gleich weiß, was es sein soll. Fräulein Marie faßt es schon beim achten Mal, und wenn sie öfters einen Viertelston tiefer steht, als das Piano, so ist das bei solch niedlichem Gesichtlein und den ganz leidlichen Rosenlippen am Ende wohl zu ertragen. – Nach dem Duett allgemeiner Beifallschorus! Nun wechseln Arietten und Duettinos, und ich hämmere das tausendmal geleierte Akkompagnement frisch darauf los. Während des Gesanges hat die Finanzrätin Eberstein durch Räuspern und leises Mitsingen zu verstehen gegeben: Ich singe auch. Fräulein Nanette spricht: »Aber liebe Finanzrätin, nun mußt du uns auch deine göttliche Stimme hören lassen.« Es entsteht ein neuer Tumult. Sie hat den Katarrh – sie kann nichts auswendig! – Gottlieb bringt zwei Arme voll Musikalien herangeschleppt: da wird geblättert und geblättert. Erst will sie singen »Der Hölle Rache etc.«, dann »Hebe, sieh etc.«, dann »Ach ich liebte etc.«. In der Angst schlage ich vor »Ein Veilchen auf der Wiese etc.«. Aber sie ist fürs große Genre, sie will sich zeigen, es bleibt bei der Konstanze. – O schreie du, quieke, miaue, gurgle, stöhne, ächze, tremuliere, quinkeliere nur recht munter; ich habe den Fortissimozug getreten und orgle mich taub. – O Satan, Satan! welcher deiner höllischen Geister ist in diese Kehle gefahren, der alle Töne zwickt und zwängt und zerrt. Vier Saiten sind schon gesprungen, ein Hammer ist invalid. Meine Ohren gellen, mein Kopf dröhnt, meine Nerven zittern. Sind denn alle unreine Töne kreischender Marktschreier-Trompeten in diesen kleinen Hals gebannt? – Das hat mich angegriffen – ich trinke ein Glas Burgunder! – Man applaudierte unbändig, und jemand bemerkte, die Finanzrätin und Mozart hätten mich sehr ins Feuer gesetzt. Ich lächelte mit niedergeschlagenen Augen, recht dumm, wie ich wohl merkte. Nun erst regen sich alle Talente, bisher im Verborgenen blühend, und fahren wild durcheinander. Es werden musikalische Exzesse beschlossen: Ensembles, Finalen, Chöre sollen aufgeführt werden. Der Kanonikus Kratzer singt bekanntlich einen himmlischen Baß, wie der Tituskopf dort bemerkt, der selbst bescheiden anführt, er sei eigentlich nur ein zweiter Tenor, aber freilich Mitglied mehrerer Singe-Akademien. Schnell wird alles zum ersten Chor aus dem »Titus« organisiert. Das ging ganz herrlich! Der Kanonikus, dicht hinter mir stehend, donnerte über meinem Haupte den Baß, als säng’ er mit obligaten Trompeten und Pauken in der Domkirche; er traf die Noten herrlich, nur das Tempo nahm er in der Eil’ fast noch einmal so langsam. Aber treu blieb er sich wenigstens insofern, daß er durchs ganze Stück immer einen halben Takt nachschleppte. Die übrigen äußerten einen entschiedenen Hang zur antiken griechischen Musik, die bekanntlich die Harmonie nicht kennend, im Unisono ging; sie sangen alle die Oberstimme mit kleinen Varianten aus zufälligen Erhöhungen und Erniedrigungen, etwa um einen Viertelston. Diese etwas geräuschvolle Produktion erregte eine allgemeine tragische Spannung, nämlich einiges Entsetzen, sogar an den Spieltischen, die für den Moment nicht so wie zuvor melodramatisch mitwirken konnten durch in die Musik eingeflochtene deklamatorische Sätze, z. B. – Ach ich liebte – achtundvierzig – war so glücklich – ich passe – kannte nicht – Whist – der Liebe Schmerz – in der Farbe etc. – Es nahm sich recht artig aus. – (Ich schenke mir ein.) Das war die höchste Spitze der heutigen musikalischen Exposition: nun ist’s aus! So dacht’ ich, schlug das Buch zu und stand auf. Da tritt der Baron, mein antiker Tenorist, auf mich zu und sagt: »O bester Herr Kapellmeister, Sie sollen ganz himmlisch phantasieren; o phantasieren Sie uns doch eins! nur ein wenig! ich bitte!« Ich versetzte ganz trocken, die Phantasie sei mir heute rein ausgegangen; und indem wir so darüber sprechen, hat ein Teufel in der Gestalt eines Elegants mit zwei Westen im Nebenzimmer unter meinem Hut die Bachschen Variationen ausgewittert; der denkt, es sind so Variatiönchen: »Nel cor mi non più sento« – »Ah vous dirai-je, maman etc.«, und will haben, ich soll darauf losspielen. Ich weigere mich: da fallen sie alle über mich her. Nun so hört zu und berstet vor Langweile, denk ich und arbeite drauflos. Bei Nro. 3 entfernten sich mehrere Damen, verfolgt von Titusköpfen. Die Röderleins, weil der Lehrer spielte, hielten nicht ohne Qual aus bis Nro. 12. Nro. 15. schlug den Zweiwesten-Mann in die Flucht. Aus ganz übertriebener Höflichkeit blieb der Baron bis Nro. 30. und trank bloß viel Punsch aus, den Gottlieb für mich auf den Flügel stellte. Ich hätte glücklich geendet, aber diese Nro. 30, das Thema, riß mich unaufhaltsam fort. Die Quartblätter dehnten sich plötzlich aus zu einem Riesenfolio, wo tausend Imitationen und Ausführungen jenes Themas geschrieben standen, die ich abspielen mußte. Die Noten wurden lebendig und flimmerten und hüpften um mich her – elektrisches Feuer fuhr durch die Fingerspitzen in die Tasten – der Geist, von dem es ausströmte, überflügelte die Gedanken – der ganze Saal hing voll dichten Dufts, in dem die Kerzen düstrer und düstrer brannten – zuweilen sah eine Nase heraus, zuweilen ein paar Augen; aber sie verschwanden gleich wieder. So kam es, daß ich allein sitzen blieb mit meinem Sebastian Bach und von Gottlieb wie von einem spiritu familiari bedient wurde! – Ich trinke! – Soll man denn ehrliche Musiker so quälen mit Musik, wie ich heute gequält worden bin und so oft gequält werde? Wahrhaftig, mit keiner Kunst wird so viel verdammter Mißbrauch getrieben als mit der herrlichen, heiligen Musika, die in ihrem zarten Wesen so leicht entweiht wird! Habt ihr wahres Talent, wahren Kunstsinn: gut, so lernt Musik, leistet was der Kunst Würdiges und gebt dem Geweihten euer Talent hin im rechten Maß. Wollt ihr ohne das quinkelieren: nun, so tut’s für euch und unter euch und quält nicht damit den Kapellmeister Kreisler und andere. – Nun könnte ich nach Hause gehen und meine neue Klaviersonate vollenden; aber es ist noch nicht eilf Uhr und eine schöne Sommernacht. Ich wette, neben mir beim Oberjägermeister sitzen die Mädchen am offnen Fenster und schreien mit kreischender, gellender, durchbohrender Stimme zwanzigmal: »Wenn mir dein Auge strahlet« – aber immer nur die erste Strophe, in die Straße hinein. Schrägüber martert einer die Flöte und hat dabei Lungen wie Rameaus Neffe, und in langen, langen Tönen macht der Nachbar Hornist akustische Versuche. Die zahlreichen Hunde der Gegend werden unruhig, und meines Hauswirts Kater, aufgeregt durch jenes süße Duett, macht dicht neben meinem Fenster (es versteht sich, daß mein musikalisch-poetisches Laboratorium ein Dachstübchen ist) der Nachbarskatze, in die er seit dem März verliebt ist, die chromatische Skala hinaufjammernd, zärtliche Geständnisse. Nach eilf Uhr wird es ruhiger; so lange bleib ich sitzen, da ohnedies noch weißes Papier und Burgunder vorhanden, von dem ich gleich etwas genieße. – Es gibt, wie ich gehört habe, ein altes Gesetz, welches lärmenden Handwerkern verbietet, neben Gelehrten zu wohnen: sollten denn arme, bedrängte Komponisten, die noch dazu aus ihrer Begeisterung Gold münzen müssen, um ihren Lebensfaden weiterzuspinnen, nicht jenes Gesetz auf sich anwenden und die Schreihälse und Dudler aus ihrer Nähe verbannen können? Was würde der Maler sagen, dem man, indem er ein Ideal malte, lauter heterogene Fratzengesichter vorhalten wollte! Schlösse er die Augen, so würde er wenigstens ungestört das Bild in der Phantasie fortsetzen. Baumwolle in den Ohren hilft nicht, man hört doch den Mordspektakel; und dann die Idee, schon die Idee: jetzt singen sie – jetzt kommt das Horn etc. – der Teufel holt die sublimsten Gedanken! – Das Blatt ist richtig vollgeschrieben; auf dem vom Titel umgeschlagenen weißen Streifen will ich nur noch bemerken, warum ich hundertmal es mir vornahm, mich nicht mehr bei dem Geheimen Rat quälen zu lassen, und warum ich hundertmal meinen Vorsatz brach. – Freilich ist es Röderleins herrliche Nichte, die mich mit Banden an dies Haus fesselt, welche die Kunst geknüpft hat. Wer einmal so glücklich war, die Schlußszene der Gluckschen »Armida« oder die große Szene der Donna Anna im »Don Giovanni« von Fräulein Amalien zu hören, der wird begreifen, daß eine Stunde mit ihr am Piano Himmelsbalsam in die Wunden gießt, welche alle Mißtöne des ganzen Tages mir gequältem musikalischen Schulmeister schlugen. Röderlein, welcher weder an die Unsterblichkeit der Seele noch an den Takt glaubt, hält sie für gänzlich unbrauchbar für die höhere Existenz in der Teegesellschaft, da sie in dieser durchaus nicht singen will und denn doch wieder vor ganz gemeinen Leuten, z. B. simplen Musikern, mit einer Anstrengung singt, die ihr gar nicht einmal taugt; denn ihre langen, gehaltenen, schwellenden Harmonikatöne, welche mich in den Himmel tragen, hat sie, wie Röderlein meint, offenbar der Nachtigall abgehorcht, die eine unvernünftige Kreatur ist, nur in Wäldern lebt und von dem Menschen, dem vernünftigen Herrn der Schöpfung, nicht nachgeahmt werden darf. Sie treibt ihre Rücksichtslosigkeit so weit, daß sie sich zuweilen sogar von Gottlieb auf der Violine akkompagnieren läßt, wenn sie Beethovensche oder Mozartsche Sonaten, aus denen kein Teeherr und Whistiker klug werden kann, auf dem Piano spielt. – Das war das letzte Glas Burgunder. – Gottlieb putzt mir die Lichter und scheint sich zu wundern über mein emsiges Schreiben. – Man hat ganz recht, wenn man diesen Gottlieb erst sechzehn Jahr alt schätzt. Das ist ein herrliches, tiefes Talent. Warum starb aber auch der Papa Torschreiber so früh; und mußte denn der Vormund den Jungen in die Liverei stecken? – Als Rode hier war, lauschte Gottlieb im Vorzimmer, das Ohr an die Saaltüre gedrückt, und spielte ganze Nächte; am Tage ging er sinnend, träumend umher, und der rote Fleck am linken Backen ist ein treuer Abdruck des Solitärs am Finger der Röderleinschen Hand, die, wie man durch sanftes Streicheln den somnambülen Zustand hervorbringt, durch starkes Schlagen ganz richtig entgegengesetzt wirken wollte. Nebst andern Sachen habe ich ihm die Sonaten von Corelli gegeben; da hat er unter den Mäusen in dem alten Oesterleinschen Flügel auf dem Boden gewütet, bis keine mehr lebte, und mit Röderleins Erlaubnis auch das Instrument auf sein kleines Stübchen transloziert. – Wirf ihn ab, den verhaßten Bedientenrock, ehrlicher Gottlieb, und laß mich nach Jahren dich als den wackern Künstler an mein Herz drücken, der du werden kannst mit deinem herrlichen Talent, mit deinem tiefen Kunstsinn! – Gottlieb stand hinter mir und wischte sich die Tränen aus den Augen, als ich diese Worte laut aussprach. – Ich drückte ihm schweigend die Hand, wir gingen hinauf und spielten die Sonaten von Corelli.
2. Ombra adorata!
Wie ist doch die Musik so etwas höchst Wunderbares, wie wenig vermag doch der Mensch ihre tiefen Geheimnisse zu ergründen! – Aber wohnt sie nicht in der Brust des Menschen selbst und erfüllt sein Inneres so mit ihren holdseligen Erscheinungen, daß sein ganzer Sinn sich ihnen zuwendet und ein neues verklärtes Leben ihn schon hienieden dem Drange, der niederdrückenden Qual des Irdischen entreißt? – Ja, eine göttliche Kraft durchdringt ihn, und mit kindlichem, frommen Gemüte sich dem hingebend, was der Geist in ihm erregt, vermag er die Sprache jenes unbekannten romantischen Geisterreichs zu reden, und er ruft, unbewußt, wie der Lehrling, der in des Meisters Zauberbuch mit lauter Stimme gelesen, alle die herrlichen Erscheinungen aus seinem Innern hervor, daß sie in strahlenden Reihentänzen das Leben durchfliegen und jeden, der sie zu schauen vermag, mit unendlicher, unnennbarer Sehnsucht erfüllen. –
Wie war meine Brust so beengt, als ich in den Konzertsaal trat. Wie war ich so gebeugt von dem Drucke aller der nichtswürdigen Erbärmlichkeiten, die wie giftiges, stechendes Ungeziefer den Menschen und wohl vorzüglich den Künstler in diesem armseligen Leben verfolgen und peinigen, daß er oft dieser ewig prickelnden Qual den gewaltsamen Stoß vorziehen würde, der ihn diesem und jedem andern irdischen Schmerze auf immer entzieht. – Du verstandest den wehmütigen Blick, den ich auf dich warf, mein treuer Freund! und hundertfältig sei es dir gedankt, daß du meinen Platz am Flügel einnahmst, indem ich mich in dem äußersten Winkel des Saals zu verbergen suchte. Welchen Vorwand hattest du denn gefunden, wie war es dir denn gelungen, daß nicht Beethovens große Sinfonie in c-Moll, sondern nur eine kurze, unbedeutende Ouvertüre irgendeines noch nicht zur Meisterschaft gelangten Komponisten aufgeführt wurde? – Auch dafür sei dir Dank gesagt aus dem Innersten meines Herzens. – Was wäre aus mir geworden, wenn, beinahe erdrückt von all dem irdischen Elend, das rastlos auf mich einstürmte seit kurzer Zeit, nun Beethovens gewaltiger Geist auf mich zugeschritten wäre und mich wie mit metallnen, glühenden Armen umfaßt und fortgerissen hätte in das Reich des Ungeheuern, des Unermeßlichen, das sich seinen donnernden Tönen erschließt. – Als die Ouvertüre in allerlei kindischem Jubel mit Pauken und Trompeten geschlossen hatte, entstand eine stille Pause, als erwarte man etwas recht Wichtiges. Das tat mir wohl, ich schloß die Augen, und indem ich in meinem Innern angenehmere Erscheinungen suchte, als die waren, die mich eben umgaben, vergaß ich das Konzert und mit ihm natürlicherweise auch seine ganze Einrichtung, die mir bekannt gewesen, da ich an den Flügel sollte. – Ziemlich lange mochte die Pause gedauert haben, als endlich das Ritornell einer Arie anfing. Es war sehr zart gehalten und schien in einfachen, aber tief in das Innerste dringenden Tönen von der Sehnsucht zu reden, in der sich das fromme Gemüt zum Himmel aufschwingt und alles Geliebte wiederfindet, was ihm hienieden entrissen. – Nun strahlte wie ein himmlisches Licht die glockenhelle Stimme eines Frauenzimmers aus dem Orchester empor:
»Tranquillo io sono, fra poco teco sarò mia vità!«
Wer vermag die Empfindung zu beschreiben, die mich durchdrang! – Wie löste sich der Schmerz, der in meinem Innern nagte, auf in wehmütige Sehnsucht, die himmlischen Balsam in alle Wunden goß. – Alles war vergessen, und ich horchte nur entzückt auf die Töne, die, wie aus einer andern Welt niedersteigend, mich tröstend umfingen. –