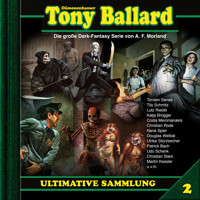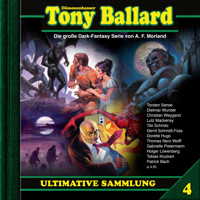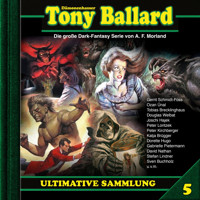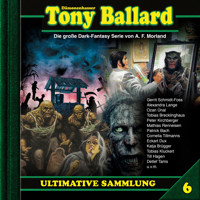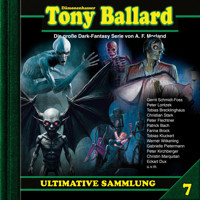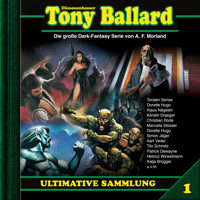1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Er war auf einmal da. Doch niemand beachtete ihn, obwohl er eine Machete in der Hand hielt, deren Klinge rot glühte. Das Publikum war außer Rand und Band.
Es kreischte, tobte und grölte vor Begeisterung. Auf der Bühne krümmte und wand sich der halb nackte, übergewichtige, langhaarige, wie ein Schwein schwitzende Mons Ritter, die neue Rap-Ikone von Inverness, die von seinen Fans aus tiefster Seele geliebt und so überschwänglich angebetet wurde, als hätte Gott nicht ihn, sondern er Gott erschaffen.
Und mittendrin in diesem brodelnden, kochenden, ekstatischen Menschenmeer stand das Böse - das Grauen - der Tod ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Amazonen-König
Special
Vorschau
Impressum
Der Amazonen-König
Ein Tony Ballard Roman
von A.F. Morland
Er war auf einmal da. Doch niemand beachtete ihn, obwohl er eine Machete in der Hand hielt, deren Klinge rot glühte.
Das Publikum war außer Rand und Band. Es kreischte, tobte und grölte vor Begeisterung. Auf der Bühne krümmte und wand sich der halb nackte, übergewichtige, langhaarige, wie ein Schwein schwitzende Mons Ritter, die neue Rap-Ikone von Inverness, die von seinen Fans aus tiefster Seele geliebt und so überschwänglich angebetet wurde, als hätte Gott nicht ihn, sondern er Gott erschaffen. Und mittendrin in diesem brodelnden, kochenden, ekstatischen Menschenmeer stand das Böse – das Grauen – der Tod ...
Mons Ritter brüllte voller Wut, Hass und Verachtung sein neuestes provokantes, Minderheiten diskriminierendes, Menschen verachtendes Traktat ins Mikrofon, und es war erstaunlich, wie textsicher alle schon waren.
Obgleich die Message des Songs politisch brisant, extrem fremdenfeindlich und in höchstem Maße verabscheuungswürdig war, gingen alle voll mit. Nicht ahnend, dass der Macheten-Teufel soeben in aller Ruhe seine Wahl traf. Er hieß Xag-Ganoum. Sein Blut war schwarz wie altes Motoröl, und er hielt auf der Erde seit geraumer Zeit reiche Ernte unter den Lebenden.
Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, der Hölle Seelen zu verschaffen, und ging dabei nicht nur sehr grausam, sondern auch ziemlich wahllos vor.
Man nannte ihn einmal Macheten-Teufel, dann wieder Macheten-Dämon oder Seelen-Collector. Auch Macheten-Monster oder Macheten-Bestie hatte man ihn schon genannt.
Sein beängstigender Eifer kannte keine Grenzen. Die Blutspur, die er hinterließ, zog sich über alle fünf Kontinente. Wohin der gnadenlose Killer mit der Machete auch kam – überall rollten Köpfe und entwichen zerstörten Leibern die Seelen, die er »befreit« hatte. Jetzt war er auf einem Mons-Ritter-Konzert erschienen und suchte sich im zum Bersten vollen Stadion mit träger Gelassenheit unter den Umstehenden sein nächstes Opfer aus, während der schwammige Rapper auf der riesigen Bühne seine sittenlose Show abzog und mit hässlichen Parolen die Herzen seiner Anhänger vergiftete.
»Der Mann ist ultracool!«, brüllte Toby Kelechi gegen den Dezibel-Tsunami, der aus den gewaltigen Boxentürmen kam, seine neue Freundin an. »Hammerstark!« Es war nicht leicht, sich gegen die mächtige Beschallungsanlage durchzusetzen und verständlich zu machen. »Megakrass!« Die Adern traten ihm weit aus dem Hals. »Ich bin total geflasht!«
Die rothaarige, sommersprossige Eris Thompson nickte hingerissen. »Mons Ritter ist echt irre heiß!«, gab sie schreiend zurück. »Ich liiiebe ihn!«
Hinter Toby Kelechi nahm der Mann mit der Machete gemächlich und präzise Maß.
†
Es war sehr traurig.
Wir hatten Kopf und Kragen riskiert, um Rigani, die Tochter des zeitreisenden Druiden A-Mhòr, wie versprochen, aus der Hölle zurückzuholen.
Ihr Schicksal war bereits besiegelt gewesen. Man hatte sie in eine grauenvolle Todeszone gebracht, wo sie von Banon, einem schlammgrauen, stinkenden Riesen mit gefährlichen schwarzen Geierkrallen, bewacht worden war.
In einem eisernen Käfig, der ihre magischen Kräfte sukzessive geschwächt hatte, hätte sie grausam darben, verhungern, verdursten und schließlich, nach ihrem qualvollen Tod, verwesen sollen. Es war nicht einfach gewesen, sie zu befreien, doch wir hatten es geschafft.
Aber Grund zur Freude hatten wir danach nicht gehabt, denn die junge Druidin, die wir ihrem Vater übergeben hatten, hatte nicht mehr gelebt, war aber auch nicht richtig tot gewesen. Rigani schwebte seit damals irgendwo zwischen einer Vielfalt von mysteriösen Existenzmöglichkeiten, die niemand durchschauen konnte.
Es war ihr weder gegönnt, richtig zu leben, noch konnte sie richtig sterben und das war für den viele hundert Jahre alten Keltenpriester ein nachgerade unerträglich schmerzlicher Zustand, den er nun schweren Herzens auf die eine oder andere Art beenden wollte.
Er war zu uns gekommen. Ein gebrochener alter Mann. Hochgewachsen, schlank, mit einem langen weißen Bart. Eingehüllt in einen schlichten Druiden-Ornat.
Sein linkes Auge war braun, das rechte grün. In ihnen sah ich eine unendliche Traurigkeit, die mich mit ihm leiden ließ. Wir saßen auf unserer großen Penthouse-Terrasse – meine Frau Vicky, der gebrochene Zeitreisende und ich.
A-Mhòr hatte kürzlich auf eine Weise mit seiner »lebendig-toten« Tochter Zwiesprache gehalten, die man als Mensch unmöglich nachvollziehen konnte. Der uralte Kelte hatte sich nicht einmal selbst erklären können, welche geheimnisvollen Kräfte diesen Dialog ermöglicht hatten. Und warum.
Schließlich passierte erfahrungsgemäß ja nie etwas nur einfach so. Man konnte den Grund nur nicht immer sofort erkennen. Es war dem weißbärtigen Zeitreisenden nach wie vor ein Rätsel, wer oder was dieses Zwiegespräch zugelassen hatte. Es stand lediglich fest, dass sich A-Mhòr mit seiner – halb toten, halb lebenden – Tochter gedanklich ausgetauscht hatte. Nur dieses eine Mal. Danach nie wieder.
»Rigani bat mich, loszulassen«, erinnerte sich der hagere Druide. »Sie nannte mich Tad. Das ist das keltische Wort für Vater. Mir ging das tief unter die Haut. Ich war gerührt, ergriffen, bewegt, versuchte ihr aber dennoch klarzumachen, dass es mir unmöglich wäre, ihrem Verlangen nachzukommen. Dass das für mich einer Selbstaufgabe gleichkäme. Sie verlangte von mir, ich solle mich in Geduld fassen. In – in – in Geduld ... Bei allen Göttern ... Das hatte ich doch schon so lange getan ... Ich müsse warten, sagte sie. Ich wollte wissen, worauf. Darauf antwortete sie: ›Auf der Flüstern der Elemente.‹«
A-Mhòr sprach nicht weiter. Ich warf Vicky einen fragenden Blick zu. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf. Lass ihm Zeit, sollte das wohl heißen. Ich nahm einen Schluck von meinem Pernod und wartete.
»Warten«, murmelte der Druide nach einer Weile geistesabwesend. »Warten solle ich ... Auf das Flüstern der Elemente ...« Er ließ die schmalen Schultern noch mehr hängen.
Ich wusste, dass den Druiden die Elemente sehr wichtig, ja nachgerade heilig waren.
»Manchmal«, fuhr A-Mhòr fort, »nehmen sie mit uns Druiden Kontakt auf, geben uns Ratschläge, erteilen uns Befehle, die wir besser nicht unbeachtet lassen, weil sie das sehr ärgerlich macht. Und zornige Elemente können sehr viel Unheil bringen.« Er sah uns niedergeschlagen an. »Ich habe die größten Erwartungen in dieses sehnsüchtig erhoffte Flüstern gesetzt, aber es blieb aus. Tagaus, tagein habe ich auf einen Rat aus der weisen, allwissenden Unendlichkeit gewartet. Auf eine Empfehlung, was man noch tun könne, um Riganis unhaltbaren Zustand zu beenden – ihr sphärisches Ich von da, wo es sich zurzeit aufhält, aus dieser transzendentalen Zwischenwelt, zurückzuholen.« Er atmete schwer aus. »Ich habe mich wahrlich lange in Geduld gefasst. Die Götter sind meine Zeugen. Es hat nichts genützt.«
Vicky fragte behutsam: »Kann man dieses Flüstern der Elemente nicht irgendwie ...«
»Man kann es nicht erzwingen«, fiel ihr der Zeitreisende deprimiert ins Wort. »Entweder es kommt von selbst, oder es bleibt aus.«
»Vielleicht kommt es noch«, sagte Vicky. Ihr Zweckoptimismus sollte ihm Mut machen.
Doch A-Mhòr schüttelte enttäuscht den Kopf. »Ich kann und will nicht mehr. Ich spüre und weiß, dass es sinnlos ist, noch länger auf etwas zu hoffen, das nie kommen wird. Dieses lange Warten und die damit verbundene Ungewissheit haben mich zermürbt. Ich musste erkennen und akzeptieren, dass es für mein Kind und mich keine Hilfe von den Elementen geben wird, und sehe mich nun gezwungen, diesen schweren Schicksalsschlag irgendwie zu meistern und eigene Entscheidungen zu treffen und zu verantworten – mögen sie auch noch so schmerzlich sein.«
Ich blickte in mein halb volles Pernod-Glas. »Was hast du vor, mein Freund?«, erkundigte ich mich. Ich hatte eine bange Ahnung.
Der Zeitreisende presste die Lippen verbittert zusammen. »Ich ertrage den Anblick dieses furchtbaren Elends nicht mehr, Tony Ballard.«
»Was wirst du also tun?«, fragte ich.
A-Mhòr sah mich ernst an. »Ich werde Rigani gehen lassen.«
Vicky erschrak. »Gehen lassen?«, fragte sie besorgt. »Was meinst du damit, A-Mhòr?«
»Ich werde mein geliebtes Kind aufgeben«, erklärte der Druide mit brüchiger Stimme.
†
Eris Thompson bückte sich, fummelte kurz unter ihrem Minirock herum, zog hastig ihr lachsfarbenes Höschen aus, drehte es über ihrem dichten roten Schopf um den Zeigefinger und kreischte in Richtung Bühne: »Hey! Hey, Mons Ritter, ich möchte ein Kind von dir!«
Toby Kelechi hatte nichts dagegen, dass sie das rief. Er war nicht eifersüchtig und konnte ihren Enthusiasmus voll verstehen. Wenn er ein Mädchen gewesen wäre, hätte er das bestimmt ebenfalls gerufen – wie Hunderte anderer weiblicher Fans ringsherum. Und bei jedem Mons-Ritter-Gig. Vielleicht hätte er sich sogar zu einem wesentlich unmoralischeren Angebot hinreißen lassen.
Ssssrt!
Zu den vielen Sommersprossen in Eris Thompsons Gesicht und in ihrem sehr offenherzigen Dekolletee gesellten sich plötzlich warme, dunkelrote Blutspritzer. Eris hatte keine Ahnung, woher sie kamen. Und sie hatte auch noch nicht realisiert, dass das Blut war, was auf ihrer hellen Haut klebte.
Eine totale Schockstarre ergriff von ihr Besitz. Es roch auf einmal nach verbranntem Fleisch. Doch niemand nahm es wahr, denn die enorme Faszination, die nach wie vor von Mons Ritter, dem absoluten Rapper-King, ausging, und seine unbeschreibliche Überpräsenz auf der riesigen Bühne waren einfach zu fesselnd. Über Toby Keleckis Gesicht huschte ein letztes, verständnisloses Zucken.
Es schien ihm schwerzufallen, zu begreifen, dass er nicht mehr lebte. Obgleich er tot war, stand er noch stocksteif, bleich und mit einem glänzenden dunkelroten Blutring um den Hals in der dicht gedrängten Menge.
Seelenlos!
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Toby seinen abgeschlagenen Kopf verlor. Noch saß er locker auf dem Halsstumpf. Vielleicht war der unbeabsichtigte Rippenstoß eines Nachbarn schuld daran, dass der Kopf plötzlich wackelte und dann nach hinten kippte.
Und es währte noch um einiges länger, bis um Toby Kelechi und Eris Thompson herum endlich die längst fällige Panik ausbrach. Die war dann aber äußerst gefährlich, weil der Fluchtreflex bei allen Zuschauern gleichzeitig einsetzte. Sie stürmten schreiend nach allen Seiten davon und trampelten alles und jeden nieder, der ihnen im Weg stand. Es gab Verletzte. Blut floss.
Knochen brachen und Xag-Ganoum, der Macheten-Teufel, hätte es begrüßt, wenn es auch Tote gegeben hätte. Die rote Glut seiner Machete erlosch. Er ließ sie unter seinem Trenchcoat verschwinden und hatte keine Mühe, einem unscheinbaren Tor, das niemand beachtete, zuzustreben. Schwarze Magie stützte ihn und schirmte ihn ab. Sie machte ihn zum Prellbock, zum Fels in der Brandung. Man konnte ihn nicht zu Boden stoßen. Er brauchte keine Sorge zu haben, dass er dieser mörderischen Menschen-Stampede zum Opfer fallen würde.
Sein Weg führte ihn in einen breiten, nüchternen Betongang. Draußen wütete, pulsierte, kochte und dampfte das schreckliche Chaos. Hier drinnen war davon so gut wie nichts zu hören, sobald er die Tür geschlossen hatte.
Er wähnte sich allein. Und das war er auch. Aber nur ganz kurze Zeit. Dann rief hinter ihm plötzlich jemand mit strenger Stimme: »He! He, Sie da!«
Xag-Ganoum blieb stehen, drehte sich provokant langsam um und sah einen untersetzten, breitschultrigen, kräftigen Mann mit einer neongelben Warnweste auf sich zukommen. »Meinen Sie mich?«, fragte der Seelen-Collector ungerührt.
»Sehen Sie sonst noch wen?«, fragte Milo Metz, der Sicherheitsmann, ätzend zurück.
»Ja, Sie.«
»Ich werde mich ja wohl kaum selbst rufen.«
Xag-Ganoum grinste angriffig. »Das kommt auf Ihren Geisteszustand an.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, blaffte der Gelbwestenmann gereizt.
»Dass es für Sie besser gewesen wäre, mir nicht zu folgen«, lautete die Antwort des Macheten-Teufels. »Und schon gar nicht, mich aufzuhalten.«
Milo Metz konnte den Fremden aus einem unerfindlichen Grund nicht riechen. Er deutete mit dem Kopf nach vorn. »In dieser Richtung gibt es keinen Ausgang«, sagte er frostig. »Sehen Sie die Wand mit dem Graffiti-Geschmiere? Dort endet der Gang.«
Xag-Ganoum bleckte seine kräftigen Zähne. »Und wo endet Ihr Leben?«
Milo Metz riss die Augen auf. »Sagen Sie mal, sind Sie besoffen?«, schnauzte er den Macheten-Dämon wütend an. »Oder high? Oder einfach nur unverfroren, rotzfrech und saudumm?«
Xag-Ganoums Züge nahmen einen grausamen Ausdruck an. Seine dunklen Augen funkelten böse. »Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort, Kumpel«, knurrte er. »Es wäre für dich gesünder gewesen, wenn du dich nicht um mich gekümmert hättest, denn jetzt geht es dir im wahrsten Sinne des Wortes an den Kragen. Weißt du, wen du vor dir hast?«
»Einen offensichtlich Geistesgestörten, dem ich gleich die vorlaute Fresse polieren werde.«
Xag-Ganoum öffnete seinen Trenchcoat.
»Oh, verdammt!«, entfuhr es Metz, als er die Machete erblickte. Er griff blitzschnell nach seinem klobigen Funkgerät und schrie aufgeregt hinein: »Hilfe! Ich habe hier einen Terroristen! Ich brauche dringend Unterstützung!« Er gab hektisch durch, wo er sich im Moment befand.
Doch Xag-Ganoum sorgte dafür, dass niemand es hörte. Er störte mit seiner Magie die Frequenz so nachhaltig, dass der Hilferuf nirgendwo ankam.
Und dann – zog er ganz langsam die Machete aus dem Gürtel ...
†
»Aufgeben«, echote Vicky blass. Sie strich sich eine Strähne ihres langen blonden Haares aus dem Gesicht. Verwirrung funkelte in ihren veilchenblauen Augen. Sie sah den Zeitreisenden unsicher an. »Was meinst du mit aufgeben, A-Mhòr?«
»Ich habe mich dazu durchgerungen, meine Tochter gehen zu lassen«, sagte der Kelte schleppend. »Ich bin des Kämpfens müde, kann nicht mehr. Meine Kräfte sind komplett erschöpft.«
Vicky kniff die Augen zusammen. »Wie muss man sich das vorstellen?«, fragte sie. »Wenn du Rigani aufgibst, wenn du sie gehen lässt ... Was passiert dann? Was geschieht dann mit deiner Tochter?«
»Ich habe vor, sie zu bestatten«, antwortete A-Mhòr ernst.
»Du willst sie lebendig begraben?«, fragte Vicky entsetzt.
Der Druide schüttelte den Kopf. »Nicht begraben. Und ... sie lebt nicht mehr.«
»Aber sie ist auch nicht ganz tot«, warf ich ein.
»Sie wird es nach der Bestattung sein«, erklärte der Zeitreisende.
»Das ...« Vicky leckte sich aufgeregt die Lippen. »Verzeih mir, dass ich das so brutal formuliere, A-Mhòr. Aber was du vor hast, ist schlicht und ergreifend Mord! Ich kann nicht glauben, dass du wirklich vorhast, dein Kind, dein eigen Fleisch und Blut, zu töten.«
»An welche Art von Bestattung hast du denn gedacht?«, wollte ich wissen.
»Sie wird auf einem Floß liegen«, gab A-Mhòr gedämpft zur Antwort. »Umgeben von all den Blumen, die sie geliebt hat. Geschmückt mit heiligen Pflanzen, Wurzeln und Kräutern. Ich werde Brandpfeile auf das Floß schießen, sobald sich das Floß weit genug vom Ufer entfernt hat, und mein Kind wird auf dem Wasser ein würdiges Ende finden.«
»Sie wird bei lebendigem Leib verbrennen«, sagte Vicky erschüttert. »Das ist barbarisch, A-Mhòr. Das darfst du ihr nicht antun.«
»Sie wird es nicht spüren«, behauptete der Druide.
»Wieso nicht?«, fragte ich.
Der Kelte sah mich an. »Weil ich sie zuvor in einen magischen Tiefschlaf versetzen werde.«
»Es bleibt trotzdem Mord«, sagte Vicky sichtlich bewegt. »Eine Straftat. Ein Verbrechen, das du nicht begehen darfst.«
A-Mhòr sah sie finster an. »Ich fühle mich euren Gesetzen gegenüber nicht verpflichtet. Sie gelten für mich nicht. Ich komme aus einer Zeit, in der Bestattungen dieser Art völlig legal waren und tagaus, tagein praktiziert wurden.«
»Du bist Gast in unserer Zeit«, sagte Vicky leidenschaftlich. »Also hast du dich an die hier geltenden Gesetze zu halten.«
»Ich kann eure Zeit verlassen, wann immer ich möchte«, behauptete A-Mhòr.
Ich hielt dagegen: »Aber solange du hier bist ...«
»Glaube mir, Tony Ballard«, unterbrach mich der bärtige Druide. »Es muss sein. Rigani leidet. Und ich leide mit ihr. Das muss – und wird –ein Ende haben.«
†
Milo Metz wich nervös zurück. »Bleib mir vom Leib, du krankes Schwein, hörst du? Meine Kollegen werden gleich hier sein. Und dann ...«
Xag-Ganoum lächelte spöttisch. »Bist du sicher, dass deine Kollegen dich gehört haben?«
Die einzige Waffe, die dem aufgewühlten Security zur Verfügung stand, war ein Pfeffer-Spray. Er hakte die Dose hastig von seinem Gürtel los und richtete sie aufgewühlt gegen den unheimlichen Seelen-Collector.
»Du bleibst, wo du bist«, krächzte der Gelbwestenmann. »Sonst ...«
»Sonst?« Xag-Ganoum machte ganz kleine Schritte auf Metz zu.
»Sonst verpasse ich dir eine geballte Pfefferladung«, fauchte Milo Metz aggressiv. »Du ahnst nicht, wie höllisch weh das tut.«
»Höllisch.« Xag-Ganoum schnalzte mit der Zunge, als hätte er von etwas höchst Delikatem gekostet. »Was für ein wunderbares Wort. Ich liebe es. Möchtest du wissen, was hier in Kürze passieren wird? Ich werde dir den Kopf abschlagen und deine Seele in die Hölle schicken.«
»Hilfe!«, krächzte Milo Metz fahrig in sein Sprechfunkgerät – mit dem er weiterhin niemanden erreichen konnte, weil Xag-Ganoum es magisch verhinderte. »Hilfe! Hört mich denn keiner? Ich habe einen gefährlichen Guerilla mit einer verdammten Machete gestellt und brauche dringend Verstärkung! Der Mann hat gedroht, mir den Kopf abzuschlagen!«
Xag-Ganoum schüttelte ernst den Kopf. »Nicht gedroht«, korrigierte er den Security. »Ich habe es angekündigt. Versprochen. Bindend festgelegt.«
Metz' Nervenstränge vibrierten. Angst kroch ihm in die Glieder, obwohl er kein Schwächling war. Er wusste nicht, was er tun sollte.
Den unheimlichen Unbekannten angreifen? Den Pfeffer-Spray einsetzen? Fliehen? War Letzteres überhaupt noch möglich? Der furchteinflößende Kerl war schon sehr nahe. Milo Metz befand sich bereits in Macheten-Reichweite. Er drückte hysterisch auf den Sprühknopf. Xag-Ganoum bekam die volle Pfefferspray-Ladung in beide Augen. Er machte sich nicht die Mühe, sie abzuwehren, drehte sich nicht einmal zur Seite.
Normalerweise hätte bei ihm jetzt ein heftig brennender Schmerz einsetzen müssen. Seine Schleimhäute hätten augenblicklich anschwellen müssen. Die Flüssigkeit hätte bei ihm Husten und Atemnot auslösen müssen. Er hätte gequält aufbrüllen und wie blind zurücktaumeln müssen. Doch er zeigte nicht die geringste Wirkung. Wie war das möglich? Metz stand vor einem Rätsel. Er konnte sich das einfach nicht erklären.
Kein Mensch kann die Wirkung des extrem effizienten Reizstoffs Capsaicin auf diese Weise wegstecken, hallte es im Kopf des Security-Mannes. Das geht gar nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Das schafft niemand. Wieso er? Ist ... er ... vielleicht ... gar ... kein ... Mensch? Mein Gott, was denke ich denn da?
Xag-Ganoum lachte verächtlich. »Ich glaube, jetzt hast du's gecheckt.«
†
Vicky und ich zwangen dem Zeitreisenden eine Art Stillhalteabkommen auf. Wir rangen ihm die Zusage ab, die – in unseren Augen grausame – Bestattung seiner Tochter noch für kurze Zeit auszusetzen.
»Was versprecht ihr euch davon?«, wollte der alte Druide desillusioniert wissen.
»Es wäre doch denkbar, dass noch nicht alle Möglichkeiten voll ausgeschöpft sind«, sagte ich.
»Sie sind es«, behauptete der Druide überzeugt.
»Vielleicht wirfst du das Handtuch zu früh«, entgegnete ich.