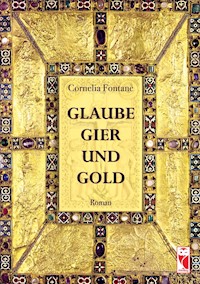
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frieling-Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Herzen Europas liegt das idyllische Kloster Echterville. Die Landschaft wird geprägt von weitläufigen Wiesen, malerischen Bergen und dichten Wäldern. Doch der Schein trügt. Während einer Springprozession setzt eine Mutter ihr Kind beim Sarkophag des Heiligen Willibrord ab. Dieses Kind nimmt der Gangster-Clan-Chef Jacco an sich. So wächst das Mädchen, welches fortan Lynn genannt wird, auf dem Kogge-Mühlen-Hof auf. Hier werden Waisenkinder zu Trickbetrügern ausgebildet. Doch eines Tages kommt es zu einem tödlichen Unfall. Lynn wird verkauft, wächst bei einer Pflegefamilie auf und wird Krankenschwester. Bei einem Besuch im alten Kloster-Skriptorium kommt Lynn mit einigen dort ausgestellten Kostbarkeiten in Kontakt. Ein "Goldschatz" lässt dabei nicht nur Lynns diebische Finger jucken, sondern auch Raufbold Rasko wittert einen Clou. Hat etwa der ambitionierte Priester Gular etwas damit zu tun? Das Ermittlerteam mit dem Kommissaren-Duo Theo und Leo will der Sache auf den Grund gehen, da geschieht ein weiterer Mord auf der Grenzbrücke und ein Inspektor Le Filou aus Park-de-Lux kommt ihnen ins Gehege, beansprucht seine Zuständigkeit. Dann mischt sich auch noch die schrullige Tanne Grete in die Ermittlungen ein. Und was das mit einer dicken Klosterschwester und Lynns Mutter zu tun hat, bleibt amüsant und spannend zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlungen und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
Manchmal, im Leben Du hast nur Jetzt Du hast nur Worte Vielleicht der Unterschied Vielleicht Sinn
Sometimes, in Life You only have now You only have words Maybe a difference Maybe sence
To Mom & Dad Thanks to Granny & Ant To my husband & children Für AllerEiflerSeelen Für Cornelia Goethe
Inhalt
Maiglockengift
Bernsteinfrühling
Elsterdiebische Retourkutsche
Gotik, Gold und Purpur
Nebellichter
Jagdlabyrinth
„Grenzenlose“ Ermittlungen
Dunkle Geschäfte
Pilgern mit tödlichen Sprüngen
Das Hütchen-Spiel
Metamorphose
Licht am Ende des Tunnels?
Kapitel 1
Maiglockengift
Eine junge Frau ging am Ufer eines Flusses in die Hocke, und es schien so, als wollte sie schreien, tat es aber aus Scham nicht.
Sie beugte sich, sie schaukelte vor, zurück. Zwischen den hohen Gräsern und verschiedenen Moosgewächsen, die in allen Grüntönen von Jade bis Türkis schimmerten, ließ sie sich fallen und berührte das Wasser. Die dadurch ausgelösten Wellen zogen ihre Kreise. Mit der Hand umgriff sie einen Zweig, so sehr, dass sich weiße Knochenkuppen auf einem ihrer Handrücken bildeten. Sie schrie. Sie schloss ihre Augen, stöhnte stumm. Gelegentlich rollte das Becken. Dann streckte sie sich vor, ihre Sehnen am Hals traten hervor. Flehend schaute sie zum Himmel. Dort oben im Mondlicht breitete sich ein gigantisches Wolkengebilde aus, das sich später mit der aufgehenden Sonne fast wie eine Freskenmalerei vor hellblauem Hintergrund darbot. Die Frau hechelte mal laut, mal leise, dann stieß sie einen heftigen Schrei aus.
Zeitgleich erhob sich ein außergewöhnliches Morgenlicht über das Tal, über das Vallée de la Sûre, über zarte grüne Knospen, die wie Ikonengold glänzten. Der Fluss plätscherte friedlich vor sich hin, wie feinperliger Wein, und es duftete angenehm nach Walnuss und Birne. Umringt von Felsen und Bäumen wirkte dieses Tal malerisch, wie ein von der Natur komponiertes Bild, eingerahmt in Eichen mit Spuren von Patina. Beinahe zu friedlich für das, was dann passierte.
In diesem „Still-Leben“ regte sich etwas. Man hörte Schreie. Die Frau presste ihre Lippen zusammen. Einige wild wachsende Sträucher schirmten sie ab gegen die Blicke der ersten Pilger, die mit Kreuz und Bibel auf der anderen Uferseite ahnungslos vorbeimarschierten. Ihre Augen quollen hervor. Blutstropfen rannen. Im Wasserspiegel blickte sie in ein verzerrtes Gesicht.
Jenseits lag die Benediktinerabtei. Mit Garten, Residenz und der vorgelagerten Ortschaft wirkte sie wie ein architektonisches Gesamtkunstwerk. In Sichtachse befand sich ein Pavillon und hinter dem Wald lag das dazugehörige „Lustschloss“ Weiler, wie es genannt wurde. Wobei Letzteres zu dem angrenzenden Gutland gehörte, weil dieser Fluss durch zahlreiche Kriegs- und Friedensabkommen zur Staatsgrenze geworden war. Dennoch, diese Klosteranlage mit ihren symmetrisch beschnittenen Baumhecken, üppigen Blumenbeeten und großflächigen, ornamentalen Rasenflächen wirkte erhaben, wie ein Prestigeprojekt. Und diese Aura umgibt sie noch heute.
Trotz – oder gerade wegen – des Zeit- und Leistungsdrucks der modernen Zeit fanden nicht wenige Menschen Hinwendung und Trost im Glauben. Andere hingegen machten hinter den Wäldern Karriere, hinter den ausgedehnten Auenlandschaften, wo im fernen Horizont die Türme von Lux-City glitzerten.
Das Kind kam zur Welt. Nach dem Saugen an ihrer Brust wusch sie ihrem Wonneproppen über die Stirn. Goldene warme Sonnenstrahlen wärmten sie und es schien, als stimme die Natur sie versöhnlich. Sie summte ein Wiegenlied. Sie küsste die winzigen Babyfinger, jeden einzeln, die freudig nach ihr griffen. Die junge Frau wickelte das Kind, richtete sich auf und ging über die Grenze. Es war Pfingsten. Der Tag war noch jung und um diese Zeit war – abgesehen von einigen Pilgern – wenig los. So konnte sie fast unbemerkt vom Gutland aus die alte Steinbogenbrücke passieren. Linker Hand lagen die Güter des Klosters. Vor ihr breitete sich Park-De-Lux aus, ein unscheinbares Land, das sanft und edel wie eine barocke Perle im Herzen Europas lag.
Sie erreichte ein kleines Städtchen mit dem Namen Echterville, das in seinen besten mittelalterlichen Tagen eine kleine Metropole gewesen war und zu einem Reich gehört hatte, das bis nach Rom reichte.
Damals wie heute bereiteten sich die Menschen auf ein alljährliches „Spektakel“ vor. So bauten Arbeiter Tribünen auf und errichteten Absperrgitter. Einheimische rollten den roten Teppich aus. Die Hochwürden kamen. In purpurfarbenen Gewändern, mit goldverzierter Mütze und Bischofsstab schritten sie auf eine Empore. Sie standen da mit ernsten Gesichtern und großen Erwartungen. Sakrale Doktrin, wie dazumal.
Zwischen alledem schlich sich die Frau mit dem Kind durch enge Gassen. Unbemerkt stolperte sie über das Kopfsteinpflaster. Sie stieg eine schmale Mauertreppe hinauf. Oben angekommen, stand sie auf einem von bogenförmigen Arkaden umringten Vorplatz. Über ein pompöses Treppenportal gelangte sie in das Kirchenschiff. Ungeachtet der Stille stöckelte sie an erhabenen Säulen vorbei, ging eine Seitentreppe hinunter in die unterirdische Krypta. Ein mystischer Raum mit vielen steinernen Sarkophagen. Hier zündete sie, wie alle Gläubigen, eine Kerze an, nur dass sie nicht katholisch war. Kurz darauf vergewisserte sie sich, dass niemand in der Nähe war. Sie nahm von der heiligen Wasserquelle und legte gleich neben dem weißen Marmorschrein ihr Neugeborenes ab. Dann stand sie auf und ging.
Plötzlich erschallten tiefe, vollgriffige Orgeltöne, gefolgt von leichteren Klängen, sanft wie Regentropfen. Das jagte der Frau einen ordentlichen Schreck ein, die daraufhin mit schmerzverzerrtem Gesicht, sich die Ohren zuhaltend, durch den Mittelgang eilte, vorbei an noch leeren Kirchenbänken. Dann kehrte Stille ein.
Weitere Musiker saßen auf Stühlen und bildeten ein kleines Ensemble vor dem Hauptaltar, der ein einziges Blockgestein darstellte, aber mit dem päpstlichen Wappen – Glöcklein mit Schirm – versehen war. Eine Dame im Abendkleid zupfte die Harfe und zartweiche Töne breiteten sich aus und verklangen. Ein Quartett führte die Bögen seiner Violinen und von der Orgel begleitet traten nun fein säuberlich gekämmte Knaben mit zeitversetzten ineinanderfließenden Gesängen in den Vordergrund. Das Ganze hatte etwas von den Gärten des Barock. Die Feierlichkeit wuchs noch über sich hinaus, als eine Solo-Sopranstimme mit „Gloria in excelsis Deo“ einsetzte, und es war schon eigenartig, in welch rascher Geschwindigkeit sich die eintretenden Bürger in verzückt fromme Bittsteller verwandelten. Hingegen nahm niemand von der Frau Notiz, die sich in Richtung Ausgang bewegte. Unverhofft stieß sie mit jemandem zusammen, und einen kurzen Moment sah es so aus, als würden sie einander zunicken. Die Frau wollte nur weg.
Der Mann mit kantigem Gesicht und goldener Armbanduhr stand lässig da, auf einem Zahnstocher kauend, mit angewinkeltem Bein auf einer Stufe. Er trug eine hellbeige Buntfaltenhose und über seinem Kragenhemd spannten sich ein Paar lederner Hosenträger. Offen darüber trug er eine dunkle Lederjacke, die sich deutlich von den knautschigen Windund Softshelljacken der Massen abhob. Und während mehr und mehr Leute eintrafen, die in sich gekehrt mit geneigten Gesichtern auf das Grab des heiligen Willibrord zusteuerten – dem Schutzpatron der gläubigen Christen hierzulande –, blickte der Fremde die junge Frau mit seltsam ölig wirkenden, dunkelbraunen Augen eindringlich an und meinte: „Hoppla, senhorita! Kennen wir uns?“
Und wo draußen auf dem Vorhof die Besucher sich in Viererketten aufstellten und wo vorneweg der Musikkapellenmeister die ersten Polkatakte vorgab, wedelte er mit einem speziell für diesen Anlass angefertigten weißen Dreiecktuch. Schmunzelnd meinte er, dies sei alles Unfug und er sei nur hier, um so eine reizende Dame wie sie zu treffen.
Die Frau wurde nervös. Er hielt eine Hand vor seinen Mund, gab vor zu husten, doch dann grinste er sie unvermittelt an: „Seltsam, wo doch jeder seinen Gott im Internet bestellen kann!“
„Lassen Sie mich!“, konterte sie barsch.
Der Mann zeigte grinsend seine Goldzahnfüllung und wirkte so, als ob er nach einer geschickten Formulierung suche. Dann ergriff er ihren Arm, kam ihr charmant, fast schon indiskret nahe, um unmissverständlich zu betonen: „Aber Madam, hören Sie etwa nicht das Klirren der vielen Klingelbeutel? Ganze Bataillone reisen jedes Jahr an, um ihr Seelenheil zu finden, dabei liegen die wahren Schätze im Inneren!“
Dabei lachte er laut auf und zeigte auf das Tafelbild hinter dem Altar. Dort bekreuzigten sich weitere ankommende Pilger. Anschließend warfen sie ein paar Münzen in den Opferstock. Lebhaft erläuterte er: „Schauen Sie nur, wie die Farben und Formen zu einer grandiosen Harmonie verschmelzen, ähnlich wie bei Bachs Musikkompositionen, die darauf abzielten, das Interesse – und natürlich das Geld – der Bittsteller zu locken.“
Er räusperte sich und fuhr mit gesenkter Stimme fort: „Schauen Sie, meine Liebe, hinter der Holzvertäfelung und den mahagonigedrechselten Sitzbänken dort drüben, die wie eine übergroße japanische Puzzlebox aussehen, dort liegen weitere goldene Schätze.“
Während die Augen der jungen Frau weiter nach einer Fluchtmöglichkeit Ausschau hielten, drängten immer mehr Menschen in die Kirche.
Er sah sie spöttisch an: „Gott hat sich bislang um jedes ‚Findelkind‘ gekümmert. Sie müssen nur, nun, Sie wissen schon …“
In seiner Aussage lag etwas Doppeldeutiges, und das war beabsichtigt.
„Diese Kirchenkapitäne steuern ihre Kirchenschiffe immer noch Richtung Rom. Wussten Sie das?“
Er lachte irritierend.
Scheinbar in der Annahme, er sei ein Reiseführer, fragte eine Pilgerin mit weitem Ausschnitt nach dem Baujahr dieser Basilika. Sie wunderte sich, dass sie so gar keinen Barockstil aufwies. Als der Mann sich ihr zuwandte, nutzte die junge Mutter ihre Chance und floh hinaus.
Draußen auf dem Vorplatz schnappte sie nach Luft. Noch immer hörte sie, wie ihr Kind schrie. Und während Pilger aufhorchten, sich wunderten, da setzte sie ihre Sonnenbrille auf, zog den Kragen ihres Trenchcoats höher, sodass er einen Teil ihres Gesichts bedeckte, und schlängelte sich an ihnen vorbei. Sie beschleunigte ihre Schritte und überquerte die Brücke, ohne sich noch einmal umzudrehen, und eilte zum Parkplatz zurück.
Im Auto sitzend, starrte sie vor sich hin. Unter ihrer Sonnenbrille kullerte eine dicke Träne ihre Wange hinab. Draußen schoben sich Quellwolken vor die Sonne. Es begann zu regnen.
Irgendwann nahm sie einen tiefen Atemzug, legte Puder auf, richtete ihre Frisur und zündete sich, während sie den Motor startete, eine Zigarette an. Doch bevor sie den Gang einschaltete und losfuhr, sendete sie – wie vereinbart – eine Textnachricht.
Kapitel 2
Bernsteinfrühling
Zwölf Jahre später …
„Du Schuft, eines Tages erwische ich dich!“, brüllte Herr Relléu in Richtung des Fahrers, der mit seinem Lanz-Bulldog-Trecker mit überbordendem Weinfass im Schlepptau viel zu dicht an seinem Grundstückszaun vorbeiknatterte.
Mit gerümpfter Nase und krakeelender Stimme wütete er, als der Lanz von den terrassenartig angelegten Weinbergen am Fluss Mosel heruntergerattert kam. Der Fahrer zeigte ihm daraufhin lediglich seinen Stinkefinger und fuhr weiter.
Er stand auf einer von Glas umzäunten Balkonterrasse seiner architektonisch modernen Immobilie, die sich unweit der vielen mittelalterlichen Burgen und Schlösser entlang des Mosel-Flusses befand, die an den zum Teil sehr steilen Hängen – oft in Alleinlage und etwa auf halber Höhe – herausragten. Zwischen den Reben im schieferschwarzen bis goldgelben Lehmboden und den von der Sonne angestrahlten Sandsteinfelsen wirkten diese Villen aufgrund ihrer Glasfronten wie ein übergroßes Türkisvorkommen.
Finster schnauzte der Hausherr seinen Gärtner an: „Du sollst was schaffen!“
Der südländisch Aussehende duckte sich, als wäre er geschlagen worden. Im Hintergrund, in Wandgröße, liefen Börsendaten auf seinem Flachbildschirm, da klingelte das Telefon. Er ging hinein und blickte sich suchend in seiner Zebrahaut-Wohnlandschaft um. Nicht auf dem Mahagonischreibtisch fand er sein Handy, sondern auf einem Glastisch, der von einer bronzenen Staute mit weiblichem und nacktem Korpus getragen wurde. Zwischen Sportbootmagazinen und Prospekten über Jagdzubehör fischte er es hervor. Lachend nahm er das Gespräch an, grüßte den Bischof am anderen Ende der Leitung und fragte lachend: „Wie laufen die Kirchendienste? Brauchst du mehr Wein oder mehr Munition?“
Er zündete sich eine Zigarre an. Zum Rauchen ging er wieder nach draußen.
„Kommst du zur Jagd?“
Er faselte etwas von Investmentstrategien in Sportklubs und Lithium. Es fielen Worte wie „Marktchancen breit streuen“ und „Aufbau eines zweiten Standbeins in diesen wirren Zeiten“.
Er lachte laut auf und betonte: „Und du weißt, was ich meine“ – er sagte es so laut, dass es die vorbeischlendernde Klosterschwester deutlich mithören konnte. Die Frau, welche die Breite eines Weinfasses besaß, lächelte ihn freimütig an.
Er bemerkte abwertend: „Was willst du, olle Schwarzbrot-Schachtel?“
Die schwarz gekleidete Nonne schnaufte vor Anstrengung und schien ihn zu ignorieren.
Sie murmelte vor sich hin: „Nur keine Bange, Kurt. Ich will zu meinen Bienenstöcken, die auf der anderen Flussseite stehen.“
Sie wusste, dass es ihn nicht die Bohne interessierte, lächelte jedoch mit ihrem breiten, aber wohlgeformten, makellosen Gesicht so, dass es fast wie ein freches Grinsen hätte gewertet werden können.
Übertrieben freundlich sagte sie: „Grüß dich! Dieser Panoramablick! Einfach herrlich an diesem Morgen! Findest du nicht auch?“
Demonstrativ wandte er sich von ihr ab. Einige Pilger kreuzten ihren Weg.Die Frau, sie besaß ein Paar unwirkliche Augen, wandte sich zu den Menschen, öffnete ihren Mantel und klappte eine Holzlatte auf. Sie nahm ein Weizenmischbrot und hielt es vor sich in die Höhe, sodass sich auf ihrem Gesicht ein Schatten bildete. Sie schloss ihre Augen und sprach ein Gebet. Doch bevor sie eine Scheibe abschnitt, nahm sie das große Messer und vollzog auf dem Brotlaib das Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“
Sie nahm von dem Schmalztöpfchen und beträufelte eine Scheibe mit Zucker. Wie ein Marktschreier bot sie es nun den vorbeikommenden Scharen an: „Ein natürlicher Energieriegel! Fünfzig Cent.“
Das Angebot wurde dankend angenommen. Sie teilte mit dem Messer einen Apfel in zwei Hälften, beugte sich vor und lächelte den Kindern zu: „Den gibt es gratis dazu!“
Da raunte er lachend zu der Schwester, wobei in seinem Lachen etwas Gemessenes mitschwang: „Geh mir fort, Schwester Hildegard! Du und dein Krämerladen! Oder du zahlst mir Standgebühren!“
Sie blieb ruhig und gelassen, dann gab sie ihm mit einem einzigen Blick zu verstehen: „Gib acht!“
Dabei hielt sie direkten Blickkontakt zu ihm, und es wirkte wie eine unsichtbare Lanze zwischen ihr und dem Kaufmann.
Mit leiser, aber fester Stimme sagte sie: „Vielleicht sorge ich dafür, dass jemand anderes den Messwein an das Traversier Bistum liefert!“
Er konterte gelassen in einer tiefen Baritonstimme: „Vielleicht kümmere ich mich um deine Versetzung.“
Falten bildeten sich auf ihrer Stirn, die von inneren Abwägungen stammten, und nach einer Weile beließ sie es dabei und ging ihrer Wege. Sein Teleskopblick folgte ihr mit einer Spur Genugtuung und sogleich schnappte er sich sein Handy.
Bereits in den frühen Morgenstunden war die Klosterfrau aufgestanden; nun ging sie zu Fuß über die Höhen von Gutland. Ebenfalls hoch oben brausten einige junge Burschen auf ihren Motorrädern. Und während sich am Himmel einige graue Wolken bildeten, wirkten jene in schwarze Lederjacken gekleideten Burschen wie eine Gang, wohl auch deshalb, weil jeder ein weißes T-Shirt mit einem aufgedruckten Adler trug. Ein Wappentier? Auffallend war auch, dass jeder eine Kette mit einem Christuskreuz als Anhänger um den Hals trug.
Einer von ihnen ragte heraus. Dieser näherte sich jetzt der korpulenten Dame. Er fuhr im Schritttempo neben ihr her und fragte sie: „Sind Sie vom Kloster Echterville? Wo müssen wir langfahren?“
Sie schreckte auf. Ihn mit der Hand abweisend und mit bangem Gesicht erwiderte sie schroff: „Bleibt mir vom Leib! Ich besitze keinen Pass, kein Handy und kein Geld!“
Der junge Mann blieb stehen und hob seine Hand. Die Sonne war nun komplett hinter den Wolken verschwunden und es begann zu regnen. Er nahm seinen Helm ab und stellte in ruhigem Ton richtig: „Keine Angst, Schwester, wir wollen nur nach dem Weg fragen!“
Die Klosterschwester blickte in blasse Gesichter, die vom Regen ganz nass geworden waren. Alle Jungs waren auf ihren Motorrädern wie im Entenmarsch hintereinander stehen geblieben. Beeindruckt von dieser Geste, deutete sie in südwestliche Richtung.
„Ja, dort drüben befindet sich Park-De-Lux mit dem Städtchen Echterville und dem Kloster! Falls ihr zur Springprozession wollt, meine Herren, müsst ihr da entlang.“
Sie zeigte mit der Hand über ein weit ausgedehntes, welliges Land voller Wald, Wiesen und purpurfarbener Pfingstrosen. Und als der Bursche sie weiterhin mit bittenden Augen ansah, mäßigte sich die Klosterfrau. Stolz und schrill führte sie aus: „Der Glaube setzt sich immer durch, meine Herren. Religionen wuchsen schon immer über staatliche Grenzen hinweg, aber auch über soziale Hindernisse, und die Kirche eint die Suchenden zu einer Familie, die stets da ist, falls ihr Beistand sucht.“
„Soso“, erwiderte der Anführer mit einem selbstgefälligen Blick in Richtung Hildegard. Die schwarz gekleidete Kurvendiva schaute ihn von der Seite an und stemmte eine Hand in die Hüfte. Ein eiserner Blick genügte und alle Burschen verstummten ehrfürchtig.
Sie fuhr sich mit dem Zeigefinger über die Lippen und sagte: „Wartet es nur ab … Gleich zur vollen Stunde, wenn die Sonne oben steht, dann werdet ihr es hören … Wir hier im Abendland halten zusammen, so haben wir schon einmal im 14. Jahrhundert die osmanische Bedrohung zurückgedrängt. Papst Calixt III. hat es damals eingeführt. Seitdem gibt es dieses Mittagsläuten der Kirchenglocken, das auch Türkengeläut, Angelusläuten oder Siegesläuten genannt wird.“
„Also, ich höre nichts“, ließ einer schulterzuckend verlauten.
„Junger Mann!“, schrie sie energisch. „Man hört nur mit dem Herzen gut! Und um zu hören, bedarf es der Stille, was eure junge, konsumsüchtige Generation vermutlich verlernt hat.“
Stille kehrte ein. Sie hielt eine ganze Weile an. Doch dann ertönte ein zartes Glockengeläut aus dem Tal. Der Westwind trug warme Töne in die Höhen. Auch aus dem Osten kam ein edler Schall zu ihnen herüber, zunächst leise, dann kraftvoll. Eine Fülle von Klängen aus sämtlichen Richtungen durchzog die grünen, fruchtbaren Ebenen von Gutland. Eine vertonte Göttlichkeit? Oder ein göttlicher Odem? Wer wusste das schon? Derjenige, der glaubte, der wusste es.
Wie in einem Kanon stimmten immer weitere Glocken mit ein. Mal dumpf, mal hell, mal kraftvoll – je nach Windstärke und nach Seilzug, erzeugt von Menschenhand. Ein Klanggebet? Der Geist des Schöpfers? Oder waren es die Menschen, die er erschaffen hatte und die dieses Land in diese religiöse Verzücktheit zu versetzen vermochten? Aus allen Richtungen erklangen die Glocken nun, sodass der Klang zu einem starken Geläut heranwuchs. Aus jedem Dorf, aus jeder noch so kleinen Kapelle erschallte Glockengeläut, fast wie ein Ensemble. Ein Wind kam auf und trug den Klang über Dörfer, übers Land und über die Köpfe der Menschen.
„Da! Hört ihr es?“, fragte die Klosterschwester mit erhobenem Zeigefinger. Es war ein bewegender Moment, selbst für die toughen Motoradfahrer. Doch es dauerte nicht lange, da stellte sich der Anführer wieder aufrecht hin.
Stolz setzte er seinen Helm auf und sagte: „Ja, das ist beeindruckend! Doch wir haben noch etwas vor, gnädige Frau!“ Und in einem betont aufgesetzten Hochdeutsch fuhr er fort: „Wenn Sie uns freundlicherweise sagen könnten, wo wir etwas zu essen bekommen, dann lassen wir Sie mit Ihrem ‚Herrn‘ umgehend wieder allein, okay?“
Er zwinkerte ihr zu. Die kräftige Frau rollte genervt mit den Augen, schnaubte und sagte schließlich in einem tiefen Ton: „Auf dem Kogge-Mühlenhof, dort drüben im Loch. Da soll es heute ein Fest geben.“
Daraufhin tippten die Jungs der Reihe nach als Zeichen des Grußes mit dem Finger an ihren Helm und die Moped-Motorrad-Gang brauste weiter über die Hügel in den Wald.
Nach vielen wendigen Kurven steil talabwärts stießen sie unten am Fluss auf eine Mühle. Im Schatten einiger Felsen, von Efeu überwuchert, standen Stallungen im Winkel zueinander. Das in die Jahre gekommene und etwas ramponiert wirkende Anwesen war von einer Mauer umgeben, die teilweise zerbröckelt und in Teilen fast zwei Meter hoch war. Einzig ein imposant gemauertes Eingangsportal zeugte davon, dass das Anwesen womöglich einst eine staatliche Institution beherbergt hatte. Unweit davon befanden sich Bahngleise, die heute als Fahrradweg dienten. In massiven Steinkübeln, die früher für die Schweinemast verwendet worden waren, blühten jetzt rote Geranien. Tonnenschwere Mühlensteine aus rotem Eifelsandstein, auf eine Wiese hingerollt und aufgestellt, dienten als Tische.
Die knatternde Motorrad-Gang erregte Aufsehen. Ein hagerer Mann in einem feinen Anzug und mit sehr kurzem Haarschnitt blickte staunend und fragte: „Wollt ihr bei uns mitmachen? Es gibt auch Freikarten fürs Fußballspiel. Oder wollt ihr lieber auf den Nürburgring? Wir können solche Kerle wie euch gebrauchen. Wir sorgen für Land und Leute, die hier wohnen. Und wie ihr seht, wurden hier früher ‚Wunderwerke‘ vollbracht. Vor rund hundert Jahren wurden Mühlen gebaut, um das Korn für die vielen Handwerker, Straßen- und Bahnbauer zu mahlen, aber auch für die Soldaten, die aus dem fernen Berlin kamen, um unser Kaiserland zu verteidigen.“
Der Gang-Leader unterbrach ihn genervt: „Komm, Alter, lass den Quatsch! Da stehen wir nicht drauf! Wir haben gehört, hier soll es was zu essen geben?“
Die beiden wechselten eisige Blicke. Doch der Mann verstand sofort und änderte seine Taktik: „Aber natürlich…“ Er lachte und bot den Jungs in betont lässiger Manier Zigaretten an.
Der Leader nahm eine. Dann wechselte der hagere Mann in einen geschäftlichen Ton und sagte: „Wir sind in der IT-Branche tätig. Unsere Firma hat eine eigene Marketingabteilung mit Social-Media-Providern, dort könnten wir noch Leute wie euch gebrauchen! Lust auf das große Geld? Auf Mädchen? Auf Autos?“ Und dabei deutete er auf seinen grünen Jaguar: „Wollt ihr mal so was fahren? Oder lieber doch einen Ferrari? – Alles kein Problem!“
Der Mann lachte und zuckte mit den Schultern. Die Skepsis der jungen Männer wich.
„Relléu, mein Name.“
Er reichte dem großen jungen Mann die Hand und überreichte ihm seine Visitenkarte.
„Kommt am Samstag in den Wald bei Bollenpiont, an der Grenze zu Park-De-Lux. Dort steigt ’ne Party für ‚große Jungs‘, wenn ihr versteht, was ich meine. Lust auf Schießen? Wir werden auf die Jagd gehen.“
Er lachte souverän, strich sich mit der rechten Hand durchs Haar und fuhr sich flüchtig mit einem Finger über die Nase.
Der schwarz gekleidete Gang-Leader blieb skeptisch, überlegte einen Augenblick, blickte den Mann mit ernsten Augen an, nahm die Visitenkarte, steckte sie ein und erwiderte: „Mal sehen! Erst wollen wir was essen!“
Er gab den anderen ein Handzeichen und ohne weitere Verzögerungen fuhren sie durch das Tor und gelangten daraufhin in einen Innenhof.
„Welch ein Lichtblick!“, bemerkte der Gang-Leader staunend. Im Hof spielten Kinder. Auf einem Stück Wiese, nicht weit entfernt vom Wald, baumelte eine Schiffsschaukel und es gab ein paar Schießbuden, um die herum Lichter blinkten und von denen ein Tingeltangel ausging, wie auf einem Jahrmarkt. Die Mittagssonne durchbrach die Wolkendecke und durchdrang das grüne Blätterdach eines Walnussbaumes, sodass diese kleine Hauskirmes schon beinahe wie eine italienische Finca-Fete anmutete.
„Der Kogge-Mühlenhof ist kein hölzernes, bauchiges, altes Handelssegelschiff, sondern eine Mühle nahe einem Dorf, das an einen Fluss ‚angedockt‘ ist, und wir Kinder ‚schipperten‘ auf dieser ‚Arche-Noah‘, um auf ein besseres Leben vorbereitet zu werden“, schilderte die zwölfjährige Lynn, dabei tänzelten lustige Sommersprossen auf ihrer Nase.
Ihre Haselnussaugen strahlten, sie wirkte wie die Heidi aus den Bergen oder wie die schwedische Koboldgöre Pippi Langstrumpf. Mit ihren abstehenden Ohren glich sie gleichzeitig der Comicfigur Micky Maus. Da musste jeder gleich lachen, der sie ansah. Ihre Haare waren blondrot, mehr Rot als Gold, halb offen, halb zu einem Kordelzopf geflochten und hinten zusammengebunden. Gleichwohl klang in ihrem frechen Unterton etwas Zurückhaltendes, etwas Blockierendes, als wäre sie in ihrer Neugierde zu oft ausgebremst, zurückgewiesen oder gar ignoriert worden.
Das Mädchen stand in dem buckeligen Innenhof, der zum Teil betoniert, zum Teil geteert und an anderen Stellen noch mit erkennbarem Kopfsteinpflaster von früher versehen war, und strahlte diese sichtbare Armut mit einer unerschütterlichen Freundlichkeit aus, was vielleicht ihrer Jungend geschuldet und dennoch bemerkenswert war. Sie trug es mit einer kindlichen Würde, so wie sie das Kleid trug, das in seiner Mischung aus Jeans und Dirndlstoffen wie selbst genäht aussah.
Rhythmisches Klavierspiel erklang im Hintergrund. Schellen setzten ein und mit dem Klang von Kastagnetten wehte ein Hauch portugiesisch-spanischer Flamenco aus dem oberen Fenster.
Wegen der geladenen Gäste hatte das Mädchen sich herausgeputzt, und da die meisten Menschen im Gutland im Alltag eine Dialektsprache sprachen, bemühte sie sich um ein gepflegtes Hochdeutsch. Sie gab sich auch deshalb Mühe, weil weit und breit weder Heimvater noch Heimmutter zu sehen waren.
Auf die Frage eines Zeitungsreporters, wo sich denn die Verantwortlichen oder die Heimeltern befänden, zuckte sie mit den Schultern und meinte in ihrer kindlichen Stimme: „Wir Kinder gehören zu einer Clan-Community. Manche von uns kommen als Baby hierher. Der Storch hat sie im Körbchen vors Tor gelegt. – Aber die Clanchefs?“ Lynn hob die Hände und machte ein unwissendes Gesicht. „Die ‚Mama‘ und der ‚Papa‘ sind nicht von hier.“
Und hinter vorgehaltener Hand flüsterte sie: „Die beiden sprechen untereinander eine andere Sprache. Es klingt spanisch oder albanisch oder kauderwelschisch oder was weiß ich. Ihr Deutsch klingt jedenfalls zum Davonlaufen.“
Alle lachten. Aber sie blieb ernst: „Mit uns Kindern sprechen sie gar nicht. Uns schreien sie nur an oder sie schlagen uns. Drum will ich eine neue Mom. Es kann auch ein Dad sein, ganz egal. Kennen Sie jemanden, der ein nettes Mädchen wie mich aufnehmen würde? Ich bin nicht immer artig. Auch nicht besonders ordentlich, aber mit mir wird es nie langweilig. Und ich lerne fix!“ Plötzlich hielt sie inne.
Anscheinend spürte sie, dass sie beobachtet wurde. In der Tat, am Fenster rutschten Gardinen hin und her. Das Mädchen zuckte zusammen und sagte plötzlich laut und brav: „Sie haben noch zu arbeiten und überlassen deshalb mir das Begrüßen der Gäste.“
Und wie die hohe Frühlingssonne so ihre Strahlen versendete und die Rosen neben dem Misthaufen um die Wette blühten, wirkte der Hof auf eigenartige Weise geradezu wild-idyllisch.
Die jungen Burschen stürmten mit einem Mordskaracho und zirkulierendem Motorengeheul das Gelände, dass es nur so knatterte und krachte. Einer nach dem anderen drehte sich um die eigene Achse, sodass die Räder Unmengen an Staub aufwirbelten. Einer raste mit seinem Gefährt auf einen Mauersims zu und vollführte ein paar Stunts. Dann nahm er seinen Helm ab.
Der junge Mann mit den markanten Gesichtszügen und dem feschen Stufenhaarschnitt wirkte groß gegenüber den Heimkindern, geradezu athletisch. Er zeigte ein blendend weißes Zahnlächeln, und als er sich die Strähnen aus dem Gesicht strich, kamen Grübchen zum Vorschein. Nicht nur Lynn war mächtig beeindruckt. Und als dieser auch noch auf sie zukam und sich mit seinem Waschbrettbauch unter dem Shirt lässig zu ihr hinabbeugte, weiteten sich ihre Augen und sie erstarrte.
Er hingegen strotzte geradezu vor Selbstvertrauen, als er, bereits im Stimmbruch, meinte: „Wenn ich alt genug und schon erwachsen wäre, würde ich dich sofort nehmen!“ Er lächelte sie verschmitzt an und fügte mit einem kühlen Blick hinzu: „Doch zuerst wollten wir was essen, okay?“
Sie suchte nach Worten und meinte schließlich stotternd: „J-ja, ja, dort drüben könnt ihr euch am Büfett bedienen.“
Zeitgleich waren jüngere Heimbuben keuchend und schnaufend damit beschäftigt, einen Klapptisch aufzubauen. Der Anführer gab sich umsichtig, pfiff laut und rief seinen Leuten zu: „He Jungs, packt mal mit an!“
Gehorsam nahmen die ihre Helme ab, stellten ihre Motorräder beiseite und hievten gleich mehrere Tische sowie weitere Sitzbänke aus der Scheune hinaus auf den Hof. Ganz uneigennützig taten sie das nicht, denn sobald alles aufgestellt war, nahmen die Burschen Platz und beanspruchten die ganzen Tische für sich.
Ein anderes Mädchen kam im schulterfreien Dirndl daher und verbreitete eine heimatliche Oktoberfest-Atmosphäre. Sie entfaltete blau-rotweiß karierte Tischdecken, und während sie Wildblumen in Vasen steckte, um diese auf die Tische zu verteilen, reckte sie sich weit zu den Burschen hinüber; ob mit Absicht oder nicht, war schwer zu sagen. Jedenfalls bekamen alle so Einblick in ihr Dekolleté. So mancher Teenager pfiff beeindruckt: „Große Titten! Sind die im Angebot?“
Das Teenagermädchen zog seine mit Spitzen besetzten Büstenhalter zurecht, legte einen Finger auf die Lippen und rollte mit den Augen. Ihr Lachen klang aufgesetzt und beim Gehen wackelte sie mit ihren Hüften. Der Anführer blickte ihr hinterher und lächelte amüsiert. Er pfiff, schnalzte mit der Zunge und rief amüsiert: „Also Jungs! Die Vorspeise wäre schon mal serviert!“
Ein Lachen ging durch die Reihen und man zwinkerte sich schelmisch zu. Und während die Schwenkbratwürste über dem Feuergrill schmorten, duftete es an anderer Stelle nach gerösteten Mandeln und Zuckerwatte.
Lynn begrüßte weitere Gäste. Alsbald flatterten nicht nur Flaschenlaternen im Gezweig des Walnussbaumes, sondern es versammelten sich noch weitere Kinder um Lynn herum, und während eine Dreijährige sie am Rock zupfend fragte, warum sie zwei verschiedene Socken anhabe, war so mancher Heimbursche bemüht, sich durch ausgiebiges Hüpfen, Fußballdribbeln oder auf andere Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Manche kletterten sogar auf das laufende Rad der Wassermühle und liefen mit dem Strom. Die Gäste waren beeindruckt. Sie klatschten, pfiffen und bedankten sich, weil sie glaubten, dies sei ein einstudiertes Unterhaltungsprogramm, ähnlich einem Varieté mit akrobatischen Vorführungen unter freiem Himmel.
Unweit des Zauns, kurz vor dem kaputten, angewinkelten, schmiedeeisernen Tor, stand eine Frau. In ihrem Trenchcoat und mit der Sonnenbrille sah sie aus, als käme sie von einer anderen Welt. Sie schaute durch die Gitterstäbe. Während so mancher Bursche sich an einem am Baum befestigten Seil von Ast zu Ast hangelte, streckte einer seine Zunge heraus und pöbelte Lynn mit Zwischenrufen an.
„Lynn, guck mal!“
„Lynn, pummelige Pippi Langstrumpf!“
Lynn tat so, als würde sie nicht hinhören, und spielte weiter die freundliche Gastgeberin, doch in dem Moment, als die Besucher damit abgelenkt waren, den alten, hofeigenen Steinofen zu besichtigen, wandte sie sich um und rief: „Passt bloß auf, ihr Lausbuben!“ Und noch während sie diese Drohung aussprach, stieß sie lachend einen der Rabauken ins Wasser, das die Mühle umgab.
Der dreizehnjährige Benny, enthusiastisch wie immer, ließ sich nicht davon einschüchtern. Unverzüglich tauchte er wieder an der Wasseroberfläche auf und rief vergnügt: „My Lady, Madam Daisy! My Lady, Pippi Langstrumpf!“ Amüsiert lachte er und spritzte mit Wasser.
Neben seinen blendend weißen Zähnen zeigten sich kleine kesse Grübchen. Lynn lachte ebenfalls. Er schien sich wirklich nicht unterkriegen zu lassen, auch, weil er anscheinend genau die Aufmerksamkeit bekam, die er wollte. Zahlreiche Paare klatschten und er rief begeistert: „Guckt mal, wie ich balanciere!“
Über das Holzmühlenrad hüpfend rief er immer wieder: „My Lady, pummelige Daisy!“ Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasserbecken. Sich mit beiden Armen an einer Trittleiter völlig durchnässt hochhievend, rannen schmutzig-schwarze Rinnsale über sein Gesicht. Doch dann wurde er unvermittelt von einem dieser Holzflügel am Kopf getroffen und wieder nach unten gedrückt.
„Hilfe!“, schrie er.
Es klang nach Spaß, also ignorierte man ihn. Der zweite Hilferuf klang schon etwas verzweifelter, und doch glaubte Lynn, er wolle nur Aufmerksamkeit heischen. Also führte sie die Gruppe weiter zur Scheune und machte vorsichtshalber eine Schiebetür zu, da sie wusste, dass sich etwas darin verbarg, was nicht für jedermanns Augen gedacht war. Und während die Motorrad-Gang sich auf und davon machte, hörte sie wieder: „Hilfe, Hilfe!“
Das klang schon bedrohlicher. Die Besucher hörten es auch und so mancher wurde hellhörig.
Lynn überkam ein seltsames Gefühl. Wenn das aber wieder einer seiner Ablenkungsversuche ist, dann finde ich das gar nicht witzig!, dachte Lynn wütend. Ein männlicher Besucher zog sich kurzerhand Hemd und Hose aus und sprang beherzt in das trübe Wasser, um rasch zum Mühlrad zu gelangen. Ein anderer hielt nach einem langen Stock Ausschau, brach schließlich einen vom Baum und wollte damit das Mühlwerk anhalten. Vergebens. Daraufhin stocherte er in der grünbraunen Suppe herum, um den Jungen ausfindig zu machen. Vergeblich. Die Wasseroberfläche an der hässlichen, mit Flechten und Moosen bewachsenen Betonmauer ebbte ab und glättete sich, jedoch ohne Leben.
Ohne darüber nachzudenken, sprang Lynn mit Kleidern in das öl- und dreckverschmierte Mühlenvorbecken, tauchte unter, sah aber nur trübes, aufgewühltes Wasser. Dann entdeckte sie etwas Dunkles, Verdicktes. Sie griff danach. Es war eine Stockente, die wild schnatternd davonflog. Lynn vermutete an einer anderen Stelle ein Bein oder besser noch wäre ein Arm, den sie hätte greifen können. Doch es stellte sich heraus, es waren nur Zweige eines morschen Weidebaums.
„Hilfe!“, schrillte es vom Hof herüber. Die Gäste stoben in alle Richtungen. Einer meinte, er würde Hilfe holen. Doch er kam nicht wieder. Lynn griff verzweifelt nach allem, was irgendwie nach dem Jungen aussah. Schließlich fand sie jemanden mit eingeknicktem Kopf im Wasser dümpeln. Leblos.
Lynn bekam einen Riesenschreck. Sie dachte aber nicht weiter nach, sondern versuchte den Körper irgendwie nach oben an die Oberfläche zu hieven.
Nun war sie es, die rief: „Hilfe!“
„Ich hab ihn!“
Sie erreichte eine Sandbank, auf der sie stehen konnte. Erst im Nachhinein begriff sie, welche Strecke sie beide zurückgelegt hatten. Mit solch starken Strömungen hatte sie nicht gerechnet.
Der Heimvater und Elenora, die Heimmutter, kamen herbeigelaufen. „Kind, was hast du wieder angestellt!“
Lynn, völlig durchnässt, keuchte schwer, während ihr einzelne Rinnsale übers Gesicht liefen. Sie schwieg. Regungslos starrte sie auf das Wasser und begann zu zittern, nicht nur wegen der Kälte. „
Jesses! Maria! Und Josef! Oh Jesses! Maria!“, schrie die Heimleiterin wiederholt.
Dabei wedelte sie mit den Händen und faltete sie dann zusammen, wie zum Gebet. Ihr Geschrei war so laut und so jämmerlich, dass es sicherlich noch über die Grenzen von Gutland hinweg zu hören war. Und denjenigen, die dabei gewesen waren, gefror das Blut in den Adern. Der Junge war tot. Seine dünnen Ärmchen lagen verkrümmt in einem knorrigem Grau, wie so manch verdorrtes Holz, das an den Rand gespült wurde. Lynn sackte zusammen, ihr Gesicht aschfahl. Mit letzter Kraft schob sie sich vor zu dem Jungen, stieß ihn sacht an, um etwas rückgängig zu machen, was nicht rückgängig zu machen war.
„Aber … aber … Oh nein!“, flüsterte sie tonlos. Und dann, als sie begriffen hatte, was geschehen war, verstummte sie. Tief in ihrem Inneren erlosch etwas. Sie resignierte und ließ den Regen auf sich niederprasseln.
Jacco, der Heimvater, ein stämmiger Typ mit schwarzem Haar und einem kontrastreichen Männerhaarschnitt – an den Seiten sehr kurz, der Oberkopf blond gefärbt und die Haare nach oben gewellt – kam angelaufen. Er trug ein verschwitztes ärmelloses Unterhemd und knöpfte sich während des Laufens die Hose zu. Er schnappte nach Luft, blieb vor der Leiche stehen und starrte diese zunächst wortlos an. Augenblicklich wich jegliche Farbe aus seinem Gesicht, es war nun mondbleich. Seine Stimme zitterte ein wenig, als er schließlich hervorbrachte: „Oh nein! Wie konnte das passieren?“
Dann, ohne Vorwarnung, stand er auf, ging zu Lynn hin und gab ihr eine schallende Ohrfeige, während er schrie: „Mädchen, das war einer, dessen Vater Rang und Namen hat! Diese Kirchenleute zahlen gut für ihre Vergehen. Der brachte viel Geld. Diese Besserwisser, diese heiligen Schweinepriester predigen das Zölibat und heimlich üben sie die Missionarsstellung.“
Er spuckte auf den Boden, räusperte sich und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn, die sich dort angesammelt hatten: „Wenn auch nur einer davon Wind bekommt, dann können wir einpacken! Hast du einen blassen Schimmer, was das bedeutet, Mädchen?“
Die Heimmutter hob das Kinn und wanderte auf und ab. Sie schien zu überlegen. Dann meinte sie: „Komm, wir verstecken ihn. Alle unsere Findelkinder sind heimlich abgegeben worden, also weiß im Grunde niemand, dass es den Benny überhaupt gibt.“
Jacco grübelte nach. Dann brummte er vor sich hin: „Der Gutsbesitzer weiß Bescheid. Ich habe ihn verkauft.“
„Was?!“, schrie die Heimmutter und sah ihn fragend an. Jacco wiederholte seine Worte, diesmal etwas lauter, und fügte noch an: „… als guten „Arbeiter, für tausend Euro.“
Die Heimmutter verzog das Gesicht: „Er war erst dreizehn.“
Daraufhin erwiderte Jacco: „Für die Feldarbeit und zum Klettern in den Bäumen war der Bengel gerade im richtigen Alter. Später sollte er nach Spanien oder Portugal. Na, du weißt schon!“
Der Heimvater und die Heimmutter hievten den Leichnam auf eine Schubkarre und versteckten ihn in der Kühlung der Milchkühlkammer nahe der Scheune.
Im Gutland, das so herrlich frei von Hektik und Eile zu sein schien, verbreitete sich dieses schaurige Ereignis schneller als eine Twitter-Nachricht. Mitten in der Nacht holperte ein schmalrädriger Traktor über den breiten Gullydeckel am Toreingang. Knatternd fuhr er in den Hof ein und hielt mit quietschenden Bremsen an, während sein Motor wie ein altes Heizungsrohr weiterblubberte.
Ein hagerer Mann im blauen, ölverschmierten Overall stieg aus. Seine Augen glühten vor Wut. Sein Gesicht glich dem von Graf Dracula, und genauso wie er schien auch er keinen Bauch zu haben, nur ellenlange dürre Glieder, deren Enden irgendwo im Nachtschatten verschwanden. Er wedelte mit einer brennenden Fackel, wohl auch deshalb, weil es hier keine Straßenbeleuchtung gab. Nun, in den Dörfern von Gutland funktionierten die Straßenlampen nach Sonneneinfluss, da konnte es schon mal vorkommen, dass manches Licht zu schwach war. Auf den umliegenden Aussiedlerhöfen wurde es provinziell und strukturschwach. Die einzig brauchbare Hoflampe, die noch an den alten Dynamo angeklemmt worden war, die war von einem der Heimkinder mit einer Gummischleuder kaputt geschossen worden.
Es war der Lohnarbeiter vom Gut-Diesburg, der von weit außerhalb, von der anderen Seite der Landesgrenze, herkam. Halb betrunken, halb in Trance, forderte er den Master Jacco schreiend dazu auf, sich zu stellen. Er hätte seinen Sohn auf dem Gewissen!
Niemand rührte sich. Niemand sprach mit dem Vater, der kurz darauf mitten im Hof zusammenbrach, bitterlich weinend. Elenora raunte zum Jacco: „Du Schuft, gelogen hast de! Haste den Bischof ’n Jung untergeschwätzt, wo dann die Kirche die Alimente zahlt, obwohl es gar nicht sein Kind war. Du bist und bleibst ein Gauner!“
Niemand nahm ernsthaft an, er würde es tun, was nun gleich folgte. Und doch tat er es. Vorher schlossen sie die Tore und verschanzten sich hinter den meterdicken Mauern. Die Kinder verkrochen sich unter ihre Betten.
Der Fremde zündete das frei gelagerte Heu außerhalb der Scheune an. Auch an den kleinen Strohbündeln, die verstreut auf dem Hof herumlagen, ging er mit der Fackel vorbei. Sie fingen Feuer. Fahrig kickte er die Strohballen in den Stall, in den Geräteschuppen und quer über den Hof, sodass in nur wenigen Minuten selbst das Häuschen im Hundezwinger brannte. Im Nullkommanix brannte alles wie ein Leuchtfeuer. Bald würde auch das Wohnhaus Feuer fangen. Diese Vermutung bewahrheitete sich schneller als gedacht. Irgendetwas durchbrach die Fensterscheibe im oberen Stockwerk – waren es Baumzweige oder auffliegende Strohfetzen oder gar beides? – und die Gardinen entzündeten sich.
Lynn hatte sich mitsamt ihren nassen Kleidern aufs Bett gelegt und sich seit dem Vorfall nicht mehr gerührt. Die Kinder rannten nach draußen. Wegen des Feuers rannten einige Heimgeschwister wieder hinein und rüttelten und schüttelten sie, in dem Versuch, sie zum Aufstehen zu bewegen. Ein dreijähriges Zwillingspaar zerrte und flehte, doch Lynn rührte sich nicht. Ihr war alles egal.
Auf dem Hof waren plötzlich Feuerwehrleute zur Stelle und fuhren in Sekundenschnelle das Schlauchwerk aus. Mit Expertise besprühten sie das Wohnhaus und den Viehstall. Das Vieh im Stall ließ man laufen. Jacco brüllte die Helfer von der Feuerwehr an, sie sollten noch ein Mädchen aus dem oberen Stockwerk des Hauses retten. Sie wäre gelähmt und könnte nicht laufen, log er. Und so stürmten zwei Männer hinauf und brachten – wie einen Sack über die Schulter geworfen – ein Mädchen mit.
Während die Rettungskräfte immer weiter zur Scheune vordrangen, eilte Heimmutter Elenora zu ihnen hin. Sie kam von der anderen Seite und sah, dass der Aufgebahrte noch zu sehen war. In einem Moment, in dem es die anderen nicht mitbekamen, und im Vorteil ihrer Ortskundschaft stieß sie die Bahre an, woraufhin diese mitsamt dem Toten in die immer näher rückende Feuerglut rollte. Trotz des einstürzenden Dachgebälks und der Gefahr, selbst getroffen zu werden, blieb sie stehen, und während ihre Sicherheit angesichts der Verdunklung wuchs, weil die Leiche Glied für Glied vom Feuer eingenommen und verschlungen wurde, breitete sich auf ihrem Gesicht ein zufriedenes Grinsen aus. Dann rettete sie sich selbst mit einem gewagten Sprung und zog rasch das eiserne Rolltor hinter sich zu.
Just in dem Moment standen Rettungskräfte da und riefen: „Wasser marsch!“
Ein Schwall ergoss sich über Elenora, als sie so dastand. Keineswegs irritiert und um abzulenken, zeigte sie auf das gegenüberliegende Sägewerk, das gerettet werden sollte, da sie davon lebten.
„Schnell! Sirr lo drüben!“
Immerzu mit der Hand winkend, schrie sie den daraufhin herbeieilenden Feuerwehrleuten hinterher, dort sei auch ein Öl- beziehungsweise ein Benzintank und der sei noch halb voll und könne explodieren!
Mit vorgetäuschter dankbarer Geste nahm sie eine dargereichte Decke entgegen. Außerdem entschuldigte man sich bei ihr wegen des Wasserschwalls; man habe sie nicht kommen sehen. Beschwichtigend lachte sie künstlich und erklärte beiläufig: „Ich habe nur den Hofhund retten wollen.“
Abermals quoll eingelagertes Heu brennend aus der Scheune und einzelne Fasern, getragen vom Wind, wedelten über den Hof und über die Dächer hinweg. Manche von ihnen brannten lichterloh. Die unten im Hof lungernden Kinder staunten. Sie fanden, das sei eine spektakuläre Unterhaltung. Die Heimmutter schrie sie an: „Macht, dass ihr wegkommt! Hier ist es gefährlich!“
In der Tat, die Einsatzkräfte gerieten immer mehr unter Stress, denn wenn die Dorffeuerwehr keine Unterstützung aus den umliegenden Ortschaften bekäme, dann würde – obwohl weiter weg gelegen – ein Übergreifen auf andere Häuser im Dorf nicht mehr zu vermeiden sein.
So eilten gleich mehrere Löschfahrzeuge im Sirenengalopp herbei. So manche Fehde war vermutlich zweckkooperativ beiseitegeschoben worden. Das Gut „Zur Linde“ schickte Helfer und von der anderen Seite des Landes, vom Gutshof Diesburg, kamen ebenfalls zähe Männer, die beherzt anpackten. Gemeinsam mit der kreisstädtischen Eifelburg-Feuerwehr verhinderten sie ein schlimmeres Inferno.
Eine Rotkreuzschwester in neonfarbener Schutzweste kam mit Decken unterm Arm und rief mit strenger Stimme: „Alle Kinder zu mir! Wir breiten jetzt die Decke aus und alle setzen sich mal dort hin. Wie viele seid ihr eigentlich?“ Die Kinder zuckten ahnungslos die Schultern.
Lynn saß teilnahmslos da. Und während die Rotkreuzschwester die Kinder zählte und begann, sie namentlich aufzuschreiben, schauten einige fragend in Lynns Richtung. Als diese spürte, dass sie beobachtet wurde, hielt sie sich die Augen zu. Geschickt wechselte die Sanitäterin das Thema und fragte: „Was hat es mit dem Namen ‚Kogge-Mühlenhof‘ auf sich?“
Ein Sechsjähriger nahm Lynns Hand in die seine und erklärte, seiner „Schwester“ ginge es nicht so gut, drum übernehme er das Wort: „Unser Hof … unser Haus ist seltsam, daher Kogge. Unser Dach ist so schwer und gebogen, dass es das Gemäuer vom Haus auseinanderdrückt, und so wirkt das Ganze wie der Bauch eines Schiffes … oder eher wie ein Wal.“ Und leise fügte der Junge noch hinzu: „Jetzt wurden wir Kinder verschluckt, wie in der Moby-Dick-Geschichte.“
Er lächelte schwach, weil es für die anderen ein Witz sein sollte, was aber im Trubel unterging. Dass er es eigentlich ernst meinte, behielt er lieber für sich. Er zeigte auf das Gebäude, als er anfügte: „Die kleinen, schmalen Fenster wirken wie die Kiemen oder wie Schießlöscher und der Schornstein bildet den Bugspriet dazu. Finden Sie nicht auch?“
Die Rettungssanitäterin, welche die Kinder darum gebeten hatte, sie Andrea zu nennen, lächelte amüsiert. „Mit ein bisschen Fantasie hast du recht.“
Durch die Feuerwehrleute waren die Kids nicht nur abgelenkt, sondern vor allem ganz schön beeindruckt. So mancher Junge durfte mithelfen und den Schlauch halten. „Das ist richtige Männerarbeit!“, prahlte der Sechsjährige mit den aufgekrempelten Ärmeln seines rot-schwarz karierten Flanellhemds, das ihm viel zu groß war. Er war mächtig stolz. Selbstsicher mit einem laufenden Wasserschlauch hantierend, ignorierte er die Sicherheitsmahnungen der Betreuer. Andere Kinder hatten die Gefahr gar nicht erst richtig wahrgenommen. Schlaftrunken folgten sie den Anweisungen der Betreuer und so fanden sie etwas abseits, auf einem umgestürzten Baumstamm im Feld, Schutz. Und während die Feuerleute alles gaben, um ein Inferno zu verhindern, saßen sie mit ihren dünnen, baumelnden Beinchen nebeneinander und pulten das Bonbonpapier ab, um sodann die Karamell- und Kirschbonbons, die ihnen die Sanitäter spendiert hatten, genüsslich zu lutschen oder zu kauen.
Noch Tage danach brachten die Leute aus dem Dorf Lebensmittel und Kleidung. Aber keiner nahm ein Kind zu sich. Der apathischen Lynn war nach wie vor alles egal. Die anderen Kinder hingegen hüpften und sprangen auf dem Hof herum, als sei nichts passiert. Anscheinend waren sie im Besitz eines überlebenswichtigen Kurzzeitgedächtnisses. Ähnlich dem sich auflockernden blauen Himmel nach einem heftigen Gewitter wurde der Kogge-Hof für sie zu einem Ruinen-Abenteuerspielplatz. Und während mithilfe der Nachbarschaft die nötigen Stallungen wiederaufgebaut wurden, wie es auf dem Lande üblich ist, verdünnisierten sich die Heimeltern.
Lediglich ein Pastor kam mit schwarzem Gewand; mit ebenso schwarzen, ehrgeizigen Augen dirigierte er das Geschehen. Seine unpersönliche Art deutete darauf hin, dass dies nur ein Karriere-Zwischenstopp war. Dem geistlichen Überflieger schien es nichts auszumachen, Kinder wie Einrichtungsgegenstände vorübergehend hin und her zu schieben auf andere Konvikte [kirchliche Schuleinrichtungen mit Internat]. Aber nur wenige Wochen später war das Wohnhaus wieder bezugsfähig und so kamen sie wieder zurück. Und als würde das Heim pro Kind mehr Geld von der Kirchengemeinde erhalten, wurden es immer mehr Kinder. Feierlich überreichte man der Heimleitung das Verdienstkreuz und huldigte ihre Bemühungen um die Ärmsten. Sie seien unverzichtbar, so der blasse, stramm organisiert wirkende Geistliche in seiner Ansprache. Auf den rasch aufgestellten Tischlein und Stühlchen nahmen die Vertreter aus allen Gemeinden Platz. Zum Dank gab es Kuchen und selbst gebackene Waffeln mit gezuckertem Sonnenschein.
Unterdessen schlich sich eine edel gekleidete Frau mit Sonnenbrille und Trenchcoat zum Tor. Hinter einer dicken Eiche blieb sie unbemerkt stehen und knipste mit ihrem Handy ein paar Fotos.
Als zum wiederholten Male ein Päckchen vor dem großen Tor abgelegt wurde, waren die Waisenkinder geschwind zur Stelle. Ohne zu fragen und ohne die Anschrift zu lesen, rissen sie die Bonbonpackungen auf und die Kamellen explodierten förmlich in alle Richtungen. Sofort stürzten sich die Kinder darauf und stopften sich die Münder damit voll. Vielleicht war es auch der blanke Hunger? Denn die Heimeltern waren mal wieder mit anderen Dingen beschäftigt.
„Weiß der Geier, wo die sich wieder herumtreiben“, brüllte ein Junge mit halb ausgezogener Socke über den Hof laufend. Lynn, warum auch immer, hatte man zur Strafe in den leeren Hundezwinger eingesperrt. Manchmal gab es tagelang kein Essen und kein Trinken. Die vierzehnjährige Berta war zwar für das Kochen zuständig, wenn die Heimmutter nicht da war, aber sie bestellte Pizza und bezahlte den Lieferanten mit gewissen „Missionarsdiensten“.
„Lynn!“ schrie der Jacco eines Tages über den Kogge-Hof laufend.
„Du musst zum Gut Diesburg! Ab in die Wanne! Die Elenora schneidet dir die Haare! Du bist ab sofort ein Junge! Klar?“
Lynn saß auf dem Fetzen Decke, den der Hund hinterlassen hatte. Niemand wusste, wo das Zotteltier eigentlich abgeblieben war. Und niemand wagte es, sich den Anweisungen eines Clanchefs zu widersetzen. Im Gegenteil: Jeder suchte das Weite, um nicht ins Visier seiner launigen Aggressionen zu gelangen.
Lynn, deren Gesicht ganz fahl war, zeigte keinerlei Reaktion. Auch dann nicht, als die Heimmutter mit ihrer Schneiderschere anrückte, einen Hocker mitten auf den Hof stellte, das Mädel dorthin zerrte und damit begann, ihr die goldroten Locken Strähne für Strähne abzuscheiden. Und während die Heimmutter dem Kind die Haare abschnitt, verlor Lynn ihre Würde.
Ein anderer verlor überdies auch noch seine Geduld. Rasend vor Wut packte er Lynn an den Schultern und sah ihr direkt in die Augen. Er fackelte nicht lange, holte aus und knallte ihr eine ins Gesicht: „Reiß dich zusammen, Mädchen!“ Er brause so laut auf, dass niemand an seiner Autorität zweifelte.
Danach folgten sanftere Worte. Es klang fast schon fürsorglich.
„Wir Menschen sind gleich mit den Kühen da drüben auf der Weide. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wir haben einiges gemeinsam. Wir arbeiten, manche von uns gebären und wir alle müssen irgendwann sterben. Dazwischen aber, mein Kind, gibt es für uns alle ein paar Stunden Leben, in denen wir in der Sonne ‚dösen‘ dürfen. Für manche sind es viele, für andere wenige. Das ist nix Ungewöhnliches. Je früher du dieses Naturgesetz akzeptierst, umso mehr ‚Sonnenstunden‘ kannst du haben! Klar? Und seinen Kummer verscheucht man am besten mit einer leichten körperlichen Tätigkeit. Ich habe das Richtige für dich gefunden!“
Er richtete sich auf und stolzierte auf und ab, bevor er weitersprach.
„Und zwar wirst du für den Benny einspringen und die Arbeit verrichten, für die der Junge vorgesehen war. Klar?“ Dabei kam er ihr so nahe, dass es schon indiskret war. Seine tyrannischen Worte klangen wie Donnerschläge. Lynn zeigte keinerlei Regung.
Die Heimmutter gab zu bedenken: „Aber Jacco, die brauchen wir doch noch für andere Aufgaben.“
Jacco kniff berechnend die Augen zusammen und erwiderte: „Ja, und deshalb soll sie erst nach der Erntesaison davonlaufen.“ Und mit Blick auf das Mädchen: „Verstanden?“
Er beugte sich noch mal zu ihr hinunter und schaute ihr direkt in die Augen, und als er seine Forderung wiederholte, antwortete sie mit einem gleichgültigen „Ja“, während weitere Locken auf den Boden kullerten. Lynn weinte ohne Tränen.
Im Inneren aber sagte sie zu sich selbst: „Eines Tages werde ich selbst entscheiden, was ich tun will und wohin ich gehen möchte!“
Kapitel 3
Elsterdiebische Retourkutsche
Nur wenige Tage später und mit schnellem Tempo war Jacco mit Lynn, die ab sofort auf den Namen „Benny“ zu hören hatte, vom Hof gerast. Dabei waren die gackernden Hühner in sämtliche Richtungen davongestoben. Am Himmel brauten sich Wolken zusammen und als sie auf Gut Diesburg ankamen, schüttete es wie aus Eimern. Das Gesicht des sonst immer so düster dreinschauenden Jacco, der deswegen auch als Mad-Face bekannt ist, glich der strahlenden Sonne, als die Geldscheine in seinem Beisein abgezählt und ihm ausgehändigt wurden. Dann flüsterte er dem Mädchen etwas ins Ohr, woraufhin diesem die Röte ins Gesicht stieg. Dann bekam sie von dem neuen Besitzer einen Eimer in die Hand gedrückt mit den barschen Worten: „Der Benny soll zu den anderen und bei der Erdbeerernte helfen.“
Alle packten mit an. Der Gutsverwalter brüllte seine Leute an: „Bis Sonnenuntergang müssen wir eine Menge geerntet haben, da die Erdbeeren noch in die Klosterläden in Echterville und Himmelroth gebracht werden müssen.“
Ein Junge, nicht viel älter als „Benny“, kam mit einem scharlachroten Fendt-Trecker über das saftige, grüne Gras angefahren. Der Regen schien ein wenig pausieren zu wollen und ein kobaltblauer Himmel kam nun zum Vorschein. Im Schlepptau kullerte ein Anhänger die Feldfurchen entlang. Schroff forderte der Junge die Leute auf, rasch die vollen Eimer einzufüllen. Dabei zeigte er auf große Kübel, die im Anhänger deponiert waren. Behände sprang er vom Trecker und schlenderte mit beiden Händen in den Hosentaschen durch die Reihen. Irgendwann blieb er bei Lynn stehen und bot ihr ein leuchtend rotes Prachtexemplar dieser köstlichen Frucht an. Sie hatte ihn gar nicht kommen sehen und erschrak. Eilig zog sie die Kapuze ihrer Regenjacke tiefer ins Gesicht und wendete sich ab, woraufhin der schlaksige blonde Junge mit den freundlichen blaugrauen Augen und einem Muttermal hinter dem Ohr beschwichtigend meinte: „Keine Angst. Solange du arbeitest, darfst du davon essen, so viel du willst. Unsere Erdbeeren sind die besten weit und breit!“ Diese Worte entlockten Lynn, die jetzt Benny hieß, ein verlegenes Lächeln, und sie grinsten beide.
Nach der Erdbeerernte kam die Kirschernte; da erst bemerkte sie, wie viele Leute oben auf den Baumkronen kletterten. Diejenigen, die Deutsch sprachen, hatten sich schnell zusammengetan und machten Witze. Die meisten waren nicht älter als dreizehn oder vierzehn Jahre und keiner von ihnen ging zur Schule.
Ein Bursche hing wie ein Affe in den Zweigen und stänkerte herum, während er seinen Eimer füllte: „Die sprechen nicht unsere Sprache. Die sind nicht von hier. Manche von denen haben wohl zu viel schwarzen Kaffee getrunken. Die kommen vermutlich aus Afrika oder Südamerika.“ Die Burschen lachten.
Ein anderer steckte sich eine Kirsche in den Mund und zog mit den Fingern seine Augenlider lang, was ihm ein asiatisches Aussehen verlieh.
Er witzelte: „Aber Schlitzaugen wie die Chinesen haben sie nicht!“
Ein anderer meinte: „Ob aus Bolivien, Brasilien oder Afrika, sie wissen zumindest, wo sie herkommen. Wir wissen es nicht!“ Solche und andere Witze sorgten für eine heitere Stimmung.
Plötzlich legte einer den Finger auf seine Lippen.
„Still! Der Aufseher kommt! Nicht quatschen! Arbeiten! Verstanden?“
Als die Sonne über die Mittagskurve wanderte und die Windenergieräder lange Schatten warfen, kam der Sohn vom Gutshof die abgeernteten Früchte abholen. Er juckelte mit seinem Trecker über das Feld und hielt bei Lynn an.
„Willst du ’ne Runde fahren? Geht ganz leicht. Ich zeig’s dir, okay?“
Lynn wusste nicht so recht. Auch wollte sie sich verdeckt halten. „Ich muss doch arbeiten. Und ich …“
„Ich soll dich sowieso zu den Hopfenfeldern bringen. Die sind als Nächstes dran.“ Er grinste sie charmant und offenherzig an.
„Ach komm schon!“ Sie blinzelte zu ihm hinüber. Das Abenteuer reizte sie. Doch sie zögerte und hielt ihr Cape fest; zumindest von der Kleidung her musste sie ein Junge bleiben.
Er ging wieder zu seinem Trecker und fuhr noch ein paar weitere Touren. Nach einer Weile hielt er mit seinem Gespann unter dem Kirschbaum, wo Lynn in den Zweigen hing. Lässig meinte er: „Du musst dich nur fallen lassen. Ich fange dich auf.“
„Du hast sie wohl nicht mehr alle! Da würde ich mir ja alle Knochen brechen!“
„Nicht, wenn du auf dem Stroh landest, das für die Hopfenfelder gedacht ist.“
Da ließ sie sich fallen. Sie jauchzte vor Freude. Aber nur einen Moment lang. Schnell richtete sie ihre Kleidung jungengerecht, wobei sie die dunkle Cordhose mit beiden Händen festhielt, da sie ihr ein bis zwei Größen zu groß war, und nahm auf dem Beifahrersitz Platz.
Erst fuhr er noch ein Stück über buckelige Feldwege, und während sie den Hang hinunterschaukelten und er das gegenüberliegende Feld wieder hinauffuhr und sein Fahrzeug hinter eine Baumgruppe lenkte, meinte er: „Kannst dich wieder normal benehmen. Ich weiß, dass du ein Mädchen bist.“ Er grinste sie an.
Sie staunte, wurde verlegen und schwieg.
Er nahm ihr mit einer Hand das Cape ab, während er mit der anderen Hand den Trecker lenkte. Sein Blick wanderte von ihr zur Fahrbahn und dann wieder zurück zu ihr. Er lächelte, grinste und lachte sie fast aus. Sie fasste sich an den Kopf und schämte sich. Da kam eine rotblonde Locke zum Vorschein.
„Ein roter Fuchs bist du also.“
Sie sahen einander an. Jeder dachte das Gleiche, aber keiner sprach es aus. Er legte seine Hand auf ihre.
„Keine Angst, ich verrate dich nicht.“ Dann wechselte der Junge das Thema: „Ich muss zu den Hopfenfeldern im Hopfendorf. Kannst dahin fahren, wenn du willst.“
Ohne Vorwarnung ließ er den Lenker los, bugsierte sich auf den Beifahrersitz und der Trecker drohte führerlos in eine Hecke zu fahren, wenn Lynn nicht alsbald das Lenkrad herumreißen würde. So tat sie es und der Trecker juckelte übers freie Feld. Sie jauchzte vor Freude und Stolz. Der Junge ermahnte sie, stets auf die Fahrbahn zu achten. Dann erklärte er ihr: „Jetzt schalten und die Kupplung kommen lassen!“
Es klappte nicht beim ersten Mal. Sie würgte den Motor ab.
Er setzte sich auf den Fahrersitz und bat sie, sich auf seinen Schoß zu setzen. Sie tat es und beide übten das Zusammenspiel zwischen Kupplung und Gangschaltung. Es dauerte den ganzen Nachmittag, doch es war das erste Mal nach langer Zeit, dass sie ihren Kummer vergaß, und das machte sie unsagbar frei. So kam es allerdings, dass sie beide die Zeit vergaßen.
Am Abend, als die Sonne unterging, ertönte eine Glocke aus dem Innenhof über die Felder hinweg. Der Duft von Apfelstreuselkuchen wehte zu ihnen herüber. Die Bäuerin stand in eine Schürze gekleidet da und betätigte jene kleine Glocke, während sie lautstark und lächelnd alle Arbeiter einlud, doch bitte in der guten Stube am großen Esstisch Platz zu nehmen. Warmherzig und vollbusig erlaubte sie es den Kindern nicht nur, sondern sie forderte alle Arbeiter mehrmals auf, tüchtig zuzulangen.
„Nehmt euch gerne eine zweite Portion, schließlich habt ihr auch tüchtig gearbeitet.“
Still setzte sich Lynn neben die anderen großen und kleinen Arbeiter auf eine ellenlange Holzbank, wie ihr schien. Ist das etwa das, was man eine „Volksbank“ nennt?, dachte sie.
Gierig stopfte sie alles in sich hinein und verschlang alles bis zum letzten Krümel und zum Schluss schleckte sie auch noch die Soße vom Tellerrand, bis der Teller blitzblank glänzte. Als es zum Nachtisch sogar noch Vanillepudding gab, wollte sie eigentlich nie wieder von hier weg. Eine gute Verpflegung und ein paar freundliche Worte sind süßer als der beste Honig, sie sind Balsam für die Seele, dachte Lynn.
Doch einige Wochen später, es war dunkle Nacht, da ertönte ein Klick-Klack an der Fensterscheibe des Hauses vom Kogge-Mühlenhof. Berta hörte es zwar, wollte aber nicht aufstehen. Lynn stand draußen, es regnete. Sie warf kleine Steinchen. Wie vereinbart war sie wieder erschienen, wenngleich mit großem Widerwillen.
Jacco grinste, öffnete ihr wissend die Fensterklappe und reichte ihr die Hand mit den Worten: „Braves Mädchen! Du wolltest also doch nicht, dass ich deinen Heimbruder Leo im Wald aussetze.“
Wortlos ging sie die knarrende Wendeltreppe hinauf und warf sich mit der Latzhose, die sie trug, aufs Bett.
An einem anderen Tag lag wieder ein Paket auf dem Esstisch. „Für Lynn!“ stand darauf geschrieben. Eines der Heimkinder hatte es entdeckt und schrie im Treppenhaus: „Lynn! Für dich ist ein Päckchen gekommen!“
Niemand rührte sich. Stattdessen hinkte Heimchef Onkel Jacco zur Tür herein und schnauzte Else an.
„Was macht das Paket hier? Wo ist mein Essen?“, wollte er wissen und warf das Paket auf ein verschlissenes Sofa in der Ecke.
Sofort stürzten sich die anderen Kinder darauf, und während Else ahnungslos mit den Schultern zuckte, rissen sie es auf. Jeder nahm sich etwas heraus. Gerade als sie verschwinden wollten, packte der Heimchef einen der Jungen an seinen Ohren: „Du Rotzbengel!“ Er knallte ihm eine. „Das ist für Lynn, leg das wieder zurück!“
Das brünette Mädchen Berta nahm das Paket und meinte, sie würde es Lynn bringen, doch Onkel Jacco winkte sie mit dem Zeigefinger zu sich. Er nahm den Karton an sich, und während er sein Mad-Gesicht aufsetzte und sich ein Gummibärchen in den Mund steckte, raunte er: „Meins! Klar?“, und verschwand in der Stube nebenan mit den tiefen, knackenden Dachbalken. Dort standen drei bis vier Schneiderpuppen in Lebensgröße, an denen an manchen Tagen die Heimchefin Tante Elenora schneiderte. An anderen Tagen, so wie heute, forderte Jacco die Kinder auf, ihm dorthin zu folgen. An den Kleidern dieser menschenähnlichen Figuren waren kleine Glöckchen befestigt.
Der Heimvater schrie sie an: „Bevor es was zu essen gibt, müsst ihr eure Geschicklichkeit üben. Verstanden?“ Dann sah er sich um.
„Lynn“, er hielt sie am Arm zurück. „Dich benötige ich für eine besondere Aufgabe. Komm!“
Die hochgewachsene Zwölfjährige mit den rotblonden Haaren und den frechen Sommersprossen entlockte ihm immer wieder Kommentare wie: „Kleine freche Hexe!“.
Er grinste doppeldeutig, nahm ihre Hände und begutachtete sie. „Zarte Werkzeuge, mein Kind. Und vielseitig einsetzbar.“ Schmunzelnd führte er eine ihrer Hände nach unten; just in dem Moment kam Elenora herein.
„Jacco, was tust du da?“, empörte sie sich. Mit düsterem Blick forderte sie ihn heraus: „Wollten wir die Kinder nicht für den Goldraub vorbereiten?“
Elenoras noble Stirn und ihr graziler Körperbau ließen vermuten, dass sie früher einmal Tänzerin gewesen war. Sie neigte ihren Kopf. Ihre künstlichen Augenwimpern wirkten glamourös, doch in ihrem Blick lag kaltes Kalkül, etwas Forderndes. Sie überlegte strategisch.
„Ihr müsst durch die Wälder über die Steinbogenbrücke. Dann über die Grenze nach Park-De-Lux. Während der Prozession sind alle Polizisten beschäftigt. Von Bollenpiont aus könnt ihr durch das dunkle Felsenlabyrinth des Müllertals ungesehen über Jung Linster in das Tal von Lux-City kommen. Und von der Osburger Festung aus gibt es einen Tunnel, der euch direkt zu den Glitzertürmen führt.“
Wenn jemand was vom Kommandieren verstand, dann Madam Elenora, dachte Jacco. Er fand sie unglaublich sexy, wenn sie Pläne schmiedete. In seinem Blick lag etwas Begehrliches. Er streichelte ihren Oberarm und grinste.
„Abgemacht!“ Freudig klatschte er in die Hände.
„Ihr habt es ja gehört, Kinder! Die royale Madam will Gold! Wir müssen also wieder auf Beutefang gehen. Am Wochenende geht’s nach Lux-City.“ Er klatschte abermals in die Hände. „Hopp, hopp, Crianças [portugiesisch für Kinder]! Ihr müsst euch nehmen, was euch zusteht. Schon in der Bibel steht geschrieben: ‚Alles gehört jedem!‘ Oder war es: ‚Macht euch die Erde untertan?‘“
Er zwirbelte an seinem Ziegenbärtchen und fuhr fort: „Alle Kinder mit einer Körpergröße bis zur Türklinke bereiten sich auf die Klingelstreiche vor. Schaut, dort drüben stehen eure Übungssoldaten.“ Damit meinte er die Schneiderpuppen. Er lachte.
„Und solltet ihr erwischt werden, übt den Kulleraugentrick, dann können die Leute euch nichts abschlagen. Die großen Jungs füllen das Pulver in die Bomben und legen die Zündkabel bereit. Wer weiß, vielleicht benötigen wir eine Ablenkung.“
Am Wochenende war es dann so weit. Jacco kommandierte. Die Kinder gehorchten. Er winkte Lynn und Berta zu sich und flüsterte: „Die großen Mädchen kommen mit mir. Steigt auf!“
Und so kletterten sie auf einen alten knatternden Lanz-Traktor. Kurz vor dem Grenzwald folgte ein Plateau mit Wiesen und Feldern, es gab aber auch Schluchten und Gräben. Vorbei an Freizeitkletterern kamen sie an eine Stelle, bei der Eisenbahnschienen durch einen Tunnel verliefen. Im Tunnel zweigten mehrere Versorgungskanäle ab. Und dorthinein beorderte Jacco die Mädchen. In gebückter Haltung folgten sie der Röhrenführung. Lynn und Berta hatten schon längst die Orientierung verloren.
Ein höllischer Lärm drang zu ihnen herüber.
Jacco flüsterte: „Kommt, hier, schnell! An den Maschinen vorbei in den schmalen Luftschacht. Die Lausbuben sprengen am Ende des Schachts die Gitterstäbe weg. Hier ist Arbeitsmaterial. Aber Vorsicht mit der Zündschnur! Die müsst ihr mir rausziehen. Verstanden?“





























