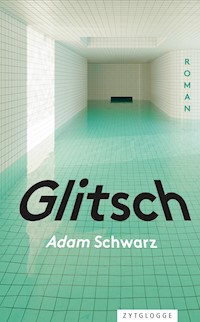
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pools, Plastikpalmen, Polarsonne: Léon Portmann durchquert auf einem Kreuzfahrtschiff die ganzjährig eisfreie Nordostpassage. Klimakatastrophentourismus mit Schlagerprogramm und Analogfisch auf der Speisekarte inklusive.Eigentlich wollte seine Freundin Kathrin die Reise allein machen, doch er hat sich ungefragt angehängt. Dabei sind die Risse zwischen den beiden offenkundig. Als Kathrin spurlos verschwindet, macht Léon sich auf die Suche nach ihr. Er taucht immer tiefer in den Schiffsbauch ab und gerät unter Verdacht, ein blinder Passagier zu sein. Weder Kathrin noch er stehen auf der Bordliste. Nach der Beziehung erhält auch die Wirklichkeit Risse: Gibt es Kathrin überhaupt? Und was haben ein neuseeländischer Philosoph, obskure Internetforen und ein 15 Jahre altes Videospiel damit zu tun?«Glitsch» ist der Trennungsroman zum Ende der Menschheit. Ein abgründiger Abgesang auf die Welt, wie wir sie zu kennen glauben, packend und klug in Szene gesetzt.Mit einem Nachwort von Philipp Theisohn
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Nachwort
Über den Autor
Über das Buch
ADAM SCHWARZ
GLITSCH
Der Autor und der Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur miteinem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
3. Auflage 2024 © 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Angelia SchwallerKorrektorat: Tobias Weskamp, Philipp HartmannCoverbild: © Jared Pike: «Dream Pool 31»Covergestaltung: Hug & Eberlein, Leipzig
Adam Schwarz
GLITSCH
Roman
«All my friends tell me I should move on
I'm lying in the ocean, singing your song»
Lana Del Rey
Wenigstens das Meer war noch da. Und auf dem Meer ein Schiff. Es schimmerte in der Spätsommersonne. Eine Aufschrift am Bug identifizierte es als Jane Grey, ein kurz vor der Ausmusterung stehendes Modell der Rapture-Klasse, einer der Kategorien, die die Diamond Lines für ihre Schiffe verwendete. Auf der Nordostpassage zwischen Hamburg und Tokyo war es unterwegs, einmal ganz Eurasien entlang, eine Strecke, die es fast zwei Mal pro Monat bewältigte, von März bis Oktober, in warmen Jahren auch bis Weihnachten.
Sie war ein schönes Schiff, die Grey. Nicht mehr ganz so glänzend und makellos wie im Hamburger Hafen damals, als die Kapitänin den Stahlbauch mit einer Flasche Schaumwein benetzt hatte. Aber ein ordentliches, ein gepflegtes und vor allem ein großzügiges Schiff war sie noch allemal, obschon die Preise für eine Überfahrt mit den Jahren gesunken waren, weshalb sich das Angebot inzwischen eher an das Preissegment der – wie es die Marketingabteilung der Reederei nannte – Konsum-Materialisten richtete und nicht mehr an das der Modernen Performer. So oder so war es ein eigenes Völkchen, das sich für ein dermaßen ausgemustertes Transportmittel begeisterte. Kreuzfahrtschiffe gehörten schließlich in eine andere Ära, eine unbeschwertere. Eine, in der das Leben simpler gewesen war, und in der man sommers Erdölkraftstoffe in die Luft gepumpt hatte, um dorthin zu fahren, wo heute deswegen die Wüste begann.
Es war der 19. August, und das Schiff war bereits seit fünf Tagen unterwegs. Die arktischen Temperaturen lagen um die achtzehn Grad, und auf dem Schiff befanden sich exakt 2508 Passagiere.
Eine große Zahl davon war auf gelbe Schaumstoffliegen drapiert. Dort übten sie unter der Polarsonne das Leben als Pflanze. Andere planschten im Blau der Außenbecken. Kinder schöpften die chlorige Brühe mit Händen und ließen sie sich auf den Kopf prasseln. Der chemische Geruch erinnerte an die Schwimmbäder in den westeuropäischen Ballungsräumen, aus denen die Kinder stammten, was aber nicht störte, gab es hier doch keinen Schwimmlehrer, der im Unterhemd den Beckenrand auf- und abschritt und den Kindern neidete, dass sie noch voll Potenzial waren, dass sie sich noch selbst aussuchen konnten, auf welche Weise sie im Leben scheitern wollten. Auch einen Bademeister gab es nicht. Die Reederei war gesetzlich nicht dazu verpflichtet, einen einzustellen, also ließ sie es sein.
Auf der Grey herrschte das Gebot, sich von seiner Seele zu trennen und sie, wie es im Katalog hieß, «baumeln» zu lassen. Baumeln, das bedeutete, dass man so viel essen und entspannen sollte, wie das Herz begehrte. Dass das Herz etwas begehren sollte, war sowieso klar.
Wer sagte, dass der Mensch nicht frei war? Für ein paar Wochen im Jahr war er es. Das Urlauben glich die Demütigungen, die ihm während dem Rest des Jahres widerfuhren, mehr als aus. Die arktische Sonne, sie schien nur für ihn. Nur für ihn überquerte das Schiff das Polarmeer, genauso wie er sonst nur für andere am Schreibtisch saß und nickte.
Wer dem in einem fort scheinenden Sonnenball nichts abgewinnen konnte, durfte sich im Schiffsbauch vergnügen. Dort konnte er die Gabel in Berge blasser Garnelen versenken, sich an den verschiedenen Zwischenhalten aufs Schiff geladene Schweden- und Schwarzwäldertorten in den Mundraum schieben und im Casino häppchenweise sein Erspartes verzocken.
Unter den Passagieren befanden sich auch solche, die nicht eigentlich Passagiere zu nennen wären, und die für sich, hätte man sie gefragt, was niemand tat, wohl die Bezeichnung Schiffsangestellte reklamiert hätten. Sie waren nicht immer leicht zu erkennen, aber sie waren da, verborgen zwischen den zahlenden Gästen: Köche und Köchinnen waren sie, Rezeptionistinnen und Rezeptionisten, Kellnerinnen und Kellner, Allrounderinnen und Allrounder, Croupiers und Croupièren, Bühnentechnikerinnen und -techniker, Tellerwäscherinnen und -wäscher sowie Entertainerinnen und Entertainer. Sie sorgten dafür, dass sich der Betriebsablauf nicht verzögerte. Die Aufgabe, den Passagieren drei Wochen zu ermöglichen, in denen sie einfach sie selbst sein konnten und wenn nicht das, dann zumindest auf der Suche danach, nahmen sie gerne wahr. Effektivität war ihr Motto, Entspannung ihr Ziel.
Doch während es den meisten Gästen bereits binnen weniger Stunden an Bord gelungen war, zu tun, wozu die Prospekte sie anhielten, gab es andere, bei denen sich partout keine Entspannung einstellen wollte. Sie schienen nicht eigentlich aufs Schiff zu gehören. Die Umstände – oder war es das Schicksal? – hatten sie hierhin verpflanzt. Da standen sie nun und wussten nicht weiter.
Zwei davon traten eben durch die Außentür der Polar Bar und stellten sich in die Nähe des Beckens, in dem sich graue nordwestrussische Wolken spiegelten. Der Mann, Ende zwanzig und gerade groß genug, um nicht als klein zu gelten, klammerte sich an seinem Gin Tonic fest. Das mintgrüne Polohemd – er hatte es sich in die Cordhosen gestopft – wollte nicht recht zum Dutt aus hellbraunem Haar, dem Ziegenbärtchen und der Discounterbrille passen. Er wirkte verkleidet oder so, als müsse er etwas beweisen.
Er streckte der Frau, die Mitte dreißig sein musste und seine gedrungene Erscheinung durch Gazellenartigkeit ausglich, sein Glas entgegen. Man prostete sich zu. Die Frau trank Wasser. Sie schien sich, anders als er, nicht nur in ihrer Haut, sondern auch in ihrer Kleidung wohlzufühlen. Die Perlohrringe, die von ihrem Septum-Piercing weit weniger gebrochen wurden, als sie glaubte, und ihr hochgeknöpftes Designer-Top ließen sie inmitten der Passagiere, die in ausgewaschenen Badehosen auf den Liegen lümmelten, leicht deplatziert erscheinen. Die Bezeichnung, auf die sich ihre Erzeuger kurz vor ihrer Geburt geeinigt hatten, lautete Kathrin, Kathrin Wahlau.
Und er, er war Léon. Einfach Léon.
Es war zwei Uhr nachmittags. Auf dem Schiff befanden sich noch immer exakt 2508 Passagiere. Trotz der Heizpilze, die sich über den ganzen Außenbereich verteilten und leise vor sich hin glühten, spürte Léon den arktischen Wind auf der Haut. Er stellte sich vor, wie es früher gewesen war, als die See rundherum so klirrend kalt gewesen war, dass sie die Schiffe an Ort und Stelle festgenagelt hatte, und spürte eine Sehnsucht, die ihn befremdete. Kälter als zwischen Kathrin und ihm konnte es damals auch nicht gewesen sein. Er sah zu seiner Freundin hinüber, die auf das beleuchtete Poolwasser starrte, als fände sich dort eine Antwort. Sie sei so still, sagte er, ohne nachzuhaken, woran das liege.
Sie musterte ihn. «Findest du?»
«Ja, schon.»
«Kannst ja was erzählen.»
Ihm war, als ob die anderen Passagiere ihn fixierten, also köchelte er ein Instant-Lächeln auf und streckte die Brust durch. Dann klopfte er seinen Hippocampus nach einer passenden Anekdote ab. Ob sie wisse, dass die Menschheit die Milchstraße nie verlassen können werde? Selbst mit Lichtgeschwindigkeit nicht. Dafür dehne sich das Universum zu schnell aus. Die Menschheit sitze fest, sagte er, und dachte: genau wie wir.
Kathrin setzte das Glas an die schmalen Lippen, kippte den Kopf nach hinten und wischte sich den Mund trocken. Dann sagte sie, sie verstehe immer noch nicht, weshalb er überhaupt mitgekommen sei.
Schon beim Frühstück im Pompadour hatte sie ihm vorgeworfen, er würde ihr die Laune verderben. Mag sein, dass er ab und an einen Spruch gemacht hatte des Schiffs wegen. Ein schwimmfähiger goldener Käfig. Eine bunt glänzende Totalität. Aber eigentlich wollte er sie bloß zum Lachen bringen. Schließlich hatte sie sich bis vor Kurzem oft genug über Kreuzfahrtouristen lustig gemacht, über Menschen, die glaubten, die Welt besser begreifen zu können, indem sie über ihre Oberfläche glitten, und dann auch noch mit einer dermaßen aus der Zeit gefallenen Form des Transports. Nun war sie selbst einer, und er mit ihr, so unbegreiflich das war.
«Ich wollte einfach mal wieder mit dir in Urlaub fahren», sagte er. Das war nicht einmal gelogen.
«Ich weiß doch, Léon.»
Er dachte an die vielen Diskussionen, die sie geführt hatten, seit sie ihm erzählt hatte, dass ihre Professorin sie nach Tokyo zu einer Konferenz zur interdisziplinären Erforschung der Weltablehnung eingeladen habe, dachte an all den Streit. Eineinhalb Wochen intensiver Diskussionen über ihr Promotionsthema. Klar, dass sie da dabei sein musste. Das sah er ein. Was er dagegen nicht hatte nachvollziehen können – und, war er ehrlich, weiterhin nicht nachvollziehen konnte –, war, weshalb sie dafür ausgerechnet ein Kreuzfahrtschiff nehmen musste. Selbst wenn sie einen Zeppelin hätte nehmen wollen, hätte er mehr Verständnis gehabt. Erst hatte sie behauptet, sie wolle einmal die Arktis sehen, den letzten Eisberg, aber das war Schwachsinn, und das wusste sie auch. Drei Wochen lang hatte er immer wieder nachbohren müssen, bis sie ihm schließlich nicht nur eröffnet hatte, dass ihre Eltern die Kabine bereits gebucht hätten, sondern auch, dass sie an Flugangst leide. Ausgerechnet sie. Ausgerechnet Kathrin, die sich sonst vor nichts zu fürchten schien, sondern sich auf alles stürzte, was nach Gefahr roch, die Felswände hochkletterte und Berge runterbretterte, Bungeesprünge von Staumauern machte und angeblich einmal, sechs Jahre, bevor sie sich kennengelernt hatten, mit Fallschirm und Schutzanzug durch die Stratosphäre gepurzelt war, ein Geburtstagsgeschenk ihres Vaters. Ausgerechnet sie also, die sonst in Todesgefahr erst richtig aufblühte, ganz so, als würde ihr der Tanz auf der Klinge helfen, das Leben besser zu verstehen.
«Sobald die Türen schließen, fühlt es sich an, als würden wir hinunterstürzen», hatte sie gesagt, eine Angst, die sie ihm in all den Jahren aus falscher Scham verheimlicht habe. Und dass es ihr leidtue, sehr sogar. Er hatte ihr geglaubt. Und vorgeschlagen, mitzukommen, obwohl er ahnte, dass das nichts für ihn war. Aber darum war es ihm auch nicht gegangen.
«Bist du sicher? Wir sind gut drei Wochen unterwegs», hatte sie gesagt. Nicht einmal, sondern viermal, fünfmal. Erst als er sie daran erinnert hatte, dass sie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gemeinsam verreist waren, hatte sie klein beigegeben. Es wird uns guttun, hatte er gesagt, nach allem, was in der letzten Zeit abgegangen ist.
Er dachte an die vergangenen fünf Tage. Wie sie bei der HafenCity auf das Schiff gestiegen waren und erst einmal vier Stunden im überfüllten Wiener Kaffeehaus hatten warten müssen, angeblich weil es Probleme mit der Lüftung gab. Daran, wie er am Abend, nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben eine echte Auster verzehrt hatte, ins Waschbecken kotzen und schließlich der Krankenstation einen Besuch abstatten musste. Wie er mit ihr den Whirlpool auf dem Flow-Deck hatte besuchen wollen und sie sich geweigert hatte, ins Wasser zu steigen, weil sich, wie sie behauptete, ein Pärchen darin befummelte. Wie sie auf dem Sonnendeck gelegen waren, ganz zuoberst auf dem Schiff, und er sich nicht auf seine Lektüre hatte konzentrieren können, weil man das Schweigen zwischen ihnen mit einem Messer schneiden konnte.
«Hey.» Er setzte sich neben sie und legte den Arm um ihre Taille. Durch den rauen Stoff ihrer Jeans spürte er die Wärme ihres Körpers. «Es tut mir leid. Wegen der Sprüche, meine ich.»
Sie rieb sich die Schläfen. Dann drückte sie ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. «Schon gut. Wir sind jetzt nun mal hier.»
«Ich meine, es hat uns ja nicht mal was gekostet. Und entspannen tun wir uns ja, oder?»
«Was anderes bleibt uns auch kaum übrig.» Sie lachte, höher als sonst.
Einen Augenblick später verfolgten sie, wie ein Mädchen in Straßenkleidung, älter als sechs konnte es nicht sein, sich den Weg durch die vor dem Pool verteilten Passagiere bahnte, wobei es einem Schnurrbartträger den Ellbogen mit einer solchen Kraft in die Rippe rammte, dass es ihn fast umwarf.
Schon stand das Kind im seichten Ende des Beckens, auf der Treppe, die in die chlorige Tiefe führte, und sah amüsiert zu, wie sich seine Jeans und sein T-Shirt mit Wasser vollsogen.
«Annalena, lass das!» Eine Frau mit Kurzhaarfrisur hetzte dem Mädchen hinterher, einen schlaksigen Achtjährigen im Schlepptau.
«Ich will aber endlich ins Wasser.»
«Was hab ich dir über das Warten gesagt?»
«Immer sollen wir warten. Du hast versprochen, wir würden zusammen ins Wasser gehen», sagte das Mädchen und machte zwei Schritte ins Becken.
«Du kommst da jetzt sofort raus!» Die Mutter setzte sich auf den Boden und löste die Birkenstocksandalen von den Füßen, wobei sie ihre Tochter nicht aus den Augen ließ. Das Mädchen starrte zurück.
Die Frau stieg ins Wasser, soweit ihre Dreiviertelleggins das erlaubten, und packte die Hand ihrer Tochter, worauf diese zu kreischen begann. Ihre Stimme war so laut und schrill, dass sie nicht recht zu ihrem Kinderkörper zu passen schien. Mehrere Passagiere hielten sich die Ohren zu.
«Annalena, du hörst jetzt sofort auf!»
Das Kind stampfte mit den Füßen. «Nein, nein, nein!»
Sie dürfe das nicht, rief der Bruder und streckte ihr die Zunge entgegen, die vom häufigen Süßigkeitenverzehr mit einer weißlichen Schicht belegt war. Sie dürfe noch nicht schwimmen. Sie sei zu jung und außerdem, das in seinen Augen größere Vergehen, ein Mädchen.
«Will aber ins Wasser.» Das Mädchen zerrte an der Mutterhand und machte ein Gesicht, als gelte es, Saft aus einem Stein zu pressen.
Sie solle das lassen, rief die Mutter, lass das, Annalena, sie könne noch nicht richtig schwimmen, und überhaupt sei jetzt nicht der richtige Augenblick.
Da riss das Mädchen den Mund auf und zeigte dem Himmel die spitzen Milchzähne. «Nie ist der richtige Zeitpunkt, du bist gemein, du lügst!», schrie es und zog an der Mutter. Die fiel um und klatschte bauchvoran auf die Wasseroberfläche, was dem Bruder einen Lachanfall entlockte.
Das Kind sprang in die Luft, als wolle es abheben und, Pionierin der Einpersonenraumfahrt, diesen von Eltern beherrschten Planeten verlassen. Eine Fontäne schoss hoch, dann explodierte es nach vorn. So stark peitschten seine Arme die Chlorbrühe, dass diese aufschoss und auf die Umliegenden herniederprasselte. Die paar Passagiere, die noch im Wasser verblieben waren, drehten sich nach ihm um und wichen ihm aus wie einer Naturgewalt. Mehrere kletterten aus dem Becken.
«Seht ihr», rief es, «ich kann's!»
Sie könne es eh nicht richtig, ergänzte der Junge die mütterliche um brüderliche Ablehnung. Er habe schon das Seepferdchen! Und den Pinguin. Schon sprang er ihr nach. Sein Lockenschopf erschien über der Wasseroberfläche.
Als es das sah, tauchte das Mädchen unter Wasser und schoss auf ihn zu. Kaum hatte es ihn erreicht, packte es seine Beine und riss ihn in die Tiefe.
Der Bruder tauchte hinunter, tauchte wieder auf, wurde erneut hinuntergezogen, hustete.
«Dumme Kuh», brachte er gerade noch hinaus, da presste seine Schwester ihm schon die Hände auf die Schultern und schickte sich an, ihn ein drittes Mal hinunterzudrücken. Doch diesmal war er vorbereitet und trat ihr unter Wasser gegen den Bauch. Als sie sich zusammenkrümmte, halb im Spiel, halb im Ernst, nutzte er den Moment, um nun im Gegenzug sie unter Wasser zu drücken.
«Aufhören!» Die Mutter war den Pool entlanggerannt, um auf der Höhe ihrer Kinder zu bleiben.
Sämtliche Gäste waren inzwischen aus dem Becken gestiegen, hatten Abstand gewinnen wollen. Noch immer drückte der Bruder seine Schwester unter Wasser.
«Lass sie los.»
«Warum?»
«Lass sie sofort los.»
«Der macht das doch eh nichts.» Der Bruder feixte, ließ dann aber doch von seiner Schwester ab. Ihr Körper trieb an die Oberfläche zurück. Das kleine Köpfchen war rot. Sie schickte sich an, sich an ihm zu rächen, ihm in die Schultern zu beißen, doch ein Blick ihrer Mutter brachte sie dazu, es sein zu lassen. Stattdessen legte sie den Kopf in den Nacken und heulte los, ihr Bruder tat es ihr gleich, zwei Kojoten, die sich von der Prärie in die Arktis verirrt hatten.
Das Gesicht der Mutter lief rot an. Sie sandte verzweifelte Blicke in alle Richtungen, als suche sie Bestätigung, dass alles in Ordnung war, doch die kam nicht. Stattdessen trat die Anklage hervor.
«Haben Sie eigentlich eine Vollmeise?»
Es war der Schnurrbartträger, den das Mädchen vorhin fast umgeworfen hatte. Er hatte das Geschehen von einer Liege aus beobachtet, die Schweinsäuglein aufgerissen, die Fäuste geballt. Hatte seinen gerechten Zorn auf kleiner Flamme vor sich hin köcheln lassen. Jetzt baute er sich vor der Mutter auf, die nicht zurückwich.
«Wir waren laut, ich weiß. Es tut mir leid.»
«Ha, ja, genau.»
«Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht ganz ...»
Der Mann richtete den wurstigen Finger auf die beiden Kinder, die im Becken ihre Bahnen zogen. «Das ist ein Erwachsenenbecken.»
«Bitte?»
Der Mann, der einen halben Kopf größer war als die Mutter, machte sich das zunutze und rückte noch näher auf, um auf sie herabzusehen. Die Frau hob das Kinn, konnte aber nicht ausweichen, weil direkt hinter ihr der Pool begann.
«Sie haben mich schon gehört. Kinder sind hier nicht zugelassen.»
«Tut mir leid, das wusste ich nicht ...»
Sie solle ihre Kinder einfach aus dem Wasser holen, sagte der Mann, so schwierig könne das ja nicht sein.
«Jetzt sind sie ja ruhig.» Wie auf ein Zeichen hielten die Kinder inne, klammerten sich am Beckenrand fest und beobachteten die Szene.
Der Mann streckte die Handflächen aus und sah in die Menge. «Glaubt das hier jemand ernsthaft?», fragte er, wobei er nicht zu merken schien, dass die Blicke, die sich auf ihn richteten, feindselig waren.
Kathrin legte Léon die Hand auf den Oberschenkel und sah ihn an, als wolle sie ihm etwas bedeuten. Nur verstand er nicht, was.
«Und überhaupt, dann tragen die Bälger auch noch normale Kleider. Und trotzdem lassen Sie sie ins Wasser, rücksichtslos, einfach rücksichtslos. Schon mal was von Erziehung gehört?»
«Wie bitte?», sagte die Mutter.
Ihre Tochter musste verstanden haben, was der Mann über sie gesagt hatte. Sie tauchte unter Wasser, als ob sie das Element vor den Anschuldigungen schützen sollte. Ihr Bruder schwamm derweil zum Beckenrand und zog sich an Land, ohne sich nach ihr umzusehen.
«Es geht niemanden etwas an, wie ich meine Kinder erziehe.»
Der Schnurrbartträger lachte freudlos. Das merke man. Erneut sah er in die Menge. Er strahlte. Die Aufmerksamkeit, die er erhielt, schien ihm zu gefallen.
Im Verlauf des Gesprächs hatte Léon Kathrin neben sich angestrengt atmen gehört, gemerkt, wie sie sich zwang, ruhig zu bleiben. Nun schoss sie auf. Streckte den Rücken durch und stakte auf den Mann zu, wie sie das immer tat, wenn sie wütend war.
«Lassen Sie die Frau ihn Ruhe, sie hat Ihnen nichts getan.»
«Auch das noch. War ja klar. – Gibt’s denn hier keine Security?»
Nach und nach waren sämtliche Passagiere auf ihren Liegen hochgerückt. Sonnenbrillen verbargen ihre Blicke. Niemand erhob sich, um dem Mann beizustehen. Sein Ruf blieb unerhört, also half er sich selbst, indem er die Gesichtsfarbe adjustierte und die mageren Beinchen noch breiter auf den Boden stellte. Unverantwortlich sei das, vollkommen unverantwortlich. Seit zehn Jahren reise er jetzt mit den Diamond Lines. Sowas sei ihm noch nie untergekommen.
Léon sah zum Becken: Blasen stiegen aus dem Wasser hoch. Das Mädchen lag auf dem Grund, immer noch in Straßenkleidung, und bewegte sich nicht. Es hatte die Augen aufgeschlagen und gen Himmel gerichtet, nicht von dieser Welt. Weshalb kümmerte es niemanden, dass es sich in Gefahr brachte?
Außerdem – so bleich, wie es aussehe – sei das Mädchen bestimmt krank, sagte der Mann jetzt plötzlich, und ob sie wisse, wie schnell sich Krankheitserreger auf Schiffen verbreiten könnten. Die seien schließlich ein geschlossener Kreislauf.
«Wovon zur Hölle reden Sie?», fragte Kathrin.
Das Kind war weiterhin unter Wasser. Léon spürte, wie sich seine Brust zusammenschnürte. Ihm fiel ein, dass er einmal gelesen hatte, dass man Ertrinkende kaum erkennen konnte, weil sie nicht auf sich aufmerksam machten. Die Sorge ließ ihn aufschießen, zog ihn zum Beckenrand.
Das Mädchen lag noch immer auf dem Beckenboden. Sein Haar, von einer der Drüsen durcheinandergewirbelt, flatterte wie ein Vorhang vor seinem Gesicht. Die Augen, soweit er sie durch das Wasser erkennen konnte, wirkten wie Murmeln, die Lider zuckten.
Wieso stritten sie um das Mädchen, anstatt ihm zu helfen? Wo war der Bruder? Weshalb schritt er nicht ein?
Sie ertrinke, schrie er, das Mädchen ertrinke, ob ihm denn niemand helfen wolle. Aber Kathrin warf ihm nur einen Seitenblick zu und auch die anderen Passagiere beachteten ihn nicht, so als gehöre er gar nicht dazu. Sonnenverkrustete Lippen saugten Alkohol, in dicken und dünnen Bäuchen rumorten die Schnitzel vom Mittag, Bürohände tapsten auf den Bildschirmen von Smartphones herum, deren Kameras das Geschehen aufnehmen sollten, um es zu bannen.
Die nächsten Momente sollten ihm rückblickend wie eine Szene aus einem Videospiel vorkommen. Als säße jemand Fremdes an einem Controller und steuerte jede seiner Bewegungen. Er registrierte Furcht, doch sie kam nicht in seinen Gliedern an. Schon lag die Brille in der Beckenrinne und sein Körper glitt ins Wasser hinab. Den Bruchteil einer Sekunde hörte er noch das Gebrüll der anderen, dann waren die Stimmen bloß noch ein dumpfes Dröhnen. So mussten sich Menschen für Fische anhören. Er bekam das Mädchen zu fassen, es war schlaff und wirkte leblos, packte es unterm Arm, stemmte die Beine gegen den Beckenboden und schwamm mit ihm an die Oberfläche zurück. Dann legte er es hin. Seine Augen brannten vom Chlor, und er spürte, wie sich seine Lungen blähten und sein Herz pumpte, um frischen Sauerstoff in seinen Körper zu bringen.
Das Mädchen lag auf dem Rücken wie ein gestrandeter Fisch. War es tot? Panik stieg in ihm auf, und er schrie erneut um Hilfe.
Nun drehte man sich doch nach ihm um, endlich. Kathrin und die Mutter rannten auf ihn zu und ließen den Mann stehen. Einige andere Passagiere erhoben sich und bildeten eine Traube um sie beide.
Sie brauchte Luft. Léon erinnerte sich an ähnliche Szenen aus Filmen, Romanen, in denen der Retter das Gegenüber beatmet, seinen Atem mit ihm geteilt hatte, wollte sich gerade über sie beugen, als die Mutter sagte: «Annalena, lass den Unsinn.»
Das Mädchen schlug die Augen auf und stieß einen spitzen Schrei aus, als es Léon über sich sah. Dann rannte es zu seiner Mutter und versteckte sich hinter ihrem Rücken vor dem Retter.
Der blieb allein zurück. Der Boden drückte ihm die Kniescheiben ein. Die nasse Kleidung klebte auf seiner Haut, tropfte, formte eine Pfütze.
Jemand lachte nervös. Es war er selbst.
Vorsicht sei besser als Nachsicht, rief ein Spötter. Vereinzelt war Gelächter zu hören.
«Trotzdem vielen Dank», hörte er die Mutter sagen.
Er stand auf. Sein Kopf war heiß. Am liebsten wäre er weggerannt. Oder über die Reling gesprungen und immer tiefer getaucht, bis runter in die Hadalzone. Auf den Meeresgrund, in den Hades, die Unterwelt. Stattdessen trat Kathrin auf ihn zu und drückte ihn an sich. Er spürte, wie sich ihr Top mit dem Chlorwasser aus seiner Kleidung vollsog, die er an sie drückte. Hinten, bei einem der Ausgänge, führten zwei weißgekleidete Securityangestellte den Schnurrbartträger ab. Seine Hände waren hinter dem Rücken mit Kabelbinder zusammengebunden. Ihre Blicke trafen sich. Léon sah weg.
Der Farbstempel, den die Scham über seine missglückte Rettungsaktion ihm aufgedrückt hatte, war hartnäckig. Er blieb, als er Kathrin dazu brachte, sich endlich von der Mutter, die ihnen nicht genug für ihren Einsatz danken konnte, zu lösen, blieb, als sie die Bäuche passierten, die sich der Sonne wie reife Kürbisse entgegenspannten, und wollte selbst dann nicht verblassen, nachdem sie über die Schwelle ins Schiffsinnere getreten waren.
Ihr Weg nach Hause – ihr temporäres Zuhause zumindest – führte am «authentisch argentinischen» Steakhouse Mendoza vorüber, aus dem ihnen ein Duft nach schlecht gealtertem Frittierfett entgegenschlug, und das Treppenhaus zum Coral-Deck hinunter. Das Gym passierten sie, das durch eine Glasscheibe vom Gang abgetrennt war, was die Trainierenden wie Ausstellungsstücke in einem Diorama wirken ließ. Dann galt es, dem purpurfarbenen Teppichboden zu folgen, eine ganze Schiffslänge lang, den Pool, die Mutter und ihre Kinder – ob es wohl einen Vater gab? – hinter sich lassend. Da war sie endlich, die 1107. Ihre Nummer. Léon drehte den Türknauf.
Der Raum roch nach Limetten, oder genauer gesagt nach deren Simulation. Wie wenn man einem Computer von ihrem Duft und ihrer Porenhaut berichtet und ihn dann seinen Träumen überlassen hatte. Die Putzequipe musste sich ihre Abwesenheit zunutze gemacht und den Raum gesäubert haben. In seiner Vorstellung war sie längst zu einer fast schon mythologischen Gestalt herangewachsen. Einer Himmelsmacht, der es gelang, stets dann aufzutauchen, wenn sie nicht hier waren. Überall hatten sie ihre Spitzel und Schergen versteckt. Tag für Tag reinigten sie Boden und Bad, einerlei, wie verdreckt sie waren. Jeden zweiten Tag wurde zudem die Bettwäsche weggerissen, um sie in den niederen Regionen der Grey an eine Industriewaschmaschine zu verfüttern.
Ihr Zimmer gehörte der Kategorie Superior an, der zweitbesten Kategorie, und war nicht nur, «nicht nur», wie es im Prospekt geheißen hatte, mit einer Spielkonsole und einem 50-Zoll-Flachbildschirm ausgestattet, auf dem die immer gleichen fünfzehn Filme liefen, sondern auch einem Balkon, von dem man aufs Wasser starren konnte – oder auf die anderen Passagiere, die ihrerseits von ihren Balkonen aufs Wasser starrten.
Doch der einzige Einrichtungsgegenstand, der Léon gerade interessierte, war das grotesk große Kingsize-Bett, auf das er sich mit einem Ächzen fallen ließ. Er sank in den Memory Foam, wurde verschluckt, gefressen, verschlungen. Es war wunderbar. Winterschlaf im Spätsommer, das wär’s. Sich totstellen, Kältestarre. Die zwei Wochen, die es noch dauern würde, bis sie in Japan anlegen würden, einfach verschlafen, und mit ihnen all den Streit, der noch bevorstand.
Kathrin setzte sich an den Schminktisch mit dem falschen Art-déco-Spiegel und pflückte sich die Perlen von den Ohrläppchen. Griff sich ein Pomadendöschen und zog eine Fettspur über die Lippen. Aus dem Spiegel heraus sah sie ihm dabei zu, wie er ihr zusah, also schaute er weg. Vergrub sich unter dem Beutel aus toten Federn. Das half nichts, denn das Bett roch nach ihr. Nicht nach ihrem Körper, sondern nach dem Duft, den sie im Biomarkt für sich erstanden hatte: Apfel-Rosmarin. Sie hatte das Parfümfläschchen bezahlt und nach Hause genommen, und jetzt durfte sie danach riechen. So war das.
Das Mädchen blitzte auf, wie es vermeintlich leblos auf dem Poolboden lag. Es musste nur gespielt haben, dass es ertrank, womöglich um zu sehen, ob seine Mutter es bemerkte. Das Lachen der anderen Passagiere hallte noch immer in seinem Ohr. Da nutzten die Stahlwände wenig, die zwischen ihnen und dem Pool waren. Wie es wohl sein musste, ein Zimmer direkt unter dem Pool zu haben? Du liegst im Bett und über und unter dir schwappt das Wasser. Bizarr.
Warum sich Kathrin wohl so für die Mutter eingesetzt hatte? Es war, als hätte die Szene die richtige Resonanz erzeugt, einen Ton angeschlagen, dem sie nicht unbeteiligt gegenüberstehen konnte. Vielleicht hatte der Mann sie an den anderen Leon in ihrem Leben erinnert, ihren Vater, Leon den Großen, den Besseren. Leon Wahlau steht für Ruhe und Orden. Er dachte daran, wie sie ihm erzählt hatte, dass ihr Vater das Wasser im Pool immer komplett ausgetauscht hatte, nachdem Kathrin und ihre Schwester darin geplantscht hatten, und wie er ihnen verbot, sein Homeoffice zu betreten, selbst als Erwachsene, weil sie es, wie er sagte, in Unordnung bringen würden. Wozu auch immer der Kerl Kinder bekommen hatte. Kinder. Wann würde sie wieder bereit sein, über das Thema zu sprechen? Noch vergangenen Oktober hatten sie halb im Scherz davon gesprochen. Etwas mehr als sechs Monate war es her, seit sie es das letzte Mal versucht hatten.
Damals vor fünf Jahren, ganz am Anfang, in der Ferienwohnung in der Auvergne, als ihm das Kondom verrutscht war: Kathrin, die unter die Dusche rennt, das halbe Duschgel leert, sich den Duschkopf zwischen die Beine hält. Wie sie mit dem Fahrrad in den Ort gerast waren, zur nächsten Apotheke. Und wie Kathrin die Pille mit Cola heruntergespült hatte.
Er hätte ihr damals gestehen müssen, dass von ihm in dieser Hinsicht kaum Gefahr ausging. Sie zur Zeugin seiner Zeugungsunfähigkeit machen sollen. Ihr das Spermiogramm von Dr. Hülser zeigen. Stattdessen hatte er geschwiegen, auch später. Und es damit von Mal zu Mal schwieriger gemacht, doch noch mit der Wahrheit herauszurücken.
Der erste Schwangerschaftstest, den sie Anfang vergangenen Jahres aus der Bahnhofsapotheke mitgebracht hatte. Kurz nach ihrem 33. Geburtstag war das gewesen, an einem Samstagmorgen. Jetzt gelte es ernst, hatte sie gesagt, die Plastikverpackung aus ihrem Jutebeutel gezogen, auf dem das Logo der Gassenküche abgebildet war, in der sie damals aushalf. Spätestens damals hätte er es ihr sagen sollen. Ihr Gesicht, als sie von der Toilette zurückkam und ihm wortlos das Plastikstäbchen entgegenhielt: ein Streifen. Wie viele Tests hatte sie seither gekauft, fünf, sechs? Fünf oder sechs Gelegenheiten für ein Geständnis. Er hasst sich dafür. Ihre starre Maske, die sich nach jedem negativen Test mehr und mehr festigte, selbst wenn sie miteinander schliefen, dieser harte Ausdruck, der nicht weichen wollte.
Und dann, plötzlich, nichts mehr. Als ob nie etwas gewesen wäre. Kein Sex, keine Küsse, keine Umarmungen, nur noch sie beide, wie sie angestrengt versuchten, so zu tun, als wäre zwischen ihnen alles in Ordnung. Plötzlich fing Kathrin damit an, dass sie nicht sicher sei, ob sie überhaupt Kinder in diese Welt setzen wolle, wie sie sagte. Sprach nur noch von ihrer Doktorarbeit. Dabei war eine eigene Familie doch immer ihr Traum gewesen, mehr noch als seiner. «Ich will es besser machen», hatte sie immer gesagt. Und nächstes Jahr wäre er doch vermutlich durch mit dem Studium, könnte endlich arbeiten.
Das ungezeugte Kind lag zwischen ihnen, wenn sie schliefen, es brüllte in der Nacht und riss ihn aus seinen Träumen. Es verhedderte sich in seinen Gedankenfäden und verdorrte ihm die Zunge.
Heute würde er es ihr sagen. Heute oder nie. Es wäre schmerzhaft, aber vielleicht würden ihre beiden Zahnräder dann endlich wieder ineinandergreifen, würde sich etwas bewegen, egal in welche Richtung. Hauptsache, kein Stillstand mehr.
Ein Knall riss ihn aus seinen Gedanken: die Badezimmertür.
Dann das Umdrehen des Schlosses, das Aufklappen des Toilettendeckels, das Surren der Ventilation, die alles Unangenehme absaugte und in die Meeresluft beförderte, wie überhaupt das Schiff alles, was sich nicht mehr verwerten ließ, ausspuckte: den Rauch, die Fäkalien, die Wasch- und Lebensmittelreste.
Das Plätschern eines Urinstrahls auf Keramik. Gleich würde sie sich die Hände einseifen, sorgfältig, wie sie das immer tat, den Handrücken und die Handfläche und jeden Finger einzeln, ohne die Zwischenräume zu vergessen. Sie würde sich die Haut mit dem weißen Frottee abschrubben, und dann würde sie sich neben ihn legen und nach einem Thema suchen, auf das sie sich beide zubewegen konnten, ohne auf eine Mine zu treten. Vermintes Gelände, das waren ihre Gespräche seit Längerem, ohne dass er hätte sagen können, wer die erste Mine gelegt hatte. Er drehte sich auf den Rücken und sah zur Tür.
Die Prophezeiung erfüllte sich: Die Vakuum-Spülung saugte und rumpelte, der Wasserhahn heulte auf wie eine Sünderseele im Höllenfeuer.
«Na?» Sie stand im Türrahmen, die Hände in der schwarzen Jeans, die skinny war wie stets. Es war dieselbe Hose, die sie damals an der Fakultätsparty getragen hatte, als sie sich kennengelernt hatten. Es musste sie sein, verwaschen, wie sie war.
Ihr Gesicht war auch verwaschen, wie bei einem überlichteten Foto. Sie legte sich neben ihn, streckte die Arme nach Backbord und Steuerbord, und gähnte. «Lass uns ab jetzt immer hier drinbleiben», sagte sie.
Er nickte. Was hätte er sonst tun können.
Eine ganze Weile lagen sie da und sahen zur mit Kunststoffplatten verkleideten Decke hoch, Schauspieler, die Entspannung mimten. Aus dem Nachbarzimmer Schüsse und Schreie. Die Nachbarn mussten die Konsole für sich entdeckt haben. Durch die Fensterfront war die See zu sehen, wie sie versuchte, das Schiff zu verschlingen, wie stets ohne Erfolg.
Er sei so still, sagte sie schließlich.
«Ich entspanne mich.»
«Du machst das richtig. Dazu sind wir ja auch hier. Also ich brauch das jetzt.» Sie legte ihren Kopf auf seine Brust, er drückte ihm auf das Schlüsselbein. Warum er sie eigentlich vorhin nicht unterstützt habe, fragte sie.
«Wie meinst du?»
«Wegen dem Arschloch.»
«Ein Kind war am Ertrinken.»
«Es war nicht am Ertrinken, Schatz.»
«Für mich sah es aber sehr danach aus.»
«Eben, für dich. Du musst dir das eingebildet haben.»
Er presste die Augenlider zusammen. Versuchte, zu schätzen, wie lange die Szene gedauert hatte. Unmöglich. Vielleicht war alles schneller gegangen, als er gedacht hatte, und das Mädchen war bloß einen Augenblick untergetaucht. Vielleicht hatte sie recht.
Als er die Augen wieder aufschlug, sah er, dass sie den Kopf vor und zurück bewegte, regelmäßig wie ein Uhrwerk. Ihr Rücken, den sie sonst so gerade hielt, als würde ihr jemand ein Lineal gegen die Wirbelsäule pressen, war eingeknickt. Tränen liefen ihr übers Gesicht.
«Kathrin?»
Sie sagte nichts. Fixierte die Anker und Segelboote, die die Tapete überzogen. Dann schrie sie plötzlich wütend auf, so laut, dass die Nachbarn es durch ihren Ego-Shooter hindurch hören mussten, nur um sich dann plötzlich den Unterarm in den Mund zu rammen und zuzubeißen.
Léon presste die Lider zusammen und riss sie wieder auf. Es half nichts. Die Situation war immer noch da.
Kathrin lag zusammengekrümmt auf dem Bett, ein nasses Bündel Mensch. Warum das alles so kompliziert sei, fragte sie.
Bis jetzt hatte er dagesessen, den Rücken gegen das Kissen gestützt, im Versuch, der oft geforderte Fels in der Brandung zu sein. Aber er war kein Fels, er war bloß Léon. Er war nur der Sohn von Gärtnereibesitzern, geboren auf einem absteigenden Ast, ein Sack voll Halbwissen auf zwei kurzen Beinchen, die weder vor noch zurück wollten.
Er drehte sich so, dass er sich an sie schmiegen konnte. Dachte an ein Video, das er einmal im Netz gesehen hatte. Sieben Dinge, die du tun kannst, wenn du die Orientierung verloren hast:
1. Verfolge deine Schritte bis zu dem Punkt, an dem du noch wusstest, wo du warst.
2. Orientiere dich an der Sonne.
3. Moos wächst immer nach Westen.
Den Rest hatte er vergessen.
Er wisse es auch nicht. Aber es müsse ja nicht so bleiben, sagte er schließlich.
«Ich hab aber Angst, dass es das tut.»
Er hätte sich am liebsten gezwickt, geohrfeigt oder mit kaltem Wasser übergossen. Irgendetwas unternommen, um sich aus dieser Starre zu befreien. Das war das Wichtigste: nicht haltmachen, immer weitermachen. Es war wie in der Musik: Wenn alles gut lief, achtete man nicht auf die einzelnen Töne, sondern überließ sich ganz ihrer Wirkung. Tappte mit dem Fuß, tanzte durch den Club. Nur wenn ihr Fluss stockte, hörte man genauer hin. Bemerkte plötzlich die Stille zwischen den einzelnen Tönen, die immer schon dagewesen war.
«Das wäre sehr schade», sagte er nach einer Weile.
Schade. Eine Phrase, die sich kaum mit seinem zunehmend schneller werdenden Herzschlag deckte. Es war mehr als schade. Wenn er in den vergangenen Monaten und Jahren an die Zukunft gedacht hatte, hatte er immer sie darin wiedergefunden. Nun drohte sie auf einmal daraus zu verschwinden, weigerte sich, weiterhin Teil seiner Tagträumereien zu sein. Träum du für dich und ich für mich und dann schauen wir, ob wir uns in der Mitte treffen.
«Kann ich dich was fragen?», sagte sie.
«Klar.»
«Warum wolltest du wirklich mitkommen?» Sie hatte sich wieder aufgesetzt und sich das Gesicht trockengewischt. Die Frage kam ihm deplatziert vor.
«Es ist doch normal, dass Paare zusammen verreisen.»
Sie wich seinem Blick aus, der über ihr Gesicht tastete, sie zu verstehen suchte. Sie war genauso schwer zu lesen wie ihre Eltern. «Das wird es sein», sagte sie.
Er spürte, wie er die Zähne aufeinanderpresste. Etwas drückte ihm von innen gegen die Kehle. Wie nach der Austernmahlzeit am ersten Abend. Gleich muss ich brechen, dachte er. Stattdessen spürte er, wie seine Augen wässerten. Ein salziger Geschmack auf seinen Lippen, sein inneres Meer.
Dieser Streit kam ihm vor wie ein Labyrinth aus Türen, die in sämtliche Richtungen führten, nur nicht nach draußen an die Luft. Frische Luft, das war es. Er stand auf und sperrte die Balkontür so weit auf wie möglich.
Draußen beugte er sich über die Reling und sog den Duft nach Salz und Rauch ein, massierte sich die Schläfen. Ein Joint oder ein Bier, das wär’s jetzt, Substanzen, die den Knoten im Kopf lösten.
Erst nach einer ganzen Weile drehte er sich wieder um. Kathrin saß noch auf dem Bett. Die Beleuchtung ihres Handybildschirms überzog ihre Haut mit einem blauen Schimmer. Ihre Augen glänzten. Wie oft in letzter Zeit wirkte sie innerhalb von Minuten wie ausgewechselt.
«Schau mal.» Sie streckte ihm das Gerät entgegen. Darauf war er zu sehen, wie er sich aufs Geländer stützte und aufs Wasser blickte. Friedlich sah er aus. Dem Bild konnte man nicht entnehmen, worüber er nachdachte. Alles war möglich. Es kam nur darauf an, in welchen Kontext man es setzte.
«Darf ich das posten?», fragte sie. «Du siehst so zufrieden aus.»
Er nickte und legte sich wieder neben sie. Sie sahen zu, wie der Upload-Balken vorankroch. Das Internet auf dem Schiff war quälend langsam, da kaum Satelliten über diesem Abschnitt des Planeten schwebten. Erst als das Foto erfolgreich hochgeladen war, verkündete die App, was Kathrin daruntergesetzt hatte: «Unser Blut hat denselben Salzgehalt wie das Meer.» Dazu drei Herzen, zwei blaue und ein rotes.
«Toll, nicht?» Sie lächelte ihn an, als wäre nichts gewesen. Etwas stimmte nicht, das merkte er. Etwas hatte schon die ganze Zeit nicht gestimmt. Ihr Gesicht sah aus, als hätte man ihr die ganze Nacht mit einem Scheinwerfer hineingeblendet. Als sie merkte, dass er sie musterte, presste sie die Arme auf seine Schultern, drückte ihn aufs Bett, schlang ihre Beine um die seinen und küsste ihn. Ihr Mund schmeckte anders als sonst, krautig und dunkel.
«Es tut mir leid, dass ich in der letzten Zeit so komisch bin.» Und dann, weil er nicht antwortete: «Weißt du noch, wie wir immer bei mir auf dem Balkon saßen? Damals am Täubchenweg?»
Es war ihre Art, einen Streit zu schlichten: Sie schaufelte den ganzen Ballast weg und legte die gemeinsamen Wurzeln frei, die sie beide, knorrig und verwinkelt, zu einem einzigen Gewächs machten.
Sie schilderte die ersten paar Wochen, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Wie sie bis drei Uhr morgens, oder war es vier, in der Septembernacht gesessen und er, das Landkind, ihr die paar Sternbilder gezeigt hatte, die nicht von den Lichtern der Stadt überblendet wurden: den Großen Wagen etwa oder auch Kassiopeia, Konstellationen, die ganzjährig zu sehen waren und auf der Nordhalbkugel nie untergingen.
Sie hatten Kindheiten getauscht, vom Kindergarten bis zum letzten Schultag. Sie wuchs plötzlich als schüchterner Sohn eines Gärtnereibesitzers auf, er als einzige Tochter des aus der Presse sattsam bekannten Powerpaars Schindelmayr-Wahlau, bestehend aus dem bekannten Abgeordneten und VR der PharmaCon und der nicht minder berühmten Architektin von Bahnhofsgebäuden und Einkaufszentren.
Sie streuten getrockneten Tabak auf dünnes Papier, rollten sich Zigarette um Zigarette und unternahmen zaghafte erste Schritte in den fremden Kindheiten. Als er erzählte, wie ihn Michael, ein pubertärer Peiniger, in der Umkleide zwang, unter dem Gejubel der anderen eine Cola zu trinken, in die er hineingespuckt hatte, drückte sie ihre halbgerauchte Zigarette aus, als wolle sie nun für immer mit dem Rauchen aufhören. Und nachdem sie geschildert hatte, wie Veronika, ihre Mutter, sie jedes Mal am Ohr gerissen hatte, wenn sie eine ungenügende Klausur geschrieben hatte – sie musste glauben, es sei nur angeklebt, sagte Kathrin –, schnippte er seine Kippe runter auf den Bürgersteig, wo sie wohl noch eine Weile trotzig vor sich hin glomm. Das musste einige Stunden gewesen sein, nachdem sie zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, und kaum eine Woche, nachdem sie ihn an der Fakultätsparty angesprochen hatte, an der er nur gewesen war, weil Hendrik ihn mitgeschleift hatte. Niemand esse von ihrem Bananenbrot, hatte sie sich beklagt, und ihn, der schon ziemlich einen sitzen hatte, zum wackligen Sperrholztisch gelotst.
«Familie kann hart sein», hatte er ihre Geschichte kommentiert, damals auf dem Balkon, und an die Gärtnerei gedacht, die gerade brach lag, weil seine Eltern in der Klinik waren.
Sie wolle trotzdem mal Kinder, hatte sie gesagt, und er hatte gesagt, er auch.
Der Léon auf der Jane Grey sah nun zu ihr hoch und entdeckte sich selbst als Flecken, der in ihrer Pupille gespiegelt wurde. Hätte er keine Menschenaugen, sondern die eines Adlers oder eines Habichts, dachte er, vielleicht könnte er in den Pupillen seines Spiegelbilds wiederum sie entdecken und dann immer so weiter, bis es nicht mehr ging.
Ob er sie etwas fragen dürfe, sagte er.
«Nur zu.»
Ob sie eigentlich noch Kinder wolle, fragte er.
Sie neigte den Kopf zur Seite. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war schwer zu lesen, er flatterte. «Wir haben es doch erst neulich probiert.»
«Wenn du Februar neulich nennst.»
Sie ließ von ihm ab und rollte neben ihn. «Weißt du, was meine Mutter zu mir gesagt hat? Ich solle mich untersuchen lassen. Kann ja nicht schaden, hat sie allen Ernstes gemeint.»
Schuldgefühl stieg in ihm auf. Um es wegzuwischen, fragte er schnell: «Sind sie also doch bereit, einen Enkel zu bekommen, der minderwertiges Portmann-Genmaterial in sich trägt?»
«Sieht ganz danach aus.»
Er stellte sich vor, wie die Wahlaus auf ihren Vitra-Sofas klebten und über Eileiter, Fruchtbarkeitszyklen und den Einfluss von zu wenig Bewegung und zu viel THC auf die Fruchtbarkeit diskutierten. Wenigstens ein Zeichen, dass sie nach fünf Jahren endlich akzeptiert hatten, dass ihre Tochter mit einem Versager zusammen war, einem Provinzler, der aus einer Gegend weit jenseits des städtischen Speckgürtels stammte. Aus den karstigen Bergen, da komm ich her.
Kathrin knöpfte ihm den Polokragen auf und legte ihm die Hand auf die Brust, als wolle sie die paar Brusthaare zählen, die sich darauf verirrt hatten. Weil er sich erinnerte, was das bedeutete – ihr Beischlaf folgte einer eingespielten Routine, daran war nichts Verkehrtes, es war eben das, was beiden passte – drückte er ihr einen Kuss auf den Nacken. Soweit er wusste, mochte sie das. Sie schickte im Gegenzug ihre Hand auf Erkundungstour über seine Schenkel, als ob sie nicht längst jedweden Winkel kennen würde, und hauchte ihm ins Ohr. Er spürte, wie er eine Erektion bekam, und zog sich unbeholfen das Hemd aus. Sie stieg aus ihrer Hose. Gerade wollte er ihr Top aufknöpfen, als sie den Zeigefinger hochhielt. «Lass uns zuvor duschen.»
Erst rückblickend sollte er erkennen, dass er in diesem Augenblick alles noch hätte abwenden können. Er hätte sie fragen müssen, ob sie mit unter die Dusche kommen wolle, so wie früher, dann hätte er gemerkt, dass alles nur ein Vorwand gewesen war. Stattdessen hatte er den Rest seiner Kleidung abgestreift, um in die enge Duschkabine zu steigen und sich unter den dampfend warmen Wasserstrahl zu stellen.
Vielleicht sollte er es ihr doch nicht sagen, dachte er, vielleicht hatte es sich inzwischen geändert, er aß neuerdings manchmal wieder Fleisch. Er könnte nochmals eine Untersuchung machen. Sie müsste nichts davon erfahren.





























