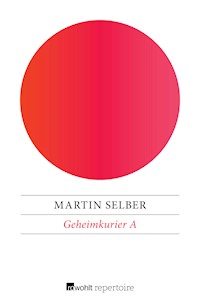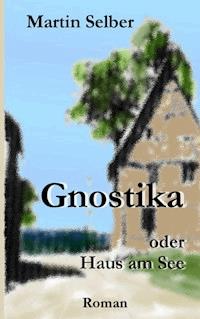
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitteldeutschland, in den 1980er Jahren. Eine Frau, nicht mehr jung, noch nicht alt, kommt mit dem Schmerz über den Tod des geliebten Ehemannes in eine Pension, das Haus am See, ein kleiner Dorfgasthof am Rande eines verschilften Gewässers. Im angrenzenden Dorf verbrachte sie ihre Kindheit, bis sie aus der Diktatur des Bauern, ihres Vaters, in die Stadt entfloh, dort ihre Aufgabe und die sanftere Diktatur des Ehemannes fand. Sie erinnert sich, besucht die Gräber der Eltern auf dem Dorffriedhof, aber das sind alles längst vergangene Geschichten. Da bringt ihr die ehemalige Magd das Tagebuch ihres Vaters, das sie nie gesehen hatte. Erschüttert findet sie eine ganz andere Seite des Bauern, dieses menschliche Wesen kannte sie nicht. Der alte Bauer hielt an seinem Acker fest, nachdem die Produktionsgenossenschaften längst das Leben der Dörfer bestimmten. Gegen alle Widerstände, Repressalien, bis er aufgab. Die Wirkung des Romans entsteht durch seine Endzeitstimmung, lange, bevor an ein wirkliches Ende des Systems und des Landes DDR überhaupt zu denken war. Vielleicht hätte aus der Gnostika der Bildungsroman der untergehenden Epoche des sozialistischen Experiments in Deutschland werden können, es gelang nicht. Zu DDR-Zeiten ließ die Selbstzensur von Lektor und Verlag keine Veröffentlichung zu . Als auf der denkwürdigen Vorstandssitzung des Schriftstellerverbandes vom 12. Oktober 1989 die Druckgenehmigungspraxis und damit die Zensur der Literatur unter „Bücherminister“ Klaus Höpcke offiziell beendet wurde, nahm ein Lektor den Autor Martin Selber beiseite: „Jetzt machen wir das Ding!“. Es war zu spät. Es interessierte sich niemand mehr für das Thema und der Roman wurde bis jetzt nicht veröffentlicht. Die Gnostika ist – im Nachhinein gesehen - keine Art „Rechtfertigungsargumentation des sozialistischen Staates“, genauso wenig wie sie vordergründige Kritik an diesem Staat ist. Sie ist Zeitzeugnis, Dokument von Gefühlen und Gedanken, die für diese Epoche und für einen Großteil der Menschen kennzeichnend waren. Wie der von Martin Selber sehr geliebte Schwejk, der Simplizissimus und der Zauberberg ist sie Chronik einer vergangenen Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Flucht in die Stille
Ein Mann namens Liebig
Ruf ohne Echo
Begegnung mit der Kindheit
Erstes Zusammentreffen
Unerwartetes Geschenk
Geteilte Last
Spurensuche
Soll Vergangenes ruhen?
Gnostika
Zweifel
Gewitter im Mai
Auf der Suche nach Trost
Seehausgeschichten
Kein Alltag ist zu klein
Der Kaffeeklatsch
Der Ausflug in die Berge
Freundschaftliche Belehrung
Ein Wolga fährt vor
Die Aussprache
Rostige Ketten
Von Mann zu Mann
Aufbruch
1
Flucht in die Stille
Die Arbeiter, die müde von der Schicht kamen, trugen ihr Gähnen unter das Wetterdach der Haltestelle. Die Sonne hatte noch nicht zwischen die Häuser gefunden, auf dem Pflaster zerging die spärliche Feuchte der Nacht. Es war wie an jedem Alltagsmorgen, ehe der Bus nach Rabisdorf angekrochen kam, träge wie immer. Ohne sich anzusehen, standen die Männer in lockerer Gruppe. Ihre Gespräche begannen zäh, mit spärlich tropfenden Worten. Es ging um ein Fußballspiel, das man wegen der Schichtarbeit nicht hatte sehen können, doch nur wenige nahmen daran wirklich Anteil. Die Müdigkeit erwies sich als stärker.
Dann kam diese ältere Dame. Sie ging in Schwarz, der Farbe der Trauer. Ein Junge fuhr ihr zwei Koffer im Handwagen nach. Sie grüßte freundlich, ein bisschen verlegen, wie es schien. Der und jener brummelte eine Antwort. Man musterte sie. Wer mit dem Frühbus aus der Stadt nach Rabisdorf will, kennt jeden Mitfahrer. Diese zierliche Frau aber hatte vorher niemand gesehen. Eine Fremde also, und Fremde, die mit Gepäck den Bus aufs Land hinaus benutzen, reisen ganz sicher zum Haus am See, wohin auch sonst.
Der Junge stand blinzelnd neben dem Handwagen, noch nisteten die Schatten der Träume in seinem Gesicht. Plötzlich blickte er auf, horchte auf das näherkommende Geräusch eines Dieselmotors. Da bog der Bus um die Ecke. Die Schichtarbeiter bildeten die gewohnte Reihe. Zischend öffnete sich die Vordertür, es roch nach Schmierfett und Straßenstaub. Die Fahrgäste trotteten heran, stemmten sich hoch, grüßten den Mann am Lenkrad. Der nickte, verlangte aber nicht einmal die Wochenkarten zu sehen, denn auch ihm waren alle Gesichter vertraut - bis auf das der älteren Dame in Schwarz, die als Letzte einstieg, mit fragendem Blick das Geldtäschchen öffnend. Der Junge hob die Koffer herein, empfing letzten Dank, ging zurück zum Handwagen.
Es waren wenig Menschen unterwegs um diese Stunde und kaum Fahrzeuge. Der Bus fuhr halb auf der Mitte der Straße. Der Fahrer drehte den Rückspiegel so, dass er die Frau sehen konnte. Sie hatte ein feines Gesicht, sicherlich war sie einmal hübsch gewesen, vor Zeiten, als junges Ding. Jetzt erschien ihr Blick ausdruckslos. Sie trug Trauer, ein naher Verwandter musste ihr gestorben sein.
Erst draußen auf der Landstraße, als die Häuserzeilen den Weiten der Felder gewichen waren, wurde die Frau lebhafter.
Das Grün draußen schien das frühe Sonnenlicht aufzusaugen und doppelt zurückzustrahlen. Das tat den Augen wohl. Es war Mai, der Monat intensivsten Farbenspiels. Die Frau atmete tief, sie schien die Fahrt zu genießen, ganz so, als wäre dies ein Ausflugsbus und nicht das staubige Linienfahrzeug, das Morgen für Morgen und Abend für Abend die gleiche, eintönige Route fährt.
Immer wieder schaute der Busfahrer die Frau an. Warum sich Leute in die Stille am Rande eines simplen Ackerdorfes zurückziehen? Der Bus klapperte entsetzlich, das Straßenpflaster schüttelte ihn erbarmungslos durch. Er schien das gewohnt zu sein, fuhr an den alten, knorrigen Obstbäumen entlang von Dorf zu Dorf und hielt dann immer an einem zentral gelegenen Platz. Das Zischen der Eingangstür weckte jedes Mal ein paar Fahrgäste, die sich schlaftrunken erhoben, durch den Gang nach vorn schwankten und mit kurzem Gruß ausstiegen. Herein kam Dieselgestank, sonst niemand.
Als sie sich Rabisdorf näherten, wurde die Frau unruhig. Sie wandte den Kopf hin und her, als wollte sie Gärten, Häuser und die wenigen Menschen rechts und links der Straße zugleich in sich aufnehmen. Ihre lebhaften Blicke verrieten Wissbegier - oder war es Wiederentdeckung? Aber was gab es hier zu entdecken oder zu erinnern?
Sie wartete bei der Endhaltestelle, bis alle ausgestiegen waren, ging dann langsam vor. Der Fahrer nahm ihr die Koffer ab. Sie nickte dankbar, stieg vorsichtig hinunter. Dort wartete ein Mann in karierter Jacke, die Mütze in der Hand. „Frau Berger?“ fragte er mit ergebenem Lächeln.
„Ja, sollen Sie mich abholen?“
Wieder dieses Lächeln. „Ich bin Richard, vom Seehaus. Guten Morgen! Lassen Sie nur, ich nehme die Koffer.“
„Danke, Herr Richard.“
„Nicht Herr, ich bin kein Herr. Sagen Sie einfach Richard, das tun alle.“
Der Mann war klein und drahtig. Er sprach ein böhmisch gefärbtes Deutsch, mochte so um die Fünfzig sein. Seine Bewegungen waren ganz die eines Dienenden. Die Koffer hob er fast spielerisch, legte sie auf einen zweirädrigen Karren. „Kommen Sie nur“, sagte er „Es ist nicht sehr weit.“
„Ich weiß.“
Die Räder rasselten über das Pflaster. Die Frau blickte sich um, schaute die Häuser an, die großen Hoftore, dann folgte sie dem Karren auf dem Gehweg. Noch waren keine Schulkinder unterwegs, doch das Dorf lebte schon. Hungerspektakel von Schweinen erfüllte die Luft, Schafgeblöke und als Bass dazwischen das tiefe Röhren einzelner Rinder. Die Frau ging wie durch eine andere Welt. Jedes einzelne Haus schien sie zu mustern, vor der alten Schule blieb sie einen Augenblick lang stehen, blickte zum Kirchturm hinauf, nahm dann bei der Bäckerei minutenlang den frischen Brotgeruch wahr. Die Straße senkte sich vor ihren Schritten. Eine Katze flüchtete unter eine Holzplanke. Zwischen den breitkronigen Linden tauchte schon der arg verlandete See auf. Am Dorfrand blühte der Holunder. Vorbei an den letzten niedrigen Gebäuden führte die Straße ins Freie, und dort lag mitten zwischen Pappeln, Fliedergebüsch und schwach begrünten Feldern das Haus am See, breit hingeduckt unter seinen roten Ziegeldächern.
Es strömte Ruhe aus, versprach Geborgenheit, wirkte vertrauenerweckend. Laute Gäste würden hier gewiss nicht wohnen. Selbst die Geräusche ringsum, das Krähen eines Hahns, Schwalbengeschwätz und Singvogelzwitschern, schienen bestellt zum Wohl der Erholungsuchenden. Die Besucherin wusste, dass sie sich hier wohl fühlen würde.
„Wir müssen hinten herum“, sagte Richard und hob die Koffer vom Karren. „Vorne ist noch abgeschlossen.“
Unbeholfen stakelte die Frau zwischen leeren Milchkannen und abgestellten Bierkästen hindurch. In der offenen Haustür erschien die Wirtin, das schwere, dunkle Haar aufgesteckt über dem freundlichen roten Gesicht. Die frischweiße Schürze trug noch ihre akkuraten Schrankfalten.
„Sie also sind Frau Berger. Willkommen bei uns! Es wird Ihnen gefallen. Es ist zwar noch früh, aber Sie bekommen gleich einen schönen heißen Kaffee.“
Das war wohltuend. Die Gaststube atmete eingelagerten Tabakschmauch aus, auf den meisten Tischen standen umgekippte Stühle, nur der große, runde vor der geschnitzten Eckbank hatte schon eine frische rotbunte Decke bekommen. Richard nahm der Frau den Mantel ab. „Ich bringe ihn gleich mit den Koffern hoch“, sagte er mit dem gewohnten Lächeln. „Sie haben die Vier, ein schönes Zimmer.“
Nun saß sie allein, blickte sich in der altersbraunen Behaglichkeit des Gastraumes um. Eine große Standuhr bewegte feierlich das Pendel mit der blinkenden Messingscheibe. Den Schanktisch zierten bunte Porzellansäulen, die nachgedunkelten Bilder an den Wänden waren sämtlich Jagdmotive. Selbst die Gardinen passten sich dem rustikalen Charakter des Raumes ein. Durch die Fensterscheiben blickten rote Blumen, sie waren hier das einzig wirklich Lebendige.
Die Wirtin brachte selbst den Kaffee, dazu frische Brötchen und einen Teller mit Aufschnitt. „Die anderen Gäste schlafen noch“, sagte sie mit einem Fingerzeig zur Decke. Sie servierte bedächtig, dann setzte sie sich herzu und zog einen Block aus der Schürzentasche. „Ich fülle Ihnen gleich den Meldezettel aus. Sie brauchen dann nur zu unterschreiben. Wie sind Ihre Personalien bitte?“
„Susanne Berger, geborene Baatz, verwitwet.“
„Ach ja, mein Beileid! - Aber, sagen Sie, geborene Baatz mit Tezett?"
„Ja, gewiss.“
„Hier gab es auch einmal eine Familie Baatz, das waren wohlhabende Bauern.“
„Aha.“
„Kannten Sie da jemand?“
Die Frau zögerte. „Ich weiß nicht“, sagte sie langsam.
„Verzeihen Sie meine Neugier; aber wir haben fast immer die gleichen Gäste hier draußen, da kennt man allmählich jeden und interessiert sich halt. Frau Liebrecht hatte Sie vermittelt, wenn ich mich recht erinnere?“
„Ja, meine Nachbarin.“
Susanne Berger wünschte, dass dieses quälende Fragespiel aufhörte. Sie war gekommen, um Stille zu finden, Vergessen, das Bisherige sollte eine Zeitlang verlöschen. Endlich konnte sie in Ruhe ihren Kaffee trinken. Richard kam zurück, legte ihr den Zimmerschlüssel hin und ging wieder fort. Hätte ich ihm nicht etwas geben müssen? überlegte sie.
Die Treppe war alt und knarrte leise. Oben tat sich ein schmaler Flur auf. Ein dicker Läufer schluckte die Schritte. Zimmer eins - zwei - gegenüber die Vier. Der Schlüssel war groß, das Schloss von massiger Gediegenheit. Susanne Berger trat ein. Das würde nun also eine Zeitlang ihr Zuhause sein, Bett, Tisch, zwei Stühle, ein Schrank, die Waschgarnitur, ein Blumenstück an der Wand, darunter die Kofferablage.
Wie sie so allein im Zimmer stand und den Blick umgehen ließ, überkam sie auf einmal Traurigkeit. Was sollte sie jetzt anfangen? Wann war sie das letzte Mal allein von zu Hause fortgewesen? Sie konnte sich nicht daran erinnern. Seit sie geheiratet hatte, war sie nur noch mit ihrem Mann gereist - vielmehr er war mit ihr gereist, er hatte alles Notwendige geregelt, Ferienplatz und Fahrkarten beschafft und mit höchster Sorgfalt den Plan jedes Urlaubs aufgestellt. Nie war er unvorbereitet gewesen, nie hatte er den Dingen freien Lauf gelassen.
Sie legte sich angekleidet aufs Bett. Ihr wurde bewusst, dass sie wirklich allein war, jetzt und für immer. Niemand würde mehr regeln, was vor ihr lag, und Verantwortung hatte sie völlig verlernt. Hilflos war sie zurückgelassen worden, und wenn ihr die Nachbarin nicht Rabisdorf und das Haus am See in Erinnerung gerufen, für sie telefoniert, die Busverbindung erfragt und ihr schließlich noch den Jungen für die Koffer mitgeschickt hätte, würde Susanne Berger immer noch allein in ihrer Wohnung sitzen und vor sich niederstarren.
Dafür starrte sie nun hier an die Decke, an den mehrfach ausgebesserten und übertünchten Putz. Dort waren Gesichter entstanden, die Flecke besaßen Gestalt. Menschen schauten sie an, teilnahmsvoll, als wollten auch sie Beileidsworte hersagen, Worte, die einem nichts geben und die man doch ertragen muss mit dankbarem Kopfnicken.
Die Frau schloss die Augen: Ich bin ganz still. Ich habe ein großes Unglück erfahren, vielleicht das schwerste meines Lebens; aber ich bin hindurch, wie man durch eine Krankheit geht, die einen ganz ermattet, bis auf den Grund. Da kann man nur noch still sein und auf ein Wunder hoffen, das einen wieder zurück in den Alltag holt. Man kann ja nicht leben ohne seinen banalen, kleinlichen, manchmal auch lächerlichen Alltag. Aber was soll das für ein Alltag werden? Ich habe für meinen Mann gelebt, wir waren nur miteinander ein Ganzes, und das ist zerrissen worden, zerstört, ich bin zurückgeblieben, ein hilfloses Teil, das sich in der gewohnten Umgebung nicht mehr zurechtfindet.
Nein, sie konnte nicht zu Hause bleiben, sie hätte diese Wohnung nicht ertragen, so ausgeleert vom Leben, so angefüllt mit Warten auf einen, der heimkommen soll, doch nie mehr kommt. Es wäre sinnlos, in einer solchen Behausung die Fenster zu putzen, die Blumen zu gießen für niemanden weiter als für sich selbst.
Sie war verzweifelt. Sie setzte sich auf und legte das Gesicht in die Hände. Was sollte sie hier, in diesem Zimmer, diesem fremden Gehäuse mit sich anfangen? Sie erkannte auf einmal, dass sie hier wahrscheinlich noch verlassener war als daheim. Nein, sie wollte nicht mehr nachdenken, nicht grübeln, wollte nur den eigenen Schmerz auskosten und ergeben ausharren, so wie jemand, der in offensichtliche Ausweglosigkeit geraten ist, sich erst einmal fallen lässt und auf irgend etwas wartet, was für ihn noch keinen Namen hat. Am Ende wird er sich beruhigen - oder einfach sterben, weil ihm die innere Kraft fehlte, sich wieder aufzuraffen.
Sie glaubte, nun würde niemand mehr nach ihr fragen, doch das war falsch. Sie wusste nicht, dass man sich unten in der Küche gerade mit ihr beschäftigte. Die Wirtin war hereingekommen und hatte zur Kochfrau gesagt: „Diese Frau Berger ist eine geborene Baatz. Wir haben doch im Dorf den Baatzschen Hof. Hast du diese Familie gekannt?“
„Das waren große Bauern“, antwortete die Frau, ohne ihre Arbeit am Küchentisch zu unterbrechen. „Ich weiß nur, dass der Mann seinerzeit, als wir aus Schlesien gekommen sind, viel für die Umsiedler getan hat.“
„Und von der Familie hast du sonst keinen gekannt?“
„Ich erinnere mich kaum. Wir waren doch fremd und haben am Dorfende gewohnt. Einmal haben wir da auf dem Hof unsern Weizen gedroschen, da gab es eine Maschine. Aber sonst? - Die Frau hab ich kaum gesehen.“
„Und die Kinder?“
Geschirrklappern, Dampf, Schritte auf den Fußbodenfliesen, dann die Antwort: „Ich weiß nicht, ob da Kinder waren.“ Richard kam herein und musterte die Abfalleimer. „Weißt du was über die Bauersleute vom Baatzschen Hof?“ fragte ihn die Köchin.
Der Mann überlegte, schüttelte dann aber stumm den Kopf. „Er ist doch viel später als du hergekommen“, sagte die Wirtin.
„Und Liesbeth?“ fragte er.
„Die war damals noch klein.“
„Warum wollt ihr das wissen?“ fragte er.
„Der neue Besucher ist eine geborene Baatz. Na ja, ich glaube, wir müssen mit dieser Frau sehr behutsam umgehen. Sicher will sie vor allem in Ruhe gelassen werden.“
Niemand widersprach.
Das Haus am See lag wie eine Insel abseits des Dorfes und fast auch ein wenig abseits von der Zeit. Auch sein Name entsprach nicht mehr ganz der Wirklichkeit; denn der Rabisdorfer See zeigte sich seit Generationen nur noch als eine ewig nasse, mit Tümpeln bedeckte Wiese voller Froschgequake und Mückenbrut. Aber eins bot das Haus, es bot Ruhe, und die wenigen Fremdenzimmer waren fast das ganze Jahr über belegt und wurden nur guten Freunden weiterempfohlen.
In Ruhe gelassen werden, ja, das wollte Susanne Berger, sich ungehemmt ihrer Trauer hingeben, sich wieder beruhigen und so von einer Ermutigung zur nächsten mehr Festigkeit gewinnen. So auch jetzt. Nein, sagte sie sich, ich weine nicht. Davon bekommt er sein Leben nicht zurück. Es geht jetzt nur noch um mich, um mich ganz allein, es ist meine Last, ich muss sie tragen, niemand nimmt mir davon etwas ab.
Sie erhob sich und trat ans Fenster. Nun wusste sie, weshalb dieser Richard das Zimmer vorhin als schön bezeichnet hatte. Dort draußen lag das Land, müde unter dem viel zu großen Himmel, der See fast zugewachsen, drüben ein winziger Angelkahn vor dem Schilf. In der Luft ein Flügelpaar, Spiralen aussteuernd.
Ja, das versprach Trost, Genesung, Rückbesinnung. Sie nahm sich vor, oft draußen umherzugehen, bei jedem Wetter, in jeder Stimmung des sich wandelnden Lichts. Der Natur wollte sie sich überlassen, schauen und lauschen und die reichen Düfte einsaugen, die der Frühling ihr hinhielt. Sie war ja bereit, weiterzuleben, vielleicht noch ein ganz kleines Stück Sonne zu erhaschen trotz aller Trauer, trotz aller Angst vor der Einsamkeit.
Ruhig packte sie ihre Koffer aus, legte die Toilettenartikel auf die Waschgarnitur, dann schaute sie in den Spiegel, musterte ihr Gesicht. War sie schon eine alte Frau? Nein, gewiss nicht. Das erschien ihr ja so furchtbar, dass sie erwarten konnte, noch viele Jahre vor sich zu haben. Wohin verschenkt eine einsame Frau ihre Liebe, wenn sie nicht mehr jung und noch nicht alt ist. Richtig arm ist doch nur der, der nichts mehr herschenken kann.
Sie strich über die Falten in ihrem Gesicht. Sie würde nun viel Zeit haben, das Wachsen dieser Lebensfurchen zu beobachten; denn jetzt noch ein neues Dasein anzufangen mit heilsamen Pflichten und ersprießlichem Umgang, diesen Mut würde sie nicht aufbringen, und doch kam sie wohl nicht umhin, sich darüber Gedanken zu machen. Sie ging im Zimmer auf und ab, nie zuvor war ihr die Zeit so träge verronnen. Nach einer Weile blieb sie wieder am Fenster stehen, drehte den alten Knebel herum und öffnete beide Flügel.
So verging der Vormittag. Sie pendelte zwischen Fenster, Bett und dem Spiegel, saß lange Zeit wieder still und starrte vor sich nieder, sie kam sich vor wie gefangen, und es war doch eine freiwillige Gefangenschaft. Niemand hätte sie gehindert, hinauszugehen, ein Stück zur Wiese hinunter oder auch ins Dorf, aber ihr war, als würde sie festgehalten, die Beklemmung war wie eine Fessel.
Als nach Stunden jemand an die Tür klopfte, schreckte sie hoch. „Ja?“ rief sie leise, „bitte?“
Eine junge Frau trat ein. Sie trug eine Servierschürze und ein Häubchen im rötlichen Haar. Man schien in diesem Haus auf traditionelle Formen zu achten.
„Guten Tag. Frau Berger“, sagte die Serviererin freundlich. „Ich bin Liesbeth. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie es mir. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir in zehn Minuten mit dem Essen beginnen.“
„Danke! - Kann ich auch hier auf dem Zimmer essen?“
„Gewiss, Frau Berger. Aber, ich glaube, Sie sollten doch besser mit herunterkommen. Es ist angenehmer in der Gaststube, und die Gäste, die hier wohnen, sind alle besonnen und werden Sie sicher nicht stören."
Susanne Berger war unschlüssig. „Wenn Sie meinen?“ fragte sie.
„Aber ja. Den ganzen Tag so allein im Zimmer, das muss Sie doch noch schwermütiger machen.“
Die junge Frau machte so bittende Augen, dass Susanne schließlich zusagte. Als sie etwas später in die Gaststube kam, waren schon fast alle Tische besetzt. Ein Ehepaar hatte mit zwei kleineren Kindern einen Tisch an den Fenstern belegt, am zweiten bemerkte Susanne eine Frau und einen Mann, die lebhaft miteinander redeten, und vor der Standuhr saß ein einzelner Herr mit angegrautem Haar. Er war der einzige, der die Eintretende aufmerksam musterte, zuschaute, wie sie sich umsah und einen freien Tisch unter den Jagdbildern wählte. Jeder saß hübsch für sich im genau umgrenzten Bereich.
Susanne erinnerte sich, dass ihr Mann diese norddeutsche Reserviertheit gern durchbrochen hatte. Wie oft war er trotz genügend bereitstehender Soloplätze zu anderen Gästen getreten und hatte gefragt, ob man sich dazusetzen dürfte, auch wenn ihn erstaunte, wenn nicht gar abwehrende Blicke empfingen. Nun, ihr verzieh man sicher, dass sie sich verkroch. Ihre Kleidung allein setzte schon Schranken, und wenn, wie die Wirtsfrau gesagt hatte, hier immer die gleichen Gäste wohnten, so hatte sich ein neuer ohnehin zurückzuhalten, und das war ihr nur recht.
Die freundliche Liesbeth bediente, sie nahm die Sonderwünsche der Gäste so gelassen zur Kenntnis, als hätte sie sie gar nicht gehört, doch alles wurde prompt erfüllt. Susanne Berger nippte nur von den Speisen, obgleich alles appetitlich angerichtet war.
2
Ein Mann namens Liebig
Nach. dem Essen ging Susanne zurück in ihr Zimmer. Der Herr mit dem angegrauten Haar sah ihr nach. Als Liesbeth hereinkam, um abzuräumen, winkte er sie heran und fragte: „Wer ist denn die Dame in Schwarz? Ein neuer Logiergast?“
„Ja. Herr Liebig. Zimmer vier“, sagte das Mädchen.
„Und wen betrauert sie?“
„Ihren Mann. Sie kommt aus der Stadt. Eine von unseren Stammgästen hat sie empfohlen.“ Sie lachte. „Wie ich Sie kenne, Herr Liebig, geben Sie jetzt keine Ruhe, bis Sie alles über die Dame erfahren haben. Sie heißt Susanne Berger. Mehr weiß ich nicht. Zufrieden?“
„Für den Anfang ja.“
Er stand auf, nickte ihr zu, schlenderte hinaus auf die Terrasse, warf einen Blick zu den Fenstern der Nummer vier hoch und wandte sich dann an Richard, der eben die Gartenmöbel zurechtstellte. „Das Wetter dürfte sich halten, oder?“
Der Mann drückte den Rücken grade. „Ja“, erwiderte er, „es mag angehen.“ Er wies mit dem Kopf hinauf: „Haben Sie sie schon gesehen, die Dame in Schwarz? Zimmer vier. Zwei Koffer hat sie mitgebracht.“
Herr Liebig setzte sich in einen der Gartenstühle und schlug die Beine übereinander. „Im Haus am See wird eine frische Seite aufgeblättert“, sagte er. „Eine geheimnisvolle Dame, die Trauer trägt. Das dürfte eine neue Geschichte ergeben. Richard, da heißt es, Augen und Ohren offenhalten.“
„Was finden Sie immer wieder an den Geschichten wildfremder Menschen?“
Eine fragende Geste. „Womit könnte man sich in Rabisdorf sonst die Zeit vertreiben? Zwei Wochen lang hält man es in totaler Faulheit aus, dann fällt einem allmählich die Decke auf den Kopf.“
Richard wischte die Tischplatten sauber. „Man könnte auch abreisen“, sagte er schmunzelnd.
„Sie wissen genau, dass das bei mir nicht so einfach ist“, erwiderte Liebig. „Ich habe etwas ganz Schlimmes gemacht, ich müsste reumütig zurückkriechen in meine alte Welt, und das lässt mein Stolz nicht zu - jedenfalls vorläufig noch nicht. Außerdem glaube ich kaum, dass man mich wiederhaben will. Ich bin ein Versager, Richard, und die Welt will kraftstrotzende Erfolgsleute haben, keine Aussteiger.“
Richard stand vor ihm, wusste auf einmal nicht, wohin er mit seinen Händen sollte. „Was ich Ihnen endlich sagen will“, meinte er zögernd. „Ich muss mich bedanken. Ich find’s schön von Ihnen, dass Sie so einen unbedeutenden Menschen wie mich zu Ihrem Vertrauten machen.“
„Werten Sie das nicht zu hoch, Richard. Mit wem sollte ich sonst so heikle Dinge besprechen? Unser guter Wirt hat alle Hände voll zu tun, und die Gäste haben ihre eigenen Päckchen zu schleppen. Da sind Sie mir grade recht gekommen. Also gar nichts Besonderes, klar?“
„Die meisten Gäste sind ja sehr nett zu mir“, fuhr Richard zögernd fort. „Aber Sie, Herr Liebig, Sie haben mir etwas gegeben. Wirklich! Dass Sie mich nicht zu klein achten, mir alles von sich erzählt haben und auch mir zuhören. Also, ohne Übertreibung, das finde ich großartig von Ihnen.“
„Ich rede nun mal gern mit Leuten, die eine ganz einfache Meinung vertreten.“
„Aber Sie kennen bestimmt viele bedeutende Menschen. Ich habe nichts gelernt, war in der Schule schon sehr dumm. Doch, doch, mein Zensurbuch habe ich gleich verbrannt, als es voll war.“
„Schulbildung ist nicht alles.“
„Wissen Sie“, Richard setzte sich spontan dazu. „Bei uns zu Hause - wir hatten einen Garten. Da hab ich als kleiner Junge schon ein Frühbeet gehabt und hatte ganz zeitig im Jahr Gemüse. Mein Großvater meinte: ‘Der Richard ist nicht dumm, der wird seinen Weg machen.’ - Na ja, Schicksal! Es ist anders gekommen. Jetzt bin ich Hausknecht.“
„Hausangestellter.“
„Wenn Sie wollen, auch das. Ich mache Besorgungen, repariere, was kaputt geht, heize, kümmere mich um den Garten, das ist auch alles wichtig.“
„Das ist sogar sehr wichtig“, sagte Herr Liebig. „Jedenfalls wichtiger als meine Tätigkeit: Worte, Worte, Worte, und so viel Papier.“ Er hob den Blick. In einem der Fenster von Zimmer vier erkannte er die neu angekommene Dame. Er nickte ihr einen Gruß zu, worauf das Gesicht dort oben augenblicklich wieder verschwand. Er fand das töricht. Wenn jemand in Trauer ist, muss er doch nicht gleich seine Umgebung vor den Kopf stoßen und vor einem gutgemeinten Gruß so brüsk zurückweichen.
Er stand auf und ging die Steinstufen hinunter, blieb unschlüssig auf dem Kiesweg stehen, schaute dann nochmals zurück, aber der Fensterrahmen dort oben blieb leer. Er schien plötzlich nicht zu wissen, was er jetzt mit sich und diesem Nachmittag anfangen sollte. Schließlich wandte er sich um, folgte der Terrassenkante, gelangte ums Haus herum in einen Gemüsegarten und an dessen Ende in eine offene Laube. Von hier bot sich ein lohnender Blick über das ganze Seegelände.
Ein Geräusch ließ ihn sich umwenden. Er sah, dass Richard ihm gefolgt war. Unbeholfen stand der Mann auf dem Gartenweg und drehte die Mütze in den Händen. Es war die verlegene Geste der Gutsarbeiter von einst vor ihrem Herrn. Das schien sich eingeprägt zu haben, Teil des Charakters geworden zu sein.
„Setzen Sie sich doch ein bisschen mit her“, sagte Liebig.
„Ich hab noch zu tun.“
„Die Arbeit rennt nicht davon, bitte, bitte!“
Zwei zaghafte Schritte. „Ich hab Sie bloß noch was fragen wollen“, sagte Richard und ließ sich vorsichtig auf die Bank nieder. „Ich denke mir, Sie müssen wohl heimlich ein Schriftsteller oder sowas sein, und Sie sammeln die Geschichten von den Leuten und schreiben sie auf.“
Herr Liebig musste lachen. „Wie kommen Sie denn darauf?“ fragte er. „Ich und Geschichten aufschreiben? Da haben Sie aber ganz falsch getippt.“
„Nicht doch so ein Bisschen?“
Liebig legte die Hände zusammen. „Lieber Richard! Wenn das so wäre, würde ich gewiss nicht hier sitzen, so abseits von der Welt. Dann hätte mein Leben ja einen Sinn, und ich müsste mich nicht verkriechen.“
„Aber hat denn nicht jedes Leben einen Sinn?“ fragte Richard. So wie er dasaß, kam er Liebig vor wie ein Schüler, dem sich der Lehrer privat zuwendet. Er nickte ihm aufmunternd zu, und Richard fuhr fort: „Jedes Leben, meine ich. Was soll ich denn sonst sagen? Gepäck fahren, den Hof fegen, Besorgungen erledigen, das muss doch getan werden, also hat es auch Sinn.“
Liebig setzte sich zurück, „Ja“, antwortete er. „Das hat Sinn. Es bringt Nutzen. Ich hab Ihnen ja gesagt, dass der Sinn meiner Arbeit ein theoretischer war. Und die Praxis? - Man reibt sich auf und sieht kein greifbares Ergebnis. Man meldet und meldet und rechnet Aufgaben ab, aus denen nichts herauskommt, was sich greifen ließe. Ich musste repräsentieren, bin formal abgefragt worden. Genutzt hat das nur den Statistikern und denen, die zufrieden sind, wenn sie in ihrer Liste wieder was abhaken konnten.“
Richard stand auf. „Dabei kann ich nicht mitreden“, sagte er.
„Nein, nein, bleiben Sie nur“, erwiderte Liebig und hielt ihn fest. „Ich stehe für Sie grade, wenn es Ärger geben sollte. Ich habe Sie gebraucht, ganz einfach! Ich bin Gast, und Sie sind für die Gäste da, das stimmt doch, oder?“
„Das stimmt genau“, sagte Richard und lachte.
„Für mich ist das Haus am See so eine Art Sanatorium“, fuhr Liebig fort. „Hierher kommen Leute, die vom Alltag genesen wollen. Dabei sind sie oft gar nicht krank. Man kann sie abhorchen und röntgen und ihren Blutdruck messen, alles normal. Und doch kommen sie her mit hängender Zunge und erwarten wer weiß was.“
„Urlaub“, sagte Richard.
„Das ist nicht bloß Urlaub. Das ist mehr. Das ist auch Sebstbefragung, Zweifel werden überprüft, man befragt sich kritisch, legt sozusagen die Elle an sein Inneres. Dazu wurde einem sonst nie Zeit gelassen.“
„Sie haben mir vor ein paar Tagen gesagt, man hat so viel Zeit, wie man sich nimmt.“
„Hm“, machte Liebig. „Zeit! - Oh, ich hatte viel Zeit, Richard, nur leider nicht für mich, das kann ich Ihnen versichern. Meine Frau hat mich oft tagelang im Hellen nicht mehr zu sehen gekriegt, und wenn ich kam, war ich hundemüde. Das war einer der Gründe, dass meine Ehe schließlich kaputtging. Zeit, Richard, das war für mich die Einteilung in meinem Terminkalender, das waren Besprechungen, Sitzungen, Berichte, zwischendurch, rasch ein paar Bissen herunter schlingen, dann war schon der nächste Termin dran. Das hält der stärkste Kerl nicht durch. Und was hätten Sie in dieser Mühle getan, Richard?“
„Ich glaube, ich wäre davongelaufen.“
„Danke! Es tut gut, zu hören, dass es auch noch andere vernünftig empfindende Menschen gibt.“
Das sollte eigentlich humorig klingen, doch es kam im Zorn heraus. Liebig wandte sich um, legte die Arme auf die Laubenbrüstung und schaute hinaus in den Frühling. Er hatte Mühe, sich zu beruhigen. Richard stand leise auf, er begriff, dass er jetzt überflüssig war. Langsam ging er hinaus, sah sich vom Gartenweg her noch zweimal um, doch der Mann in der Laube rührte sich nicht von seinem Ausguck weg. Da verließ Richard den Garten und ging in die Küche.
„Wo steckst du denn?“ fragte Liesbeth und schüttelte das rote Haar zurecht. „Wir brauchen Holz.“
Richard nahm den leeren Tragkorb und trottete wortlos hinaus in den Stall. Was hat nun so ein Mensch von seinem Dasein in dem feinen Büro - überlegte er. Den Kopf voller Probleme, nichts weiter. Ich habe keine Probleme, ich bin, wie ich bin, im Sommer harke ich die Wege, und im Winter schippe ich Schnee. Wenn sie in der Küche Holz brauchen, hole ich es rein, und wenn die Kohlen kommen, schaffe ich sie in den Keller. Ganz einfach ist das. Daraus entstehen keine Probleme. Aber solche Leute da in solchen Funktionen? - Terminkalender! - Ich wüsste überhaupt nicht, was ich mit so einem Ding anfangen sollte, und wenn es beginnen würde, mich zu beherrschen, da würde ich es ins Feuer schmeißen. Probleme? - Hat die Frau von Zimmer vier Probleme? Ja, sie hat den Mann verloren, das hat wehgetan. Als ich meine Eltern verlor, das tat auch weh. Aber Probleme? - Ich weiß gar nicht, was das ist.
Mit kräftigem Schwung warf er den Tragekorb auf den Rücken, packte die Riemen und schleppte seine Last in die Küche.
„Du siehst so mürrisch aus“, sagte Liesbeth. „Hat es was gegeben?“
„Nummer zwei sitzt wieder in der Laube und starrt auf den See“, antwortete er.
„Das muss ein ziemlicher Packen sein, an dem er schleppt, und er hat schon zweimal verlängert.“
„Aber eines Tages muss er doch zurück, das ist nicht zu ändern!“ Richard stapelte das Holz in die Kiste. „Ich würde ihm gern helfen“, sagte er wie zu sich selber, „aber wie?“
Liesbeth kam näher. „Ihr redet doch oft miteinander. Was ist denn nun in Wirklichkeit mit ihm los?“
Richard hob fragend die Hände. „Ehe kaputt und die Arbeit geschmissen, das reicht doch wohl.“
„Na und? Erzähl mal ein bisschen mehr!“
„Mädchen! - Das ist Vertrauenssache. Beichtgeheimnis sozusagen.“
„In unserer Küche gibt es keine Geheimnisse“, sagte die Kochfrau.
Die Küche war das Hirn, von dem aus das Haus am See gelenkt wurde. Hier führten die Fäden von Zimmer eins bis sechs zusammen, hier mündeten die Geschichten der Gäste ein, ihre Eigenarten, ihre speziellen Wünsche, und von hier aus gingen dann die Ratschläge zurück, die Trostworte, die Pflästerchen, die der Mensch halt braucht, wenn er fern von seinem Alltag dessen Nachwirkungen zu verdauen hat. Und solche Ratschläge kamen von allen, die hier arbeiteten, mütterlich überwacht von der Kochfrau; denn in der Küche war auch die Wirtin nur ein Teil dieses kleinen Kollektivs, das hier für das Wohl der Gäste lebte und wirkte.
Vielleicht trugen die freundlichen, hilfreichen Worte, die aus der Küche in die Fremdenzimmer liefen, wesentlich dazu bei, dass das Haus am See unter seinen Gästen einen so guten Ruf besaß und nur als Geheimtipp an wirklich vertrauenswerte Leute weiterempfohlen wurde. Gut Essen und Trinken, offene, fröhliche Gesichter und Worte, die wohl tun, das zusammen ergibt oft schon die halbe Erholung.
Meist blieben die Gäste zwei oder drei Wochen hier. Der Mann namens Liebig hatte indessen schon die vierte herum. Grund genug, sich mehr Gedanken als bisher um ihn zu machen. Wer hat so lange Urlaub? - Und die Arbeit geschmissen? - Einfach so? - Geht das überhaupt? - Und wenn, für wie lange? - Der Mensch muss schließlich Geld verdienen, wenn er leben will. Wurde er denn nicht inzwischen draußen vermisst? Aber es kam nie Post für die Nummer zwo, also schien die Verbindung zur Welt tatsächlich abgebrochen zu sein. Und in einem solchen Fall, der die ganze Küche bewegte, von Beichtgeheimnis zu reden, hier im Hirn des Hauses - das verzieh man allenfalls dem Richard, und der wusste das auch und nutzte dieses Verzeihen.
Herr Liebig saß noch immer in der Laube und sah auf den See hinaus, wo die Vögel kreisten und der Wind die Büsche durchkämmte. Er saß gern hier, nur wird auch das schönste Bild allmählich langweilig, wenn man es immer und immer wieder betrachtet. Heute hatte Richard einen Gedanken dazugegeben: Die Geschichten aufschreiben. Liebig schüttelte den Kopf. Geschichten sollten ausgedacht sein. Wenn man die notiert, die das Leben schreibt, macht man sich leicht Ungelegenheiten.
Mitunter halten sich Leser für so wichtig, dass sie sich in der Literatur wiederzufinden glauben, und nehmen dann jedes Wort übel, das ihren Erinnerungen nicht entspricht.
Liebig war an einem Punkt angelangt, wo die ihm eigene Aktivität mit dem Mangel an Pflichten kollidierte. Er kam sich vor wie ein genesender Kranker, der längst wieder den Drang in sich spürt, tätig zu sein, der auch die notwendige Kraft dazu hätte. doch der Arzt hat gerade das noch nicht gestattet. Anfänglich, wenn man krank wird, sich hinlegen muss, überlässt man sich gern erst einmal dein Übermaß an Zeit, das einem so lange schon nicht mehr zugestanden wurde. Erst einmal schlafen, schlafen, schlafen - dann plötzlich kann man das nicht mehr, man ist ausgeruht auf Vorrat und braucht wieder Leben um sich und Aufgaben, die den Tag ausfüllen, den Arbeitstag, der einem so fehlt.
Herr Liebig hatte schon nach der zweiten Woche begonnen, den Menschen nachzuspüren, mit denen er es hier zu tun hatte. Wer waren die Mitgäste, die anderen Leute im Haus? Das Personal, das er nur als eine Schar fortwährend Dienender erlebte, hatte doch auch sein eigenes privates Dasein mit allen positiven und negativen Seiten, womit man sich beschäftigen könnte. Richard war der erste, der sich ihm erschloss, und über Richard wusste er sich der Küche, dem Hirn des Hauses anzunähern. Und plötzlich, als hätte er sich in ein fremdes Datensystem eingeschaltet, flossen ihm die Geschichten zu, über die er sich nun Gedanken machte, mit denen er sich beschäftigte wie ein Forscher. Diese Geschichten aufzuschreiben, nein, das wäre ihm wie Vertrauensbruch vorgekommen. Man trägt nicht in die Öffentlichkeit, was einem freundlicherweise erzählt wurde. Da ist so viel Privates drin, viel Schmerzliches auch, dafür braucht es Mitgefühl, doch nicht die Neugier der großen Masse.
Aber auch das Sammeln von Geschichten schleift sich ab, vor allem braucht man ständig Neues. Das wird schließlich zu einer Sucht, und der Süchtige kennt kein Ziel, er steigert sich, und sein Begehren wird allmählich übergroß. Herr Liebig wusste das natürlich, er spürte es an sich selber, doch er fand keine echte Befriedigung. Trotzdem ließ er nicht nach in seinem Wissensdrang.
Nun war diese neue Dame gekommen, ein Rätsel in Schwarz, von den anderen Gästen teils mitleidig, teils gleichgültig angesehen. Die Trauerkleidung schuf einen natürlichen Abstand. Herr Liebig aber hatte sich während des Essens so sehr in Gedanken mit ihr beschäftigt, dass er sich befugt wähnte, ihr von der Terrasse aus einen Gruß zuzunicken. Sie jedoch reagierte wie eine Mimose, zuckte zurück, als hätte er sie ungeschickt berührt. Warum denn nur?
Er verstand das nicht. Er hatte viel mit Menschen zu tun gehabt, robusten und überempfindlichen, zugänglichen und verschlossenen, solchen, die er mochte, und anderen, die ihm überhaupt nichts bedeuteten. Da kam es schon vor, dass man einen gelegentlichen Gruß nur kühl erwiderte - aber dabei zu erschrecken? Er war doch gewiss nicht der Typ, über den man erschrickt.
Ich will nicht ungerecht sein, sagte er sich schließlich. Wer weiß, was sie durchgemacht hat, was sie bedrückt. Ich hoffe doch, dass sich das Rätsel lösen lässt und dass ich noch erfahren werde, wie es um sie steht. Sie bleibt bestimmt ihre zwei Wochen hier, und sie wird auch an den Punkt kommen, wo sie sich aussprechen will, weil sie Zuspruch braucht und Anlehnung. Einsamkeit ist eine schlimme Arznei, entweder man geht an ihr kaputt, oder man gewinnt neue Kraft. Ich muss Richard fragen, wie lange sie bleibt. Richard wird es wissen, er weiß alles, und er freut sich, wenn man dieses Wissen nutzt.
Und der Mann namens Liebig wandte sich weg von seinem Ausguck, er verließ den Garten und ging gemächlichen Schritts zum See hinunter, wo die Wege zu Pfaden wurden und die Natur sich noch so viel Vorrechte gegenüber den Menschen bewahrt hatte.
3
Ruf ohne Echo
Susanne Berger hatte auch den Nachmittag in ihrem Zimmer verbracht. Schlafen wollte sie nicht, und obgleich sie mit ihrer vielen Zeit noch wenig anzufangen wusste, konnte sie sich nicht entschließen, hinunterzugehen. Sie fürchtete sich, unter Menschen zu sein und mit ihnen reden zu müssen, und sie war doch immer sehr gesellig gewesen. Sie wehrte auch jeden Gedanken an die Welt außerhalb dieses stillen Gasthauses ab. Zu jener Welt gehörte auch der Ort Rabisdorf, durch den sie am Morgen mit so aufmerksamen Blicken gegangen war. Nein, nichts davon, nichts von der Stadt, von ihrer verwaisten Wohnung - nur Abstand gewinnen, Ruhe finden, auch wenn die Ruhe sie schreckte und ihr Angst machte.
Ihr war, als hätte sie sich verlaufen, wie ein Kind, das im Gedränge die behütende Hand verlässt und dann plötzlich zwischen den vielen fremden Menschen erschreckend allein steht.
Doch wenn das Kind dann ruft, seiner Angst Stimme gibt, wird man es hören, andere werden sich seiner annehmen und. ihm helfen, die verlorene Hand wiederzufinden. Susannes Ruf hörte niemand, denn es war ein innerlicher Schrei, der aber umso mehr schmerzte. Erwachsene dürfen ihr Weh nicht herausschreien, dieses Vorrecht haben sie mit ihrer Kindheit für immer aufgegeben. Würden sie es sich zurücknehmen, so stießen sie sicher auf Unverständnis, Verwunderung, ja den Unwillen ihrer Umgebung. Susanne glaubte zu spüren, wie ihr Ruf in einem weiten dunklen Raum ins Nichts davonlief. Dieses Gefühl der Leere war lähmend. Lethargie gebiert Hoffnungslosigkeit, und ohne Hoffnung ist ein Mensch verloren. Wie aber soll man Hoffnung finden in völliger Leere?
Susannes Alltag war aufgehoben, und niemand kann leben ohne seinen mitunter banalen, lächerlichen und auch kleinlichen Alltag. Ohne ihn quälen sich die Stunden dahin, zäh, erbarmungslos träge. Aber der alte, gewohnte Alltag würde nie wieder für sie da sein, sie brauchte einen neuen, noch unbekannten, von dem sie nicht wusste, ob sie ihn überhaupt meistern würde. Sie hatte Angst vor dem Ungewissen, und niemand war da, ihr diese Angst zu nehmen.
Mit den Stunden wich ihre Lähmung, dann dachte sie an ihren Mann. Längst vergangene Begebenheiten kamen ihr wieder ins Gedächtnis zurück, und das war tröstend, denn sie erinnerte sich gemeinsamer Reisen, schöner Erlebnisse, die sie einander nähergebracht hatten. Einmal waren sie ein paar Tage weit mit den Rädern gefahren. Leonhard, ihr Mann, hatte die Etappen genau auskalkuliert und trotz aller Mühen Unterkunft ausfindig gemacht. Damals, wenige Jahre nach dem Krieg, gab es noch Lebensmittelkarten.
Sie hatten also Verpflegung mitgenommen und. unterwegs auf einer Spiritusflamme abgekocht. Ein Birkenwäldchen bot ihnen Rast. Hier hatte Leonhard einen Taschenspiegel an einen der weißen Stämme gehängt und sich davor rasiert. Sie fand das lustig, damals beherrschte sie ein Gefühl völliger Freiheit, völligen Lebensglücks. Man war Teil der Natur, niemand kam und blätterte Vorschriften auf, man gehörte ganz sich selber, und Susanne spielte insgeheim mit der Überlegung, es wäre möglich, immer so zu leben. Doch welcher Augenblick hat Dauer?
Leonhard hatte gern spontane Einfälle erprobt. Freilich blieb der Zufall dabei weitgehend ausgeschlossen, denn das Planen und Organisieren bereitete ihm ebenso viel Spaß, und sie hatte sich nur zu gern davon anstecken lassen. So hielten sie im Winter die Träume des Sommers fest und kosteten das geplante Kommende schon in Gedanken aus, erlebten es also doppelt.
Sie erinnerte sich eines Ausfluges, den sie gemeinsam mit seinen Berufsschülern unternommen hatten. Die Wanderung führte ein Bachtal aufwärts, in dem, aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur, einige alte Wassermühlen lagen. Dort drehte sich schon lange kein Mühlrad mehr; aber Leonhard wollte den jungen Leuten viel von der Geschichte so alter Gewerke vermitteln, Vorstellungen vom einstigen Treiben. Er hatte sich vorher etliche Fragen notiert, die er den dortigen Bewohnern stellte, und die waren dann von diesem Forschungseifer so angetan, dass sie alle Türen öffneten, vergilbte Papiere und Fotos hervorkramten, und ihre unangemeldeten Gäste mit Milch und Obst bewirteten.
Susannes Gedanken wurden plötzlich unterbrochen, als Liesbeth anklopfte und zum Abendessen bat. Nein, jetzt nicht in die Gaststube, jetzt nicht! Also wurde dem Wunsch der Dame von Nummer vier entsprochen und das Essen heraufgetragen.
Susanne blieb also auch beim Abendbrot allein, und das Gespräch, das Liesbeth beim Abräumen mit ihr versuchte, kam nicht über wenige Sätze hinweg.
Die Küche empfing dann die Nachricht, in Nummer vier hätte sich die Trauer eingenistet, und man würde sich wohl viel Trost anüben müssen, und auch dann würde es sicher ein gehöriges Maß Zeit brauchen, bis man dort oben Vertrauen gewinnen und sich mit seinen hilfreichen Ratschlägen Gehör verschaffen konnte.
Susanne Berger legte sich früh nieder, sie schlief dann rasch ein, war aber über Stunden hinweg wieder wach und kämpfte gegen die Grübeleien an, die sie nicht loslassen wollten. Morgens fiel sie dann doch endlich noch in tiefen Schlaf.
Als sie erwachte, war es draußen schon ganz hell. Sie trat ans Fenster. Von unten kamen Klappergeräusche. Richard war beschäftigt, die Terrassenmöbel aufzustellen. Susanne schaute dem Mann zu, jede Bewegung, jeder seiner Gänge schienen genau festzuliegen. Sicher war die Reihenfolge, in der er Stühle und Tische aus dem Schuppen holte, seit Jahrzehnten gleich geblieben. Eine Art Hausknecht ist das, fuhr es ihr durch den Kopf. Dass es das überhaupt noch gibt. Die Terrasse lag im Sonnenlicht, leiser Windhauch trug Gerüche vom See herüber, etwas Moder dabei, etwas von verrottetem Dung und frisch aufgebrochenen Blüten.
Sie frühstückte im Zimmer, dann aber war sie entschlossen, heute nicht wieder ins nutzlose Grübeln zu verfallen. Sie überlegte, dann nahm sie ein Buch aus dem Koffer und ging hinunter auf die Terrasse. Die übrigen Gäste saßen noch drin an den Tischen, das war ihr nur recht. Sie wählte einen Stuhl ganz an der Seite aus, wo ein sauber gestrichenes Geländer Balkonkästen mit bunten Zwergtulpen trug. Blumen muss ich mir auch noch ins Zimmer holen, dachte sie, drehte den Stuhl herum, so dass sie im Sitzen das Wuchergrün des Sees sehen konnte.
Wenn Leonhard noch lebte, fuhr es ihr durch den Kopf, würde er jetzt mit mir dort hingehen, Sauerampfer pflücken, mich davon kosten lassen und erklären: ‘Dies ist Rumex acetosa, man nahm es früher als Arznei gegen Skorbut, auch zu Salat ist es geeignet.’ - Er hat so gern von seinem Wissen abgegeben, vormittags seinen jungen Leuten, nachmittags und abends mir und den Freunden im Kulturbund. Er hat mir Tore geöffnet, die ich allein nie gefunden hätte. Mir ist, als wäre ich immer und überall an seiner Hand gegangen, hätte meine ganze Kraft aus diesem Kontakt gezogen - und jetzt? -
Ihr Blick fiel auf eine Spinne, die beharrlich zwischen Hausecke und Geländer an ihrem Netz webte, ein unermüdliches Spiel, Faden um Faden zu jenem bewundernswerten Kunstwerk gezogen, das doch zu nichts weiter entstand, als mörderische Falle gegen unvorsichtige Insekten zu sein. Sie schlug das Buch auf, nestelte das Lesezeichen heraus und überflog die ersten Zeilen der Seite. Sie sagten ihr nichts. Es war Wochen her, seit sie hier aufgehört hatte, das Zettelchen eingelegt, nichtsahnend, welch tiefgehender Schrecken auf sie wartete.
Ja, es hatte sie überfallen wie ein Blitz. Aus dem Badezimmer war ein dumpfer Schlag gekommen, ein Klirren, doch ihr besorgter Ruf blieb ohne Antwort. Dann lag da der Mann, besinnungslos, den Mund offen, die Augen verdreht. Mühsam hatte sie ihn herausgezerrt und war mit flatternden Händen ans Telefon gelaufen. Die Hilfe kam rasch, doch alles, was dann geschah, war nur Aufschub, krampfhaftes Bemühen, jemand zurückzuhalten, der den Schritt über die Schwelle hinaus längst getan hat zu seiner weiten Reise ohne Wiederkehr. Für sie war es die Katastrophe.
Susanne Berger zwang den Blick ins Buch, sie blätterte zwei Seiten zurück, las, versuchte, das Bild jener Gestalten wieder aufleben zu lassen, mit deren Alltag sie sich beschäftigt hatte. Es fiel ihr nicht leicht, doch sie wollte endlich herausfinden aus den nutzlosen Grübeleien der letzten Tage, die sie nur immer und immer wieder im Kreise herumgeführt hatten. Ihr Ruf fand kein Echo, also wollte sie aufhören zu rufen, wollte versuchen, selber den Weg aus dem Nichts herauszufinden und das sinnlose und entmutigende Spiel ihrer Verzweiflung abbrechen. Warum also nicht mit diesem Buch.
Endlich fand sie den abgerissenen Erinnerungsfaden wieder. Es war erlösend, den persönlichen Kummer über dem fremder Menschen vergessen zu können, auch wenn dies nur erdachte Figuren waren. Es gibt mehr auf der Welt als die eigenen Schmerzen, viel mehr und viel Wichtigeres. Das zu erkennen kann ein Trost sein.
Sie las sich also fest, und es störte sie keiner. Von Zeit zu Zeit kam jemand aus dem Haus, warf sekundenlang einen Blick zu ihr herüber, doch da dieser nicht aufgefangen wurde, erlosch die Neugier nach dem unbekannten Gast rasch. Erst Stunden später trat Richard behutsam heran und meldete, in zehn Minuten würde drin das Essen aufgetan.
Susanne überlegte nur kurz, dann nickte sie ihr Einverständnis. Gut, sie konnte nicht ewig oben im Zimmer essen, das würde wohl auch Liesbeth allmählich zu beschwerlich sein. Sie fand ihren Platz vom gestrigen Mittag frei. Nach und nach kamen die anderen Gäste herein, das Ehepaar mit den Kindern, die beiden älteren Leute. Sie grüßten freundlich. Susanne dankte mit leichtem Kopfnicken. Auch der Mann mit dem angegrauten Haar kam, er stutzte, als er sie sitzen sah, grüßte mit knapper Verbeugung und nahm wieder vor der Standuhr Platz.
Susanne blickte nicht hin. Sie suchte mit niemandem Kontakt, sie war hier in der Gaststube, um zu essen. Als aber Liesbeth fragte, ob sie ihr ein Glas Wein servieren dürfte, schaute sie auf und meinte: „Ach, warum eigentlich nicht?“ - Dieses Wort lief sogleich in die Küche und wurde dort als ein erster Lichtblick im Verhältnis zu der Dame von Zimmer vier gewertet.
„Na also“, sagte die Wirtin zufrieden. „Wir werden sie schon aufrichten. Im Haus am See hat noch keiner auf die Dauer sein Leid für sich behalten. Das wird ihm abgenommen, oder nicht?"
Die anderen lachten.
„Übrigens“, warf die Kochfrau ein, „ich habe mich umgehört. Diese Baatzens hatten wirklich eine Tochter, die Susanne hieß. Auch das Alter könnte stimmen.“
„Aber warum gibt sie das nicht zu?“ fragte Liesbeth. „Sie scheint doch nicht zu wollen, dass man das weiß.“
„Ja, warum?“ Die Wirtin zuckte mit den Schultern, „Mancher hat Angst, sein früheres Leben wiederzufinden Vielleicht sind die Erinnerungen daran nicht gut. Das wäre doch möglich.“
„Oder auf dieser Familie liegen ein paar dunkle Flecken“, gab Liesbeth zu bedenken.