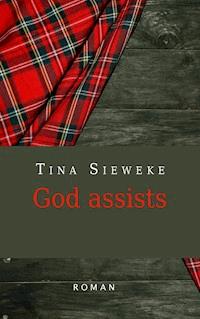
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katrina Bruis, gerade sechzig Jahre alt geworden, blickt nach dem Unfalltod ihres zweiten Ehemannes bereits häufiger in die Vergangenheit als in die Zukunft. Eine unheilbare Krankheit, die immer wieder zu Sturzanfällen führt, drängt sie in die Frührente. Zudem wird sie nachts von sonderbaren Träumen heimgesucht, in denen jemand sie von einer Klippe stößt. Auf einer Reise nach Schottland möchte Katrina zur Ruhe kommen und mietet sich in der kleinen Pension von Mary Finnegan in Stonehaven ein. Am Tag ihrer Ankunft begibt sie sich im Rollstuhl auf einen Ausflug an die Steilküste, denn etwas drängt sie zur alten Burguine des Castle. Als sie auf der Klippe steht und einen Schwächeanfall erleidet, droht der Sturz aus ihrem wiederkehrenden Traum Wirklichkeit zu werden – doch im letzten Moment kommt ihr jemand zur Hilfe. Ihr Retter ist der schottische Schäfer William Duff. Katrina fühlt sich auf magische Weise zu dem raubeinigen Highlander hingezogen. Sein merkwürdiges Verhalten warnt sie jedoch, sich auf ihn einzulassen. Was sie nicht weiß: William Duff hütet ein Geheimnis, das mit einem dramatischen Ereignis aus einem früheren Leben zu tun hat – und in dem Katrina eine nicht unbedeutende Rolle spielt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Danksagung
Prolog
Das passte zu ihr, dachte sie. Immer ließ sie sie im Stich, wenn sie sie am nötigsten brauchte. An jeder bisherigen Gabelung ihres Lebensweges musste sie allein entscheiden. Wenn sie es recht bedachte, war es ihr eigentlich auch immer gelungen, den richtigen Weg zu finden. Kompromisse musste man schließlich immer eingehen. Das war auch prinzipiell kein Problem, solange sie sich dafür nicht verbiegen musste oder sich gar selbst verlor. Aber heute war ein Tag, an dem sie sich nicht entscheiden konnte.
Sie war am 14. Juni 1955 im Sternzeichen Zwilling geboren. Nicht eben wankelmütig, wie es diesem Zeichen gern nachgesagt wurde, sondern eher Kopfmensch, hatte sie ihr Leben analytisch wie ein Strategiespiel gelebt. Allerdings hatten sie bisweilen seltsame Träume heimgesucht, die sie immer wieder verunsicherten. Da war in der Kindheit ihre Blinddarmoperation gewesen, bei der sie träumte, ihr Unterbewusstsein hätte den Körper verlassen und seelenruhig von der OP-Lampe aus zugeschaut, was die Ärzte unter ihr mit dem Körper trieben, während ihre Seele abzuwägen schien, ob sie wieder in den Körper einziehen oder weiter auf Reisen gehen sollte. Anscheinend entschied sie sich für Ersteres. Den genauen Ablauf bekam sie, als sie aus der Narkose erwachte, nicht mehr zusammen. Aber nie bezweifelte sie, ihren Körper verlassen zu haben, auch wenn sie es für lange Zeit vergaß.
Auch als sie ihren Freund das erste Mal nach Hause begleitete, um den Eltern vorgestellt zu werden, überkam sie gleich im Eingangsflur das Gefühl, dort schon gewesen zu sein. Sie erkannte die Treppe, die grün gemusterte Tapete und den lindgrünen Teppichboden, mit dem die Treppe ausgelegt war. Auch diese Begebenheit legte sie in die geheime Schublade, in der schon die Blindarmoperation gelandet war, möglichst fernab vom täglichen Zugriff. Mehrere Jahre später hatte sie wieder einen Traum. Oft besuchte sie die nahe gelegene Burganlage der Stadt, um zu malen; damit finanzierte sie sich einen guten Teil ihres Studiums zum Lehramt. In dem Traum hatte sie ihre Staffelei aufgestellt und sich auf die Burgmauer gesetzt, um ihr Motiv eingehend zu betrachten. Irgendjemand stieß sie, sie kam ins Wanken und stürzte in die Tiefe. Das Ergebnis träumte sie nicht mehr, aber es war ihr klar, dass es da kein Überleben gab. Von diesem Tag an jedoch erinnerte sie sich an den verborgenen Hort ihrer Erinnerungen und an vergangene Eingebungen. In der Angst, es könne sich bewahrheiten, was ihr Unterbewusstsein suggeriert hatte, mied sie die Burganlage.
Die Träume jedoch hörten nicht auf, und immer stürzte jemand ins Bodenlose. Allerdings waren die Träume nicht mehr so konkret oder zumindest führten sie sie nicht mehr an Orte, die sie kannte oder an die sie sich wirklich erinnern konnte. Also waren sie anscheinend auch nicht gefährlich. Sie wachte zwar immer auf und schreckte hoch, weil sie das Gefühl hatte, selbst zu fallen. Doch wenn sie gewahrte, dass sie sicher in ihrem Bett lag, schlief sie wieder ein, wenn sich ihr Puls beruhigt hatte und das Gefühl der Bedrohung verflogen war.
Immer wieder schlich sich ein Gedanke in ihren Kopf: Sollte es möglich sein, dass ein Zwilling tatsächlich zwiegespalten war und der eine dominant war und der andere im Hintergrund weilte? Hatte sie sie seit dem letzten Traum verlassen? Sie, die immer so kreativ und einfallsreich Lösungen für jede Lebenslage parat hatte? Eigentlich nicht, das wusste sie innerlich. Es war da immer diese andere Person in ihr. Welche von beiden gerade gefordert war – die zielstrebige, wendige, intelligente Frau, die mit Kopf und Verstand herrschte, oder die melancholische, romantische, sehnsüchtige Zweite, die hin und wieder schwer missgelaunt in die Welt schaute –, bestritt den neuen Tag oder hielt sich bedeckt. Oder war das einfach der Facettenreichtum, der ihr gegeben war und sich nicht zu einer grauen Suppe vermischen ließ?
Aber wäre das nicht allzu leicht? Da war häufig ein Widerstreit in ihrer Brust und in ihrem Kopf…
Sie dachte zu viel – ja, das war's. Sie dachte einfach zu viel.
Schublade auf – Irritation hinein, Schublade zu.
Einfach vergessen.
1
Sie war mit ihren neunundfünfzig Jahren wohl bereits im späten Herbst ihres Lebens angekommen, aber für das zwanzigste Jahrhundert noch nicht zu alt. Schließlich hätte sie, wenn alles normal gelaufen wäre, noch ein paar Jahre arbeiten müssen bis zur wohlverdienten Muße. Im Übrigen hatte sie sich ganz gut gehalten. Ihrem Gesicht sah man nicht an, dass sie die Fünfzig schon überschritten hatte, was auch darauf zurückzuführen war, dass sie ihre Haut nie mit Schminke, Cremes und solchem Zeug überfordert hatte. Allein Wasser und nichts, was die Poren zukleisterte, kamen ihr ins Antlitz. Allenfalls kleinere Lachfalten an den Augen und an den Lippen begannen sich so langsam auszubilden und sich ihrem tatsächlichen Alter entsprechend in ihre zarte Haut einzugraben. Doch prinzipiell war sie ein Mensch, der sich schnell allen Gegebenheiten anpasste und nicht lange mit Ärger verbrachte. Vielleicht zahlte sich auch das durch jüngeres Aussehen aus. Auch ihre Figur konnte sich noch sehen lassen. Bei ihren immer noch einsachtundsiebzig Körpergröße kam es auf ein paar Gramm nicht an, die verteilten sich gut. Und trotzdem…
In ihrem Inneren schien der Winter schon vor langer Zeit Einzug gehalten zu haben. Sie fühlte sich uralt und gebrochen und hatte ihr Vegetieren, so empfand sie es, endgültig satt. Im Übrigen wunderte es sie kein bisschen, dass sie mal wieder an einem Scheideweg stand. Irgendwie änderte sich ihr Leben wie von Geisterhand gesteuert circa alle zwanzig Jahre – und na ja, da war sie nun.
Achtzehn Jahre war sie im Kinderheim aufgewachsen, neunzehn Jahre hatte ihre erste Ehe gehalten. Sie hatten noch während des Studiums geheiratet und danach einige Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet. Als sie sich dann für Nachwuchs entschieden, hatte sie zwei Totgeburten. Das war wirklich nicht leicht, zu wissen, dass man ein Kind gebären musste und bereits unter dem Schmerz wusste, dass es tot sein würde. Und das zweimal, sie kam darüber kaum hinweg. Deshalb stürzte sie sich erneut in ihre Arbeit und die Ehe scheiterte.
Nun war auch die zweite Ehe zu Ende. Aber auch wenn es diesmal nicht am Miteinanderleben scheiterte, so war die Trennung doch abzusehen. Sie hatte keine Tränen mehr. Sie konnte nach den vergangenen Monaten des Begreifens und der Erkenntnis nicht mehr um ihren Mann weinen. Zu oft hatte sie ihm gesagt, dass er eines Tages sein Leben auf der Straße lassen würde. Seine Raserei hatte schon ein kleines Vermögen in die Kassen der jeweiligen Kommunen gespült, sie könnte ein ganzes Zimmer mit den Bußgeldbescheiden tapezieren. Zwanzig Jahre lang hatte sie mit der Angst gelebt und ihm wenigstens in der Zeit das Versprechen abnehmen können, dass er anrief oder eine Nachricht schickte, wenn er irgendwo angekommen war, damit sie beruhigt sein konnte. Eines Tages kamen eben keine Nachricht und kein Anruf und sie wunderte sich auch nicht, als spät abends zwei Polizeibeamte an der Tür schellten und ihr das mitteilten, was sie ohnehin schon wusste. Sie war gefasst und sprachlos. Des Nachts war jedoch die Wunde aufgebrochen, die schon den ganzen Tag wie eine schwelende Infektion geschmerzt hatte.
Sie war wütend, sie war traurig, unfassbar traurig, sie war einsam, sie war unsicher, was sie abgrundtief hasste, und sie war behindert.
Sie brauchte ihn doch, sie hatte doch auf ihn gebaut, er sollte ihr doch lebenslang zur Seite stehen und nun? Er hatte sich einfach davon gemacht.
Nein, sie war schrecklich wütend, brüllte ein Bild auf dem Kaminsims an, das sie durch den Tränenschleier nicht einmal deutlich sah. Zu Hause war sie sicher, zu Hause war ihre Wehr-Burg. Dort konnte sie sich frei bewegen, wusste, wohin sie ging, wie der Weg aussah, wo alles lag, aber draußen – draußen war für sie ein gefährlicher Ort. Da war sie auf Hilfe angewiesen.
Sie machte ihm gefühlte hundertachtzig Vorwürfe und war am Ende völlig erschöpft auf dem Sofa zusammengerollt eingeschlafen. Die Tränenflüsse trockneten auf ihrem Gesicht und hinterließen Salzkrusten.
2
Ein Jahr später, als Beerdigung, Erbschaft und all das geregelt waren, stellte Katrina fest, dass sie sogar im Notfall draußen halbwegs ohne fremde Hilfe zurechtkam. Dass die Hilfsmittel wie Gehstock, Brillen und Rollstuhl vom Besten waren, und als sie endlich gelernt hatte, wie man das Ding auch noch ohne große Kraftanstrengung in den Kofferraum laden konnte, fühlte sie sich schon wieder etwas lebendiger. Trotzdem verging kein Tag, an dem sie nichts mit Schmerzen zu tun hatte, und es verging nahezu keine Stunde, in der ihr nicht klar wurde, dass sie nicht frei von Handicaps war. Sie hatte eben nicht nur kürzlich ihren Mann beerbt, sondern schon viel länger vorher, quasi schon bei ihrer Entstehung, einen ihrer Elternteile. Aber sie kannte beide nicht, also konnte sie wohl kaum auf sie böse sein. Es war ihr auch klar, dass weder der eine noch der andere etwas dafürgekonnt hatte. Erbkrankheiten durchlebte, wer sie eben erbte. Fertig, aus.
Aber sie war auch nicht völlig allein zurückgeblieben. Da war ihre Schwiegermutter und da war ihr Stiefsohn, den sie liebte, als hätte sie ihn selbst auf die Welt gebracht. Auch der Junge kümmerte sich um Katrina, die ihn aufgezogen und ihn stets wie ihr eigen Fleisch und Blut behandelt hatte. Sie hatte ihn umsorgt, ihm Trost gespendet und großen Anteil an seiner Ausbildung und seinem Empfinden für Verantwortung und Gerechtigkeit.
»So, meine Liebe, morgen um zehn kommt der Fensterputzer, kriegst du das alleine hin, oder soll ich rüberkommen?«, fragte Lena, ihre Schwiegermutter, für die sie Gott von Herzen dankte. Auch wenn die Frau schon auf die Achtzig zuging, war sie fit und voller Unternehmungsdrang. Keine Feier, keine Seniorenfahrt ging ohne Lena. Das war ein wahres Phänomen für sie, und sie war unendlich dankbar für Lena.
Lena liebte Katrina wie eine Tochter und kümmerte sich seit dem Tod ihres eigenen Sohnes rührend um sie.
»Ja klar, ich bin doch zu Hause. Da kenn ich mich schon aus, kein Problem.«
Mit einem gehauchten Kuss auf die Stirn verabschiedete sich Lena und war schon wieder durch die Terrassentür und den angrenzenden Garten in ihr eigenes Domizil verschwunden.
Der Schwiegervater war vor fünf Jahren verstorben und auch bei Lena hatte die Zeit die Wunden geheilt. Ihr würde es auch so gehen. Zeit heilt, diesen Spruch bekam sie derzeit an jeder Ecke hinterhergeworfen. Sie konnte es nicht mehr hören. Zeit heilt. Wie viel Zeit denn? Was passierte denn dann?
Oh Gott, wie banal.
3
Trotz des vergangenen Jahres fühlte sich Katrina immer noch nicht geheilt, aber sie befand sich, so glaubte sie, auf einem neuen Weg.
»Hallo Mama«, rief sie durch den Garten und ging langsam zur Terrasse ihrer Schwiegermutter herüber. Das klappte eigentlich ganz gut. Es war ihr zwar nicht möglich, den Weg schnurgerade hinter sich zu bringen, auch ging es nur langsam voran, aber sollte sie hier stürzen, sah es nur die Familie und sie fiel schließlich auf Rasen, das tat nicht so weh. »Hast du mal 'ne Minute? Ich wollte dich fragen, ob du zwei oder drei Wochen ein Auge aufs Haus haben kannst. Ich habe mir überlegt, dass mir vielleicht ein bisschen Luftveränderung gut tun würde.«
»Aha, wo soll es denn hingehen?«, fragte Lena. In ihrer Stimme klang leichtes Unbehagen und ihre Brauen hatten sich stirnaufwärts bewegt.
»Na ja, eigentlich hätten Daniel und ich nächste Woche wieder nach Schottland fahren wollen. Ich denke, ich mach das jetzt, wenn auch allein. Ich möchte dorthin.«
»Meinst du wirklich, dass das gut ist? Warum fährst du nicht nach Ischia oder so, wo du auch was für deine Gesundheit tust? Musst du ausgerechnet dahin, wo du viel an Daniel denken musst? Kind, das ist falsch, das ist so falsch. Mach das nicht.«
»Lena, ich liebe dieses Land, ich fühle mich dort wohl, ich sehne mich dorthin«, versuchte sie zu erklären. »Es wird mich nicht traurig machen, dort zu sein. Ich glaube, es wird mir helfen, außerdem wird es anders sein. Ich bin dort allein. Es wird anders sein, glaub mir, und ich würde es nicht tun, wenn ich denken würde, es würde mich quälen.«
Sie wartete Lenas Nicken ab und machte sich wieder auf den Rückweg in ihr Haus. Das Treppensteigen in den ersten Stock fiel ihr zwar schwerer als früher, aber hinauf ging noch ganz gut. Hinab war etwas anderes, vor allem, wenn sie noch einen Koffer hinunterschleppen sollte. Schweißnass saß sie eine gefühlte halbe Stunde später im Erdgeschoss auf ihren Sachen und war heilfroh, die Gepäckaktion ohne Unfall überstanden zu haben.
Sie hatte einen Flug nach Inverness gebucht.
Erik, Daniels Sohn aus erster Ehe, den sie quasi gratis zu ihrem Mann dazubekommen hatte, weil seine Mutter einem Krebsleiden erlegen war, fuhr sie nach Düsseldorf zum Flughafen. Er sorgte dafür, dass Gepäck und Rollstuhl aufgegeben wurden und seine Stiefmutter, die er von Herzen gern hatte, zum Einchecken an die richtige Stelle gelangte. Er hielt unterstützend ihren Arm und geleitete sie bis dorthin, wo sich Passagiere und Bleibende trennen mussten. Er sah sie liebevoll an, wusste er doch um die Seelennot seiner Mutter, die der Tod seines Vaters verursacht hatte.
»Ciao, Mama, melde dich, wenn du angekommen bist. Ich wünsch dir einen schönen Urlaub. Wir sehen uns in drei Wochen, ich hol dich wieder ab, okay?«
Er gab ihr einen warmen, weichen Kuss auf die Wange und sah in ein fast ängstliches Gesicht. Er musste fort, er hatte es ihr genauso ausreden wollen wie Lena, ausgerechnet nach Schottland zu fahren. Sein Magen kniff und er machte sich Vorwürfe, aber sie hatte darauf bestanden. Sie hatte sogar gedroht, mit dem Taxi zu fahren, wenn sie keiner brachte. Sie wäre gefahren, so oder so.
Langsam löste sich die Verkrampfung und er machte sich auf den Heimweg. Innerlich winkte er dem Flieger hinterher, obwohl der noch gar nicht in der Luft sein konnte.
4
Nach zwei Stunden Flug erreichte sie Inverness und hatte Mühe, ihre vom Sitzen eingeschlafenen Glieder wieder in Gang zu bekommen. Was für die meisten Leute eine lächerliche Kurzstrecke sein mochte, war für ihre Verhältnisse schon eine kleine Quälerei.
Ein junger Mann, der neben ihr am Gepäckband wartete, um seinen Seesack herunterzufischen, bot ihr Hilfe an und sie war selig, dass sie ihren schweren Koffer nicht allein dort herunter heben musste. Er stellte ihn an ihre Seite und murmelte ein kurzes »Bitte, Mam«, um sich abzuwenden und zu gehen. Sie hauchte ihm ein »Vielen Dank« nach und blieb mit dem Herunterheben ihres Rollstuhles allein. Woher hätte der Mann das auch wissen sollen? Sie stand unsicher da und überlegte, wie sie es anstellen sollte, ohne ihr Gleichgewicht zu verlieren.
Das erste Mal ließ die den Rollstuhl passieren, weil sie merkte, dass der Widerstand durch das Gewicht des Gerätes sie ins Schwanken brachte, und ließ unverzüglich los. Beim zweiten Durchlauf war sie sicher, dass sie es aus einem anderen Winkel versuchen musste, damit die Rollen Kontakt mit dem Laufband bekamen und sie ihn quasi nur noch herunterrollen lassen musste. Es klappte. Gott sei Dank war es ja schon ein leichtes Modell, aber dennoch fiel es ihr schwer. Sie klappte ihn auf und setzte sich erst mal ein paar Minuten zum Durchatmen.
Da kam ihr auch schon das nächste Problem in den Sinn. Der Akku des Rollstuhls war im Koffer, zwar geladen und so kräftig, dass sie damit immerhin eine Reichweite von zwanzig Kilometern überbrücken konnte, aber in dem Moment war es halt ein manuell zu betreibender Rollstuhl. Wenn sie nun die Räder per Hand antreiben musste, konnte sie nicht gleichzeitig den Koffer hinter sich herziehen. Sie stand also schweren Herzens wieder auf und beschloss den Rollstuhl als Rollator zu benutzen. Sie zog die Bremse an, wuchtete den Koffer auf den Rollstuhl und machte sich auf den Weg durch die Passkontrolle und zur Leihwagenstation.
Sie ließ ihren Tross einfach als Öffner in der schweren Eingangstür des Autoverleihs stehen und ging zum Informationsschalter.
»Hallo, ich bin Katrina Bruis und ich hatte einen Kombi gebucht. Steht das Auto bereit?«
Der Kopf mit dem schütteren Haar eines Endvierzigers hob sich hinter dem Tresen und sah sie fragend an.
»Führerschein, Personalausweis und Kreditkarte, bitte«, forderte er sie mit sich täglich wahrscheinlich zig Mal wiederholender Tonbandstimme auf.
Sie reichte ihm die gewünschten Unterlagen und suchte die Buchung heraus.
»Ah«, sagte er, »die Dame mit dem Automatikwagen. Sie können aber schon Auto fahren, oder? Das ist ja mal völlig unüblich.«
»Natürlich kann ich Auto fahren, aber warum sollte ich mich hier schlechter stellen als zu Hause? Dort habe ich auch einen Automatikwagen, höchstens der Linksverkehr wird gewöhnungsbedürftig sein. Wo ist also das Problem? Haben Sie keinen Wagen?«
»Doch, doch, er ist vor einer halben Stunde aus der Zentrale aus Edinburgh angekommen.« Er reichte ihr die Unterlagen zurück und schob ihr den Vertrag zur Unterschrift hin. »Bitte dort und dort«, er zeigte auf zwei mit kleinen Kreuzchen markierten Stellen und bat um die Zeichnung.
Dann erhob er sich und Katrina musste fast grinsen, als sich ihre Vermutung bestätigte, dass das Männlein sie auch noch in der Statur fast an einen der Gnome aus den Harry-Potter-Filmen erinnerte. Sie rief sich aber augenblicklich zur Ordnung, schließlich konnte sie ihm ebenso gut wie eine schwankende Riesin erscheinen. Man warf halt nicht mit Steinen, wenn man im Glashaus saß. Am Ende dieses Gedankens kam der Zwerg um die Ecke des Tresens, Fahrzeugpapiere und Schlüssel in der Hand, um sie zu dem Auto zu begleiten. Kurze Besichtigung, keine Schäden, kurze Einweisung, alles bekannt, und Übergabe, aber kein Angebot der Hilfe beim Einladen des Gepäcks, nur ein geschmackloser Blick auf den Rollstuhl und ein wieder vom Band gesprochenes »Gute Fahrt und auf Wiedersehen«. Damit verschwand der Gnom und Katrina lud ihre Habe in den Kofferraum.
Sie stieg auf der falschen Seite ins Auto ein, ganz in dem alten Trott, weil ja links immer Daniel saß. Doch niemand stieg dazu. Sie atmete tief durch und stieg wieder aus, umkreiste argwöhnisch das Fahrzeug und ließ sich auf der Fahrerseite nieder.
Also gut. Zähne zusammen und durch, alles war verkehrt herum, aber das hatte sie schließlich gewusst. Sie stellte das Navigationssystem an und gab die Zieladresse ein. Das Auto war mit Rückfahrkamera und allem Gepiepe ausgestattet, um nirgendwo anzuecken, und so schaffte sie es dann auch prima aus der Tiefgarage an die Freiheit. Der Linksverkehr war dann gar nicht so schwierig, man brauchte ja eigentlich nur den anderen hinterherzufahren, und in kürzester Zeit war sie auf links eingestellt. Katrina suchte sich den Weg auf die A96 in Richtung Aberdeen und genoss die ersten Eindrücke der Fjord-Landschaft. Bis Elgin konnte sie immer noch hin und wieder einen Blick auf das Meer erhaschen, aber dann ging es landeinwärts.
Am späten Nachmittag kam sie entspannt, nein sogar völlig entschleunigt, etwas außerhalb von Stonehaven bei ihrem Stamm-B&B an. Mary Finnegan hatte nach dem Tod ihres Mannes das Haus in eine gemütliche, familiäre kleine Pension umgestaltet und war eine wunderbare Gastgeberin. Immer offenen Ohres, aber niemals aufdringlich oder neugierig. Katrina freute sich so auf ein Wiedersehen und wurde auch nicht enttäuscht, als die Eingangstür sich öffnete, während sie noch im Kofferraum herumkramte. Mary kam ihr mit offenen Armen entgegen und drückte sie ganz herzlich, und es war eine Wärme, die zu Katrina hinüberströmte, die sie nie für möglich gehalten hätte. Es fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen. Allein der kurze Anflug von Beileid trübte den Augenblick. Katrina wollte nicht mehr trauern, sie wollte ihren Mann in Erinnerung behalten, aber sich nicht in Trauer aufgeben. Mary hatte ein außerordentliches Gespür für das emotionale Durcheinander ihres Gastes, sodass sie sich auf die liebevolle Begrüßung, ihre Hilfe beim Entladen des Autos und eine Tasse frischen Tees beschränkte. Für alles andere wäre noch viel Zeit, immerhin blieb Katrina zwei oder drei Wochen und das war sehr viel Zeit in einem B&B.
Über ihre Teetasse hinweg studierte Mary ihr Gegenüber und sah eine attraktive Frau, die sich anscheinend noch nicht wieder auf ihrem richtigen Weg befand. Sie sah in den blaugrauen Augen, die sich auf seltsame Art der jeweiligen Umgebung anpassten und auch schon mal das helle Grün eines frischen Lindentriebes annehmen konnten, eine ungewohnte Unsicherheit. Viele Jahre waren sie sich bereits bekannt. Immer wieder hatten Daniel und Katrina einige Tage bei ihr verbracht und ihrer Einschätzung nach war Katrina immer der klarere Typ gewesen. Sie wusste, was sie wollte, war sprachlich gewandter und durchaus in der Lage, sich in jedem Winkel der Welt zurechtfinden. Aber nun sah Mary nur Hin- und Hergerissen-Sein. Nichts klares, keine Struktur. Es tat ihr leid, dass Katrina litt. Sie hatten sich über die Jahre angefreundet und trotzdem gab es da einen inneren Kreis, den sie zu durchbrechen noch nicht in der Position war. Dafür waren die Bande nicht wirklich eng genug und sie wusste, dass nur Katrina diese Grenze öffnen konnte. Mary mochte sie gern, aber niemals würde sie jemanden zu etwas zwingen. Sie wäre da, wenn sie gebraucht würde, und sie hoffte sehr, dass Katrina das auch fühlte.
5
Nachdem Katrina ihren Koffer ausgepackt und sich in ihrem liebevoll hergerichteten Zimmer niedergelassen hatte, überkam sie die Müdigkeit, die nach einer Tagesreise wohl jeden überfiel, wie aus dem Nichts. Sie hatte Hunger und auch wieder nicht. Sie wollte an die frische Luft, das Meer sehen und auch wieder nicht. Schließlich legte sie sich auf ihr Bett und schlief ein. Sie schlief wie eine Tote, tief, traumlos und losgelöst von allem. Sie spürte nicht mehr den Hunger, den sie eigentlich hatte, sie spürte nicht, dass sie eigentlich fror, da sie nur in ihren Sommerkleidern auf dem Bett lag und nicht zugedeckt war.
Katrina erwachte, als der Hahn von Marys Hühnerschar zum ersten Mal des Morgens schrie und es draußen schon fast hell war. Warum auch nicht, schließlich war es Juni. Nun hörte sie ihren Magen erwartungsvoll knurren und merkte an dem warmen Brennen, dass sie ihn bereits über Gebühr vertröstet hatte. Nein, eigentlich nicht einmal das. Sie hatte ihn ignoriert. Also stieg sie steif aus dem Bett, zog sich komplett die Reisekleidung aus und ging duschen. Sie machte ihre Haare, die sie noch vor der Reise pflegeleicht zu einem kurzen Bob hatte schneiden lassen, sodass kurzes Föhnen und, wenn nötig, ein wenig Gel genug sein würden, um einigermaßen passabel auszusehen. Ihr blonder Haarschopf war gerade frisch nachblondiert. Obwohl sie eigentlich jetzt bereits grau gewesen wäre und auch gar keine Lust mehr auf diese ständige Nachfärberei hatte, hatte sie doch noch einmal auf ihre Friseurin gehört, die ihr gesagt hatte, dass Grau noch gar nicht zu ihrem Gesicht passe. Die Eitelkeit hatte gesiegt und jetzt strahlte ihr Haar eben in der Farbe getrockneten Strohs.
Sie zog sich ihre dreiviertellange Jeans an und ein grünbuntes, langes T-Shirt und streifte ihre kurzen Söckchen über, die man in den Sportschuhen nicht sah. Sie steckte die Füße in ihre Nikes und band sie zu. Ein kurzer, zufriedener Blick in den Spiegel am Kleiderschrank und sie befand sich auf dem Weg zum Frühstücksraum. Der Wermutstropfen Treppe nach unten wurde gemeistert, indem sie, sich an Handlauf und Wand abstützend, langsam Stufe für Stufe nach unten stieg.
Der Duft von Rührei und Speck ließ ihren rebellischen Magen noch einmal vernehmlich seinen Unmut über die langsame Versorgung kundtun, sodass Katrina froh war, gleich beim Eintreten von Mary begrüßt zu werden und mit einem kurzen Fingerzeig einen Tisch zugewiesen zu bekommen. »Bin gleich wieder da«, hatte sie ihr zugeraunt, und mit der Frage: »Kaffee, nicht wahr?«, auf die sie gar keine Antwort erwartet hatte, war sie aus dem Raum geflogen und in die Küche entschwunden.
Am Buffet stand schon alles bereit, was ein schottisches Frühstück ausmachte. Katrina liebte ihr Porridge, wenn sie hier war, und genehmigte sich ein kleines Schälchen, damit der widerborstige Gast in ihrer Körpermitte sich beruhigte. Auch wenn diese Frühstücksspeise von vielen Fremdländern belächelt wurde, wusste Katrina nicht nur das geschmackliche Zusammenspiel von Salz, Sahne und Honig sehr zu schätzen, sondern auch die sättigende Wirkung dieses zugegebenermaßen unansehnlichen Haferschleims. Sie jedenfalls konnte ihn genießen, und gerade hatte sie ihren letzten Löffel davon vertilgt, als Mary mit dem Kaffee erschien.
»Hast du gut geschlafen, meine Liebe? Ich war ein bisschen irritiert, als du gestern gar nicht mehr aufgetaucht bist, aber na ja, es war bestimmt ein anstrengender Tag. Was möchtest du vom gekochten Frühstück? Rührei, Spiegelei, Würstchen?«, fragte sie geschäftig weiter und Katrina bestellte Rührei, Speck und Blackpudding.
6
Gut gestärkt und fast zu satt, um sich mit Elan auf den Weg zu machen, gab Katrina kurz bei Mary Bescheid, dass sie sich mit dem Rollstuhl am Küstenweg entlang in Richtung Castle begeben wolle. Den geladenen Akku baute sie schnell in ihren Rolli und wollte gerade den Parkplatz der Pension verlassen, als Mary ihr hinterherrief: »Nimm ein Handy mit, falls was passiert mit dieser Höllenmaschine. Ruf mich an, okay?« Katrina hatte das zwar akustisch nicht ganz verstanden, winkte Mary aber dennoch und begab sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen recht guten Feldweg, der in den Küstenwanderweg mündete.
Der Rollstuhl war neu und der letzte Schrei, der auf dem Markt zu haben war. Die elektrische Unterstützung machte es ihr leicht, voranzukommen, und zu Hause hatte Erik ihr gezeigt, was das Ding alles konnte. Sie hatte die Bedienung schnell begriffen und den Umgang perfektioniert. Sie lernte seine Wendigkeit schätzen und die Lenkung über einen Joystick empfand sie als einfach. Erik hatte geflachst, wenn sie wiederkäme müssten sie an dem Motor was machen, der könnte jawohl ein bisschen getunt werden, damit der Rolli insgesamt ein wenig schneller würde. Sie hatten zusammen darüber gelacht. Das war ihr gerade wieder eingefallen, als sie sich im Schneckentempo auf diesem Feldweg vorwärts bewegte, auf dem sie doch ein paar tieferen Furchen ausweichen musste, damit der Stuhl nicht umkippte. Zwar war es schon ein Sportrollstuhl, dessen Räder leicht schräg an dem Gestell angebracht waren, sodass eben ein Umfallen nahezu ausgeschlossen war, aber man musste das ja nicht unbedingt gleich ausprobieren. Sie zuckelte also dahin und kam auf dem gut ausgebauten Wanderweg an. Es war ein Klippenweg, der zwar nicht asphaltiert, aber mit einem gemahlenen gelblichen Belag ausgestreut und festgewalzt worden war und einen erstaunlich festen Grund hatte. Eine kleine Fußgängerautobahn, denn wie sie wusste, war diese Strecke ausgiebig bewandert.
Sie hielt den Rolli an und genoss den Blick auf das Meer. Es gab einen ganz ordentlichen Ostwind und sie war froh, dass sie sich noch eine Wetterjacke mitgenommen hatte. Schottland war wettertechnisch nicht so ganz berechenbar und besser, man war gut gerüstet. Diese lohnende Ausgabe in diesem unverfroren teuren Jagdgeschäft bereute sie nicht eine Minute. Sie hatte die Deerhunter-Jacke aus der Seitentasche ihres Gefährtes gezogen und astete sich aus dem Rollstuhl, um sie überzuziehen. Als sie nun so da stand und während des Anziehens auf das Meer sah, spürte sie den Boden unter ihren Füßen sich gleichermaßen im Wellengang wie die See, auf die sie sah, zu bewegen. Sie drehte sich um und hoffte, dass der Blick landeinwärts wieder Klarheit in ihren Kopf brachte. Tatsächlich beruhigte sich ihr Eindruck und ihre plötzliche Panikattacke, der Boden könnte ihr unter den Füßen weggezogen werden, ging vorbei. Sie schloss die Jacke, die mit Magnetknöpfen ausgestattet war, denn ein Reißverschluss hätte Geräusche von sich gegeben, mit dem man das Wild verscheucht hätte. Tolle Technik, dachte sie so bei sich, als sie sich wieder in die Sicherheit ihres Rollstuhls begab, ihn vom Meer in Fahrtrichtung Wanderweg lenkte, der sie zum Castle führte. Dennoch blieb ihr Puls noch eine Weile erhöht. Wie konnte sie nur so dumm sein und hier alleine herumstrolchen. Sie hatte auf Hilfsmittel und Technik gebaut, aber völlig verdrängt, dass auch dafür erst mal körperliche Fähigkeiten erforderlich waren.
Mit Daniel war das früher alles kein Problem gewesen. Sie waren jedes Jahr mit der Fähre von Amsterdam nach Newcastle gekommen und mit dem eigenen Auto durch Schottland gereist. Ja, früher waren Schiffe auch kein Problem für sie gewesen. Selbst als sich ihre Krankheit langsam anschlich und sie auch an Land das Gefühl hatte, dem Seegang auf einem Schiff ausgesetzt zu sein, hatte sie sich immer noch schutzsuchend bei ihm einhaken können. Er hielt sie und sie fühlte sich sicher. Jetzt hasste sie Schiffe und mied sie. Es kam ihr so vor, als hätte alles mit einem Flugzeugträger angefangen, auf dem sie den Wellengang nur ahnen konnte, und nun wären die Fähren zu Nussschalen mutiert, die nur so auf und ab tanzten. Aber sie wusste auch ganz genau, dass sich bei den Schiffen überhaupt nichts geändert hatte. Allein bei ihr war nicht mehr alles richtig. Dieses ewige Schwanken, diese ewige Unsicherheit, den ersten Schritt zu tun und einen Weg einigermaßen gerade hinter sich zu bringen, das strengte sie mörderisch an. Dann verfluchte sie die Welt, fragte sich, womit gerade sie das alles verdient hatte und verlor sich in Selbstmitleid.
Das wollte sie aber heute nicht, sie wollte schaffen, was sie sich vorgenommen hatte: zum Castle zu gelangen. Also tuckerte sie weiter den Klippenweg entlang und konnte es schon in der Ferne auf einem Felsvorsprung liegen sehen. Heute würde sie sich ohnehin mit der Fernsicht begnügen müssen, denn allein könnte sie niemals den steilen, unebenen Ab- und Zugang bewältigen.
7
Komisch war es schon irgendwie, dass heute niemand unterwegs war, um diese alte Burgruine, die in jedem Reiseführer als Muss ausgewiesen war, zu besuchen. Auch das gegenüberliegende Ausflugsrestaurant war seltsamerweise geschlossen. Sie war am Parkplatz angekommen und fuhr bis zum Eingang des Zuweges zum Burgplateau und schaute sehnsüchtig zu dem alten Gemäuer. Schade. Jedes Jahr war sie dort gewesen, und obgleich die Geschichte viele Veränderungen an dem Schloss kannte, war es für sie immer gleich gewesen. Vielleicht hatten zu jeder Zeit andere Blumen geblüht und dadurch andere Farben auf den Burg-Berg gebracht, aber ansonsten war immer alles wie zuvor. Jedes Mal, wenn sie dort herumspazierte, war es ihr so seltsam vertraut. Sie kannte jede Ecke und auch den Großteil des Werdegangs der Burg, aber warum sollte es auch nicht so sein? Es waren auch schon mindestens zehn Besuche gewesen, bei denen sie nicht müde geworden war, sich die Beschreibungstafeln durchzulesen. Die Faszination wurde letztlich wohl durch die Lage ausgelöst. Immer wieder dachte sie, dass diese Burg eigentlich uneinnehmbar gewesen sein musste. Aber die Historie sagte etwas anderes. Mehrmals hatte die Geschichte gezeigt, dass auch diese Burg fallen konnte, und natürlich wäre sie wohl keine Ruine, wäre das nicht geschehen.





























