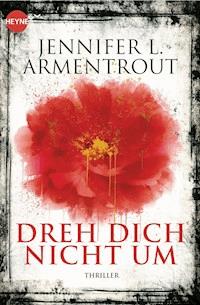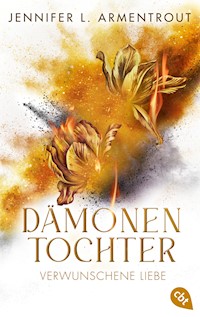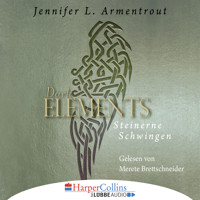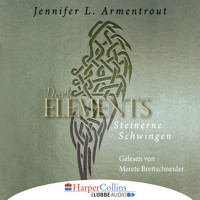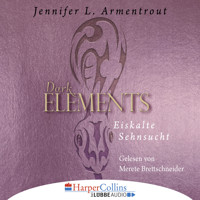16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eBundle
- Sprache: Deutsch
GOLDEN DYNASTY - GRÖßER ALS VERLANGEN Eine Familie, aufgebaut auf Sünden und Skandalen. Julia ist fassungslos, dass dieser berüchtigte Clan sie als Krankenschwester engagiert hat. Aber noch mehr schockiert sie, dass sie einen der Brüder bereits persönlich kennt. Sehr persönlich. Mit Lucian, dem jüngsten und wildesten Spross der Familie, hatte sie erst gestern eine heiße Nacht. Und er könnte ihr gefährlicher werden als alle Intrigen und dunklen Geheimnisse, in deren Strudel sie hinter den Toren des prächtigen Anwesens gerät … GOLDEN DYNASTY - BRENNENDER ALS SEHNSUCHT Unfassbar reich, unglaublich mächtig - und sie füllen die Titelseiten der Boulevardpresse. Nikki Besson weiß nur zu gut, wie die Welt der de-Vincent-Brüder aussieht. Denn als Tochter der Haushälterin ist sie gemeinsam mit ihnen aufgewachsen. Aber nie hätte sie gedacht, dass sie einmal auf das Anwesen in Louisiana zurückkehren würde, um selbst für diesen skandalumwitterten Clan zu arbeiten. Dorthin, wo sie sich in Gabriel verliebt hat - den sie seit der verhängnisvollen Nacht von damals nie wiedersehen wollte … »Das richtige Buch für alle, die stimmungsvolles Drama, gefährliche Familiengeheimnisse und sinnliche Liebesromane lieben.« Romantic Times Book Reviews »Die verwobenen Geheimnisse und die leicht düstere Atmosphäre sorgen dafür, dass die Leser mehr wollen.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1145
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jennifer L. Armentrout
Golden Dynasty - Teil 1 & 2
MIRA® TASCHENBUCH
Copyright © 2019 für die deutsche Ausgabe by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2018 by Jennifer L. Armentrout Originaltitel: »Moonlight Sins« Erschienen bei: Avon Books, New York
Covergestaltung: zero-media.net, München Coverabbildung: FinePic / München E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783955768829
www.harpercollins.de Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
Widmung
An alle Leser,
die dieses Buch in die Hand nehmen:
Danke!
1. Kapitel
1. Kapitel
»Stimmt es, was über die Frauen gesagt wird, die hierherkommen?« Rot lackierte Fingernägel strichen über Lucian de Vincents Bauch und zogen sein Hemd vorne aus dem Hosenbund. »Dass sie … wahnsinnig werden?«
Lucian zog eine Augenbraue hoch.
»Ich habe nämlich das Gefühl, ein bisschen wahnsinnig zu werden, etwas außer Kontrolle zu geraten. Ich will dich schon so lange.« Lippen in derselben Farbe wie die Fingernägel streiften durch das kürzere Haar um sein Ohr. »Aber du hast mich nie beachtet. Bis heute Abend.«
»Das stimmt nicht«, raunte er und griff nach der Flasche Old Rip. Er hatte sie mehr als einmal angesehen. Gewiss auch einige Male abgecheckt. Dieses blonde Haar, dieser Körper in dem tief ausgeschnittenen Kleid, nein, garantiert hatte er das, so wie die Hälfte der anderen Gäste im Red Stallion auch. Verdammt, wahrscheinlich hatten an die neunzig Prozent von ihnen, männlich wie weiblich, mehr als einmal in ihre Richtung geschaut, und das wusste sie.
»Doch du warst immer anderweitig beschäftigt«, fuhr sie fort, und er konnte förmlich vor sich sehen, wie sie einen Schmollmund machte.
Er goss sich von dem zwanzig Jahre alten Bourbon ein, während er sich zu erinnern versuchte, wen er sonst noch abgecheckt haben könnte. Da waren unzählige Optionen, nur hatte er nie genau genug hingeschaut, als dass er jemanden Bestimmtes hätte nennen können. Tatsache war, dass er nicht einmal richtig auf die Frau hinter sich achtete, auch jetzt nicht, als sie das, was sich wie wundervolle Brüste anfühlte, an seinen Rücken presste und mit einer Hand unter sein Hemd glitt. Sie gab diesen Laut von sich, ein kehliges Stöhnen, das keinerlei Wirkung auf ihn hatte. Gleichzeitig legte sie die flache Hand auf seine unteren Bauchmuskeln.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der nur ein wissendes Lächeln und eine heiße Stimme vonnöten gewesen waren, damit er so hart wurde, dass er eine Wand hätte durchbohren können. Als er noch weniger brauchte, um sich für einen Moment in einer heißen Nummer zu verlieren.
Aber jetzt?
Eher nicht.
Ihre scharfen kleinen Zähne fingen sein Ohrläppchen ein und ihre Hand wanderte tiefer, bis ihre Finger seine Gürtelschnalle erreichten. »Aber weißt du was, Lucian?«
»Was?« Er hob das niedrige, schwere Glas an seine Lippen und stürzte die rauchige Flüssigkeit hinunter, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Der Bourbon floss durch seine Kehle und wärmte seinen Bauch, während er das Gemälde über der Bar betrachtete. Es war nicht das beste hier, doch etwas an den Flammen gefiel ihm, erinnerte ihn an dieses brennende Abgleiten in den Wahnsinn.
Sie öffnete seinen Gürtel. »Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder an eine andere denkst.«
»Wirst du …?« Er verstummte, runzelte die Stirn und versuchte, sich zu erinnern.
Mist.
Er hatte ihren Namen vergessen.
O Mann, verdammt, wie hieß die Frau? Die violett-roten Flammen auf dem Bild verrieten es ihm nicht. Er holte tief Luft und erstickte fast an ihrem schweren Parfüm. Es war, als hätte er einen Erdbeerstrauch im Mund.
Sein Hosenknopf sprang auf und er hörte, wie das Ratschen des Reißverschlusses den ganzen Raum ausfüllte. Keine Sekunde später war ihre Hand unter dem Bund seiner Boxershorts, da, wo sein Schwanz ruhte.
Ihre Hand erstarrte nur sehr kurz. Sie schien den Atem anzuhalten. »Lucian?«, fragte sie und schlang ihre Finger um seinen halb erigierten Schaft.
Das offensichtliche Desinteresse seines Körpers ließ Lucian angewidert den Mund verziehen. Was, verflucht noch mal, stimmte denn mit ihm nicht? Er war hier mit einer wunderschönen Frau, die seinen Schwanz berührte, und war ungefähr so erregt wie ein Schuljunge in einem Raum voller Nonnen.
Er war … verflucht, er war gelangweilt. Gelangweilt von ihr, von sich – von alldem hier. Eigentlich entsprach diese Frau seinem Beuteschema: Mit ihr könnte er ein bisschen Spaß haben und sie danach vergessen. Er war nie mehr als einmal mit einer Frau zusammen, weil es, fing man einmal damit an, sich öfter zu sehen, zu einer Gewohnheit wurde, mit der sich schwer brechen ließ. Einer von beiden entwickelte Gefühle, und das war nicht er, niemals er. Er hatte bestenfalls das Gefühl, dass er … damit durch war.
Und dieses Gefühl, drüber hinweg zu sein, über alles, begleitete ihn schon seit ein paar Monaten, lag praktisch wie die Pest über seinem gottverdammten Leben. Die Rastlosigkeit hatte sich tief in ihn eingegraben, wucherte in ihm wie der beknackte Efeu, der die ganze Hausfassade einnahm.
Und er hatte sich schon lange, bevor alles auf den Kopf gestellt wurde, so gefühlt.
Die Frau ließ ihre andere Hand unter seinem Hemd nach oben wandern und griff unten fester zu. »Du lässt mich richtig arbeiten für diesen Schwanz, was?«
Fast hätte er gelacht.
Mist.
Bedachte man, wo er in Gedanken war, müsste sie sich enorm anstrengen. Er stellte sein Glas zurück auf die Bar, ließ den Kopf nach hinten sinken und schloss die Augen, zwang seinen Geist, Ruhe zu geben. Sie war zum Glück still, während sie ihn mit der Hand verwöhnte.
Mehr denn je brauchte er das hier jetzt, dieses gedankenlose Entspannen, und sie – Clare? Clara? Irgendwas mit C, da war er sich sicher. Jedenfalls wusste sie, was sie tat. Mit jeder Sekunde wurde er härter, doch sein Kopf … tja, sein Kopf war nicht bei der Sache.
Seit wann musste er mit dem Kopf dabei sein?
Er stellte die Beine weiter auseinander, gab ihr etwas mehr Spielraum, während er blind nach der teuren Flasche Bourbon griff. Heute Nacht ging es darum, sich zu verlieren, das Gefühl zu haben, er würde tatsächlich leben. Was für jede andere Nacht auch galt, doch ganz besonders heute, denn morgen müsste er sich um einige Dinge kümmern.
Aber im Moment brauchte er nicht zu denken. Er brauchte auch nichts anderes zu fühlen als ihre Hand, dann ihren Mund und vielleicht die Art wie …
Die leisen, kaum hörbaren Schritte im Stockwerk über ihnen zwangen ihn, die Augen zu öffnen. Er neigte den Kopf zur Seite, glaubte bereits, dass er sich das Geräusch eingebildet hatte, doch da war es wieder. Eindeutig Schritte.
Wie zum Teufel konnte das sein? Er fing ihr Handgelenk ein, um sie zu stoppen. Was ihr gar nicht gefiel. Sie bewegte die Hand, rieb ihn fester und härter. Er übte gerade genug Druck auf ihre Hand aus, dass sie innehalten musste.
»Lucian?« Sie klang verwirrt.
Er antwortete nicht, sondern lauschte angestrengt. Unmöglich konnte er gehört haben, was er zu hören meinte. Es konnte niemand in den Zimmern oben sein, niemand sonst war hier.
Nachts war kein Personal im Haus. Sie alle weigerten sich, im Herrenhaus der de Vincents zu bleiben, sobald der Mond aufgegangen war.
Nichts als Stille vernahm er, möglich also, dass er sich Dinge einbildete und dafür dem verfluchten Bourbon danken durfte.
Mann, vielleicht war er derjenige, der den Verstand verlor.
Er zog ihre Hand aus seiner Hose und drehte sich zu der Frau um. Sie war wirklich schön, dachte er, als er ihr Gesicht betrachtete. Allerdings hatte er schon vor langer Zeit erkannt, dass Schönheit ein zufälliges Geschenk war, gedankenlos verteilt. In den meisten Fällen war sie nur oberflächlich und oft nicht einmal echt, sondern mit ärztlicher Hilfe und viel Geschick erzeugt.
Er legte eine Hand in ihren Nacken und fragte sich, wie tief ihre Schönheit reichte und wo die Hässlichkeit begann. Mit dem Daumen fühlte er ihren Puls, gespannt darauf, wann er sich beschleunigen würde.
Sie öffnete den Mund leicht und senkte die Lider über ihre Augen in der Farbe der Iris, die gerade überall in Louisiana blühte. Er wollte wetten, dass bei ihr zu Hause eine oder zwei Kronen lagerten, zusammen mit den passenden Schärpen, die sie als eine der vielen Schönheiten der Südstaaten auswiesen.
Langsam senkte Lucian den Kopf, da klingelte sein Handy auf der Bar. Sofort ließ er die Frau los und wandte sich um. Sie stieß ein enttäuschtes Murmeln aus. Er ging zu seinem Handy und war verwundert, als er den Namen seines Bruders auf dem Display sah. Es war spät, und außerdem lag der goldene Junge doch schon irgendwo in diesem Haus in seinem Bett. Dev wäre zu dieser Uhrzeit nicht mal mit seiner Verlobten zusammen und würde die Nacht durchvögeln, wie Lucian es sich bei normalen, glücklichen Paaren vorstellte.
Andererseits konnte er sich auch schwerlich vorstellen, dass die makellose Sabrina irgendwen vögelte.
Über die Männer und Frauen der de Vincents wurde so manches geredet. Ein Gerücht jedoch schien absolut falsch: Ihre Urgroßmutter hatte einst behauptet, wenn sich ein de Vincent verliebte, dann tat er es schnell und intensiv, ohne Verstand und ohne zu zögern.
Das war totaler Blödsinn.
Der Einzige von ihnen allen, der sich jemals verliebt hatte, war ihr Bruder Gabe gewesen, und was war dabei herausgekommen? Ein verdammtes Chaos.
»Was?«, fragte Lucian, als er das Gespräch annahm und erneut nach der Flasche griff.
»Du musst sofort nach unten in Vaters Arbeitszimmer kommen«, befahl Dev.
Lucian zog die Augenbrauen hoch, doch sein Bruder hatte schon wieder aufgelegt. Das war eine interessante Anweisung. Er steckte das Handy in seine Tasche, machte seinen Reißverschluss zu, zog den Gürtel aus den Schlaufen und warf ihn auf die nahe stehende Couch. »Bleib hier«, sagte er.
»Was? Du gehst weg?«, fragte sie, wobei es klang, als wäre sie noch nie von einem Mann stehengelassen worden, nachdem sie erst mal ihre Hand an seinem Schwanz hatte.
Er grinste sie an und öffnete die Tür, die zur Veranda im ersten Stock führte. »Ja, und du wirst hier auf mich warten.«
Ihr stand der Mund offen, aber während er hinaus in die kühle Nachtluft trat, wusste er, sie konnte so genervt sein, wie sie wollte, sie würde dennoch dableiben und auf ihn warten.
Er überquerte die Veranda und stieg die daran angeschlossene Treppe hinunter, die die direkt zur hinteren Diele führte. Das Mausoleum von einem Haus war nur schwach beleuchtet und still. Der Fliesenboden unter seinen nackten Füßen wich glattem Parkett.
Es dauerte ein paar Minuten, zum Arbeitszimmer im rechten Flügel zu gelangen, weit entfernt von den neugierigen Blicken derjenigen, die das Heim der de Vincents besuchten. Der Flügel verfügte sogar über eine eigene Zufahrt und Eingangstür.
Lawrence, sein Vater, nahm Privatsphäre extrem ernst.
Lucians Schritte wurden langsamer, als er sich den geschlossenen Türen näherte. Zwar hatte er keinen Schimmer, was ihn in dem Arbeitszimmer erwartete, doch da sein Bruder ihn um diese nächtliche Stunde kaum wegen nichts rufen würde, machte er sich auf alles gefasst.
Die schweren Eichentüren schwangen lautlos auf, und Lucian blieb direkt im Eingang des hell erleuchteten Raumes abrupt stehen. »Ach du Scheiße.«
Zwei Beine schwangen leicht hin und her, und die Brooks-Brother-Slipper aus Alligatorenleder hingen mehre Zentimeter über dem Boden. Darunter befand sich eine kleine Pfütze. Der grässliche Gestank verriet Lucian, um was es sich handelte.
»Deshalb habe ich dich gerufen«, sagte Dev matt irgendwo im Zimmer.
Lucian betrachtete die dunkle Hose, deren Beine an der Innenseite nass waren. Darüber ein türkisblaues Hemd, halb aus dem Bund gezogen. Hände und Arme hingen schlaff herunter, die Schultern waren eingesunken, und der Hals befand sich in einem merkwürdigen Winkel.
Wahrscheinlich lag es an dem Gürtel, der um ihn geschlungen war. Jener war oben am Deckenventilator befestigt, der vor gut einem Monat aus Indien importiert und hier eingebaut worden war. Mit jeder Bewegung des baumelnden Körpers hörte sich die Deckenbefestigung wie eine alte, tickende Standuhr an.
»Mein Gott«, stieß Lucian knurrend aus, ließ die Hände sinken und blickte sich rasch im Zimmer um. Die Urinlache breitete sich in Richtung des beige-goldenen Perserteppichs aus.
Würde seine Mutter noch leben, hätte sie entsetzt ihre Perlenkette umklammert.
Bei dem Gedanken trat ein verbittertes Grinsen auf seine Züge. Bei Gott, er vermisste seine Mutter an jedem einzelnen verdammten Tag, seit sie ihn – sie alle – in jener stürmischen, drückend schwülen Nacht verlassen hatte. Seine Mom hatte es gemocht, wenn Dinge schön, alters- und makellos waren. Auf eine traurige Art passte es, dass sie diese Erde genauso verließ.
Diese Gedanken setzten ihm mehr zu als der Tote in diesem Raum, weshalb er nach rechts schritt und sich in einen der Ledersessel fallen ließ. In ebendiesem Sessel hatte er als Kind gehockt und stumm einer der vielen, vielen Ausführungen gelauscht, weshalb er eine solch grandiose Enttäuschung war. Nun saß er mit gespreizten Beinen da. Er brauchte keinen Spiegel, um zu wissen, dass sein blondes Haar, anders als das dunkle seines Bruders, aussah, als wären ein Dutzend Hände hindurchgefahren. Er brauchte auch nicht tief einzuatmen, um den extrem blumigen Parfümduft wahrzunehmen, der in seiner Kleidung hing.
Hätte Lawrence ihn so gesehen, er hätte angewidert die Oberlippe gekräuselt. Doch nie wieder würde Lawrence ihn so anschauen, denn er baumelte am Deckenventilator wie an einem Schlachterhaken.
»Hat jemand die Polizei gerufen?«, fragte Lucian, wobei er mit seinen langen Fingern auf der Armlehne trommelte.
»Das will ich doch hoffen«, antwortete Gabriel. Er lehnte sich an die polierte Kirschholzanrichte. Kristallgläser stießen klirrend gegeneinander, aber die Karaffen, gefüllt mit Brandy und feinem Whiskey, bewegten sich kaum.
Gabe, der als der normalere Bruder der de-Vincent-Horde galt, schien noch halb zu schlafen. Er trug lediglich eine Jogginghose und rieb sich das Kinn, während er die Beine beäugte. Sein Gesicht war blass und eingefallen.
Doch wer Gabriel für normal hielt, kannte ihn nicht wirklich.
»Ich habe Troy angerufen«, erklärte Dev grimmig von der anderen Seite des Arbeitszimmers. Er entsprach ganz dem Bild des ältesten Sohnes – der nun offenbar über die gesamte Dynastie herrschte: das dunkle Haar sorgfältig gekämmt, glatt rasiert und keine einzige verfluchte Falte in der Baumwollhose, in der er geschlafen hatte. Wahrscheinlich hatte er sie sogar gebügelt, ehe er herkam.
»Ich habe ihm erzählt, was passiert ist«, fuhr Dev fort. »Er ist unterwegs.«
Lucian sah hinüber zu Dev. »Hast du ihn gefunden?«
»Ich konnte nicht schlafen, deshalb bin ich aufgestanden und nach unten gegangen. Ich bemerkte, dass Licht brannte, und da habe ich ihn gefunden.« Dev verschränkte die Arme vor der Brust. »Wann bist du nach Hause gekommen, Lucian?«
»Was spielt das denn für eine Rolle?«
»Beantworte einfach die Frage.«
Lucian grinste träge, denn er begriff, worauf sein Bruder hinauswollte. »Denkst du, ich habe irgendwas mit dem gegenwärtigen Zustand des lieben alten Dad zu tun?«
Devlin schwieg. Er wartete. Was typisch für ihn war. Still und kalt wie ein frisch ausgehobenes Grab. Er hatte nichts mit Lucian gemein. Nichts. Es war Gabe, der Lucian beobachtete, als erriete er die Wahrheit, als wisse er es besser.
Lucian verdrehte die Augen. »Ich habe nicht mal gewusst, dass er wach und hier unten war, als ich nach Hause gekommen bin. Ich habe meinen eigenen Eingang benutzt und bin fröhlich mit anderem beschäftigt gewesen, bis du mich angerufen hast.«
»Ich werfe dir ja nichts vor«, erwiderte Dev in demselben Tonfall, mit dem er in ihrer Kindheit schon hunderte Male am Tag mit ihnen gesprochen hatte. »Klingt aber verdächtig danach.« Wie verkorkst war das denn? Ihr Vater baumelte an seinem Sechshundert-Dollar-Gürtel am Deckenventilator, und Dev fragte Lucian, wo er gewesen war? Seine trommelnden Finger auf der Armlehne stoppten und er bemerkte den roten Schmierstreifen an seinem Zeigefinger. Er ballte die Hand. »Und wo wart ihr zwei?«
Dev zog die Brauen hoch.
Gabe wandte das Gesicht ab.
Kopfschüttelnd lachte Lucian leise. »Hört mal, ich bin kein Forensiker, aber es sieht aus, als hätte er sich selbst erhängt.«
»Es ist ein unbeabsichtigter Tod«, behauptete Gabe, und Lucian fragte sich, aus welcher Krimiserie er diesen Ausdruck hatte. »Sie werden es dennoch untersuchen. Vor allem, weil er anscheinend keinen … keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat.« Er wies mit dem Kinn zum leeren Schreibtisch. »Allerdings hat bisher auch noch keiner von uns richtig gesucht. Mist. Ich fasse das nicht …«
Lucian blickte wieder zur Leiche seines Vaters. Er konnte es genauso wenig fassen. »Du hast Troy angerufen?« Er sah Dev an. »Der wird wahrscheinlich eine verdammte Party schmeißen. Zum Teufel, wir sollten feiern.«
»Besitzt du überhaupt keinen Anstand?«, entgegnete Dev.
»Stellst du mir ernsthaft diese Frage? Wir reden hier über unseren Vater!«
Devs Züge verhärteten sich leicht – eine kaum merkliche Gefühlsreaktion. »Hast du eine Ahnung, was die Leute hierzu sagen werden?«
»Vermittelt dir mein Gesichtsausdruck den Eindruck, dass es mich interessiert, was andere denken?«, erwiderte Lucian ruhig. »Oder dass es mich jemals interessiert hat?«
»Dich schert es vielleicht nicht, aber das Letzte, was unsere Familie braucht, ist, schon wieder durch den Dreck gezogen zu werden.«
Es gab eine Menge Dinge, die ihre Familie nicht brauchte, doch ein weiterer dunkler Fleck auf der alles andere als weißen Weste war ihre geringste Sorge.
»Vielleicht hätte unser Vater das bedenken sollen, bevor …« Er verstummte und deutete mit dem Kopf auf die Leiche.
Dev verkniff den Mund, und Lucian wusste, dass es seinen Bruder seine gesamte Selbstbeherrschung kostete, nichts zu erwidern. Aber schließlich hatte Dev jahrelange Übung darin, nicht auf Lucians Provokation anzuspringen.
Dev schwieg, schritt einfach um die Beine ihres Vaters herum aus dem Arbeitszimmer und schloss leise die Türen hinter sich.
»Habe ich irgendwas gesagt?«, überlegte Luc laut.
Gabe bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Warum musst du das tun?«
Gleichgültig zuckte er mit einer Schulter. »Warum nicht?«
»Du weißt, wie er sein kann.«
Der springende Punkt war, dass Luc sehr wohl wusste, wie Dev sein konnte, aber tat Gabe es? Das glaubte er weniger. Wahrscheinlich, weil Gabe nicht sehen wollte, wie Dev wirklich sein konnte, wenn diese einstudierte Gefasstheit einen Riss bekam.
Gabe starrte abermals zu den verdammten Beinen, und er klang grimmig, als er fragte: »Glaubst du tatsächlich, unser Vater hat das getan?«
»Für mich sieht es so aus«, antwortete Lucian, während er sich auf die gespenstisch weißen Hände konzentrierte, eingefroren für alle Zeit.
»Es gibt nur sehr weniges, was mich bei ihm tatsächlich überrascht hätte, aber dass er sich erhängt?« Gabe strich sich mit den Fingern durchs Haar. »Das ist nicht sein … Stil.«
Luc musste ihm zustimmen. Es sah Lawrence überhaupt nicht ähnlich, ihnen den Gefallen zu tun und sie alle in Ruhe zu lassen. »Vielleicht ist es der Fluch.«
»Meinst du das ernst?« Gabe fluchte leise. »Du hörst dich schon an wie Livie.«
Bei dem Gedanken an ihre Haushälterin kehrte Lucians Grinsen zurück. Mrs. Olivia Besson war wie eine zweite Mutter für sie, gehörte so fest zu diesem Haus wie die Mauern und das Dach, aber die Frau war auch abergläubisch wie Matrosen auf stürmischer See. Das Grinsen verschwand.
Eine schwere Stille senkte sich über sie, während sie beide ihren Vater anstarrten. Es war Gabe, der das Schweigen brach, indem er flüsternd, als fürchtete er, belauscht zu werden, sagte: »Ich bin aufgewacht, bevor Dev mich gerufen hat. Ich dachte, dass ich jemanden im obersten Stock höre.«
Lucian stockte der Atem.
»Ich bin nach oben gegangen, aber …« Gabes Brust hob und senkte sich unter einem tiefen Atemzug. »Weißt du noch, was du morgen vorhattest? Das wird jetzt nicht mehr möglich sein.«
»Warum nicht?«
»Warum nicht?«, wiederholte Gabe ungläubig lachend. »Du kannst das Anwesen nicht einen Tag nach dem Tod unseres Vaters verlassen.«
Lucian sah darin kein Problem.
»Dev würde ausflippen.«
»Dev hat keine Ahnung, was ich tue«, erwiderte er. »Sicher wird er gar nicht merken, wenn ich weg bin. Und am nächsten Morgen bin ich wieder da.«
»Lucian …«
»Es ist wichtig, dass ich das mache, und das weißt du. Ich vertraue nicht … ich vertraue nicht darauf, dass Dev die richtige Person ausgesucht hat. Auf keinen Fall werde ich mich zurücklehnen und ihn das übernehmen lassen.« Sein Ton duldete keine Widerrede. »Dev mag sich so viel er will einbilden, dass er derjenige ist, der alles regelt. Ist mir egal. Aber ich werde hier ein Wort mitreden.«
Gabe seufzte erschöpft und ließ einen Moment verstreichen. »Dann sorg lieber dafür, dass dein Gast vollends begreift, wie wichtig es ist, dass sie keine Silbe über das verliert, was hier geschehen ist.«
»Natürlich«, murmelte Lucian und erhob sich träge. Ihn wunderte nicht, dass sein Bruder von dem Besuch wusste, den er mit nach Hause gebracht hatte.
Dieses Haus hatte Augen und Ohren.
Gabe lief zur Tür. »Ich suche Dev.«
Lucian schaute seinem Bruder nach, ehe er sich wieder zu seinem toten Vater umdrehte, in sich hineinhörte und hoffte, irgendwas, egal was, zu fühlen. Der Schock, den er beim Betreten des Zimmers empfunden hatte, war schon verflogen gewesen, bevor er in ihm nachwirken konnte. Dieser Mann, der am Deckenventilator hing, hatte ihn aufgezogen, und Lucian konnte keinen Funken Trauer aufbringen. Achtundzwanzig Jahre hatte er unter der Fuchtel dieses Mannes gelebt, und da war nichts. Nicht mal Erleichterung. Schlicht ein Abgrund von Nichts.
Wieder blickte er zum Deckenventilator.
Hatte Lawrence de Vincent sich erhängt? Der Patriarch der Familie hätte sie alle aus purem Trotz überlebt.
Doch wenn er es nicht gewesen war, bedeutete es, dass jemand anders ihn getötet und es wie Selbstmord hatte aussehen lassen. Was nicht auszuschließen war. Verrücktere Sachen passierten. Lucian dachte an die Schritte, die er gehört hatte. Es konnte nicht sein …
Für einen Moment schloss er die Augen und stieß einen Fluch aus. Dies würde eine lange Nacht, und das nicht im spaßigen Sinne. Der morgige Tag würde noch länger. Als er das Zimmer verließ, bückte er sich und rollte den schweren Teppich ein Stück auf, damit die Lache ihn nicht erreichte.
2. Kapitel
2. Kapitel
Auf dem Weg die dämmrige Treppe hinauf übersprang Lucian mal eine, mal zwei Stufen. Sein Wohnbereich war nicht der erste Halt. Stattdessen eilte er auch die dritte Treppe hinauf und durch den überdachten Gang in den Korridor. Wandleuchten erhellten den Weg gerade so, dass er wenige Schritte vor sich etwas sehen konnte.
Er kam an mehreren geschlossenen Türen von Zimmern vorbei, die das Personal aus diversen verschrobenen Gründen nicht betreten wollte, und blieb am Ende des Korridors stehen. Seine Rückenmuskeln spannten sich an, als er die grauweiße Tür ansah.
Der Knauf lag kalt in seiner Hand. Lucian drehte ihn und öffnete die Tür, woraufhin diese lautlos über den dicken Teppichboden glitt. Rosenduft umwehte Lucian. In dem Zimmer brannte Licht. Eine der kleinen Nachttischlampen mit pastellfarbenem Schirm war angeschaltet. Die Gestalt, die in dem großen Bett mit den handgedrechselten Pfosten lag, wirkte unglaublich klein und zerbrechlich. Kein bisschen so, wie sie früher gewesen war.
»Maddie?«, rief er, was sogar in seinen eigenen Ohren schroff klang.
Im Bett rührte sich nichts. Kein Geräusch. Nichts, das ihm verraten könnte, ob sie wach war oder ihn wahrnahm. Sein Brustkorb verengte sich unter einem Druck, den noch so viel Trinken und Vögeln nicht lindern konnten.
Unmöglich konnten jene Schritte ihre gewesen sein.
Er blickte in das Bett, schaute sie für einen Moment an; dann trat er zurück und schloss die Tür hinter sich. Während er sich mit einer Hand übers Gesicht fuhr, steuerte er auf den Durchgang zu und stieg eine Treppe tiefer. Dort passierte er das leere Gästezimmer schräg gegenüber von seinen Zimmern.
Eine andere Form von Anspannung überfiel ihn, als er die Tür zu seinen Räumen aufriss. Drinnen blieb er direkt wieder stehen.
Sein Gast stand von der Couch auf, vollständig nackt bis auf schwarze Vögel-mich-Schuhe. O Mann. Sein Blick wanderte nach unten, der Hand mit den rot lackierten Fingernägeln folgend zwischen den Brüsten hindurch und tiefer, zwischen ihre Schenkel.
»Du hast zu lange gebraucht«, sagte sie und biss auf ihre Unterlippe, als er wieder in ihr Gesicht sah. »Da habe ich schon mal alleine angefangen.«
Klang für ihn nach einer super Art, sich die Zeit zu vertreiben.
Ein Teil von ihm wollte die Tür hinter sich zu treten und vergessen, was unten los war. Verdammt, er war ein Mann, und vor ihm verwöhnte sich eine sehr attraktive und sehr nackte Frau selbst, aber …
Verflucht.
Er durfte sich nicht erlauben, diesen vergnüglichen Pfad einzuschlagen.
Also konzentrierte er sich auf ihre Nase, die er für unverfänglich hielt. »Süße, ich tue das nur sehr ungern …«
Sie stürzte sich wie ein Tiger auf ihn, sprang regelrecht einen guten halben Meter oder gar weiter durch die Luft.
Vor lauter Schreck fing er sie auf, er konnte sie ja schlecht auf dem Boden aufschlagen lassen. Er mochte ein Arsch sein, aber ganz so mies war er dann doch nicht.
Lange Beine schlangen sich um seine Hüften, und warme Hände legten sich an seine Wangen. Ehe er auch nur Atem holen konnte, war ihr Mund auf seinem, drängte ihre Zunge zwischen seine Lippen, so wie sie offensichtlich wollte, dass er es zwischen ihren Schenkeln tat.
Anscheinend hatte sie sich etwas aus der Flasche Bourbon genehmigt.
Das schmeckte er.
Er fasste sie an den schmalen Hüften, befreite sich von ihr, als ob er einen Schokoriegel auspacken würde, und stellte sie hin. »O Mann«, raunte er und trat zurück. »Warst du am College im Leichtathletik-Team?«
Sie trat einen Schritt vorwärts und runzelte die Stirn, da er ihr auswich, sich bückte und ihren Slip aufhob. Verwundert beobachtete sie, wie er als Nächstes nach ihrem Kleid griff. »Was machst du?«
»Auch wenn ich die enthusiastische Begrüßung sehr zu schätzen weiß, musst du gehen.« Er hielt ihr ihre Sachen hin.
Sie ließ die Arme an ihrem Körper herunterhängen. »Was?«
Mit einer Geduld, die er für gewöhnlich gar nicht besaß, holte er tief Luft. »Entschuldige, Süße, aber du musst gehen. Es ist etwas dazwischengekommen.«
Ihr Blick glitt zur Tür hinter ihm, und Lucian schwor bei Gott, sollte dort einer seiner Brüder stehen … »Was ist dazwischengekommen?«, fragte sie.
»Nichts, was dich etwas anginge.« Als sie sich weiterhin weigerte, ihre Sachen zu nehmen, warf Lucian sie auf die Couch hinter ihr. »Hör mal, es tut mir leid, doch du musst jetzt sofort verschwinden.«
Ihre Kinnlade fiel herunter, und sie machte keinerlei Anstalten, sich Richtung Couch zu bewegen und sich anzuziehen. »Auf keinen Fall schickst du mich jetzt weg.«
Drückte er sich unverständlich aus?
»Egal, was los ist, ich kann warten …«
»Du kannst nicht warten, und ich habe wirklich keine Zeit hierfür«, fiel er ihr deutlich bestimmter ins Wort.
Einen Moment lang starrte sie ihn an, dann kniff sie die Lippen zusammen. »Du willst mich doch verarschen, oder? Das ist totaler Bullshit.« Ihre Stimme wurde schriller, und Lucian stellte fest, dass er die Antwort auf seine Frage von vorhin bekam. Ihre Schönheit war wirklich nur oberflächlich. »Du schleifst mich den ganzen Weg hier raus, machst mich scharf und setzt mich dann vor die Tür?«
»Dich scharfmachen?« Er lachte. »Ich habe dich kaum berührt.«
»Darum geht es nicht.«
»Ob du deine Klamotten mitnimmst oder nicht, ob du splitternackt gehst oder dir deine verdammten Sachen anziehst, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal.« Er trat auf sie zu; diese Unterhaltung war für ihn beendet. »Aber ich habe das Gefühl, dass der Fahrer, der unten auf dich wartet, nicht deinen nackten Arsch auf seinen Polstern haben will.«
Ihre Wangen röteten sich. »Weißt du überhaupt, wie ich heiße?«, fragte sie, während er zur Bar lief.
Ach, verflucht noch eins.
Er schenkte sich einen Drink ein, wohlwissend, dass diese Situation schneller eskalierte, als er gucken konnte.
»Ich heiße übrigens Cindy, du Arschloch.«
Er kippte den Drink herunter und war froh, dass er beim Raten gar nicht mal so weit danebengelegen hatte. Dann drehte er sich wieder zu ihr um.
Cindy zog sich gerade einen schwarzen Fetzen Seide über die Schenkel nach oben. »Hast du einen Schimmer, wie viele Männer buchstäblich sterben würden, um jetzt an deiner Stelle zu sein?«
»Sicher ist es eine lange Liste«, antwortete er trocken.
Sie schnappte sich ihr Kleid von der Couch und sah ihn wütend an. »O ja, du klingst sehr überzeugt.« Das Kleid glitt über ihren Kopf. »Weißt du eigentlich, wer ich bin?«
»Ich weiß sogar genau, wer du bist.«
»Da du nicht mal meinen Namen kanntest, bezweifle ich es.« Sie griff ihre Handtasche vom Beistelltisch und warf ihr blondes Haar über die Schulter. »Aber du wirst es wissen, wenn ich mit dir fertig bin …«
Sie rang nach Luft, als er schneller als erwartet auf sie zukam. Wieder legte er wie vorhin eine Hand in ihrem Nacken. »Zwar erinnerte ich mich nicht an deinen Namen, aber das heißt nicht, dass ich nicht sehr gut weiß, wer du bist.«
»Ach nein?«, flüsterte sie und senkte die Lider.
»Du bist ein wandelnder Treuhandfond und es gewohnt, alles von Daddy zu bekommen, was du dir wünschst. Du verstehst das Wort Nein nicht und besitzt kein Fünkchen Verstand, wenn es um pure Selbsterhaltung geht.«
»Und du bist so anders?« Sie beugte sich vor und benetzte ihre Unterlippe. »Denn es hört sich an, als würdest du über dich selbst reden.«
Er neigte den Kopf und blickte ihr in die Augen, während sein Griff in ihrem Nacken fester wurde. »Du weißt einen Scheiß über mich, wenn du das denkst. Es gibt nichts, was du mir oder meiner Familie antun könntest, das ich dir nicht dreimal schlimmer zurückzahlen könnte. Also denk nicht mal dran, deine hübschen kleinen Drohungen zu Ende zu spinnen.«
Ihre Hand landete auf seiner Brust, und sie schloss die Augen. »Bist du dir sicher?«
Verdammt.
Dies hier erregte sie.
Angewidert riss er seine Hand weg und ließ Cindy rückwärts stolpern. »Du warst nicht hier. Du warst heute Nacht nicht einmal in der Nähe dieses Hauses. Solltest du irgendjemandem gegenüber auch nur andeuten, du wärst es gewesen, vernichte ich dich.« Er legte eine Pause ein, um sich zu vergewissern, dass sie zuhörte. »Und bevor du aussprichst, was immer dir auf der Zunge brennt, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich tun kann.«
An der Stelle hatte Cindy den Mund geschlossen. Sie begriff und machte ihm keinen Stress mehr.
Sobald sie sicher in dem Wagen saß, der hinterm Haus wartete, ging Lucian zu seinen Brüdern ins Hauptwohnzimmer.
»Hat ja lange genug gedauert«, sagte Dev und musterte ihn. »Und doch hattest du nicht die Zeit, dir Schuhe anzuziehen oder dein bescheuertes Hemd in die Hose zu stecken?«
Lucian verengte die Augen, während er an seinem Bruder vorbeischritt. »Ist dir bewusst, dass es fast fünf Uhr morgens ist? Ich glaube kaum, dass irgendwer darauf achten wird, wie ich angezogen bin.«
»Lucian hat recht«, sagte Gabe, der auf dem Sofa saß und wie üblich den Vermittler spielte. »Es ist richtig spät – oder richtig früh. Da ist es unerheblich.«
Dev neigte den Kopf zur Seite. »Hast du nach ihr gesehen?«
Lucian nickte. »Alles unverändert.«
Gabe strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Die Spitzen berührten beinahe seine Schultern. Ihr Vater hasste sein langes Haar und behauptete, er sähe damit aus wie – was hatte er noch gleich gesagt – ein Taugenichts? »Was machen wir, wenn sie das Haus durchsuchen und sie finden? Nicht einmal Troy weiß von ihr.«
»Es gibt keinen Grund, weshalb sie das Haus durchsuchen sollten«, antwortete Dev. »Genauso wie es keinen Grund gibt, dass Troy von ihr erfährt. Es ist schlimm genug …«
»Was ist schlimm genug?«, unterbrach Lucian ihn. Er spürte, wie Wut in ihm aufflammte. »Dass sie hier ist? Dass sie tatsächlich lebt?«
»Ich wollte sagen, es ist schlimm genug, dass wir Dr. Flores praktisch seine neue Praxis finanzieren mussten, die er schon seit fünf Jahren bauen wollte, um sicherzustellen, dass er die in dieser Situation nötige Diskretion wahrt.« Devs Ton war völlig neutral. Kein Gefühl. Nichts. »Und wer weiß, wie viel Geld …« Sein Blick schweifte zur Tür, und im nächsten Augenblick klopfte es.
Dev hatte diese übernatürliche Fähigkeit, stets zu spüren, wenn jemand in der Nähe war, der nicht zur Familie gehörte. Das war irgendwie unheimlich.
Lucian setzte sich neben Gabe, als Dev das Zimmer verließ, hob die Hände und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Fuck.«
»Jap«, antwortete Gabe, und mehr sagte er nicht.
Dev kehrte zurück, gefolgt von Detective Troy LeMere. Troy sah aus, als hätte er glücklich mit seiner frischangetrauten Frau im Bett gelegen, als er den Anruf erhielt. Seine braune Kakihose war so zerknittert, wie sich Lucians Hirn anfühlte. Die dünne Windjacke verbarg die Waffe an seiner Hüfte nicht.
Sie hatten Troy in einem Sommer kennengelernt, als sie vom Internat im Norden, in das man sie gesteckt hatte, während der Ferien nach Hause kamen. Damals schlichen sie sich vom Anwesen und zu den Basketball-Courts einige Meilen weiter. Dort trafen sie Troy, und obgleich sie kaum aus unterschiedlicheren Welten stammen könnten, hatte sich eine starke Freundschaft zwischen ihnen entwickelt. Ihren Vater hatte dieses enge Band gestört, bis Troy zur Polizeiakademie ging. Von da an legte er gesteigerten Wert auf diese Beziehung, um sie nach Kräften zu nutzen.
Manchmal fragte Lucian sich, ob auch Dev nur deshalb bis heute mit Troy zu tun hatte.
»Das ist nicht euer Ernst, Jungs«, sagte Troy und strich sich über das kurz geschorene dunkle Haar. Keine Beileidsbekundung. So dumm war er nicht. »Den ganzen Weg hierher dachte ich, es sei ein kranker Scherz.«
»Warum sollten wir über so etwas Scherze machen?«, fragte Dev. »Um diese Uhrzeit?«
Lucian verdrehte die Augen, während Gabe etwas murmelte, das verdächtig nach »Fick dich« klang.
Troy kannte Dev und beachtete ihn nicht weiter. »Also, er hat sich erhängt?«
»In dem alten Arbeitszimmer.« Dev trat zur Seite. »Vielleicht kommst du mit und siehst es dir selbst an. Ich bringe dich hin.«
Troy ersparte sich den Kommentar, dass er durchaus wusste, wo das Arbeitszimmer war, doch während er an Lucian vorbeiging, warf er ihm einen Blick zu. Lucian schüttelte kaum merklich den Kopf.
Seufzend stand Gabe auf, als die beiden den Flur hinunter Richtung Arbeitszimmer verschwanden. »Ich gehe mich lieber umziehen, ehe Dev merkt, dass ich immer noch kein Hemd anhabe.«
Lucian schnaubte. »Ich bin ziemlich sicher, dass er das schon gemerkt hat, aber es gehört nun mal nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, dich zu nerven.«
»Stimmt, trotzdem mache ich es.«
Seinem Bruder nachblickend, lehnte Lucian sich in die Polster zurück und streckte einen Arm auf der Rückenlehne aus.
Troy und Dev blieben nicht lange weg, fünf Minuten vielleicht.
Als sie zurück waren, stellte Dev sich vor einen der vielen nie genutzten Kamine, die Arme vor der Brust verschränkt und die Miene versteinert. Troy wirkte ein wenig erschüttert und schien trotz seiner dunklen Haut blass, als er sich auf die Armlehne eines Sessels hockte. »Ich muss den Gerichtsmediziner herrufen, aber wir können versuchen, die Truppe möglichst klein zu halten.«
»Das wäre sehr gut«, antwortete Dev.
Troy sah ihn einen Moment an. »Bevor alle hier sind und der Zirkus losgeht, wie lautet die Story?«
»Was meinst du?« Dev runzelte die Stirn. »Die habe ich dir schon erzählt. Ich konnte nicht schlafen, also bin ich aufgestanden und sah, dass Licht brannte. Ich habe ihn so gefunden.«
»Erzählst du mir ernsthaft, dass du glaubst, der Mann hat sich umgebracht?«, fragte Troy entgeistert. »Ich kenne euren Vater. Der Mistkerl würde eine Atombombe überleben, bloß um …«
»Nicht«, stieß Dev warnend aus. Seine Nasenflügel blähten sich.
Troys Augen verengten sich.
Lucian mischte sich ein, ehe das Gespräch eskalierte – wie die meisten Unterhaltungen mit Dev. Wobei die Eskalation stets einseitig war. »Wie kann es nicht das sein, wonach es aussieht?«
Sein Freund schaute ihn wissend an. »Wo warst du?«
»Ich war im Red Stallion und gegen kurz nach zwei zu Hause, glaube ich.« Seinen Gast ließ er unerwähnt. Sie musste nicht in diese Sache reingezogen werden. »Ich kam nach unten, nachdem Dev mich anrief.«
»Und Gabe?« Troy blickte sich um. »Wo ist er hin?«
»Er wollte sich etwas anziehen«, antwortete Lucian, stützte die Ellbogen auf die Knie und lehnte sich vor. »Er müsste gleich wieder da sein, aber ich sage dir, so haben wir ihn gefunden.«
Troy sah zu dem Handy an seinem Gürtel und fokussierte sich dann wieder auf sie. »Hört mal, ihr wisst, dass ihr mir vertrauen könnt. Wenn der Gerichtsmediziner mit seinem Team hier ist, werden sie ihn sicher nicht nur herunternehmen und einpacken. Sie werden ihn untersuchen.«
»Schon klar«, entgegnete Dev matt. »Vater war … er hatte in letzter Zeit einige Probleme, vor allem wegen all dem, was mit unserem Onkel passiert. Damit kam er schlecht klar. Du weißt, wie wichtig ihm sein Ruf war.«
Interessant.
Lucian blickte zu seinem Bruder. Ja, ihr Onkel, der erhabene Senator, war in einen hässlichen Skandal um eine vermisste Praktikantin verwickelt … oder zwei. Ihr Vater hatte deswegen nicht sonderlich aufgebracht gewirkt, war hingegen völlig ausgerastet, als er hörte, wer oben im zweiten Stock war, und das war verständlich.
»Habt ihr die Sicherheitsbänder angeschaut?«, fragte Troy.
»Auf den Aufnahmen von draußen war nichts Verdächtiges zu sehen. Keiner kommt oder geht, bis auf Lucian«, erklärte Dev. »Und die Kameras drinnen funktionieren schon ewig nicht mehr.«
Fragend blickte Troy ihn an. »Tja, das klingt ein bisschen verdächtig.«
»Es stimmt«, sprang Lucian seinem Bruder bei. »Egal, wie oft wir jemanden hier haben, der sich die Anlage ansieht, sie fällt immer wieder aus. Da ist irgendeine Störung. Das Gleiche, wenn jemand hier drinnen eine normale Kamera benutzen will. Das Einzige, was zu funktionieren scheint, sind bekloppte Handy-Kameras.«
Troy runzelte die Stirn, als wolle er darauf hinweisen, wie dämlich sich das anhörte, doch Lucian machte sich nicht über ihn lustig. Die blöden Videoaufzeichnungen brachen dauernd ab, und bisher hatte kein Techniker die Ursache entdecken können. Natürlich waren den Angestellten Erklärungen eingefallen – paranormale. Dies war einer der Gründe, warum sich einige von ihnen in dem Haus unwohl fühlten.
»Eurem Vater war wichtiger, was die Leute von seiner Familie dachten, als die Familie selbst«, sagte Troy nach einer Weile, und Dev konnte das nicht abstreiten, weil es stimmte. »Es wird Fragen geben, Dev. Wie viel sind die Ölraffinerien, die Immobilien und Vincent Industries wert? Milliarden? Wer erbt das alles?«
»Gabe und ich«, antwortete Dev prompt. »So stand es im Testament unseres Vaters. Ich glaube nicht, dass er es geändert hat.«
Troy wies mit dem Kinn zu Lucian. »Was ist mit dir?«
Lucian lachte. »Ich bin schon lange aus dem Familienunternehmen raus, aber keine Sorge. Ich komme mehr als gut zurecht.«
»Fantastisch, da kann ich gleich ruhiger schlafen, weil ich das weiß.« Troy wandte sich wieder zu Dev. »Worauf ich hinauswill, ist, dass die Leute Fragen stellen werden. Es wird sich nicht verschweigen lassen.«
»Gewiss nicht.« Dev zog eine Augenbraue hoch. »Und es wird bekannt werden, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist.«
Troy stieß ein Lachen aus, als er seine Augen weit aufriss. »Verarschst du mich?«
»Sieht er so aus, als würde er dich verarschen?«, konterte Lucian trocken.
»Klar kann ich ein paar Strippen ziehen, aber das wäre eine höllisch dicke Strippe, die nichtsdestotrotz sehr schnell aufribbeln könnte.« Troy schüttelte den Kopf. »Der Gerichtsmediziner wird einen Suizid nicht als natürliche Todesursache verzeichnen.«
Dev hob eine Augenbraue. »Du würdest dich wundern, was Leute alles zu tun bereit sind.«
Der verblüffte Gesichtsausdruck von Troy verschwand, und er starrte Dev an, als wäre er drauf und dran, ihm eine zu verpassen. »Tatsächlich wundert mich nicht mehr vieles, Devlin.«
»Wir verstehen, dass du deinen Job erledigen musst«, mischte Lucian sich wieder ein, die plötzlich scharfe, warnende Miene seines Bruders ignorierend. »Und wir möchten nicht, dass du etwas aufs Spiel setzt. Wir können damit umgehen … mit was auch immer die Leute sagen oder denken werden.«
»Gut zu wissen, denn einige von uns sind nicht im Begriff, ein Milliarden-Dollar-Unternehmen zu erben«, antwortete Troy, wobei er Dev einen vernichtenden Blick zu warf. »Glück für dich.«
In diesem Moment tat Dev etwas, das Lucian schon länger nicht mehr erlebt hatte.
Der Teufel lächelte.
Die Morgendämmerung verdrängte die Schatten, während Lucian im Wohnzimmer wartete. Die Leute, die im Arbeitszimmer seines Vaters ein- und ausgingen, waren leise, und wenn sie überhaupt sprachen, dann mit gedämpften Stimmen. Draußen waren keine Blaulichter und man stellte den drei Brüdern nur die allernötigsten Fragen. Dev war noch bei Troy, höchstwahrscheinlich, um sicher zu gehen, dass auch genau die Geschichte nach draußen durchsickerte, die er erzählte.
Lucian wandte seinen Blick vom Kamin ab und dem Team an Leuten zu, das im Zimmer erschien. Auf dem schwarzen Polohemd von einem der Männer, die eine Trage schoben, stand »Gerichtsmediziner«.
Das Bild erinnerte ihn an eine andere Nacht mit dem gleichen Ausgang.
Wenn er ehrlich sein sollte, erinnerte es ihn an viele Nächte.
Eine Frau schrie. Lucian erhob sich und drehte sich zur Tür. Dort stand Mrs. Besson und klammerte sich an den Arm ihres Mannes. Beide waren blass. »Was ist los?«
Lucian trat auf sie zu, nahm Richard beim Arm und führte beide in eines der vielen ungenutzten Wohnzimmer, weit weg vom Arbeitszimmer.
»Lucian, was ist passiert?«, fragte Richard und sah ihn besorgt an.
Lucian rollte die Schultern. Er war unsicher, wie er es ihnen sagen sollte. Nicht, dass sie um Lawrence trauern würden, dennoch war er ihr Arbeitgeber gewesen und mithin ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. »Es gab einen Vorfall.«
Richard legte einen Arm um die Taille seiner Frau, als ihre Hand hinauf zu ihrem Kopf wanderte und ihren ohnedies glatten silbergrauen Haarknoten noch glatter strich. »Ich habe das Gefühl, dass du schamlos untertreibst, Junge.«
»Ja, könnte man sagen.« Lucian blickte zur Tür und drückte Richards Schulter. Livie war ihre Haushälterin, hatte den Überblick über das Personal, das tagsüber kam und ging, und über alles andere. Ihr Mann war eine Art Butler, Hausmeister und Haustechniker in einer Person. Das Paar war schon so lange bei ihnen, wie Lucian denken konnte, und er wusste, dass sie absolut verlässlich waren, ungeachtet ihrer Ansichten über das Anwesen. Das mussten sie letztlich auch sein, um für die de Vincents zu arbeiten und Teil der Familie zu sein; sie waren mehr für die Jungen da gewesen, als es deren Eltern je waren. Ihre Tochter war als Kind durch diese Flure gelaufen und wie eine zweite Schwester für die Jungen gewesen. Inzwischen hatte Lucian Nicolette seit Jahren nicht gesehen. Nicht mehr, seit sie aufs College ging.
»Lawrence hat sich im Arbeitszimmer erhängt«, sagte er.
Kleine Falten gruben sich in Livies Gesicht, als sie die Augen zukniff und etwas murmelte, das sich wie ein Gebet anhörte. Ihr Mann starrte Lucian bloß an und fragte: »Ist das wahr?«
»Scheint so.« Es war deutlich zu erkennen, was Richards Gesichtsausdruck bedeutete. Er glich Troys und entsprach dem, was sie im Grunde alle dachten. Auf einmal war Lucian völlig erledigt und strich sich mit einer Hand durchs Haar.
»Lucian!«, rief Gabe aus dem Korridor. Seine Züge waren verhärtet. »Wir müssen mit dir reden.«
Er ging um das Paar herum. »Falls ihr ein bisschen Zeit braucht …«
»Nein«, erklärte Livie und schaute ihn mit ihren braunen Augen an. »Uns geht es gut. Wir sind für euch Jungs da.«
Er lächelte müde. »Danke«, sagte er aufrichtig. »Ich würde mich nur vorerst von Vaters Arbeitszimmer fernhalten.«
Richard nickte. »Willst du immer noch heute weg?«
»Ich muss.«
»Weiß ich.« Richard klopfte ihm auf die Schulter und lächelte entschlossen. »Ich halte hier die Stellung für dich, solange ich kann.«
Lucian ergriff die Hand des Älteren und drückte sie sanft, bevor er die beiden allein ließ und zu seinem Bruder lief. Als er sich Gabe näherte, bemerkte er, dass Troy im Flur auf sie wartete. Dev war nicht zu sehen. »Will ich überhaupt wissen, was ihr zu sagen habt?«
Gabe schüttelte den Kopf. »Ganz sicher nicht.«
Troy sprach mit gesenkter Stimme. »Als sie die Leiche vom Ventilator nahmen, zogen sie auch den Gürtel ab. Euch ist das vermutlich nicht aufgefallen, so wie er hing, und wegen des Gürtels, aber …«
Ein kalter Schauer rann Lucian über den Rücken, als er seinen Bruder ansah. »Was aber?«
»Da waren Spuren an seinem Hals.« Troy holte tief Luft. »Ungefähr da, wo der Gürtel war. Die sehen wie Kratzer aus. Was zweierlei bedeuten kann. Entweder ist er rauf und hat es sich dann anders überlegt, oder er hat sich den Gürtel nie selbst um den Hals gelegt.«
3. Kapitel
3. Kapitel
»Warum musst du mich verlassen?«, rief Anna. Sie stampfte mit einem Fuß auf und schob die Unterlippe vor, während der leuchtend blaue Drink über den Rand ihres Glases schwappte. »Wer soll sich die Klagen über meine höllischen Nachbarn oder meine sehr sachlichen Bemerkungen über richtig scharfe Pharmavertreter anhören?«
Julia Hughes lachte über ihre Kollegin – oder seit zwei Stunden vielmehr ihre Ex-Kollegin. Sie beide und mehrere andere Schwestern und Mitarbeiter aus dem Center waren in einer Bar wenige Blocks von ihrer Arbeitsstelle entfernt und feierten eine kleine Abschiedsparty. Die sich mittlerweile in einen Wettbewerb verwandelte, wer morgen am übelsten verkatert sein würde.
Julia setzte auf Anna.
»Du hast ja noch Susan. Sie hört sich mit Vorliebe deine trübsinnigen Geschichten an und checkt die Vertreter genauso gerne ab.«
»Tut doch jeder, doch du warst als Einzige noch Single bei uns. Jetzt muss ich mit der Fantasie auskommen, wie du mit denen ausgehst und so irren Sex hast, dass du hinterher nur noch komisch laufen kannst.«
Julia verschluckte sich fast an ihrem Drink und nahm ihr Glas herunter.
Anna grinste, bevor sie einen kräftigen Schluck trank. »Und ich kann nicht mal versuchen, Susan mit einem von ihnen zu verkuppeln.«
»Die Glückliche. Vergiss nicht, dass keines von den Dates ein gutes Ende genommen hat«, erinnerte Julia sie. Tatsächlich waren sie entweder sehr langweilig gewesen oder sie war versetzt worden. Es hatte nichts dazwischen gegeben, und irren Sex, nach dem sie am nächsten Tag eine Schmerztablette brauchte, erst recht nicht.
Julia beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf den runden Stehtisch. Die Rockmusik wurde lauter, während sich ihre Gruppe in der Bar verteilte. Der Kuchen, den jemand mitgebracht hatte, war innerhalb von Minuten verputzt gewesen. »Ich werde auch alle vermissen«, sagte sie und holte tief Luft.
»Ich fasse immer noch nicht, dass du das machst.« Seufzend lehnte Anna sich an sie.
Wenn sie ehrlich sein sollte, fasste Julia selbst nicht recht, dass sie ihre Festanstellung als Krankenschwester sausen ließ und mehrere Bundesstaaten weit entfernt in einer anderen Zeitzone eine Stelle als freiberufliche Schwester antrat. Die Entscheidung war so untypisch für sie gewesen, dass ihre Eltern dachten, sie litte unter einer verfrühten Midlife-Crisis.
Den Ansporn zur Bewerbung für den Job hatte eine geleerte Flasche Wein gegeben und … der verzweifelte, geradezu überwältigende Wunsch, dass sich etwas, irgendetwas in ihrem Leben änderte. Sie hatte schon beinahe vergessen, dass sie sich überhaupt beworben hatte, und so war der Anruf von der Agentur letzte Woche ein Schock gewesen: Es gab einen Job in Louisiana, in einem Privathaushalt, und als sie hörte, was dort gezahlt würde, wäre sie beinahe umgefallen.
Julias erste Reaktion war abzulehnen, doch sie hatte nicht auf diese dumpfe Stimme gehört, die sie bis spät in die Nacht wachhielt und dafür sorgte, dass sie bedächtig und übervorsichtig handelte. Und so war, nach dem Ausfüllen eines Berges an Formularen – einschließlich eines Stapels von Vertraulichkeitsvereinbarungen, die laut Agentur in gewissen Situationen gang und gäbe waren –, heute ihr letzter Arbeitstag in der Pflegeeinrichtung gewesen, in der sie die letzten drei Jahre gearbeitet hatte. Für sie war es auch der letzte Tag Normalität gewesen, denn sie hatte das Undenkbare getan.
Nun, zumindest für sie bisher undenkbar, denn sie hatte stets wie in Angst gelebt.
Keine Furcht vor etwas Bestimmten, aber so ziemlich vor allem, was da draußen lauerte. Sie hatte sich davor geängstigt, aus ihrem Elternhaus auszuziehen, um aufs College zu gehen; Angst vor dem Ende ihrer Ausbildung und dem ersten »richtigen« Job; Angst vorm Fliegen; Angst vor Autobahnfahrten. Sie hatte sich vor jenem ersten Date vor Jahren gefürchtet, das sich als eine ihrer miesesten Entscheidungen entpuppte. Und sie hatte sich geängstigt, den einen Menschen zu verlassen, der ihr tagtäglich kleine Stücke ihres Lebens raubte.
Angst zu haben, bedeutete nicht, dass sie sich nicht zwang, sie zu überwinden, doch für gewöhnlich hieß es, dass sie vor jeder Entscheidung endlos alles analysierte und viel grübelte. Was alles schwieriger machte, und die Dinge zu schaffen, umso wichtiger.
So wollte sie nicht mehr leben – nicht mehr wie eine Siebzigjährige, die vor drei Jahren die Liebe ihres Lebens beerdigt hatte, anstatt sich von ihr scheiden zu lassen, wie sie es tatsächlich getan hatte. Die letzten drei Jahre hatten sich angefühlt, als hätte sie aufgegeben und würde leise einschlummern.
Damit war jetzt Schluss.
Die meisten ihrer Sachen hatte sie schon vorausgeschickt und morgen würde sie in den Flieger steigen.
»Ich bin stolz auf dich«, sagte Anna und drehte sich halb zu Julia um. »Ich werde dich schrecklich vermissen, aber ich bin stolz auf dich.«
»Danke«, antwortete Julia und blinzelte ihre Tränen weg. Sie und Anna waren sich im Laufe der Jahre sehr nahegekommen. Anna wusste, was Julia mit ihrem Ex durchgemacht hatte. Und ihr war klar, was für eine große Sache dies hier für sie war.
Sie neigte sich zu Julia und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dann stützte sie ihr Kinn auf Julias Schulter. »Wann geht dein Flug?«
»Um zehn, und ich muss früh los zum Flughafen.«
»Aber du musst nicht frühmorgens zur Arbeit, und was heißt das?« Sie richtete sich auf und schob Julias Glas an deren Mund. »Zeit, auszutrinken und durchzudrehen, ehe wir beide noch heulend in der Ecke enden wie zwei Loser. Das wollen wir doch nicht.«
»Niemand will das.« Grinsend gehorchte sie dem Befehl. Nun, zumindest in etwa. Julia war keine große Trinkerin, weil ihr die Vorstellung missfiel, keine Kontrolle über sich zu haben. Deshalb hielt sie sich meist an Wein. Nun trank sie ihr Glas aus, und bei der Hälfte des zweiten Glases summte es schon angenehm in ihr.
Einige andere Schwestern kamen an ihren Tisch und Anna verschwand, um auf der anderen Seite der Bar eine Runde Darts zu spielen. Julia versuchte, sie im Blick zu behalten, doch es war spät geworden und in der Bar wurde es voller. Hin und wieder sah sie ihre zierliche blonde Freundin und den Mann, mit dem sie Darts spielte. Er war groß; andererseits wirkte jeder Mann neben Anna groß. Sein dunkles Hemd spannte sich über breite Schultern, wenn er den Arm anhob, um einen Pfeil zu werfen. Selbst aus der Entfernung erkannte Julia, wie wohlgeformt seine Bizepse waren.
Wer er auch sein mochte, er hatte einen netten Rücken.
Kopfschüttelnd konzentrierte sie sich wieder auf das Gewimmel um sich herum. Anna war verheiratet – und das glücklich. Sie war einfach nur sehr kontaktfreudig und fand überall neue Freunde.
Alle redeten über die neuen Eigentümer des Pflegeheims, die es zu Jahresanfang übernommen hatten. Sie hatten sich Sorgen gemacht, waren unsicher gewesen, was der Leitungswechsel langfristig bedeutete. Offensichtlich musste Julia sich nicht mehr sorgen, freute sich jedoch für ihre Kollegen, dass die neuen Besitzer zu wissen schienen, was sie taten.
Da Julia noch nie als freiberufliche Schwester gearbeitet hatte und unsicher war, ob sie es nach diesem Auftrag weiter sein würde, hatte sie keine Ahnung, was sie bei ihren neuen Arbeitgebern erwartete. Sie unterstand der Agentur, durch die sie engagiert worden war, aber auch der Familie, für die sie arbeiten würde.
Sie spielte mit dem dünnen Stiel ihres Glases und verdrängte die Gedanken daran, was morgen passieren würde. Sie war nervös, verständlicherweise, aber sie durfte nicht ausflippen. Andernfalls würde sie Panik bekommen und an sich selbst zweifeln. Jetzt war es ohnehin zu spät, noch irgendwas …
»Julia!«, rief Anna eine Sekunde, bevor sie Julias Arm von hinten umfasste. »Hier ist jemand, denn ich dir unbedingt vorstellen muss.«
O Gott.
Wenn Anna ihr unbedingt jemanden vorstellen musste, handelte es sich meist um irgendeinen exzentrischen Fremden, über den Anna buchstäblich eben erst gestolpert war und den Julia wirklich nicht kennenlernen wollte. Sie unterdrückte ein Stöhnen, drehte sich langsam um und ließ beinahe ihr Glas fallen, als ihr Blick von Annas gerötetem, strahlendem Gesicht zu dem Mann neben ihr wanderte.
Julias Augen wurden größer, während sie den Fremden musterte. Heiliger Bimbam … Ihr Hirn schien einen Kurzschluss erlitten zu haben, der sämtliche nützlichen Gedanken vernichtet hatte. Es war der Mann, mit dem Anna Darts gespielt hatte. Das erkannte Julia an dem dunklen Hemd, das sich als Thermoshirt entpuppte, dessen Ärmel bis zu den Ellbogen hochgeschoben waren. Und der Mann war groß. Nicht nur, weil er momentan neben einer verrückten Elfe stand, sondern er war mindestens einen Kopf größer als Julia, und sie war nicht klein.
Dieser Mann, wer er auch sein mochte, war absolut atemberaubend.
Er hatte etwas Verwegenes an sich. Hohe, breite Wangenknochen und einen wohlgeformten Mund mit einem perfekten Amorbogen. Leichte Bartstoppeln an einem Kinn, das wie aus Marmor gemeißelt wirkte. Sein goldbraunes Haar war oben wellig und an den Seiten kürzer. Julia wettete, dass es bei Tageslicht fast so blond war wie Annas. Und nach dem zu urteilen, was sie sich unter dem Shirt und der dunklen Jeans verbarg, dürfte sein Körper genauso fantastisch sein wie sein Gesicht.
Und diese Augen mit den unglaublich dichten Wimpern? Sie waren eine wunderbare Mischung aus Blau und Grün und erinnerten Julia an warmes Meer und Sommer.
Er stand da, blickte sie an, die Schultern locker, und dennoch hatte sie das seltsame Gefühl, dass er komplett angespannt und bereit war, jederzeit durchzustarten, obwohl alles an ihm entspannt wirkte.
Hatte Anna dieses Prachtexemplar von einem Mann an der Dartscheibe kennengelernt? Julia sollte sich weit häufiger bei diesen Dingern aufhalten, wenn die Typen dort so waren …
»Julia – Julia, das ist …« Annas blaue Augen blitzten vor Aufregung, als sie Julia zu dem schönsten Mann drehte, den diese jemals gesehen hatte. »Entschuldige, wie heißt du noch mal?«
Wie in aller Welt konnte Anna seinen Namen vergessen? Wenn Julia ihn erst einmal gehört hatte, würde er sich auf ewig in ihr Hirn einbrennen.
Nun lächelte er, und Julia nahm es mit jeder Faser ihres Körpers wahr, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen, und ganz besonders an all den lange nicht beachteten Stellen dazwischen. Bei seinem schiefen Lächeln zog sich der linke Mundwinkel etwas weiter nach oben als der rechte, was vollends hinreißend war. »Taylor.«
O Mann.
Seine Stimme.
Tief und samtig mit dem Hauch eines Akzents. Südstaaten? Julia wusste es nicht, aber Taylor wurde immer besser und besser.
»Taylor, richtig.« Anna grinste wie eine Katze, die eben einen Schwarm Kanarienvögel vertilgt hatte. »Jedenfalls ist dies die wunderbare und sehr ledige Julia, von der ich dir erzählt habe.«
Hatte sie das wirklich gesagt? Sehr ledige? War Anna betrunken? Sah sie nicht, wie der Typ aussah? Nicht, dass Julia wie eine menschgewordene Müllhalde aussah. Sie hatte das, was ihre Mutter als »symmetrische Züge« bezeichnete. Ihr Gesicht war gleichmäßig proportioniert und viele Leute fanden ihr Haar großartig. Sehr viele. Manche wollten es gar anfassen, was ziemlich schräg war. Es war lang und fiel in dicken Wellen bis über ihre Brüste. Momentan war es zu einem losen Knoten aufgesteckt. Julia hatte gerade genug Zeit gehabt, sich nach der Arbeit umzuziehen; fürs Frisieren war keine mehr übrig gewesen. Jedenfalls wusste sie, dass sie passabel aussah, aber gewiss nicht wie ein Model – nicht wie die Frauen, die sie sich gut an Taylors Seite vorstellen konnte. Die Art Frau, die entweder groß oder winzig war, aber definitiv schlank mit Kurven an den richtigen Stellen. Die Art Figur, wie Julia sie hatte, war schon nicht mehr in gewesen, als sie damit geboren wurde.
»Hi.« Taylor reichte ihr die Hand. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
Ihr Blick wanderte von seinem Gesicht zu seiner Hand und wieder zurück. Sein schiefes Grinsen wurde breiter, als er wartete, während sie nur dastand und ihn idiotisch anglotzte. Sie erwachte aus ihrer Starre und schaffte es, ihre Hand zu heben. »Freut mich auch.«
Seine Finger umschlossen ihre fest. »Darf ich dir etwas zu trinken spendieren?«
»Ja«, antwortete Anna für sie. »Das darfst du ganz sicher.«
Sie würde Anna umbringen.
Taylor lächelte. »Was hättest du gern?«
Sie murmelte den Namen irgendeines Getränks, von dem sie nicht mal sicher war, ob sie es jemals probiert hatte, und bemerkte, dass er immer noch ihre Hand hielt.
Er trat einen Schritt näher und beugte sich vor, bis sein Mund neben ihrem Ohr war. Als er sprach, strich sein Atem durch ihr Haar und ihr jagte ein Schauer über den Rücken. »Lauf nicht weg.«
Ihr Atem stockte. »Mache ich nicht.«
»Versprochen?« Er drückte ihre Hand sanft.
»Versprochen«, bestätigte sie.
»Gut.« Er wich zurück und schaute ihr für einen Moment in die Augen. »Bin gleich wieder da.«
Jetzt erst ließ er ihre Hand los.
Vollkommen benommen schaute sie zu, wie er sich umdrehte und zum Tresen ging. Die Menge teilte sich für ihn, als sei er so etwas wie ein Gott. In ihren siebenundzwanzig Jahren hatte Julia noch nie einen solch attraktiven Menschen gesehen.
»O mein Gott, ich glaube, ich habe eben einen Orgasmus nur vom Hinsehen gehabt«, sagte Anna.
Julia starrte sie mit großen Augen an, und Anna hüpfte klatschend auf und ab.
»Wo hast du den gefunden?«, fragte Julia. »Hast du ihn bei einem Versand bestellt, der zufällig ›Wie Träume aussehen‹ heißt?«
Anna lachte. »Ich hatte mir etwas zu trinken geholt – Wasser, wie ich hinzufügen möchte – und er hat mich gefragt, ob ich Darts spiele. Natürlich habe ich Ja gesagt. Das musste ich, weil ich wissen wollte, ob er wirklich real ist.«
Was Julia gut verstand. Ihr fiel es ebenfalls schwer zu glauben, dass er real war.
»Jedenfalls habe ich eine Runde mit ihm gespielt, und rate mal, was passiert ist!«
»Was?« Julia blickte über Annas Kopf hinweg und sah, dass Taylor noch an der Bar stand.
Erneut fasste Anna sie am Arm. »Er hat nach dir gefragt, Julia.«
»Was?«
Sie nickte. »Er wollte wissen, wer die schöne Frau ist, mit der ich vorher geredet habe, und die warst du. Keine andere. Und deshalb hatte er mich zum Dartspielen ausgesucht. Ich wurde benutzt.« Sie grinste. »Und das ist in Ordnung für mich. Weißt du, warum?«
Julia hatte Mühe, alles zu begreifen. »Warum?«
»Weil er an dir interessiert ist und es deine letzte Nacht in der Stadt ist, also wirst du mitgehen, wohin er will, und tun, was immer er will. Sprich: alles.« Sie beugte sich vor und senkte die Stimme. »Sogar anal, das würde ich erlauben. O ja.«
»O mein Gott.« Julia lachte. »Du bist wahnsinnig. Ich kenne ihn nicht mal …«
»Mein süßes Sonnenkind«, sagte Anna und Julia runzelte die Stirn. »Du musst ihn nicht kennen, um dich mit ihm zu vergnügen. Der Mann ist fantastisch. Er sieht übermenschlich gut aus und die ganze Zeit über, in der wir Darts gespielt haben, hat er immer wieder zu dir gesehen.«
Hatte er? »Das … das kann nicht wahr sein.«
»Ist es. Julia, ich weiß, dass du eine Durststrecke durchgemacht hast – eine richtig lange Durststrecke – und dass dein Ex ein Arsch war, aber es wird Zeit für dich, deine scharfen Flügel auszubreiten und zu fliegen, Baby. Dieser Mann, dieser sexy Mann ist …«
»Stopp!« Ihr Herz machte einen Hüpfer, als sie sah, wie Taylor auf sie zukam. »Er kommt zurück.«
Anna klappte den Mund zu, doch ihr Blick sagte Julia, dass sie ihr nie verzeihen würde, sollte sie dies hier vermasseln. Ihr blieb keine Zeit, alles richtig zu durchdenken, denn Taylor trat bereits um Anna herum und reichte Julia einen Drink, der fruchtig roch.
»Ich bin froh, dass du noch da stehst, wo ich dich zuletzt gesehen habe«, sagte er und lehnte sich an den Tisch. »Denn ich war in Sorge, dass du wegläufst.«
»Nein«, entgegnete sie und blickte hilflos zu Anna.
»Klar«, erwiderte er grinsend.
Was sollte sie jetzt sagen? Oder tun? Gott sei Dank hatte sie sich ein niedliches schwarzes Kleid angezogen, das eine Empire-Taille und Ärmel bis zum Ellbogen hatte. Es war ein altes Kleid, in dem sie sich seit jeher wohlgefühlt hatte. Wäre sie nur vorausschauend genug gewesen, nicht den Baumwollslip mit den Totenköpfen drauf anzuziehen!
Hilfe.
Warum dachte sie das überhaupt?
Dieser Typ würde ihren Schädelslip nicht zu Gesicht bekommen.
Julia bemerkte, dass Anna sich dezent zurückzog und sie allein ließ. Sie nippte an ihrem Drink und überlegte, was sie sagen könnte, das nicht grenzenlos blöd klang. »Warum solltest du das denken?«
Etwas Besseres fiel ihr nicht ein.
»Ehrlich?« Er senkte die Lider, sodass seine fantastischen Augen kurz abgeschirmt waren. »Du wirkst ein bisschen ängstlich.«
Ihre Wangen wurden heiß. »Ist es so offensichtlich?«
»Dann hast du Angst?«, fragte er und hob die Bierflasche an seinen Mund.
So unmöglich es schien, spürte sie, wie sie noch mehr errötete. »Ich würde nicht behaupten, dass ich Angst habe. Ich bin nur … nur überrascht.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: