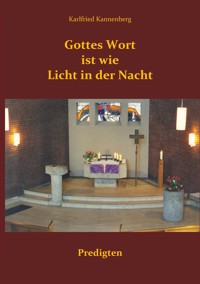
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mit diesem Band legt Karlfried Kannenberg einen Querschnitt durch seine Arbeit als Prediger mit einer großen stilistischen Bandbreite vor. Auf spannend zu lesende Erzählungen folgen tiefsinnige, teils ungewöhnliche Bibelauslegungen. Wichtig ist es ihm, Lebensfragen mit ihrem sozialen Kontext vor einem religiösen Horizont zu deuten und in ihrer spirituellen Dimension zu verstehen. Immer wieder scheint eine ehrliche und persönliche Auseinandersetzung mit dem Rassismus durch, der ihn in seiner Jugend im Südafrika der 1960er Jahre geprägt hat und zu dessen Überwindung er beitragen will. Mit ihrer aufrichtenden Botschaft lassen sich viele Predigten auch wie ein persönliches Trostbüchlein lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet meiner lieben Frau Ulricke, ohne deren ungeteilte Unterstützung ich meinen Beruf als Pastor nicht in dieser Weise hätte ausfüllen können
INHALTSVERZEICHNIS
A ERZÄHLENDE PREDIGTEN
22.1.1989 Matthäus 9,9-13 Septuagesimae Die Berufung des Levi,
17.4.2003 Johannes 13,1-17 Agape am Gründonnerstag Verleugnung des Petrus
27.3.2005 Matthäus 28,1-10 Ostern
B BIBLISCHE PREDIGTEN
21.1.1984 Apostelgeschichte 10,21-35 3. Sonntag nach Epiphanias Der Hauptmann Kornelius
03.11.1985 Matthäus 18,21-31 22. So. nach Trinitatis Der Schalksknecht
29.11.1987 Offenbarung 5,1-14 1. Advent Das Buch mit den sieben Siegeln
23.3.1997 Johannes 12,9-19 Palmarum Einzug in Jerusalem
24.8.1997 Lukas 10,25-37 13. Sonntag nach Trinitatis Der barmherzige Samariter
13.6.1999 Matthäus 22,1-14 2. Sonntag nach Trinitatis Das große Gastmahl
03.2.2002 Apostelgeschichte 16,6-15 Sonntag Sexagesimae Die Purpurhändlerin Lydia
03.3.2002 1. Könige 19,1-13 3. Sonntag der Passion Elia unter dem Wachholder
13.7.2003 Lukas 6,36-42 4. Sonntag nach Trinitatis Splitter und Balken im Auge
06.8.2005 Matthäus 21,28-32 11. Sonntag nach Trinitatis Die ungleichen Söhnen
C PREDIGTEN ZU CHRISTUSFESTEN
24.12.2006 Lukas 2,1-20 Heiligabend Die Weihnachtsgeschichte
23.3.2008 Lukas 24,13-35 Ostern Die Jünger von Emmaus
D PREDIGT MIT SYMBOLMEDITATION
23.2.1997 Markus 12,1-12 2. Sonntag der Passion Der verworfene wird zum Eckstein
E THEMENPREDIGTEN
26.3.1995 Johannes 18,33-38 4. Sonntag der Passion Was ist Wahrheit
02.2.2003 Markus 4,35-41 4. Sonntag nach Epiphanias Sturmstillung / Golfkrieg
30.8.2003 11. So. nach Trinitatis Der Froschkönig
22.5.2011 Patientengottesdienst
F BUNDESSCHLUSS- & EINE-WELT-GOTTESDIENSTE
(
Siehe Anm. 12 & 13)
23.4.1989 Klagelieder 5 - Mental Slavery Bundesdelegiertentagung der Aktion Bundesschluss
12.2.2006 1. Korinther 12,12-27 Eine-Welt-Gottesdienst zum Thema "HIV/AIDS"
10.2.2008 Matthäus 4,1-11 Eine-Welt-Gottesdienst zum Thema "Gentechnik"
15.11.2009 Nehemia 3,38 und Jesaja 61,1-11 Bundesschlussgottesdienst
07.2.2010 Hebräer 4,12-13 Eine-Welt-Gottesdienst zum Thema "Learning tobe white"
14.11.2010 Matthäus 5,13-16 Bundesschlussgottesdienst Salz der Erde / Licht der Welt
G IKONENBETRACHTUNGEN
23.12.2018 Lukas 1,39-56 4. Advent mit Ikonenbetrachtung zur Hodegetria
18.12.2022 Lukas 1,26-38 4. Advent - Verkündigung Mariä mit Bildbetrachtung zu Meister Bertram
H ABSCHIED UND NEUANFANG
28.10.2012 1. Korinther 15,12-20 / Johannes 11,1-27 Predigt zur Verabschiedung aus Oststeinbek
9.12.2012 Jesaja 35,3-10 2. Advent - Zur Einführung als Altenheimseelsorger in Harburg-Süd
VORWORT
Es stand nicht mehr auf der Vorhabenliste für mein Leben, ein Buch zu schreiben. Aber die zwölf Aktenordner mit ausgearbeiteten Predigten, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, betrachte ich in gewisser Weise als Teil meines Lebenswerkes - vor allem diejenigen aus den 25 Jahren von 1988 - 2012 in Oststeinbek. Daraus wollte ich gerne eine Quintessenz meines theologischen Denkens zusammenstellen. Dabei ist diese Sammlung entstanden. Als Literatur zur Vorbereitung habe ich hauptsächlich die Göttinger Predigtmeditationen1 und die Predigtstudien aus dem Kreuzverlag2 benutzt. Hier und da habe ich zuweilen einen ganzen Absatz daraus übernommen. Da ich in meinen Predigtmanuskripten selten Vermerke zu solchen Quellen gemacht habe, ist es mir jetzt gar nicht mehr möglich, solche übernommenen Passagen als Zitate zu kennzeichnen und die Quellen anzugeben. Aber diese Sammlung ist ja weder eine Veröffentlichung in dem Sinne noch eine wissenschaftliche Arbeit sondern dokumentiert Predigten, so wie ich sie mir erarbeitet und am angegebenen Sonntag gehalten habe. Die drei Predigten von 1984 - 1987 habe ich in meiner ersten Gemeinde in Hohenlockstedt gehalten. Es war mir stets bewusst und hat mir auch viel bedeutet, dass meine Wirkungsstätten die letzten beiden Kirchen des (geist-)begabten Kirchbaumeisters Olaf Andreas Gulbransson waren, die posthum vollendet wurden (Die Dreifaltigkeitskirche in Hohenlockstedt 1965 und die Auferstehungskirche in Oststeinbek 1966). Diese "Predigten aus Stein" mit Leben zu füllen, war mir eine besondere Bestimmung.
Dezember 2023
Karlfried Kannenberg
A. ERZÄHLENDE PREDIGTEN
Predigt zu Matth. 9, 9 – 13 Septuagesimae 22.1.1989 (Die Berufung des Levi) 3
Kapernaum ist ein kleines Städtchen oben in Galiläa am See Genezareth. Schon früh haben wir hier von einem neuen Propheten gehört. Jesus ist sein Name. Er soll auch hier im galiläischen Bergland aufgewachsen sein. Ich glaube in Nazareth. Das erste Mal hörte ich von ihm, als es bei uns in Kapernaum in der Fischerkolonie große Unruhe gab. Simon und Andreas hatten einfach die Fischerei aufgegeben, um sich der Jesus-Bewegung anzuschließen. Besonders hart traf es dann den alten Zebedäus, als seine kräftigen Söhne, Johannes und Jakobus ihn verließen, um sich dem neuen Propheten anzuschließen. Nun musste Zebedäus in seinem Älter wieder alleine aufs Meer rausfahren und seinen Fang mit den angeheuerten Tagelöhnern teilen, wo er sich doch bald zur Ruhe setzen wollte. Ich hab das damals nicht verstanden. Denn von der Fischerei konnte man doch leben. Gewiss, man konnte dabei nicht reich werden, aber man hatte doch immerhin sein Auskommen, um das einen viele beneideten. Bei den kleinen Bauern war das Leben viel härter. Davon kann ich ein Lied singen. Denn früher gehörte ich selbst dazu. Die römischen Steuereinnehmer forderten hart und rücksichtslos ihren Tribut. Uns blieb oft wenig genug zum Essen. Und dann kamen zwei trockene Sommer hintereinander, in denen die Ernte knapp ausfiel. Schon im ersten Jahr mussten wir schließlich das Saatgut essen, als unsere sonstigen Vorräte aufgebraucht waren. Für die neue Aussaat mussten wir uns dann beim Händler neues Saatgut leihen, als es am teuersten war. Als dann auch die zweite Ernte der Dürre zum Opfer fiel, bedeutete es für mich den Garaus. Ich habe noch selbst mit meinen beiden Jungs ihre Taschen gepackt, damit sie in die Berge fliehen konnten. Dort haben sie sich den Zeloten angeschlossen, einer bewaffneten Brigade im Untergrund, um die Römer zu vertreiben, die uns so viel Elend gebracht hatten. Wären sie nicht geflohen, so wären sie mit uns in die Sklaverei verkauft worden.
Ja, - das war ein bitterer Abschied damals. Mein ganzes bisheriges Leben brach zusammen. Wir verloren Haus und Hof und mussten auch die Dorfgemeinschaft verlassen. Wen wundert es, dass meine Frau zwei Jahre später starb vor lauter Gram.
Als nach sieben Jahren meine Schuld getilgt war, und ich entlassen wurde, ging ich mittellos nach Kapernaum. Ich wurde angesehen wie ein Stück Dreck. Den Verlust an sozialer Geltung kann wohl nur der nachempfinden, der selbst Ähnliches erlebt hat. Das tat weh genug. Schlimmer noch war aber die Angst. Ich war unversorgt. Wovon sollte ich leben?
Während ich so ohne Ziel und Hoffnung durch Kapernaum schlenderte - meine Selbstachtung verbot es mir noch, mich einfach an den Straßenrand zu setzen und zu betteln - da traf ich Timäus. Er war Zollpächter am Südtor und sah sehr verhärmt aus. Die Pöbeleien der Händler machten ihn fix und fertig, sagte er mir. Er könne kaum die Jahrespacht für die Römer zusammenkratzen und jeden Tag dieser psychische Druck am Tor. Er könne es nicht länger aushalten. Am liebsten würde er einen Gehilfen einstellen. Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, dass es mir die Sprache verschlug. Als sich meine Versteinerung löste, muss ich wohl ziemlich gestammelt haben. Ich fragte ihn, ob ich denn nicht als Gehilfe in Frage käme. Ich merkte, wie meine Frage auch ihn traf. Er sagte eine ganze Weile lang gar nichts, bis seine Miene sich erhellte. Er hielt mir seine Hand entgegen und ich schlug ein. So kam es, dass ich Zolleinnehmer wurde. Zunächst war ich nur sein Gehilfe. Nach einigen Jahren konnte ich sogar seine Pacht übernehmen.
Das Leben an der Zollstätte war hart. Es trieb mich tiefer in die Isolierung. Die Händler hassten mich von Berufs wegen. Die vornehmen und gebildeten Leute ließen mich ihre Verachtung spüren, denn ich kam ja aus bescheidenen Verhältnissen. Bei den Patrioten war ich als Römerfreund verschrien. Wenn sie nur wüssten, dass meine Jungs bei den Zeloten waren, und wie sehr sie mir Unrecht taten! Die Armen beneideten mich um mein Einkommen und zu den Zöllnern an den anderen Stadttoren herrschte eine scharfe Konkurrenz. Nein, Freunde hatte ich keine. Aber die hatte ich schon vorher verloren. Ich war dennoch froh. Denn mit dieser neuen Existenz war mein Leben gerettet.
Jesus ging öfter in Kapernaum ein und aus. Die Schwiegermutter des Petrus wohnte noch hier, auch der alte Zebedäus. Selbst beim Hauptmann war er einmal eingekehrt. Eines Tages blieb Jesus vor meinem Zollhaus stehen, sprach mich an und sagte: Matthäus, folge mir nach. Ich war wie vom Donner gerührt. Seit Ewigkeiten hatte sich keiner mehr persönlich für mich interessiert. Allen war ich durch meinen Beruf zum Gegner oder Feind geworden. Gradlinig schaute er mich mit seinen dunklen, braunen Augen an. Er strahlte eine tiefe Wärme aus und weckte in mir Vertrauen. Ich fand ihn sehr kraftvoll und auch mutig. Denn ausgerechnet meine Gefolgschaft wurde das Prestige und das Ansehen seiner neuen Bewegung nicht gerade heben. Doch dann packte mich die Angst. Es war die gleiche Angst wie damals, als wir unseren Hof verloren. Die Angst ummeine Existenz. Wie mühsam hatte ich mir hier nicht wieder einen Platz aufgebaut, an dem ich mein Auskommen hatte. Wie viele Verunsicherungen hatte ich besonders in der Anfangszeit durchlitten. Wie viele Beschimpfungen hatte ich nicht ertragen müssen. Aus wie vielen Fehlern hatte ich nicht lernen müssen, bis ich endlich genügend Fingerspitzengefühl bei gleichzeitiger Härte entwickelt hatte, um zu wissen, wie viel Zoll ich bei den verschiedensten Passanten eintreiben konnte. Nur langsam hatte ich Routine entwickelt in diesem schwierigen Geschäft. Und nun hatte ich meine Sicherheit innerlich und äußerlich. Sollte ich das alles wieder aufgeben??? Sollte ich noch einmal ganz von vorne anfangen?
Doch andererseits machten mich diese ständigen Geldgeschäfte kaputt. Es war ein täglicher Krieg. Ständig zähe Verhandlungen, Auseinandersetzungen mit harten Bandagen, unflätige Worte, verletzende Beleidigungen.. Nie durfte ich auch nur einen Hauch von Schwäche erkennen lassen. Und doch musste ich meinen Zorn zügeln, damit sich die Konflikte nicht allzu sehr steigerten. Denn ich hatte niemanden, der mir zur Seite stand. Und dann immer noch der Druck seitens der Römer, deren Forderungen auch ständig stiegen. Nein, auch wenn ich es wieder zu einem kleinen Vermögen gebracht hatte, unter der Macht des Geldes gab es kein wirkliches Leben. Auch wenn ich gelernt hatte, wie eine Maschine zu funktionieren, fühlte ich mich doch wie lebendig begraben.
Ich muss blind gewesen sein. Ja, es war blindes Vertrauen, aus dem heraus ich dann den Schritt tat. Ich kämpfte meine Angst und meine Bedenken nieder. Dieser Jesus hatte mich irgendwie überwältigt. In mir wuchs die Überzeugung, dass die ganze Welt und mein ganzes Leben grundverkehrt waren. Es kann doch nicht Ziel des Lebens sein, dass einer den anderen ausquetscht und unterdrückt, und die Schwächsten dabei auf der Strecke bleiben. Es kann doch nicht Gottes Wille sein, dass jeder Mensch dem anderen zum Feind wird. Ich sehnte mich nach einem neuen Leben in Gemeinschaft, Frieden und Gerechtigkeit. Ich stand auf und folgte ihm nach.
Ich erwartete nun, dass Jesus uns bald belehren würde mit seinem Programm, wie man die Menschen und die Welt verbessern könnte. Ich wollte mir seine Ziele zu eigen machen. Doch Jesus sammelte zunächst noch weitere schäbige und anstößige Gestalten. Verzeihung! Das klingt so abwertend und herablassend. Und ich gehöre ja schließlich auch dazu. Doch wenn ich ehrlich bin: ich hatte es durchaus auch so gemeint. Aber es war wie ein Wunder, wie diese verachteten und ehrlosen Menschen ihre Würde und ihr Selbstvertrauen wiedergewannen, wenn Jesus sie als Würdige ansprach.
Am Abend gab es keine programmatische Belehrung. Keine großen Reden. Jesus wollte mit uns ein Fest feiern. Ich bot ein letztes Mal mein Haus an. Ich ließ es mir nicht nehmen, ein großes Festessen herzurichten. Wie lange hatte ich das nicht entbehren müssen? Ich schaute mich im Kerzenschein in der Runde meiner Gäste um. Mit vielen hatte ich schon meine Auseinandersetzungen gehabt. Hier saß ich nun mit meinen Neidern und Konkurrenten an einem Tisch. Während Jesus das Brot brach und es herumreichte, ging mir auf: Mensch! Das Neue Leben hatte schon begonnen. Gestern noch wäre diese Gesellschaft völlig undenkbar gewesen. In mir wuchs die Überzeugung: ein Leben in Gemeinschaft, in Frieden und Gerechtigkeit ist möglich. Wir müssen es nur tun. Der Anfang ist schon da.
Erzählpredigt: Johannes 13,1–17 zur Agape 17.4 2003 (Verleugnung des Petrus)
Ich erinnere mich noch sehr genau an den Abend damals. Es war der letzte gemeinsame Abend mit Jesus. Wir wollten miteinander das Passahfest feiern. Als wir uns gerade zu Tisch niedergelassen hatten, band sich Jesus die Schürze eines Dieners um und kam mit einer Wasserschüssel wieder. Er fing an, uns die Füße zu waschen wie ein Hausdiener. Ich war völlig perplex. Ich konnte diesen peinlichen Anblick kaum ertragen. Dieser Jesus, von dem ich glaubte, dass er der Gesalbte aus dem Königshaus Davids war! Er konnte so glänzende und ermutigende Reden halten. Er konnte einen richtig in seinen Bann ziehen. Er sollte uns im Kampf gegen die Römer anführen. Unsere Schlachtreihen sollte er ordnen und uns endlich von der Ausbeutung befreien und in die Freiheit führen. Ich war von ihm begeistert. Ja, ich himmelte ihn an. Und jetzt ließ er sich herab zu dieser erniedrigenden Arbeit. Das ging mir völlig gegen den Strich. Er gehörte doch ans Kopfende der Tafel und nicht zu unseren Füßen. Als er zu mir kam, weigerte ich mich: „Du willst mir die Füße waschen? Niemals!“ rief ich entrüstet. „Eher umgekehrt: ich dir!“ Aber Jesus blieb beharrlich. Er sagte: „Wenn ich nicht deine Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir.“ Ich fasste mich an den Kopf. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wie wollte er sich denn auf diese Art durchsetzen? So verlor er doch den ganzen Respekt seiner Anhänger. Während ich noch kopfschüttelnd da saß, sagte Jesus: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ Das verstehe, wer will.
Das war nicht das erste Mal, dass er mich ziemlich durcheinander gebracht hat. Schon früher einmal hatte ich ihm gegenüber die Überzeugung ausgesprochen, dass er der Messias sei, der den Thron Davids wieder aufrichten würde. Das war ein feierlicher Augenblick. Er schaute mir tief in die Augen, sprach mich mit vollem Namen an und sagte: "Simon, Sohn des Jonas, das weißt du nicht aus eigener Erkenntnis, sondern mein Vater im Himmel hat es dir eingegeben." Ich war ziemlich stolz auf mich und ich wollte ihm zeigen, dass er sich auf mich verlassen konnte. Ich hatte mir ein neues Schwert schmieden lassen, dass ich unter meinem Mantel versteckt immer bei mir trug. Das war nicht ganz ungefährlich. Denn die Römer duldeten keine Waffen bei uns aus Angst vor einem Aufstand. Damit hatten sie ja auch nicht ganz Unrecht. Ich war jedenfalls auf die große Schlacht vorbereitet und wollte an vorderster Front mitkämpfen. Doch schon damals wunderte ich mich. Kaum hatten wir uns zu ihm als Messias, als vorbestimmten König bekannt, da fing er an zu lamentieren, dass er wohl als erster sein Leben lassen würde. Ich verstand das nicht. Ob er plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekommen hatte? Ich nahm ihn beiseite und versuchte, ihm ins Gewissen zu reden: „Was soll denn das jetzt? Erst sammelst du so eine eindrucksvolle Menge um dich und jetzt machst du alles wieder kaputt. Du als Hoffnungsträger, als göttlicher Feldherr – tot. Allein so ein Gerede demoralisiert doch die ganze Truppe.“ Wisst Ihr, was er mir damals geantwortet hat? Ich spüre den Schmerz in meiner Brust noch heute wie einen Stich ins Herz. „Weiche von mir Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist.“ Satan sagte er! ... zu mir. Ich wusste gar nicht, was ich nun schon wieder Falsches gesagt hatte.
Am letzten Abend ging es mir nicht viel besser. Jesus hatte wieder einmal Zweifel an unserer Gefolgschaft und unserm Durchhaltevermögen geäußert. Da beteuerte ich ihm meine absolute Loyalität und meine Entschlossenheit zu kämpfen. Ja, ich war bereit, mein Leben zu riskieren und für ihn zu sterben. Wisst Ihr, wie er darauf reagierte? Er sagte mir direkt ins Gesicht, dass ich ihm die Treue versagen würde. Auch ich würde desertieren, und abstreiten, ihn überhaupt zu kennen. Ha! Das sollte mir nicht passieren. Seit dem Augenblick war meine rechte Hand jederzeit bereit, zum Schwert zu greifen. Ich wollte an seiner Seite kämpfen bis zum Tod.
In der Nacht, als die Soldaten der Tempelwache uns in Gethsemane abfingen, da war ich gleich zur Stelle. Ich hatte zwar ein ziemlich mulmiges Gefühl, als wir das Waffengeklirr aus der Ferne hörten. Als ich die gewaltige Überzahl der anderen sah, kriegte ich es richtig mit der Angst zu tun. Aber Jesus würde ja, sobald es losging, die himmlischen Heerscharen zum Einsatz bringen. Also biss ich die Zähne zusammen. Nein, ein Verräter, ein Deserteur war ich nicht. Gleich bei der ersten Feindberührung, noch bevor der Einsatzbefehl gegeben wurde, machte ich den ersten Gegner nieder. In der Aufregung traf ich nicht gleich richtig, sondern schlug ihm nur ein Ohr ab. Aber Jesus blies den Kampf sofort ab und sagte zu mir: „Stecke dein Schwert weg; denn wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen.“ Das begreife einer! Wieder stand ich Kopf schüttelnd daneben. Jetzt war die Stunde der Bewährung da – und Jesus ließ sich einfach so – kampflos und gewaltfrei – abführen.
Plötzlich stand ich ganz alleine da. Die anderen Jünger waren offensichtlich alle weggelaufen. Jedenfalls war keiner mehr zu sehn. Verwirrt, unschlüssig und zögernd ging ich dem Waffengeklirr nach, das sich die dunkle Pflasterstraße hinab auf den Gerichtshof zu bewegte. Ich wollte zu diesem Jesus von Nazareth stehen. Ich wollte ihn verteidigen. Doch wie sollte ich das anstellen. Was konnte ich vor dem Hohen Rat schon ausrichten. Paragraphenchinesisch ist nicht mein Metier. Ich bin Fischer.
Im Vorhof zum Gerichtsgebäude war es feucht und kalt. Zum Glück war es etwas windgeschützt. Das flackernde Licht eines kleinen Feuers zog mich an. Menschen standen darum und wärmten sich. Ich stellte mich in die zweite Reihe dazu. Es waren Hofknechte und Mägde, Gerichtsdiener und ein paar Wachen. Ich merkte sehr schnell, aus welcher Richtung der Wind ideologisch her wehte. Eine einzige Hetze gegen unsere Befreiungsbewegung. Mörderbande wurden wir beschimpft. Jesus gehöre als Terroristenführer ans Kreuz. Ich kriegte vor Beklemmung kaum noch Luft. Es war kaum auszuhalten. Nur nicht auffallen, sonst ist es aus, dachte ich bei mir. Und dann kam da diese Frau – diese dumme Ziege. Ich möchte mal wissen, woher sie mich kannte. Sie rief mir einfach vor versammelter Mannschaft ins Gesicht: „Du bist doch auch einer von diesen galiläischen Terroristen. Man erkennt dich doch schon von weitem an deinem Dialekt.“ Plötzlich stand ich im Mittelpunkt des Geschehens. Alle drehten sich zu mir um und ich fühlte, wie ihre stechenden Blicke mich durchbohrten.
Auf einmal konnte ich meiner Gefühle nicht mehr Herr werden. Ich wurde übermannt von Panik. Das ganze Gerede von Heldenmut und Tapferkeit half nicht mehr. Es war, als wäre ich plötzlich überflutet von Angst, die ich vorher nie spüren durfte... als wäre ein Schutzdeich gebrochen. Die ganzen Parolen meiner Männlichkeitserziehung versagten: „Ein Junge weint doch nicht. Ein Galiläer kennt keinen Schmerz. Beiß die Zähne zusammen. Kopf hoch, Junge.“ Es funktionierte einfach nicht mehr. Es war als hätte ich gar keine Zähne mehr zum Zusammenbeißen... als hätte ich gar keinen Kopf mehr zum Hochhalten. Kopflos stürzte ich davon und rannte und rannte und rannte. Und doch konnte ich meiner eigenen Angst nicht davonlaufen. Ich war am Ende der Tapferkeit angelangt. Ich hatte versagt. Ich hatte es nicht geschafft, bei Jesus auszuhalten. Im Laufen hörte ich noch den Hahn krähen. Aber das war jetzt auch egal.
Ich fand bei Freunden von Simon Zelotes Unterschlupf. Ich warf mich auf mein Nachtlager und heulte. Ich heulte wohl drei Tage und drei Nächte lang. Es strömten die Tränen aus mir heraus, die dreißig Jahre lang nicht strömen durften. Ich fühlte den Schmerz, den ich dreißig Jahre lang nicht fühlen durfte. Ich erlebte meine eigene Schwachheit, die ich dreißig Jahre lang nicht wahr haben wollte.
Und dann veränderte sich etwas. Auf dem tiefsten Punkt der Verlassenheit spürte ich eine geheimnisvolle Nähe. Der Christus, dem ich davon gelaufen war, war mir nachgeeilt. Der Christus, dem ich die Treue nicht halten konnte, war mir treu geblieben. ER WAR DA – und richtete mich auf. Am tiefsten Punkt meiner Schwachheit spürte ich seine Kraft in mir wachsen. Langsam begann ich das Geheimnis von Schwachheit und Niedrigkeit zu begreifen. Ich fing an zu begreifen, warum Jesus nicht auf Stärke setzte. Ich fing an zu begreifen, warum er auf Gewalt verzichtete und Leiden in Kauf nahm. Ich fing an zu begreifen, warum er Erniedrigungen auf sich nahm und Niedrigkeit zu seinem Weg dazu gehörte. Jetzt begriff ich, warum er sich dazu erniedrigt hatte, um mir die Füße zu waschen. Er hatte sich vor mir auf den Boden gesetzt! Doch um das zu begreifen, dazu musste ich selbst erst einmal zu Grunde gehen. Am Boden zerstört, fand ich neuen Boden unter meinen Füßen, auf dem ich wieder gehen konnte... auf neuem Grund, neue Wege, andere Wege. Ach, hätte ich es doch damals schon begriffen, als er noch bei uns war. Aber damals war ich noch nicht so weit.4
Predigt zu Matthäus 28, 1-10 Ostern 27.03.2005
Liebe Gemeinde,
Ich habe einmal versucht, mich in die Rolle der Maria Magdalena hineinzuversetzen. Wie mag sie diesen Ostermorgen wohl erlebt haben? Ich will davon erzählen.
Es war noch dunkel. Eigentlich war es noch Nacht, als ich mich mit Maria, der Schwester von Lazarus auf den Weg zum Grab machte. Noch am Freitag hatten wir Salbe eingekauft. Wir haben ein Vermögen dafür ausgegeben. Fast alles, was wir gespart hatten. Aber für Jesus war uns nichts zu teuer. Doch dann, um sechs Uhr hatte der Sabbat begonnen, und wir durften die heilige Zeit des Feiertages nicht stören. Also gingen wir nach Hause. Wir ließen unseren Tränen freien Lauf. Wir haben fast den ganzen Tag geweint und die halbe Nacht. Zum Schluss war es so, als hätten wir keine Tränen mehr, die wir weinen könnten, und unsere Trauer ebbte in trockenes Schluchzen. Wir waren erschöpft und konnten doch kaum schlafen. Meine Seele brannte vor Schmerz. Als sie Jesus in die Grabhöhle legten, da dachte ich bei mir: Eigentlich könnt ihr mich auch gleich mit ins Grab legen. Ohne Jesus will ich auch nicht mehr leben. Er war ja mein ein und alles.
Bevor ich Jesus kennen gelernt hatte, war ich krank gewesen, schwer krank an meiner Seele. Bei uns im Dorf, in Magdala, munkelten die Leute, ich wäre von bösen Geistern besessen. Alle schauten mich scheel an, nur weil ich noch nicht verheiratet war. Ich hatte einfach noch nicht den richtigen Mann getroffen und meinen Platz im Leben noch nicht gefunden. Alles, mein ganzes Leben, ja die ganze Welt erschien mir völlig sinnlos. Wenn ich morgens aufwachte, fühlte ich mich schwer wie Blei. Nur schwer kam ich aus dem Bett hoch. Es gab ja auch keinen Grund aufzustehen. Mit Mühe schleppte ich mich über den Tag. Alles war grau in grau. Und mit dem Gefühl großer Leere legte ich mich abends wieder schlafen, wenn ich denn Schlaf finden konnte. So waren Monate vergangen, Jahre. Und dann hörte ich, dass Jesus durch unser Dorf kommen würde. Ich hatte schon von ihm gehört, dass er Wunder vollbracht hatte und Menschen heilte. Die Hoffnung, ihn zu sehen, brachte wieder Licht in mein Leben. Als ich ihn dann traf, war es, als hätte er mir das Leben neu geschenkt. Alles Schwere fiel von mir ab. Der graue Schleier, der alles umgeben hatte, wich und meine Augen konnten die Farben wieder sehen. Meine Seele fing an zu singen und konnte wieder Freude empfinden. Von dem Tag an, versuchte ich, so viel Zeit wie irgend möglich mit Jesus zu verbringen. Ich wollte nicht mehr ohne ihn sein. Ich folgte ihm auf Schritt und Tritt (soweit das möglich war und sich schickte.)
Und jetzt, mit dem Karfreitag, war plötzlich alles aus. Ich fühlte mich wie lebendig begraben. Sinnlosigkeit breitete sich in mir aus, wie damals in den endlosen Tagen in Magdala. Nur eins war jetzt anders: Ich hatte die Farben schon einmal gesehen und das Leben geschmeckt. Die Hoffnung, die Jesus in mein Leben gebracht hatte, und die Erinnerung an ihn, die konnte mir niemand nehmen. Und so konnten wir es kaum abwarten, dass der Sabbat endlich vorüber war. Wir wollten zu Jesus. Wir wollten zum Grab. Wir wollten ihm noch einmal etwas Gutes tun, auch wenn er dadurch nicht wieder lebendig werden würde.
Unterwegs fiel uns ein, dass das Grab mit einem riesigen Stein verschlossen war. Wer würde uns helfen, den Stein beiseite zu rollen, den Stein vom Grab, und den Stein von unseren Herzen? Da erinnerten wir uns an die Wachen, die aufgestellt worden waren. Vielleicht würden die uns helfen?
Als wir dann am Grab angekommen waren, da mussten wir uns doch sehr wundern. Es war geradezu unheimlich. Der Stein war schon beiseite gerollt und aus der Graböffnung schien ein fahles Licht. Wir waren gar nicht die ersten. Mit zitternden Knien wagten wir uns weiter vor. „Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst,“ begrüßte uns eine Stimme. Wir erschraken. „Ich weiß, was ihr hier sucht. Ihr sucht Jesus, den sie ans Kreuz genagelt haben. Er ist nicht hier. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat.“ Wir gingen hinein und sahen dort die Leinentücher, in die sie Jesus gewickelt hatten. Aber ihn sahen wir nicht. Wir begriffen nicht gleich, was das zu bedeuten hatte. Da hörten wir wieder die Stimme zu uns sagen: „Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: ‚Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen.‘ Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen.“ Ich war wie vom Donner gerührt. Ich traute mich gar nicht, weiter zu fragen. Es durchzuckte mich wie ein Erdbeben und alles Schwere fiel von mir ab. Ich machte auf dem Absatz kehrt und fing an zu laufen. Erst nach einer ganzen Weile beruhigten sich meine Schritte und ich hörte Maria neben mir keuchen. Wir sprachen kein Wort miteinander. Was hätten wir auch sagen sollen. Unterwegs kam uns ein Mann entgegen, der auch schon zu dieser Stunde unterwegs war. Es überraschte mich, dass er uns einfach ansprach, da wir ihn doch nicht kannten. „Maria,“ grüßte er. Ich blieb wie angewurzelt stehen und erkannte an der Stimme, dass es Jesus war. Ehe ich etwas erwidern konnte, sagte Jesus: „Ihr braucht keine Angst zu haben. Geht und sagt meinen Jüngern, dass ich auferstanden bin. Sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.“ Jetzt hatte ich ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Mit Maria rannte ich weiter zurück nach Jerusalem. Völlig außer Atem kamen wir zum Versteck der Jünger und erzählten ihnen alles, was wir gesehen und gehört hatten. Sie wollten uns zunächst nicht glauben. Da war ich sehr enttäuscht. Aber dann war es mir auch egal. Ich hatte ihn gesehen - und nun war ich wie verwandelt. Es war wie damals, als er mich von meiner Schwermut geheilt hatte. Die Trauer fiel mir wie ein schwerer Stein vom Herzen. Ich konnte wieder frei atmen. Ich musste nicht mehr nach Sinn suchen und nach Sinn fragen. Das Leben erschien mir einfach wieder bunt und schön. Ja, nachdem ich selbst am Boden zerstört war, stand ich nun selbst wieder auf zu neuem Leben. Das war wie eine Auferstehung – meine Auferstehung zu neuem Leben!
B. BIBLISCHE PREDIGTEN
Predigt zu Apostelgeschichte 10, 21-35 am 3. Sonntag nach Epiphanias am 22.1.1984 (Der Hauptmann Kornelius)
Liebe Gemeinde!
Petrus bekehrt einen Heiden. Lange bevor der Apostel Paulus als der große Heidenmissionar auf der Bühne der urchristlichen Missionsarbeit auftritt, traut sich Petrus auf dieses schwierige Feld. Wie groß die Schwierigkeiten waren, lässt die lange, sorgfältige und gut begründete Erzählung des Lukas noch sehr deutlich erkennen. Nach dem Pfingstereignis, dem Empfang des Heiligen Geistes, gründeten die Jünger Jesu die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. Dabei blieben die Christen überzeugte Juden. Die jüdischen Reinheitsgesetze, die jüdischen Gebetsstunden, die jüdischen Bräuche und Feste blieben ihnen wert und teuer. Nur das Neue begann sie von den Juden in der Synagoge zu trennen: Das Evangelium von Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn. Aber für diese neue Botschaft wollten sie ja die Juden, das ganze Volk Gottes gewinnen. Und sie waren überzeugt: Wenn ein Heide Christ werden wollte, dann musste er zuerst ein guter Jude werden mit all den Bedingungen und Schwierigkeiten, die das bedeutete. Die Christen in Jerusalem waren eben Judenchristen. Sie blieben ganz bewusst Juden und bewahrten ihre jüdische Tradition, aber in Erweiterung durch die Nachfolge Jesu Christi, dessen Leben, Sterben und Auferstehen sie miterlebt hatten.
Während Petrus auf einer Reise durch die urchristlichen Gemeinden in Joppe am Mittelmeer verweilt, kommen zwei Fremde auf ihn zu. Petrus erkennt sie gleich als römische Soldaten - also Heiden. Aber Petrus versucht nicht, ihnen aus dem Weg zu gehen. "Hier bin ich", sagt er, als er merkt, dass sie ihn suchen. "Welches Anliegen habt ihr an mich?" Er zeigt gleich große Bereitschaft, die Fremden anzuhören. Sie antworten bereitwillig: "Kornelius, unser Hauptmann, ist ein frommer und gottesfürchtiger Mann. Er steht der jüdischen Gemeinde nahe und genießt dort ein hohes Ansehen. Während einer Gebetsstunde erschien ihm ein heiliger Engel, der ihm Weisung gab, dich in sein Haus nach Cäsarea kommen zu lassen. Von dir soll er weitere Mitteilungen empfangen."
Der Fußmarsch nach Cäsarea ist weit. So lädt Petrus die Fremden ein, bei ihm zu übernachten, und er bewirtet sie gastfreundlich. Für uns hört sich das ganz natürlich an. Für Petrus und für die anderen Christen in Joppe ist das etwas Ungeheuerliches. Petrus nimmt diese Ausländer auf. Er bricht damit alle Apartheidgesetze seiner Zeit. Mehr noch. ER SITZT MIT IHNEN ZU TISCH! Er isst gemeinsam mit diesen Heiden, die nicht zwischen reinen und unreinen Speisen unterscheiden können. Die Milch- und Fleischspeisen nicht streng voneinander trennen und für die sich Schweinefleisch und Rindfleisch allenfalls im Geschmack unterscheiden. Petrus erinnert sich nämlich an einen Traum, den er kurz vorher hatte. Es war um die sechste Stunde (also 12 Uhr mittags) und er war schon hungrig geworden. Vor der Mahlzeit wollte er jedoch noch das jüdische Mittagsgebet halten. Während er den Herrn anrief, sah er den Himmel sich öffnen und er sah ein großes Gefäß vom Himmel zur Erde herabkommen. Es sah aus wie ein großes Segeltuch, das an den vier Zipfeln zur Erde herabgelassen wurde. Darin wimmelte es von allerlei vierfüßigen und kriechenden Tieren und Vögeln des Himmels - reine und unreine Tiere unentwirrbar durcheinander. Da hörte Petrus eine Stimme vom Himmel, die sprach zu ihm: "Steh auf, Petrus, schlachte und iss!" "Niemals, o Herr," entgegnete Petrus, "denn noch nie im Leben habe ich etwas Unreines gegessen." Da ertönte die Stimme ein zweites Mal: "Was Gott als rein erklärt hat, das sollst du nicht unrein nennen."
Petrus hat lange über diesen Traum nachgedacht und gegrübelt. Endlich versteht er den Sinn. Er soll die Menschen nicht unterscheiden in Reine und Unreine, auch wenn er dadurch die Reinheits- und Speisevorschriften seiner jüdischen Vorfahren verletzt.





























