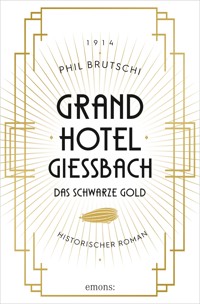Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Grandhotel Giessbach
- Sprache: Deutsch
Ein facettenreicher historischer Spannungsroman – aktueller denn je. 1910: Europa gleicht einem Pulverfass, der Erste Weltkrieg steht kurz bevor. Im abgelegenen Schweizer Grandhotel Giessbach tagt die Orion-Gesellschaft für Fortschrittsfragen, eine elitäre Verbindung mit weitreichendem Einfluss. Ihr will der junge Ingenieur Carl Lohser sein neuartiges Elektroautomobil präsentieren. Er ahnt nicht, dass einige Mitglieder der Gesellschaft nicht das sind, was sie vorgeben. Hinter verschlossenen Türen wird ein Komplott geschmiedet, das Europa bis ins Mark erschüttern könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Geboren 1977 und aufgewachsen im Schweizer Kanton Aargau, arbeitet Phil Brutschi seit 2001 als Bauingenieur und Senior Projektleiter. Parallel schuf er zahlreiche Songtexte, Sketche, Drehbücher und Skripte für Werbe- und Filmproduktionen.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, andere nicht. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/alex74, shutterstock.com/Verlion
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Karte: Staatsarchiv des Kantons Bern, AA 2280 (bearbeitet)
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-9604-1776-7
Historischer Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Unglück macht Menschen,Wohlstand macht Ungeheuer.
Victor Hugo: »Les Misérables«
PROLOG
Montag, 9. Mai 1910, später Nachmittag
Claudette juckte es an fünf Stellen ihres Körpers, aber sie wagte es nicht, sich zu kratzen. Sie kauerte auf einer Mischung aus Kies, Staub und undefinierbarem Moder, in dem vereinzelte braune Gräser steckten. Claudette konnte sich keine Vorstellung machen, wie in dieser schattigen Welt jemals hatten Pflanzen sprießen können. Spinnweben und Fetzen von etwas, was vermutlich einst Spinnweben gewesen waren und jahrelang Dreck und Insektenpanzer gesammelt hatte, hingen von den Holzdielen, die sich unmittelbar über ihrem Kopf hinzogen. Der Rock ihrer Mägdeuniform war ihr bis zur Wade hochgerutscht, und sie hatte das Gefühl, als krabbelte und wuselte das Ungeziefer überall um sie herum.
Unbedeutende Widrigkeiten, mahnte sie sich durchzuhalten.
Dass Claudette das erste Opfer in einer Reihe von Opfern sein sollte, die die gerade erst beginnende »Giessbach-Affäre« noch forderte, konnte sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Erste Opfer ahnten nie, was das Schicksal für sie bereithielt. Und doch hätte Claudette die Gefahr, der sie sich gerade aussetzte, besser einschätzen sollen. Je höher das Risiko, umso höher der Ertrag, hieß es zwar immer, und daran hielt sie eisern fest, aber manchmal war der Preis für Leichtsinn auch einfach zu hoch.
Über ihrem Versteck scharrten zwei Paar blank polierte Schuhe auf den Dielen. Sie gehörten Émile Lambert, dem Chef des französischen Geheimdienstes, dem Deuxième Bureau, und seinem Gegenüber Alain Le Fèvre. Es war ein milder Frühlingsabend in der Provence, und die beiden saßen gerade einmal zwei Armlängen von ihr entfernt in der Laube von Lamberts Landhaus an einem roh gezimmerten Tisch bei Wein, Brot und ein paar auserlesenen Käsesorten.
»Was ist der eigentliche Grund für die Einladung auf Ihren Landsitz?«, fragte Le Fèvre, der amtierende Verteidigungsminister Frankreichs.
»Ich brauche einen größeren Etat«, erwiderte Lambert offen heraus, und Claudette erspähte durch einen Spalt im Holzboden, wie er sich ein Stück Brie von der Käseplatte klaubte.
»Sie haben mich eingeladen, bloß um mich um Geld anzubetteln?« Die Empörung Le Fèvres wirkte gekünstelt.
»Uns fehlt es hinten und vorne.«
»Dann sparen Sie! Sie wissen ja selbst, dass der öffentliche Druck uns genötigt hatte, das Deuxième Bureau nach dem Debakel der Dreyfus-Affäre zu schließen.«
Dem Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus wurde vorgeworfen, militärische Geheimnisse an das Deutsche Reich weitergeleitet zu haben, und die Justiz hatte ihn wegen Landesverrats zu lebenslanger Verbannung verurteilt. Als zwei Jahre später Beweise für seine Unschuld auftauchten, wurden diese von höchster Stelle vertuscht. Doch sie sickerten durch, und der öffentliche Aufruhr war immens. Die Öffentlichkeit forderte, dass einige hochrangige Köpfe rollten. So hatte auch das Deuxième Bureau aufgrund seiner Verwicklungen in die Affäre seine Tore schließen müssen.
»Das ist jetzt elf Jahre her«, gab Lambert zu bedenken.
»Sie können froh sein, dass wir das Bureau überhaupt wieder reaktivieren konnten. Wenn auch nur inoffiziell. Ich habe mich immer für Sie eingesetzt, doch kann ich dafür auch nicht mehr als die mir zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Bleiben Sie dabei, kleine Baguettes zu backen, Lambert. Halten Sie Ihren Geheimdienst noch eine Zeit lang geheim.«
Unter ihnen begannen allmählich Claudettes Schenkel zu brennen, viel zu eng war ihr Horchposten. Auch wenn sie nicht gerade groß gewachsen war, musste sie bald ihre Beine ausstrecken, ganz sachte, ohne auf dem Kies ein Geräusch zu verursachen. Doch noch biss sie sich durch. Viel mehr beschäftigte sie, dass sich ihre Geduld nicht auszuzahlen schien. Den gesamten Abend lang hatten die beiden Männer gespeist und über Belanglosigkeiten wie Pferderennen, die Fischerei und die Regeln beim Péton palavert. Nun zeichnete sich allmählich ab, dass Claudette heute keine nachrichtendienstlichen Informationen mehr aufschnappen würde.
Sie nahm ihren Notizblock zur Hand und den weichen Bleistift – damit die Belauschten das Kratzen auf dem Papier nicht hören konnten – und notierte: »Grund des Treffens: Lambert bittet den Minister um mehr Geld«.
Zwischen den Spinnweben erblickte sie das frech grinsende Skelett eines Kleintieres – einer Maus oder einer Kröte, sie kannte sich bei Skeletten nicht aus.
»Ihre Zeit wird kommen, mein Freund. Gedulden Sie sich!« Le Fèvres Stimme hatte einen beschwichtigenden Ton angenommen.
»Bei unserer Aufgabe geht es um die nationale Sicherheit. Es wäre unverantwortlich, alles den Cretins der Sûreté nationale zu überlassen«, gab Lambert zu bedenken.
»Denken Sie nicht, Sie überdramatisieren?«
»Keineswegs. Wir sind da etwas auf der Spur. Wenn wir diese Angelegenheit aufdecken, können wir mit Pauken und Trompeten zurück an die Öffentlichkeit.«
Kommt da doch noch etwas? Claudette spitzte die Ohren.
»Von welcher Angelegenheit sprechen Sie?«, wollte der Minister wissen.
»Es tut mir leid, Monsieur Le Fèvre, aber dazu haben Sie nicht die erforderliche Sicherheitsklassifizierung.«
»Wenn Sie meine Hilfe wollen, dann müssen Sie mir auch etwas anbieten.«
Lambert überlegte. Er griff nach seinem Glas, nahm einen gehörigen Schluck und sagte: »Der 1903er Château de Balroq harmoniert vorzüglich mit dem Camembert, finden Sie nicht?« Er schmatzte vernehmlich. »Ich darf Ihnen wirklich nichts verraten. Aber Sie kennen ja bereits die Liste der vom Deuxième Bureau überwachten Personen, die regelmäßigen Kontakt zum Deutschen Kaiserreich pflegen. Unter ihnen ist ein Friedrich Klemens.«
Claudette notierte sich den Namen. Es schien, als würde sie doch noch etwas von Interesse aufschnappen. Ihr Herz begann so sehr zu pochen, dass sie fürchtete, die beiden Belauschten könnten es hören.
Le Fèvre erinnerte sich. »Klemens. Schweizer Großindustrieller. Schokoladenbaron. Man hat ihn des Öfteren in der Gesellschaft eines deutschen Generalleutnants beobachtet.«
»Wahrscheinlich wissen Sie auch bereits, dass er einen Kongress in seinem eigenen Nobelhotel in den Alpen in die Wege geleitet hat«, mutmaßte Lambert.
»Gewiss. Der Kongress für Zukunftsbetrachtungen. Offizieller Veranstalter ist die Orion-Gesellschaft für Fortschrittsfragen, ein Zusammenschluss von Wirtschaftskapitänen und hohen Tieren der Politik. Sie üben großen Einfluss auf die Schweiz und weit über die Grenzen hinaus aus. Aber was soll mir das sagen?«
»Wie gesagt, Sie verfügen nicht über die erforderliche Klassifizierung.« Wieder schien Lambert um einen Entschluss zu ringen. »Aber es wäre denkbar, dass Sie zufällig über dieses Schreiben hier gestolpert sind.«
Claudette hörte etwas rascheln, als würde Lambert ein Papier aus seinem Jackett ziehen, es auffalten, auf den Tisch klatschen und glatt streichen.
»Ein Telegramm?«, fragte der Minister und las vor: »›Beginn Kongress im Giessbach in fünf Tagen. Klemens erwartet deutsche Delegation. Kann Beweismittel beschaffen. Bitte um weitere Instruktionen.‹ – Sie haben einen Agenten im Grandhotel Giessbach stationiert?«
Lambert schwieg.
Le Fèvre überlegte. »Es wundert mich, dass eine deutsche Delegation in den Kongress eingeladen wurde. Für gewöhnlich kümmern sich die Eidgenossen um ihre eigenen Angelegenheiten.«
Lambert ging nicht darauf ein und ließ den Minister seine eigenen Schlüsse ziehen.
»Mir ist nicht bekannt, dass jemand von uns eingeladen wurde. Ich hätte es durch interne Bulletins erfahren müssen. Wie ist es mit den Engländern?«
Zwischen den Dielen hindurch sah Claudette, wie Lambert den Kopf schüttelte.
»Die Österreicher? Die Russen?«, fragte Le Fèvre weiter.
Wieder schüttelte Lambert den Kopf.
»Das gefällt mir nicht. Deutschland rüstet schon seit einiger Zeit zum Krieg, auch wenn sie vorgeben, es wären reine Verteidigungsmaßnahmen. Bloß eine Reaktion auf die Aufrüstung Großbritanniens.«
»Sie verstehen also die Brisanz dieser Angelegenheit?«, fragte Lambert.
Claudette schwellte die Brust. Es machte sie stolz zu hören, wie das Deutsche Kaiserreich die Franzosen erzittern ließ.
Als Magd war es ihr möglich, sich auf dem Anwesen frei zu bewegen. Bevor sie hier mit der Arbeit beginnen durfte, hatte sie eine personelle Überprüfung über sich ergehen lassen müssen. Die hatte sie mit Leichtigkeit bestanden – wer rechnete schon damit, dass ein einfaches Mädchen aus der nördlichen Provence für den deutschen Nachrichtendienst arbeitete?
Fernab vom nächsten Dorf lag Lamberts Anwesen eingebettet in eine idyllische Landschaft von Heiden und Ufergehölz. Claudette verrichtete einfache Arbeiten im Haus, im Garten oder in den Stallungen. Abends konnte sie müde und zufrieden in ihr Bett fallen. Doch wenn der Hausherr hier residierte, erhaschte sie so manche für das Kaiserreich verwertbare Information.
Claudettes Liebhaber Heiner hatte sie dazu bewogen, für den deutschen Nachrichtendienst zu arbeiten, und war nun ihr Verbindungsmann. Was man nicht alles für die Liebe tat. Und natürlich auch fürs Geld. Sie verdiente fürstlich für ein Mädchen vom Lande. Heiner hatte sie ausgebildet und meinte, sie sei ein Naturtalent, neige allerdings zum Leichtsinn. Er hatte ihr stets eingebläut, sich zweifach oder dreifach abzusichern, anstatt zu improvisieren. Dabei war gerade die Improvisation ihr Talent. So träumte sie davon, den ganz großen Coup zu landen. Wollte eines Tages mit den besten Spionen an den größten Fällen arbeiten.
»Wie gedenken Sie in der Giessbach-Angelegenheit vorzugehen?«, wollte Le Fèvre wissen.
»Das darf ich Ihnen nun wirklich nicht verraten. Nur so viel, ich werde meinen besten Mann einsetzen.«
Lambert reichte Le Fèvre eine Schachtel, und dieser entnahm eine Zigarre. Er zog sie unter der Nase durch und sog dabei laut vernehmbar ihren Duft ein. Dann schnitt er sie an und ließ sich von Lambert Feuer geben.
»Nun gut. Ich werde Ihren Etat erhöhen«, sagte der Minister, nachdem er den Rauch ausgestoßen hatte. »Sagen wir, um zehn Prozent?«
»Fünfundzwanzig.«
»In Ordnung.«
Frankreich hatte die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg noch immer nicht verarbeitet, obwohl der schon beinahe vierzig Jahre her war. Die Grande Nation hatte damals Elsass und Lothringen an die Deutschen abtreten müssen. Hinzu kam, dass der Krieg die zahlreichen deutschen Länder geeint und dem damaligen Kanzler Bismarck die Gelegenheit geboten hatte, sie zu einem großdeutschen Nationalstaat zusammenzuschließen. So war das Deutsche Reich zu einer bedrohlichen Großmacht angewachsen. Frankreichs Selbstbewusstsein schwand dahin im Anblick dieses mächtig gewordenen Nachbarn. Auch Großbritannien fürchtete um seine Kolonien, weil Deutschlands unberechenbarer Kaiser Wilhelm II. seine Marine ausbauen ließ.
Ein Automobil brauste heran, und Claudette nutzte den Lärm, endlich ihr Bein auszustrecken.
»Erwarten Sie noch jemanden?«, fragte Le Fèvre.
»Das muss Bailleul sein. Er fährt wie ein Henker.«
»Antoine Bailleul?«
»Mein bester Agent.«
»Mich beschleicht das Gefühl, dass Sie von Anfang an damit gerechnet haben, dass ich einlenke.«
Claudette würde noch heute Nacht ins Dorf eilen und eine Brieftaube losschicken. Sie musste ihren Auftraggeber so schnell wie möglich darüber in Kenntnis setzen, dass dieses Grandhotel Giessbach in der Schweiz infiltriert wurde.
Der Wagen glitt mit stehenden Reifen ein Stück auf dem Kiesplatz, bis er zum Stillstand kam. Kurz darauf wurde ein Mann durch das Château zur Laube hinausgeleitet. Er hatte einen dynamischen Gang, seine Schritte polterten auf den Dielen über Claudette. Lambert und Le Fèvre erhoben sich zum Gruße, doch Bailleul stampfte wortlos an ihnen vorüber und vollführte einen beherzten Sprung über die Brüstung. Im Gras ging er auf die Knie und zerrte die kreischende Magd an einem Fuß unter der Laube hervor. Sie an ihren goldenen Zöpfen in Schach haltend, brachte er sie an den Tisch.
Claudette hatte sich vor Schreck in den Notizblock gekrallt, anstatt ihn rechtzeitig fallen zu lassen. Lambert entwand ihn ihren Fingern. Er blätterte darin, und das Gelesene ließ seine Brauen in die Höhe schnellen, was seinem Blick einen Hauch peinlicher Verlegenheit verlieh. Der Chef des französischen Geheimdienstes wurde von einem einfachen Mädchen ausspioniert! Noch dazu in der Gegenwart des Ministers. Nachdem er nach einem langen Augenblick die Contenance wieder gefasst hatte, gab er Bailleul mit einer fahrigen Geste zu verstehen, was als Nächstes zu tun war.
Bailleul zerrte die Spionin über eine Wiese zu einem entfernten Schuppen. Es duftete nach frisch gemähtem Gras. Die Grüntöne kamen ihr gerade sehr intensiv vor. Im Schuppen sah sie das Messer aufblitzen. Kurz darauf hörte Claudette auf zu existieren.
KAPITEL 1
Dienstag, 10. Mai 1910, früher Abend
Fünf Tage vor der Eröffnung des Kongresses
Feierabend im kleinen Dorfteil Thäli unweit der Aare. Nachdem die Mechaniker und Vorarbeiter die Fertigungshalle der Dädalus-Werke laut schwatzend verlassen hatten, war Ruhe eingekehrt. Carl Lohser vollführte seinen allabendlichen Kontrollgang zwischen den Maschinen hindurch etwas hastiger als sonst. Auch die Inspektion der drei im Aufbau befindlichen Automobile führte er nur oberflächlich durch. Er hatte noch etwas Gewichtigeres zu erledigen. So löschte er das Licht, trat ins Freie und verriegelte die Tür zur Fabrik. Über den frisch gewischten Vorplatz erreichte er mit strammen Schritten das Wohnhaus. Am Fuß der Treppe zur oberen Kammer traf er auf Gisela, die Haushälterin, die ein Tablett mit einem Teller dampfender Hühnerbrühe, Brot und einer Tasse süßen Tee vor sich hertrug.
»Ich übernehme das.« Carl nahm ihr das Tablett ab. »Ich habe noch etwas mit ihm zu besprechen.«
»Wie Sie wollen, Carl«, meinte Gisela etwas säuerlich.
Carl erklomm die Treppe und betrat das stickige und von einer einzigen Glühbirne erhellte Zimmer seines Vaters. Er stellte das Tablett auf das Nachttischchen. »Ich werde an deiner Stelle am Kongress teilnehmen.«
Jakob Lohser, der von allen »Köbi« genannt wurde, richtete sich vorsichtig in seinem Bett auf. »Das kommt überhaupt nicht in Frage«, ächzte er. Seine Haare klebten als asphaltgraue Strähnen am Kopf.
»Ich glaube kaum, dass du in fünf Tagen wieder auf dem Damm bist.«
Köbi hustete und hinterließ im Nastuch braune Flecken. Das Atmen bereitete ihm Schmerzen. »Die haben eine vorzügliche Wasserheilanstalt da oben, und der Arzt ist eine Kapazität auf seinem Gebiet.«
»Dieser Arzt würde dir bloß verordnen, nach Hause zu gehen und dich ins Bett zu legen, Vater. Mit einer Lungenentzündung ist nicht zu spaßen.«
Köbi suchte vergeblich nach einer Erwiderung. Wenn er einmal so weit war, dass ihm das Debattieren schwerfiel, ging es ihm wirklich nicht gut. Stattdessen ergriff er das braune Fläschchen Suppenwürze und reicherte sein Mahl mit Aromen an. Wie immer, ohne vorher probiert zu haben.
»Aber du gehst mir auch nicht dahin.« Köbi blies sachte auf den vollen Löffel.
»Ich habe mich bereits einschreiben lassen.« Carl zog einen Stuhl neben das Bett und setzte sich. Als Köbi nichts erwiderte, erklärte Carl: »Jemand muss unseren Betrieb da oben vertreten. Diese Gelegenheit haben wir nur alle vier Jahre.«
»Aber du bist kein Mitglied der Orion-Gesellschaft.«
»Ich habe mich als Gastredner angemeldet.«
Köbi hustete.
»Ich werde mit der Gans II anreisen«, informierte Carl seinen Vater weiter.
Köbi schaute seinen Sohn an, als hätte der sich aus bloßem Jux blau angemalt. »So weit kommt es noch.«
»Wenn ich schon für unseren Betrieb Geldgeber suchen soll, dann muss ich auch unser neustes Produkt vorführen können.«
»Ausgeschlossen, wie sähe das aus? Ein Prahlhans, der mit einem Automobil vor dem Hotel vorfährt, zu dem alle anderen Gäste mit dem Schiff anreisen.«
»Die werden mir sofort den seriösen Ingenieur ansehen.«
»Es gibt auch andere Wege …« Sein Atem rasselte.
»Wir können nicht bis zum nächsten Kongress rote Zahlen schreiben.«
»Ich kenne die Bücher. Hör mir einmal zu, Junior.« Köbi erhob den Löffel wie einen mahnenden Finger. »Du bist Ingenieur und kein Verkäufer. Dazu kommt, die meisten da oben werden dich nicht ernst nehmen, weil du schlichtweg zu jung bist.«
»Ich bin dreiunddreißig Jahre alt, Vater. Wenn ich vor die Tür gehe, sehen die Leute einen gestandenen Mann, der gemeinsam mit seinem Vater einen Qualitätsbetrieb führt«, verteidigte sich Carl.
»Auf dem Kongress sind nicht dieselben Leute anzutreffen wie vor unserer Haustür. Du bist halb so alt wie die meisten Herrschaften dort oben.«
»Damit werde ich zurechtkommen.«
Köbi grübelte, während er den Suppenteller auslöffelte. »Was, wenn die Gans einen Defekt hat? Sie befindet sich noch immer im Entwicklungsstadium«, warf er ein.
»Dann repariere ich sie wieder.«
Jakob stellte den leeren Teller zurück aufs Tablett. Das Brot hatte er nicht angerührt. Zu rau für seine wunde Kehle.
»Werd du nur wieder gesund und lass mich machen.« Carl legte seinem Vater die Hand auf die Schulter. »Bleib schön im Bett und lass dich von Gisela umsorgen.«
Gisela neigte zu einem etwas resoluten Ton, was die beiden Männer das eine oder andere Mal vielleicht auch brauchten. Sie hielt das Wohnhaus von Jakob und Carl in Schuss, die sich hier oftmals nur zum Essen und Schlafen aufhielten. Den größten Teil ihres Lebens verbrachten die beiden ohnehin im Büro in der Fertigungshalle.
Carl hatte keine Geschwister und war seit seinem dreizehnten Lebensjahr von seinem Vater allein großgezogen worden. Anfänglich noch von der Trauer über den Verlust von Carls Mutter überschattet, hatte Jakob die Verantwortung der Erziehung pflichtbewusst wahrgenommen. Dazu gehörte auch mütterliche Fürsorge, die er jedoch geflissentlich unter einer gehörigen Portion väterlicher Aufsicht verbarg.
An jenem schicksalhaften Tag war Mutter nicht von der Arbeit heimgekehrt. Sie habe einen Unfall gehabt, sei jetzt an einem besseren Ort, hatte man Carl gesagt. Was genau geschehen war, hatte ihm nie jemand erklärt. Er hätte vor der grausamen Wahrheit verschont bleiben sollen. Aber Wissbegier war schon seit jeher Bestandteil von Carls Naturell, und das Ereignis war noch lange das größte Gesprächsthema im Dorf. In allen Einzelheiten schilderte man sich den Vorgang, hielt aber inne, wenn der arme Junge aufgetaucht war, und bemaß ihn mit mitleidvollen Blicken. Doch nicht jeder hatte ihn rechtzeitig bemerkt. So erfuhr Carl die Einzelheiten. Teile eines blutigen Puzzles.
Schon seit ihrer Errichtung vor Jahrzehnten wurde die Weberei, in der Marlis Lohser angestellt gewesen war, mit einem Wasserrad betrieben. Es brachte die Hauptwelle in Drehung, die alle Webstühle mit frei liegenden Transmissionsriemen antrieb. Eine unermüdliche Übertragung von Bewegungsenergie. Kraftvoll. Unbarmherzig. Einem jeden wurde eingetrichtert, sich davor fernzuhalten. Man passte aufeinander auf. Aber jeder hatte schon beobachtet, wie ein Riemen ein Stück Stoff zerriss oder ein unachtsam hingelegtes Werkzeug in ein Geschoss verwandelte. Bis zu jenem Tag war immer alles gut gegangen. Der Direktor, dem die Gefahrenquelle ebenfalls bewusst war, mahnte stets zur Vorsicht, weniger aus Angst davor, einen Arbeiter zu verlieren, als vielmehr vor der Arbeitsunterbrechung und dem damit verbundenen finanziellen Schaden. Ein Gitter oder Schutzblech anzubringen, stand für ihn nicht zur Debatte. Zu teuer. Zu umständlich bei Unterhalt und Reinigung.
Auch an jenem Tag wurden die Stoffrollen mit dem Karren quer durch die Fabrik befördert, um sie bei der Rampe zu verladen. Viel zu schnell waren sie zwischen den auf Hochtouren laufenden Webstühlen unterwegs gewesen, das Wochensoll gab es zu erfüllen. Marlis huschte zur Seite. Ein Moment der Unachtsamkeit. All dies konnte der junge Carl in Erfahrung bringen. Setzte es Stück für Stück zusammen. Der Riemen hatte sie am rechten Arm erfasst, riss sie von den Füßen und aus ihrem Leben. Sie flog fünf Meter durch die Halle, erzählte man sich. Vielleicht zehn. Genickbruch. Kleid zerrissen. Sofortiger Tod. Den Arm hatte man in einer Ecke im Staub gefunden.
Womöglich hatte dies Carl dazu bewogen, Elektrotechnik zu studieren. Elektrische Kabel und Motoren ließen Antriebsriemen überflüssig werden. Mit Bestimmtheit aber lag hier der Grund für Carls Einstellung Fehlern gegenüber. Ein einziger Fehler konnte das Leben grundlegend verändern. Der Fehler des Fabrikanten, die schon lange bekannte Gefahrenquelle nicht zu beheben. Der Fehler des Vorarbeiters, keine besseren Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Der Fehler der Hilfsarbeiter, den Karren zu ungestüm vor sich herzuschieben. Der Fehler von Marlis, in der Eile ihre Achtsamkeit aufzugeben. Alle hatten sie Fehler gemacht. Aber Jakob und Carl oblag es, die Konsequenzen zu tragen.
Zur Trauer hatte sich damals Wut gemischt. Deshalb hatte sein Vater ihm gezeigt, wie er die Wut kanalisieren konnte: Wie man fließendes Wasser mittels eines Wasserrades nutzen konnte, um etwas zu fabrizieren, so konnte auch die Wut zum Antrieb genutzt werden, etwas zu schaffen. Mit ihrer gemeinsamen Arbeit halfen sie sich über den Schicksalsschlag hinweg. Doch Marlis würde ihnen ihr Leben lang fehlen.
Köbi blies den Dampf von der Teetasse. Carl verstand noch immer nicht, wieso sein Vater sich so vehement dagegen wehrte, dass er ihn vertrat. An seinen Fähigkeiten konnte es nicht liegen. Auch wenn Köbi bisweilen ein unverbesserlicher Nörgler war, so wusste Carl doch um die Anerkennung seines Vaters. »Du warst doch immer gerne auf den Kongressen. Wenn es dir da so gefallen hat, erklär mir, wieso es für mich dann gefährlich sein soll.«
»Nicht gefährlich. Sondern …« Köbi brach ab.
Carl wartete.
»Es ist halt einfach nichts für dich.« Mehr kam nicht.
»Dann habe ich also deinen Segen, Vater?«
»Du tust ja sowieso, was du willst.«
Carl bedeutete seinem Vater, dass er noch etwas Suppe im Bart hatte. Jakob wischte sie hastig weg, und Carl verließ die Kammer, nicht ohne einen leichten Anflug von Vorfreude auf den bevorstehenden Ausflug.
***
Von der Nachtschicht an der Rezeption abgesehen, war Luc de Phiton im Grandhotel Giessbach derjenige, der am längsten in die Nacht hinein arbeitete. Es verschaffte ihm die Freiheit, noch ungestört ein Telegramm an das Deuxième Bureau abzusetzen. Zu diesem Zweck hatte er im Verborgenen einen Kleintelegrafen an die offizielle Leitung des Grandhotels eingehängt. Routinemäßig überprüfte er vor dem Telegrafieren den Draht nach laufenden Telefongesprächen, um zu vermeiden, dass seine Aktivitäten bemerkt wurden. Dann und wann stieß er dabei tatsächlich auf ein Gespräch. In einem Hotel vom Format eines Giessbachs war es keine Seltenheit, dass nachts Telefonate in ein Land mit einer anderen Zeitzone geführt wurden. Uninteressant für Luc. Doch gelegentlich wurden Gespräche geführt, die nicht mitgehört werden sollten. In dieser Nacht war ebendies der Fall.
»Ich habe eine Änderung in der Teilnehmerliste des Kongresses zu vermelden.« Luc erkannte den Concierge des Hotels an seiner gestelzten Sprechweise.
»Ja, bitte.« Der Empfänger war Deutscher, was Lucs Aufmerksamkeit erregte.
Der Concierge erläuterte: »Ein Jakob Lohser lässt sich abmelden. Grund: Krankheit. An seiner Stelle hat sich sein Sohn als Gastreferent einschreiben lassen.«
Luc notierte die personellen Angaben, die der Concierge durchgab: »Carl Lohser, Geburtsdatum 04. Mai 1877, Größe: 182 Zentimeter, Postur: schlank.«
Die Stimme auf der deutschen Seite fragte nach. Der Concierge erklärte: »Postur. Das heißt Wuchs. Schreiben Sie: ›Körperbau: schlank‹. Haarfarbe: dunkelbraun. Ingenieur, Mitinhaber der Dädalus-Werke nebst seinem Vater, Wohnort: Thäli.«
Dies musste der Concierge buchstabieren. Danach fuhr er fort: »Zivilstand: ledig. Lohser gehört keiner Partei an und ist in keinem Verein eingetragen. Keine Straftaten gemeldet.«
Damit war das Gespräch beendet, und Luc vernahm das Knacken in der Leitung. Der Concierge handelte zweifelsohne auf Geheiß von Klemens. Es war Luc nicht neu, dass Klemens alle Teilnehmer des Kongresses penibel durchleuchtet und geprüft hatte. Dass die gesammelten Personalien aber an die deutschkaiserliche Bürokratie weitergegeben wurden, ließ ihn aufhorchen. Misstrauisch, wie die »Teutonen« waren, würden sie eine zweite Personenüberprüfung durchführen. Das bedeutete, dass sie auch ihn, Luc, überprüft hatten. Er musste darauf vertrauen, dass seine Legende wasserdicht war.
Nun, da die Leitung frei war, ergänzte Luc seine Meldung mit der neuen Erkenntnis, verschlüsselte sie sorgfältig und setzte das Telegramm ab.
Dr. Friedrich Klemens war einer der großen Schweizer Schokoladefabrikanten. Ermittlungen des Deuxième Bureaus hatten ergeben, dass er zahlreiche Reisen ins Deutsche Kaiserreich unternommen hatte und mit einem Generalleutnant Manfred Brechtesloh in Verbindung stand, der seinerseits im Fokus des Bureaus stand. Als dann Klemens das Grandhotel Giessbach erworben hatte, war das für den französischen Geheimdienst Grund genug gewesen, Luc hier einzuschleusen. Sechs Monate lang konnte er nur wenig über Klemens und den bevorstehenden Kongress für Zukunftsbetrachtungen in Erfahrung bringen. Eine offizielle Agenda oder Teilnehmerliste gab es nicht. Es lag in der Natur von Verbindungen wie der Orion-Gesellschaft für Fortschrittsfragen, dass derlei geheim gehalten wurde. Selbst die Teilnehmer wurden erst nach der Eröffnung über das Programm in Kenntnis gesetzt.
Doch dann war plötzlich Leben in die Angelegenheit gekommen. Wie heute war Luc vor ein paar Tagen schon auf ein spätnächtliches Telefongespräch gestoßen, das mit einem Empfänger im Deutschen Reich geführt worden war. Es ging um die Unterkunft eines Gastes, der für die Dauer des Kongresses im Grandhotel residieren sollte. Der Gast wurde »der Preuße« genannt. Luc hatte vernommen, dass für den Preußen eine Suite bereitzustellen sei. Für den Oberst, der ihn begleitete, und einen Personenschützer sollten zwei kleinere Zimmer reichen.
Eine Delegation von drei deutschen Militärs am Kongress, schlussfolgerte Luc. Ob es sich beim »Preußen« um Generalleutnant Brechtesloh handelte? Luc war davon überzeugt. Er hatte die Informationen auch da postwendend an das Bureau weitergegeben und als Antwort erhalten, dass man ihm Verstärkung zukommen lassen werde.
KAPITEL 2
Freitag, 13. Mai 1910, früher Morgen
Zwei Tage vor der Eröffnung des Kongresses
Als die Sonne ein gutes Stück über dem entfernten Schloss Lenzburg prangte, bestieg Carl die Kabine der Gans II. Er betätigte das Pedal und ließ die Dädalus-Werke im Thäli hinter sich. Die Reise ins Berner Oberland begann. Die Nacht zuvor hatte ihn eine Unmenge von Gedanken wach gehalten. Was würde ihn am Kongress für Zukunftsbetrachtungen erwarten? Hatte er bei seinen Vorbereitungen auch an alles gedacht? Carl hatte sich die Route mit Hilfe der detaillierten Siegfriedkarte festgelegt. Sie sollte ihn durch das Emmental und den Thunersee entlang nach Interlaken führen. Danach würde er den Brienzersee halb umrunden und beim Grandhotel Giessbach vorfahren. Er würde sich Zeit nehmen, um die Fahrt und das schöne Wetter zu genießen.
Er kam gut voran. Die erdigen Straßen waren trocken. Am Himmel begleitete ihn der Halley’sche Komet, der zeitweise auch tagsüber als verschmierter weißer Punkt auszumachen war. Vom fahrenden Automobil aus betrachtet, wanderte er am Horizont mit und tauchte immer wieder hinter Bäumen ab. Das erinnerte Carl an eine Geschichte über einen Delphin, der ein Schiff begleitete. Es war bereits der zweite Komet in diesem Jahr, der die Erde besuchte. Die Zeitungen hatten schon lange vor seinem Auftauchen vom Halley’schen Kometen berichtet, der im April und Mai zu sehen sein würde. So hatte die Ankunft eines Schweifsterns im Januar alle überrascht. Kein Berechnungsfehler. Nicht Halley. In Südafrika wurde er zuerst gesichtet und wurde daraufhin Johannesburger Komet genannt. Zwei Kometen in einem Jahr. Wer spirituell angehaucht war, vermutete ein schlechtes Omen. Carl indes betrachtete solcherlei Zufälle nüchtern.
Unterwegs begegnete er Fuhrwerken, die mit Weinfässern oder Getreidesäcken beladen waren und von massigen Kaltblütern gezogen wurden. Eselkarren und Reiter hoch zu Ross kamen ihm entgegen. Dann und wann überholte er einen Velocipisten. Die meisten Leute aber gingen zu Fuß, nicht selten mit schweren Lasten beladen. Auf andere Automobile traf Carl nur selten. Man winkte sich zu, wenn man sich kreuzte. An Sonntagen hingegen kam es häufiger vor, dass man bei einer Begegnung mit einem anderen Automobilisten ein wenig ins Plaudern kam. Stolz berichtete man über seine Erfahrungen und über die Vorzüge seiner Maschine. Carl kam des Öfteren in Verlegenheit, wenn er erklärte, er habe sein Fahrzeug in der heimatlichen Werkstatt selbst entwickelt. Er behielt dies lieber für sich, profitierte aber von den Automobilisten, die ihn bereitwillig an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben ließen.
Ein gut betuchter und besonders gesprächiger Familienvater hatte Carl einmal erzählt, dass er in seinem Gefährt stets den Schminkspiegel seiner Frau mitführte. Auf diese Idee war er gekommen, als er einen steifen Nacken gehabt hatte und es ihn jedes Mal schmerzte, wenn er durch das Rückfenster nach hinten spähen musste. Carl war fasziniert von dem Gedanken und montierte kurzerhand Helénes Handspiegel unten ans Kabinendach. Zwar musste er seiner damaligen Verlobten einen neuen Spiegel besorgen, doch von da an verkaufte er jeden Wagen mit diesem Zubehör, ein Verkaufsargument, das schon den einen oder anderen Käufer dazu bewogen hatte, eine Dädalus Gans I zu erstehen. Im Prototyp, der Gans II, mit dem er heute unterwegs war, hatte er denselben Spiegel wieder montiert. Rein aus Nostalgie.
Carl erreichte schon bald das Emmental. Sanfte runde Hügelchen mit Wiesen und Wald besetzt erhoben sich. In einem kleinen Dorf hörte er schon von Weitem Marktrufer, die lauthals auf ihre Brote, Fische, Schinken und Zöpfe aus Zwiebeln aufmerksam machten. Schon bald fand sich Carl in einem bunten Markttreiben wieder, und es ging nur noch stockend voran. Er kurvte die Gans II um ein Gatter voller Mastschweine und musste einer musizierenden Spielmannsgruppe ausweichen. Mehrmals war er gezwungen, durch die geöffnete Kabinentür mit einem lauten »Äxgüse!« auf sich aufmerksam zu machen. Entschuldigend huschten die erschrockenen Marktbesucher zur Seite und blieben am Straßenrand stehen. Einige betrachteten das Automobil voller Andacht, andere mit unverhohlener Skepsis.
Vor einem gut besuchten Stand mit geräucherten Fleischwaren musste Carl nun vollends anhalten. Ein kleiner Junge und sein größeres Schwesterchen mit schmutzbeflecktem Kleidchen standen mitten auf der Straße und starrten mit weit aufgerissenen Augen und Mündern auf das ankommende Vehikel. Sie führten einen Berner Sennenhund mit sich, der einen Karren großer und kleiner Töpfe zog. Die Kutsche des kleinen Mannes, wie man so schön sagte. Ein freundliches Winken und das gerufene »Äxgüse!« halfen nichts.
Carl setzte seinen Hut auf und stieg aus, worauf die beiden Kinder mitsamt Hund und Wägelchen auf ihn zukamen. Noch bevor er etwas sagen konnte, fragte das Mädchen, wo denn bei seiner Kutsche die Pferde seien. Carl ging in die Hocke und gab den Kleinen bereitwillig Auskunft, dass dieses Automobil mit Strom laufe. Es fresse kein Gras und auch kein Holz. Er erlaubte den beiden, es anzufassen, sie hatten wohl noch nie ein Automobil von Nahem betrachtet. Als er ihnen einen Batzen schenkte und sich umschaute, stellte er fest, dass seine Gans II zum Mittelpunkt des Markttreibens geworden war. Selbst ein bunt gekleideter Gaukler, der zuvor noch mit Gemüse jongliert hatte, stand im Ring der Zuschauer, der sich um sein Gefährt gebildet hatte. Nach einer nicht ganz bühnenreifen Verbeugung bestieg Carl die Fahrerkabine und fuhr unter begeistertem Händeklatschen wieder los. Bald hatte er das Dorf hinter sich gelassen.
Die Fahrt bot ihm die Gelegenheit, das Fahrverhalten der Gans II zu studieren. Er hatte schon Dutzende Kilometer mit diesem Wagen zurückgelegt und ihn so weit optimiert, dass er auch für lange Reisen gewappnet war. Jeder zusätzliche Test brachte weitere Erkenntnisse mit sich, selbst wenn es nur die war, dass alles ordnungsgemäß funktionierte. Diese Erkenntnis war ihm die wertvollste.
Nach einer Biegung um einen bewaldeten Hügelfuß tat sich vor ihm ein übersichtliches, schnurgerade gezogenes Stück Überlandstraße auf. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Einen bestimmten Test hatte er mit der Gans II noch nie durchgeführt. Sein Vater hätte ihm davon abgeraten, dem Wagen so richtig die Sporen zu geben, doch nichtsdestotrotz trat Carl das Pedal durch und beschleunigte.
Das schnellste Elektroautomobil, von dem er je gelesen hatte, war vor acht Jahren der amerikanische Baker Torpedo gewesen. Ein Hochgeschwindigkeitswagen, der für nichts anderes konstruiert worden war als für den Geschwindigkeitsrekord. Er glich einem Bügeleisen ohne Griff, dafür mit vier Rädern, und sollte über hundertzwanzig Kilometer pro Stunde erreicht haben. Beim letzten Rekordversuch war eine Achse gebrochen. Zwei Zuschauer kamen dabei ums Leben. Moderne Züge waren mit bis zu hundert Kilometern pro Stunde unterwegs. Schnelle benzinbetriebene Automobile erreichten in etwa dieselbe Höchstgeschwindigkeit.
Carl spürte die Beschleunigung. Spürte die Euphorie in sich aufsteigen. Den Gedanken »Werde nicht unvernünftig!« verdrängte er durch ein »Ich tu es im Namen der Wissenschaft!«. Der DEUTA-Geschwindigkeitsmesser, den Carl unlängst für viel Geld direkt bei der Deutsche Tachometerwerke GmbH erstanden und eingebaut hatte, zeigte zweiundvierzig Stundenkilometer an. Mehr war nicht herauszuholen. Immerhin.
Weiter vorne, wo das gerade Wegstück zu Ende war, bog ein einspänniger Heuwagen um die Ecke. Es wurde Zeit, den Wagen wieder abzubremsen. Carl stieg in die Eisen und hielt die Gans II am rechten Straßenrand an, um den Heuwagen vorbeizulassen. Das Pferd tänzelte unruhig. Ein alter Emmentaler mit wallendem Bart und fein verzierter Tabakspfeife im Mundwinkel hielt die Zügel lose in krummen Fingern. Als er das wartende Auto kreuzte, fixierte er Carl aus zusammengekniffenen Augen. Nachdem sie ihn passiert hatten, sah Carl durch Helénes Innenspiegel, wie sich das Pferd aufbäumte. Es machte einen Satz zur Seite. Die Versuche des alten Sennen, es zu zügeln, blieben ergebnislos. Der Heuwagen geriet von der Straße in ein frisch angesätes Feld und kam zum Stehen. Carl stieg aus und eilte dem Mann zu Hilfe.
Der alte Senn keuchte und krallte sich mit seinen Gichtfingern in die Banklehne. Sein hochrotes Gesicht bot einen starken Kontrast zu seinem weißen Bart. Die gelblichen Augen hatte er weit aufgerissen. Carl näherte sich sachte dem Pferd und hielt es am Zaumzeug fest. Während er die Nüstern streichelte, redete er ihm mit sanfter Stimme zu. Nachdem es sich beruhigt hatte, wandte er sich dem Sennen zu. »Ist alles in Ordnung bei Ihnen?«
Dieser murrte etwas Unverständliches in die Pfeife, stieg ungelenk vom Kutscherbock, überprüfte die Ladung und stellte fest, dass nur ein paar wenige Büschel verloren gegangen waren. Carl führte das Pferd mitsamt Wagen wieder auf die Straße zurück. Der Alte stieg wieder auf, nahm die Pfeife aus dem Mund und deutete mit dem Mundstück auf Carl. »Der Furz mit diesen Automobilen wird auch wieder mal vergehen, sobald es den Bonzen verleidet ist.« Ohne ein weiteres Wort setzte er mit einem Zügelschlag das Fuhrwerk in Bewegung und zog seines Weges.
Kein Dankeschön. Nichts. Obwohl ihm Carl gerade geholfen hatte, das Pferd zu beruhigen, das der Alte selbst nicht im Griff hatte. Carl hatte seine Schuhe und den guten Kittel verdreckt, um den Heuwagen wieder auf die Straße zu schleppen. In einem Punkt hatte der Alte aber recht: Diese Vehikel waren noch immer eine Domäne der Reichen. Genau das wollte Carl ändern.
***
Nicu erklomm federnden Schrittes die Treppe und betrat das hohe Vestibül des Grandhotels Giessbach. Dr. Friedrich Klemens hatte ihm und Fritz aufgetragen, stets pünktlich zu erscheinen. Pünktlich hieß: eine Viertelstunde früher. Falls man unterwegs aufgehalten wurde, hatte man noch immer eine Chance, rechtzeitig anzukommen. Nicu prüfte im Spiegel seinen Schnurrbart, den er sich an diesem Morgen zu einem schmalen Streifen über der Lippe rasiert hatte. Mit dem Anzug, der Schiebermütze und diesem Schnauzer hatte er durchaus etwas Schneidiges, fand er.
Auch Fritz traf ein, sein Schnurrbart stand wie immer zu allen Seiten ab, er musste aber frisch gebadet haben, stellte Nicu fest, für einmal zog er keine Schweißfahne hinter sich her. Auch das hatte ihnen Klemens eindringlich nahegelegt: Wenn man in gepflegter Gesellschaft arbeitete, hatte man gepflegt zu erscheinen. Doch was sollte der Tölpel machen? Er neigte nun einmal zu starkem Körpergeruch. Nach einem langen Arbeitstag mit Fritz hatte Nicu bisweilen das Gefühl, als ob sich der Geruch in seiner Nase festgesetzt hatte. Er befürchtete dann sogar, selbst zu riechen. Gerüche hatten immer mit Bakterien zu tun, hatte Nicu irgendwo aufgeschnappt. Folglich stellte sich ihm die Frage, ob Körpergeruch ansteckend war.
Fritz war ein grobschlächtiger Holzfäller um die vierzig. Auch wenn es einem gelang, einen Ochsen in einen Anzug zu zwängen, so blieb er noch immer ein Ochse. Eines musste man ihm aber lassen, der Schaffhauser konnte ausgesprochen gut mit der Axt umgehen. Damit waren aber auch schon alle seine Fähigkeiten aufgezählt. Fritz war ein Trottel, und niemand würde Nicu vom Gegenteil überzeugen können. Fritz verbarg seinerseits nicht, dass er zu einer ausgeprägten Ausländerfeindlichkeit neigte. Schon gar nicht gegenüber dem Rumänen Nicu Butoi mit seinem hölzernen Akzent.
Die beiden brachten sich breitbeinig an der Wand gegenüber der Rezeption in Aufstellung. Diskretion war eine wahre Wissenschaft, und sie hatten sie inzwischen verinnerlicht. Auf die Details kam es an, das hatte Nicu gelernt. Selbst Fritz machte Fortschritte in diesen Belangen, auch wenn er aufgrund der zu breiten Statur und seiner Neandertalerstirn nicht gerade unauffällig war.
Sie taten, wofür Klemens sie eingestellt hatte: Sie standen da. In Hotels, an Empfängen und Kongressen. Der rechte und der linke Handschuh des Großindustriellen Friedrich Klemens, sinnierte Nicu. Wobei der rechte Handschuh, aufgrund seiner ausländerfeindlichen Gesinnung, natürlich Fritz sein musste. Nicu fand diese Analogie ziemlich gelungen und musste schmunzeln.
Ihre Namen standen nicht auf der offiziellen Lohnliste der Schokoladenfabrikkette Klemens. Klemens wahrte zu ihnen die nötige Distanz, denn dann und wann wurden von den beiden Tätigkeiten verlangt, die sich jenseits der Legalitätsgrenze befanden. Und der Moral. Vermutlich verfügten die meisten erfolgreichen Firmenpatrone dieser Tage über Leute mit vergleichbarem Pflichtenheft. Man musste schauen, wo man blieb. Klemens musste sich dank seiner beiden Handschuhe die Hände nicht schmutzig machen. Noch eine Analogie zu den Handschuhen, Nicus Gewitztheit war in voller Fahrt. Nur schade, dass sie nicht gefragt war.
Offiziell verdingte sich Nicu als Tagelöhner, mal schippte er Kohle, mal schleppte er Weinfässer oder zog einen Leiterwagen voller Gemüse. Für die Dauer des Kongresses im Grandhotel Giessbach hatte er sich freinehmen müssen. Noch nie hatte einer von Nicus Arbeitgebern Fragen gestellt, wenn er von seiner Arbeit abgezogen wurde. Er hegte den Verdacht, dass dies im Verborgenen von Klemens persönlich geregelt wurde. Für ihre Einsätze in gepflegter Gesellschaft wurden Nicu und Fritz Anzüge geliehen, die ein Bote bei ihnen ablieferte und die sie nach dem Einsatz wieder abgeben mussten. Schäden an den Kleidungsstücken wurden ihnen vom Gehalt abgezogen. Leider war es bei der Arbeit, die von ihnen verlangt wurde, nicht immer einfach, die Kleidung schadlos zu halten.
Noch zwei Minuten, verriet ihm die Uhr über der Rezeption. Der Telefonapparat auf der Theke klingelte. Der Concierge hob ab, flüsterte eine Antwort, winkte mit schmaler Hand einen Pagen herbei, dem er – ebenfalls flüsternd – eine kurze Anweisung erteilte. Der Page bat Nicu und Fritz, ihm zu folgen, wenig später erreichten sie im zweiten Stock eine massive Eichentür. Sie blieben davor stehen, ohne anzuklopfen.
Nach einigen Sekunden öffnete Friedrich Klemens die Tür. Nicu hätte seine beste Hose darauf verwettet, dass exakt im selben Augenblick der Minutenzeiger der Rezeptionsuhr auf die Zwölf klickte. Die von Klemens geforderte Pünktlichkeit trieb er selbst auf die Spitze.
Klemens trug einen steifen Dreiteiler, der mehr Geld gekostet haben musste, als Nicu je zu Gesicht bekommen würde.
»Guten Tag, Herr Dr. Klemens«, begrüßten Nicu und Fritz ihren Brötchengeber wie aus einer Kehle.
Klemens blieb stehen und musterte sie eingehend. »Ihr Stümper seht wieder zum Kotzen aus!« Den Zeigefinger auf Nicu gerichtet, befahl er: »Du, Krawatte richten!« Dann an Fritz gewandt: »Was für einen Dreck hast du da auf den Schultern?« Tatsächlich waren dort vereinzelte Flusen auszumachen.
»Woher sollt ihr auch wissen, wie man sich anzieht? Ich müsste jemanden einstellen, der es euch immer wieder langsam und deutlich erklärt.« Klemens wandte sich ab. »Aber für solchen Humbug habe ich jetzt keine Zeit.«
Nicu hasste Klemens dafür, dass er ihnen dauernd unter die Nase rieb, wer der feinen Gesellschaft und wer dem Pöbel angehörte. Es wollte ihm einfach nicht gelingen, den Tonfall zu überhören. Wieder musste er seinen Ärger herunterschlucken. Zudem hatte er den Eindruck, dass Klemens von Nicu mehr verlangte als von Fritz, wobei Klemens mit Fritz auch nicht gerade kameradschaftlich umging. Fritz’ voller Name war Friedrich Huggentobler, doch Friedrich Klemens verbot ihm, sich ebenfalls Friedrich zu nennen. »Wo kommen wir denn hin, wenn der Gorilla gleich heißt wie der Patron?«
Nicu hatte beobachtet, dass Fritz jedes von Klemens’ Worten wie ein Schwamm aufsog, ohne gekränkt zu wirken. Auf eine für Nicu unverständliche Art und Weise ermunterten Klemens Zurechtweisungen den Holzfäller sogar dazu, sich mehr anzustrengen. Vermutlich war Fritz so sehr davon eingenommen, Teil von etwas Großem sein zu dürfen, dass er es über sich ergehen ließ. Nicu musste versuchen, es auch so zu handhaben.
Klemens entnahm etwas seiner Dokumententasche. Nicu wusste genau, was jetzt kam. Es war schon beinahe ein Ritual. Auch Fritz neben ihm wechselte von einem Fuß auf den anderen. Klemens kam auf sie zu und drückte jedem eine Tafel Schokolade aus seiner Produktion in die Hände. Nicu versuchte gegen den Glanz in seinen Augen anzukämpfen. Er hatte den Verdacht, dass Klemens seine beiden Leibgardisten doch insgeheim mochte. Der Gedanke hatte etwas Rührendes, aber Klemens wusste nur zu gut diesen Anschein zu überspielen. »Diese Tafeln sind Ausschussware aus der Fabrik. Lassen sich so nicht mehr verkaufen. Aber anstatt sie wegzuwerfen …«
Die Verpackung der Klemens-Schokolade hatte das Bild eines süßen Mädchens aufgedruckt, das mit dunklen Flecken um den Mund genüsslich Schokolade mampfte. Der Schriftzug und die Verzierungen entsprachen nicht mehr ganz der allerneusten Mode. Im Grunde genommen entsprach gar nichts in Klemens’ Umfeld der allerneusten Mode. Er war eher konservativ eingestellt, was an seinem fortgeschrittenen Alter von siebzig Jahren liegen mochte.
An Nicus Abneigung gegenüber Klemens änderte das süße Präsent jedoch nichts. Vielmehr machte es ihn noch wütender, dass Klemens sie damit manipulierte, und obwohl Nicu ihn durchschaut hatte, gelang es dem Alten jedes Mal von Neuem. Zuckerbrot und Peitsche. Klemens hatte als Industriekapitän sein Schiff jahrzehntelang durch die rauen Gewässer der Wirtschaft manövriert, da würde er zweifellos solche Strategien verfolgen. Ja, Nicu durchblickte langsam, wie die Welt sich drehte. Er war nicht mehr länger der Tumbe von der Straße. Er las nun Bücher, investierte seinen Zusatzverdienst aus den Leibgardistenaufträgen in seine Bildung. Die Schokolade liebte er dennoch. Jeder liebte die Klemens-Schokolade.
Es klopfte an der Tür, und Klemens ließ bitten. In diesem Augenblick verlor Nicu sein Herz. Ein Wesen von göttlicher Anmut schwebte ins Büro. »Guten Tag, Herr Klemens. Es freut mich, von Ihnen persönlich empfangen zu werden«, hauchte es. Es hatte mandelbraune Augen.
»Fräulein Amanda«, begrüßte Klemens sie und wies ihr den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Nehmen Sie Platz!«
Amanda. Wie dieser Name klingt! Sie hatte ein dezentes Parfüm angelegt. Nelken und noch etwas Blumiges konnte Nicu ausmachen. Es war um ihn geschehen. Sie war von feinem Körperbau, das Kleid hatte das Weiß von Schönwetterwolken am Sommerhimmel und betonte an den richtigen Stellen ihre Vorzüge. Ihr gigantischer Hut musste wohl von einem der Meister in Paris kreiert worden sein. Die Federn, Maschen und Spitzen darauf waren allesamt in demselben Weiß gehalten wie das Kleid. Eine Grazie.
Klemens machte sich weder die Mühe, der Dame den Stuhl zurechtzurücken, noch, sich nach ihrem Befinden und der Anreise zu erkundigen. Er kam direkt zum Punkt. »Sie werden sich an der Rezeption melden und Ihr Zimmer beziehen. Es ist alles in die Wege geleitet. In den nächsten sieben Tagen werde ich voraussichtlich mehrmals nach Ihnen schicken lassen, wenn Ihre besonderen Dienste gefragt sind.«
Wie Klemens »besondere Dienste« betonte, ließ Nicu aufhorchen.
»Sehr wohl, Herr Klemens«, antwortete sie.
»Herr Doktor Klemens, Fräulein Amanda!«, korrigierte er sie.
»Entschuldigen Sie bitte. Herr Doktor Klemens!«
Wer war die Dame, und warum behandelte Klemens sie wie eine Angestellte? Für gewöhnlich war er recht charmant zu Frauen, die nicht halb so viel Klasse hatten wie diese Dame.
Klemens erhob sich und wies ihr die Tür. »Guten Tag.«
Damit verließ Amanda den Raum, und Nicu meinte, erst jetzt wieder zu Atem zu kommen.
***
Carl erreichte Burgdorf und somit das erste Etappenziel seiner Tour. Viel weiter würde er heute nicht kommen. Die Akkus waren nur noch zu einem Fünftel geladen, wie ihm das Voltmeter in der Fahrerkabine verriet. Hier wohnte und arbeitete sein Freund Mario Chiorazzo, ein Nachkomme italienischer Einwanderer. Carl pflegte mit Mario regen Briefkontakt und hatte schon vor einiger Zeit eine Einladung in sein Heim erhalten.
Mario empfing Carl mit offenen Armen und einem Chianti in der Bastflasche. Er bewohnte ein altehrwürdiges Bauernhaus mit einem für die Region typischen strohgedeckten Dach, das beinahe bis zum Boden reichte. In der benachbarten Scheune war eine Spenglerwerkstatt eingerichtet. Für den Bau der Dädalus Gans II hatte Carl Mario beauftragt, die Blecharbeiten für die Karosserie zu entwerfen, so lag es auf der Hand, dass Mario nach einem ersten Anstoßen mit dem Rotwein die Spenglerarbeiten an der Gans prüfte. Er freute sich, das erste Mal seine Arbeit für ein Automobil in die Tat umgesetzt zu sehen. Mario lud Carl zu einem leichten Mahl mit Trockenfleisch, hiesigem Käse und Rotwein ein, wozu sich auch seine Frau und die Sprösslinge gesellten. Danach begaben sich die beiden auf einen Spaziergang und schlenderten einen Feldweg entlang, vorbei an der Bartholomäuskapelle und dem Siechenhaus, das bis ins 17. Jahrhundert als Pflegehaus für Aussätzige gedient hatte.
Da seine Geschäfte gut liefen, überlegte Mario, seinen alten Lastesel durch ein Automobil zu ersetzen, und bat Carl, ihm mit seinem Rat zur Seite zu stehen. Carl riet ihm, es zuallererst vom Budget abhängig zu machen, was für ein Automobil es sein sollte. Wobei er Mario beim Kauf eines Dädalus einen großzügigen Freundschaftsrabatt zusichern könne.
»Danke für das Angebot. Aber ich habe bereits mit einigen Automobilisten gesprochen, und die rieten mir, einen Wagen mit Verbrennungsmotor anzuschaffen.«
Carl hatte die Diskussion schon Dutzende Male geführt. »Automobile wären ›bloß ein Furz, der wieder vergeht, wenn es den Bonzen verleidet ist‹, hat mir heute ein alter Senn an den Kopf geworfen.« Carl kickte einen Stein weg. »Wenn etwas ein Modetrend ist, dann sind es Automobile, die mit Sprit, Petrol oder Benzin betrieben werden. Diese Motoren sind laut und stinken.«
Mario schob seinen Kiefer vor. »Damit kann ich leben.«
»Die Mechanik der benzinbetriebenen Automobile ist viel komplexer und dadurch um einiges störanfälliger. Sie benötigen ein aufwendiges Getriebe mit mehreren Gängen, im Gegensatz zum Elektroauto. Der Vergaser muss während der Fahrt immerzu nachgeregelt werden, dafür muss sich der Fahrer eine gewisse Handfertigkeit aneignen. Nicht, dass ich dir das nicht zutrauen würde, Mario.«
»Das will ich auch meinen!«
»Der laufende Verbrennungsmotor rüttelt am gesamten Wagen, selbst im Stand. Vor der Abfahrt müssen eine Menge Handgriffe durchgeführt werden, bis das Fahrzeug endlich in Bewegung gesetzt werden kann. Zum Beispiel muss die Handkurbel an der Front des Wagens kräftig gedreht werden, damit der Motor in Gang kommt. Nicht selten verletzt man sich dabei an der Hand, wenn die Kurbel ausschlägt. Selbstredend musst du auch bei Regen, Wind und Schnee an der Kurbel drehen.«
»Haben strombetriebene Wagen keine Kurbel?«, fragte Mario.
»Nein, du setzt dich rein und fährst einfach los.« Sie nahmen eine Biegung zum Dorf zurück. »Außerdem musst du für einen Verbrennungsmotor dauernd zu einer Apotheke oder einem Händler gehen, um Spiritus oder Benzin zu besorgen. Dieses Zeug ist übrigens hochgiftig.«
»Das elektrische Automobil hänge ich einfach zu Hause an die Stromversorgung an und lade es über Nacht«, griff Mario Carls Gedanken auf. »Wie ist es mit der Leistung und der Reichweite? Es heißt, die wären deutlich geringer als bei Benzinmotoren.«
Dem musste Carl beipflichten. »Zugegeben, es gibt auch Schwächen beim elektrischen Antrieb. Die Energiedichte. Mit einem Kilogramm Batterie kommt man nicht so weit wie mit einem Liter Tankfüllung. Wenn auch ein Benziner mit seinem großen Motor und den ganzen mechanischen Teilen, insbesondere dem Getriebe, recht schwer ist, so sind aufgrund der großen Zahl an Batteriezellen die Strombetriebenen auch nicht leichter. Mit einer Tankfüllung beträgt die Reichweite um die dreihundert Kilometer, mit geladenen Akkumulatoren kommst du hundert Kilometer weit.«
Mario lachte. »So warst du gezwungen, mich einmal besuchen zu kommen, um dein Automobil zu laden.«
»Wie oft fährst du weiter als hundert Kilometer?«
»Nicht sehr oft«, sagte Mario.
Carl verriet Mario Chiorazzo, dass er seine Entwicklungsarbeit bei den Dädalus-Werken an genau diesem Punkt angesetzt hatte. Er entwickelte Techniken, welche die Reichweite von elektrisch betriebenen Fahrzeugen deutlich erhöhen sollten. Diese wollte er auf dem Kongress dem Publikum präsentieren.
Zurück bei der Spenglerei wechselten sie das Thema und schwelgten in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit am Polytechnikum. Nach einem reichhaltigen Nachtessen – Marios Frau beherrschte die italienische Küche, als wäre sie damit aufgewachsen – setzten sie sich an eine noch warme Grundmauer des Wohnhauses, und Mario fragte: »Du bist also der Meinung, die Benzintechnik ist die schlechtere?«
»Die Technik an sich ist nichts Schlechtes«, antwortete Carl. »Ich kann die Zuneigung der Benzinenthusiasten schon nachvollziehen, die Freude an der komplexen Mechanik, die gefühlvolle Hingabe zur lustig knatternden und rauchenden Maschine. Wenn es keucht und sich schüttelt –«
»So wie mein alter Esel!«, warf Mario lachend ein.
»Genauso ist es, wie ein liebes Tierchen, um das man sich kümmern muss, damit es nicht den Geist aufgibt. Die Technik ist schlichtweg unausgereift. Aber bei Fortbewegungsmitteln geht es um Zuverlässigkeit und Komfort. Und da hat der elektrische Antrieb die Nase ganz klar vorne. Es ist einfach der einzige logische Antrieb für ein Fahrzeug.«
Mario schenkte einem Gedanken nachhängend jedem ein Gläschen Grappa ein, und noch bevor er die schlanke Flasche wieder verkorkt hatte, sagte er: »Man müsste ein Netz von Läden aufmachen, die Benzin verkaufen. Oder wenn ich noch weiterspinne, ein Netz von Läden, bei denen man geladene Akkus gegen leere Akkus austauschen könnte.«
»Die Idee ist gut«, fand Carl. »Nur möchte ich meine teuren Akkus der Accumulatoren-Fabrik Oerlikon nicht gegen schlechte austauschen müssen.«
»Auch wieder wahr.«
Mario vertagte seine Entscheidung auf später. Vielleicht würde er sich auch wieder einen jungen Esel zulegen.
KAPITEL 3
Samstag, 14. Mai 1910, Vormittag
Ein Tag vor der Eröffnung des Kongresses
Luc de Phiton hörte Schritte den Flur entlangkommen. Es waren nicht die Schritte von jemandem, der sich in einem Nobelhotel als Gast heimisch fühlte, sondern von jemandem, der sich bis in die letzte Faser seines Selbst die Diskretion eines Hotelangestellten angeeignet hatte. Die Schritte waren vorsichtig und zurückhaltend, aber nicht etwa lautlos wie die eines Geistes, denn ansonsten hätte man die Gäste erschreckt. Es waren Schritte, die aussagten: Hier kommt ein Hotelangestellter, der nur seine Arbeit erledigt, damit Sie sich hier wohlfühlen. Auf solche Details wurde in einem Etablissement wie dem Grandhotel Giessbach großer Wert gelegt.
Doch Luc – obwohl er selbst ein Angestellter dieses Hotels war – wollte nicht im zweiten Stock gesehen werden. Insbesondere nicht vor der Tür von Friedrich Klemens’ Büro, wo er mit einem nachgemachten Schlüssel im Schloss rüttelte. Er hatte ihn offenbar nicht sauber genug geschliffen. Aber das Unterfangen konnte nicht verschoben werden, es musste ihm jetzt gelingen. Klemens und seine beiden Schergen waren unterwegs, um Dinge zu erledigen. Luc war aufgefallen, dass der Schokoladenfabrikant ein neues Notizbuch bei sich trug. Er hatte ein Auge für solche Details, was ihm in seiner mehrjährigen Tätigkeit als geheimdienstlicher Mitarbeiter schon oft von Nutzen gewesen war.
Klemens ging nie ohne ein Notizbuch vor die Tür. Mit seinem Gedächtnis stand zwar noch alles zum Besten, aber er musste sich mehr Informationen merken als die meisten Leute, und da halfen ihm die Notizen. Klemens führte immerhin einen Konzern und hatte nebenbei den Kongress in die Wege geleitet. Wenn jemand mit einem solchen Engagement kein Notizbuch brauchte, war er eine Zirkusattraktion.
Der Schlüssel wollte die Stifte im Schloss noch immer nicht bewegen. Die Schritte kamen näher, Luc schätzte, dass der Page in zwei oder drei Sekunden um die Ecke biegen und ihn erkennen würde.
Der Umstand, dass Friedrich Klemens ein neues Notizbuch benutzte, führte Luc zu der Annahme, dass das alte voll war und in diesem Büro aufbewahrt wurde. Er erhoffte, in den Notizen eine Fülle von aufschlussreichen Informationen den Kongress betreffend vorzufinden.
Die Tür zum Büro, das vor acht Monaten noch das Büro von Victor Hauser gewesen war, war neu eingebaut worden. Unter den Hotelangestellten rankten sich die verrücktesten Gerüchte, wie die Beschädigung der alten Tür Hauser zum Verkauf des Grandhotels bewogen hatte. Die neue Tür indes, aus massiver Eiche gefertigt, war ein wahres Bollwerk mit Scharnieren. Diese schlug so schnell niemand ein. Zudem war sie absolut schalldicht. Aber die beste Tür ist nicht so sicher wie ihr Schloss.
Es knackte, und das Schloss öffnete sich just in dem Augenblick, als der Page um die Ecke bog. Er trug zwei mit Clochen bedeckte Teller auf einem Tablett, daneben stand eine schmale Jugendstilvase mit einer gelb-roten Tulpe. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. Luc, ein Hotelangestellter, der nichts in diesem Stockwerk zu suchen hatte, stand mit aufgerissenen Augen vor der offenen Tür zum Chefbüro. Der Page starrte ihn fragend an.
Zeit, zu improvisieren. »Danke, dass Sie mich empfangen, Herr Dr. Klemens«, rief Luc kurzerhand in das leere Büro und trat in aller Selbstverständlichkeit ein. »Ja, in Ordnung, ich schließe die Tür.« Er ließ sie hinter sich ins Schloss fallen. Erleichtert atmete er aus. Ob der Page den Brocken geschluckt hatte?
Es klopfte. Luc wäre beinahe vor Schreck aufgesprungen. Es war ein diskretes und vorsichtiges Klopfen, das jedoch gut zu hören war. Das Klopfen eines Hotelangestellten. Des Pagen. Was sollte er tun? Es wäre ein Einfaches, den Jungen hereinzubitten und mit einer Klaviersaite zum Schweigen … Er brach den Gedanken ab. Der Junge würde vermisst werden. Abgesehen davon war er ein guter Junge. Sehr aufmerksam.
Luc öffnete die Tür einen Spalt und streckte den Kopf hindurch. »Herr Dr. Klemens lässt ausrichten, dass wir nicht gestört werden wollen!«
Der Page antwortete: »Ich bin untröstlich, aber richten Sie ihm bitte aus, er hat seinen Schlüssel außen stecken lassen.« Womit er diesen vom Schloss abzog und Luc überreichte. Dann wandte er sich ab und widmete sich weiter dem Zimmerdienst.
Luc verriegelte die Tür von innen. Reine Vorsichtsmaßnahme. Erstaunlicherweise passte der Schlüssel auf dieser Seite des Schlosses besser. Dann sah er sich um. Geschmacklose Einrichtung. Ausgestopfte Tiere, antike Waffen und Ausstellungsstücke aus Afrika, Indien und Brasilien. Ansonsten alles penibel aufgeräumt, Luc erblickte nirgendwo ein Staubkorn. Also, wo könnte der Alte sein altes Notizbuch aufbewahrt haben?
Luc wurde beim Deuxième Bureau als Agent zweiter Klasse gehandelt. Ein Agent zweiter Klasse reichte wohl, um die Stellung im Grandhotel Giessbach zu halten. Damals, 1905 in Marokko, waren Fehler passiert. Fehler, die zwar nicht Luc unterlaufen waren, doch sie hätten seinen Augen nicht entgehen dürfen. Unterlagen über die Truppenstärke französischer Forts waren beinahe in die Hände des Deutschen Kaiserreichs gefallen, was er in letzter Minute noch verhindern konnte. Wäre ihm dies nicht gelungen, hätte die Marokkokrise, wie sie von den Zeitungen genannt wurde, eine ganz andere Wendung genommen. Die Urheber der Fehler wurden weggesperrt. Luc hatte mehr Glück. Unterlassene Kontrolle hatte man ihm vorgeworfen, doch sein beherztes Eingreifen wurde zu seinen Gunsten angerechnet. Es blieb bei einer Degradierung.
Nichtsdestotrotz erledigte er seinen neuen Auftrag mit voller Hingabe. Vor einem halben Jahr hatte er sich vom Hotel einstellen lassen, mit Hilfe einer penibel durchdachten Legende. Selbst seine äußerliche Erscheinung hatte er so weit verfremdet, dass nie der Gedanke aufkommen könnte, er wäre als Spion tätig. Bereits vor Wochen hatte er sich einen Zweitschlüssel für Klemens’ Büro geschliffen, als sich ihm die Gelegenheit geboten hatte, sich das Original einen Tag lang zu borgen.
Die Aktenablage auf dem Schreibtisch hatte er abgesucht. Auch in den unverschlossenen Schreibtischschubladen fand er das Notizbuch nicht. Als Nächstes würde er das Bücherregal durchsuchen müssen.
Antoine Bailleul hatte sich diesen Vormittag an der Rezeption als Pièrre Trusseau eingeschrieben. Es war nicht geplant, dass er über Nacht bleiben würde. Nachdem Bailleul sein Gepäck auf das Zimmer hatte bringen lassen, hatte er Luc einen kurzen Blick zugeworfen. Das Zeichen. Nach fünf Minuten Wartezeit verließ Luc das Grandhotel und stieg den Wanderweg den Giessbachfällen entlang hinauf. Den Treffpunkt hatte Luc vorgängig erkundet. Es war ein gehöriger Aufstieg, höher, als die meisten Touristen zu gehen bereit waren, was sie beide vor neugierigen Blicken schützte, zudem übertönte das Rauschen des Baches ihr Gespräch. Eine womöglich übertriebene Maßnahme, doch sicher war sicher.
Bailleul war ein Dreckskerl. Schon immer gewesen. Schon damals, als sie in der Fremdenlegion im selben Fort nahe Algiers gedient hatten.
»Man könnte fast meinen, du willst mir an die Wäsche, wenn du mich in ein solch lauschiges Eckchen lockst!« Bailleul lachte allein, was ihn aber nicht zu stören schien. »Sacrebleu! Wie siehst du eigentlich aus? Gab es Rabatt auf Schnurrbart in der Familienpackung?« Wieder sein kehliges Lachen. Er musste sich ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen.
»Der Schnurrbart ist Bestandteil meiner Tarnung«, erklärte Luc.
»Gehört der zur Ausrüstung eines Agenten zweiter Klasse?«
»Lass uns zum Geschäftlichen kommen.«
»Schön hast du es hier oben. Muss ich schon sagen. Großartige Landschaft! Und dieses Hotel! Das kann sich mit den besten messen. Glaube mir, ich habe schon in einigen dieser Preisklasse residiert. Bringt meine Anstellung als gefragter Agent so mit sich, n’est-ce pas?«
Antoine war offenbar auf der Suche nach Anerkennung. Von Luc würde er die nicht kriegen.
»Vor fünf Tagen war ich beim Chef auf seinem Château«, fuhr Bailleul fort. »Der Minister saß ebenfalls in der Laube. Als ich gerade so über die Bretter marschierte, erblickte ich durch einen Spalt einen blassen Unterschenkel. Du weißt, ich kenne mich mit blassen Unterschenkeln aus!« Er versuchte, Luc mit dem Ellenbogen in die Seite zu knuffen. Luc wich rechtzeitig zurück.
»Was ich dann unter der Laube hervorgezogen habe, war eine Angestellte des Chefs, die für die Deutschen geschnüffelt hat. Du hättest den Chef sehen sollen, wäre vor Scham am liebsten im Erdboden versunken. Stell dir vor, eine Spionin bei Lambert zu Hause!«
»Was habt ihr mit ihr gemacht?«, fragte Luc.
Antoine zog seinen Daumen über seine Kehle. »Schade um sie. War noch eine Hübsche. Aber ich glaube, das hat Lambert und den Minister ziemlich beeindruckt. Weißt schon, gekonnt ist gekonnt.«
»Wenn du meinst.« Luc begann sich zu langweilen.
Antoine bewunderte die Aussicht und rieb sich gedankenverloren die Narbe über dem linken Auge. Sie war von der Art, die ein Gesicht nicht entstellte, sondern dem Träger einen verwegenen Ausdruck verlieh. Bailleul trug sie mit Stolz.
»Also, was ist unsere Mission?«, kam er nun endlich zur Sache. »Ich wurde nur dahingehend informiert, dass ich hier aufkreuzen, den Touristen mimen und ein Souvenir mit nach Hause bringen soll. Hast du es da?«
Luc hatte das »Souvenir« noch immer nicht. Er suchte in Klemens’ Büro das gesamte Bücherregal nach dem Notizbuch ab. Es war Bestandteil der Mission, die Unterlagen erst nach der Ankunft Bailleuls zu beschaffen. So standen die Chancen besser, dass Bailleul diese bereits außer Landes gebracht hatte, wenn ihr Fehlen bemerkt wurde.
Natürlich musste der Agent zweiter Klasse in das Büro einbrechen und das Notizbuch beschaffen und nicht etwa der Topagent. Dieser musste ja auch nicht seine seit einem halben Jahr mühsam aufgebaute Tarnung riskieren. Andererseits, wenn man wollte, dass etwas richtig gemacht wurde, dann machte man es am besten selbst.
Nachdem Luc sämtliche Ablagemöglichkeiten durchsucht hatte, blieb nur noch der Aktenschrank mit den abgeschlossenen Schubladen übrig. Wo würde jemand wie Klemens die Schlüssel dazu aufbewahren? Bestimmt in der einzigen abschließbaren Schublade des Schreibtisches. Und wo hatte Klemens den Schlüssel hierzu? Vermutlich am Schlüsselbund, den er bei sich trug.
Luc untersuchte das Schloss. Im Gegensatz zum modernen Türschloss war dies ein altes und einfaches Fabrikat. Plötzlich wurde von außen ein Schlüssel in die Tür gesteckt. Luc erstarrte.
Wolken von der Farbe von Ambossen waren aufgezogen, als Luc einige Stunden zuvor neben Bailleul gestanden hatte. Es würde jeden Augenblick zu regnen beginnen. Von hier oben am Giessbach, eingebettet in die monumentale Landschaft, sah das Grandhotel winzig, wie ein detailreiches Touristensouvenir aus. Ich hätte schon früher heraufkommen und die Aussicht genießen sollen, hatte Luc gedacht.
Bailleul wollte keinesfalls heute schon abreisen. Er habe ein Zimmer gebucht und könne genauso gut eine Nacht bleiben. »Lasst uns einen einzigen Tag opfern, um vielleicht ein ganzes Leben zu gewinnen«, sagte er.
Hatte er eben aus »Les Misérables« zitiert? Luc starrte ihn an. Er hätte nicht gedacht, dass dieser Holzklotz fähig war, ein Buch zu etwas anderem zu verwenden, als eine Spinne totzuschlagen.
»Der Kongress beginnt doch erst morgen. Mir gefällt es hier«, fügte Bailleul hinzu.
»Ich halte das für keine gute Idee, Antoine. Das ist ein unnötiges Risiko«, gab Luc zu bedenken. Aber Bailleul war im Grunde genommen Lucs Vorgesetzter. Er hatte die Befehlsgewalt, und wenn er entschied zu bleiben, dann war es so.
Sie hatten Ort und Zeit für das nächste Treffen verabredet. Wenn alles gut ging, würde er ihm das Notizbuch aushändigen. Wenn es nicht gut ging, dann … Darüber wollte Luc im Grunde gar nicht nachdenken.
Jetzt hörte Luc, wie Klemens in sein Büro trat. Zornig hastete der Alte zum Schreibtisch und durchsuchte in gebückter Haltung den Aktenstapel. Seine Lippen bewegten sich flüsternd.
Luc zwang sich, leise zu atmen. Die schweren Gardinen vor seinem Gesicht dufteten frisch gewaschen. Wenn er die Hand ausgestreckt hätte, hätte er Klemens am grauen Jackett packen können.
Plötzlich schoss Klemens hoch und verließ mit einer Mappe unter dem Arm den Raum. Gewissenhaft verriegelte er von außen die Tür, damit ja niemand eindringen konnte. Die Ironie in Kombination mit der Erleichterung ließ Luc schmunzeln. Er kam hinter dem Vorhang hervor. Es war nicht verboten, auch einmal etwas Glück zu haben.
Nun musste er das Schloss der Schreibtischschublade knacken. Auch wenn er keinen Schlüssel dazu hatte, war er nicht unvorbereitet. Er kniete sich hin und entnahm der Innentasche seiner Livree eine kleine lederne Werkzeugrolle, die er auf der Tischplatte auslegte. Er suchte sich zwei Werkzeuge aus. Das eine, den Spanner, führte er in das Schloss, bis der auf den Schlosskern drückte. Mit dem anderen, dem Haken, tastete er nach dem ersten Stift. Mit oft eingeübten Bewegungen ruckelte er am Haken, bis sich der Stift in die entriegelte Position hebeln ließ. Das Gleiche wiederholte er mit den übrigen Stiften, bis ein leichtes Klicken signalisierte, dass sich die Schublade nun öffnen ließ.
Sie beinhaltete eine Menge Büromaterial wie Schreibfedern, Klammern, Brieföffner, Tintenfass, aber auch allgemein Nützliches wie Schnur, Nägel, eine 38er und einen Kaffeelöffel. Darunter lag ein Ring mit zwölf Schlüsseln für zwölf abschließbare Aktenschubladen.