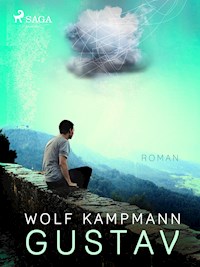
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Was Wahrheit ist, entscheide ich!" Diese Maxime trägt Gustav Bülow durch die siebzig Jahre seines Lebens, vom Ende des Zweiten Weltkrieges über den Zusammenbruch der DDR bis zur Jahrtausendwende. Er ist Künstler, Forscher, Womanizer und Weltenretter. Sein Bezugssystem ist das Reich der Fantasie. "Wer Probleme damit hat, ist ein Idiot." Er erfindet blutstrotzende Kriegsabenteuer, samt einer mysteriösen Begegnung mit Hitler persönlich, eine Ehe mit einer Mohawk in Kanada und Abenteuer mit Wölfen mitten in der Zivilisation. Die Wirklichkeit ist Gustav stets dicht auf den Fersen, doch er ist der Wahrheit immer eine Nasenlänge voraus.Wolf Kampmann erzählt mit Wortwitz die Lebensgeschichte eines Hochstaplers und entführt die Leser in eine bunte Welt voller Mut, Fantasie und Husarenstücke. Mit einem einzigen Satz kann Wolf Kampmann – wie seine Hauptfigur – "Hunderte in Erstarrung versetzen oder zu Tränen rühren". Dieser Romanheld verspricht: "Ihr werdet euch noch alle wundern!"Der Autor selbst über seinen Debütroman "Gustav":"'Gustav' ist zwar in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts verankert, hat jedoch einen höchst aktuellen Subtext. Geschichte findet immer statt, auch jetzt. Es kommt für jeden Menschen darauf an, sein Leben in diesem Rahmen zu nutzen, und sich nicht hinter Ausreden zu verstecken, warum er an sich selbst und seinen Möglichkeiten vorbei gelebt hat. "Gustav" ist ein inniges Bekenntnis zur Einzigartigkeit des Lebens und der Unwiederholbarkeit jedes einzelnen Augenblicks.Dem ganzen Buch liegt eine Melodie zugrunde. Auch wenn es in der Geschichte zu keinem Zeitpunkt um Musik geht, ist es doch ein zutiefst musikalisches Buch mit einem kontinuierlichen Groove, das darauf wartet vorgelesen oder noch besser vorgesungen zu werden..."Buchhändler über "Gustav":"Endlich konnte ich 'Gustav' lesen und bin unglaublich beeindruckt! Dieser Sog von der ersten Seite, das Unbestimmte, die Phantasie, die genauen Bobachtungen, die unerfüllten Wünsche. Ein ganz starkes Buch!"(Martina Kraus, Buchhandlung RavensBuch)-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf Kampmann
Gustav
Roman
Saga
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden.Eingeflossen sind jedoch Erinnerungen an und von M.V.
1.
Ein Geräusch. Gustav Bülow erwacht. Er weiß nicht, wie lange er geschlafen hat. Das Gefühl für Zeit ist ihm längst abhanden gekommen. Wer wie er in der Epoche der Fantasie aufgewachsen ist, kümmert sich irgendwann nicht mehr um das mechanische Ticken der Uhr. Schlaf ist ohnehin nur eine Ausrede für Versager. Gustav schläft nicht.
Wenn die anderen die Augen schließen, um sich von der Wirklichkeit auszuruhen, schickt er sich erst an, sein wahres Leben zu genießen. Das ist keine Flucht. Er wechselt nur die Ebene, als würde er ein anderes Zimmer betreten. Wie und warum ihm dieser chronologische Zustandswechsel gelingt und anderen nicht, kann er sich nicht erklären, aber – offen gestanden – es hat ihn auch nie interessiert. Er macht es einfach.
Schon sein Vater und seine Lehrer hatten ihn mit ihrer lächerlichen Vorstellung von der Unumkehrbarkeit der Zeit genervt. Zeit ist Geld, nutze den Tag, was du heute kannst besorgen … Alles Unsinn. Jedem steht ein Reich offen, in das er entfliehen kann. Man muss nur die Tür kennen und rechtzeitig nach der Klinke greifen. Doch sein Vater und seine Lehrer, all das ist lange her.
War der Vater ein alter oder junger Mann? Gustav weiß nicht, wie er sich erinnern soll. Gleich wird er wieder die Augen schließen, womöglich wird er ihn dann treffen. Gar nicht mehr lange, dann wird auch sein eigenes Leben Vergangenheit sein. Als würde das etwas ausmachen, denn mit dem Leben verhält es sich ja wie mit dem Wachsein. Alles eine Frage der Luken, durch die man schlüpfen kann.
Aber da war ja noch dieses Geräusch. Gustav liegt in seinem Bett, von dem seine Frau behauptet, es wäre sein Krankenbett. Gustav weiß es besser. Zugegeben, manchmal überkommt ihn diese Müdigkeit, diese unerträgliche Schwere, dann will er sich gar nicht rühren. Und sich erinnern schon gar nicht. Dabei hat er auch immer wieder Momente, in denen er ganz der Alte ist. »Ihr werdet euch noch alle wundern.«
Unterhalb der Zimmerdecke umschwirrt ein Geschwader Fliegen die liebevoll mit Fragmenten von Hirschgeweihen verzierte Lampe, als wäre es eine Raumstation. Gustav versucht sie zu zählen. Es gelingt ihm nicht, es ist ihm noch nie gelungen. Wenn die Viecher doch nicht ständig von ihren Flugbahnen abweichen würden. Für einen Augenblick stellt er sich vor, die schwirrenden Punkte wären Geier und die Enden der Geweihe ferne Andengipfel. Wie imponierend ein Schwarm Fliegen doch aussehen kann, wenn man ihn von der Zimmerdecke in Vorpommern über ein Gebirge am anderen Ende der Welt versetzt. Für das Große im Kleinen hat er schon immer ein Auge gehabt.
Neben seinem schneeweiß bezogenen Bett wartet auf einem dreibeinigen Hocker ein kleiner Teller mit einem halben Wurstbrot und ein paar einsamen Weintrauben darauf, in die Küche zurückgetragen zu werden. Hin und wieder unterbricht eine der Deckenfliegen ihre Lampenumrundung für einen kurzen Besuch auf der Wurstscheibe, um sogleich wieder ans Firmament des Zimmers zurückzuschwirren. Gustav ist für diese Stippvisiten seiner klitzekleinen Mitbewohner dankbar, als würden sie nicht der Wurst, sondern ihm gelten.
Eine winzige Ecke der Brotscheibe fehlt, wahrscheinlich hat er vorhin einmal abgebissen. Er kann sich nicht erinnern. Wozu auch? Früher hat er gern gegessen. Vor allem viel, ein Mann wie er braucht schließlich Kraft. Aber jetzt interessiert ihn Essen nicht mehr.
Eine Zigarette, das wär’s jetzt. Seine Frau – wie hieß sie noch gleich? – erlaubt ihm das Rauchen jedoch nicht, wenn er allein im Bett liegt. Ihr schönes Haus könnte ja abfackeln. Die dumme Kuh. Hat sowieso nie Zeit für ihn. Ständig hört er sie im Untergeschoss mit dem penetranten Pack von Nachbarn quasseln. Sie wartet nur darauf, dass er abkratzt. Gustav muss bei diesem Gedanken lachen.
Das Geräusch kommt von der Tür seines kleinen Zimmers unter dem Dach. Durch das große Fenster dringt die Sonne ein und tastet die Tapeten ab. Die breite Wand gegenüber dem Bett hängt voller Bilder – er und seine Hunde. Ja, das waren die Einzigen, die ihn wirklich verstanden haben. Hunde lügen nicht, sind niemals illoyal, missbrauchen unter keinen Umständen das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt. Die Liebe eines Hundes ist bedingungslos und aufrichtig, sein Gebell niemals geschwätzig. Seine Anhänglichkeit ist ohne jeden Hintergedanken. Mit Hunden kann man das Lager teilen. Sie sind da, wenn man sie braucht.
Vier Hunde hat er gehabt. Sie alle sind längst fort und warten auf der anderen Seite auf ihn. Das wird ein Fest. Auf einer länglichen Holzkommode gegenüber dem Fußende liegen ein paar besonders dekorative Stücke seiner einst ansehnlichen Sammlung von Fossilien und anderen Eigentümlichkeiten der Natur. Bei einigen hat er ein wenig nachgeholfen, um ihnen ihr heutiges Aussehen zu verpassen. Er kann ja nichts dafür, dass selbst die Natur zuweilen ihre Unzulänglichkeiten hat.
Aber wen interessiert das schon, nur der Eindruck zählt. Ein wenig Lack hier, ein paar Pinselstriche dort, auch Leim hat noch nie geschadet, schon wird aus ein paar Scheren und Schalenteilen, die er einzeln am Strand aufgelesen hat, ein kompletter Hummer. Neben der Tür türmen sich die Trinknäpfe seiner Hunde, die er über all die Jahre wie Heiligtümer aufbewahrt hat, zu einem Altar seiner Lebensgeschichte.
Ach ja, die Tür. Da war doch was. Im Moment kann Gustav sich nicht so einfach bewegen wie sonst. Er muss seinem Nacken bewusst den Befehl geben, den Kopf zur Seite zu drehen, selbst dann fällt es ihm noch schwer. Wo er einst Muskeln gewohnt war, reiben jetzt schmerzhaft die Knochen aufeinander. Soll er oder soll er nicht? Dann ein Räuspern von der Tür her. Offensichtlich steht da jemand. Elke – stimmt, das war ihr Name – ist es nicht. Die würde sich nicht diskret räuspern, sondern ihn ohne zu fragen mit ihren dummen Alltäglichkeiten vollquatschen, ihn mit irgendwelchen Pillen oder Tropfen martern, die sie sonst niemandem in ihrer Apotheke aufschwatzen kann, oder stolz reinplatzen und ihn mit den Worten »Weißt du, wer heute zu dir kommt« aus seinen intimen Vorbereitungen reißen. Als ob er hier noch jemanden sehen will. Nein, Elke ist es nicht.
Nun macht er sich doch die Mühe, den Kopf zu wenden. Langsam, ganz langsam. Um keine Energie zu verschwenden, schließt er dabei die Augen. Der Schlaf will schon wieder nach ihm greifen.
Im Türrahmen steht eine Gestalt, offenbar ein Mann. Anfangs nimmt er nur die Umrisse wahr, aber da ist etwas, das ihn zwingt, den Besucher etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Gustav hat ihn noch nie gesehen, und doch wirkt der andere in seiner Durchschnittlichkeit so vertraut, als wäre er ihm schon tausendmal begegnet, ja als hätte er ihn wie sein Alter Ego ein Leben lang begleitet. Mittelgroß, mittelblond, mittleren Alters, der Zweiteiler mittelgrau. In seinem Revers steckt ein winziges goldenes Abzeichen, doch Gustav kann nicht erkennen, was es darstellt. Wo hat die Kuh denn schon wieder seine Brille hingelegt? Dann muss er eben versuchen, seinen unangemeldeten Gast auch ohne Sehhilfe etwas eingehender in Augenschein zu nehmen. Auf seine Sinne konnte er sich ja bis zuletzt ganz gut verlassen.
Unter den immer noch buschigen Brauen kneift er die müden Augen zusammen. Nein, dieses Gesicht sagt ihm wirklich gar nichts. Sowas von unauffällig, absolut nichts Charakteristisches, das er irgendwo in seiner Erinnerung verorten könnte. Nur die Haltungsschwäche sticht ins Auge, der schmächtige Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, der Hals vom Kopf in den Rumpf gedrückt, die Knie unentschlossen angewinkelt. Irgendwie weibisch. Unter dem Arm trägt er eine speckige Kunstledermappe. Ein Beamter, der irgendeine Unterschrift von ihm will?
Gustav hat schon lange nichts mehr unterschrieben. Das erledigt jetzt die Frau für ihn. Seine Elke. Wie gut, dass er sie hat. Morgen früh muss er ihr Blumen kaufen. Rosen, einen Riesenstrauß. Hinter den schmalen Schultern des Eindringlings macht er weitere Gestalten aus, doch mit denen wird er sich später beschäftigen.
Gustav nimmt alle Kraft zusammen, um mit seiner Stimme diesen Eindruck von früher hervorzurufen, als er von der Bühne herab mit einem einzigen Wort Hunderte in Erstarrung versetzen oder zu Tränen rühren konnte. Die Bühne und das Leben. Und jetzt?
Er muss Haltung bewahren. In entscheidenden Momenten hat er schließlich immer auf Höflichkeit geachtet. »Guten Tag?« Es ist mehr Frage als Begrüßung.
Eine Pause entsteht. Der Fremde lächelt und schweigt. Gustav weiß nicht, was er davon halten soll. Er beginnt, Vertrauen zu fassen, aber gerade das macht ihn zugleich misstrauisch. Will ihn da jemand mit geheuchelter Nähe einwickeln? Abstand zwischen sich und anderen war ihm stets wichtig. Nur nicht zu schnell die Karten auf den Tisch legen. Nein, das Bild gefällt ihm nicht. Also bloß nicht das ganze Pulver auf einmal verschießen, das trifft es schon eher. Das Kartenspiel war nie seine Sache, die Freuden des Waidmanns hingegen haben seit den Kindheitstagen seine Sehnsucht beflügelt. Im Wald und auf der Heide, wie von selbst spitzen sich seine Lippen, als wollten sie die geliebte Weise pfeifen, wie einst, als er mit den Hunden unterwegs war, als er noch Laub unter den Füßen und Moos unter den Fingernägeln spürte. Ja, ein Mann muss schießen können. Schießen! Damals, als er …
Er will gerade die Augen schließen, um den Schauplatz zu wechseln, da hört er, wie der andere tief durchatmet. Gustav kennt dieses rhetorische Schniefen. Da will sich einer Gehör verschaffen, um etwas Gewichtiges loszuwerden. Na gut, soll er. Die Stimme ist genauso mittelmäßig wie alles andere an dieser armseligen Figur. »Gustav, willst du nicht mitkommen?«
Wieder eine Pause. Wie kommt diese Nervensäge dazu, ihn einfach zu duzen? Woher kennt der eigentlich seinen Namen? Und wohin mitkommen? »Wer sind Sie überhaupt?«, entfährt es ihm missmutig und wesentlich weniger auf Form bedacht als eine halbe Minute zuvor.
»Ich bin der Tod.«
Gerade weil es so sanft ausgesprochen wird, trifft es Gustav wie ein Meteorit. Der Tod? Jetzt? Plötzlich ist er hellwach. Der Unauffällige lächelt und blickt ihn fest an. Seine Haltung wirkt gar nicht mehr so schlaff wie noch vor wenigen Augenblicken. Gustav verspürt das Bedürfnis, die Schuhe des immer noch in der Tür Stehenden zu sehen. Mit Mühe hebt er seinen Kopf über die Bettkante. Gleichzeitig achtet er darauf, dass seine nackten Füße unter der Bettdecke nicht in Richtung Tür zeigen. Unter dem leichten Schlag der grauen Hosenbeine erkennt er schwarze, abgerundete Schuhspitzen, vorn leicht abgestoßen, oben voller Staub und getrockneter Schlammspritzer. Gustav vermutet, dass die Hacken der billigen Gummisohlen schiefgetreten sind. Das soll der Tod sein? Wie banal! Bestimmt nur wieder so ein geschmackloser Scherz seiner dämlichen Nachbarn, die ihn auf diese Weise vorzeitig ins Jenseits befördern wollen.
In einem Volksstück hat er mal selbst den Tod gespielt. Nicht nur das Publikum, auch seine Kollegen erschauerten angesichts seiner Verkörperung des Bösen. Geradezu lachhaft, wie dieser Todesschnösel da auftritt. In dieses angenehme Gefühl der Überlegenheit drängt sich wie ein schneidender Luftzug durch die Hintertür seiner Gedanken die Formulierung »der Tod kommt auf leisen Sohlen«. Gustav wird nachdenklich: »Haben Sie vielleicht eine Zigarette?«
»Tut mir leid, ich rauche nicht.«
Von wegen. Gustav weiß sich zu helfen. Lange und genießerisch stößt er Luft zwischen den Lippen hervor und folgt mit den Blicken vergnügt den tanzenden Schimären des erdachten Tabakrauchs. »Wieso der Tod?« Jetzt ist er es, der eine rhetorische Pause einlegt. Und nach einer kleinen Ewigkeit und weiteren Zügen aus der unsichtbaren Zigarette: »Der Tod ist doch nicht so freundlich wie Sie. Er ist grausam und unbarmherzig. Er bittet nicht, sondern fordert. Meist nicht einmal das, er klopft kurz an die Tür und holt ohne Worte, wen er will. Ich weiß, wovon ich rede.« Gustav spürt, wie seine Stimme an Schärfe verliert. Hoffentlich hat er es diesem sichtlich um Harmlosigkeit bemühten Wichtigtuer jetzt gegeben. Der Fremde aber tut, was er die ganze Zeit schon getan hat. Er lächelt.
Was soll das? Wo bleibt der Respekt? Es reicht. Gustav hat von diesem Gespräch genug. Der Schlaf wartet, er schließt die Augen und will seinem Körper das Kommando geben, sich zur anderen Seite zu drehen. Doch wieder vernimmt er dieses Räuspern. Offenbar lässt der penetrante Eindringling nicht so leicht locker. Gustav kann sich nicht dagegen wehren.
»Es gibt viele Tode«, hört er den anderen sagen.
Im Zimmer ist es totenstill. Gustav lauscht. Der Unscheinbare redet mit ihm wie mit einem Kind, langsam, nachsichtig und mit vielen Pausen, fast als würde er singen. »Es gibt den grausamen Tod, den heimtückischen Tod, den plötzlichen Tod, den Tod durch Fremdverschulden, den Freitod, den langwierigen Tod, den lauernden Tod, den lächerlichen Tod, den plötzlichen Kindstod, nicht zu vergessen das Massensterben – und ich bin eben der freundliche Tod. Ich weiß, ich werde immer mit schwarzem Umhang und Sense dargestellt, aber das ist ja nur ein billiges Klischee. Wer unter den Lebenden hätte mich schon jemals so zu Gesicht bekommen, dass er von mir hätte erzählen können? Der eine oder andere ist mir vielleicht im letzten Augenblick von der Schippe gesprungen. Auch das ist wieder nur so eine Redensart, aber bitte, niemand soll mir Kleinlichkeit nachsagen. Die Erinnerung dieser Deserteure habe ich sowieso stets sofort gelöscht. Im schlimmsten Fall haben sie von Nahtod-Erfahrung erzählt. Reine Einbildung, ein Nahtod ist mir wirklich noch nicht begegnet. In Wirklichkeit ist alles ganz anders, als die Normalsterblichen es glauben. Aber wer sollte das besser wissen als du, Gustav? Ich meine, das mit der Wirklichkeit. Kommst du jetzt mit oder nicht?«
Gustav ist wieder hellwach. Das Wort Deserteur hat ihn an etwas erinnert. Nichts Angenehmes. Aber darüber kann er jetzt nicht nachdenken. Langsam beginnt ihm zu dämmern, dass dies hier kein Scherz seiner Nachbarn ist. Verdammt, wo ist nur diese Scheißbrille? Sein Blick richtet sich mit der ganzen Restschärfe auf das kleine goldene Abzeichen. Kaum zu erkennen, aber es handelt sich tatsächlich um eine Sense.
In der Gefolgschaft der grauen Erscheinung beginnt es unruhig zu werden. Zum ersten Mal unterzieht Gustav die Menschentraube einer genaueren Prüfung. Sie hat sich im Rücken ihres merkwürdigen Anführers devot gruppiert wie ein Rudel christlicher Märtyrer hinter einer mittelalterlichen Darstellung des Heilands. Das sind doch Hartmut, Fritz und Günter, die nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind. Und sein langjähriger Freund, der Schauspieler Paul Borchert, mit dem er früher regelmäßig auf Sauftour war. Seitdem der Arsch als Fernsehkommissar dauerbesetzt war, hatte er den Kontakt abgebrochen. Pauls Erfolg war für Gustav wie ein Verrat an der gemeinsamen Freundschaft. Was hätte er selbst für einen Kommissar abgegeben! Als der Kumpan von früher vor ein paar Jahren nicht mehr aus dem Koma erwachte, weinte er ihm keine Träne nach. Das hatte er nun davon, der alte Suffkopp. Und – sein Herz schlägt fast bis zum Kieferknochen – da ist sein Vater.
Er selbst ist jetzt zwei Jahre älter als sein alter Herr damals war, als ihn völlig unerwartet der Schlag hinstreckte. Kaum zu glauben. Doch hier steht der Vater als junger Mann. So, wie Gustav als Junge von unten zu ihm aufgesehen hat, stark war er, entschlossen, streng, unnachgiebig und doch in geheimen Momenten, die nur ihnen beiden gehört hatten, liebevoll und gütig. Auch in anderen Silhouetten glaubt er ehemalige Wegbegleiter zu erkennen, die der Tod bereits mit sich gerissen hat.
Die Sonne hat sich aus dem Zimmer zurückgezogen. Die Hundebilder an der Wand sind nur noch neutrale Vierecke in Grau. Keine geliebte Schnauze mehr, die ihm ihre rosafarbene Zunge schlabbernd entgegenstrecken würde. Ist es Abend oder sind einfach nur Wolken aufgezogen? Vielleicht weigert sich das ewige Symbol des Lebens auch nur, Zeuge dieser düsteren Szene zu sein. Gustav versucht noch einmal, das Gesicht des unheimlichen Besuchers abzutasten, doch das liegt jetzt im Halbschatten, als hätte er klammheimlich doch noch eine Kapuze über seine grausige, hier auf Unschuld getrimmte Visage gezogen. Kein Zweifel, das ist der Tod, wenn auch der freundliche.
»Elke!« Er ruft, so laut er kann, doch sie hört ihn nicht. Niemand hört ihn in diesem Augenblick, in dem der Sensenmann in seiner Tür steht. Sein kultiviertes Benehmen und die lächerlich moderne Aufmachung ändern ja nichts an der Tatsache, um wen es sich da handelt. Verdammter Mist!
»Elke!« Der flehende Ruf nach seiner Frau erstickt in seiner trockenen Kehle und hinterlässt ein stumpfes Echo unterhalb seiner Schädeldecke. Ihm ist, als würde der Tod ihn leise auslachen, doch genau weiß er es nicht. Flüsternd wendet er sich an sein Gegenüber. »Wollen Sie nicht endlich abhauen? Ich verliere auch kein Sterbenswörtchen darüber, dass Sie hier waren.«
»Ich habe Zeit«, säuselt die sanfte Stimme unbeeindruckt. Immer wieder dieses unsinnige Wort Zeit. Selbst Gevatter Tod ist davon besessen. Einmal mehr muss Gustav grinsen, denn er glaubt, seinen Gesprächspartner durchschaut zu haben. Zum Glück ist der einzige Hocker im Zimmer mit dem Teller blockiert. Elke ahnt gar nicht, was sie ihm da für einen Gefallen getan hat. Nicht auszudenken, wenn dieser lästige Freundlichtuer sich jetzt auch noch zu ihm ans Bett setzen würde. »Du kannst ruhig mitkommen, es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst«, raunt es aus der Entourage des Jenseitigen.
»Früher oder später wirst du sowieso mitkommen, ob du willst oder nicht«, beharrt er jetzt in deutlich sachlicherem Ton, und dann unerwartet distanziert: »Sei froh, wenn ich dich hole und nicht eines Tages einer meiner Kollegen in deiner Tür steht.«
Wie bitte? Das wäre ja noch schöner. Den Augenblick seines Abgangs will Gustav immer noch selbst bestimmen. Als hätte er sich jemals etwas vorschreiben lassen. Wenn seine Gliedmaßen ihm gehorchen würden, dann würde er es diesem ungehobelten Kerl zeigen. Soll ihn doch der Teufel holen. Lustige Vorstellung: Der Teufel holt den Tod. Gustav versucht sich vorzustellen, wie das in einer Theaterinszenierung aussehen würde. Welche Rolle würde er lieber spielen, Teufel oder Tod? Er entscheidet sich für den Teufel. Mephisto hatte er nie spielen dürfen, immer nur Faust.
Er weiß nicht, ob er zwischendurch wieder eingeschlafen war. Das Zimmer ist dunkel. Ist der Graue noch da? Gustav kann ihn nicht mehr sehen. Besser so. In diesem Erlösung verheißenden Moment des unwiderruflichen Loslassens hat er nämlich ganz plötzlich noch etwas anderes zu klären. Er gerät in Panik.
Da steht diese eine Frage im Raum, vor deren Beantwortung er sich ein Leben lang erfolgreich gedrückt hat. Seine Augen sind wieder geschlossen. Gustav hat das Gefühl, immer leichter zu werden, abzuheben und von einer Anhöhe aus ein letztes Mal auf sich selbst herabzublicken, wie er da unten in seinem Bett liegt. Doch die Züge seines Spiegelbilds beginnen sich in ihrer Umgebung aufzulösen.
Er versucht seinen Blick für diese allerletzte Begegnung zu fokussieren wie das Teleobjektiv seiner Kamera, die ihn über all die Jahre ebenso treu begleitet hat wie seine Hunde, und sich selbst in ein Gespräch zu verwickeln. Aber wer soll den Anfang machen? Gustav weiß nicht, ob er es laut ausspricht oder einfach nur die Atemluft unter seinen Bartstoppeln hervorstößt. »Wer bin ich?«
Hat er tatsächlich eine Antwort erwartet? Statt abschließender Klarheit breitet sich ein verklärtes Lächeln in seinen Zügen aus. Na klar, er ist immerhin ein Auserwählter. Während alle anderen vor, hinter und neben ihm nur stupide ihrem Lebensfaden folgen, dessen einzige vorgegebene Richtung keinerlei Abweichung zulässt, hat er nicht ein, sondern viele Leben gelebt. Gustav hat es besser gemacht. Aber jetzt – buchstäblich im Angesicht des Todes – muss er eine Entscheidung treffen. »Wer?«, fleht es immer eindringlicher in ihm. Er möchte aufspringen, die Arme hochreißen, doch die Kräfte verlassen ihn.
Da spürt er auf seiner Haut wieder den Atem seines Gastes, der ihn umhüllt wie einst die Mutter, wenn sie ihn ein ganzes Menschenleben zuvor mit einem Tuch aus der Badewanne hob. Gerade noch die liebe Mutter und jetzt der Tod. Sein Herz schlägt an, er will erschauern, doch der Hauch des Todes riecht nicht etwa verfault oder muffig, nein er riecht nach Wald, Moos, morgendlichem Nebel und den nassen Felsen des Elbsandsteingebirges. Bald wird ein Baum aus seinen Eingeweiden wachsen. Und Gustav wird zu Hause sein. Er atmet tief ein. Bevor er die allerletzte Möglichkeit verpasst, will er sich ein einziges Mal zu dem winzigen Krümelchen Lebenswirklichkeit bekennen können, das ihm geblieben ist. Gleich, gleich …
2.
Wenn sich Gustav Bülow an seine Kindheit erinnerte, hatte er ein unübersichtliches Mosaik vor Augen, das sich aus Hunderten zusammenhangloser Einzelbilder aufbaute. Nur der verbindende Kitt der elterlichen Erzählungen machte daraus einen kontinuierlichen Film der Ereignisse mit Anfang und viel zu frühem Ende. Aus der Sicht des Erwachsenen konnte Gustav natürlich nur schwer unterscheiden, welche Szenen auf eigener Erinnerung beruhten und welche von den Begleitern seiner unbeschwerten Kindheitstage ergänzt worden waren.
Doch das machte ihm gar nichts, denn zu diesen beiden Säulen des Denkens an seine ersten Tage kam noch eine dritte tragende Komponente hinzu, die seine Lebenschronik erst zu dem machte, was sie war. Eine Unzahl von gehörten, angelesenen und in Wachträumen ersehnten Begebenheiten, die sich genau so zumindest hätten ereignet haben können und auf deren Glorie Gustav keineswegs verzichten wollte, verdichtete seine Kindheit zu einem einzigen langen Abenteuer. Doch wer wollte ihm das jetzt noch vorhalten? Der Schleier der Lebensjahre hatte die Grenzen zwischen Sehnsucht und Wahrheit ohnehin längst aufgehoben.
Gustav Bülow durfte auf eine knallbunte Kindheit zurückblicken. Seine Erinnerungen hatten so gar nichts gemein mit den im Kino oft in Schwarzweiß getunkten Rückblenden, mit denen die Vergangenheit im Auge des Betrachters von der Gegenwart abgesetzt werden soll, als ließe sich die Erinnerung in eine Ära vor und nach Einführung des Farbfernsehens einteilen.
Für Gustav war es genau umgekehrt. Je weiter sich sein Alltag von der unverschämten Grenzenlosigkeit der Knabenzeit entfernte, desto praller wurde deren retrospektive Farbenpracht. Die schwarzen und graubraunen Tage, von denen es nicht wenige gab, blendete er einfach aus. Damals war er ein Abenteurer, stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen, ein später Kumpan von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Mit dem kleinen Unterschied, dass er beide gleichzeitig sein durfte.
Am nordwestlichen Stadtrand von Dresden herrschte sommers wie winters Idylle. Die Elbe schleppte sich träge und ölig dahin, überflutete in manchen Jahren die sie umfangenden Wiesen, um den Stadtteil Cotta erstreckte sich ein Gürtel von Parks, Wäldern und Feldern. Als Junge genoss Gustav alle erdenklichen Freiheiten – solange er allein war. Nach Erledigung seiner schulischen Pflichten, die ihm im Grunde ziemlich egal waren, rannte er, so schnell ihn seine Füße trugen, in den nahe gelegenen Zschoner Grund, ein Wäldchen, das trotz seiner relativ geringen Ausdehnung mit Bächen, Hängen und Felsen wie das endlose Labyrinth eines amerikanischen Canyons wirkte. Was er am Abend zuvor in den Büchern Karl Mays oder Friedrich Gerstäckers gelesen hatte, konnte Gustav nach dem Unterricht sogleich in handfestem Spiel nacherleben. Im Zschoner Bach wusch er Gold, auf der Wiese zwischen den Hängen erlegte er Büffel und manchen Desperado brachte er furchtlos zur Strecke.
In der Erinnerung herrschte in der Zschone, wie Gustav sein Wäldchen liebevoll nannte, immer Spätsommer. Noch Jahrzehnte später hörte er die Melodie der Grillen über dem von der Sonne verbrannten Gras. Woran mag es liegen, dass dieses Zirpen nie wieder jenen verführerischen Klang der Weite Afrikas hatte wie in jenen Jahren zwischen zehn und vierzehn, die Gustav als die glücklichsten seines Lebens abspeicherte?
Die Schleuse zwischen den letzten villenartigen Häusern von Cotta und der Zschone bestand aus einigen herrenlosen Obstbäumen hinter einem niedergetrampelten Lattenzaun, an deren zu Boden gefallenem Überfluss er sich schadlos halten konnte. Äpfel, Birnen und Pflaumen, so viel er wollte und die Wespen zuließen. Vor den Stechinsekten hatte er einen Mordsrespekt, denen wollte er nichts von dem Fallobst streitig machen. Und doch liebte er die kleinen Flügeltiere wegen des akkuraten Schwarzgelbs ihres Streifenkostüms und nicht zuletzt auch wegen ihrer Wehrhaftigkeit. Die Natur war doch ein famoser Maler, dessen Form- und Farbenpracht keine Grenzen kannte. Gustav hielt in Zeichnungen fest, was er sah.
Mehr noch, er sprach mit den Bäumen, konnte stundenlang auf Rehe warten, die früher oder später an einer bestimmten Lichtung vorbeikommen mussten, beobachtete den Mäusebussard, wenn er ein Kaninchen in seinen Horst in den Wipfeln trug. Von den Augen in der Buchenrinde fühlte er sich beobachtet, in jeder Astgabel vermutete er eine Eule. In der Dämmerung verfolgte er den Flug der Fledermäuse und versuchte Nachtfalter zu kategorisieren. Es wäre ihm nicht im Traum eingefallen, eines der schönen Tiere zu fangen und zu töten. Nein, er liebte die Natur lebend, wurde zum Teil von ihr. Hier im Wald war er zu Hause, und seine Eltern ließen ihn gewähren, solange er draußen war.
Zeit existiert in der Kindheit nicht. Kinder lernen die Uhr lesen, wollen aber nicht einsehen, wozu. Warum etwas messen wollen, das man nicht festhalten kann? Zeit ist eine Erfindung der Erwachsenen, die nur dazu dient, das Unendliche einzugrenzen. Etwas völlig Unbegreifliches, in jeder Hinsicht Überflüssiges. Ein Tag, eine Woche, ein Jahr, das machte überhaupt keinen Unterschied. Im Spiel konnte Gustav Jahrhunderte überspringen.
Nur einmal im Jahr, wenn der Geburtstag naht, wird Zeit wichtig. Wie lange noch? Und wie würde es sich anfühlen, wenn man wieder ein Jahr älter wäre. Wenn man aber nachmittags auf dem Rücken liegend nichts tut, als die Wolken über sich hinweg ziehen zu lassen, gibt es weder Morgen noch Gestern und schon gar kein nächste Woche. Jeder einzelne Augenblick dehnt sich im Universum aus. Spielt es für die Wolke eine Rolle, wie lange sie braucht, um ihre Gestalt zu verändern? Wie würde es sich anfühlen, eine Wolke zu sein? Eben noch ein Krokodil, das einen Vogel verschlingt, und im nächsten Augenblick ein riesiger Hase, eine Dampflok oder ein gewaltiger Blumenkohl. Gustav würde gern zum Himmel aufsteigen und wie eine Wolke seine Umrisse wechseln. Und wie mochte es erst einmal über den Wolken aussehen? Die Sterne lagen ihm näher als das Nachbarhaus. »Wenn du groß bist, werdet ihr auf dem Mond spazieren gehen«, hatte der Vater gesagt. Gustav bezweifelte keinen Augenblick, dass sein alter Herr recht hatte.
Freunde hatte Gustav nicht, aber er brauchte auch niemanden zum Spielen. Die sportlichen Wettkämpfe seiner Schulkameraden langweilten ihn. Fußball hasste er ebenso wie Völkerball. Wenn beim Mannschaftssport die Aufstellungen gelost wurden, blieb er immer bis zum Schluss stehen. Keiner wollte ihn in der Mannschaft haben. Anfangs wurmte ihn das, nach einer Weile hielt er es für ein Privileg. Im Wald übte er heimlich Speerwerfen und Bogenschießen, Klettern und Laufen. Er spielte Bergsteiger und Großwildjäger, suchte sich Verstecke, falls ihn einst Banditen durch das kleine Tal jagen würden. Hier kannte er jeden Winkel, keiner würde ihm überlegen sein. Nein, nicht er war der von den anderen Jungs Geschmähte, sondern er ließ sie nicht an seiner Lebenswelt teilhaben. So einfach war das.
Hin und wieder traf er auf den saftigen Wiesen neben dem Bach oder unter den Obstbäumen einen Schäfer. Die zottelige Gestalt sah aus, als wäre sie gerade aus einer fernen Vergangenheit aufgetaucht, braun gebrannt, mürrisch, mit undefinierbaren graubraunen Lumpen behängt, deren ursprüngliche Bestimmung nicht mehr erkennbar war. Sein Gesicht war stets unrasiert, ein Bart, der diesen Namen verdient hätte, wollte ihm trotzdem nicht sprießen. Wangen und Kinn waren eher von einer Art schwarzem Unkraut überwuchert. Die struppige Frisur ließ sich unter dem breiten, ausgefransten Schlapphut nur erahnen. So mussten wohl die Trapper ausgesehen haben, von denen Gustav in seinen Abenteuerbüchern las.
Wie der Schäfer hieß, sollte Gustav nie erfahren. Er nannte ihn Vogelscheuche, ohne ihn allerdings jemals direkt mit diesem Namen anzusprechen. Gustav war fasziniert von dieser Naturerscheinung in Menschengestalt, hatte aber auch ein wenig Angst vor ihr. Vogelscheuche redete so gut wie nie. Und wenn er es doch tat, hatte Gustav Mühe, ihn zu verstehen. Er sprach nie in Sätzen, sondern stieß einzelne Wörter hervor, die von gutturalen Geräuschen und unbändigem Fluchen unterbrochen waren. Vogelscheuche vermied es, Gustav direkt in die Augen zu sehen. Und doch spürte der Knabe, dass diese seltsame Figur, die so gar nicht in die Zeit passen wollte, ihn mochte.
Manchmal stibitzte Gustav aus der elterlichen Küche etwas Essbares, um es seinem unkonventionellen Kameraden mitzubringen. Dann zog sich über das narbige Gesicht des Schäfers ein breites, tonloses Lachen, das einen kläglichen Rest verfaulter Zähne zum Vorschein brachte. Wenn Vogelscheuche die Geschenke aber sogleich laut schmatzend, spuckend und pausenlos fluchend verspeiste, hätte sich Gustav am liebsten die Ohren zugehalten. So sehr er die gedeckte Tafel der Natur bevorzugte, lagen ihm doch die strengen väterlichen Tischsitten weitaus mehr als Vogelscheuches Rumgemansche.
Der wortkarge Einzelgänger hatte einen Hund namens Wolf, mit dem sich Gustav schnell anfreundete. Vogelscheuche erzählte ihm auf seine umständliche Art, dass Wolf tatsächlich von Wölfen abstammen würde. Früher hätten seine Vorfahren Schafe gerissen, heute passte Wolf auf, dass kein Schaf verloren geht. Der rasselose Vierbeiner schien völlig verwildert, seinen Pelz bevölkerten ganze Stämme von Läusen und Flöhen, doch wenn Vogelscheuche einen heiseren Pfiff ausstieß, parierte er sofort. Auf Kommandos von Gustav reagierte Wolf nicht. Gustav konnte Knüppel werfen, so oft er wollte, das ignorante Hundevieh blieb träge liegen. Und doch war Gustav stolz darauf, dass Wolf ihn als Teil der Herde akzeptierte und ihm nach den ersten Begegnungen laut bellend und schwanzwedelnd entgegenstürmte, wenn er sich Vogelscheuche und seinen Schafen näherte.
Von dem Hirten lernte Gustav nicht nur schnitzen, pfeifen, spucken, nach Herzenslust fluchen, Feuer machen, Fährten lesen und den Kot unterschiedlicher Tiere zu unterscheiden. Er verinnerlichte auch das Gesetz des Überlebens. Der heranwachsende Städter sog jede Bewegung seines burlesken Lehrmeisters auf, der ihm viel mehr Achtung abrang als das steife Lehrergesocks in der Schule, das so oft über ihn spottete. Er lernte, in der Natur den Körper vom Bewusstsein zu trennen, einzuschlafen, aber sofort hellwach zu sein, wenn die Situation es erforderte, zum Beispiel, wenn sich ein Fremder der Herde näherte.
Stundenlang konnte er mit Vogelscheuche und Wolf unter einer durchlässigen Plane im heftig prasselnden Regen sitzen und nichts tun, als wortlos vor sich hin zu starren. Zeit spielte keine Rolle. Beim ersten Mal störte ihn die durchdringende Nässe noch, aber er biss die Zähne zusammen und ließ sich nichts anmerken. Der Schäfer warf ihm eine nach Schaf und Erde riechende Decke hin und Gustav wickelte sich ein. Nass wurde er trotzdem, aber er fühlte sich wie ein Indianer vor seinem Tipi. Und bald machte ihm der Regen nichts mehr aus.
Schlotternd vor Kälte und am ganzen Körper verdreckt kam er an solchen Tagen nach Hause. Die Mutter wollte wissen, warum er sich nicht untergestellt hätte oder früher nach Hause gekommen wäre. Doch Gustav strahlte sie so glücklich an, dass sie nicht weiter insistierte. Hin und wieder erzählte Gustav den Eltern von Vogelscheuche, aber die hielten das für eine der vielen Fantastereien ihres Sohnes. Der war zunächst beleidigt, im Grunde war ihm das Unverständnis seiner Alten jedoch nicht einmal unrecht, fürchtete er doch, der Vater könnte ihm den Kontakt zu seinem so gar nicht salonfähigen Gefährten womöglich verbieten. Dann wäre es mit seinem Leben als Abenteurer vorbei gewesen, bevor es überhaupt angefangen hatte.
Mit Spannung hatte Gustav die Berichte des schwedischen Weltreisenden und Naturschützers Bengt Berg gelesen. Auch der war seit den Tagen seiner Kindheit ein bedingungsloser Liebhaber der Natur geworden. In seinen Büchern machte er aus seiner Verachtung der Zivilisation mit all ihrer Berechnung und Zerstörungswut keinen Hehl. In eindrucksvollen Bildern schilderte er die Schönheit und Empfindlichkeit, aber auch die Unbarmherzigkeit der Natur. Der Stärkere setzt sich durch. Immer und überall. Gustav musste stark sein, lernen, in einer feindlichen Umgebung zu überleben und all die Dinge, vor denen die Verfechter der Zivilisation flohen, zu seinem Vorteil zu nutzen. Wie Bengt Berg. Sich in Pfützen zu waschen und mit der Feldflasche das Regenwasser aufzufangen.
Bergs Bücher über Wildgänse und Adler ließen den wissbegierigen Jungen nicht mehr los. Er las sie immer wieder, bis er das Gefühl hatte, selbst all diese Abenteuer erlebt zu haben. Wie gern wäre er einer der sechs deutschen Jungs gewesen, die sich in dem Film »Sehnsucht nach Afrika« von Bergs Schilderungen berauschen ließen. Er sah den Film so oft, bis er ihn auswendig kannte. Doch er absorbierte nicht nur die Bilder und Aussagen, er studierte auch seine Machart. Die suggestive Kraft, die von den Naturbildern ausging, faszinierte ihn. Was wären diese Aufnahmen wohl ohne das gesprochene Wort, ohne die Anleitung, wie man sie zu betrachten und zu bewerten habe. Ein und dasselbe Bild, das wurde Gustav klar, konnte ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Erst die begleitende Schilderung machte es zu dem, was es in der Erinnerung des Betrachters blieb. Das Gesetz der Bilder stand in erstaunlichem Gegensatz zum Gesetz der Natur.
Der Schwede war auch Fotograf. Seine Fotos waren sensationell. Niemand sonst kam so dicht an die Tiere heran wie er. Wenn er Vögel fotografierte, wurde er selbst zum Vogel. Gustav wünschte sich nichts sehnlicher als eine Spiegelreflexkamera, um die Tiere im Zschoner Grund zu fotografieren. Später würde es auch ihn ins Himalaya, in die Serengeti und in die Rocky Mountains verschlagen. Wie sein Vorbild würde er den Kindern in der Heimat von seinen großen Forschungsreisen erzählen. Die Klassenkameraden von heute würden dann ihre Söhne und Töchter in seine Vorträge schicken und damit prahlen, dass sie einst mit Gustav die Schulbank gedrückt hatten. Der Blick des Expeditionsleiters in spe schweifte in die Wolken und er freute sich auf diesen Augenblick.
Zu Hause in der kleinen Drei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Dresden galt freilich ein anderes Regiment. Das Leben hangelte sich an einer Reihe fester Rituale entlang, die sich vom Tages- und Wochenablauf über die Verteilung der häuslichen Pflichten bis zum Essensplan erstreckten. Gustav konnte sich zum Beispiel nicht erinnern, dass es sonntags jemals etwas anderes zu Mittag gegeben hätte als Schnitzel mit Salzkartoffeln und Mischgemüse. Der Vater wollte es so und niemand hätte gewagt, einen anderen Vorschlag zu unterbreiten. Warum auch, es war völlig in Ordnung. Der kleinste Bruch einer jener niemals schriftlich oder mündlich fixierten, sondern als unumstößlich empfundenen Regeln wurde nicht etwa bestraft, er lag schlicht außerhalb alles Vorstellbaren. Gustav und seine sechs Jahre ältere Schwester Ingeburg hätten nicht im Traum an einen Verstoß gegen das Vaterrecht gedacht.
Allerdings wusste Gustav, dass Ingeburg ihm gegenüber im Vorteil war, und das ärgerte ihn. Sie musste nur das Gesetz der Eltern einhalten, er zusätzlich die Lex Ingeburg, die nicht immer zum Regelkanon der Altvorderen kompatibel war. Gegen die Schwester aufzubegehren kam ihm zwar hin und wieder in den Sinn, doch wurde seitens Ingeburgs jede Übertretung ihrer willkürlichen Zusatzparagrafen mit harten Strafen bedacht. Kleinere Vergehen wurden mit einem ausgeklügelten System von Demütigungen geahndet, die selbstredend nur in Anwendung kamen, wenn die Eltern nicht zugegen waren. Darüber hinaus musste Gustav regelmäßig häusliche Obliegenheiten von Ingeburg übernehmen und sich dann anhören, wie ihr Pflichtbewusstsein von den Eltern gelobt wurde. Wie hasste er sie dafür!
Kam es ganz schlimm, musste er stundenlang Publikum spielen, wenn Inge ihre Kleider vor dem Spiegel ausprobierte. Und wehe, eine der Kostümierungen gefiel ihm nicht. Dann setzte es die nächste Gemeinheit. Von manchen Vergehen wusste Gustav nicht einmal, dass er sie begangen hatte. Zum Beispiel die Hände in den Hosentaschen halten oder Rotz hochziehen. Er hatte den Vater nie darüber reden hören, aber Inge versicherte ihm, die Strafe der Eltern wäre weit strenger als die ihm von ihr auferlegte Buße.
Wenn er sich Inge nicht gefügig zeigte, musste er sich von ihr anhören, dass er eigentlich gar nicht der Sohn seiner Eltern sei, sondern ein Findelkind, das sie, Ingeburg, vor ein paar Jahren beim Spielen im Gebüsch des nahe gelegenen Leutewitzer Parks entdeckt habe. Ihr allein habe er es zu verdanken, dass Mutter und Vater sich seiner angenommen hätten. Sie könne die Eltern bewegen, ihn wieder auszusetzen.
Gustav spürte zwar intuitiv, dass diese Fabel nicht stimmte, und doch hasste er sie, weil Inge sie immer erzählte, wenn er im Bett lag. Er konnte dann nicht einschlafen. Was, wenn sie doch recht hatte? Müsste er vielleicht ins Waisenhaus, wenn er sich Inge gegenüber nicht dankbar erwies? Nein, auf keinen Fall, nicht umsonst lernte er, in der Natur auf sich selbst gestellt zu überleben. Sie sollten nur versuchen, ihn ins Heim zu stecken, er würde weglaufen und sich im Zschoner Grund so verstecken, dass sie ihn nie finden würden. Erst aus seinen später von Millionen Kindern gierig verschlungenen Abenteuerberichten würden sie in vielen Jahren erfahren, was aus ihm geworden war. Dieser Gedanke beruhigte ihn.
Süßigkeiten besaß Gustav fast nie. Oder zumindest nie lange. Die Eltern beschenkten zwar beide Kinder mit allerlei Zuckerkram, da sie selbst gern naschten, aber die von Ingeburg erdachten Strafzölle brachten Gustav um einen wesentlichen Teil seines Vorrats. Den kläglichen Rest nahm sie ihm ohne Begründung trotzdem weg. Er konnte sein Naschzeug noch so gut verstecken, sie fand es immer. Fragte er, wo seine Kekse oder sein Kandis wären, zuckte sie nur schnippisch mit den Achseln. Drohte er aber, dem Vater davon zu erzählen, setzte sie ein derart strenges Gesicht auf, dass er sich die Strafe für seine Petzerei gar nicht ausmalen wollte und es lieber bleiben ließ.
Einmal wagte Gustav es dennoch, die Mutter ins Vertrauen zu ziehen. Er konnte seine Traurigkeit über den Verlust eines kostbaren Schokoladenschatzes einfach nicht verbergen. »Gustav, was hast du denn«, fragte Clara Bülow.
Er wollte mit der Wahrheit nicht heraus, wusste er doch, was ihm dafür blühte. Doch die Mutter ließ nicht locker, streichelte ihm über den Scheitel und fragte immer wieder. Da berichtete Gustav von dem Diebstahl.
»Passiert das öfter«, wollte die Mutter wissen. In solchen Momenten konnte ihre Stimme hart wie Stahl sein. Wieder zögerte er mit der Antwort, aber die Mutter schaute ihn so ernst an, dass er nicht mehr wusste, vor welchem der beiden weiblichen Mitglieder der Familie er sich mehr fürchtete. Schweren Herzens beichtete er, dass er sich nicht erinnern könne, wann es anders gewesen sei. Die Mutter war außer sich und Gustav überlegte, was er wohl falsch gemacht hatte. Gleich würde sich ein häusliches Gewitter entladen. Aber die Mutter schickte ihn nur aus dem Zimmer und rief nach Inge.
Er rannte zu seinen Bäumen und Wiesen. Was sich an diesem Nachmittag genau zwischen Mutter und Schwester abgespielt hatte, sollte er nie erfahren und vorsichtshalber wollte er auch nicht fragen.
Am Abend schaute Ingeburg ihn ein einziges Mal kurz aus den Augenwinkeln an, doch dieser Blick erschütterte ihn bis ins Mark. Danach sprach sie drei Wochen lang kein einziges Wort mit ihm. Sie schien es nicht einmal zu bemerken, wenn er im Raum war. Gustav stellte die Schachtel mit seinen Bonbons offen auf den Tisch des gemeinsamen Zimmers, doch Inge rührte nichts von dem Naschzeug an. Diese Strafe war schlimmer als alle Drangsalierungen, die er zuvor seitens der Schwester zu erdulden hatte.
Inge konnte unerbittlich sein. Gustav liebte sie, aber er fürchtete sich auch vor ihr, weil sie der einzige Mensch auf der Welt zu sein schien, dem er nichts vormachen konnte. In Sekundenschnelle vermochte sie ihn mit ihren Röntgenaugen zu durchdringen, ihm jedes Geheimnis zu entlocken, noch bevor er sich dessen selbst bewusst war. Ihre kühle, unnachgiebige Art hatte sie vom Vater. Am meisten störte ihn ihre herablassende Nachsicht. Wenn er ihr begeistert vom Wald erzählte und sie ihm nichts anderes entgegnete als: »Ach Gustav, du musst noch viel lernen«, spürte er, wie es in ihm kochte.
Fast täglich dachte er sich neue Geschichten aus, um die Schwester zu beeindrucken. Zwei größere Jungs hätten ihm an den Obstbäumen aufgelauert. Er hatte sie nicht bemerkt, und als er sich nach Äpfeln und Birnen bückte, gingen sie plötzlich von hinten auf ihn los. Gustav versuchte, nach einem Knüppel zu greifen, doch die beiden Großen waren schneller und wollten zuschlagen.
Da kam Gustav plötzlich eine Idee, wie er seine Überlegenheit ausspielen könnte. Auf der den Angreifern abgewandten Seite einer angefaulten Birne bemerkte er zwei Wespen, die er blitzschnell als Waffe einzusetzen beschloss. Er tat so, als wolle er nach der Birne greifen, bewegte sich aber so langsam und auffällig, dass es den beiden Wegelagerern nicht entgehen konnte. Einer der beiden trat auf seinen Arm und langte nun selbst ganz langsam und seine Überlegenheit auskostend nach dem Stück Fallobst. In dem Augenblick, als er aber zugriff, stachen Gustavs unfreiwillige Alliierten zu. Der Junge schrie laut auf, seine Hand zuckte zurück. Gustav nutzte den Moment der Verwirrung seiner Kontrahenten, griff nach dem Knüppel und zog dem Unversehrten der beiden eins über den Schädel. Heulend suchten die zwei viel Größeren das Weite.
Je ausführlicher Gustav dieses oder andere Abenteuer schilderte, desto mehr glaubte er die Geschichte selbst. Er spürte buchstäblich die Blessuren der Keilerei. War es nicht so passiert, dann wäre es doch genau so und nicht anders geschehen, wenn ihm wirklich zwei Größere aufgelauert hätten.
Und Ingeburg? Die wandte sich nicht einmal von ihrem Spiegel ab und ließ nur ein lakonisches »Aha, Gusti der große Held von Dresden« vernehmen. Er kam gegen diese Mauer der Dominanz seiner Schwester nicht an, fühlte sich hilflos und ausgeliefert.
Manchmal fügte er sich selbst leichte Verletzungen zu, um seinen Geschichten mehr Nachdruck zu verleihen – niemals so, dass es wirklich wehtat, denn vor körperlichem Schmerz hatte er große Angst. Oder er zog ein Bein nach, wenn er aus dem Wald nach Hause kam, spulte mit einstudierter Beiläufigkeit seine Geschichte ab, wie er mit einem Wildschwein aneinandergeraten oder von einem Felsvorsprung gefallen war, nur damit Inge ihm anschließend belustigt hinterherrief: »Gusti, hinken nicht vergessen!«
Familie Bülow erhielt selten Besuch. Waren doch mal Gäste im Haus, betonten seine Eltern immer wieder lauthals, wie sehr Inge dem Vater ähnelte. Gustav fand diese Bemerkungen unerträglich. Er glich angeblich seiner Mutter, dabei hätte er doch auch so gern wie der Vater ausgesehen. Vor dem Spiegel übte er heimlich den ernsten Blick und die würdevolle Haltung seines Vaters, aber so sehr er sich auch mühte, es wollte ihm nicht gelingen. Wie würde er wohl wirken, wenn seine Wangen etwas kantiger wären und nicht so rundlich und mädchenhaft wie bei seiner Mutter? Er versuchte in seinem Mund ein Vakuum zu erzeugen, um so das weiche Wangenfleisch nach innen zu ziehen. Aber so konnte er ja nicht ewig herumlaufen. Vielleicht war es ja einfach nur eine Frage des Alters, wann er es mit dem Äußeren seines Vaters aufnehmen könnte.
Einen Bart würde er sich später wachsen lassen, daran hatte er keinen Zweifel. Wenn er in den Spiegel schaute, was er freilich nur tat, wenn er sich unbeobachtet wusste, versuchte er sich vorzustellen, wie sein Gesicht mit Bart aussehen würde. Er deckte Kinn, Wangen und Oberlippe mit Tüchern und Lappen ab, um dieser Fantasie mehr Realität zu verleihen. Ein wenig schämte er sich für diese Bartschau, denn genau genommen mochte er es überhaupt nicht, sich im Spiegel zu betrachten. Das war etwas für Mädchen. Hätte Vogelscheuche jemals einen Spiegel benutzt? Gustav fand es viel spannender, sich im Wasser eines Baches zu spiegeln, wenn die sich kräuselnden Wellen und die unter der Oberfläche liegenden Steine das Abbild bis zur Unkenntlichkeit verfremdeten. Man brauchte den Kopf nur ein paar Zentimeter nach links oder rechts zu drehen und schon blickte man in ein völlig anderes Gesicht, das eines Trappers oder Beduinen.
Vom Wasser haben wir’s gelernt – wie recht das Volkslied doch hatte. Gustav lernte, lernte und lernte. Er fühlte sich wie ein Mooskissen unten am Zschoner Bach, das sich statt mit Wasser mit Wissen vollsog. Wissen war sein Wasser. Er zeichnete alles auf, ordnete zu, beschrieb. Pilze, Blumen, Zapfen, Gräser, Vögel, Insekten, Fährten, Blätter, Mineralien, Rinden – alles musste erfasst werden. Wer weiß, wofür er diese Aufzeichnungen eines Tages noch gebrauchen könnte, wenn er angesichts von Lämmergeiern oder Seeelefanten keine Zeit mehr hatte, den Flug des Rotkehlchens zu studieren.
3.
Gustavs Vater Walter war ein Mann vom alten Schlag, wie es so schön heißt. Er war schlank, bewegte sich langsam, aber entschlossen und bewahrte in jeder Lebenssituation Haltung. Nichts schien ihn aus der Ruhe zu bringen. Ins behäbige Dresden mit seiner bürgerlichen Gemütlichkeit passte der nüchterne Hanseat wie Knäckebrot zu Eierschecke. Ursprünglich kam er aus Kiel, viel mehr wusste Gustav aber nicht über die Jugend seines Vaters. Dass er mal ein Kind gewesen sein könnte, ging über seine Vorstellungskraft hinaus. Nein, sein Vater musste schon immer ein Erwachsener gewesen sein.
Freunde hatte auch Walter Bülow keine, und wenn doch, dann kannte Gustav sie nicht. Der Vater schien sich auch nicht nach Gesellschaft zu sehnen. Zu gern hätte Gustav ihm offenbart, wie gut er ihn verstand. Doch das hätte der Vater nie zugelassen. Manchmal traf er sich mit Geschäftsfreunden, aber er brachte sie niemals mit nach Hause. Der größte Teil seiner Freizeit spielte sich verlässlich im Kreis der Familie ab. Seine Eltern sprachen in Gegenwart der Kinder nicht viel miteinander und doch schienen sie auf wundersame Weise eng verbunden.
Vor allem redete der ältere Bülow nicht gern über sich. Das Wenige, das Gustav über ihn wusste, hatte er von der Mutter. Die Prähistorie seiner eigenen Existenz erschien ihm ohnehin wie ein Mythos aus grauer Vorzeit. Kaum zu glauben, dass es mal eine Zeit gegeben hatte, in der die wie durch ein göttliches Gesetz verbundenen Eltern sich nicht gekannt hatten.
Walter Bülow und Gustavs Mutter Clara, geborene Brandt, hatten sich, soweit Gustav rekonstruieren konnte, einige Jahre vor dem Weltkrieg kennengelernt. Sie waren sich im Park begegnet. Clara war Walter sofort aufgefallen. Fast unmerklich hatte er ihr zugenickt, und sie hatte mit einem verräterischen Blick aus ihren wunderschönen grauen Augen geantwortet. Am nächsten Sonntag kehrte er zur selben Zeit am frühen Nachmittag in den Park zurück, das Frollein, wie er sie damals vor sich selbst nannte, war wieder da. Er fand sie zauberhaft und meinte, sie hätte trotz des kühlen Wetters ein besonders reizvolles rötlich schimmerndes Kleid angezogen – nur für ihn, da war sich Walter sicher. Was hätte er darum gegeben, sich ihr so dicht zu nähern, um das zweifellos betörende Rascheln ihrer Falten und Säume zu hören. Doch eine derartige Indiskretion verbot sich von selbst. Auch diesmal sollte es nur zum einmaligen kurzen Blickwechsel kommen.
Von nun an trafen sie sich jeden Sonntag zur selben Stunde. Nie sprachen sie ein Wort miteinander. Walter achtete stets peinlich darauf, dass sein kurzes Haar perfekt saß und sein weißer Sonntagsanzug keine Falte zu viel aufwies. Er steckte sich je nach Saison eine Blume ins Knopfloch und wartete aufgeregt, ob seine Angebetete wieder im Park erscheinen würde. Pünktlich um drei Uhr nachmittags tauchte sie auf und gab vor, ihn nicht zu bemerken. Selbstredend überspielte auch er sein Interesse, so gut es ging. Bis es zum ersehnten Blickwechsel kam und beide glücklich wieder auseinandergehen konnten.
Es war ein unverabredetes Spiel: Wer hielt es länger aus, den anderen zu ignorieren. Sie waren zwei Menschen, die, magnetisch voneinander angezogen, jeden Sonntag demselben Ritual folgend zur gleichen Zeit an derselben Stelle aufeinander lauerten. Walter hatte niemanden, dem er sich hätte anvertrauen können, denn schon damals legte er keinen Wert auf die Gesellschaft von Freunden. Womöglich hätte er Clara niemals angesprochen, wäre nicht der Krieg dazwischengekommen, der damals noch nicht Weltkrieg hieß.
Für Walter war es keine Selbstverständlichkeit, seine Pflicht gegenüber dem Vaterland zu erfüllen. Von der allgemeinen Kriegsbegeisterung blieb er relativ unbeeindruckt, er hatte weder einer Burschenschaft noch einem damals wie Pilze aus dem Boden schießenden Verein angehört. Walter Bülow brannte in keiner Weise darauf, dem Feind zu zeigen, was es bedeutete, sich mit dem Kaiser anzulegen. Pathos und übertriebene Leidenschaft waren seine Sache nicht. Doch er wusste, dass man ihn auf jeden Fall einziehen würde. Als Freiwilliger rechnete er sich gewisse Privilegien aus, die ihm die berüchtigten Drangsalierungen im deutschen Militär ersparen würden.
Eigentlich wollte er zu Kaiserlichen Marine, denn für Schiffe hatte er sich schon immer begeistert, doch dort wurde ihm eröffnet, man nehme keine Schwimmer – und Walter schoss durchs Wasser wie ein Delfin. Jeder aber, der schwimmen konnte, war ein potenzieller Deserteur, der sich in die Fluten retten würde, sowie es darum ginge, das Schiff mit seinem Leben zu verteidigen. So ging Walter zur Infanterie, die erstaunlicher Weise sehr wohl Freiwillige nahm, die laufen konnten. Eine Woche, bevor er seinem Stellungsbefehl Folge leisten musste, nahm er allen Mut zusammen und sprach Clara im Park an: »Frollein, würden Sie mich ein Stück begleiten?«
Walter war erstaunt, wie wenig es ihm ausmachte. Es fühlte sich gut und richtig an. Und Clara beschenkte ihn mit dem dankbarsten Augenaufschlag, den der kühle Charmeur je gesehen hatte. Arm in Arm gingen sie in eine Konditorei und Walter fragte unumwunden, ob er Frollein Clara – deren Namen er jetzt kannte – am nächsten Tag wiedersehen dürfe. Diesmal blickte sie beschämt nach unten, und er hätte zu gern gewusst, ob sie errötete. Aber seine Manieren verboten es ihm, genau hinzusehen.
Am letzten Tag vor seiner Einberufung verlobten sich Walter und Clara. Sie wagten es nicht einmal, einen Kuss auszutauschen. Keiner von beiden ahnte, dass sie sich sechs lange Jahre nicht wiedersehen würden. Walter schrieb hin und wieder Briefe von der Front. Prahlerei von Kriegsabenteuern lag ihm fern. Nüchtern und in knappen Worten erzählte er vom Krieg, als wäre es eine Sache der Buchhaltung. Die Anrede lautete immer: »Liebes Fräulein Clara«, das Wort »du« schien Walter nicht zu kennen, und am Ende jedes Briefes standen die Worte »Ergebenst, Walter Bülow«.





























