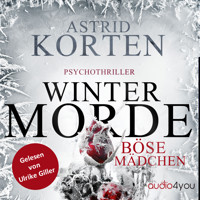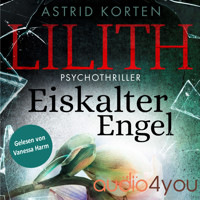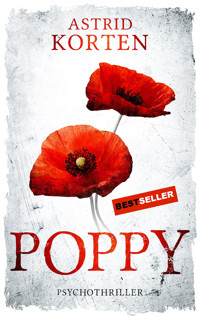4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.“ Ingmar Bergman Ein Junge wird in einen Keller verschleppt. Ein brutaler Serienmörder verbreitet Angst und Schrecken. Eine junge Frau hat das Grauen der Vergangenheit nicht vergessen und verliert zunehmend die Kontrolle. Im HAUS DER ANGST wird ein Verbrechen immer effektvoll inszeniert. Doch wer sind die Opfer, wer die Täter? In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Alle Spuren der bestialischen Verbrechen führen immer wieder in das Haus der Angst. Ein bitterböser Psychothriller um Angst, Vergeltung und unbändigem Zorn. 480 Seiten Spannung pur!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Haus der Angst
Über das Buch
Prolog
Teil 1 – Die Katze
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Teil II – Das Kätzchen
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Polizeipräsidium München
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Impressum
Haus der Angst
Die Nacht ist wie ein großes Haus. Und mit der Angst der wunden Hände reißen sie Türen in die Wände - dann kommen Gänge ohne Ende, und nirgends ist ein Tor hinaus.
Rainer Maria Rilke
Über das Buch
In dem Thriller HAUS DER ANGST wird das Verbrechen stets effektvoll in Szene gesetzt. Doch wer sind die Opfer und wer die Täter? Wie stehen sie zueinander?
Ein Junge wird in einen Keller verschleppt, ein brutaler Killer verbreitet Angst und Panik, eine junge Frau hat das Grauen der Vergangenheit nicht vergessen und beginnt, zunehmend die Kontrolle über sich zu verlieren.
Alle Spuren der bestialischen Verbrechen führen in das blaue Haus der Angst.
HAUS DER ANGST ist ein bitterböser Psychothriller über Angst, Rache und unbändigem Zorn.
Prolog
Aus dem Tagebuch des Jungen
Der Raum im Haus ist besonders klein, niedrig und ziemlich finster. Es gibt nur ein Fenster mit einer Außenverbretterung und einer einzigen Lichtquelle, einer schmalen Luke, dahinter ist eine schwach flackernde Birne. Die Bruchsteinwände sind mit Schaumstoff ausgekleidet und mit Jute überzogen. Sie erinnern ihn an einen mit Laub überwucherten Leinensack. Der Steinboden ist nass und kalt, selbst das Bett und der Stuhl, auf dem der Junge sitzt. Es riecht nach verfaultem Laub, nach Tod, und es ist dunkel. So dunkel, dass jeder, der sich hier aufhält, Angst haben wird.
Egon ist sich sicher, dass die Schwärze eines Tages vorübergehen wird und dass irgendwo in diesem engen, kleinen Raum eine Tür oder ein Fenster ist, vielleicht zwischen den Fugen der Bruchsteine, ein Wurmloch, das zu einem Zufluchtsort führt, an dem er wieder atmen kann.
Er tastet blind umher, denn er ist sich sicher, der Ausgang muss hier irgendwo sein. Er muss nur lange genug auf dem Stuhl an der Wand ausharren und in die Dunkelheit starren. Irgendwann werden sich die Fugen öffnen und dahinter eine Tür freigeben, die in einen winzigen Gang führt. Er hat sie schon einmal gesehen. Doch sobald er seine Erinnerungen aufrufen will, wo denn nun diese Tür ist, lösen sich die Bilder immer genau in diesem Augenblick auf. Die Halluzination verschwindet zusehends. Doch etwas anderes tritt an ihre Stelle: Ein Atemhauch fegt vorbei. Kalt. Eisig. Egon streckt einen Arm nach dem Schatten aus, manchmal auch ein Bein und verharrt in dieser Position, still wie eine Statue.
Dabei hat er sein Spiegelbild vor seinem inneren Auge. Komisch sieht er aus, als sei er von einer Eismaschine schockgefroren worden. Sein Mund aufgerissen, das Gesicht weiß. Die Augen dunkel, sein Blick unheimlich, sobald er zwischen den Spalten zwischen den Brettern etwas wahrnimmt. Dort, wo der Garten das Böse freigibt, die Finsternis sich bewegt, die Zipfel der Bäume sich beugen, der Himmel dunkler ist und schwarze Wolken vorbeifegen, dort liegt dann zwischen den ineinandergeflochtenen Blättern etwas Lebendiges, am Stück und doch wieder nicht. Er sieht nur Körperteile und Stofffetzen, rot durchtränkt, so traurig; und er hört das Wimmern der anderen, ihre Schreie, das Schluchzen. Ein Hauch von Eisengeruch, den Egon nur allzu gut kennt, dringt stets in seine Nase. Der Geruch von Blut … oder der Gestank des Todes.
Egon ist weder geschockt noch beunruhigt, sondern streitsüchtig und widerspenstig; und er fragt sich, wo nun sein Platz in diesem löchrigen Szenario sein wird. Er zeigt den Ritzen seine unbändige Wut, streckt dem Fenster die geballte Faust entgegen. Er will zurückschlagen, furchtbar schlagen. Dort draußen hat er durch die Ritzen die Sorte von Schlägen gesehen, die sehr wehtun, ohne zum Tode zu führen. Die Art von Schlägen, die sich anfühlen müssen, als seien sie endlos. Die jede Hoffnung töten, während der Körper am Leben bleibt. Der Mann und sein Gefolge wollen das Aufheulen aus den Eingeweiden hören, ein seelenzerschmetterndes Geräusch, einen Schrei, lang genug, um die Welt zu zerstören.
Das schwarze Loch umkreist ihn, wird zu einem Wirbelsturm. „Hi Junge“, zischt es, „beruhige dich. Ich werde eine Lösung für dich finden.“ Dann verschmilzt das Dunkel erneut mit der Wand.
Egon sieht sich um. Ihm ist immerzu schwindlig. Tag und Nacht. Und das kommt nicht davon, dass der Mann ihm nur Kartoffeln und Brot gibt und er zu wenig trinke. Der Staub kommt aus den Nähten dieser Wände – von allen Seiten. Es ist, als ob seine Eingeweide beiseitegeschoben werden oder in ihm vertrocknen und nur ein großes leeres Loch zurücklassen. Der Garten wimmert stets hinter den Ritzen, während er um Hilfe ruft.
Der Mann behauptet, dass das Tageslicht nicht gut für ihn sei. Aber er schwört, dass er allen beweisen werde, dass er kein Junge der Dunkelheit ist. Dass er später keine Ritzen mehr zwischen seinem Gesicht und dem Blau des Himmels dulden und er sich für das, was sie ihm hier antun, rächen wird.
Doch hier, auf dem Stuhl in diesem Raum hat er Angst, obwohl er schon vierzehn Jahre ist. Er nimmt stets eine Witterung wahr, sobald der Mann und diese Leute dem Wald ein Opfer bringen: Uringestank. Und er weiß: Er hat seine Hosen vollgepinkelt. Es muss auch an den Pillen liegen, die der Mann ihm neuerdings gibt, wenn er ihn hier einsperrt. Er wird sie nicht mehr schlucken. Dann verabschieden sich bestimmt auch der Schwindel und die Schlaflosigkeit, die albtraumhaften Visionen und der schwarze Tornado. Er wird hier lebendig rauskommen, einen Freudentanz aufführen und wieder durch die Straßen von Aachen ziehen.
Egon steht vom Stuhl auf und legt sich auf die Pritsche. Plötzlich fühlt sich seine Kehle eng an. Er glaubt, drei tiefe Atemzüge zu hören, lehnt den Kopf gegen die Wand, und schließt die Augen. Die Kühle wirkt besänftigend und bringt seinem erhitzten Gesicht ein wenig Erleichterung.
Da! Das leise Trippeln kleiner Füße. Gestalten in weißen Nachthemden? Auf seiner Netzhaut tanzt der Nachtglanz der Ritzen. Sein Herz pocht. Er reibt sich voller Unbehagen die Brust, blinzelt ein paar Mal und richtet sich auf. Unter der Tür schimmert ein wenig Licht.
Er kann es hören. Es ist nur ein leises Geräusch, das Knarren eines Bettes, ein Atmen, das aus dem Takt geraten ist. Draußen entfernen sich Schritte. Oder kommen sie womöglich näher? Er hört das Knirschen des Kieses, das Quietschen des Gartentors. Dann ist alles wieder ruhig.
Seine Augenlider flattern. Er streicht mit der Zunge im Mund herum, starrt die Wände an.
Die Schritte kommen wieder näher. Er steht auf, setzt sich langsam in Bewegung in Richtung der Verbretterung und beobachtet durch die Ritzen das Geschehen im Garten. Als es vorüber ist, hört er das Geräusch einer Brandung in seinem Kopf und das Ticken einer Uhr. Oder ist es der Regen, der jetzt aus den Wolken fällt? Er will schreien. Über sein Schicksal, sein Leben und das Pendeln zwischen Realität und Wahn, und versucht sich zu bewegen, aber seine Füße widersetzen sich. Egon spürt etwas Enges und unerbittlich Festes, das ihm den Atem nimmt. Dann fällt er in Ohnmacht.
Als er wieder zu sich kommt, steht ein zorniger Schatten vor ihm. Er kriecht vor lauter Angst in eine Ecke. Er weiß: Heute wird es mehr wehtun …
Teil 1 – Die Katze
„Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.“
Ingmar Bergman
Kapitel 1
München, 28. September 2006
Seit sechs Jahren litt sie nun schon unter diesen Gedächtnisstörungen, ein Zustand, dessen sich Anna Gavaldo immer dann bewusst wurde, wenn sie mit den Schatten der Vergangenheit konfrontiert wurde. Die Schatten kamen neuerdings in der Nacht vor einer Therapiesitzung und hatten immer die unscharfe Kontur jenes Mannes, der sie vor sechs Jahren in einem Kellerraum eingesperrt hatte. Aber sie erkannte ihn nicht und hatte keine Erinnerung an das Geschehen in diesem dunklen Raum.
„Retrograde Amnesie“ nannte ihr Psychotherapeut dieses Krankheitsbild. Prof. Jörg Kreiler war nicht nur eine Kapazität auf dem Gebiet der Neurochirurgie, sondern genoss auch einen ebenso hervorragenden Ruf als Psychiater, und nicht zuletzt war er ihr Freund und besaß seit vielen Jahren Annas Vertrauen.
Heute drängten sich ihr die Schatten förmlich auf. Donnerstag, der 28. September 2006. Jörg – so stand es im Terminkalender: ein Schattentag.
Am Morgen war sie schon um halb sieben aufgestanden, hatte den Küchenschrank aufgeräumt und das Frühstück gemacht. Und nachdem Max mit ihrer sechsjährigen Tochter Lisa das Haus verlassen hatte, hatte sie im Badezimmer mit einem Schwung den Inhalt des Medikamentenschränkchens in den Abfalleimer gefegt und danach den Spiegel geputzt und gedacht: Ich brauche das alles nicht mehr, nicht die Psychopharmaka, nicht die Schlaftabletten. Diese Pillen umnebelten nur ihr Hirn. Ihre Seele schützte sich durch das Vergessen jener grauenvollen Tage, die sie in der Gewalt eines Psychopathen verbracht hatte. Sie fühlte sich heute Morgen klar und frisch wie ein sprudelnder Wasserfall. Wozu also all diese Pillen?
Den traumatischen Erlebnissen war eine Zeit des Glücks gefolgt, das Glück, das ihr die Geburt ihrer Tochter schenkte, und eine Zeit der Zärtlichkeit, in der die Angst sich verflüchtigte. Auch das Studium an der Kunstakademie hatte ihr viel Freude bereitet, seit sie nach ihrem Abschluss jeden Dienstag Zweitklässler unterrichtete. Außerdem war sie bereit für ein zweites Kind. Sie war richtig eifersüchtig auf den Babybauch ihrer Freundin Mathilda, die in wenigen Wochen Zwillinge zur Welt bringen würde. Aber die Pillen würden kein heranwachsendes Wesen in ihrem Körper zulassen.
Anna seufzte. Warum hatte sie neuerdings dieses seltsame Gefühl, ihr Leben könnte entgleisen? Vielleicht, weil sie die Medikamente ohne Jörgs Zustimmung allmählich abgesetzt hatte. Ob ihr Körper und ihr Geist den Entzug nicht verkrafteten? Die Zwerge in der Schule hatten eine Antenne für ihre Stimmungsschwankungen. Die Kinder schauten sie hin und wieder mit seltsamen Augen an, besonders dann, wenn sie ihrer Lehrerin eine Frage stellten und keine Antwort bekamen. Es gab Momente, da hörte sie das Kinderlachen, die niedlichen Stimmen, aber sie hörte nicht, was die Kleinen sagten, sondern nur das Sausen in ihren Ohren.
Sie durfte die Vergangenheit nicht an sich herankommen lassen, und insbesondere durfte sie Max nicht mit ihren Hirngespinsten belasten – ihren Mann mit dem energischen, scharf geschnittenen Gesicht, den intelligenten dunkelbraunen Augen; Max, der Geist und Körper immer unter Kontrolle hatte. Er hatte genug um die Ohren, sie durfte ihn nicht belasten. Nach dem Tod seiner Eltern, die vor drei Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, hatte er die Leitung des Mailänder Pharmakonzerns Biocell übernommen und ihr zuliebe die Verwaltung nach München verlegt. Die Produktionsstätte der gentechnologisch hergestellten Pharmaka befand sich nach wie vor in Mailand, doch Max spielte mit dem Gedanken, sie nach Polen zu verlegen.
Schade, dass Max und Jörg sich nicht so gut verstanden. Jörg war nur selten Gast im Haus, denn Max mochte ihn nicht besonders.
Sie lächelte. Vielleicht war ihr Ehemann eifersüchtig auf diesen attraktiven Arzt, der damals ihrer Schwester Katharina den Kopf verdreht hatte. Aber Jörg hatte ihr geholfen, vielleicht auch deshalb, weil er mit ihrer Schwester befreundet gewesen war, bevor sie ums Leben kam. Oder vielleicht, weil sie ihn an Katharina erinnerte.
Jörg Kreiler war ihr Psychiater, ihr Anker und ihr Freund. Er brachte sie dazu, sich wirklich gut zu fühlen und sich den Dämonen ihrer Träume zu stellen, die ihr ständig auflauerten; mit seiner Hilfe würde sie sie vertreiben, und ab sofort auch ohne Psychopharmaka. Heute würde sie nicht den Wagen nehmen, ihr war nach S-Bahn zumute.
Als sie den Eingangsschacht der S-Bahn-Station hinunterging, wehte ihr von der Treppe ein Geruch verborgener Orte entgegen, modriger Untergrundstaub, den die Dunkelheit verströmte und der sie an den Raum erinnerte, in dem Jakob sie vor Jahren eingeschlossen hatte. Nur allzu gut erinnerte sie sich an den unheilvollen Klang seiner Stimme. Ihr Körper nahm immer wieder feinste Anpassungen vor, glich jede Veränderung ihres Geistes in Geschwindigkeit und Richtung aus, wenn Erinnerungen wie Blitze aufzuckten. Und wenn sich ihr Gehirn aus Jakobs frostiger Umklammerung befreite, gab es jedes Mal einen Moment, in dem ihr Kopf sich absolut rein anfühlte. Das war den Schmerz der Erinnerung wert – dieses Gefühl, diese süße, verschwommene Erlösung.
Einmal hatte sie Mathilda gefragt, ob sie dieses Gefühl kenne, ob sie wisse, was sie meine, aber die Freundin hatte ihr nur einen eigenartigen, besorgten Blick geschenkt und sich später sogar über ihre Frage lustig gemacht.
Nicht so Jörg Kreiler. Der verstand sie vollkommen.
Jörg Kreilers von einem kleinen Eichenbestand abgeschirmte Villa, in der die privaten Praxisräume untergebracht waren, befand sich am oberen Ende der Rudliebstraße.
Als Kreiler die Klingel hörte, fuhr er auf. Anna!
Er holte tief Luft und atmete aus, dann ging er zur Sprechanlage. Er wusste, dass sie es war, aber er wusste auch, dass die Form gewahrt werden musste.
Er sprach in das Metallgitter. „Ja?“
Die Antwort folgte fast augenblicklich, hell und melodisch. „Ich bin’s, Anna. Hallo, Jörg. Anna hier.“
Er hörte ihrem Tonfall an, dass sie ihre Medikamente nicht genommen hatte.
„Du bist pünktlich auf die Minute“, entgegnete er. „Komm herein.“
Er wartete neben der Tür, hörte ihre Schritte auf den steinernen Treppenstufen, ein leises Klack–Klack–Klack, das lauter und lauter wurde, bis plötzlich nichts mehr zu hören war. Als er öffnete, machte Anna einen Schritt zurück, verblüfft über das abrupte Öffnen.
„Mein Gott, hast du mich erschreckt!“ Dann lächelte sie, entspannte sich und trat ein.
Er hielt einen Moment inne und musterte sie von oben bis unten, bemüht, nicht allzu aufdringlich zu erscheinen. Es fiel ihm schwer, sie nicht zu umarmen.
Anna legte die Stirn in Falten. „Jörg, ich muss mit dir reden.“
„Deswegen bist du ja hier. Setz dich doch. Wir sollten uns über deine Therapie unterhalten.“
„Mir ist etwas Merkwürdiges passiert. Es geschah, als ich heute Mittag auf dem Weg zur Schule war. Ich wollte Lisa abholen. Es war doch heute ein ganz gewöhnlicher Tag. Ich ging die Straße entlang, und alles war wie immer. Ich dachte an nichts Besonderes, nur an Entscheidungen und Termine und was ich als Erstes erledigen müsste, als ich plötzlich die Stimme eines Mannes hörte.“
„Was sagte er?“
„Ich liebe dich, Anna. Es war seine Stimme, Jörg. Ganz sicher. Es war Jakobs Stimme.“ Tränen standen in ihren Augen.
Er beugte sich näher zu ihr. „Was hast du dann gemacht?“
„Ich blieb stehen. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich tatsächlich umdrehte oder nicht, aber ich sah – nein, ich sah es nicht, ich spürte es irgendwie … Es hat keinen Sinn, ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich hatte dieses ungeheuer starke Gefühl – nein, mehr als das, ich wusste es. Er war neben mir. Jakob stand neben mir, sah mich an und lächelte. O Anna, sagte er, ich habe dich wirklich lieb.“
„Und was hast du dabei empfunden?“
„Zunächst gar nichts, aber dann sagte er: Es ist ein wundervolles Gefühl. Glücklich, stolz, erhaben …“
„Was hast du geantwortet?“
„Ich antwortete: Ich hab dich auch lieb.“ Sie brach in Tränen aus.
Er reichte ihr Papiertaschentücher und nahm ihre Hand. Er musste sich beherrschen, sie nicht in den Arm zu nehmen und sie zu küssen. „Hm … Und dann?“
„Dann klickte es in meinem Kopf, und alles war wieder beim Alten. Ich dachte, das kann nicht passiert sein. Ich glaube nicht an Gespenster, und Jakob lebt nicht mehr. Er ist seit sieben Jahren tot, erschossen von Benedikt van Cleef.“
Was geht verdammt noch mal wirklich in deinem hübschen Köpfchen vor, Anna?
„Manchmal sitze ich in einem Café an der Theke, doch ich achte nicht auf die Menschen und den Lärm um mich herum. Ich trinke meinen Kaffee aus, diesen lauwarmen und bitteren letzten Schluck in der Tasse, dann greife ich nach einer Zeitschrift, die auf dem Tresen vor mir liegt, und erlebe Ähnliches. Ich blicke in den Spiegel hinter dem Tresen und sehe ihn.“
„Versuch mir deine Gefühle zu erklären. Was, glaubst du, könnte es bedeuten, wenn du mir sagst: Es war ein wundervolles Gefühl. Glücklich, stolz, erhaben?“
„Ich glaube, meine Erinnerung kehrt zurück. Ich habe Angst davor und weiß nicht genau, was sie bei mir auslösen könnte. Vielleicht stürze ich ab.“
„Es gibt Menschen in deinem Leben, die dich auffangen werden.“ Er tupfte die Tränen von ihrem Gesicht.
Anna beruhigte sich ein wenig. „Du auch?“, fragte sie schelmisch.
„Ganz besonders ich. Aber so weit sind wir noch nicht.“
„Ich möchte dich etwas fragen. Wäre es hilfreich, mir die Aufnahmen von damals zu zeigen? Wenn du Benedikt van Cleef um die Tatortfotos bitten würdest, wird er sie dir zukommen lassen.“
„Und du möchtest sie mit mir gemeinsam ansehen?“
„Ja“, flüsterte sie.
„Was hält Max von dieser Idee?“
„Er weiß nichts davon, und das ist auch gut so.“
„Warum?“
Jörg hatte das Gefühl, sie könne jeden Moment erneut in Tränen ausbrechen.
„Jakob benutzte den Namen meiner Schwester, den ich unserer Tochter gegeben habe: Elisabeth-Katharina, die Glückliche, die Stolze, die Erhabene.“
„Du glaubst immer noch, Lisa ist Jakobs Tochter?“
„Ja.“
Erneut nahm er ihre Hand. „Anna, der Gentest war eindeutig. Max ist Lisas Vater.“
„Vielleicht wurde der Test manipuliert.“
Er sehnte sich danach, sie in den Arm zu nehmen, sie zu trösten und ihr zu sagen: Jakob ist tot. Mausetot.
„Und da ist noch etwas. Manchmal glaube ich, dass er mich Katharina nennt. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin Katharina und nicht Anna …“
Kreiler stand am Fenster und blickte ihr nachdenklich hinterher, als sie rasch in Richtung S-Bahn-Station ging. Seufzend setzte er sich an seinen Schreibtisch und schaltete das Diktiergerät ein.
„Heute ist Donnerstag, der 28. September 2006, sechzehn Uhr. Anna Gavaldo war in meiner Praxis …“
Aber da meldete sich sein Piepser, und dreißig Minuten später stand er am OP-Tisch, um einem Patienten mit einer frischen Hirnblutung das Leben zu retten.
Erst gegen Mitternacht, zurück in der Villa, konnte er seinen Gedanken freien Lauf und das Gespräch mit Anna Gavaldo Revue passieren lassen.
Mit den angewandten Psychoanalysen der vergangenen Wochen hatte er in ihrem Gehirn einen Prozess in Gang gesetzt, den er in seinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte.
Er hatte schon häufiger versucht, sie zu verstehen, dabei aber festgestellt, dass er sie nur schwer erreichen konnte. Er wusste, dass ihr Trick des Abtauchens nur dem Eigenschutz diente, da sie sehr sensibel und verletzbar war. Sie scheute offene Auseinandersetzungen, selbst wenn sie völlig harmlos waren. Anna ließ Gefühle seit jenen Ereignissen nicht mehr nach draußen. Ihre Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, ließ ihre Fantasie gedeihen. Sie lebte manchmal sogar völlig in einer Traumwelt, bis sie vom Alltag wieder eingeholt wurde.
Ihre Schwester Katharina war da ganz anders gewesen. Sie war ein sinnlicher Mensch und – wie er – allen schönen Dingen des Lebens zugetan. Sie war eine Genießerin, hatte Geschmack und hatte als Krankenschwester hart gearbeitet. Geduld war ihre Stärke, doch manchmal konnte das bei Katharina auch in Sturheit ausarten. Sie hatte sich immer gerne Zeit gelassen und wollte ihren eigenen, natürlichen Rhythmus finden.
Sie war keine Träumerin wie Anna, sie konnte sehr realistisch sein, deshalb war Katharina für ihn der Fels in der Brandung gewesen, an dem er sich orientiert hatte. Auch er strebte nach Besitz und Sicherheit. Katharina war sein Eigen gewesen, und er hatte sie nie mehr hergeben wollen.
Katharina … Wenn seine Gedanken sie umkreisten, legte sich die Einsamkeit wie ein schweres Tuch auf ihn und erinnerte ihn an jenen schicksalsträchtigen 27. Oktober 1995, der ihm bewusstgemacht hatte, dass er seit Katharinas Ermordung aufgehört hatte zu leben.
München, November 1995
Das Büro des Beerdigungsinstituts Borowski war spartanisch eingerichtet: ein schlichtes Kreuz an der weißen Wand, ein einfacher Schreibtisch aus Nussbaum und ein grauer Teppichboden, der die Schritte dämpfte.
Die Schreibtischlampe unterstrich mit ihrem kalten Licht die schaurige Atmosphäre, und Dr. Jörg Kreiler konnte ein Frösteln nicht unterdrücken. Auf dem Schreibtisch stapelten sich die Akten, die der Mann dahinter rasch beiseiteschob, als Jörg sich setzte.
Lothar Borowski begrüßte ihn mit einem wohlwollenden Blick. Jörg schätzte den Bestattungsunternehmer in seinem dunklen Anzug auf mindestens siebzig, vielleicht älter, aber seine rosafarbene Haut strahlte vor Gesundheit. Sein kahler Schädel hatte unter der grauen Beleuchtung etwas mondähnlich Imposantes. Die tiefschwarze Fliege hing auf eine Weise schief, die vermuten ließ, dass er sich in Windeseile für seinen Gast umgezogen hatte.
Borowski führte ihn schweigend in die Kapelle. Während sie stumm nebeneinander hergingen, dachte Jörg an die drei Worte, die seine Welt hatten einstürzen lassen. Drei Worte, die Katharinas Mutter in den Telefonhörer gesprochen hatte. Nein, es waren vier Worte gewesen: „Katharina ist tot. Ermordet.“ Und nach einer kurzen Pause am anderen Ende der Leitung: „Kommst du zur Beerdigung? Ihre Leiche wird in etwa vier Tagen freigegeben.“
Er hatte den Hörer aufgelegt und danach und auch später das Telefon immer wieder läuten lassen. Wie konnte sie ihre Tochter bloß so nennen? Ihre Leiche statt einfach nur Katharina.
Eine Leiche hatte keinen Namen, keine Konsistenz, keine Wünsche. Für sie würde sich nichts mehr ereignen. Sie würde nie mehr zu irgendetwas ihre Meinung sagen, nie mehr von ihrem Schmerz sprechen. Aus Katharina war eine unbewegliche starre Hülle geworden, für die nichts mehr eine Rolle spielte, auch er nicht.
Als Arzt wusste er, was man in einem Leichenschauhaus mit einem Körper nach der Obduktion machte. Außer dass man sie in ein Kühlfach legte oder sie beiseitestellte, bis jemand sie abholte, geschah nichts mit ihr. Gar nichts.
Und jetzt war er hier in Borowskis Beerdigungsinstitut und wollte vor der morgigen Beisetzung Abschied von seinem Mädchen nehmen. Er glaubte, im Hintergrund dezente Musik zu hören. Oder war es Katharina, die, von weichem Samt umgeben, in dem Mahagonisarg lag und seinen Namen rief? Es klang wie ein süßes, weit entferntes Lied.
Sein Herz pochte. „Öffnen Sie bitte den Sarg.“
Lothar Borowski sah ihn entsetzt an. „Morgen ist die Bestattung. Ich habe alles Mögliche getan, sie einigermaßen für die Beerdigung vorzubereiten. Dennoch ist es kein schöner Anblick. Wollen Sie sich dem wirklich aussetzen? Ich könnte das Licht noch mehr dämpfen.“
„Bitte.“ Seine Stimme klang tonlos.
Borowski hob den Deckel und trat mit gesenktem Kopf, die Hände respektvoll gekreuzt, einige Schritte zurück.
Jörg holte kaum wahrnehmbar Luft. Er wusste, was der Tod bedeuten konnte, doch zwischen dem natürlichen Ableben und diesem Tod stand eine Bestie, die ein blühendes Leben auf grausame Weise ausgelöscht hatte.
Sein Herz galoppierte. In seinem Kopf hallten Katharinas Schreie durch die Nacht, begleitet vom Singsang ihres Mörders. Er hörte ihr unaufhörliches Weinen, ihr krampfhaftes Schluchzen während der Vergewaltigung, ihr Flehen, sie nicht zu töten.
Er nahm eine Haarsträhne in die Hand und flüsterte leise: „Meine Liebe.“
Dann drehte er sich abrupt um, ging zum Eingang der Kapelle und nahm am äußersten Ende einer Reihe von Klappstühlen Platz. Er blickte auf seine im Schoß gefalteten Hände. Tief in seinem Inneren spürte er das Zittern, von dem er gehofft hatte, es würde nachlassen, wenn er sich einen Moment hinsetzte. Der Tod seiner Mutter hatte ihn tief berührt, doch der Schmerz, den er heute empfand, war unvergleichbar größer. Er griff in die Tasche seines Sportsakkos und tastete nach den blauen Beruhigungstabletten: Valium 20.
Er rutschte auf seinem Stuhl herum und blickte auf, als ein Mann die Kapelle betrat. Auch Borowski wunderte sich über das Erscheinen des Fremden. Der Mann blieb steif an Katharinas Sarg stehen, die Hände gefaltet, während seine Augen herumhuschten. Augen, in denen nur kalte Gleichgültigkeit lauerte. Jörg hörte, dass der Fremde kurz mit Borowski sprach. Die Worte bedeuteten nichts.
Für einen Moment schloss Jörg die Augen und konzentrierte sich auf die flüsternden Geräusche, doch er hörte nur das pfeifende Dröhnen in seinem Kopf und den leisen Hauch seines Atems.
Sein Mädchen war tot. Vorher war ihm alles hell, strahlend und leicht erschienen. Er hatte sie grenzenlos geliebt, Katharina war ihm unsterblich erschienen. Jetzt hatte sie ihn verlassen, zurückgelassen mit seiner Sehnsucht. Sie hatte nicht auf ihn gewartet, es gab kein Auf Wiedersehen, keinen Abschiedskuss. Er konnte nur abwarten, wie es ohne sie weitergehen würde. Konnte es überhaupt weitergehen? Jeder kehrte nach der Beerdigung in sein Leben zurück. Und Anna? Wie würde sie mit dem Tod ihrer Schwester umgehen? Die süße Anna erinnerte ihn so sehr an Katharina. Merkwürdig, dass ihm diese Ähnlichkeit mit einem Mal so quälend bewusst wurde.
Er beobachtete den Fremden, der sich nun vom Sarg entfernte.
Was wäre, wenn Katharinas Mörder hier auftauchen würde, fragte er sich. Was brütete ein krankes Hirn nach einem Mord sonst noch aus? Vielleicht, sich an dem Anblick ein letztes Mal aufzugeilen?
Als er die Kapelle verließ, rannte er beinahe in Katharinas Jugendfreund Severin Corelli hinein, der wohl auch in aller Stille Abschied nehmen wollte. Plötzlich hielt Severin inne und drehte sich nach ihm um. Seine Augen blickten vorwurfsvoll. Wollte er ihm damit sagen, dass er Katharina im Stich gelassen hatte?
Er wandte sich ab, um diesen Augen zu entgehen, die ihn aus einem fremden Gesicht anstarrten.
Die Gegenwart der Villa holte ihn wieder ein. Er biss die Zähne zusammen und atmete langsam und konzentriert durch. Dann drückte er die Zigarette im Aschenbecher aus, ging ins Schlafzimmer, öffnete die Schublade seiner Kommode und nahm Katharinas Glasperlenkette heraus, die Anna ihm vor Jahren geschenkt hatte. Sie war zerrissen. Er hielt die kleinen Kugeln lose in der Hand und ließ sie durch seine Finger gleiten.
Die Geister der Vergangenheit hatten noch immer Macht über ihn. Er hatte beim Anblick von Katharinas Leiche alles verloren. Warum musste sich ihr Mörder Jahre später ein neues Opfer suchen und sich ausgerechnet an ihrer Schwester Anna austoben? Sie wäre damals beinahe unter seinen Händen gestorben. Wenigstens hatte er ihr Leben retten können. An diese tröstliche Tatsache klammerte er sich so lange, bis sein Alter Ego ihn hämisch auslachte. Was für eine durchsichtige Verdrängungsstrategie!
An Schlafen war nicht zu denken. Er litt an Schlaflosigkeit, die seine Wahrnehmung allmählich auch tagsüber trübte. Und sobald er eindöste, sah er heute wie damals immer wieder in schauderhafter Deutlichkeit Katharinas zertrümmertes, in einer Blutlache liegendes Gesicht. Daran hatte sich nichts geändert, auch nicht, nachdem er Anna das Leben gerettet hatte. Dieses halluzinatorische Bild wirkte echt bis in die Details, selbst den Stoff ihrer Bluse oder die Form des Blutflecks hätte er genau beschreiben können.
Um die quälenden Gedanken loszuwerden, versetzte er sich in Trance und regredierte sich mit aller Kraft in eine bessere Welt: tropische Sonnenuntergänge in der Karibik, wo von dunkelgrünen, fleischigen Blättern der Regen tropfte und die Lianen bis auf den Boden hingen. Ein Papagei flatterte krächzend davon, Katharina berührte ihn. Sie sagte mit dieser sanften Stimme, die ihn so erregte, dass sie verrückt nach ihm sei, nach seinem Haar, nach seinem Mund, nach seinem Lachen, seinem Körper …
Er drehte sich auf die Seite und klemmte die dünne Bettdecke zwischen die Knie. „Katharina …“
Endlich übermannte ihn der Schlaf.
Kapitel 2
Rom – 22. September 2006
Seine langen, makellosen Finger umspielten Stein für Stein die Mauer der Aussichtsplattform der Villa d’Este. Unten auf den Kieswegen des Tivoli-Gartens eilten Menschen wie Ameisen von Brunnen zu Brunnen. Er fragte sich, ob Pirro Ligorio, der den Park für die Familie d’Este angelegt hatte, sich wohl je hätte träumen lassen, dass er eines Tages damit Millionen von Touristen erfreuen würde.
Die Villa d’Este lag ein Stück nordöstlich von Rom, an die Sabiner Hügel geschmiegt. Er war schon oft dort gewesen, und jedes Mal hatte es ihm besonderes Vergnügen bereitet, auf dem höchsten Plateau zu stehen und auf die sprudelnde Vielfalt der Springbrunnen herabzublicken, alle derart raffiniert angelegt, dass keiner dem anderen glich.
Alles sollte ganz schnell gehen – wie immer. Die Aussichtsplattform der Villa eignete sich vortrefflich für geheime Übergaben. Hier, mehr als 200 Meter über den Tivoli-Gärten, würde Pawel Kubanek, den alle nur die Katze nannten, niemandem begegnen, den er kannte. Nur Touristen nahmen die Anstrengung von dreihundertsiebenundzwanzig Stufen in Kauf, um den Ausblick auf die sprudelnden Brunnen zu genießen. In Rom kannte er jeden Winkel, er hatte hier einige Jahre gelebt.
Die Auftraggeber waren mit seiner Arbeit zufrieden. Pawel Kubanek wusste, dass er einer der besten Auftragskiller Russlands war. In den letzten Jahren war die RAK, eine russische Organisation fragwürdiger Charaktere, immer mächtiger und einflussreicher geworden. Das Drogen- und Geldwäschegeschäft sowie der Menschenhandel wurden ausgeweitet. Sexuelle Ausbeutung und die Entnahme und der Handel mit Organen waren zwar ein gefährliches, aber auch ein sehr lukratives Geschäft.
Er tötete Menschen, die der RAK gefährlich werden konnten. Häufig kamen seine Opfer aus dem Rotlichtmilieu: Zuhälter, die Verrat begingen; eine Prostituierte, die ihren Mund nicht halten konnte; ein Dealer, der die Jugendlichen auf dem Kinderstrich mit verunreinigtem Heroin der Konkurrenz versorgte. Hin und wieder erhielt er sogar den Auftrag, Persönlichkeiten aus Politik oder Wirtschaft aus dem Weg zu räumen.
Sie alle waren wie die Bösen in den Märchen, die seine Mutter ihm an den kalten Winterabenden unter Moskaus Brücken erzählt hatte. Er fürchtete sich nicht in den dunklen, undurchdringlichen Wäldern ihrer Seelenlandschaft, sondern tötete sie mit grausamer Effizienz und ohne jegliche Gefühlsregung.
Manchmal ließ er seine Opfer Blut schmecken, das er ihnen zu trinken gab, ihr eigenes Blut. Ihre Schreie hallten dann in seinem Kopf nach und verbanden sich mit den pochenden Schlägen seines Herzens.
Er wischte sich mit einer eleganten Handbewegung eine silberblonde Strähne aus dem Gesicht.
„Dein Name!“, forderte plötzlich eine Stimme neben ihm.
„Man nennt mich die Katze“, flüsterte Pawel Kubanek, ohne sich zur Seite zu wenden.
Unauffällig schob der Mann ihm einen braunen Umschlag zu, den er geschickt in die Innenseite seines Mantels wandern ließ. Dann verschwand der andere genauso unauffällig, wie er gekommen war.
Auch Pawel verließ die Aussichtsplattform, um in sein Hotel zurückzukehren. Es lag nicht weit entfernt vom Tivoli-Garten.
In der Penthousesuite des Hotels angekommen, öffnete er den braunen Umschlag und lächelte. Routine, dachte er im ersten Augenblick. Als er jedoch die Transfersumme auf dem Überweisungsträger las, stutzte er. Der Vorschuss war wesentlich höher als die Summen, die sonst auf sein Schweizer Bankkonto flossen.
Er blätterte die Unterlagen durch. Kein Foto, sondern Namen und Adressen. Und der Auftrag, eine Akte zu beschaffen und sie einem gewissen Konstantin Kollmann zukommen zu lassen.
Entgegen seiner Gewohnheit fragte er sich, weshalb ein Klient ein solch starkes Interesse an einer alten Ermittlungsakte hatte: ein Verbrechen, das als ungelöster Mordfall längst Geschichte war.
Üblicherweise erledigte er die Aufträge, ohne Fragen zu stellen. Den Kanälen, über die er an seine Auftraggeber kam, konnte er vertrauen. Die polnischen und russischen Kontaktleute wussten, dass er keine Spuren hinterließ; deshalb stand er hoch im Kurs. Wer war dieser Konstantin Kollmann überhaupt? Ob er der Sache nachgehen und den Klienten überprüfen sollte?
In den nächsten Tagen führte Pawel einige Telefonate, flog nach Düsseldorf und traf sich in einem Café in der Kö-Passage mit Benny Kretschmar, dem er Päckchen mit gebündelten Banknoten überreichte. Am selben Abend schlenderte er schon wieder durch die dunklen Gassen Roms.
Drei Tage später traf per Kurierdienst ein großer Umschlag ein. Er enthielt die Akten, die Konstantin Kollmann angefordert hatte. Ein Gerichtsdiener des Amtsgerichts Aachen hatte sie für Kretschmar kopiert, ebenso eine weitere Ermittlungsakte jüngeren Datums, nachdem Benny die Bedenken des Justizangestellten mit einer stattlichen Summe hatte ausräumen können. Bevor sie morgen an Konstantin Kollmann gingen, würde Pawel einen Blick hineinwerfen.
Er betrat die Terrasse der Penthousesuite und schaute über die Dächer dieser wunderbaren Stadt. Gierig sog er die klare Luft auf. Er genoss es, mit seinem geliebten Rom allein zu sein. Der bequeme Korbsessel war der ideale Platz, um sich in die alten Prozessakten zu vertiefen …
Aachen, 12. Oktober 1944 – Aufzeichnung Richter Kollmann
Seitdem er Kriegsgerichtsrat war, wimmelte es in seinem Terminkalender nur so von Einträgen. Richard Kollmann starrte auf die dicht beschriebenen Zeilen unter dem Datum Freitag, 13. Oktober 1944: 10 Uhr Verhandlung Grabosch, Krasinski, Jansen, Mahler.
Wehrmachtsstreifen, die Jagd auf Plünderer machten, hatten die vier jungen Männer aufgegriffen, und in der alten Kaiserstadt Aachen galt das Standrecht.
Die Schreibtischlampe verlieh dem Arbeitszimmer mit ihrem kalten weißen Licht eine unbehagliche Atmosphäre. Trotz der einschläfernden Wärme, die vom Kohleofen ausging, konnte Kollmann ein Frösteln nicht unterdrücken. Seit amerikanische Einheiten den Aachener Stadtwald bombardierten und der Bodenkrieg den deutschen Westen erreicht hatte, litt er unter starken Migräneanfällen.
Er schloss die Lider und rieb sich heftig die Schläfen, aber der dröhnende Schmerz, der ihm zu schaffen machte, konnte nicht einfach wegmassiert werden. Er öffnete die Augen und schenkte sich ein weiteres Glas Rotwein ein.
Auf dem schweren Mahagonischreibtisch stapelten sich die Akten festgenommener Jugendlicher. Er plante, die morgige Gerichtsverhandlung im Eilverfahren mit sofort verkündbarem Urteil zu beenden. Deshalb hatte er die Gerichtsakten der Angeklagten am Vormittag mit größter Sorgfalt studiert.
Durch diese exzellente Vorbereitung würde die Sitzung höchstens eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, und es blieb dann immer noch genügend Zeit, um anschließend zu Fuß zum Hotel Quellenhof zu gehen, in das SS-Reichsführer Himmler um zwölf zu einem kleinen Imbiss geladen hatte.
Der schwere Wein und die Opiattablette, die er vor einer Stunde eingenommen hatte, betäubten allmählich den Kopfschmerz. Ein feines Lächeln umspielte jetzt seine Mundwinkel. Die Burschen unmittelbar nach der Verhandlung von einem Exekutionskommando hinrichten zu lassen wäre eine Überlegung wert und würde ganz sicher Himmlers Stimmung heben. Der Gedanke ließ ihn schaudern. Womöglich brachte es ihm sogar eine Berufung zum Oberlandesgericht ein.
Stille lag über dem feudalen Wohnhaus, das zu den wenigen hochherrschaftlichen Villen gehörte, die bislang von Angriffen verschont geblieben waren. Draußen zogen graue Wolken am fahlen Mond vorbei. Sein Licht sickerte durch die Äste der alten Eiche und warf die Schatten, knöcherne Finger einer alten Frau, auf die Wände des Arbeitszimmers.
Kollmann leerte das Glas mit dem schweren roten Burgunder, löschte das Licht seiner Schreibtischlampe und ging schmunzelnd die Stufen zum Keller hinunter, wo das Vergnügen auf ihn wartete.
Am Freitag, den 13. Oktober 1944, einem bewölkten, kühlen Tag, wurden eine Gruppe junger Soldaten und ein vierzehnjähriger Zivilist wie Rinder bei einer Viehauktion ins Kriegsgericht getrieben.
Zur Vernehmung des achtzehnjährigen Grenadiers Maryam Krasinski, eines jungen Mannes mit kindlich weichen Gesichtszügen, erschien auch seine Mutter Dónya. Man hatte ihr gesagt, dies sei eine reine Routineangelegenheit, die schnell über die Bühne gehen werde.
Sie setzte sich in die letzte Reihe des Gerichtssaals, neben ihr der jüngere Sohn Jánosz und eine junge Frau, die in stummer Verzweiflung ein wimmerndes Baby umklammert hielt.
Dónya Krasinski weinte still in sich hinein, und ihre Augen blickten ausdruckslos zu dem erhöhten, langen Tisch. Noch war er verwaist, noch war kein Urteil über Maryam gesprochen. Als das Tribunal den Saal betrat und kalte graue Augen den Raum überblickten, legte sie unwillkürlich die Hand an ihre Kehle und spürte das Flattern ihres Herzschlags.
Kurze Zeit später verurteile ich ihren Sohn Maryam zum Tode.
Pawels Hände zitterten, als er die Akten beiseitelegte, und er starrte eine ganze Zeitlang ins Leere. Er war auf etwas völlig Unerwartetes gestoßen, und die Dokumente hatten sein bisheriges Leben völlig ins Wanken gebracht. Pawel griff sich an die Stirn und massierte seine Schläfen. Erinnerungen flackerten auf, Bilder der Vergangenheit: der Umzug von seiner Geburtsstadt Warschau nach Russland, eine Kindheit ohne Hoffnung, der Hunger, die Kälte, die Einsamkeit.
Pawel Kubanek dachte an Moskau, an das Denkmal für Minin und Poscharski, das er so oft betrachtet hatte: eine Bronzeskulptur des Bildhauers Martos, die vor der Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz stand. An der Kremlmauer befand sich der Alexander-Garten. Plötzlich war er wieder ein Kind auf dem Schoß seiner Mutter, das dort mit ihr auf einer Bank saß. Während sie ihn an ihren warmen, weichen Körper drückte, um ihn gegen die klirrende Kälte zu schützen, erzählte sie ihm von seinem Vater und seinem Großvater, die eines Tages kommen und sie beide in ein warmes Haus bringen würden.
Ganz in der Nähe des Kreml und des Roten Platzes waren einige der ältesten Steinbauten des Kitai-Gorod, der Moskauer Altstadt, erhalten geblieben: Baulichkeiten des alten Zarenhofs, das Haus des Bojaren Romanow und die Annen-Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Wenn er traurig und es besonders kalt war in Moskaus dunkelsten Gassen, schlichen sie sich in den alten Zarenhof. Dort erzählte seine Mutter ihm Geschichten von gläsernen Bergen und blauen Drachen, von Lebensbäumen und Mondblumen, von Talismanen und Tarnkappen, von Zauberern und Geistern, vom Feuervogel und der Regenbogenschlange, von weissagenden Träumen und dem Weg ins Himmelreich. Er lauschte ihren Worten, die ihn trösteten und ablenkten von dem nagenden Hunger, der seinen kleinen Körper ausmergelte.
Er tippte mit den Fingern einen nervösen Rhythmus auf dem Aktendeckel. Morgen würde er mit der Suche nach seinem wahren Ich beginnen und nach der Person fahnden, von deren Existenz er bislang nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.
Kapitel 3
Italien, Costa Smeralda – 3. Oktober 2006
Anna streckte genießerisch ihre Nase in den kühlen Wind. Sie fuhr auf der Straße nach Porto Cervo. Der Fahrtwind roch wunderbar frisch und rein. Wie in einer Projektionstrommel zogen Tausende mit Margeriten bewachsene Grashügel und riesige Flächen von Zwistrosen mit ihren aufdringlich weißen Blüten an ihr vorbei, gefolgt von Strohblumenfeldern und feuchten Tälern voller Erdbeerbäume, Erika und Oleander.
Anna holte tief Luft und sah im Rückspiegel zu ihrer Tochter. Lisa war auf dem Kindersitz eingeschlafen.
Jedes Jahr verbrachten sie im Herbst eine Woche in ihrem Haus an der Liscia di Vacca. Max hatte es vor Jahren erworben. Die Villa war mit architektonischem Feingefühl in die faszinierende Landschaft eingebettet worden und umgeben von einer prächtigen Parkanlage; eine Oase der Ruhe und ein Platz, an dem ihre Tochter ihren Spieltrieb ausleben konnte.
Manchmal dachte Anna dabei an ihre eigene Kindheit, an die Wochenenden, an denen sie mit ihrer Freundin Mathi und ihrem Großvater in den Hühnerstall ging, um kleine Küken unter einer großen Wärmelampe zu bewachen. Opa Alexe konnte wunderbare Geschichten aus Rumänien erzählen und hatte ihr so wichtige Dinge beigebracht wie Toleranz, Großzügigkeit und Anstand, die Neigung zur Musik, Kunst und Literatur und die Bedeutung einer Freundschaft. Das Wichtigste aber war, dass er sie lehrte, dass man nur sich selbst gehörte.
Eine Ewigkeit war seitdem vergangen. Sie war früher so fröhlich und unkompliziert gewesen, bis dieses Schwein …
Ich muss unbedingt etwas unternehmen, dachte sie. Max hatte darauf bestanden, schon diese Woche nach Italien zu fahren. Die Luftveränderung würde ihr guttun und sie auf andere Gedanken bringen, aber die Abgeschiedenheit hatte ihr nicht die ersehnte Erholung gebracht. Vielleicht hätte sie ein wenig Abwechslung aufgemuntert, aber im Ort gab es außer einem winzigen Lebensmittelladen, einem Fischhändler und einem Metzger nichts, was dieses Bedürfnis hätte befriedigen können, und die kleine, direkt neben der Kirche liegende Bar mochte vielleicht für die Einwohner eine Attraktion sein, für sie jedenfalls nicht.
Es gab kein größeres Vergnügen, als mit Lisa auf den Spielplatz zu gehen oder im Meer zu baden, aber in dieser ersten Urlaubswoche war alles anders geworden, nachdem sie mit Max und Lisa zum ersten Mal die Bar betreten hatte. Vielleicht lag es daran, dass an der Wand über der Theke das große Bild eines Erzengels hing, der mit seinem Schwert einen am Rand der Hölle liegenden Dämon niederstach. Vor dem Bild flackerte eine Kerze in einem roten Plastikbehälter.
Sie verschwieg Max, dass diese Augen Erinnerungssequenzen in ihr wachriefen. Der Dämon hatte stechende schwarze Augen wie der Mann in ihren Träumen, der sie in dem kalten, dunklen Raum so sehr gequält hatte. Jakob …
Sie blickte wieder in den Rückspiegel und betrachtete kurz ihre Tochter, die am Daumen nuckelte. Seltsam, dachte sie. Lisa liebte es besonders, in diese Bar zu gehen und sich wie die Dorfbewohner auf den Barhocker zu setzen, dabei ein Eis zu schlürfen und dieses Bild anzustarren.
„Was fasziniert dich bloß daran? Es ist so grausam …“, flüsterte Anna und erschauderte.
„Ich mag diese Bar nicht“, hatte sie zu Max gesagt. „Zu viele Dämonen an der Wand.“
Doch er hatte nur gelacht und sich über sie lustig gemacht. Es gäbe keine Dämonen, sagte er und suchte von da an gelegentlich allein die Bar auf, um meistens erst nach Mitternacht beschwipst heimzukehren.
Seine sonst so messerscharfen und raschen Rückschlüsse, die sie immer bewundert hatte, versagten hier, obgleich sie sonst so unerwartet wie Gedankenblitze kamen und immer eine fundierte logische Basis hatten, mit der er Probleme löste. Ja, das war es, was so besonders an ihm war. Aber bei ihr setzte sein Verstand aus. Er hatte keine Ahnung, welche Abgründe sich plötzlich auftaten.
Sie musste einen klaren Kopf bewahren und nicht immer sofort aus dem Häuschen geraten, wenn für den Bruchteil einer Sekunde eine Erinnerung aufblitzte wie vorhin.
Sie hatten im Ort einen Segler getroffen, der manchmal den kleinen Hafen ansteuerte und mit dem Max an einigen Abenden in der Bar ein Glas Rotwein trank. In der Bar hatte sie ihn „Jakob“ genannt.
„Sie verwechseln mich, Frau Gavaldo“, hatte er geantwortet.
Plötzlich war es still geworden in der Bar, der Raum hatte seine physischen Eigenschaften verändert, und es schien, als verlöre er seine Substanz. Alle hatten sie angestarrt. Sie hatte Lisa an die Hand genommen und war mit ihr eilig zum Auto gerannt. Das arme Kind war ganz verwirrt gewesen und hatte vor Schreck sein Eis auf den Boden fallen lassen.
Wie konnten Lisa, Max und die Bewohner des Dorfs auch wissen, dass Jakob sie noch immer verfolgte, sie beobachtete und sich womöglich noch immer in diesem Haus in Grünwald aufhielt; vielleicht in seinem mit den Zeichen des Todes übermalten Kellerraum oder im Dachgeschoss mit dem großen Bogenfenster. Wenn Erinnerungssequenzen sie in diese Räume führten, was bedeutete das? Nein, sie wollte nicht darüber nachdenken.
Nach Lisas Geburt hatte sie sogar geglaubt, dass die Zeit allmählich die Wunden heilte, auch weil der Tod durch neues Leben verdrängt worden war. Aber es gab hier in Italien zu viele Nächte, in denen sie kerzengerade und schweißgebadet im Bett saß.
Seltsam, dachte sie, Jörg hatte sie von Anfang an vor der Flüchtigkeit des Erinnerns gewarnt. Was würde er zu dem Dämon sagen? Warum wurde sie gezwungen, in die Augen dieses Ungeheuers zu schauen? „Während du dabeisitzt und dein Eis schlürfst“, sagte sie zornig und blickte in den Rückspiegel.
Lisas dunkle Augen musterten sie mit einem seltsamen Blick.
Plötzlich raste ihr Herz. „Hast du ausgeschlafen, Schätzchen?“
Lisa nickte. „Mit wem sprichst du da, Mami?“
„Ach, weißt du, manchmal denken Erwachsene einfach nur laut.“
Das Mädchen schien mit der Antwort zufrieden zu sein und sah durchs Seitenfenster. „Mami?“
„Ja, Kleines?“
„Stehst du auf Papi?“
„Äh, ja.“
Lisa nickte zufrieden. „Gut. Papi steht auch auf dich.“
Anna hob die Augenbrauen. „Hat er dir das erzählt?“
„Nein.“
„Woher weißt du das denn?“
„Ich weiß es. Ich bin klug“, antwortete Lisa.
„Aha.“
„Papi hat gesagt, du bist toll.“
„Hat er?“ Anna errötete unter dem prüfenden Blick ihrer sechsjährigen Tochter.
„Ja“, bestätigte das Kind.
„Gut.“
„Und warum hast du dann Angst?“
Anna erstarrte und trat auf die Bremse. Ihr Blick verschleierte sich, sie schloss die Augen. In Gedanken stieg Nebel hinter den Grashügeln auf. Er verwandelte die saftigen Wiesen in geisterhafte Weiden, zog über die Zwistrosen hinweg und umhüllte den Wagen. Der blaue Himmel war jetzt grau. Von weitem ragte ein Baum mit Hunderten von Krähen darauf gespenstisch empor.
Sie öffnete die Augen und lockerte den Sicherheitsgurt, dann drehte sie sich langsam um und starrte ihrer Tochter direkt in die Augen.
Das Mädchen war ein schönes Kind, mit seinen dunklen Locken, den großen dunklen Augen, einer feingezeichneten Nase und vollen Lippen. Und dennoch fragte sie sich, ob Jakobs Brut aus der Hölle in den Kindersitz geschlüpft war.
Sie bildete sich ein, dass das Kind sie anlächelte und ihr zärtlich übers Haar strich, doch beim Anblick des kleinen fremden Wesens empfand sie Angst und Zorn. Trieb die kleine Furie sie in den Wahnsinn? Das würde sie nicht zulassen. Sie war eine Heldin. Jakob hatte ihr das immer wieder ins Ohr geflüstert und ihr gesagt: Heldinnen töten, oder sie werden getötet. Sie würde überleben. Nichts würde sie davon abhalten, auch nicht diese kleine Bestie im Kindersitz.
In ihren Schläfen begann es dumpf zu pochen. Die Gegenwart holte sie wieder ein. Leise verließ sie in Gedanken die geisterhaften Weiden. Der Nebel lichtete sich, und der Himmel erhielt sein strahlendes Blau zurück. Sie glaubte, aus der Ferne das Wimmern eines Babys zu hören, und kam zur Besinnung, gerade rechtzeitig.
Ihre Tochter schluchzte heftig und versuchte, sich aus dem Kindersitz zu befreien. „Mami! Mami!“ Tränen rannen über Lisas Wangen, und sie streckte verzweifelt die Arme nach ihr aus.
„Meine Kleine. Warum weinst du denn?“, fragte sie betroffen.
„Du hast so komisch geguckt, Mami. Ich habe Angst.“
Sie stieg rasch aus, löste den Sicherheitsgurt des Kindersitzes und umarmte ihre Tochter. „Du musst keine Angst haben, Kleines. Alles ist in Ordnung.“
Lisa sah sie mit großen Augen an. Noch immer kullerten Tränen über das kleine Gesicht. „Wirklich?“
„Ja, Schätzchen“, flüsterte Anna und wiegte das Mädchen sanft hin und her, bis es sich beruhigte.
Wenig später fuhr sie weiter. Ihr Kopf dröhnte, ihr Herz schlug bis zum Hals. Dass sie raste, merkte sie gar nicht. Sie blickte in den Rückspiegel. Jakob hat mal wieder die Zähne gefletscht, dachte sie.
„Was meinst du, Kleines. Wollen wir heute Abend Onkel Jörg anrufen?“
Lisa nickte und lächelte.
Kapitel 4
München, 2. Oktober 2006
Es war ein sonniger Tag; eine Frühlingsbrise streichelte seine Haut, und doch fühlte sich die Luft schwer wie Eisen an.
Als Konstantin Kollmann am Abend die halbe Meile bis zum Kleinhesselohersee joggte, glaubte er, gegen die Last glücklicher Tage ankämpfen zu müssen, und er dachte unwillkürlich an das Sprichwort, nach dem nichts schwerer zu ertragen war als eine Reihe guter Tage.
Vom Joggen heimgekehrt, riss er als Erstes den großen Umschlag auf, den er gestern mit der Morgenpost erhalten hatte. Außer den alten Prozessakten enthielt er eine Notiz mit Informationen, auf die er gewartet hatte. Zögernd löste er den Knoten der braunen Kordel und klappte den Aktendeckel auf.
Sein Blick verdunkelte sich, als er die vor ihm liegenden Dokumente durchblätterte: Maryam Krasinski, ehelicher Sohn einer polnischen Landarbeiterin und eines deutschen Arbeiters, wurde im Alter von achtzehn Jahren am 16. Oktober 1944 hingerichtet. So stand es zumindest im Protokoll.
Er zitterte plötzlich und hatte das verängstigte Kind vor Augen, das viele Jahre später – am Abend des 20. Juli 1971 – im Haus in der Ludwigsallee 25 in Aachen aus dem Schlaf gerissen worden war.
Die Männer, die damals in das Haus seines Großvaters eingedrungen waren und den ehemaligen Richter auf bestialische Weise getötet hatten, waren zweifellos am Leben gewesen.
Er hatte sich in jener mörderischen Nacht ihre Vornamen eingeprägt. Ihre Sprache hatte er nicht verstanden, ihre Namen schon. Dieses Wissen behielt er für sich. Auch in den darauffolgenden Tagen verharrte er während der polizeilichen Vernehmung in Schweigen. Schließlich gaben die ermittelnden Beamten auf und führten sein Verhalten auf das durchlebte Trauma zurück.
Er wollte nicht, dass diese Männer gefasst wurden. Sie könnten gegenüber der Polizei die Schande erwähnen. Die Scham, versagt oder sich eine Blöße gegeben zu haben, diese quälende Empfindung wollte er mit niemandem teilen. Deshalb hatte er die Filmkassette aus dem Rekorder genommen und geschwiegen. Nur seiner Mutter vertraute er sich zwei Tage nach der Ermordung seines Großvaters an, und sie schworen einander, für immer zu schweigen. Jahre später begann er mit seinen Recherchen und beauftragte unzählige Detekteien im In- und Ausland mit der Suche nach den Männern und ihrem Anführer. Sie kosteten ihn ein Vermögen. Er selbst hatte die Polizeiakten eingesehen, Ermittlungsprotokolle gelesen und das Wesentliche notiert. Die Mörder seines Großvaters hatten Spuren hinterlassen: An dem Abend war das Wort Malinka gefallen. Er fand heraus, dass Malinka eine ehemalige polnische Widerstandsorganisation war und die Mörder ehemalige Mitglieder waren. Heute, fünfunddreißig Jahre später, wusste er, wo sich jeder Einzelne von ihnen aufhielt. Sogar den Anführer hatte eine Detektei ausfindig gemacht. Den, von dessen Hinrichtung diese Akte berichtete.
Auf eine Menge Fragen hatte er Antworten gefunden, aber jede Antwort warf noch mehr Fragen auf, die ihm vorher nie in den Sinn gekommen wären, besonders seit die Erinnerungen ihm den Schlaf raubten und ihn zu dem machten, was er war: skrupellos und von einer Kälte, die ihn selbst erschreckte.
Stets begleiteten ihn Erinnerungen an die unvergesslichen Abende, an denen er seinen Großvater besucht und mit ihm Rommé gespielt hatte, um seine Stärke, seine Schnelligkeit, überhaupt seine ganze Persönlichkeit mit ihm zu messen. Er lebte vom Lob und vom Beifall des Richters, wie die Nachbarn ihn nannten, dort draußen auf der Veranda hinter dem alten Haus.
Der Großvater zeigte ihm nach dem Spiel die Kisten auf dem Dachboden, die zahlreiche Papiere enthielten, und erzählte ihm Geschichten von Menschen, die ihm ihr Leben verdankten. Dabei legte der alte Mann den Arm um seine Schulter. Er bemerkte die Anziehungskraft und die Grausamkeit dieser grauen Augen; eine primitive Geilheit, die den betörenden Duft der am Dachfenster wild emporrankenden Rosen vernichtete und den Mond zitternd schillern ließ, eine blasse Scheibe unten im Weiher.
Er hatte die Lippen des Alten gespürt, wie sie an seinem Hals saugten, die herumrührende Zunge in seinem Mund, eine streichelnde Hand an seinen Genitalien, die andere hielt ihn fest, unerbittlich. Irgendwann drang der alte Mann in ihn ein. Dabei entging ihm natürlich die Veränderung in seinem Enkelkind, die Schauer einer mörderischen Wut, ein Schrei, ein Junge, der von den Fängen eines Falken durchbohrt und durch die Luft davongetragen wurde.
Oft erwachte er heute aus seinem Schlaf; immer waren es die Schreie und das Stöhnen des Spätsommers, jener hitzigen Nächte nach dem verlorenen Kartenspiel, und er, in den Fängen seines Großvaters. Damals war er fünf Jahre alt gewesen.
Unzählige Male hatte der Richter sich in den darauffolgenden Jahren, während er schlief, aus dem Staub seines Grabes erhoben, um ihn auf dem Dachboden zu missbrauchen, immer und immer wieder. Die Gewalt des Richters, der sein Großvater war, hatte ihm seine Kindheit geraubt und ihn besudelt. Sie schlug tiefe Wurzeln in seinem Herzen, sie kannte weder Blüte noch Erntezeit, weder Frühling noch Winter, sie war immer reif, immer frisch.
Er seufzte. Die Prozessakte war vom vielen Durchblättern ziemlich zerfleddert, die Seiten waren zerknittert und an den Rändern ausgefranst, an der rechten unteren Ecke befand sich ein bräunlicher Kaffeefleck. Aber das war gleichgültig. Seine Zeit war gekommen.
Die Hirnoperation eines zwielichtigen Privatpatienten hatte ihm die Lösung gebracht: die Kontaktadresse eines Auftragskillers. Für diesen Hinweis hatte er sogar auf sein Honorar verzichtet.
Der Mann, den alle nur die Katze nannten, hatte erste Anweisungen erhalten und war bereits auf dem Weg nach Essen.
Kapitel 5
Salzburg
Jörg Kreiler wachte auf der Wohnzimmercouch in seinem Ferienhaus auf, ihr Lächeln vor Augen. Irgendwo draußen am Stadtrand von Salzburg stromerte die Nacht herum. Noch immer hielt er die Aufnahmen in der Hand, die heute mit der Post gekommen waren.
Seit Wochen hatte er auf diesen Moment gewartet. Die Aufnahmen von ihr und dem Kind, einem sechsjährigen Mädchen, lächelnd, schwarze Locken, dunkle Augen. Diese Augen, dachte er, haben etwas Unergründliches. Plötzlich kam ihm Annas Peiniger und Katharinas Mörder in den Sinn: der Arzt Nicolas Giacomo Corelli, der sich Jakob nannte, wenn er seinen Perversionen nachging. Er war nur ein armseliges krankes Müttersöhnchen gewesen, das reihenweise junge Frauen umbrachte, die seiner Mutter glichen. Corelli hatte Katharina schon als Kind im Visier gehabt. Niemand hatte Verdacht geschöpft, weil Katharina mit Corellis Adoptivsohn Severin befreundet war. Sie war das unbeschriebene Blatt, das Corelli mit seinen Wünschen und Vorstellungen füllte, bis Katharina sich in ihn, Jörg Kreiler, verliebte. Corelli hatte sie dafür mit dem Tod bestraft. Aber warum musste sich dieses Schwein später auch noch auf die heranwachsende Anna stürzen? Ganz klar, weil sie ihrer Schwester Katharina glich.
Er ertappte sich neuerdings dabei, dass tief in seinem Inneren Verständnis für dieses Motiv aufflackerte. Jakob hatte Katharina begehrt, und in Anna hatte der Bastard nur Katharina gesehen. Diese verdammte Ähnlichkeit machte auch ihm zu schaffen.
Er starrte auf die Fotografie. Das waren nicht Max’ Augen im Gesicht des Mädchens!
Schon der bloße Gedanke an Annas Ehemann ließ ihn wütend werden. Max, der ihr nur das unangenehme Gefühl des Nicht-ausgefüllt-Seins brachte. Er war der Inbegriff der Eintönigkeit, der Ödnis, ein entsetzlicher Langweiler, der diese Frau nicht verdient hatte.
Nie würde er sie verstehen, denn Anna war keine turbulente Aktienkurve. Sie verkörperte die Leichtigkeit des Tanzes und drückte das Gefühl der Sehnsucht nach Liebe aus. Aber sie hatte Sicherheit gesucht, finanzielle Sicherheit. Ihre Eltern waren alles andere als vermögend gewesen. Das prägt einen Menschen. Nur kein Risiko eingehen.
Mein Gott, wie naiv! Emotionale Abenteuer, Leidenschaften, rauschende Sinnlichkeit, nichts wusste sie davon! Nichts! Könnte er ihr doch sagen, dass sein Haus in ihrer Abwesenheit in Schweigen verfiel, obwohl er dennoch die Nähe von etwas spürte, einen Geist, den Gedanken an Feuer, das drohte, ihn zu verzehren. Die Erinnerung an Katharinas festen Körper, ihre Bewegung, wenn sie das Licht löschte, bevor sie sich liebten …
Er kratzte sich den Oberarm auf und starrte auf die blutige Spur.
Warum blieb Anna bloß bei diesem gestylten Nadelstreifenhänfling? Er wusste sie doch nicht zu lieben. Nicht mit einer Begierde wie die seine, die immer heftiger wurde, immer tiefer, die sich verausgabte. Max’ Gleichgültigkeit war nur grauenvoll. Er verschwendete keinen Gedanken an ihren Körper, ihre Haut, ihre Seele.
„Aber ich, ich schreie nach dir, Anna“, flüsterte er. „Anna, hörst du? Komm, lass mich fliegen mit dir. Abheben von allem.“
Er zitterte jetzt am ganzen Körper. Katharina war so reizvoll, so außergewöhnlich, faszinierend schön und so ausgesprochen weiblich gewesen. Mit Geduld, aber auch mit Entschlossenheit hatte er sie umworben. Auch Anna war bildschön. Die Ähnlichkeit mit ihrer Schwester Katharina verblüffte ihn immer wieder aufs Neue.
Aber Anna war feminin, romantisch, sanft und zerbrechlich, eine bezaubernde Träumerin, fast als wäre sie gerade einem Märchenbuch entstiegen. Ihre Schönheit war zart und elfenhaft. Lachen und Weinen lagen bei ihr oft nahe beieinander, da sie sehr gefühlvoll war und rasch auf äußere Einflüsse reagierte.
Seine Finger glitten zart über das Gesicht auf dem Foto, das ihn anlächelte: Katharina in anderer Gestalt. Niemand wusste etwas von seiner Qual, nicht mal Anna selbst.
Die Zeit der Umsicht war vorbei. Er würde sie bald wiedersehen, in fünf Tagen, in einer Woche, jedenfalls bald, in München oder in dem Haus am Meer; im Bikini am Pool, in Schlauchtop und kurzem Rock, in einem Kleid, schimmerndes Azurblau im Spiel des Sonnenlichts.
Er brauchte frische Luft und ging hinaus. Die Straße war menschenleer. Noch einmal betrachtete er im Licht der Straßenlaterne ihr Foto. Anna sah fröhlich aus, und das verwirrte ihn noch mehr. Angewidert warf er es auf den Boden und zertrat es im Straßenschmutz, setzte sich darauf und weinte.
Noch immer glaubte er, Katharina an einem der Fenster im oberen Stockwerk ihres Hauses zu sehen. Ihre blauen Augen strahlten, und sie winkte zu ihm herab, ihr blondes Haar war zur Seite gebürstet.
Nach all den Jahren war er immer noch nicht frei. Anna war in sein Leben getreten und hatte wieder alles aufgewühlt, die Trauer, die Verzweiflung, die Vergeblichkeit, die Tränen und … die Liebe.
Kapitel 6
Essen – Freitag, 6. Oktober 2006
Während der zwanzig Jahre, die Sedar Biljano im Essener Stadtteil Kettwig wohnte, war die Ruhrbrücke zu seinem Lieblingsplatz avanciert. Von hier hatte der zweiundsiebzigjährige Mann in dem braunen Wollmantel, der schon bessere Zeiten gesehen hatte, einen wunderschönen Blick auf das mittelalterliche Fachwerkhaus-Ensemble der Kettwiger Altstadt mitsamt der Evangelischen Marktkirche oberhalb des Mühlengrabens, eines ehemaligen Seitenarms der Ruhr. An diesem Vormittag tat die herbstliche Sonne ein Übriges und schenkte dem märchenhaften Panorama seine schönsten ockergelben und rotgoldenen Farben. Die alte Steinbrücke aus dem Jahr 1786 führte über die idyllische Teichanlage, und fast hatte er den Eindruck, im Mittelalter zu sein.
Auf den gut ausgebauten Wanderwegen in Richtung Essen-Werden herrschte reger Betrieb. Auch Sedar Biljano war heute Morgen den Promenadenweg bis zur Ruine Kattenturm entlanggegangen und hatte im nahe gelegenen Ausflugslokal einen Kaffee getrunken. Aber den Heimweg hatte er mit einem Ausflugsboot der Weißen Flotte angetreten, das direkt am Ruhrufer an der Bootsanlegestelle Kattenturm abfuhr.
Seine alten Knochen machten längere Spaziergänge nicht mehr mit. Doch das war nicht der einzige Grund; an diesem Vormittag beschlich ihn das unangenehme Gefühl, dass hinter seinem Rücken jemand war, der ihn im Auge behielt. An der alten Burgruine hatte er versucht, diesen Eindruck zu ignorieren und dem Drang zu widerstehen, einen Blick über die Schulter zu werfen. Als er sich dann doch umgedreht hatte, war weit und breit niemand zu sehen gewesen, der ihm verdächtig vorgekommen wäre. Doch seit das Boot am Promenadenweg angelegt hatte, war das Gefühl wieder da.
Langsam schlurfte er von der Brücke in Richtung Kirchtreppe. Sie war eine schmale Gasse, die durch eine Gruppe gut erhaltener Fachwerkhäuser führte, die unter Denkmalschutz standen und sich bis ins 14. Jahrhundert zurückdatieren ließen. Die Treppe endete auf dem tiefer gelegenen Tuchmacherplatz im Herzen der Kettwiger Altstadt, wo er ein kleines Haus besaß.
Auf dem gepflasterten Platz stand seit einigen Jahren die Skulptur Weberbrunnen, die an die jahrhundertealte Tradition der Tuchmacherei in Kettwig erinnerte. Und dort glaubte er einen Schatten zu sehen, nur für den Bruchteil einer Sekunde, aber er war sich absolut sicher.
Rasch schloss er die schwere Eichentür seines Hauses auf und verriegelte sie von innen. Dann schob er die Gardine ein wenig beiseite und spähte durchs Fenster, das ihm einen Blick auf das gesamte Häuserensemble an der Kirchtreppe ermöglichte. Nichts. Die Gasse war menschenleer.
Am Anfang der ruhigen kleinen Straße lag eine mit Brettern vernagelte Kneipe, an ihrem Ende ein kleiner Antiquitätenladen. Ansonsten war sie von alten Fachwerkhäusern gesäumt, eine Kleinstadtidylle, in der sich gegen Abend Kinder auf ihren Fahrrädern austobten. Biljano wusste, dass sich die Familien hier schon immer ziemlich sicher gefühlt hatten. Und genau das war der Grund, weswegen er selbst sich hier niedergelassen hatte.
Er zog seine Schuhe aus, stellte sie in den Dielenschrank und steckte seine Füße in braune Filzpantoffeln. Dann schlurfte er ins Schlafzimmer, legte sich aufs Bett und grübelte.
Die Vorhänge seines Hauses blieben tagsüber geschlossen. Der Putzfrau hatte er wegen der Schwierigkeiten, die sie machte, vor drei Wochen gekündigt, und allmählich türmte sich das Geschirr in der Küche. Sie hatte in seinen Sachen herumgeschnüffelt und ihn irgendwann gefragt, ob der Kandinsky an der Wand über seiner Couch echt sei.
Verdammt, hatte er gedacht. Wenn jemals herauskäme, dass er das Bild und auch andere wertvolle Gegenstände damals aus Kollmanns Haus hatte mitgehen lassen, wäre er geliefert.
Als er heute in den frühen Morgenstunden aufgewacht war und nicht wieder einschlafen konnte, hatte er sich noch einmal Karl Nüskers „Vermächtnis“ angesehen: den Doppel-8-Schmalfilm aus dem Jahr 1944 über eine Misshandlungsorgie, den er auf eine DVD überspielt hatte. Es war, viele Jahre später, ein zutiefst befriedigendes, ja erhebendes Gefühl gewesen, mit anzusehen, wie sein Kamerad Michail Heptna diesem Widerling die Augen ausgestochen hatte.
Allerdings konnte er bis heute nicht nachvollziehen, warum Krasinski gewollt hatte, dass der Junge bei dieser Schweinerei zugegen war. Schließlich beinhaltete sein Plan lediglich die Ermordung des Kriegstribunals von 1944, lautlos und schnell und ohne wesentliche Spuren zu hinterlassen. Sie hatten Kollmanns Haus wochenlang observiert, sich Notizen gemacht und festgestellt, dass der Richter und sein Tribunal noch immer ihren sadistischen Neigungen nachgingen.
Jedes Mal, wenn sich Biljano diese Aufzeichnungen monströser menschlicher Verfehlungen anschaute, wurde ihm übel. Und trotzdem musste er sich eingestehen, dass eine dämonische Faszination ihn geradezu zwang, sich diese Bilder immer wieder anzusehen.
Der alte Mann zog die schmuddelige Steppdecke bis zu den grauen Bartstoppeln hoch. Seine Augenlider wurden schwer, der Spaziergang an der frischen Luft hatte ihn ermüdet. Er musste sich ein wenig ausruhen und ein kurzes Mittagsschläfchen einlegen, schließlich würde er am Abend Besuch bekommen.