
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Ähnliche
Am Silser- und am Gardasee.
Erstes Kapitel.
Im stillen Hause.
Im Ober-Engadin, an der Straße gegen den Maloja hinauf, liegt ein einsames Dörfchen, das heißt Sils. Da geht man von der Straße querfeldein, und hinten, ganz nahe an den Bergen, liegt ein kleiner Ort, der heißt Sils-Maria. Da standen zwei Häuschen einander gegenüber, ein wenig abseits im Felde. Die hatten beide uralte hölzerne Haustüren und ganz kleine Fenster tief in der Mauer drinnen. Beim einen Haus war ein kleines Stück Garten, da wuchs Kraut und Kohl und es standen auch vier Blumenstöcke darin, die sahen aber mager aus und aufgeschossen wie das Kraut. Beim anderen Häuschen war gar nichts als ein kleiner Stall neben der Tür; da krochen zwei Hühner aus und ein. Dies Häuschen war noch ziemlich kleiner als das andere, und die hölzerne Tür war schwarz vor Alter.
Aus dieser Tür trat jeden Morgen um dieselbe Zeit ein großer Mann, der mußte sich bücken, um hinauszukommen. Der große Mann hatte ganz glänzend schwarze Haare und schwarze Augen, und unter der schön geformten Nase fing gleich ein so dichter, schwarzer Bart an, daß man vom übrigen Gesichte nichts mehr sah als die weißen Zähne, die zwischen den Barthaaren durchblitzten, wenn der Mann einmal sprach; aber er sprach sehr wenig. Alle Leute in Sils kannten den Mann, aber niemand nannte ihn bei einem Namen, er hieß bei allen nur »der Italiener«. Er ging regelmäßig den schmalen Weg querüber gegen Sils hin und den Maloja hinauf. Dort wurde viel an der Straße gebaut, und da hatte der Italiener seine Arbeit. Ging er aber nicht den Weg hinauf, so ging er hinunter, dem Bade St. Moritz zu; dort baute man Häuser, und er fand auch seine Arbeit. Da blieb er den Tag über und kehrte erst am Abend wieder ins Häuschen zurück. Gewöhnlich, wenn er am Morgen aus der Tür trat, stand hinter ihm ein Büblein; das stellte sich auf die Türschwelle, wenn der Vater draußen war, und schaute mit den großen, dunklen Augen lange hinaus dem Vater nach, oder sonst wohin, man hätte nicht sagen können, wohin, denn es war, als ob die dunklen Augen über alles wegschauten, was vor ihnen lag, und auf etwas hin, das niemand sehen konnte.
Am Sonntagnachmittag, wenn die Sonne schien, dann traten die beiden auch manchmal miteinander aus dem Häuschen und gingen nebeneinander her die Straße hinauf. Und wenn man sie so ansah, so sah man ganz dasselbe vor sich in den zwei Gestalten, nur bei dem Büblein alles im kleinen, aber es war ganz wie vom Vater abgeschnitten, bis auf den schwarzen Bart, den hatte es nicht, sondern ein schmales, bleiches Gesichtchen war da zu sehen, mit dem schöngeformten Näschen in der Mitte, und um den Mund herum lag etwas Trauriges, wie wenn er nicht lachen möchte. Das konnte man beim Vater nicht sehen vor dem Bart.
Wenn nun die beiden so nebeneinander hergingen, dann sagte keiner ein Wort zu dem anderen; meistens summte der Vater leise ein Lied, manchmal auch lauter, und das Büblein hörte zu. Wenn es aber regnete am Sonntag, dann saß der Vater daheim im Häuschen auf der Bank am Fenster, und das Büblein saß neben ihm, und sie sagten wieder nichts zueinander. Aber der Vater zog eine Mundharmonika hervor und spielte eine Melodie nach der anderen, und das Büblein hörte aufmerksam zu. Manchmal nahm er auch einen Kamm oder ein Baumblatt und lockte Melodien daraus hervor, oder er schnitt ein Stück Holz zurecht und pfiff darauf ein Lied. Es war, als gäbe es keinen Gegenstand, dem er nicht Musik entlocken könnte. Aber einmal hatte er eine Geige mit nach Hause gebracht, die hatte das Büblein so entzückt, daß es sie nie wieder vergessen konnte. Der Vater hatte viele Lieder und Melodien darauf gespielt und das Büblein unverwandt zugeschaut, nicht nur zugehört; und wie der Vater die Geige weggelegt hatte, da hatte sie das Büblein leise genommen und probiert, wie man die Melodien herausbringe. Und es mußte es so gar schlecht nicht gemacht haben, denn der Vater hatte gelächelt und gesagt: »So komm!« und hatte seine großen Finger auf die kleinen gelegt mit der linken Hand, und mit der rechten die Hand des Bübleins mitsamt dem Bogen in die seinige genommen, und so hatten sie eine gute Zeitlang fortgegeigt allerlei Melodien.
Die folgenden Tage, wenn der Vater fort war, hatte das Büblein fort und fort probiert und gegeigt, bis es eine Melodie herausgebracht hatte; aber da war auf einmal die Geige wieder verschwunden und kam nie wieder zum Vorschein. Zuweilen, wenn sie so zusammensaßen, fing der Vater auch an zu singen, erst nur leise und dann immer deutlicher, wenn er einmal daran war. Dann sang das Büblein auch mit, und wenn es die Worte nicht recht mitsingen konnte, so sang es doch die Töne; denn der Vater sang immer italienisch, und es verstand vieles, aber es war ihm nicht so recht bekannt und geläufig zum Singen. Da aber war eine Melodie, die konnte es besser als alle anderen, denn der Vater hatte sie vielhundertmal gesungen.
Sie gehörte zu einem langen Lied, das fing so an:
Es war eine ganz wehmütige Melodie, die einer zu der kurzweiligen Romanze gemacht hatte, und sie gefiel dem Büblein besonders wohl, so daß es sie immer mit Freuden und ganz andächtig absang, und es tönte gut, denn das Büblein hatte eine helle, glockenreine Stimme, die floß so schön mit des Vaters kräftigem Baß zusammen. Auch jedesmal, wenn dieses Lied zu Ende gesungen war, klopfte der Vater den Kleinen freundlich auf die Schulter und sagte: »Bene, Encrico, va bene.« So nannte aber nur der Vater den Knaben, bei allen anderen Leuten hieß er nur »Rico«. Da war auch noch eine Base, die mit in dem Häuschen wohnte, die flickte und kochte und alles in Ordnung hielt. Im Winter saß sie am Ofen und spann, da mußte Rico immer nachdenken, wie er seine Gänge einrichten könne, denn sobald er die Tür aufmachte, sagte die Base: »Laß doch einmal diese Tür in Ruh’, es wird ja ganz kalt in der Stube.« Er war dann oft lange allein mit der Base. Der Vater hatte in der Zeit irgendwo unten im Tale Arbeit und blieb viele Wochen lang fort.
Zweites Kapitel.
In der Schule.
Rico war bald neun Jahre alt und hatte schon zwei Winter hindurch die Schule besucht, denn im Sommer gab es da droben in den Bergen keine Schule; da hatte der Lehrer seinen Acker zu bebauen und zu grasen und zu hauen wie alle anderen Leute, zur Schule hatte dann niemand Zeit. Das tat aber dem Rico nicht besonders leid, er wußte sich schon zu unterhalten. Wenn er sich am Morgen dort auf die Schwelle gestellt hatte, so blieb er stehen, schaute hinaus mit träumenden Augen und bewegte sich nicht, und so konnte er stundenlang stehen, wenn nicht drüben am anderen Häuschen die Türe aufging und ein kleines Mädchen herauskam und lachend zu ihm herüberschaute; dann lief Rico schnell hinüber, und die Kinder hatten sich schon wieder viel zu sagen seit gestern Abend, wo sie sich zuletzt gesehen hatten, ehe Stineli ins Haus gerufen wurde. Stineli hieß das Mädchen und war gerade so alt wie Rico; sie hatten miteinander angefangen in die Schule zu gehen und waren in derselben Klasse, und schon von jeher waren sie immer beieinander gewesen, denn es war ja nur ein schmaler Weg zwischen ihren Wohnungen und sie waren die allerbesten Freunde.
Rico hatte auch nur diese einzige Freundschaft, denn mit den Buben ringsherum hatte er keine Freude, und wenn sie sich prügelten und auf dem Boden herumwarfen und sich auf die Köpfe stellten, dann ging er davon und schaute nicht einmal zurück. Wenn sie aber riefen: »Jetzt wollen wir einmal den Rico abprügeln«, dann stand er still und stellte sich geradeauf hin und machte gar nichts; aber er schaute sie mit den dunkeln Augen so merkwürdig an, daß ihn keiner packte.
Aber beim Stineli war’s ihm wohl zumute. Es hatte ein lustiges Stumpfnäschen und darüber zwei braune Augen, die lachten immerfort, und um den Kopf hatte es zwei dicke, braune Zöpfe gebunden, die sahen sehr sauber aus, denn das Stineli war ein ordentliches Mädchen und wußte sich zu helfen; es war auch in einer guten Schule Tag für Tag. Stineli war wohl kaum neun Jahre alt, aber es war die älteste Tochter und mußte der Mutter überall helfen, und da war viel zu tun. Denn nach dem Stineli kamen noch: das Trudi und der Sami und der Peterli, und das Urschli und das Anne-Deteli und der Kunzli, und dann noch das Ungetaufte. Immerfort rief man nach dem Stineli aus allen Ecken, und es war dabei so flink geworden, daß ihm alles aus der Hand lief wie von selbst. Den Kleinen hatte es immer schon drei Strümpfe und zwei Schuhe angezogen und festgebunden, eh’ das Trudi dem einen, dem es helfen sollte, nur die Beine dazu in die rechte Stellung gebracht hatte. Und wenn in der Stube die kleinen Kinder und in der Küche die Mutter miteinander dem Stineli riefen, dann rief der Vater noch aus dem Stall herüber, er hatte dort die Kappe verlegt oder die Peitsche war verknüpft, und das Stineli mußte ihm helfen, denn es fand die Kappe immer gleich, sie war meistens auf dem Futterkasten, und seine gelenkigen Finger brachten die Peitschenschnur gleich auseinander. So war das Stineli immerfort im Laufen und am Arbeiten, aber es war ganz lustig und munter dabei, und im Winter war es froh über die Schule, denn dann wanderte es dahin und wieder heim mit dem Rico, und in der Pause gingen sie auch zusammen. Und im Sommer war es wieder froh, da gab es schöne Sonntagabende, da es hinaus durfte; dann zog es aus mit dem Rico, der schon lange drüben unter der Tür gewartet hatte, und sie liefen Hand in Hand über die große Wiese hin nach der bewaldeten Anhöhe drüben, die weit in den See hinausgeht wie eine Insel. Dort oben saßen sie unter den Tannen und schauten in den grünen See hinunter und hatten einander so viel zu erzählen und zu fragen, und es war ihnen so wohl, daß das Stineli sich die ganze Woche und durch alles durch freute, denn es wurde immer wieder Sonntag.
In dem Häuschen aber war noch jemand, der dann und wann nach dem Stineli rief, das war die alte Großmutter. Die rief aber nicht, damit es ihr noch helfe, sondern sie hatte ihm etwa einen Blutzger zu geben, der ihr in die Hand kam, oder sonst etwas, denn Stineli war ihr Liebling und sie sah es mehr als sonst irgend jemand, wie viel das Stineli schon tun mußte für sein Alter, mehr als die meisten Kinder. Darum gab sie ihm gern etwas, daß es auch wie andere Kinder am Jahrmarkt etwas kaufen könne, etwa ein rotes Bändeli oder ein Nadelbüchsli. Die Großmutter war auch gegen Rico sehr gut und sah die Kinder gern beisammen und tat auch manchmal etwas für das Stineli, daß es mit dem Rico noch ein wenig draußen bleiben durfte.
An den Sommerabenden saß sie immer vor dem Häuschen auf dem Holzstumpf, der da lag; und oft standen Stineli und Rico bei ihr und sie erzählte ihnen etwas. Wenn dann die Betglocke zu läuten anfing vom Türmchen, so sagte sie: »Jetzt müßt ihr jedes ein Vaterunser beten, und das dürft ihr nie vergessen, daß man am Abend sein Vaterunser beten muß; dazu läutet die Betglocke.«
»Und seht, Kinder«, sagte die Großmutter von Zeit zu Zeit einmal wieder, »ich habe schon lange gelebt und viel gesehen, und ich kenne nicht einen, der nicht einmal in seinem Leben sein Vaterunser nötig gehabt hätte, aber manchen, der es mit Angst gesucht und nicht mehr gefunden hat, wenn die Not da war.« Dann standen Stineli und Rico ganz andächtig da und jedes betete ein Vaterunser.
Jetzt war es Mai und eine kleine Zeit mußte die Schule noch dauern, lange konnte es nicht mehr sein, denn es grünte unter den Bäumen und große Strecken waren ganz frei von Schnee. Rico stand schon unter der Tür seit einer guten Weile und stellte diese Betrachtungen an. Dabei schaute er immer wieder nach der Tür drüben, ob sie noch nicht aufgehen wollte. Jetzt ging sie auf und Stineli kam herausgesprungen.
»Bist du schon lang dagestanden? Hast du wieder gestaunt, Rico?« rief es lachend. »Siehst du, heut’ ist es noch früh, wir können langsam gehen.«
Jetzt nahmen sie einander bei der Hand und wanderten der Schule zu.
»Denkst du immer noch an den See?« fragte Stineli im Gehen.
»Ja gewiß«, versicherte Rico mit ernstem Gesicht, »und manchmal träumt es mir auch davon und ich sehe so große, rote Blumen daran und drüben die violetten Berge.«
»Ach, das gilt nicht, was es einem träumt«, sagte Stineli lebhaft; »es hat mir auch einmal geträumt, der Peterli kletterte ganz allein auf die allerhöchste Tanne hinauf, und wie er auf dem obersten Zweiglein saß, da war’s nur noch ein Vogel, und er rief herunter: ›Stineli, zieh mir die Strümpf’ an.‹ Jetzt siehst du doch, daß das nichts sein kann.«
Rico mußte stark nachdenken, wie das sei, denn sein Traum konnte doch sein und war nur wie etwas, das ihm wieder in den Sinn kam. Aber jetzt waren sie nahe beim Schulhaus angelangt und ein ganzer Trupp Kinder lärmte von der anderen Seite daher. Sie traten alle miteinander ein, und bald nachher kam auch der Lehrer. Der war ein alter Mann mit dünnen, grauen Haaren, denn er war schon undenklich lang Lehrer gewesen, so daß ihm darüber die Haare grau geworden und ausgefallen waren. Es ging nun an ein strenges Buchstabieren und Syllabieren, dann kam das Einmaleins an die Reihe und zuletzt kam der Gesang. Da holte der Lehrer seine alte Geige hervor und stimmte sie, und nun ging es an und alle sangen aus voller Kehle:
und der Lehrer geigte dazu.
Nun schaute aber der Rico so gespannt auf die Geige und des Lehrers Finger, wie dieser die Saiten griff, daß Rico darüber ganz das Singen vergaß und keinen Ton mehr von sich gab. Jetzt fiel mit einem Male die ganze Sängerherde einen halben Ton hinunter, da wurde die Geige auch unsicher und fiel nach, und die Sänger fielen noch tiefer, und man kann gar nicht wissen, wie tief hinunter alles miteinander gefallen wäre, – aber jetzt warf der Lehrer die Geige auf den Tisch und rief erzürnt: »Was ist das für ein Gesang! Ihr unvernünftigen Schreier! Wenn ich doch wissen könnte, wer mir so falsch singt und einen ganzen Gesang verdirbt!«
Da sagte ein kleiner Bube, der neben Rico saß: »Ich weiß schon, warum es so gegangen ist; allemal geht es so, wenn der Rico aufhört zu singen.«
Dem Lehrer war es selbst nicht so ganz unbekannt, daß die Geige am sichersten ging, wenn Rico fest mitsang.
»Rico, Rico, was muß ich hören«, sagte er ernsthaft, zu diesem gewandt. »Du bist sonst ein ordentliches Büblein, aber Unachtsamkeit ist ein großer Fehler, das hast du jetzt gesehen. Ein einziger unachtsamer Schüler kann einen ganzen Gesang verderben. Jetzt wollen wir noch einmal anfangen, und daß du aufpassest, Rico!«
Nun setzte Rico mit fester, klarer Stimme ein, und die Geige folgte nach, und alle Kinder sangen aus allen Kräften mit, so daß es ganz herrlich anzuhören war bis zum Schluß. Da war der Lehrer sehr zufrieden und rieb sich die Hände und tat noch ein paar feste Striche auf der Geige und sagte vergnüglich: »Es ist auch ein Instrument danach.«
Drittes Kapitel.
Des alten Schullehrers Geige.
Vor der Tür hatten sich Stineli und Rico bald aus dem Rudel herausgemacht und zogen zusammen ihren Weg.
»Hast du vor lauter Staunen nicht mehr mitgesungen, Rico?« fragte jetzt Stineli. »Ist dir etwa auf einmal der See in den Sinn gekommen?«
»Nein, etwas anderes«, sagte Rico; »ich weiß jetzt, wie man spielt: ›Ihr Schäflein hinunter‹. Wenn ich nur eine Geige hätte!«
Der Wunsch mußte Rico schwer auf dem Herzen liegen, denn er kam mit einem tiefen Seufzer heraus. Stineli war gleich ganz voller Teilnahme und unternehmender Gedanken.
»Wir wollen eine kaufen zusammen«, rief es plötzlich in großer Freude über die Hilfe, die ihm in den Sinn gekommen war. »Ich habe ganz viele Blutzger von der Großmutter, etwa zwölf; wie viele hast du?«
»Gar keinen«, sagte Rico traurig; »der Vater hat mir ein paar gegeben, ehe er fortging. Aber die Base hat gesagt, ich mache nur unnützes Zeug damit, und hat sie genommen und ganz hoch hinauf in den Kasten gelegt; man kann sie nicht mehr erlangen.«
Aber Stineli ließ sich nicht so bald entmutigen. »Vielleicht haben wir doch genug Geld, und die Großmutter gibt mir schon noch ein wenig«, sagte es tröstend; »weißt du, Rico, eine Geige kostet nicht so viel; es ist nur altes Holz und vier Saiten darüber gespannt, das kostet nicht viel. Du mußt nur morgen den Lehrer fragen, was eine Geige kostet, und nachher suchen wir eine.«
So blieb es ausgemacht, und Stineli dachte, es wolle daheim tun, was es nur könne, und ganz früh aufstehen und das Feuer anmachen, eh’ nur die Mutter auf sei; denn wenn es so immerfort etwas tat von früh bis spät, steckte ihm gewöhnlich die Großmutter einen Blutzger in den Sack.
Am folgenden Morgen, als die Schule aus war, ging Stineli allein hinaus und an der Ecke vom Schulhaus stand es still hinter dem Holzhaufen und wartete auf den Rico, der jetzt den Lehrer fragen sollte wegen der Geige. Er kam lange nicht heraus, und Stineli guckte immer wieder mit Ungeduld hinter dem Holze hervor, aber es waren nur die anderen Buben, die noch da und dort herumstanden. Aber jetzt – richtig, Rico kam um den Holzhaufen herum. Da war er.
»Was hat er gesagt, was kostet sie?« rief Stineli mit angehaltenem Atem vor Erwartung.
»Ich habe nicht fragen mögen«, antwortete Rico verzagt.
»O, wie schade!« sagte Stineli und stand ganz verblüfft da, aber nicht lange. »Es ist gleich, Rico«, sagte es wieder fröhlich und nahm ihn bei der Hand zum Heimgehen, »du kannst nur morgen fragen. Ich habe auch schon wieder einen Blutzger bekommen heute früh von der Großmutter, weil ich schon auf war, als sie in die Küche kam.«
Nun ging es aber am folgenden Tage wieder ganz gleich und am dritten auch; Rico blieb immer eine halbe Stunde lang vor der Wohnstube des Lehrers stehen und mochte nicht hineingehen und seine Frage tun. Da dachte Stineli heimlich: Wenn er noch drei Tage lang nicht fragt, dann frag’ ich. Aber am vierten Tage, als Rico wieder nachdenklich und zaghaft an der Tür stand, ging diese plötzlich auf, und der Lehrer trat eilig heraus und stieß so gewaltig gegen den Rico an, daß das federleichte Büblein ein gutes Stück rückwärts flog. In großem Erstaunen und ziemlichem Unwillen stand der Lehrer da. »Was ist das, Rico?« fragte er jetzt, als der Kleine wieder am Platze stand. »Warum kommst du an eine Tür und klopfest nicht an, wenn du da etwas zu verrichten hast; wenn du aber nichts da zu verrichten hast, warum entfernst du dich nicht? Solltest du mir aber etwas zu berichten haben, so kannst du’s gleich hier sagen. Was wolltest du?«
»Was kostet eine Geige?« stürzte Rico vor lauter Angst in voller Hast heraus.
Des Lehrers mißbilligendes Erstaunen wuchs sichtlich. »Rico, was muß ich von dir denken?« fragte er mit gestrenger Miene; »kommst du extra an die Tür deines Lehrers, um unnütze Fragen an ihn zu tun? oder hast du eine Absicht? Was hast du damit sagen wollen?«
»Ich habe nichts sagen wollen«, entgegnete Rico schüchtern, »nur fragen, was eine Geige kostet.«
»Du hast mich nicht verstanden, Rico; paß jetzt auf, was ich dir sage: ein Mensch spricht etwas aus und denkt sich dabei einen Zweck; oder er denkt sich nichts dabei, das sind unnütze Worte. Nun paß auf, Rico: hast du soeben diese Frage getan aus gar keinem Grunde, oder aus Neugierde, oder hat dich jemand geschickt, der gern eine Geige anschaffen wollte?«
»Ich wollte gern eine kaufen«, sagte Rico ein wenig herzhafter; aber er erschrak sehr, als der Lehrer mit einem Male in hellem Zorn ihn anfuhr: »Was? Was sagst du da? So ein – verlorenes, unvernünftiges, welsches Büblein, wie du eins bist, eine Geige kaufen? Weißt du denn, was eine Geige ist? Weißt du, wie alt ich war und was ich gelernt hatte, eh’ ich eine Geige anschaffen konnte? Lehrer war ich, fertiger Lehrer, zweiundzwanzig Jahre alt und stand in meinem Beruf! Und dann so ein Büblein, wie du eins bist! Und jetzt will ich dir sagen, was eine Geige kostet, so kannst du deinen Unverstand bemessen. Sechs harte Gulden habe ich bezahlt dafür; kannst du dir die Summe vergegenwärtigen? Wir wollen sie gleich einmal in Blutzger auflösen: Enthält ein Gulden 100 Blutzger, so enthalten sechs Gulden 6 × 100 gleich? – gleich? – Nun Rico, du bist sonst keiner von den Ungeschickten, – gleich?«
»Gleich 600 Blutzger«, ergänzte Rico leise, denn der Schrecken versagte ihm die Stimme, nun er die Summe überschaute und Stinelis zwölf Blutzger damit verglich.
»Und dann, Büblein«, fuhr der Lehrer im Zuge weiter fort, »was meinst du? Meinst du, es nimmt einer eine Geige nur in die Hand und spielt? Da muß einer anders dran, bis er so weit ist. Komm gleich einmal da herein« – und der Lehrer machte die Tür auf und nahm die Geige von der Wand –; »da, nimm sie einmal in den Arm und den Bogen in die Hand; so, Büblein, und wenn du mir nun c d e f herausbringst, so geb’ ich dir gleich einen halben Gulden.« Rico hatte wirklich die Geige im Arm; seine Augen leuchteten auf wie Feuer. c d e f – spielte er fest und völlig korrekt. »Du Erzblitzbub«, rief der Lehrer vor Bewunderung aus, »woher kannst du das? Wer hat dich’s gelehrt? Wie kannst du die Töne finden?«
»Ich kann noch etwas, wenn ich’s spielen darf«, sagte Rico und schaute mit Verlangen auf das Instrument in seinem Arm.
»Spiel’s!« bedeutete der Lehrer. Jetzt spielte Rico mit aller Sicherheit und freudestrahlenden Augen:
Der Lehrer hatte sich auf einen Stuhl niedergelassen und die Brille aufgesetzt. Er schaute mit ernster Prüfung jetzt auf Ricos Finger, dann auf seine funkelnden Augen, dann wieder auf die Finger. Rico hatte fertig gespielt.
»Komm hier zu mir her, Rico!«
Der Lehrer rückte seinen Stuhl ins Licht, und Rico mußte sich gerade vor ihm aufstellen. »So, nun muß ich ein Wort mit dir reden. Dein Vater ist ein Welscher, Rico, und siehst du, dort unten gehen allerhand Dinge, von denen wir hier in den Bergen nichts wissen. Nun sieh mir in die Augen und sag mir aufrichtig und der Wahrheit gemäß: Wie bist du dazu gekommen, diese Melodie ohne Fehler auf meiner Geige zu spielen?«
Rico schaute den Lehrer mit ganz ehrlichen Augen an und sagte: »Ich habe sie Euch abgelernt in der Singschule, wo wir sie so viel singen.«
Diese Worte gaben der Sache eine ganz andere Wendung. Der Lehrer stand auf und ging einige Male hin und her. So war er selbst der Urheber dieser wunderbaren Erscheinung; da waren also keine Schwarzkünste dabei im Spiel. Mit versöhntem Gemüte zog er jetzt seinen Beutel hervor: »Da ist ein halber Gulden, Rico, er gehört dir mit Recht. Nun fahr so fort und sei recht aufmerksam auf das Geigenspiel, solange du zur Schule gehst, so kannst du’s zu etwas bringen, und in zwölf bis vierzehn Jahren wird die Zeit da sein, da du auch eine Geige anschaffen kannst. Jetzt kannst du gehen.«
Rico warf noch einen Blick auf die Geige, dann ging er mit der allertiefsten Betrübnis im Herzen.
Stineli kam hinter dem Holzstoß hervorgerannt: »Diesmal bist du aber lang geblieben, hast du gefragt?«
»Es ist alles verloren«, sagte Rico, und seine Augenbrauen kamen vor Leid so nah zusammen, daß ein dicker, schwarzer Strich war über die Augen hin. »Eine Geige kostet sechshundert Blutzger, und in vierzehn Jahren kann ich eine kaufen, wenn schon lange alles tot ist; wer wollte noch am Leben sein in vierzehn Jahren. Da, das kannst du haben, ich will’s nicht.« Damit drückte er den halben Gulden in Stinelis Hand.
»Sechshundert Blutzger!« wiederholte Stineli voller Entsetzen. »Aber woher hast du das viele Geld hier?«
Rico erzählte nun alles, wie es gegangen war bei dem Lehrer, und endete wieder mit dem Worte des größten Leides: »Jetzt ist alles verloren.«
Stineli wollte ihm wenigstens seinen halben Gulden aufdringen als einen ganz kleinen Trost; aber er war ganz ergrimmt über den unschuldigen halben Gulden und wollte ihn nicht ansehen.
Da sagte Stineli: »So will ich ihn zu meinen Blutzgern tun und dann wollen wir das Geld alles miteinander teilen und alles gehört uns zusammen.«
Diesmal war auch Stineli sehr niedergeschlagen; als es aber mit Rico um die Ecke kam, wo es ins Feld hineinging, lag der schmale Fußweg so schön trocken in der Sonne bis zur Haustür hin, und dort flimmerte das Plätzchen davor auch ganz weiß und trocken, und Stineli rief:
»Sieh, sieh, nun wird’s Sommer, Rico, und wir können wieder in den Wald hinauf; dann freut’s dich auch wieder. Wollen wir schon am Sonntag gehen?«
»Es freut mich gar nichts mehr«, sagte Rico; »aber wenn du gehen willst, so will ich schon mitkommen.«
An der Tür wurde es noch ganz ausgemacht, am Sonntag wollten sie hinübergehen auf die Waldhöhe, und dem Stineli kam schon wieder die Freude obenauf. Es tat auch noch die Woche durch, was es nur vermochte, und es gab viel zu tun; der Peterli und der Sami und das Urschli hatten die Röteln, und im Stall war eine Geiß krank, der mußte man öfter heißes Wasser bringen, und Stineli mußte da- und dorthin laufen und überall Hand anlegen, sobald es nur aus der Schule kam, und am Samstag den ganzen Tag lang, bis spät am Abend, da mußte es noch den Stalleimer fegen. Da sagte aber auch der Vater am Abend: »Das Stineli ist ein handliches.«
Viertes Kapitel.
Der ferne, schöne See ohne Namen.
Als am Sonntagmorgen Stineli die Augen aufmachte, hatte es eine große Freude im Herzen und wußte zuerst gar nicht warum, bis es sich besann, daß es Sonntag war und die Großmutter noch am Abend spät gesagt hatte: »Morgen mußt du Sonntag haben, den ganzen Nachmittag; er gehört dir!«
Als das Mittagessen vorbei war und Stineli alle Teller weggetragen und den Tisch abgewaschen hatte, rief der Peterli: »Komm zu mir, Stineli«, und die zwei anderen im Bett schrieen: »Nein, zu mir!« Und der Vater sagte: »Das Stineli muß nach der Geiß sehen.«
Aber nun ging die Großmutter in die Küche hinaus und winkte dem Stineli nach. »Geh du jetzt in Frieden«, sagte sie, »der Geiß und den Kindern will ich schon nachgehen, und wenn’s Betglocke läutet, kommt ordentlich heim.« Die Großmutter wußte schon, daß ihrer zwei waren.
Jetzt schoß Stineli davon wie ein Vogel, dem man die Käfigtür aufgemacht hat, und drüben stand Rico, der hatte lange schon gewartet. Nun zogen sie aus über die Wiese hin, der Waldhöhe zu. Die Sonne schien an allen Bergen und der Himmel lag blau darüber. Auf der Schattenseite mußten sie noch ein wenig im Schnee gehen bis hinauf, aber da kam die Sonne von vorn und flimmerte über den See, und da waren schöne, trockene Plätzchen am Abhang, steil über dem Wasser. Da saßen die Kinder hin; es pfiff ein scharfer Wind über die Höhe und sauste ihnen um die Ohren. Stineli war lauter Freude und Genuß. Ein Mal über das andere rief es aus:
»Sieh, sieh, Rico, die Sonne, wie schön! Jetzt wird’s Sommer; sieh, wie es glitzert auf dem See. Es kann gar keinen schöneren See geben, als der ist«, sagte es jetzt zuversichtlich.
»Ja, ja, Stineli, du solltest nur einmal den See sehen, den ich meine!« und Rico schaute so verloren über den See hin, als finge, was er ansehen wollte, erst dort an, wo man nichts mehr sah.
»Siehst du, dort stehen nicht so schwarze Tannen mit Nadeln, da sind so glänzende, grüne Blätter und große, rote Blumen, und die Berge stehen nicht so hoch und schwarz und so nah, nur weit drüben liegen sie ganz violett, und am Himmel und auf dem See ist alles golden und so still und warm; da tut der Wind nicht so und die Füße hat man nicht so voll Schnee, dann kann man immer so am sonnigen Boden sitzen und zuschauen.«
Stineli war bald hingerissen; es sah schon die roten Blumen und den goldenen See vor sich, das mußte doch so schön sein.
»Vielleicht kannst du wieder einmal dahin gehen an den See und alles wieder sehen; weißt du den Weg?«
»Man geht auf den Maloja. Dort bin ich schon mit dem Vater gewesen: da hat er mir die Straße gezeigt, die geht den ganzen Weg hinunter, immer so hin und her, und weit unten ist der See, aber noch so weit, daß man fast nicht hinkommen kann.«
»Ach, das ist ganz leicht«, meinte Stineli, »du müßtest nur immer weiter gehen, so kämst du sicher zuletzt dahin.«
»Aber der Vater hat mir noch etwas gesagt; siehst du, Stineli: wenn man auf dem Wege ist und in ein Wirtshaus hineingeht und ißt und schläft da, so muß man immer bezahlen, da muß man wieder Geld haben.«
»O, Geld haben wir jetzt so viel«, rief Stineli triumphierend. Aber Rico triumphierte nicht mit.
»Das ist gerade so viel wie nichts, das weiß ich noch von der Geige her«, sagte er traurig.
»So bleib du lieber daheim, Rico; sieh, es ist doch daheim so schön.«
Eine Weile lang saß Rico nachdenklich da, seinen Kopf auf den Ellbogen gestützt, und seine Augenbrauen kamen wieder ganz zusammen. Jetzt kehrte er sich wieder zu Stineli, das unterdessen von dem weichen, grünen Moos ausrupfte und ein Bettlein machte, zwei Kissen und eine Decke, die wollte es dem kranken Urschli bringen. »Du sagst, ich soll nur daheim bleiben, Stineli«, sagte er mit gefalteter Stirne; »aber siehst du, mir ist es gerade so, wie wenn ich nicht wüßte, wo ich daheim bin.«
»Ach, was sagst du«, rief Stineli und warf vor Erstaunen eine ganze Hand voll Moos weg. »Hier bist du daheim, natürlich. Da ist man immer daheim, wo man seinen Vater und seine Mutter –«; hier hielt es plötzlich inne: Rico hatte ja gar keine Mutter, und der Vater war schon so lang wieder fort, und die Base? – Stineli kam der Base nie zu nah, sie hatte ihm nie ein gutes Wort gegeben; es wußte gar nicht mehr, was sagen. Aber Stineli konnte in einem so unsicheren Zustande nicht lange bleiben. Rico hatte wieder zu staunen angefangen; auf einmal faßte es ihn am Arm und rief:
»Nun möchte ich doch etwas wissen, wie heißt der See, wo es so schön ist?«
Rico besann sich. »Ich weiß es nicht«, sagte er, selbst verwundert darüber.
Da schlug Stineli vor, sie wollten jemand fragen, wie er heißen könne; denn wenn Rico doch einmal viel Geld hätte und gehen könnte, so müßte er ja den Weg erfragen und einen Namen wissen. Nun fingen sie an zu beraten, wen man fragen könnte; den Lehrer oder die Großmutter. Da fiel es Rico ein, der Vater werde es am besten wissen; den wollte er fragen, sobald er heimkomme.
Unterdessen war die Zeit vergangen und auf einmal hörten die Kinder ganz in der Ferne ein leises Läuten. Sie kannten den Ton, es war die Betglocke. Sie sprangen gleich beide vom Boden auf und rannten miteinander Hand in Hand durch Gestrüpp und Schnee die Halde hinunter und über die Wiese hin, und es hatte noch nicht lange verläutet, so standen sie schon an der Tür, wo die Großmutter nach ihnen aussah.
Stineli mußte nun gleich ins Haus hinein, und die Großmutter sagte nur schnell: »Geh du auch gleich hinein, Rico, und bleib nicht mehr stehen vor der Tür.«
Das hatte die Großmutter noch nie zu ihm gesagt, obschon er es immer tat, denn es gelüstete ihm nie, in das Haus hineinzugehen, und er stand immer erst eine Zeitlang vor der Haustür, ehe er’s tat. Er gehorchte aber der Großmutter aufs Wort und ging gleich hinein.
Fünftes Kapitel.
Ein trauriges Haus, aber der See hat einen Namen.
Die Base war nicht in der Stube, so ging er wieder hinaus und machte die Küchentür auf. Da stand sie; aber ehe er nur eintreten konnte, hob sie den Finger in die Höh’ und machte: »Bst! Bst! Mach nicht alle Türen auf und zu und einen Lärm, als kämen ihrer vier. Geh in die Stube hinein und halte dich still. Der Vater liegt oben in der Kammer; sie haben ihn auf einem Wagen gebracht, er ist krank.«
Rico ging hinein und setzte sich auf die Bank an der Wand und bewegte sich nicht. So saß er eine gute halbe Stunde lang; die Base fuhr noch immer in der Küche herum. Da dachte Rico, er wolle ganz leise in die Kammer hineinschauen, vielleicht wollte der Vater auch etwas zu Abend essen, es war schon lange Zeit dazu.
Er schlich hinter dem Ofen die kleine Treppe hinauf und kroch in die Kammer hinein. Nach einiger Zeit kam er wieder und ging gleich in die Küche hinaus und bis nahe zur Base heran. Dann sagte er leise: »Base, kommt!«
Diese wollte ihn eben tüchtig anfahren, als ihre Blicke auf sein Gesicht fielen: es war völlig ohne Farbe, Wangen und Lippen weiß wie ein Tuch, und aus den Augen schaute er so schwarz, daß ihn die Base fast fürchtete.
»Was hast du?« fragte sie hastig und folgte ihm unwillkürlich.
Er ging leise das Treppchen hinauf und in die Kammer hinein. Da lag der Vater mit starren Augen auf seinem Bett; er war tot.
»Ach, du mein Gott«, schrie die Base und lief mit Lärm zur Tür hinaus, die auf der anderen Seite auf den Gang führte, die Treppe hinunter und gleich hinüber in die Stube hinein und rief, der Nachbar und die Großmutter sollten herüberkommen, und von da lief sie zum Lehrer und zum Gemeindevorsteher.
So kam eins ums andere und trat in die stille Kammer hinein, bis sie voll von Menschen war, denn einer hörte draußen vom anderen, was geschehen sei. Und mitten in dem Gewimmel und den vielen klaghaften Worten von all’ den Nachbarn stand Rico an dem Bette, lautlos und unbeweglich, und schaute den Vater an. – Die ganze Woche durch kamen täglich noch Leute ins Haus, die den Vater ansehen und von der Base hören wollten, wie alles zugegangen sei, so daß es Rico ein Mal über das andere erzählen hörte: Sein Vater hatte drunten im St. Gallischen an einer Eisenbahn Arbeit gehabt. Beim Steinsprengen hatte er eine tiefe Wunde in den Kopf bekommen, und da er nun doch nicht mehr arbeiten konnte, wollte er heimgehen, um sich zu pflegen, bis es besser würde. Aber die lange Reise, teils zu Fuß, teils auf offenen Fuhrwagen, hatte er nicht ertragen können, war am Sonntag gegen Abend daheim angelangt und hatte sich auf sein Bett gelegt, um nicht wieder aufzustehen; ohne daß ihn jemand gesehen hatte, war er verschieden; denn Rico hatte ihn schon starr ausgestreckt auf dem Bette gefunden. Am Sonntag darauf wurde der Mann begraben. Rico war der einzige Leidtragende, der dem Sarge folgte, einige gute Nachbarn hatten sich noch angeschlossen; so ging der Zug hinüber nach Sils. Dort hörte Rico, wie der Herr Pfarrer in der Kirche laut ablas: »Der Verstorbene hieß Enrico Trevillo und war gebürtig aus Peschiera am Gardasee.«
Da war es Rico, als hörte er etwas, das er ganz gut gewußt, aber gar nicht mehr hatte zusammenfinden können. Immer hatte er auch den See vor sich gesehen, wenn er mit dem Vater gesungen hatte:
Aber er hatte nicht gewußt, warum. Leise mußte er die Namen wiederholen, eine Menge alter Lieder stiegen damit vor seinen Augen auf.
Als er allein zurückgewandert kam, sah er die Großmutter auf dem Holzstumpf sitzen und neben ihr das Stineli. Sie winkte ihn zu sich. Dann steckte sie ihm ein Stück Birnbrot in die Tasche, wie sie vorher dem Stineli getan hatte, und sagte, nun sollten sie spazieren gehen, an dem Tage müsse Rico nicht allein sein. Da wanderten die Kinder zusammen in den hellen Abend hinaus. Die Großmutter blieb auf ihrem Holze sitzen und schaute mitleidig dem schwarzen Büblein nach, bis sie nichts mehr von den Kindern sehen konnte. Dann sagte sie leise für sich:
Sechstes Kapitel.
Ricos Mutter.
Über den Weg von Sils her kam an einem Stab der Lehrer gegangen. Er hatte an dem Begräbnis teilgenommen. Er hustete und keuchte, und als er nun bei der Großmutter angekommen war und einen »Guten Abend« geboten hatte, setzte er hinzu: »Wenn es Euch recht ist, Nachbarin, so sitze ich einen Augenblick neben Euch, denn ich habe es stark in dem Hals und auf der Brust; aber was kann unsereins sagen mit bald siebzig Jahren, wenn man solche begräbt, wie den heute. Er war noch nicht fünfunddreißig und ein Mann wie ein Baum.«
Der Lehrer hatte sich neben die Großmutter niedergesetzt.
»Es gibt mir auch zu denken«, sagte diese, »daß ich, eine Alte, Fünfundsiebzigjährige, übrig bleibe und da und dort ein Junges fort muß, von dem man denkt, es wäre noch nötig gewesen.«
»Die Alten werden auch noch zu etwas gut sein. Wo wäre sonst ein Beispiel für die Jungen?« bemerkte der Lehrer. »Aber was meint Ihr, Nachbarin, was soll nun aus dem Büblein werden da drüben?«
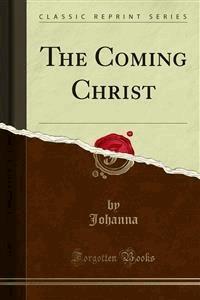
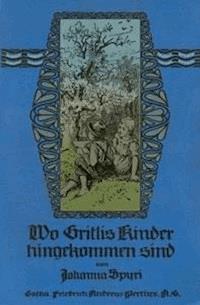













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













