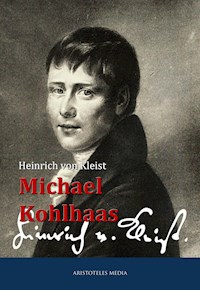Heinrich von Kleist's politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken E-Book
Heinrich Von Kleist
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In "Heinrich von Kleist's politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken" versammelt der Autor provozierende und schwer fassbare Texte, die nicht nur als literarische Meisterwerke, sondern auch als tiefgreifende politische Reflexionen zu verstehen sind. Kleists knackiger, oft fragmentarischer Stil spiegelt den turbulenten Kontext des frühen 19. Jahrhunderts wider, geprägt von Revolution und Umbruch. In seinen Schriften unterschwellig das Ringen um individuelle Freiheit, die Macht des Individuums gegenüber der gesellschaftlichen Ordnung und die komplexen Spannungen zwischen Pflicht und Neigung thematisiert, zeigt der Autor sowohl Hoffnung als auch Verzweiflung im Angesicht der politischen Realitäten seiner Zeit. Heinrich von Kleist (1777-1811) war ein bedeutender deutscher Dramatiker und Erzähler, dessen Werk von existenziellen Fragen und einem ungewöhnlichen Umgang mit der Sprache bestimmt ist. Geprägt durch persönliches Unglück und eine unkonventionelle Lebensführung, reflektiert Kleist in seinen politischen Schriften die Ambivalenzen seines eigenen Schicksals sowie das seiner Zeitgenossen. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und die Auseinandersetzung mit politischer Theorie markieren ihn als einen der aufregendsten Denker der deutschen Literatur. Dieses Buch ist eine unerlässliche Lektüre für alle, die sich für die Grundlagen der modernen politischen Philosophie und deren literarische Ausdrucksweise interessieren. Es lädt ein zur differenzierten Auseinandersetzung mit dem literarischen Erbe Kleists und eröffnet neue Perspektiven auf seine vielschichtigen Figuren und deren Konflikte. Bei jedem Leser, der sich für die Verflechtungen von Literatur und Politik interessiert, wird es nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Heinrich von Kleist's politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
I.
Wehe, mein Vaterland, dir! Die Leier zum Ruhm dir zu schlagen,
Ist, getreu dir im Schooß, mir, deinem Dichter, verwehrt,
schrieb Heinrich von Kleist auf das Titelblatt seines vaterländischen Dramas die Hermannsschlacht, als er es im Jahre 1808 vollendet hatte. Es war eine Grabschrift, die er dem Vaterlande, seiner Dichtung, sich selbst setzte, und in finsterm Haß sich in das Schweigen der Hoffnungslosigkeit zu vergraben, schien der letzte Trost, den das Leben ihm noch nicht geraubt hatte. Voll Liebe zum Vaterlande will er ihm zum Ruhme singen, aber in der Gegenwart sieht er es schmachbedeckt in den Staub getreten; er wendet den Blick rückwärts, der ruhmvollen Vergangenheit entlehnt er den Stoff seiner Dichtung, im Sturme will er sein Volk mit sich fortreißen, aber die Hörer verschließen ihm das Ohr. Für die Enkel ist es gefährlich geworden, dem Heldenliede von den Thaten der Ahnen zu horchen, der Sänger schließt sein „letztes Lied“, „er wünscht mit ihm zu enden, und legt die Leier thränend aus den Händen!“[1] Keine Bühne will sich seinem vaterländischen Schauspiel öffnen. Zurückgewiesen von den Seinen verschließt er einsam den Schmerz und das Elend des eigenen Lebens, die Schmach und den Gram Deutschlands in jene Worte, die zur schwer lastenden Anklage eines selbstvergessenen Volks werden.
Dennoch nennt sich Kleist den Dichter seines Vaterlandes; getreu bleibt er ihm im Schooß, während viele andere, denen es Macht, Ehre, Ruhm gegeben hatte, untreu geworden waren, es durch That, Wort oder verzagtes Schweigen verrathen hatten. Nicht Fürsten und Volksstämme, Generale und Staatsmänner allein, auch Männer der Wissenschaft und Dichter hatten das gethan. In das Unendliche hatte sich die Wissenschaft versenkt und die Welt durchmessen, das Vaterland, in dem sie aufgewachsen war, blieb ihr fast fremd; in Griechenland und Rom lebte die Dichtung, in Deutschland nicht. Weder die eine noch die andere ahnte das Verderben, das sich heranwälzte, bestürzt hatten sie geschwiegen, als es hereinbrach, oder den fremden Gewalthaber als den Vollzieher des Weltgeschicks wohl gar bewundert und gepriesen. Kleist wollte nichts als sein Deutschland, sein oft geschmähtes Brandenburg, ob auch hier „die Künstlerin Natur bei der Arbeit eingeschlummert“, ob es auch gerade jetzt doppelt arm und öde sein mochte; er wollte es, weil es das Vaterland war.[2] Aus ihm sprach die Stimme des lang eingeschläferten Gewissens, das laut mahnte, dem Zwiespalt zwischen Weltbürgerthum und Volkssinn, Staat und Vaterland, Wissenschaft und Leben ein Ende zu machen, und die tiefsten Kräfte zum Kampfe aufzurufen. Jene Verse, wie sein Drama, waren ein erster erschütternder Ausdruck der Wiedervereinigung der Dichtung mit dem Vaterlande, und darum lassen sie selbst in der Hoffnungslosigkeit die Rettung ahnen; es liegt in ihnen der Wendepunkt des deutschen Lebens. Denn anders mußte es werden, sobald diese Ueberzeugung allgemein ward; selbst die höchsten Güter der Menschheit, denen man so lange nachgetrachtet hatte, verloren ihre bildende und heiligende Kraft, wenn sie durch den volksthümlichen Muth nicht mehr geschirmt wurden. Es brach die Zeit an, wo Schleiermacher und Fichte Volksredner waren, Arndt durch Lied und That wirkte und ein jüngeres Dichtergeschlecht heraufwuchs, das nicht mehr classisch, sondern vaterländisch sein wollte, selbst zum Schwerte griff und kämpfend fiel, wie Körner, oder das Glück der Sieger beneidend, den Sieg feierte, wie Schenkendorf und Rückert.
Nicht so glücklich war Kleist; in die Mitte gestellt, zwischen die schonungslose Uebermacht der Gegenwart und die zweifelhafte Zukunft, hat er weder den Kampf noch den Sieg erlebt, und gleichgültig haben sich seine Zeitgenossen von ihm abgewandt. Den Weltklugen zu mystisch, den Frommen zu ruchlos, den Politikern zu unpraktisch, den Zahmen zu wild, dem Meister der Kunst zu roh und formlos, fand er bei seinem Leben nur wenige Freunde, und als der widerwärtige Streit über seinem Grabe verstummt war, ward er im Toben des Volkskampfes, den er erwecken wollte, fast vergessen, und die Kränze, nach denen er gegeizt hatte, wurden andern zu Theil.
Gewiß war er als Mensch weder im Leben noch im Tode frei von schwerer Schuld, aber so oft dies auch gesagt worden ist, dem Dichter ist die folgende Zeit langer Ruhe kaum gerecht, geschweige denn günstig, geworden. Zehn Jahr später hat ihn Tieck in das Gedächtniß des genießenden Geschlechtes, dem die starke, männliche Dichtweise unbequem geworden war, zurückgerufen. Ihm, seiner reinen Anerkennung verdankt man es, wenn Kleist’s Stelle in der Litteraturgeschichte gesichert ist. Auch das ist langsam und zögernd geschehen. In fünfzig Jahren sind nur zwei Gesammtausgaben erschienen, und zwischen beiden liegt ein Menschenalter. Nicht ohne Mühe haben sich drei seiner Dramen auf der Bühne eingebürgert, gerade das vollendetste, das vorzugsweise heimische, mußte, der Gefahr des Unterganges kaum entzogen, am längsten gegen das Vorurtheil kämpfen, und die Hermannsschlacht, die schon vor einem halben Jahrhundert zünden sollte, hat ihre Hörer bis heute nicht gefunden.
Auch die Nachlese, so ergiebig bei andern Dichtern, und die Kunde von seinem Leben ist demselben Mißgeschick verfallen. Einen großen Theil seiner Schriften hat er in selbstquälerischer Verachtung zerstört; was sonst zu hoffen, war verschollen oder in unbekannten Zeitschriften begraben, und erst Julian Schmidt’s Ausgabe hat aus dem Phöbus einen Theil des Vergessenen wieder ans Licht gebracht. Vereinzelt und zufällig sind manche Briefe von ihm zum Vorschein gekommen und unbeachtet geblieben; die später von E. v. Bülow und Koberstein herausgegebenen größeren Sammlungen sind, wenn auch die erste, fast einzige Quelle, doch nicht umfassend genug, um auf sein dunkles Leben ein überall genügendes Licht zu werfen. Bülow’s freilich nicht erschöpfende doch verdienstliche Lebensbeschreibung blieb in der politischen Sturmzeit von 1848, wie vierzig Jahre früher der lebende Dichter, fast unbeachtet. Erst in den letzten Jahren hat man sich ihm aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen Zeitgeschichte, in der er in so fragwürdiger Gestalt hervortritt, wieder mehr zugewendet.[3] Dennoch scheint eine Seite seines zerrissenen Lebens der näheren Besprechung würdig und bedürftig, von allen die erhebendste und reinste, in der sich die jähen Widersprüche vielleicht am ersten ausgleichen, die vaterländische. Ich würde es nicht unternehmen, allein auf Grund des schon benutzten Stoffes darüber zu reden, aber ich bin glücklich genug Neues, bisher Unbekanntes oder Vergessenes, hinzufügen zu können, und halte es für eine That der Gerechtigkeit, die folgende nicht geringfügige Nachlese zu Kleist’s Schriften der Oeffentlichkeit zu übergeben. Eben hier erscheint er vorzugsweise als politischer Schriftsteller, von dieser Thätigkeit mindestens gewinnt man ein bedeutend vollständigeres Bild.
Zuerst habe ich Rechenschaft von den Quellen, aus welchen diese Nachträge geschöpft sind, abzulegen. Theils sind sie handschriftlicher Art, theils gehören sie vergessenen Drucken an; von jenen spreche ich zuerst.
Nicht alles, was Tieck aus dem Nachlasse Kleist’s besaß, hat er in seine Ausgabe aufgenommen. „Auch finden sich“, schreibt er, „in seinem Nachlasse Fragmente aus jener Zeit (1809), die alle das Bestreben aussprechen, die Deutschen zu begeistern und zu vereinigen, sowie die Machinationen und Lügenkünste des Feindes in ihrer Blöße hinzustellen: Versuche in vielerlei Formen, die aber damals vom raschen Drang der Begebenheiten überlaufen, nicht im Druck erscheinen konnten, und auch jetzt, nach so manchem Jahre und nach der Veränderung aller Verhältnisse, sich nicht dazu eignen.“[4] Also Schriftstücke politischen, vaterländischen Inhalts, die ein Aufruf an das Volk sein sollten, jedoch nie zur Verwendung gekommen sind, waren es, die Tieck im Jahre 1821 vor sich hatte. Zunächst scheint ihn die Rücksicht auf die Erregung des eben durchgekämpften Völkerkrieges, die jetzt friedlichern Stimmungen Platz machen sollte, von der Veröffentlichung abgehalten zu haben, und noch 1826 glaubte er dabei stehen bleiben zu müssen. Auch mochten ihm diese Fragmente im Vergleiche mit den großen Dichtungen minder bedeutend scheinen. Er sah in Kleist einen befreundeten gleichzeitigen Dichter, dem er aus den vollendetsten Werken ein Denkmal errichten wollte, von welchem er das Geringfügigere meinte ausschließen zu können. Ueberhaupt war seine Kritik ein Ausdruck der Begeisterung für den Gegenstand, mehr ästhetisch, allgemein anschauend und nachdichtend als historisch philologisch; er konnte zufrieden sein, den Dichter und dessen Werke der Vergessenheit entrissen und in genialen Zügen ein groß gehaltenes Bild beider entworfen zu haben. Ganz anders stand es, als zweiundzwanzig Jahre später Bülow in der Vorrede zum Leben Kleist’s schrieb:[5] „Die schon von Tieck besprochenen zerstreuten politischen Blätter aus dem Jahre 1809 habe ich ebenfalls durchgesehen und des Druckes meist unwerth befunden.“ Diese „Reliquien“, die er damals noch unverkürzt in Händen hatte, legte er also in demselben Augenblicke als unwichtig bei Seite, wo er den Untergang oder die absichtliche Zurückhaltung anderer beklagte. Der Umstand allein hätte den Biographen bestimmen sollen, nicht seinem persönlichen Geschmacksurtheil über den Werth dieser Blätter, sondern dem historischen Gesetze zu folgen, das zu retten gebietet, was noch zu retten ist, damit das Bild des Dichters so getreu als möglich hergestellt werden könne. Das verlangte die inzwischen zur Wissenschaft herangereifte Litteraturgeschichte, die auch für die Schriftsteller der nächsten Vergangenheit eine willkürliche Kritik dieser Art nicht mehr duldete. Nicht ohne ironisches Lächeln über Kleist’s „naive Absicht“ begnügte er sich, einen dieser Aufsätze, überschrieben: „Was gilt es in diesem Kriege?“ sorglos abdrucken zu lassen. Von Tieck hatte Bülow diese Papiere erhalten; im Nachlasse des einen oder des andern mußten sie aufbewahrt sein.
Unter den zahlreich angesammelten Handschriften Tieck’s fand sich in der That eine, die aus dem Nachlasse Kleist’s herstammte, eine Abschrift der Penthesilea, vom Dichter durchgesehen und nicht ohne bedeutende Veränderungen einzelner Verse und Worte von seiner Hand. Aus der Vergleichung mit der Tieckschen Ausgabe, welcher der Druck von 1808 zu Grunde liegt, und den nicht unerheblich abweichenden Bruchstücken im Phöbus, ergab sich diese Handschrift als eine dritte noch frühere Bearbeitung selbständigen Charakters, die auf’s neue beweist, wie sorgfältig Kleist seine Dichtungen im einzelnen durcharbeitete. Dagegen schien sich die nah liegende Vermuthung, der Herausgeber der Kleist’schen Schriften werde von seinen Sammlungen mehr als dieses eine Erinnerungszeichen bewahrt haben, nicht zu bestätigen, als sich später, bei der Durchsicht eines Restes ungeordneter Papiere, noch eine Anzahl Blätter nach und nach unerwartet zusammenfanden. Es war ein Theil des großartigen Bruchstücks Robert Guiskard, das Kriegslied der Deutschen, das Sonett an die Königin von Preußen und das an den Erzherzog Karl im März 1809, denen sich einiges Prosaische anschloß; im Ganzen 28 Halbbogen und 6 Blätter in Quart bläulich grauen Streifenpapiers, dessen höheres Alter nicht bezweifelt werden konnte. Nur freilich waren es nicht Kleist’s Schriftzüge, sondern die altmodisch steife Hand eines sächsischen Schreibers, von der alles, nach der Tinte zu urtheilen, fast in einem Zuge geschrieben worden war. Zwar beginnt die Zählung der Seiten mehr als einmal von vorn und manche Blätter sind gar nicht bezeichnet, aber offenbar liegt hier ein Bruchstück einer Handschrift vor, die wenngleich sehr verschiedenartigen Inhalts, doch äußerlich ein Ganzes bilden sollte.
Bei näherer Untersuchung des prosaischen Theils fanden sich mehrere bisher unbekannte Aufsätze: fünf Halbbogen, unter der Ueberschrift „Satyrische Briefe“, deren drei numerirt aufeinander folgen: „1. Brief eines rheinbündischen Officiers an seinen Freund; 2. Brief eines jungen märkischen Landfräuleins an ihren Onkel; 3. Schreiben eines Burgemeisters in einer Festung an einen Unterbeamten“; welchen sich ohne Zahlenbezeichnung ein vierter anschließt „Brief eines politischen Pescherü (so) über einen Nürnberger Zeitungsartikel.“ Auf einem Quartblatt folgte „die Bedingung des Gärtners, eine Fabel“; dann vier Halbbogen „Lehrbuch der französischen Journalistik“, sechs Halbbogen und ein Blatt „Katechismus der Deutschen, abgefaßt nach dem Spanischen zum Gebrauch für Kinder und Alte“, jedes Stück mit besonderer Seitenzählung; endlich noch vier nicht paginirte Halbbogen, drei Stücke enthaltend, eines mit der Aufschrift „Einleitung“, ein anderes ohne Titel beginnend mit der Anrede „Zeitgenossen“, das dritte mit der Ueberschrift „Was gilt es in diesem Kriege?“ Eben dieses Blatt hatte Bülow herausgegriffen; es war also kein Zweifel mehr, die politischen Blätter Kleist’s, die er nach Tieck’s Vorgang bei Seite gelegt hatte, waren noch erhalten. Gewiß ein glücklicher Fund, der durchaus Neues ans Licht brachte und für manchen andern Verlust entschädigen konnte. Die nächste Frage, ob er vollständig sei, beantwortete sich leider verneinend. Die Seitenzahlen des Katechismus ergeben, daß der dritte und sechste Halbbogen fehle; das Lehrbuch der französischen Journalistik bricht mit Paragraph 25, die Einleitung mitten im Satze ab; ursprünglich mußten diese Blätter vollzählig gewesen sein.
Ohne besondere Veranlassung zur Herausgabe und andern Arbeiten hingegeben, hatte ich mich längere Zeit bei diesem Ergebniß beruhigt, als die Briefe Kleist’s an seine Schwester mich zu jenen politischen Bruchstücken zurückführten; denn was etwa noch gefehlt hätte, ein bestimmtes Zeugniß des Verfassers selbst, fand sich hier. Am 17. Juni 1809 nach der Schlacht von Wagram und dem Waffenstillstand von Znaym schrieb er von Prag aus, wohin ihn seine Hoffnungen auf Oesterreich geführt hatten, an seine Schwester: „Gleichwohl schien sich hier durch B. (Brentano?) und die Bekanntschaften, die er mir verschaffte, ein Wirkungskreis für mich eröffnen zu wollen. Es war die schöne Zeit nach dem 21. und 22. Mai, und ich fand Gelegenheit meine Aufsätze, die ich für ein patriotisches Wochenblatt bestimmt hatte, im Hause des Grafen v. Kollowrat vorzulesen. Man faßte die Idee, dieses Wochenblatt zu Stande zu bringen, lebhaft auf, Andere übernahmen es, statt meiner den Verleger herbeizuschaffen, und nichts fehlte als eine höhere Bewilligung, wegen welcher man geglaubt hatte, einkommen zu müssen. So lange ich lebe, vereinigte sich noch nicht so viel, um mich eine frohe Zukunft hoffen zu lassen, und nun vernichten die letzten Vorfälle nicht nur diese Unternehmung, — sie vernichten meine ganze Thätigkeit überhaupt.“
Also ein Theil der Aufsätze, die Kleist im Frühjahr 1809 für ein patriotisches Wochenblatt bestimmt hatte, ist in diesen Blättern enthalten, nach allen äußeren Zeugnissen kann seine Autorschaft keinem Zweifel unterliegen. Heutiges Tages indeß, wo es darauf ankommt den Stoff der abgeschlossenen Litteraturperiode zu sammeln und zu sichten, wird man bisher unbekannte Schriften eines bedeutendern Dichters nicht leicht aus der Hand geben, ohne sie einer allseitigen Durchforschung unterworfen zu haben, auch wenn ihre Aechtheit feststeht. Es ist daher gerathen, auch diese Briefe und Aufrufe nach Form und Inhalt näher zu prüfen; auch schon aus dem Grunde, weil dies zugleich für einige andere Stücke, deren Kleistischer Ursprung äußerlich weniger verbürgt ist, den erforderlichen Maßstab gewähren wird. Um die stilistische Gestaltung dieser politischen Aufsätze zu beurtheilen, wird man zunächst auf eine etwas allgemeinere Betrachtung der Prosa Kleist’s hingewiesen.
Seine prosaischen Schriften, äußerlich weniger umfassend als die versificirten Dichtungen, bestehen aus Erzählungen und Briefen. Nur in jenen erscheint er in voller bewußter Kraft, in ihnen wird man daher den Schriftsteller studieren können, während diese vom Augenblicke eingegeben, ungleich und schwankend, bald lehrhaft, bald fieberisch erregt und abspringend den Menschen und den jähen Wechsel seiner Stimmungen auch in der Form zeigen. In der darstellenden Prosa ist er Meister, so daß Tieck der Ansicht war, hier entfalte sich sein Talent vielleicht noch glänzender als im Drama. Könnte man einige Auswüchse beseitigen, die in seiner Natur wurzeln und von der vollendetern Handhabung der Form unabhängig sind, man würde von seinen acht Erzählungen die vier ersten größeren und sorgfältig durchgearbeiteten mustergültig nennen können. In der Haupttugend aller Erzählung beruhen ihre Vorzüge, in der durchsichtigsten Gegenständlichkeit. Ueberall treten Personen und Verhältnisse in festen und kräftigen Umrissen, bis zur sinnlichen Greifbarkeit deutlich hervor. Alles ist Bewegung, Leben, That, nirgend eine Stockung, eine todte Beschreibung, die sich abmüht viele einzelne Züge zusammen zu lesen, und es eben darum nie zu einem ganzen Bilde bringt, während hier die glückliche Einflechtung eines unscheinbaren Zuges auf einzelne Personen und ganze Gruppen einen hellen Rückstrahl wirft, der das Ganze in neuem überraschendem Lichte erscheinen läßt. Weil der Dichter diese Gestalten als ob sie lebten mit seinem Auge sah und darstellte, erweckt er in der Seele des Lesers, diesem unbewußt, die Kraft des dichterischen Nachschaffens. Mit der Selbstentäußerung eines Geschichtschreibers oder Dramatikers verschwindet er hinter seiner Darstellung, nirgend sieht man ihn mit zufahrender Hand in das Spiel hineingreifen und die Täuschung ungeschickt selbst zerstören, nirgend sich mit seinen Empfindungen und Betrachtungen aufdrängen; auch nicht in den Reden und Handlungen der Personen findet man ihn, weil sie überall ganz eigenthümlich, aus ihrer Stimmung, unter diesen gegebenen Umständen fühlen und handeln. Nur aus der Gesammtwirkung aller Kräfte, die er spielen läßt, ist sein letzter Gedanke zu erkennen. Und weil er seinen Menschen so wenig als sich selbst Abschweifungen philosophierender Betrachtung oder überschwellenden Gefühls verstattet, haben sie nichts von der idealistischen Weise anderer Dichtergestalten; sie sind vielmehr von einer realistischen Derbheit, die in Härte und Schroffheit übergehen kann, aber eben darum scheinen sie aus Phantasiegeschöpfen zur Höhe historischer Charaktere, in denen sich ganze Menschengattungen und Zeiten darstellen, emporzuwachsen.
Er selbst nähert sich dadurch, so weit sich das von dem Dichter sagen läßt, der Grenze des Geschichtschreibers. Ohne es sein zu wollen, oder auch nur den Anspruch des historischen Romanstils zu erheben, hat ihn sein historischer Realismus auf den geschichtlichen Boden geführt. Unmittelbar aus dem Leben, aus Gegenwart oder Vergangenheit schöpft er den Stoff, wie schon seine Vorliebe für die Anekdote beweist, die er da und dort aufgegriffen hat, und von denen er manche bis zur Erzählung ausspinnt. Auf diese lebendige Quelle deutet er bei der „Marquise von O.“ mit dem wichtigen Zusatze, der sich nur im Phöbus, nicht aber in den Ausgaben findet, selbst hin: „Nach einer wahren Begebenheit, deren Schauplatz vom Norden nach dem Süden verlegt worden.“[6] Wieder aber hat er diese Episode, in der er die ganze Fülle seines Talents entfaltet, in den Hintergrund des großen gleichzeitigen Revolutionskrieges eingefügt. Ebenso hat er im „Kohlhaas“, dem „Erdbeben in Chili“, der „Verlobung in St. Domingo“ sich großen historischen Verhältnissen entweder angeschlossen, oder deren Natur an einem einzelnen Falle meisterhaft dargestellt; wie denn die erste Erzählung, sicherlich ohne daß er es beabsichtigte, zugleich eine ergreifende Darstellung des Ständekampfes geworden ist, der unter der Nachwirkung der Reformation in ganz Deutschland entbrannte. Selbst die Verirrungen, in denen er unerwartet eine andere Seite seines Innern herauskehrt, und sich mit vollständiger Verleugnung des historischen Charakters auf das Gebiet des dunkeln Wahns verlocken läßt, dienen nur dazu, die Kraft seiner Darstellung in hellerem Lichte erscheinen zu lassen; denn auch die Traumgebilde seiner Phantasie hat er so mit Fleisch und Blut zu bekleiden gewußt, daß man sie sieht, ohne an ihre Wahrheit zu glauben. Sein „Kohlhaas“ bleibt trotz des unhistorischen Vornamens Michael und trotz des mythischen Kurfürsten von Sachsen, bei dem der Historiker von Fach nur mit Haarsträuben an den standhaften Johann Friedrich denken kann, nach Auffassung und Darstellung eine fast vollendete historische Erzählung, deren Grundzüge dem Thatsächlichen entsprechen. Denn die Zurückhaltung der Pferde, die Rechtsverweigerung und Verschleppung sächsischer Seits, die Niederbrennung der Vorstadt von Wittenberg, das Gespräch mit Luther sind historisch.[7] Nach ihrer Kunstform könnte sie ohne Uebertreibung ein in Prosa ausgelöstes Epos genannt werden.
Auch sind seine Erzählungen von der modernen Novelle, dem historischen Roman und dem, was heute dafür gelten will, sehr verschieden. Die Novellenhelden sind überwiegend Träger der Reflexion, sie kämpfen die Gegensätze nicht nach außen wirkend, durch die That aus, sondern in dialectischem Ringen mit sich selbst, sie ziehen die ganze Welt in den Strom ihrer Betrachtungen hinein, und dessen ungeachtet verblassen sie zu Schatten, die nach dem Lehrbuche sprechen. Andererseits in den neueren sogenannten historischen Romanen, die mit der Macht der Geschichte den Zauber der Dichtung zu verbinden wähnen, werden die historischen Riesen auf das zwerghafte Maß einer schwächlichen Phantasie herabgedrückt, die eigentlich nur deshalb ihre Zuflucht zur Geschichte nimmt, weil diese mit der unübersehbaren Fülle eigenthümlicher Gestalten der dürftigen Erfindung zu Hülfe kommt. Der falsche Schein historischer Kenntniß soll die Mängel der Dichtung verdecken, und schließlich verliert jede von beiden den reinen und ursprünglichen Charakter durch die Verbindung mit der anderen.
So sehr Kleist Dramatiker ist, so vermeidet er doch in der Erzählung in der Regel den unmittelbaren Dialog, der in neueren Novellen so die Oberhand gewonnen hat, daß der verkehrte Versuch einer wörtlichen Uebertragung in das Drama hat gewagt werden können. Dagegen hat er im vollsten Verständnisse dieser Darstellungsweise die indirecte Rede überwiegend gebraucht. Auch da, wo seine Personen direct reden müßten, ist er epischer Berichterstatter, er läßt sie nicht aus dem Rahmen des Ganzen selbständig heraustreten, sondern verwandelt ihre Rede in ein Handeln, von dem er zu erzählen hat. Es ist bemerkt worden, sein dramatischer Dialog verrathe in den unruhigen Sprüngen, in dem hastigen Hin- und Wiederfliegen von Frage und Antwort, wodurch die Lebhaftigkeit zwar gesteigert wird, die innere Erregtheit des Dichters; seiner erzählenden Rede ist diese Zerrissenheit durchaus fremd. Mit gleichem Wellenschlage fließt sie wie ein breiter Strom dahin, auf dem der Hörer sich mit stets gleicher Theilnahme von einer Windung zur andern tragen läßt.