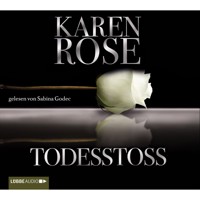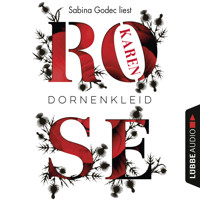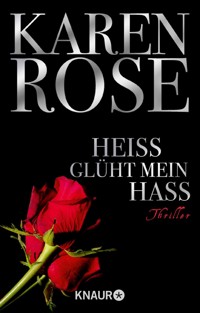
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Chicago-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein tödlicher Serienkiller. Eine mutige Polizistin. Ein packender Thriller voller Spannung und Romantik. Was war das? Da! Da war es schon wieder, dieses unheimliche Geräusch … Zu spät erkennt die Studentin Caitlin, dass ihr Leben in Gefahr ist – wenig später verschlingen Flammen ihren toten Körper … Sie ist nicht das erste Opfer jenes Mörders, der in Chicago wütet und seine Taten dann durch Brandanschläge zu vertuschen sucht. Um ihn zu fassen, muss Detective Mia Mitchell mit dem eigenwilligen Brandexperten Reed Solliday zusammenarbeiten. Doch als der Killer Mia ins Visier nimmt und auf seine Todesliste setzt, wird die Jagd nach dem Serienmörder zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Reed ist ihre einzige Hoffnung, dem tödlichen Inferno zu entkommen … Pulsierende Spannung & prickelnde Leidenschaft: ein fesselnder romantischer Thriller Heiß glüht mein Hass ist der sechste Band ihrer erfolgreichen Chicago-Reihe. Die Chicago-Thriller der Bestseller-Autorin Karen Rose sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Eiskalt ist die Zärtlichkeit« (Band 1) - »Das Lächeln deines Mörders« (Band 2) - »Des Todes liebste Beute« (Band 3) - »Der Rache süßer Klang« (Band 4) - »Nie wirst du entkommen« (Band 5) - »Heiß glüht mein Hass« (Band 6)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Karen Rose
Heiß glüht mein Hass
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Rose liebt es heiß – in jeder Hinsicht.« Publishers Weekly
Da! Da war es schon wieder, dieses unheimliche Geräusch: Zu spät erkennt die Studentin Caitlin, dass ihr Leben in Gefahr ist – wenig später verschlingen Flammen ihren toten Körper … Sie ist nicht das erste Opfer des Mörders, der in Chicago wütet und seine Taten durch Brandanschläge zu vertuschen sucht. Um ihn zur Strecke zu bringen, muss Detective Mia Mitchell mit dem eigenwilligen Brandexperten Reed Solliday zusammenarbeiten – ein Bündnis, bei dem bald die Fetzen fliegen und Funken sprühen. Als der Killer Mia auf seine Todesliste setzt, ist Reed ihre einzige Hoffnung …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Donnerstag, 23. November, 23.45 Uhr
1. Kapitel
Samstag, 25. November, 23.45 Uhr
Sonntag, 26. November, 1.10 Uhr
Sonntag, 26. November, 2.20 Uhr
Sonntag, 26. November, 2.15 Uhr
Sonntag, 26. November, 2.55 Uhr
Sonntag, 26. November, 14.55 Uhr
2. Kapitel
Montag, 27. November, 6.45 Uhr
Montag, 27. November, 8.30 Uhr
Montag, 27. November, 8.40 Uhr
Montag, 27. November, 8.50 Uhr
Montag, 27. November, 9.00 Uhr
3. Kapitel
Montag, 27. November, 9.15 Uhr
Montag, 27. November, 10.05 Uhr
Montag, 27. November, 11.00 Uhr
4. Kapitel
Montag, 27. November, 11.45 Uhr
Montag, 27. November, 12.05 Uhr
Montag, 27. November, 13.15 Uhr
Montag, 27. November, 16.00 Uhr
Montag, 27. November, 16.00 Uhr
5. Kapitel
Montag, 27. November, 17.20 Uhr
Montag, 27. November, 18.00 Uhr
Montag, 27. November, 18.40 Uhr
Montag, 27. November, 18.40 Uhr
Montag, 27. November, 19.45 Uhr
Montag, 27. November, 20.00 Uhr
6. Kapitel
Montag, 27. November, 20.00 Uhr
Montag, 27. November, 23.15 Uhr
Montag, 27. November, 23.25 Uhr
Montag, 27. November, 23.45 Uhr
Dienstag, 28. November, 0.35 Uhr
Dienstag, 28. November, 1.35 Uhr
7. Kapitel
Dienstag, 28. November, 7.55 Uhr
Dienstag, 28. November, 8.45 Uhr
Dienstag, 28. November, 9.05 Uhr
Dienstag, 28. November, 9.25 Uhr
8. Kapitel
Dienstag, 28. November, 9.45 Uhr
Dienstag, 28. November, 12.10 Uhr
Dienstag, 28. November, 12.30 Uhr
Dienstag, 28. November, 13.35 Uhr
Dienstag, 28. November, 15.15 Uhr
Dienstag, 28. November, 16.00 Uhr
Dienstag, 28. November, 16.15 Uhr
Dienstag, 28. November, 16.30 Uhr
9. Kapitel
Dienstag, 28. November, 18.45 Uhr
Dienstag, 28. November, 19.00 Uhr
Dienstag, 28. November, 20.15 Uhr
Dienstag, 28. November, 20.30 Uhr
Dienstag, 28. November, 20.45 Uhr
Dienstag, 28. November, 22.15 Uhr
10.Kapitel
Dienstag, 28. November, 23.15 Uhr
Mittwoch, 29. November, 0.30 Uhr
Mittwoch, 29. November, 6.00 Uhr
Mittwoch, 29. November, 7.25 Uhr
Mittwoch, 29. November, 7.25 Uhr
Mittwoch, 29. November, 7.55 Uhr
Mittwoch, 29. November, 10.10 Uhr
11.Kapitel
Mittwoch. 29. November, 10.45 Uhr
Mittwoch, 29. November, 13.05 Uhr
Mittwoch, 29. November, 13.25 Uhr
Mittwoch, 29. November, 13.25 Uhr
Mittwoch, 29. November, 13.30 Uhr
Mittwoch, 29. November 14.45 Uhr
Mittwoch, 19. November, 15.15 Uhr
Mittwoch, 29. November, 15.45 Uhr
12.Kapitel
Mittwoch, 29. November, 17.00 Uhr
Mittwoch, 29. November, 17.00 Uhr
Mittwoch, 29. November, 18.05 Uhr
Mittwoch, 29. November, 19.15 Uhr
Mittwoch, 29. November, 19.45 Uhr
Mittwoch, 29. November, 19.55 Uhr
Mittwoch, 29. November, 20.00 Uhr
13.Kapitel
Mittwoch, 29. November, 20.40 Uhr
Mittwoch, 29. November, 22.05 Uhr
Mittwoch, 29. November, 23.15 Uhr
Mittwoch, 29. November, 23.50 Uhr
Donnerstag, 30. November, 00.30 Uhr
14.Kapitel
Donnerstag, 30. November, 3.10 Uhr
Donnerstag, 30. November, 3.50 Uhr
Donnerstag, 30. November, 4.15 Uhr
Donnerstag, 30. November, 4.50 Uhr
Donnerstag, 30. November, 5.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 7.20 Uhr
15.Kapitel
Donnerstag, 30. November, 8.10 Uhr
Donnerstag, 30. November, 8.15 Uhr
Donnerstag, 30. November, 8.35 Uhr
Donnerstag, 30. November, 9.15 Uhr
Donnerstag, 30. November, 10.15 Uhr
16.Kapitel
Donnerstag, 30. November, 10.55 Uhr
Donnerstag, 30 November, 11.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 12.30 Uhr
Donnerstag, 30. November, 14.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 15.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 16.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 17.30 Uhr
Donnerstag, 30. November, 17.55 Uhr
Donnerstag, 30. November, 18.15 Uhr
17.Kapitel
Donnerstag, 30. November, 18.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 20.05 Uhr
Donnerstag, 30. November, 20.15 Uhr
Donnerstag, 30. November, 20.45 Uhr
Donnerstag, 30. November, 21.15 Uhr
Donnerstag, 30. November, 21.15 Uhr
Donnerstag, 30. November, 22.00 Uhr
18.Kapitel
Donnerstag, 30. November, 22.40 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 2.30 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 3.15 Uhr
Freitag. 1. Dezember, 3.50 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 3.55 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 5.05 Uhr
19.Kapitel
Freitag, 1. Dezember, 5.40 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 6.05 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 7.10 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 8.10 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 8.55 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 10.10 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 10.50 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 11.50 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 13.30 Uhr
20.Kapitel
Lido, Illinois, Freitag, 1. Dezember, 14.15 Uhr
Chicago, Freitag, 1. Dezember, 16.20 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 17.35 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 18.20 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 18.55 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 20.15 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 21.15 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 21.55 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 22.15 Uhr
Freitag, 1. Dezember, 22.45 Uhr
21.Kapitel
Indianapolis, Freitag, 1. Dezember, 23.00 Uhr
Chicago, Freitag, 1. Dezember, 23.05 Uhr
Indianapolis, Samstag, 2. Dezember, 2.15 Uhr
Chicago, Samstag, 2. Dezember, 6.35 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 7.15 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 8.10 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 10.30 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 11.45 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 17.15 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 18.45 Uhr
22.Kapitel
Samstag, 2. Dezember, 19.25 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 21.20 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 22.00 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 22.50 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 23.10 Uhr
Samstag, 2. Dezember, 23.25 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 3.15 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 7.15 Uhr
23.Kapitel
Sonntag, 3. Dezember, 8.00 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 11.15 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 17.15 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 18.15 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 18.20 Uhr
Sonntag, 3. Dezember, 20.35 Uhr
Montag, 4. Dezember, 0.45 Uhr
Montag, 4. Dezember, 7.55 Uhr
24.Kapitel
Montag, 4. Dezember, 9.25 Uhr
Montag, 4. Dezember, 9.35 Uhr
Montag, 4. Dezember, 11.05 Uhr
Dienstag, 5. Dezember, 7.25 Uhr
25.Kapitel
Montag, 11. Dezember, 15.55 Uhr
Montag, 11. Dezember, 17.15 Uhr
Epilog
Sonntag, 12. August, 9.25 Uhr
Dank an …
Für Martin, für die besten fünfundzwanzig Jahre meines Lebens. Ich liebe dich.
Für Cristy Carrington, die mir ihre wunderschönen Gedichte zur Verfügung gestellt hat und Emotionen in meinen Figuren entdeckte, die nicht einmal ich gesehen habe. Ich hatte einen Felsen. Du hast ihn behauen.
Für meine Seelenschwestern, die mich kennen und dennoch lieben.
Prolog
Springdale, Indiana
Donnerstag, 23. November, 23.45 Uhr
Er starrte mit grimmiger Befriedigung in die Flammen. Das Haus brannte lichterloh.
Er glaubte, ihre Schreie zu hören. Hilfe! O Gott. Hilfe! Er hoffte, dass er sie wirklich hörte, hoffte, dass es sich nicht nur um seine Einbildung handelte. Und er hoffte, dass sie litten.
Sie waren im Haus gefangen. Meilenweit keine Nachbarn, die zu Hilfe eilen würden. Er konnte sein Handy hervorholen. Die Polizei anrufen. Oder die Feuerwehr. Ein Mundwinkel verzog sich zu einem winzigen Lächeln. Wieso sollte er? Sie bekamen endlich, was sie verdienten. Endlich. Und dass es durch ihn geschah, war … nur gerecht.
Er konnte sich nicht erinnern, das Feuer gelegt zu haben, aber er wusste, dass es so gewesen sein musste. Ohne den Blick vom Haus zu nehmen, hob er die Hand an die Nase. Schnupperte an dem Lederhandschuh, den er trug. Er konnte das Benzin daran riechen.
Ja, er hatte es getan. Und er war zutiefst froh, dass er es getan hatte.
Er konnte sich ebenso wenig erinnern, hergefahren zu sein, aber er war hier. Er erkannte das Haus wieder, auch wenn er nie hier gewohnt hatte. Hätte er hier gewohnt, wäre alles anders geworden. Hätte er hier gewohnt, wäre Shane nie etwas geschehen. Shane könnte noch leben, und der tiefe Hass, den er so viele Jahre lang in seinem Herzen eingeschlossen hatte, hätte niemals existiert.
Aber er hatte nie hier gewohnt. Shane war allein gewesen, ein Schaf unter Wölfen. Und als er endlich entlassen worden war und zurückkehren konnte, war sein Bruder kein glücklicher Junge mehr gewesen. Als er endlich zurückgekommen war, hatte Shane den Kopf gesenkt gehalten, damit man die Scham und die Furcht in seinen Augen nicht sah. Denn sie hatten ihm etwas angetan.
Zorn kochte in ihm hoch. In eben jenem Haus, in dem Shane sicher und geborgen hätte sein sollen, in eben jenem Haus, das nun brannte wie die Hölle selbst, hatte man Shane etwas angetan, das ihn vollkommen verändert hatte.
Shane war tot. Und nun litten sie, genau wie er gelitten hatte. Es war nur … gerecht.
Dass der Hass und die Wut von Zeit zu Zeit in ihm aufstiegen war vermutlich unausweichlich. Beides gehörte zu ihm, beinahe solange er zurückdenken konnte. Aber den Grund für seine Wut … diesen Grund hatte er vor allen versteckt. Sogar vor sich selbst. Er hatte ihn so lange geleugnet, hatte die Geschichte so oft anders erzählt, dass selbst er inzwischen Probleme hatte, sich an die Wahrheit zu erinnern. Es gab ganze Zeitabschnitte, die er vergessen hatte. Die zu vergessen er sich gezwungen hatte. Weil es zu schmerzhaft war, sich daran zu erinnern.
Nun aber erinnerte er sich wieder. An jede einzelne Person, die ihre Hand erhoben hatte, um ihm etwas anzutun. An jede einzelne Person, die ihn und Shane hätte beschützen sollen und es nicht getan hatte. An jede einzelne Person, die einfach weggesehen hatte.
Und der Junge hatte das ausgelöst. Der Junge, der ihn an Shane erinnerte. Der Junge, der ihn hilfesuchend angesehen hatte. Schutz suchend. Ein Blick voller Angst und Scham. Heute Abend war es gewesen. Und er war in die Vergangenheit zurückversetzt worden. In eine Zeit, an die er sich nicht erinnern wollte. Damals war er … schwach gewesen. Jämmerlich schwach. Nutzlos.
Er kniff die Augen zusammen, als die Flammen an den Wänden des Holzhauses leckten, das wie Zunder brannte. Er war nicht mehr schwach oder nutzlos. Nun nahm er sich, was er wollte, und zum Teufel mit den Konsequenzen.
Plötzlich drang sein gesunder Menschenverstand durch den Zorn. Wie es immer geschah.
Denn manchmal schickten die Konsequenzen ihn zum Teufel. Besonders dann, wenn die Wut Oberhand nahm, wie es heute Abend geschehen war. Diese Nacht war nicht die erste, in der er wie aus einem Traum erwachte, sah, was er getan hatte, sich aber kaum daran erinnern konnte, es getan zu haben. Es war der erste Brand, den er gelegt hatte …
Er schluckte. Der erste Brand seit einer langen Zeit. Aber er hatte andere Dinge getan. Notwendige Dinge. Dinge, die ihn ins Gefängnis bringen würden, wenn man ihn fasste. Diesmal in ein echtes Gefängnis und nicht in eine Jugendhaftanstalt, die schon schlimm genug war, aber in der man zurechtkommen konnte, wenn man ein bisschen Verstand hatte.
Heute Abend hatte er getötet. Und er bereute nichts. Überhaupt nichts. Aber er hatte Glück gehabt. Dieses Haus stand einsam in der Gegend, weit und breit keine Nachbarn, keine Zeugen, niemand, der etwas gesehen haben konnte. Aber was, wenn er irgendwo in der Stadt gewesen wäre? Wenn man ihn dabei beobachtet hätte? Jedes Mal stellte er sich dieselbe Frage. Was, wenn man ihn erwischte?
Eines Tages würde seine unkontrollierbare Wut ihn in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Sie beherrschte ihn. Machte ihn verwundbar. Er biss die Zähne zusammen. Verwundbar zu sein war etwas, das er sich nie wieder zugestehen würde.
Und mit einem Mal schien die Lösung so klar. Die Wut musste getilgt werden.
Und daher musste die Ursache der Wut getilgt werden. Was bedeutete, dass alle Menschen, die ihnen etwas angetan oder weggesehen hatten, verschwinden mussten. Und während er dort stand und den Flammen zusah, erinnerte er sich an jeden einzelnen dieser Leute so, als hätte er sie gestern noch gesehen. Er sah Gesichter. Hörte Namen. Spürte Hass.
Er neigte den Kopf zur Seite, als das Dach einbrach und ein Funkenfeuerwerk in den Himmel schickte. Er hatte ganze Arbeit geleistet. Hübsch.
Es würde schwer sein, eine solche Darbietung zu übertreffen. Aber natürlich würde es ihm gelingen. Er machte niemals halbe Sachen. Was immer er tat, tat er gut. Und so musste es sein. Für Shane. Und für sich selbst. Dann konnte er endlich diesen Teil seines Lebens abschließen und wieder nach vorn sehen.
Der letzte Funkenregen mochte hell genug gewesen sein, um die Feuerwehr zu alarmieren. Er sollte verschwinden, solange es noch gefahrlos möglich war. Er stieg in den Wagen und wendete in Richtung Stadt, während ein Lächeln auf seinen Lippen erschien. In seinem Kopf begann ein Plan zu reifen.
Ja, es würde eine großartige Darbietung werden. Und wenn der letzte Vorhang fiel, konnte Shane endlich in Frieden ruhen. Und ich werde endlich frei sein.
1. Kapitel
Chicago
Samstag, 25. November, 23.45 Uhr
Ein Ast klatschte ans Fenster, und Caitlin Burnette fuhr zusammen. »Nur der Wind«, murmelte sie. »Sei nicht so ein Jammerlappen.« Dennoch machte das Heulen draußen sie nervös, und in Doughertys altem, ächzendem Haus ganz allein zu sein, trug nichts dazu bei, ihre Unruhe zu dämpfen.
Sie senkte den Blick wieder auf ihr Statistik-Buch und seufzte. Die Party im TriEpsilon war bestimmt viel spaßiger als das hier. Und viel lauter. Und genau aus diesem Grund saß sie in diesem langweiligen alten Haus und versuchte zu lernen, während im College ihre Kommilitoninnen feierten.
Ihr Professor hatte für Montagmorgen eine Klausur angekündigt, und wenn sie durchfiel, war das Semester umsonst gewesen. Dann würde ihr Vater ihr den Wagen abnehmen, verkaufen und mit dem Geld mit ihrer Mutter auf die Bahamas fliegen.
Caitlin knirschte mit den Zähnen. Sie würde es ihm schon zeigen und diese blöde Klausur bestehen, und wenn es das Letzte war, was sie tat. Und falls nicht, hatte sie genügend Geld gespart, um sich den blöden Wagen selbst zu kaufen – oder vielleicht sogar noch einen besseren. Der Betrag, den die Doughertys ihr zahlten, damit sie die Katze hütete, war lächerlich, aber es reichte, um einigermaßen zurechtzukommen, und …
Ein anderes Geräusch ließ sie auffahren. Was war das? Es kam von unten. Und es klang wie … wie ein Stuhl, der über den Holzboden schrammte.
Ruf die Polizei. Sie legte die Hand auf den Hörer, holte dann aber tief Luft und zwang sich zur Ruhe. Wahrscheinlich nur die Katze. Sie würde ziemlich dumm dastehen, wenn sie die Polizei wegen einer fetten, verwöhnten Perserkatze anrief. Im Übrigen sollte sie jetzt gar nicht hier sein. Mrs. Dougherty hatte sich ziemlich klar ausgedrückt. Sie sollte nicht »hier übernachten«, sie sollte keine »Partys feiern«, und sie sollte auch nicht »das Telefon benutzen«. Sie sollte die Katze füttern und ihr Klo saubermachen, Punkt.
Die Doughertys konnten wütend werden und ihr das Geld streichen, wenn sie es herausfanden. Caitlin seufzte. Und dann würde ihr Vater davon erfahren, für den diese Nachricht bestimmt ein innerer Triumph wäre. Und all das wegen einer dummen Kuschelkatze, die auch noch Percy hieß!
Dennoch konnte es nicht schaden, etwas vorsichtig zu sein. Lautlos verließ Caitlin das Zimmer, das die Doughertys als Büro benutzten, und schlich ins Schlafzimmer, wo sie die kleine Pistole aus Mrs. Doughertys Nachttischschublade holte und sie entsicherte. Sie hatte die Pistole entdeckt, als sie nach einem Stift gesucht hatte. Es war eine .22, und mit einer solchen Waffe hatte sie mit ihrem Vater schon oft am Schießstand geschossen. Sie stieg die Treppe hinunter und hielt die Waffe hinter dem Rücken. Es war stockdunkel, aber sie wagte es nicht, Licht zu machen. Lass es, Caitlin. Ruf die Cops. Aber sie ging weiter, die Schritte durch den Teppich gedämpft, bis die zweite Stufe von unten knarrte. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Ihr Herz hämmerte laut, während sie lauschte.
Und dann hörte sie das Summen. Da war jemand im Haus, und er summte!
Das Quietschen von etwas Schwerem, das über den Boden gezogen wurde, übertönte das Summen. Und dann roch sie Gas.
Raus! Hol Hilfe! Sie stürzte vorwärts, stolperte, als ihre Füße den Holzboden berührten und fiel auf die Knie. Die Pistole flog aus ihrer Hand und rutschte über den Boden. Laut.
Das Summen verstummte. Verzweifelt fuhren ihre Hände im Dunkeln über den Boden, tasteten nach der Pistole. Dann hatte sie sie gefunden und kam auf die Füße. Raus! Raus! Raus!
Sie war zwei Schritte auf die Tür zugelaufen, als sich jemand von hinten auf sie stürzte und mit ihr zu Boden ging. Sie wollte schreien, bekam aber keine Luft. Gott, bitte! Sie zappelte unter ihm, aber er war zu schwer. Sein Atem strich heiß über ihr Ohr. Dann spürte sie, wie er hart wurde. Nein, bitte nicht. Nicht das!
Sie kniff die Augen zusammen, als er seine Hüften gegen sie presste. Seine Absicht war klar. »Bitte. Lassen Sie mich gehen. Ich sollte nicht einmal hier sein. Ich werde nichts sagen, das verspreche ich.«
»Du solltest nicht einmal hier sein«, wiederholte er. »Was für ein Pech für dich.« Seine Stimme war tief, aber aufgesetzt tief. Sie klang wie eine Darth-Vader-Imitation. Caitlin konzentrierte sich, entschlossen, sich jede Einzelheit einzuprägen, so dass sie, falls sie lebend entkommen würde, der Polizei alles erzählen konnte.
»Bitte, tun Sie mir nichts an«, flüsterte sie.
Er zögerte. Sie spürte, wie er die Luft anhielt. Die Zeit schien stillzustehen. Dann, endlich, stieß er den Atem wieder aus.
Und lachte.
Sonntag, 26. November, 1.10 Uhr
Reed Solliday drängte sich durch die Menschenmenge, während er im Vorbeigehen den Stimmen lauschte und die Gesichter betrachtete, die dem brennenden Haus zugewandt waren. Es war eine Mittelklasse-Gegend, in der hauptsächlich ältere Menschen wohnten, und die Leute, die hier in der Kälte standen, schienen einander alle zu kennen. Schockiert und ungläubig drängten sie sich zusammen, und er wusste, dass sie sich sorgten, die Flammen könnten auf ihre eigenen Häuser überspringen. Drei ältere Frauen standen etwas abseits, und über ihre ängstlichen Gesichter flackerte der Schein des verbliebenen Feuers, das zuvor nur mit zwei Löschtrupps unter Kontrolle hatte gebracht werden können. Dieses Feuer war kein Zufall. Es hatte zu stark, zu heiß und an zu vielen Stellen im Haus gebrannt.
Doch trotz des allgegenwärtigen Schockzustands musste er die Schaulustigen befragen, bevor sie Zeit hatten, ihre Erlebnisse auszutauschen. Selbst bei Leuten, die nichts zu verbergen hatten, glichen sich die Geschichten über das Gesehene aneinander an, wodurch wertvolle Einzelheiten verlorengehen und sogar Brandstifter entkommen konnten. Reeds Job war es dafür zu sorgen, dass das nicht geschah.
»Meine Damen?« Mit der Marke in der Hand näherte er sich den drei Frauen. »Ich bin Lieutenant Solliday.«
Alle drei Frauen musterten ihn. »Sie sind Polizist?«, fragte die mittlere. Sie war um die siebzig und so zart und klein, dass der Wind sie hätte umwehen können. Ihr weißes Haar war fest auf Wickler gedreht, und ihr Flanellnachthemd stach unter dem Wollmantel hervor und schleifte über den gefrorenen Boden.
»Fire Marshal«, antwortete Reed. »Würden Sie mir bitte Ihre Namen nennen?«
»Emily Richter. Und das sind Janice Kimbrough und Darlene Desmond.«
»Und Sie kennen sich hier ein wenig aus, Ma’am?«
Mrs. Richter rümpfte die Nase. »Ich lebe seit beinahe fünfzig Jahren hier.«
»Wer wohnt in diesem Haus, Ma’am?«
»Bis vor einiger Zeit die Doughertys. Joe und Laura. Aber Laura ist gestorben und Joe ist nach Florida gegangen. Jetzt wohnen sein Sohn und dessen Frau hier. Hat’s ihnen ziemlich billig verkauft, der gute Joe. Das hat hier in der Gegend anständig die Preise gedrückt.«
»Aber sie sind nicht da«, fügte Janice Kimbrough hinzu. »Sie sind über Thanksgiving zu Joe nach Florida gefahren.«
»Es war also niemand im Haus?« Das war den Männern bei ihrer Ankunft bereits gesagt worden.
»Nein. Es sei denn, sie sind vorzeitig zurückgekommen«, meinte Janice.
»Sind sie aber nicht«, sagte Emily Richter bestimmt. »Ihr Truck ist zu breit für die Garage, deshalb parken sie immer in der Auffahrt. Und da dort kein Truck steht, sind sie auch noch nicht wieder zurück.«
»Haben Sie heute jemanden gesehen, der nicht zu dieser Gegend gehört?«
»Gestern war ein Mädchen hier«, sagte Emily Richter. »Sie füttert die Katze.« Wieder rümpfte sie die Nase. »Früher hätte Joe uns den Schlüssel und Katzenfutter in die Hand gedrückt. Aber sein Sohn hat die Schlösser ausgetauscht und irgendein junges Ding engagiert.«
Reeds Nackenhaare stellten sich auf. Vielleicht war es Instinkt, vielleicht etwas anderes. Aber er hatte überhaupt kein gutes Gefühl bei dieser Sache. »Ein junges Ding?«
»Studentin«, erklärte Darlene Desmond. »Joes Schwiegertochter hat mir erzählt, dass sie hier nicht übernachten würde. Sie sollte nur ein- oder zweimal am Tag kommen, um die Katze zu füttern.«
»Hatten die Doughertys noch andere Autos?«, fragte Reed.
Janice Kimbrough zog die Brauen zusammen. »Die Frau von Joes Sohn hatte einen Wagen. Einen Ford?«
Emily Richter schüttelte den Kopf. »Buick.«
»Und das waren die einzigen Fahrzeuge? Der Truck und der Buick?« Er hatte in der Garage die verschmorten Überreste von zwei Wagen gesehen. Übelkeit machte sich in seinem Inneren breit.
Die drei Frauen nickten und tauschten verwirrte Blicke aus. »Ja, nur die beiden«, bestätigte Emily Richter.
»Vielen Dank, meine Damen, Sie waren eine große Hilfe.« Er ging über die Straße, wo Captain Larry Fletcher mit einem Funkgerät neben dem Löschwagen stand. »Larry.«
»Reed.« Larry betrachtete stirnrunzelnd das brennende Haus. »Das Feuer ist gelegt worden.«
»Ja, das denke ich auch. Larry – es könnte doch noch jemand drin sein.«
Er schüttelte den Kopf. »Die älteren Damen meinten, die Hausbesitzer wären nicht in der Stadt.«
»Sie sagten konkret, dass die Besitzer eine Studentin zum Katzenfüttern engagiert hätten.«
Larrys Kopf fuhr herum. »Angeblich ist niemand im Haus gewesen.«
»Ja, das Mädchen sollte auch nicht hier übernachten. In der Garage sind zwei Autos, oder? Die Besitzer haben aber nur eines dort stehen. Mit dem anderen, dem Truck, sind sie unterwegs. Wir müssen rein und nachsehen, ob das Mädchen dort drin ist, Larry.«
Mit einem knappen Nicken hob Larry das Funkgerät an die Lippen. »Mahoney. Möglicherweise Opfer im Haus.«
Das Gerät knisterte. »Verstanden. Ich versuche reinzugehen.«
»Falls es zu gefährlich ist, kommst du sofort wieder raus«, befahl Larry, dann wandte er sich wieder Reed zu. »Wenn sie drin ist …«
Reed nickte grimmig. »Ist sie wahrscheinlich tot. Ich weiß. Ich höre mich noch ein bisschen um. Lass mich reingehen, sobald es möglich ist.«
Sonntag, 26. November, 2.20 Uhr
Sein Herz hämmerte immer noch zu schnell und zu heftig. Alles war so gelaufen, wie er es geplant hatte.
Na ja, nicht ganz. Das Mädchen war eine Überraschung gewesen. Miss Caitlin Burnette. Er holte ihren Führerschein aus der Tasche, die er mitgenommen hatte. Ein kleines Andenken an die Nacht. Sie hätte nicht dort sein dürfen, hatte sie gesagt. Er solle sie gehen lassen, hatte sie ihn angefleht. Sie würde nichts sagen, hatte sie versprochen. Aber sie hatte natürlich gelogen. Frauen logen immer. Das war eine Tatsache.
Rasch fegte er die Erde vom Versteck und hob den Deckel der Plastiktonne hoch. Glänzender Tand und Schlüssel funkelten ihm entgegen. Er hatte sie am Tag, als er hergekommen war, vergraben und seitdem nicht mehr angerührt. Es hatte keinen Grund dazu gegeben, doch jetzt gab es einen. Er warf Caitlins Tasche hinein, setzte den Deckel wieder auf und fegte sorgsam wieder Erde darüber. So. Fertig. Jetzt konnte er schlafen.
Während er davonging, leckte er sich über die Lippen. Er konnte sie noch immer schmecken. Süßes Parfum, weiche Rundungen. Sie war ihm buchstäblich in den Schoß gefallen. Es war wie Weihnachten gewesen. Sie hatte sich gewehrt. Er lachte leise. Und wie sie sich gewehrt hatte. Sie hatte sich ihm zu verweigern versucht. Das hatte ihn nur noch härter gemacht. Sie hatte versucht, ihm das Gesicht zu zerkratzen, aber er hatte sie leicht festhalten können. Er schauderte. Er hatte fast vergessen, wie gut es sich anfühlte, wenn jemand sich ihm verweigerte. Allein der Gedanke daran erregte ihn wieder. Immer glaubten sie, sie könnten sich wehren. Immer meinten sie, sie könnten sich verweigern.
Aber er war größer. Und stärker. Heute traf er die Entscheidungen, und niemand würde ihm je wieder eine Abfuhr erteilen.
Der Junge sah vom Fenster im ersten Stock aus zu. Sein Herz klopfte laut. Du musst es jemandem sagen. Aber wem? Er findet bestimmt heraus, dass ich es verraten habe. Er würde wütend werden, und der Junge wusste, was geschah, wenn er wütend wurde. Krank vor Angst ging der Junge zurück ins Bett, zog die Decke über den Kopf und begann zu weinen.
Sonntag, 26. November, 2.15 Uhr
Es war ein hübsches Haus gewesen, dachte Reed, als er durch die Überreste wanderte. Der Schaden schien in der einen Hälfte größer als in der anderen zu sein. Sobald es Tag wurde, würde es eine gründlichere Untersuchung geben. In der Zwischenzeit würde er mit einer starken Taschenlampe die Wände nach Spuren absuchen, um den Brandverlauf zu rekonstruieren.
Er blieb stehen und wandte sich zu dem Feuerwehrmann um, der seine Truppe ins Hausinnere geführt hatte. »Wo hat es gebrannt, als Sie reinkamen?«
Brian Mahoney schüttelte den Kopf. »Flammen in der Küche, der Garage, oben im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Als wir im Wohnzimmer ankamen, begann die Decke einzustürzen, und ich habe meine Jungs wieder rausgeschafft. Gerade noch rechtzeitig, denn die Küchendecke ist ebenfalls eingestürzt. Danach haben wir uns darauf konzentriert zu verhindern, dass das Feuer nicht auf die anderen Häuser überspringt.«
Reed blickte nach oben, wo bis vor kurzem noch zwei Etagen, ein Speicher und ein Dach gewesen waren, und sah die Sterne am Himmel. Möglicherweise hatte es mehrere Brandherde gegeben. Irgendein Mistkerl hatte sicherstellen wollen, dass dieses Haus auch wirklich abbrannte. »Ist jemand verletzt?«
Brian zuckte die Achseln. »Kleinere Verbrennung bei dem Neuen, aber nichts Wildes. Einer der Jungs hat Rauch eingeatmet. Der Captain hat beide vorsichtshalber ins Krankenhaus geschickt. Hören Sie mal, Reed, ich habe noch einmal nach dem Mädchen gesehen, aber der Rauch war zu dicht. Wenn sie hier war …«
»Ich weiß.« Reed seufzte und setzte sich wieder in Bewegung. »Ich weiß.«
»Reed!« Es war Larry Fletcher, der aus der Küche rief.
Reed bemerkte sofort, dass der Herd von der Wand abgerückt worden war. »Habt ihr das gemacht?«
»Nein«, sagte Brian. »Sie glauben, er hat das Gas eingesetzt?«
»Das würde die erste große Explosion erklären.«
Larry hatte die ganze Zeit auf den Boden gestarrt. »Hier ist sie«, sagte er leise.
Reed biss die Zähne zusammen und trat neben Larry. Obwohl er am liebsten nichts sehen wollte, lenkte er den Strahl der Taschenlampe auf seine Füße. Und sog scharf die Luft ein. »Verdammt!«
Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt.
»Verdammt«, sagte auch Brian. »Wissen wir, wer sie ist?«
Reed leuchtete die Umgebung der Leiche ab und zwang sich zur Professionalität, zwang sich, nicht daran zu denken, wie sie gestorben war. »Noch nicht. Ich habe die Telefonnummer von dem ehemaligen Besitzer dieses Hauses. Die alten Damen draußen haben sie mir gegeben. Joe Dougherty senior. Sein Sohn wohnt jetzt hier. Ich habe den Vater angerufen, und er hat mir erzählt, dass sein Sohn und seine Frau sich ein Boot gechartert hätten und an der Küste Floridas rumschippern würden. Sie werden nicht vor Montag zurückkommen. Allerdings hat er mir auch gesagt, dass seine Schwiegertochter in einem Anwaltsbüro in der Innenstadt arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Studentin die Tochter einer ihrer Kollegen gewesen ist. Vielleicht kann ich die Eltern ausfindig machen.« Er seufzte, als er sah, dass Larry immer noch auf den Boden starrte. »Du konntest nicht wissen, dass sie hier drin war, Larry.«
»Meine Tochter ist auch auf dem College«, erwiderte Larry rauh.
Und meine wird es bald sein, dachte Reed, verbannte den Gedanken dann aber schnell aus seinem Kopf. »Ich bestelle den Gerichtsmediziner her«, sagte er. »Und hole mein Team. Larry, du siehst aus wie ausgekotzt. Ihr beide seht so aus. Gehen wir wieder hinaus, damit ich deine Leute befragen kann, dann fahrt ihr zur Wache und ruht euch aus.«
Larry nickte betäubt. »Du hast mal wieder das ›Sir‹ unterschlagen.« Es war ein Versuch, ein wenig Humor in die Situation zu bringen, aber er versagte kläglich. »Du sagst nie ›Sir‹. Und dabei sind wir so viele Jahre zusammen gefahren.«
Und es waren gute Jahre dabei gewesen. Larry war einer der besten Captains, die Reed je gehabt hatte. »Sir«, verbesserte er sich sanft. Er zog an Larrys Arm, damit sein Freund und ehemaliger Vorgesetzte die verkohlte Gestalt, die einmal ein junges Mädchen gewesen war, nicht mehr sehen musste. »Gehen wir.«
Sonntag, 26. November, 2.55 Uhr
»Die Scheinwerfer sind aufgestellt, Reed.«
Reed, der in seinem SUV saß, sah von seinen Notizen auf. Ben Trammell stand ein paar Meter entfernt und sah ihn müde an. Ben war das neueste Mitglied seines Teams, und wie die meisten war er Feuerwehrmann gewesen, bevor er zu den Fire Marshals stieß. Dies war Bens erster Tag als Brandursachenermittler, und man konnte ihm ansehen, welchem Druck er ausgesetzt war.
»Alles in Ordnung?«, fragte Reed, und Ben antwortete mit einem knappen Nicken. »Gut.« Reed winkte dem Fotografen, der in der Wärme seines eigenen Wagens wartete. Foster stieg mit der Kamera in der Hand und dem Camcorder um den Hals aus.
»Gehen wir«, sagte Reed und ging durch den Schutt, den die Feuerwehrleute zurückgelassen hatten, die Auffahrt zum Haus hinauf. Sie würden sich um den Außenbereich kümmern, sobald das Licht ausreichte. »Im Moment fassen wir nichts an. Wir fotografieren die Szene und holen uns ein paar Messwerte. Dann können wir sehen, was wir haben.«
»Hast du eine richterliche Verfügung?«, fragte Foster.
»Noch nicht. Ich will erst genau wissen, was ich überhaupt rechtlich abdecken muss.« Er hatte ganz und gar kein gutes Gefühl in Bezug auf die Leiche in Doughertys Küche, und da er bei seiner Arbeit äußerst penibel war, bereitete er sich jetzt schon mental auf alle gesetzlichen Fallstricke vor. »Wir können reingehen und nach Ursprung und Ursache suchen. Wenn wir etwas anderes finden, beantrage ich eine richterliche Verfügung. Immerhin sind die Besitzer nicht hier, um uns die Erlaubnis zu geben.«
Reed führte sie durch die Eingangshalle, an der Treppe vorbei und in die Küche, wo die Scheinwerfer alles in grelles Licht tauchten. Der Raum war vernichtet. Die Fensterscheiben waren explodiert, und an einer Stelle war die Decke heruntergekommen. Man konnte die Küche kaum durchqueren, ohne über Schutt zu stolpern. Eine dicke Ascheschicht bedeckte den gekachelten Boden. Aber das Erschreckendste war die verkohlte Leiche, die noch immer dort lag, wo Larry Fletcher sie entdeckt hatte.
Eine Weile lang standen die drei Männer reglos da, starrten das Opfer an und versuchten zu verarbeiten, was im Licht noch grausiger erschien als im Dunkeln. Mit einem tiefen Atemzug setzte Reed sich schließlich in Bewegung. Er zog Latexhandschuhe über und holte ein kleines Aufnahmegerät aus seiner Tasche. »Foster, fang mit dem Camcorder an. Wir machen Fotos, wenn wir unseren ersten Durchgang hinter uns haben.«
Er hob das Gerät an die Lippen, während Foster zu filmen begann. »Lieutenant Reed Solliday in Begleitung der Marshals Ben Trammell und Foster Richards. Wir befinden uns im Haus der Doughertys am sechsundzwanzigsten November, drei Uhr nachts. Außenbedingungen, einundzwanzig Grad Fahrenheit, Wind von Nordosten mit fünfzehn Meilen pro Stunde.« Er holte tief Luft. »Ein einzelnes Opfer in der Küche. Die Haut ist verkohlt. Einzelheiten des Gesichts nicht erkennbar. Geschlecht auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Die schmale Statur verweist auf eine weibliche Person, was mit Zeugenaussagen übereinstimmt.«
Reed ging neben dem Körper in die Hocke und holte den Photoionisationsdetektor aus der Tasche, die am Riemen über seiner Schulter hing. Er führte das Gerät langsam über den Körper, und augenblicklich ertönte ein hohes Geräusch. Das überraschte ihn nicht. Er schaute zu Ben auf. Immerhin konnte man diesen Moment zu einer Lehrstunde nutzen. »Ben?«
»Hohe Kohlenwasserstoffkonzentration«, sagte Ben gepresst. »Verweist auf Brandbeschleuniger.«
»Gut. Was bedeutet?«
»Was bedeutet, dass das Opfer wahrscheinlich mit Benzin übergossen wurde.«
»Benzin oder etwas anderem«, sagte Reed, der sich bemühte, weder den Gestank wahrzunehmen, noch das Bild der toten jungen Frau zu nah an sich heranzulassen. Ersteres war nahezu, Letzteres vollkommen unmöglich. Doch er hatte einen Job zu erledigen. »Der Leichenbeschauer wird uns Genaueres sagen können. Gut, Ben.«
Ben räusperte sich. »Soll ich den Hund holen lassen?«
»Das habe ich schon getan. Larramie hat heute Nacht Dienst. Er sollte mit Buddy in ungefähr zwanzig Minuten hier sein.« Reed richtete sich wieder auf. »Foster, nimm das Opfer bitte von der anderen Seite auf, okay?«
»Jep.« Foster filmte den Schauplatz von verschiedenen Blickwinkeln. »Was noch?«
Reed war zur Wand getreten. »Hier, diese Wand brauche ich im Ganzen. Und dann noch Nahaufnahmen von den Spuren hier.« Er beugte sich näher heran und runzelte die Stirn. »Was, zum Teufel …«
»Enges ›V‹«, sagte Ben, nun selbstsicherer. »Das Feuer ist unten ausgebrochen und dann rasch die Wand hinaufgerast.« Er sah zu Reed. »Sehr rasch. Mit Hilfe eines Zündmittels?«
Reed nickte. »Sieht so aus.« Er fuhr mit dem PID an der Wand entlang, und wieder hörten sie das hohe Geräusch. »Brandbeschleuniger auf der Wand. Ein chemisches Mittel.« Beunruhigt musterte er die Wand. »Ich glaube nicht, dass ich so etwas jemals schon gesehen habe.«
»Das Gas aus dem Herd«, bemerkte Foster und richtete die Kamera auf das, was von dem Gerät übrig war. Er beugte sich vor, um den Bereich zwischen Herd und Wand aufzunehmen. »Die Schraube ist entfernt worden. Das muss Absicht gewesen sein.«
»Ja, schätze ich auch«, murmelte Reed und hob dann wieder sein Diktiergerät an den Mund. »Das Gas strömte in den Raum und stieg zur Decke. Das Feuer wurde nah am Boden entzündet und ist dann aufwärtsgewandert. Wir sollten Proben nehmen. Aber was ist das hier?« Er trat zurück und betrachtete die Pockennarben, die die ganze Wand sprenkelten.
»Da ist etwas explodiert«, sagte Ben.
»Du hast recht.« Reed führte den PID an der Wand entlang. Kurze, kreischende Signaltöne, aber kein langer Warnton wie zuvor. »Klebt an der Wand wie Napalm.«
»Sieh mal.« Ben hockte neben der Tür, die zur Waschküche führte. »Plastikstückchen.« Er schaute verwirrt auf. »Die sind blau.«
Reed beugte sich herab. Sie sahen tatsächlich blau aus. Er sah sich rasch um und entdeckte noch mehr blaue Stücke auf dem Boden, und ein Bild erschien vor seinem geistigen Auge. Er hatte so etwas schon einmal in einem Buch gesehen. Einem Handbuch für Brandermittler, und es musste schon mindestens fünfzehn Jahre her sein. »Plastikeier.«
Ben blinzelte. »Eier?«
»Ich wette, wenn wir genug Stücke finden, wird das Labor sie uns zu einem Plastikei zusammensetzen. Ein Ei, wie es sie an Ostern gibt. Der Brandstifter füllt das Ei mit einem Beschleuniger – fest oder zähflüssig wie zum Beispiel Polyurethan – und steckt eine Zündschnur durch ein Loch. Dann wird die Schnur angezündet, und der Druck lässt das Ei explodieren, so dass der Beschleuniger sich überall verteilt.«
Ben sah ihn beeindruckt an. »Das würde das Brandmuster erklären.«
»O ja. Und es zeigt auch, dass man alles schon gesehen hat, wenn man den Job nur lange genug macht. Foster, nimm die Stücke und ihre Lage auf, dann will ich Bilder von jedem Gegenstand in diesem Raum. Ich fordere eine richterliche Verfügung für Ursachen- und Quellenproben an. Ich habe keine Lust, dass uns nachher irgendein Anwalt erzählt, wir könnten die Proben zwar als Beweise für die Brandstiftung verwenden, aber nicht für den Mord an diesem armen Mädchen.«
»Verdammte Anwälte«, murmelte Foster. »Zum Kotzen, dass man immer auch seinen eigenen Hintern schützen muss.«
»Wir sammeln die Plastikstücke ein, sobald Larramie und sein Hund hier fertig sind. Vielleicht ist ein Stück darunter, das groß genug ist, um Latent einen Abdruck zu verschaffen.«
»Optimist, du«, murmelte Foster.
»Mach die Fotos und nimm auch die Türen und die Fenster hier unten auf, insbesondere die Schlösser. Ich will wissen, wie er hier reingekommen ist.«
Foster nahm die Kamera von den Augen und sah Reed an. »Du weißt ja – wenn das hier ein Mord ist, dann reißen sie dir den Fall direkt unterm Hintern weg.«
Daran hatte er auch schon gedacht. »Nicht wirklich. Ich werde wohl teilen müssen, aber hier deutet noch genug auf Brandstiftung hin, damit wir anständig mitmischen können. Und im Augenblick sind ja nur wir hier. Wir haben den Ball. Also seht zu, dass wir ihn in Tornähe bringen, okay?«
Foster verdrehte die Augen. Er war kein Sportfan. »Na schön.«
»Ben, in der Garage stehen zwei Autos. Laut Zeugen gehört der Buick den Doughertys. Finde heraus, wem der andere gehört. Und, Foster, sobald das Licht reicht, machst du draußen Aufnahmen. Bei all dem Schlamm sollte etwas Brauchbares dabei sein.«
»Ich liebe Optimisten«, murmelte Foster wieder.
Sonntag, 26. November, 14.55 Uhr
Er war ausgeschlafen, und konnte nun darüber nachdenken, was er erreicht hatte. Und was nicht. Er saß am Tisch, die Hände gefaltet, und blickte aus dem Fenster, während er die Ereignisse der vergangenen Nacht analysierte. Nun konnte er genau bestimmen, was gut gelaufen war, und würde sich beim nächsten Mal daran halten. Im Gegenzug konnte er entscheiden, was nicht gut funktioniert hatte, damit er beim nächsten Mal nicht dieselben Fehler machte. Oder vielleicht gab es sogar etwas zu verbessern. Er musste es schrittweise durchgehen. Alles der Reihe nach. So war es am besten.
Der erste Punkt war die Explosion. Er verzog das Gesicht, als er unwillkürlich sein wundes Knie bewegte. In Anbetracht der Wucht der Explosion musste er sich eingestehen, dass er es ein wenig übertrieben hatte. Die Druckwelle hatte ihn umgeworfen, als er die Auffahrt entlanggerannt war. Wahrscheinlich hatte er die Zündschnur zu kurz abgeschnitten. Er hatte sich zehn Sekunden erhofft, um aus dem Haus zu fliehen und die Straße zu erreichen. Aber es waren wohl eher sieben Sekunden gewesen. Zu wenig. Er brauchte zehn. Zehn waren sehr wichtig.
Das nächste Mal musste er die Länge der Zündschnur besser berechnen.
Das erste Ei, das er in der Küche deponiert hatte, hatte wunderbar funktioniert – ganz wie der Prototyp. Das zweite dagegen, das er in Doughertys Bett gelegt hatte … Ursprünglich hatte er geplant, die beiden Alten umzubringen und dann in ihren Betten zu verbrennen. Aber als er festgestellt hatte, dass sie gar nicht da waren, hatte die zweite Bombe zwar einen symbolischen Wert erhalten, aber letztlich keinen Nutzen gehabt.
Als er die Zündschnur in Brand setzen wollte, war ihm bewusst geworden, dass das Ding vermutlich bereits explodieren würde, während er nach unten lief, um den Brand in der Küche zu legen. Dadurch hätte sich auch das Gas entzünden können, noch bevor er das Haus wieder verlassen hatte. Also hatte er es einfach dort liegen lassen und gehofft, dass es in die Luft gehen würde, sobald das Feuer sich ausbreitete. Und so, wie es sich durch das Dach gefressen hatte, musste das wohl auch funktioniert haben. Wenn aber nicht, war es möglich, dass die Polizei etwas gefunden und mehr erfahren hatte, als gut für ihn war.
Obwohl die Idee von den zwei Bomben schön gewesen war, hatte sich das gleichzeitige Zünden als unpraktisch erwiesen. Das Risiko war zu groß, so dass er sich in Zukunft nur noch auf eine verlassen würde. Alles andere war wie aus dem Lehrbuch gelaufen – ganz, wie er es geplant hatte. Nun ja, nicht ganz, wie er es geplant hatte.
Was ihn zum zweiten Punkt führte. Das Mädchen. Sein Lächeln wurde breiter, und er spürte … Macht. Allein der Gedanke daran, ließ seinen Körper vibrieren.
Als sie ihn angefleht, sich gegen ihn gewehrt hatte, war es gewesen, als wäre ein Schalter in ihm umgelegt worden, und er hatte sie missbraucht. Gründlich. Bis sie zitternd am Boden gelegen hatte und nicht ein Wort mehr hatte sagen können. Und so sollte es immer sein. So sollten sie immer sein. Still. Und wenn nicht freiwillig, dann durch Zwang. Sein Grinsen verschwand. Er hatte sie ohne Kondom vergewaltigt, was unglaublich dumm gewesen war. Er hatte nicht darüber nachgedacht, war zu sehr im Augenblick versunken gewesen. Doch wieder hatte er Glück gehabt. Das Feuer hatte alle Beweise und Spuren vernichtet. Zumindest hatte er die Geistesgegenwart besessen, sie mit Benzin zu übergießen, bevor er hinausgelaufen war. Von ihr würde nichts übrigbleiben, und von dem, was er hinterlassen hatte, auch nicht.
Blieb noch Punkt drei. Seine Flucht. Er war nicht gesehen worden, als er zum Wagen gelaufen war. Was für ein Glück. Aber er konnte sich nicht immer auf sein Glück verlassen. Er musste sich unbedingt etwas Besseres einfallen lassen. Er musste sich etwas überlegen, das der Polizei keinerlei Hinweise lieferte, selbst wenn man ihn bei der Flucht beobachtete. Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Er wusste, wie er das anstellen musste.
Einen Moment lang dachte er über den Plan nach. Er war gut gewesen. Hatte, im Ganzen betrachtet, funktioniert. Aber er musste zugeben, dass vor allem der Sex den Abend abgerundet hatte. Er hatte auch vorher schon getötet. Er hatte sich auch vorher schon genommen, was er brauchte. Aber nun, da er Mord und Sex gemeinsam erfahren hatte, konnte er sich das eine ohne das andere nicht mehr vorstellen.
Nun, eigentlich durfte ihn das nicht überraschen. Es lag vermutlich an seiner eigenen … Schwäche. Und vielleicht war diese Schwäche auch seine größte Stärke. Von all den Waffen, die er je eingesetzt hatte, war Sex die mächtigste. Die grundlegendste.
Wenn es darum ging, eine Frau auf ihren Platz zu verweisen, gab es nichts Effektiveres. Ob junge oder alte, das spielte keine Rolle. Das Vergnügen, die Erlösung lag darin, es sich zu nehmen – und in dem Wissen, dass anschließend kein Tag vergehen würde, ohne dass sie sich bewusst war, wie schwach sie war … und wie stark er.
Das größte Problem war immer gewesen, sie am Leben zu lassen. Einmal war er deswegen fast gefasst worden. Einmal hätte er deswegen beinahe eine Strafe erhalten, die weit größer und unangenehmer war als alles, was er in der lächerlichen Jugendstrafanstalt erlebt hatte. Auch daraus hatte er gelernt, wie er an Caitlin Burnette bewiesen hatte. Wenn man eine Frau vergewaltigte, musste man dafür sorgen, dass sie nicht überlebte.
Aber er musste ganz aufrichtig zu sich sein. Theoretisch war die Nacht weit besser verlaufen, als er zu hoffen gewagt hatte. Praktisch hatte er versagt. Er hatte das Zielobjekt verfehlt. Und nun, im Licht des folgenden Tages, verblasste auch die Freude über das Feuer und sogar über Caitlin. Hier konnte es nicht um das Feuer an sich gehen. Das Feuer war nur ein Werkzeug. Hier ging es um Vergeltung. Die alte Dame Dougherty war ihrem Schicksal entkommen. Sie war gar nicht in der Stadt, sondern über Thanksgiving verreist. Das hatte er von dem Mädchen erfahren. Aber sie würde zurückkommen, und er würde auf sie warten.
Bis dahin hatte er aber noch einiges zu tun. Miss Penny Hill war die Nächste auf der Liste. Sie und die alte Dougherty hatten immer so dicke miteinander getan. Penny Hill hatte die Lügen der anderen geglaubt. Genau wie ich zu Anfang. Zu Anfang. Am Anfang hatte die Dougherty ihnen Sicherheit und Geborgenheit versprochen. Seine Lippen verzogen sich. Hoffnung. Aber dann hatte sie eine Kehrtwendung gemacht und sie Dinge beschuldigt, die sie nie getan hatten. Sie hatte ihr Versprechen gnadenlos gebrochen. Sie hatte sie vor die Tür gesetzt, und Hill hatte sie wie Vieh abtransportiert. Es ist nur zu eurem Besten. Das hatte Hill gesagt, als sie sie fortgebracht hatte, und zwar direkt in die Hölle auf Erden. Ihr werdet schon sehen. Aber es war nicht zu ihrem Besten gewesen. Ganz bestimmt nicht.
Sie hatte gelogen, wie all die anderen auch. Er und Shane waren hilflos gewesen. Verwundbar. Hatten kein Zuhause gehabt. Nun hatte auch die alte Dougherty kein Zuhause mehr. Und bald würde sie hilflos sein. Und dann tot. Nun war Penny Hill an der Reihe, verwundbar und hilflos zu werden. Und zu sterben. Es war nur gerecht. Um es mit ihren eigenen Worten auszudrücken – es war nur zu ihrem Besten.
Er sah auf die Uhr. Er musste los. Und er wollte nicht zu spät kommen.
2. Kapitel
Chicago
Montag, 27. November, 6.45 Uhr
Daddy!«
Der laute Ruf und das anschließende Hämmern an seiner Schlafzimmertür ließen Reed vor Schreck zusammenfahren. Die Krawattennadel rutschte ihm aus der Hand und unter die Kommode. Er seufzte. »Komm rein, Beth.«
Die Tür flog auf und ließ seine vierzehnjährige Tochter und ihren drei Monate alten Hirtenhund herein, der augenblicklich mit einem Satz auf Reeds Bett sprang. Dort schüttelte er sich und verspritzte überall Schlamm. »Biggles, aus!« Beth zog ihn an seinem Halsband quer über das Bett und auf den Boden, wo sich der Hund hinhockte und ihn mit einem Welpenblick ansah, der jegliche Strafaktion unmöglich machte.
Reed stemmte die Hände in die Hüften und blickte entnervt auf die Schmutzstreifen, die der Hund auf seinem Bett hinterlassen hatte. »Ich hab’s gerade frisch bezogen, Beth. Ich hab dir doch gesagt, du musst ihm die Pfoten abwischen, bevor du ihn ins Haus lässt. Der Garten ist ein einziges Schlammbad.«
Beths Lippen zuckten. »Na ja, saubere Pfoten hat er jetzt. Ich wasch das Bettzeug, Dad, versprochen. Aber ich brauche jetzt Geld fürs Mittagessen. Der Bus kommt gleich.«
Reed holte seine Brieftasche aus der hinteren Hosentasche. »Habe ich dir nicht erst vor ein paar Tagen Geld gegeben?«
Beth zuckte die Achseln und streckte die Hand aus. »Soll ich etwa hungern?«
Er bedachte sie mit einem aufgesetzt geduldigen Blick. »Du sollst mir beim Suchen meiner Krawattennadel helfen. Sie ist unter die Kommode gerutscht.«
Beth bückte sich und tastete den Boden unter der Kommode ab. »Hier ist sie.« Sie ließ sie in seine Hand fallen, und er gab ihr einen Zwanziger.
»Gib dir bitte Mühe, dass es mindestens für zwei Wochen reicht, okay?«
Sie zog die Nase kraus und sah einen Moment lang ihrer Mutter so ähnlich, dass sein Herz sich zusammenzog. Beth faltete die Banknote und schob sie in die Tasche ihrer Jeans, die ihm bisher nicht so eng vorgekommen war. »Zwei Wochen? Das ist doch’n Witz.«
»Sehe ich aus, als würde ich Witze reißen?« Er musterte sie von oben bis unten. »Deine Jeans sitzt zu eng, Bethie«, sagte er, und sie sah ihn auf eine Art an, die er nicht ausstehen konnte. Dieser Blick war relativ neu und mitsamt den Pickeln und den Stimmungsumschwüngen aufgetaucht, und Reeds Schwester, Lauren, hatte ihm neulich noch hinter vorgehaltener Hand verraten, dass sein kleines Baby nun kein kleines Baby mehr war. Guter Gott. PMS. Er war auf so etwas nicht vorbereitet. Aber leider spielte das keine Rolle. Sein Baby steckte mitten in der Pubertät. Nicht mehr lange, und sie würde wegziehen und aufs College gehen.
Seine Gedanken rasten zurück zu dem Opfer, das zwischen all dem Schutt in Doughertys Haus lag. Falls es sich wirklich um die Studentin handelte, die die Katze füttern sollte, konnte sie nicht viel älter als Beth gewesen sein, und Reed wusste noch immer nicht, wie sie hieß. Sie hatten noch nichts von Joe Dougherty junior gehört. Er hatte den ausgebrannten Chevy in der Garage bis zu einem Roger Burnette zurückverfolgen können, aber als er und Ben bei der Adresse vorbeigefahren waren, hatte ihnen keiner aufgemacht. Er würde es nachher noch einmal probieren, wenn er im Leichenschauhaus und im Labor gewesen war.
Beth verengte die Augen, und ihr beißender Tonfall durchdrang seine Gedanken. »Willst du damit sagen, dass ich in der Jeans dick aussehe?«
Reed sog die Wangen ein. Es gab keine richtige Antwort auf diese Frage. »Nicht einmal ansatzweise. Du bist nicht zu dick. Du bist gesund, du bist wunderschön. Du brauchst nicht abzunehmen.«
Sie verdrehte die Augen und setzte eine Leidensmiene auf. »Ich werde schon nicht magersüchtig, Dad!«
»Dann ist es ja gut.« Er stieß den Atem aus, den er angehalten hatte. »Ich meinte nur, dass wir dir wohl eine neue Jeans besorgen müssen.« Er lächelte schwach. »Du wächst zu schnell, Süße. Keine Lust auf neue Klamotten?« Die Krawattennadel drehte sich in seinen tauben Fingern. »Ich dachte, alle Frauen lieben es, shoppen zu gehen.«
Beth nahm ihm die Krawattennadel aus der Hand, befestigte sie und strich den Schlips glatt. Der Blick, den er so hasste, verschwand, und ein spitzbübisches Grinsen erschien auf ihrem Gesicht, so dass ihre dunklen Augen funkelten. »Ich liebe es. Wir können sechs Stunden allein bei Marshall Field’s verbringen. Pullis, Jeans und Röcke. Und Schuhe!«
Reed schauderte, als er sich das vor seinem geistigen Auge vorstellte. »Jetzt bist du einfach nur gemein!«
Sie lachte. »Die Rache für die Bemerkung, ich sei zu dick. Du willst also mit mir einkaufen gehen, Daddy?«
Er schauderte wieder. »Eine Wurzelbehandlung wäre mir, ehrlich gesagt, lieber. Kannst du mit Tante Lauren gehen?«
»Klar, ich frag sie.« Beth stellte sich auf Zehenspitzen und küsste ihn auf die Wange. »Danke für das Mittagessen-Geld, Daddy. Ich muss los.«
Reed sah ihr nach, wie sie davonstob, den tapsigen Welpen auf den Fersen. Die Haustür fiel krachend zu, als sie nach draußen lief, und er betrachtete die verschmutzten Laken. Dieser verflixte Hund. Beth hatte darum gebettelt, ihn zum Geburtstag zu bekommen. Er seufzte. Wenn er heute Nacht in einem sauberen Bett schlafen wollte, würde er es wohl selbst neu beziehen müssen. Aber der Duft von frischem Kaffee kitzelte seine Nase. Seine Tochter hatte offensichtlich daran gedacht, die Maschine anzuschalten, womit sie die Sache mit den Pfotenabdrücken im Grunde wieder ausgeglichen hatte. Auch wenn sie im Augenblick ziemlich launisch war, war sie doch ein liebes Mädchen.
Und Reed würde seine Seele verkaufen, damit das so blieb. Er blickte zu dem Foto auf seinem Nachttisch. Christine sah ihm fröhlich entgegen, wie sie es seit elf Jahren tat. Er setzte sich auf die Bettkante, nahm das Bild und wischte mit dem Hemdsärmel den Staub vom Rahmen. Christine hätte Beths Entwicklung, die Einkaufstrips, die »Gespräche unter Frauen« genossen. Wahrscheinlich hätte ihr nicht einmal Beths »Blick« etwas ausgemacht. Bis vor einiger Zeit hatte er Gott und die Welt verflucht, dass seine Frau nie eine Chance hatte, das alles mitzuerleben. Aber inzwischen … Er stellte das Foto zurück auf den Nachttisch, exakt auf die staubfreie Stelle, wo es gestanden hatte. Nach elf Jahren war aus dem Zorn traurige Resignation geworden. Was geschehen war, war geschehen. Er riss sich zusammen und streifte sein Jackett über. Wenn er nicht allmählich losfuhr, würde er im dichten Verkehr zu spät kommen. Kaffee, Solliday, und dann schwing deinen Hintern.
Er fuhr gerade aus der Garage, als sein Handy klingelte. »Solliday.«
»Lieutenant Solliday?« Die Stimme klang gehetzt. »Hier spricht Joseph Dougherty. Ich bin gerade mit dem Boot zurückgekehrt, und mein Vater hat mir erzählt, dass Sie angerufen haben.«
Joe junior. Endlich. Er machte den Motor wieder aus und zog seinen Notizblock aus der Tasche. »Mr. Dougherty. Tut mir leid, dass ich auf diese Art mit Ihnen Kontakt aufnehmen musste.«
Ein schweres Seufzen. »Dann stimmt es? Mein Haus ist zerstört?«
»Leider ja. Mr. Dougherty, wir haben jemanden in der Küche gefunden.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. »Was?«
Reed wünschte sich, er hätte dem Mann gegenübergestanden, aber das Entsetzen schien echt. »Ja, Sir. Die Nachbarn haben mir erzählt, Sie hätten jemanden eingestellt, der aufs Haus aufpasst.«
»J-ja. Sie heißt Burnette. Caitlin Burnette. Sie ist eigentlich sehr zuverlässig.« Die plötzliche Panik ließ die Stimme des Mannes etwas höher klingen. »Ist sie tot?«
Reed dachte an den verkohlten Körper und schluckte sein Seufzen herunter. Ja, sie ist sehr, sehr tot. »Wir nehmen an, dass es sich bei der Leiche um dieses Mädchen handelt, aber wir haben noch keine Bestätigung. Wir würden es zu schätzen wissen, wenn Sie es uns überließen, die Familie zu benachrichtigen.«
»Selbst …« Er räusperte sich. »Selbstverständlich.«
»Wann sind Sie wieder in der Stadt, Mr. Dougherty?«
»Eigentlich wollten wir erst am Freitag zurückkommen, aber wir werden versuchen, heute noch einen Flug zu bekommen. Wenn ich Genaueres weiß, rufe ich Sie an.«
Reed warf das Handy auf den Beifahrersitz, doch es klingelte sofort wieder. Das Display zeigte die Nummer des Leichenschauhauses an. »Solliday.«
»Reed, ich bin’s, Sam Barrington.« Der neue Gerichtsmediziner. Die Frau, die gewöhnlich dort arbeitete, war in Mutterschutz gegangen. Die Medizinerin war effizient, scharfsichtig und herzlich gewesen. Barrington war … nun, effizient und scharfsichtig.
»Hey, Sam. Ich bin auf dem Weg ins Büro. Was gibt’s?«
»Das Opfer ist eine Frau, Anfang zwanzig. Wahrscheinlich zweiundzwanzig, dreiundzwanzig.«
Sam rief gewöhnlich nicht an, wenn es um so grundlegende Informationen ging. Er musste mehr wissen. »Und?«
»Nun, bevor ich anfing zu schneiden, habe ich den Körper geröntgt. Ich hatte erwartet, den Schädel in Fragmenten vorzufinden.«
Bei menschlichen Körpern, die einer solchen Hitze ausgesetzt wurden, geschah es, dass … dass der Schädel unter dem Druck einfach explodierte. »Aber das war nicht der Fall.«
»Nein. Weil ein Einschussloch in der Schädeldecke den Druck abgeleitet hat.«
Reed war nicht überrascht. Aber es war ärgerlich. Nun musste er den Fall teilen. Er kümmerte sich um den Brandstifter, die Cops um die Leiche. Zu viele Köche verderben den Brei … Er zog den Kopf ein. Kein angemessener Vergleich. »Irgendein Hinweis auf eine Rauchvergiftung?«
»So weit bin ich bisher noch nicht«, sagte Sam knapp. »Ich fange jetzt gleich mit der Autopsie an, also kommen Sie rein, wann immer Sie wollen.«
»Danke. Mach ich.« Er fuhr aus der Auffahrt auf die ruhige, mit Bäumen gesäumte Straße, und schaltete die Scheibenwischer gegen den einsetzenden Regen ein. Es war lange her, dass er mit der Mordkommission zu tun gehabt hatte, aber er nahm an, dass Marc Spinnelli noch immer Lieutenant war. Marc war ein feiner Kerl. Er konnte nur hoffen, dass der Detective, den er ihm zuteilen würde, kein allseits bekannter Draufgänger war.
Montag, 27. November, 8.30 Uhr
Mia Mitchell hatte kalte Füße. Was wirklich ärgerlich war, zumal sie eigentlich warm und trocken hätten sein und auf ihrem Tisch liegen können, während sie ihren dritten Kaffee des Tages trank. Aber sie sind kalt und nass, dachte sie verbittert, weil ich hier bin. Sie stand auf dem Gehweg, und der Regen tropfte von der Krempe ihres alten Huts. Starrte wie eine Vollidiotin auf ihr eigenes Spiegelbild in den Glastüren. Sie war viele hundert Mal durch diese Glastüren gegangen, aber heute war es anders. Heute war sie allein.
Weil ich wie eine verdammte, blutige Anfängerin versagt habe. Und ihr Partner hatte den Preis dafür gezahlt. Auch zwei Wochen danach war die Erinnerung noch so frisch, dass sie bei dem Gedanken erstarrte. Sie blickte auf den Gehsteig. Auch zwei Wochen danach hörte sie noch ganz deutlich den Schuss, sah Abe zusammensacken und stürzen, sah, wie sich der Blutfleck auf seinem weißen Hemd rasch, viel zu rasch ausbreitete, während sie hilflos und vollkommen bewegungsunfähig dastand.
»Entschuldigung.«
Mia fuhr zusammen und musste gegen den Impuls ankämpfen, ihre Waffe zu ziehen und herumzuwirbeln. Sie hob das Kinn und verengte die Augen, um sich auf das Spiegelbild der Person hinter sich zu konzentrieren. Ein Mann, mindestens eins neunzig groß. Sein schwarzer Trenchcoat hatte dieselbe Farbe wie der sauber gestutzte schmale Bart, der seinen Mund einrahmte. Sie hob den Blick zu seinen Augen. Mit zusammengezogenen Brauen blickte er unter seinem Regenschirm hervor.
»Alles in Ordnung, Miss?«, fragte er in dem tiefen, ruhigen Tonfall, den sie selbst stets einsetzte, um nervöse Verdächtige und Zeugen zu beruhigen. Sie verzog die Lippen zu einem freudlosen Lächeln, als ihr seine Absicht klar wurde. Er hielt sie für irgendeine Irre von der Straße. Vielleicht sah sie so aus. Jedenfalls hatte er momentan Oberwasser, und das war etwas, das sie nicht leiden konnte. Reiß dich zusammen, Herrgott noch mal! Sie durchsuchte ihren Verstand nach einer passenden Antwort.
»Ja, danke, alles in Ordnung. Ich … ich warte auf jemanden.«
Es klang nach einer schwachen Ausrede, sie wusste es, aber er nickte, trat um sie herum, klappte seinen Regenschirm zu und zog die Tür auf. Hintergrundgeräusche drangen aus der Eingangshalle, und statt sie endlich in Ruhe zu lassen, blieb er stehen und betrachtete sie, als wollte er sich jede Einzelheit einprägen. Sie überlegte, ob sie sich ausweisen sollte, tat aber … nichts. Stattdessen unterzog sie ihn einer ähnlichen Musterung, und endlich setzte ihr Polizistenverstand wieder ein.
Er war attraktiv, ein dunkler Typ und wirkte älter, als sein Spiegelbild verraten hatte. Es lag an seinen Augen, entschied sie. Sie waren hart, kühl. Und an seinem Mund. Er sah aus, als lächelte er niemals. Sein Blick fiel auf ihre nackten Hände, und als er wieder aufsah, waren seine Augen sanfter. Er empfand Mitgefühl, dachte sie und musste schlucken.
»Falls Sie einen Ort zum Aufwärmen brauchen, finden Sie auf der Grand eine Unterkunft. Vielleicht können Sie da auch Handschuhe bekommen. Passen Sie auf sich auf. Es ist kalt.« Er zögerte, dann hielt er ihr seinen Schirm entgegen. »Nehmen Sie den. Wenn man durchnässt ist, wird man schnell krank.«
Zu verdattert, um etwas zu erwidern, nahm sie den Schirm. Ihr Mund öffnete sich, um ihn aufzuklären, aber er war schon fort und durchquerte rasch die Eingangshalle. Er blieb am Empfang stehen und zeigte auf sie. Der Beamte, der dort saß, blinzelte kurz, nickte dann aber ernst.
Oje, Tommy Polanski hatte heute Morgen Dienst. Er kannte sie schon, seit sie noch eine Rotznase gewesen war und ihren Dad im Schießstand angebettelt hatte, doch auch einmal schießen zu dürfen. Aber Tommy sagte nichts und ließ den Fremden offenbar vergnügt in dem Glauben, dass sie eine Obdachlose war. Mia verdrehte die Augen und setzte sich in Bewegung, trat durch die Türen und ging auf Tommy zu, der sie mit einem breiten Grinsen empfing.
»Na, da schau her, wer hier hereingeschneit kommt. Wenn das nicht Detective Mia Mitchell ist, die uns endlich wieder mit ihrer Anwesenheit beehrt.«
Sie nahm den Hut ab und schüttelte ihn trocken. »Ich hatte den Serienquatsch in der Glotze satt. Wie steht’s?«
Er zuckte die Achseln. »Alles wie immer, meine Kleine.« Aber seine alten Augen funkelten vergnügt.
Er wollte, dass sie fragte, der Schuft. »Also – wer war der Typ eben?«
Tommy lachte. »Ein Fire Marshal. Er hatte Angst, dass du das Haus hier stürmen könntest. Ich habe ihm gesagt, dass du durchaus öfter hier herumlungern würdest – und harmlos wärst du auch.« Sein Grinsen wurde noch vergnügter.
Mia verdrehte wieder die Augen. »Oh, wow, danke, Tommy«, sagte sie trocken.
»Für Bobbys Mädchen tue ich doch alles.« Sein Grinsen verblasste, und er musterte sie rasch von Kopf bis Fuß. »Wie geht’s deiner Schulter, Kleine?«
Unwillkürlich spannte sie sie unter der langen Lederjacke an. »Nur ein Kratzer. Der Arzt meint, ich bin wieder so gut wie neu.«
Eigentlich war es mehr als ein Kratzer gewesen, und der Arzt hatte gesagt, sie müsse noch eine Woche zu Hause bleiben, aber auf ihr Knurren hin hatte er achselzuckend den Schein unterschrieben.
»Und Abe?«
»Auf dem Weg der Genesung.« Das hatte die Nachtschwester jedenfalls gesagt, als Mia anonym um drei Uhr morgens angerufen und nach ihrem Partner gefragt hatte.
Tommys Kinnmuskeln verspannten sich. »Wir kriegen das Schwein, das das getan hat, Mia. Keine Sorge.«
Nach zwei Wochen war das Schwein, das ihren Partner auf der Straße niedergeschossen hatte, noch immer auf freiem Fuß und prahlte zweifellos damit, dass er einen Cop, der mindestens doppelt so groß gewesen war wie er, erlegt hatte. Eine Woge von Zorn brandete in ihr auf, aber sie kämpfte sie nieder. »Ich weiß. Danke.«
»Grüß Abe von mir.«
»Auch das«, log sie. »Ich muss jetzt los. Ich will am ersten Tag nicht gleich zu spät kommen.«
»Mia.« Tommy zögerte. »Tut mir leid wegen deines Vaters. Er war ein guter Cop.«
Ein guter Cop. Mia biss sich auf die Wangeninnenseite. Nur schade, dass Bobby Mitchell kein besserer Mensch gewesen war.
»Danke, Tommy. Meine Mom hat sich sehr über den Korb gefreut.« Obstkörbe hatten den Küchentisch im kleinen Haus ihrer Mutter beinahe zum Einsturz gebracht – Beileidsbekundungen der vielen Kollegen aus einer langen, langen Karriere bei der Polizei. Drei Wochen nach dem Herzanfall ihres Vaters war das Obst in den Körben verfault gewesen. Ein passendes Ende, würden viele wahrscheinlich sagen, wenn sie ihn wirklich gekannt hätten. Aber kaum einer hatte ihn wirklich gekannt.
Mia schon. Ein dicker Klumpen entstand in ihrer Kehle, und sie setzte sich den Hut wieder auf. »Ich muss jetzt los.« Sie ging an den Fahrstühlen vorbei und hastete die Treppe, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, nach oben. Dummerweise brachte sie das noch schneller an den Ort, den sie in letzter Zeit gemieden hatte.
Montag, 27. November, 8.40 Uhr
Er arbeitete in gespannter Stille, fuhr mit der Rasierklinge am Lineal entlang und trennte die ausgefransten Kanten des Artikels, den er aus der Tribune gerissen hatte, säuberlich ab. Feuer zerstört Haus, ein Opfer. Es war nur ein kurzer Artikel ohne Foto, aber immerhin wurde erwähnt, dass die Doughertys die Besitzer gewesen waren, und daher gehörte er durchaus in sein Album. Er lehnte sich zurück, blickte auf den Bericht und lächelte.
Er hatte erreicht, was er erreichen wollte. Aus den Worten der Nachbarn, die der Reporter interviewt hatte, war Furcht zu lesen. Aber warum? Wer macht denn so etwas Schreckliches?
Ich. So lautete die Antwort. Ich mache so etwas. Weil ich will.
Der Reporter hatte die alte Richter befragt. Sie war eine der Schlimmsten gewesen, war ständig zu den Doughertys zum Tee gekommen, hatte stundenlang geklatscht und getratscht und hatte auf sie beide herabgesehen. »Ich verstehe nicht, was du dir dabei gedacht hast, Laura«, hatte sie einmal naserümpfend gesagt. »Wie kann man nur solche Burschen aufnehmen? Es ist ein Wunder, dass sie dich noch nicht im Schlaf umgebracht haben.« Und die alte Dougherty hatte geantwortet, sie würde das Leben der Jungen verändern. O ja, das hatte sie wahrhaftig getan. Und ihre Veränderung bestand darin, sie beide in die Hölle zu schicken. Ihre Veränderung hatte Shane getötet.