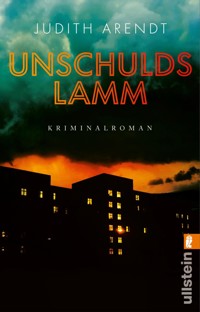9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Oktober und Helle Jespers ist im Urlaub. Doch selbst Pastis, Zigaretten und südfranzösische 18 Grad Lufttemperatur können die dänische Polizeikommissarin nicht davon ablenken, dass es zu still in ihrem Leben zugeht. Hätte sie nach Fredrikshavn zur Polizeibehörde gehen sollen? Zur Mordkommission nach Kopenhagen? Stattdessen hat sie es sich in Skagen zwischen den Dünen in ihrer kleinen Polizeistation gemütlich gemacht. Plötzlich klingelt aber mitten im Urlaub Helles Handy. Ihr Kollege Ole hat eine erschütternde Nachricht: Eine enge Freundin ihres Sohnes wurde tot am Strand aufgefunden. Steht die Leiche in Zusammenhang mit einem jungen Paar auf der Flucht in Zusammenhang, das eine Schneise der Verwüstung bis nach Kopenhagen zieht? Helle ist klar: Diesen Fall übernimmt sie selbst. Sie steigt in den nächsten Flieger zurück nach Dänemark und beginnt mit den Ermittlungen. Was sie nicht ahnt: dieser Mord war erst der Anfang, und er wird das Leben ihrer Familie betreffen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Judith Arendt
Helle und der falsche Prophet
Der dritte Fall für Kommissarin Helle Jespers
Ein Dänemark-Krimi
Atlantik
I.
He’ll wrap you in his arms
Tell you that you’ve been a good boy
He’ll rekindle all the dreams
It took you a lifetime to destroy
He’ll reach deep into the hole
Heal your shrinking soul
But there won’t be a single thing that you can do
He’s a god, he’s a man
He’s a ghost, he’s a guru
They’re whispering his name through this disappearing land
But hidden in his coat
Is a red right hand
Nick Cave, Red right hand
Aalborg
»Es ist für dich.«
Schon an ihrer Stimme hörte er, dass etwas nicht stimmte.
Er ging durch den Flur und sah den Rücken seiner Frau in der geöffneten Tür. Die Schultern hochgezogen, rückzugsbereit. Marit drehte sich auch nicht um, als sie ihn hinter sich hörte.
Willem stoppte. Hielt den Atem an. Er wusste, wer draußen vor der Tür stand. Konnte das wirklich sein? Ein Schauer lief seine Wirbelsäule hinab. Zu gern hätte er sich gesagt, dass es nur Einbildung war. Die alten bösen Geister, die ihn nicht losließen.
Aber.
Er konnte ihn spüren, noch bevor er ihn sah.
Seine Aura.
Das Böse.
Er ging zu seiner Frau, legte seine Hand auf ihren Rücken und nickte Marit zum Zeichen, dass sie sich zurückziehen konnte, zu. Er würde jetzt hier übernehmen. Zögernd wich Marit zurück, aber als sie merkte, dass er ihr mit seinem Körper den Blick versperrte und sich vor dem Fremden aufbaute, ließ sie ihn allein.
»Was willst du?«
Die Augen zwei Kohlestücke. Die langen Haare waren weiß geworden, er hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Der Bart war ordentlich gestutzt, die Klamotten unauffällig. Das Wilde war verschwunden, auf den ersten Blick. Aber Willem ließ sich nicht täuschen, auch nicht nach zwanzig Jahren. Es war alles noch da. Das Wilde und das Böse. Das Magnetische und, ja, auch das Unwiderstehliche.
Er war die Flamme, so nannten sie ihn.
Willem spürte, wie seine Handflächen feucht wurden. Vor ihm stand sein Albtraum, stand der, der ihn nicht schlafen ließ, seit damals. Es kam nicht mehr so häufig vor, aber ab und an schreckte er nachts aus dem Schlaf hoch, nicht immer schreiend, aber jedes Mal schweißgebadet. Wie hatte er sich gewünscht, dass diese Zeit ein für alle Mal aus seinem Leben verschwinden würde, aber es hatte nicht funktioniert und nun kamen sie ihn holen.
»Was willst du?«, wiederholte er, nachdem der Mann vor ihm ihn nur ansah, ruhig, gelassen.
Dieser ließ sich Zeit mit der Antwort. »Wir treffen uns an der Bushaltestelle.«
Damit drehte sich der Mann um und ging ruhig über die Straße. Willem folgte ihm mit den Augen, seine Knie wurden weich. Ihm zu begegnen war unmöglich, er konnte ihn nicht ansehen, sich nicht neben ihn setzen, nicht nach all dem, was er ihm angetan hatte.
Aber er wusste, würde er dem Befehl – und nichts anderes war es – nicht Folge leisten, würde alles nur noch schlimmer werden.
»Wer war das?«
Marit sah ihn an, in ihrem Blick lag Besorgnis. Zu Recht, dachte er.
»Ein Informant. Ich treffe ihn gleich an der Bushaltestelle.«
»Woher weiß er, wo du wohnst?«
Willem zog sie an sich, aber seine Frau blieb steif. »Keine Ahnung. Vielleicht hat er mich zufällig gesehen.«
»Er ist seltsam.« Marit schob sich von ihm weg und sah ihm ins Gesicht. »Ich möchte nicht, dass solche Typen wissen, wo du wohnst, Will. Das ist nicht gut.«
»Es kommt nicht wieder vor. Versprochen.« Er gab ihr einen Kuss. »Ich rede mit ihm, jetzt gleich.«
Marit nickte. »Mir gefällt das nicht. Die Kinder …«
»Schon gut! Ich sorge dafür, dass er nicht noch mal auftaucht.« Er schnappte sich ein Stück Gurke vom Schneidebrett und gab sich unbekümmert. »Der Typ ist harmlos«, schob er hinterher, und Marit lächelte.
»Okay. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen zu empfindlich.« Instinktiv legte sie eine Hand auf ihren Bauch.
Willem lächelte auch, küsste sie und sah zu, dass er aus dem Haus kam. Er musste es hinter sich bringen, was immer es auch war. Von wegen harmlos. Der Mann war alles andere als das. Er war die Flamme. Aber er war auch das Schwert und die Peitsche. Die sieben Plagen und das Beil. Er war Richter, Henker und Waffe in einer Person.
Der Mann saß auf der Bank an der Haltestelle. Aufrecht, die Hände gefaltet, in sich ruhend. Als Willem neben ihm Platz nahm, aufgewühlt, kam keine Regung von dem Mann neben ihm. Nichts. Der Mann hatte gewusst, dass er kommen würde, er war nicht verwundert, er nahm es für selbstverständlich. Aber er wäre nicht zu ihm, Willem, gekommen, wenn es nicht wichtig wäre, das war ihm völlig klar. Um die Flamme aus ihrem Königreich zu locken, bedurfte es eines außerordentlichen Vorkommnisses. Die Flamme kam nicht so ohne weiteres. In seiner Zeit im Königreich hatte Willem es niemals erlebt, dass er sich selbst bemüht hätte. Er hatte für alles seine Diener und Boten.
Es musste also etwas Besonderes sein.
Oder die Zeiten hatten sich geändert, dachte Willem. Auch tausendjährige Reiche hat man schon fallen sehen.
Er schwieg. Die Flamme sollte reden.
Der griff stattdessen in die Innentasche seiner Jacke und reichte Willem ein Bild. Ein junger Mann, Anfang zwanzig, nicht älter. Die Haare lang, brav gescheitelt. Er sah aus wie irgendjemand, nichts an seinem Gesicht wäre Willem im Gedächtnis geblieben, hätte er nicht die frische rote Wunde, die sich quer über seine Wange zog.
Sie taten es also noch immer.
Willem konnte nicht anders, als auf die Wunde zu starren, eine Wunde, die verheilen würde, aber während er auf die Wunde des Jungen blickte, schmerzten die Narben auf seiner Seele.
»Was hat er getan?«, fragte er, und noch während die Worte aus seinem Mund fielen, wusste er, dass er keine Antwort bekommen würde.
Der Mann stand auf, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
»Finde ihn.«
»Warum ich?«
Jetzt drehte sich die Flamme um und lächelte. Sah ihm direkt in die Augen, in die Seele, in sein verwundetes Ich und lächelte.
»Weil du schon damals ein besonders pflichtbewusster Soldat warst.«
Damit ließ er ihn stehen. Drehte sich um und ging.
Willem blieb auf der Bank an der Bushaltestelle sitzen, unfähig, sich zu bewegen.
Die alte Angst war zurückgekommen. Eine zwanzig Jahre alte Angst. Mit niemandem konnte er darüber sprechen. Nicht einmal mit Marit, denn sie kannte den Willem DANACH. Sie wusste nichts von dem DAVOR.
Er konnte es also nicht erzählen, aber dennoch wagte er es nicht, den Befehl zu ignorieren. Sehet nun, dass ich’s allein bin, und ist kein Gott neben mir! Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen, und niemand kann aus meiner Hand reißen. Er musste es tun. Diesen armen Jungen finden. Und dann?
Willem blickte auf das Foto in seinen Händen. Es war ein Schnappschuss, vielleicht mit einer versteckten Kamera aufgenommen. Eine ziemlich grobe Vergrößerung. Vielleicht bei einer Session? Machten sie noch Sessions, dort, im Königreich?
Es war jedenfalls kein normales Foto. Es war nicht, was es sein sollte: ein Partybild. Ein Bild, das diesen Jungen im Kreis seiner Freunde zeigte, wie sie tranken oder kifften oder Spaß hatten. Der junge Mann – vielleicht war er auch noch nicht einmal zwanzig Jahre alt, dachte Willem –, der junge Mann also hatte keinen fröhlichen Moment, als das Foto von ihm aufgenommen wurde. Er sah ertappt aus, gehetzt. Willem erkannte den Blick, und er konnte das Gefühl in sich abrufen. Genauso hatte er sich gefühlt, damals. Und seitdem nie wieder – bis jetzt. Er dachte, dass er entkommen war. Hatte sich in Sicherheit gewähnt; was für ein Fehler.
Man hatte ihn gefunden. Die Flamme hatte ihm einen Auftrag erteilt. Und er, Willem, konnte sich nicht wehren. Wie es seine Art war, hatte er ihn im Unklaren gelassen. Warum der Junge gefunden werden sollte, wer er war und wo er vor seinem Verschwinden gewesen war. Wie er hieß und wer seine Familie oder Freunde waren. Willem wusste nichts. Er hatte nur das Bild. Das Bild eines verzweifelten Jungen mit einer frischen Narbe.
Das Bild eines Jungen, wie er einer gewesen war.
Deshalb hatte er ihn auserwählt.
Denn das war es. Die Flamme erteilte keine beliebigen Aufträge. Die Flamme wählte aus. Und der Herr sah, dass es gut war.
Willem drehte das Bild in seinen Händen. Eine Buchstaben-Zahlen-Kombination war darauf gekritzelt. Es sah aus wie ein Kennzeichen.
Irgendetwas stimmte nicht. Wenn es darum ging, einen Abtrünnigen zu finden, hätte die Flamme seine eigenen Leute schicken können. Dahinter musste mehr stecken. Es gab keinen Grund, dass er ausgerechnet zu ihm kam. Er brauchte einen Profi, das war es. Die Flamme wusste, dass er mit seinen eigenen beschränkten Mitteln in der Sache nicht weiterkam. Es musste etwas Besonderes mit dem Jungen auf sich haben. Etwas, was selbst ihn vor Probleme stellte. Er brauchte jemand, der Zugang zu Methoden und Mitteln hatte, die ihm versagt waren.
So einen wie ihn, Willem.
Irgendwo in Dänemark
Anfangs hatte sie starr neben ihm gesessen, hatte ausdrucklos durch die Windschutzscheibe gestarrt und kein Wort mit ihm geredet. Aber nun, wo sie ein paar Stunden und viele Kilometer weitergefahren waren, taute sie auf. Rutschte auf dem Beifahrersitz hin und her und stellte ihm Fragen. Was ist das? Ein Supermarkt. Und das? Ein Fast-Food-Restaurant. Wo fahren all die Menschen hin? Zur Arbeit. Besitzt jeder hier ein Auto? Sehr viele. Wo geht die Straße hin? In die Freiheit.
Sie kannte nichts. Es war eigentlich unvorstellbar. Dass ein Mensch, der seit neunzehn Jahren mitten in Dänemark lebte, all das nicht kannte.
Er war immerhin schon neun Jahre alt gewesen, als seine Eltern sich entschieden, nach Dänemark zu kommen. Ins Königreich.
Neun Jahre und das Leben war vorüber.
Er hatte Handys gekannt, Computerspiele, Playstation, Nintendo, er und sein Bruder hatten stundenlang bei den Nachbarskindern gesessen und Mario Kart gezockt. Und dann war von einem auf den anderen Tag alles vorbei. Er hasste seine Eltern dafür, und er hasste seinen Bruder, der ihn mit der Scheiße allein gelassen hatte. War einfach nicht mitgekommen, abgehauen. Und das Größte? Dass seine Eltern behaupteten, sein Bruder wäre tot. Einfach tot, weil er sich ihnen widersetzt hatte.
Im Königreich hätte es dafür satte Strafen gegeben, und das hatte sein Bruder geahnt. Oder er hatte es gewusst und ihm nicht gesagt.
Sein kluger Bruder. Es verging kein Tag, an dem er sich nicht fragte, was aus ihm geworden war. Er legte sich immer eine andere Geschichte zurecht. In einer war sein Bruder unter die Räder gekommen, klar. Vierzehn Jahre und ohne Eltern in Deutschland unterwegs? Das konnte nicht gut gehen. Auf der Straße leben, betteln, Crack rauchen, auf den Strich gehen, sterben.
In einer anderen Version aber hatte sein Bruder großes Glück gehabt. Er war in ein Heim gekommen, einer der Erzieher hatte sich besonders um ihn gekümmert, ihn schließlich adoptiert, ihm eine Lehre vermittelt, jetzt lebte sein Bruder als Schreiner oder Dachdecker irgendwo mit seiner Freundin. Die vielleicht schwanger war.
Oder aber er hatte sich auf der Straße durchgeschlagen, war ein gerissener Kleinkrimineller geworden, ein Boss war auf ihn aufmerksam geworden, hatte ihm kleinere Aufträge verschafft, dann hatte er sich hochgearbeitet, von Autos knacken über Drogen verticken und Mädchen für sich arbeiten lassen, zur rechten Hand vom Boss. Jetzt hatte er Kohle und dicke Autos und eine heiße Braut.
Ein toller Bruder, Stoff für viele Geschichten.
Ein schrecklicher Bruder, der einfach verschwand.
Ihn zurückließ mit den Gebeten, den Schlägen, der Arbeit, den Spinnern, der Flamme.
Andererseits: Wäre er nicht in der Hölle gelandet, hätte er sie niemals kennengelernt. Jemi.
Absalom oder Niklas, wie er eigentlich hieß und wie es ab sofort auch wieder sein Name sein sollte, oder noch viel besser: Nick, sah zu ihr hinüber. Das Gesicht sah er nur angeschnitten, sie blickte aus dem Fenster. Die Knie hatte sie auf den Sitz gezogen, umschlang sie mit den Armen. Sie war wunderschön. Das Schönste, was er je gesehen hatte. Im Königreich war sie Schneewittchen gewesen, das junge Mädchen, das von allen diesen armen, verhärmten grauen Frauen um seine Schönheit beneidet wurde. Dabei war sie sich selbst ihrer Schönheit nicht bewusst. Eitelkeit war eine Sünde, und Jemi war gottesfürchtig erzogen. Sie sah nicht in den Spiegel, sie schminkte sich nicht – mit was auch? –, und sie konnte sich nicht vergleichen. Frauen in ihrem Alter gab es dort nicht. Es gab die Mütter und es gab die Kinder. Von den Kindern war das älteste fünfzehn. Von den Frauen die jüngste vielleicht Mitte, Ende zwanzig. Dazwischen hatte es nur sie beide gegeben: Absalom und Jemima. Die zwei Königskinder.
Jetzt waren sie Nick und Jemi. Für immer.
»Können wir anhalten?«
Jemi sah ihn an. Königsaugen. Blau wie das Meer. Das Mittelmeer, wie er es aus Italien in Erinnerung hatte. Der einzige Urlaub, den er außerhalb Deutschlands gemacht hatte. Natürlich nicht mit seinen Eltern, sondern mit einem Klassenkameraden. Es hatte viel Überzeugungskraft gekostet, seine Eltern so weit zu bringen, dass er mitfahren durfte. Nach Italien!
Hier in Dänemark hatte das Meer eine andere Farbe. Grau, fast schwarz. Mit viel Wohlwollen war es bierflaschengrün. Schmutzig weißer Schaum obendrauf.
Er wusste das, weil er einmal mitkommen durfte. Sein Vater und ein anderer Jünger waren nach Helsingør geschickt worden, eine Familie abholen. Und er hatte sie begleiten dürfen. Als Lockvogel, das wusste er heute. Es war ihnen normalerweise streng untersagt, das Königreich zu verlassen. Aber die Familie hatte Söhne, jünger als er. Wenn er mitkam, war die Chance, dass sie ihren Eltern bereitwillig folgten, größer. Wenn die Söhne Vertrauen zu ihm fassten, dann würden sie keine Angst haben, in das Königreich zu ziehen. In die Wälder. Dorthin, wo die Zeit angehalten worden war.
»Abs… Nick? Können wir anhalten?«
Jemi legte ihre Hand auf seine, die auf der Gangschaltung ruhte, lässig, als hätte er nie etwas anderes gemacht, als Auto zu fahren. Dabei hatte er nicht einmal einen Führerschein. Er hatte das Fahren von den Männern auf der Farm gelernt, die Traktoren und Bulldozer, aber auch die Pick-ups und Hiobs alten Jeep hatte er fahren dürfen. Das Königreich war groß und weitläufig, sie hatten die Wälder bewirtschaftet und damit Geld verdient. Dazu mussten sie Maschinen bedienen können, gerade die Jungen und Kräftigen unter ihnen. Den Acker bestellten die Weiber mit dem Pflug.
Nick blinkte und fuhr bei der Tankstelle raus. Er hielt an einer der Zapfsäulen. Jemi sah ihn an.
»Und jetzt?«
»Ich tanke. Währenddessen kannst du aufs Klo.« Er zeigte ihr das kleine beleuchtete Schild an der Seite des Häuschens. »Wenn ich fertig bin, gehst du rein und zahlst.«
Jemi verzog das Gesicht. »Kannst du das nicht machen? Ich bin … zu unsicher. Das fällt bestimmt auf.«
»Das hier fällt auch auf.« Er zeigte auf die frische Narbe quer über seinem Gesicht. »Mehr als ein unsicheres Mädchen. Glaub mir.«
Sie nickte und glitt aus dem Wagen.
Nick – das war so viel besser als Niklas und schon gleich dreimal besser als beschissener Absalom – stieg ebenfalls aus. Er zog die Kapuze seines Pullis tief ins Gesicht, damit niemand auf den Überwachungskameras sein Gesicht sehen konnte. Er wusste, dass es so etwas gab. Natürlich noch immer geben musste und wahrscheinlich sehr viel ausgefuchster als zu seiner Zeit.
Zu seiner Zeit. So sagte er es, wenn er an sich zurückdachte. An sein Leben in Freiheit. In relativer Freiheit. Gemeinsam mit seinem Bruder Jan. Allerdings waren die Eltern schon immer streng gewesen, strenger als andere. Gläubiger. Sonst wären sie auch nicht in die Fänge Hiobs geraten. Aber sein Bruder, fünf Jahre älter, der hatte immer wieder Schlupflöcher gefunden. Hatte ihn mitgenommen zu seinen Beutezügen, Kaugummi klauen an der Tankstelle. Hubba Bubbas, die füllten den ganzen Mund aus. Das Wissen seines Bruders musste ihm jetzt auch weiterhelfen. Zwar hatte er Geld mitgenommen, Bargeld, aber weit würden sie damit nicht kommen. Den Pick-up hatten sie geklaut, aber Nick machte sich nichts vor: nicht hinter dem Wagen würden sie her sein.
Nervös sah er sich um. Die anderen Leute an der Tankstelle waren Normalos. Keine Auffälligkeiten, niemand, der sie vielleicht verfolgte. Eine vierköpfige Familie im Kombi, ein Geschäftsmann, eine Tramperin mit Surfboard.
Die Zapfsäule war ihm für einen kurzen Moment ein Rätsel, er hob die Zapfpistole ab, öffnete den Tankdeckel und wusste nicht weiter. Im Königreich hatten sie die Autos mit Kanistern befüllt, da schüttete man das Benzin in den Tank, fertig. Hier lief es anders. Er warf einen Blick auf den Familienvater an der Zapfsäule neben ihm. Der hatte die Augen fest auf die Anzeige geheftet und eine Hand an der Pistole. Es klickte. Dann klickte es noch mal. Der Familienvater schien noch nicht zufrieden, kniff die Augen zusammen, klickte, erst dann zog er die Zapfpistole aus dem Tank.
Nick begriff: Man musste den Hebel am Griff gedrückt halten. Ein bisschen dauerte es, aber dann hatte er den Dreh raus. Und machte es dem Mann nach: die Anzeige überprüfen und den Hebel drücken. Woher wusste man, dass der Tank voll war? 50 Liter gingen in den Pick-up, das wusste er, aber sie hatten immer so lange nachgeschüttet, bis das Benzin oben aus dem Loch gluckerte. Das würde man hier kaum so machen. Er stoppte bei 30 Litern, um sicherzugehen. Kein Aufsehen erregen. Mittlerweile kam auch Jemi von der Toilette zurück. Ihre Wangen waren gerötet.
»Es gibt keine Spülung und keinen normalen Wasserhahn«, flüsterte sie ihm zu. »Ich habe alles abgesucht, aber erst als ich aus dem Klo bin, hat es hinter mir gespült. Wie unheimlich.«
Er grinste. »Da hatte Hiob mal recht: Die Maschinen haben die Macht übernommen.« Es sollte ein Scherz sein, aber Jemi starrte ihn erschrocken an.
»Und wenn es stimmt? Wenn wir gar nicht klarkommen hier draußen?« Sie sah sich um. »Wenn es ein Fehler war?«
Er beendete den Tankvorgang und steckte ihr die Scheine zu. »Quatsch. Schau dich um, sehen die Leute geknechtet aus? Die sind doch alle ganz zufrieden. Das ist eben die Zukunft, Jemi. Ist doch cool, wenn du nicht mehr spülen musst.« Er lachte, aber Jemi knabberte an ihren Haarspitzen.
»Ich weiß nicht. Mir macht das Angst.«
»Jetzt geh rein und zahl. Sonst schauen die komisch, weil wir hier so lange rumstehen.«
Sie nickte und ging zurück zur Tankstelle, seine Blicke folgten ihr. Bestimmt war sie nervös, noch niemals war sie in einem Laden gewesen, hatte sich mit fremden Menschen unterhalten, geschweige denn irgendetwas bezahlt. Aber wenn sie sich komisch benahm, dann baute er darauf, dass es genug Menschen gab, die einen kleinen Dachschaden hatten und man wegen Jemi nicht gleich die Polizei holen würde. Er beobachtete, wie Jemi sich an der Kasse hinter die Tramperin stellte, die mit ihrem Board vor ihr stand. Die Tramperin bezahlte, mit Karte. Dann ging sie ein paar Schritte von der Kasse weg und Jemi war an der Reihe. Der Typ hinter der Kasse schien sie etwas zu fragen, sie schüttelte den Kopf und sah sich hilflos um.
»Komm schon, Jemi, du schaffst das«, presste Nick leise hervor. Jemi sah zu ihm hin, vermutlich konnte sie nicht viel erkennen, aber er nickte ihr zu.
Sie deutete schließlich zu ihm hinaus, der Typ nickte auch und nahm Jemis Geld.
Die Tramperin war ein paar Schritte von der Tür entfernt stehen geblieben und sah sich um.
»Verpiss dich«, dachte Nick. Sie schien allerdings auf seine Freundin zu warten, und als Jemi zum Ausgang strebte, sprach sie sie an.
Nick stöhnte. Verdammt, lass uns in Ruhe.
Aber die beiden jungen Frauen kamen Schulter an Schulter aus dem Kassenhäuschen und liefen gemeinsam auf den Pick-up zu.
»Hej«, sagte die Tramperin und grinste ihn an. »Ich bin Merle. Deine Freundin hier hat gesagt, ihr könnt mich ein Stück mitnehmen?« Und warf, ohne zu fragen, ihr Board hinten auf die Ladefläche.
»Hast du gesagt?« Er warf Jemi einen strafenden Blick zu, und sie schlug augenblicklich die Augen nieder. Verdammt, er wollte kein Arschloch sein, sie war seine Frau, er wollte sie mit Respekt behandeln, aber jetzt war er echt sauer. Sie konnten das Mädchen nicht mitnehmen. Sie waren auf der Flucht.
»Kein Platz mehr«, murmelte er, aber das Mädchen warf einen Blick auf die Beifahrerbank.
»Ach komm schon, wir rücken zusammen.«
Jemi nickte. »Das geht schon. Oder? Nick?«
Ein flehender Blick. Wenn sie bloß nicht immer so unterwürfig wäre, es fiel ihm schwer, ihr irgendetwas abzuschlagen. Das hatte Hiob geschafft – sie hatte überhaupt keinen eigenen Willen.
War sie ihm deshalb gefolgt?, schoss es ihm durch den Kopf, aber dann schob er den Gedanken weg, holte tief Luft und sagte: »Also okay. Wohin willst du?«
»In den Norden. Je weiter, desto besser. Richtung Frederikshavn. Fahrt ihr da hin?«
Das Mädchen hatte schon die Beifahrertür geöffnet, Jemi räumte ihren Kram zusammen und rutschte zuerst auf den Sitz, dann das Mädchen.
»Wie heißt ihr?«, fragte sie und grinste.
»Ich bin Nick und das ist Jemi.«
»Jemi? Lustiger Name. Noch nie gehört.«
»Eigentlich Jemim…«, wollte Jemi antworten, aber er ging dazwischen.
»Woher kommst du?«, fragte er und fädelte sich wieder in die Schnellstraße ein. Und ärgerte sich im gleichen Moment, denn wenn er das Mädchen fragte, woher sie kam, würde sie zurückfragen. »Wir sind gerade auf dem Weg zurück von Kolding«, schob er deshalb nach.
»Ich komme eigentlich aus Frederikshavn«, antwortete Merle munter. »Aber ich hab gerade meinen Bruder in Aalborg besucht, wegen der Demo, und mein Board abgeholt. Jetzt will ich wieder zurück. An den Strand.«
»An den Strand?« Jemis Augen leuchteten. »Da möchte ich auch hin. Ans Meer. Ich war noch nie dort. Ich sehne mich danach, einmal das Meer zu sehen.«
Merle zog die Brauen zusammen und sah Jemi belustigt an. »Ist das ein Zitat? Aus einem Film oder so?«
Jemi verstand nicht, aber bevor sie etwas entgegnen konnte, ging Nick dazwischen.
»Was willst du nachts am Strand? Zu dieser Jahreszeit? Ist ein bisschen zu kalt, um zu surfen, oder?«
Die Tramperin lachte. »Warum denn? Ist doch langweilig. Ich bin schon ein paarmal nachts gesurft. Das ist wenigstens eine challenge. Du gehst an deine Grenzen.«
Sie zuckte mit den Schultern, während Jemi und Nick sich ansahen. Sie hatten keinen Schimmer, was Merle meinte.
»So ein Quatsch«, sagte Nick. Er ärgerte sich über das Mädchen, aber noch mehr ärgerte er sich darüber, dass sie ihm so fremd schien. Ihre Sprache, diese lässige Selbstverständlichkeit, die sie an den Tag legte. Alles an ihr provozierte ihn.
»Du bist sehr mutig. Was sagen deine Eltern?« Jemi legte ihre Hand auf Nicks Oberschenkel und drückte leicht. Sie bat ihn damit, sich zurückzunehmen, er verstand die sanfte Geste.
Merle guckte etwas schräg und lachte dann. »Du sprichst so komisch, du bist nicht aus Dänemark, oder? Woher kommst du?«
Jemi warf Nick einen irritierten Blick zu.
»Doch. Ich bin hier geboren. Aber bei mir zu Hause reden wir alle so.«
»Aha.«
Zum Glück gab Merle sich mit der Antwort zufrieden, sonst hätte er sie bald wieder absetzen müssen, dachte Nick. Sie war gefährlich, ohne es überhaupt zu wissen.
»Ich dachte ja, dass ich mehr Glück habe beim Trampen«, fuhr diese unbekümmert fort. »Ich meine, es sind doch ziemlich viele nach der Demo wieder nach Hause gefahren. Aber weil ich das Board bei meinem Bruder abgeholt habe, habe ich die meisten Mitfahrgelegenheiten verpasst.« Merle warf ihnen einen interessierten Blick zu. »Wart ihr auch da?«
»Wo?«
»Fridays for Future. In Aalborg.«
»Was ist das?«, fragte Jemi.
»Hä? Nicht dein Ernst, oder?« Merle lachte kurz auf, halb belustigt, halb schockiert.
»War ein Scherz«, beeilte sich Nick einzuwerfen. Er wurde immer nervöser. Es war so eine Scheißidee, dieses Mädchen mitzunehmen. Sie mussten versuchen, sie so schnell wie möglich loszuwerden. »Natürlich wissen wir, was das ist. Aber nein, wir waren nicht da. Konnten heute nicht. Wir hatten zu tun.«
Damit gab Merle sich zufrieden, aber Jemi ruckelte schon wieder nervös auf ihrem Sitz herum und kaute auf den Haarspitzen.
»Also, wenn ihr wollt, kommt doch mit an den Strand. Das wird cool. Ich hab auch was zu rauchen dabei.«
»Ich rauche nicht«, meinte Jemi, fast entschuldigend.
»Ich rauche auch nicht.« Merle grinste. »Nur Gras.«
Jemi guckte verständnislos. »Gras? Ehrlich, du rauchst Gras?«
Merle lehnte sich mit einem Ruck gegen die Beifahrertür, sodass sie einen besseren Blick in ihre Gesichter hatte. Nick wandte seines ab. Er hatte noch immer die Kapuze des Hoodies auf, und seine Narbe befand sich zum Glück auf der Merle abgewandten linken Gesichtshälfte.
»Ihr seid ja totale Freaks! Was geht mit euch?«
Nick starrte auf die Straße. Er zog es vor, darauf nicht zu antworten. Jede Antwort war eine zu viel. Andererseits tat es ihm leid. Für Jemi. Er hatte ihr die Freiheit in den tollsten Farben ausgemalt, was sie alles sehen und erleben würde, dass sie endlich Leute kennenlernen würden, Leute in ihrem Alter, junge Leute, ohne Bibel in der Hand. Sie würden ihre Musik hören und die Welt sehen. Und nun war hier ein Mädchen, so alt wie sie, ein junges, freies Mädchen, das sie obendrein einlud, etwas Verrücktes mit ihr zu machen. Und anstatt sich zu freuen, ließen sie sich in die Ecke drängen und empfanden sie vor allem als: Bedrohung.
Jemi machte einen Versuch der Erklärung. »Wir leben auf einer Farm, weißt du? Wir sehen nicht viel von der Welt.«
Merle lachte auf. »Kein Scheiß – ihr werdet ja wohl Internet haben. Ich mein, ihr lebt doch nicht im Mittelalter.«
Nick konnte aus den Augenwinkeln sehen, wie Jemi ihre Hände knetete. Sie war nervös, wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte. Hoffentlich rastete sie nicht aus. Er hatte es oft genug erlebt, wie sie reagierte, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlte. Sie konnte nicht so gut mit Worten umgehen, natürlich, sie hatte nicht einmal eine Schule besucht, sie lebte nicht unter Gleichaltrigen. In ihrer Welt gab es nur Hiob und die anderen. Die armen Gestalten. Die Diener Hiobs. Sein Volk. Es galt das Wort des Herrn, und der Herr im Königreich war Hiob. Er hatte auf alles eine Antwort. Er beendete jeden Satz, den Jemi nicht rausbrachte, stellte und beantwortete für sie jede Frage, die ihr Geist nicht in Sprache verwandeln konnte. Und manchmal ließ er Jemi einfach in all ihrer Hilflosigkeit stehen. Wenn sie nicht mehr weiterwusste, dann bekam sie diese Anfälle.
Nick wollte sich nicht eingestehen, dass sie ihm in diesen Augenblicken unheimlich war. Es kam eine Jemi zutage, die er lieber nicht kannte. Sie wusste meistens nachher nicht, was geschehen war, war nicht Herr über das, was sie dann tat. Hiob war der Einzige, der sie in diesen Situationen in den Griff bekam. Allerdings war Nick noch nie dabei gewesen, wenn Hiob das regelte. Er wusste nicht, was dann geschah. Schlug er sie? Hypnotisierte sie? Gab ihr Drogen?
Zuzutrauen war ihm alles.
Die anderen sagten über Jemi, dass sie besessen war. Oder krank im Kopf. Aber die glaubten auch an Engel und so einen Scheiß.
»Halt dich von ihr fern, sie ist böse«, hatte seine Mutter ihm gepredigt, aber gerade das hatte ihn so angezogen. Ihre überirdische Schönheit und diese dunkle Seite ihrer Seele.
Aber jetzt, gerade jetzt, konnte er einen Ausraster ihrerseits am allerwenigsten brauchen.
»Wir biegen da vorne ab«, sagte er unvermittelt und zeigte auf den Kreisverkehr in der Verlängerung der Straße. »Ich setz dich da ab.«
»Spinnst du?« Merle schüttelte den Kopf. »Das war nicht abgemacht, wir sind doch gerade erst losgefahren. Ich denke, ihr fahrt mindestens bis Frederikshavn?«
»Davon habe ich nichts gesagt«, antwortete er schroff. »Ich habe gar nichts gesagt. Du hast dich selbst eingeladen.«
Er blinkte und stoppte den Pick-up kurz vor dem Kreisverkehr.
»Ich denk nicht dran.« Merle setzte sich wieder gerade hin und Jemi blickte ihn stirnrunzelnd an.
»Nick, doch nicht hier. Lass uns wenigstens zu einer Tankstelle fahren«, sprang sie Merle zur Seite.
»Ich steig hier nicht aus – in the middle of nowhere«, sagte Merle und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Und ich fahr dich nicht weiter. Raus jetzt.«
»Mann, dein Freund hat vielleicht eine Scheißlaune«, sagte Merle. »Ich hab’s ja gleich gemerkt, dass du keinen Bock auf mich hast, aber mal ehrlich – Nächstenliebe? Never heard?«
»Nick?« Jemi klang ängstlich.
»Ja, ist okay«, gab er klein bei. Wegen Jemi. Nicht wegen der Trulla. Ein Stück noch. Aber er würde zusehen, dass sie die Nervensäge so schnell wie möglich loswurden.
Gigarot, Südfrankreich
»Du auch?« Bengt hielt die Flasche mit dem Pastis fragend über Helles Glas. Sie nickte. Langsam wurde es ein wenig kühl, selbst hier. Helle schob ihre nackten Füße unter Emil, der regungslos bei ihrem Stuhl lag. Er hatte ein Alter erreicht, in dem sie ständig überprüfte, ob er noch atmete oder vielleicht schon für immer eingeschlafen war.
Als wenn der Tod so gnädig wäre.
»Hast du gesehen?« Triumphierend hob sie ihr Smartphone in die Höhe, damit Bengt sehen konnte, was die Wetter-App anzeigte: Skagen, sieben Grad. Helle wischte. Saint-Tropez, achtzehn Grad.
»Das ist unfair.« Bengts Augen blitzten, Helle sah die Lachfältchen in den Augenwinkeln. »Heute ist es hier besonders schön gewesen und zu Hause außergewöhnlich schlecht.«
»Es kann in Skagen niemals, niemals so warm werden wie hier. Ende Oktober!«
»Wenn wir so weitermachen, schon«, widersprach Bengt. »Irgendwann wird es hier heißer und immer heißer. Die Wälder werden brennen, sogar im Winter. In hundert Jahren willst du hier nicht mehr leben – wenn es uns dann noch gibt.«
Helle legte den Kopf in den Nacken und trank den mit Wasser verdünnten Lakritzschnaps in einem Zug. Das Thema deprimierte sie. Nicht im Urlaub, dachte sie. Können Probleme nicht auch mal Urlaub machen? Und schob das leere Glas dicht an die Flasche Ricard. Aber Bengt schüttelte den Kopf.
»Lass gut sein. Du bist schon wieder streitlustig.«
Helle öffnete den Mund, schloss ihn dann aber wieder ohne Entgegnung, sie erinnerte sich an ihre Therapeutin.
»Du hast recht«, gab sie stattdessen zurück und kam sich verlogen vor. Engelszungen, das war nicht sie. Sie wollte trinken. Trinken und sich streiten, dass die Fetzen fliegen. Gläser auf den Boden schmeißen, sich anbrüllen, dass sie das Rote in ihren Augen sah, so lange, bis Bengt sie im Klammergriff ins Bett verfrachten und mit ihr schlafen würde. So sollte Urlaub sein! So sollte es sein, wenn man nicht als Kriminalkommissarin im kalten Jütland seinen Dienst tat. So war es gewesen, früher, vor den Kindern. In ihrem ersten gemeinsamen Urlaub, Bengt und Helle. Jung und wild. Damals waren sie mit Interrail durch Europa gefahren, Marokko war ihr Ziel, gekommen waren sie bis Saintes-Maries-de-la-Mer. Sechs ganze Wochen waren sie dort auf dem Campingplatz geblieben, Tage, die nach Wein und Salz, nach Haut und Meer schmeckten. Tempi passati.
Jetzt saßen sie hier, in einer hübschen Ferienwohnung, die sie sich nur hatten leisten können, weil Nebensaison war, und plänkelten harmlos umeinander herum. Sprachen übers Wetter.
Helle spürte den Blick ihres Mannes auf sich. Er hatte die Augen zusammengekniffen. »Du bist unfair«, sagte er.
»Liest du meine Gedanken?«
Er fasste an seinen roten Wikingerbart, durchzogen von ein paar weißen Haaren und strich darüber. Eine Beschwichtigungsgeste, so hatte ihre Tochter Sina es einmal genannt. Helle war es nie aufgefallen, Bengt selbst auch nicht. Aber es stimmte – jedes Mal wenn zwischen ihnen die Luft ein bisschen knisterte, streichelte Bengt seinen Bart.
Jetzt nahm er ertappt die Hand von seinem Kinn. »Kannst du es nicht einfach genießen? Den Frieden, die Sonne.«
Statt einer Antwort schob Helle ihre Hand über den Tisch, den ganzen Arm hinterher, bettete ihren Kopf darauf.
»Ich weiß nicht, was mit mir los ist«, murmelte sie. »Scheißwechseljahre. Das hört nie auf.«
Bengt nahm ihre Hand.
»Du bist unzufrieden. Dir reicht dein Leben nicht. Meine Diagnose.«
Helle schossen Tränen in die Augen, sie schloss die Lider. Er hatte recht. Sie liebte ihr Leben, aber seit ein paar Jahren wurde es weniger. Erst war ihre Tochter Sina aus dem Haus gegangen. Jetzt Leif. Emil war ein alter Hund, der sich bereit machte zu sterben. Auch ihre kleine Polizeistation schrumpfte. Amira war nach Kopenhagen gegangen. Jan-Cristofer arbeitete nur noch Teilzeit, um sich um seinen Sohn zu kümmern. Blieben sie und Ole, der sich ständig um Versetzung bemühte. Er wollte ebenfalls nach Kopenhagen, zu seiner Freundin Amira, und wer könnte es ihm verübeln? In Skagen hatten sie einem jungen ehrgeizigen Polizisten nichts zu bieten.
Blieben Bengt und Helle, allein in einem ruhigen Leben. Zu ruhig, wenn es nach Helle ging. Sie bekam Beklemmungen, wenn sie abends nach Hause kam. In ihr wunderschönes Haus am Strand. Selbst gebaut, mitten in den Dünen, es konnte nicht idyllischer sein. Aber immer häufiger ertappte Helle sich dabei, dass sie sich noch nicht bereit fühlte für die Ruhe und den Frieden, der sie dort empfing. Es fehlte ihr an nichts. Mann, Hund, Freunde, Haus, Kollegen – es war perfekt. Sie würde eingehen.
Konnte man an Harmonie sterben?, fragte Helle sich, mit dem Kopf auf ihrem Arm, ihre Hand in Bengts warmer Hand. Emils Fell an ihren Füßen, der Blick aufs Meer, ein Nebel von Pastis im Hirn.
Die Reise war ihre Idee gewesen. Um der alten Zeiten willen. Weil es Emils letzte große Reise sein würde. Weil sie noch einmal die wilde Lust spüren wollte, die sie damals befallen hatte, als sie vor dreißig Jahren noch kinderlos in Südfrankreich gewesen waren. Sie hatte ausgeklammert, dass sie heute alt und dick waren. Wieder kinderlos zwar, aber jeder mit einem Päckchen auf dem Buckel. Bis in die Camargue hatte Helle dann auch nicht fahren wollen, nichts würde mehr so sein wie damals, und sie war zu der traurigen Erkenntnis gekommen, dass sie nicht mehr auf einen Campingplatz gehörten.
Die Sonne schien und hinter ihrer Stirn stiegen schwarze Wolken auf.
»Komm, lass uns den Sonnenuntergang am Meer ansehen.« Bengt stand auf und sofort hob Emil den Kopf. »Ja, mein Dicker, wir drehen noch eine Runde.«
Als verstünde er jedes Wort, wuchtete sich der große Rüde mit Mühe auf die Hinterbeine. Helle vermied es, ihm dabei zuzusehen. Ihr Emil. Ihr über alles geliebter Emil würde gehen. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen. Aber in absehbarer Zeit.
Der Schmerz der Gewissheit seines nahen Todes war nicht auszuhalten für sie. Es gab Tage, da lief sie betäubt hinter ihm her, sah auf sein gemütlich wackelndes Hinterteil und dachte in ewiger Wiederholungsschleife: Du stirbst. Du stirbst! Wie oft drehte Emil ausgerechnet dann seinen großen Kopf zu ihr, und seine schwarzen Augen schienen zu sagen: »Na und? Ist nicht weiter schlimm.« Und dann schämte Helle sich. Für den Hund war es der natürliche Lauf des Lebens, Angst vor Tod und Verlust kannte er nicht. Warum ihn also mit ihrer Heulerei unnötig beunruhigen?
Bengt und der Hund waren bereits die drei Stufen vom Ferienbungalow zur Straße gelaufen, aber Helle suchte noch nach ihrem Päckchen Tabak.
Bengt drehte sich zu ihr um. »Ich habe dir ein Päckchen Gauloises besorgt«, rief er und lächelte. »Ohne Filter. Good old times.« Dabei kramte er in der Hosentasche seiner Bermuda, bevor er sich wieder umdrehte und bedächtig mit Emil an seiner Seite zum Strandweg zockelte.
Helle hatte im vergangenen Herbst wieder angefangen zu rauchen, als die Tote in der Wanderdüne gefunden worden war. Vorgeblich, weil sie so gestresst gewesen war, tatsächlich aber hatte sie das Rauchen als Entspannungsritual für sich wiederentdeckt. Sie fand es gemütlich, im richtigen Moment mit einer Zigarette dazusitzen und an nichts zu denken als den perfekten Rauchkringel. Schwummerig wurde ihr aber noch immer davon, und es schmeckte auch nicht.
Ein paar Sekunden verweilte sie auf der Terrasse und sah ihren Männern hinterher. Sie waren sich so ähnlich, fand sie, Bengt und Hund Emil. Unerschütterlich ließen die beiden Helles Launen über sich ergehen und hielten ihr unverbrüchlich die Treue. Hoffte sie zumindest. Würde Bengt sie betrügen können? Vermutlich war er dazu ebenso zu bequem wie sie. Emil dagegen hatte es versucht. Mehrfach. Jeder läufigen Hündin im Umkreis von fünf Kilometern war er hinterhergestürmt. Erfolglos. Und er war stets zu ihr zurückgekehrt.
Ihr Handy zeigte den Eingang einer Nachricht an, aber Helle schaltete rasch auf Flugmodus und folgte schließlich den Herren zum Strand.
Sie liefen ein paar Meter an der Wasserlinie entlang, durch Tang und Muscheln, Steine und zerdrücktes Plastik, bevor sie sich auf einen der Felsen setzten, der von der Sonne des Tages aufgewärmt war. Weitaus angenehmer als der kühle Sand.
Bengt reichte ihr das Päckchen, sie zog eine Filterlose heraus und schnupperte daran. Ungeraucht rochen Zigaretten um einiges besser. Bengt gab ihr Feuer. Helle bewunderte ihn für seine Disziplin. Er leistete ihr alle paar Wochen mal Gesellschaft beim Rauchen, sie dagegen verspürte, kaum hatte sie dieses Laster wieder aufgenommen, jeden Tag mehrfach das Bedürfnis. Die ersten Züge saßen sie stumm da und beobachteten einen Kitesurfer draußen auf dem Meer, der geradewegs in den orangefarbenen Sonnenuntergang segelte.
Bengt legte einen Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. Schwer ließ Helle sich gegen ihn fallen.
»War eine gute Idee von dir.«
Helle nickte nur.
»Ich wäre sonst vielleicht nie wieder hierhergekommen«, fuhr Bengt fort. »Südfrankreich.«
Emil vergrub seine Schnauze im Sand und schnaubte tief. Dann scharrte er mit den Vorderbeinen, gab die Aktion aber schnell wieder auf. Die Arthrose.
»Ich finde, du solltest dir Gedanken machen, wie es weitergeht.« Bengt warf einen Blick zu ihr hinüber.
»Was, mit uns?« Helle bekam einen Schreck.
»Quatsch. Was soll mit uns sein? Wir werden zusammen alt. Und lassen uns immer wieder mal therapieren.« Bengt lachte, dass sein Bauch wackelte.
»Ja, ich weiß.« Natürlich war Helle vollkommen klar, wovon ihr Mann sprach. »Ich denke manchmal, es war ein Fehler, Frederikshavn nicht zu machen.«
Nachdem sie den Fall im vergangenen Jahr aufgeklärt hatte, bot man ihr die Leitung der Polizeibehörde in Frederikshavn an. Ein mittelgroßes Kommissariat, mehr als fünfzig Mitarbeiter, deutlich bessere Ausstattung, große Fälle, mehr Verantwortung, mehr Aufgaben, mehr Arbeit und Herausforderungen. Aber Helle hatte gekniffen. Hatte sich eingeredet, dass sie sich in ihrer Ministation, dieser Dead-End-Police am Arsch der Welt, viel wohler fühlte. Mit ihrer Sekretärin Marianne, die nicht nur den weltbesten Kaffee kochte, sondern sich die Verantwortung für Helles Bauchfett zu gleichen Teilen mit Bengt teilte; mit Ole, dem forschen Jungspund, der immer noch zu jung war, um nichts zu tun, und Jan-Cristofer, dem alten Freund und Gefährten aus den Anfangstagen. Aber dann war ein ganzes Jahr lang so gut wie gar nichts vorgefallen. Ladendiebe und Falschparker – das hatte bereits Sören Gudmund, Leiter der Kopenhagener Mordkommission, so treffend auf den Punkt gebracht. Und im Sommer ein paar Betrunkene. Auffahrunfälle, das ein oder andere geknackte Auto, illegale Beachpartys – es war ein gähnend langweiliges Jahr für alle gewesen und hatte aufs Neue bestätigt, dass die kleine Polizeistation in Skagen eigentlich auf reinen Saisonbetrieb umgestellt werden konnte. Eine Helle war überbezahlt und überqualifiziert.
»Na ja, Fehler, das würde ich so nicht sagen«, meinte Bengt beschwichtigend. »Sei nicht so hart zu dir. Du warst eben noch nicht so weit.«
Und du bist viel zu gütig zu mir, lieber Bengt, dachte Helle. Du bist und bleibst Sozialpädagoge. Und ich weiß: Ich bin dein schwierigster Fall. Laut sagte sie: »Ich hab’s verkackt. Die Chance kommt so schnell nicht wieder.«
»Weißt du«, sagte Bengt, als hätte er sie nicht gehört, »wenn Emil mal nicht mehr ist, könnten wir auch darüber nachdenken, nach Kopenhagen zu ziehen. Näher bei Sina sein.«
»O Gott! Die wird sich bedanken!«
»… ein schickes kleines Apartment in Nørrebro, du fährst mit dem Rad zur Arbeit ins Morddezernat, und abends gehen wir ins Kino. Oder ins Theater. Oder besuchen eine Ausstellung – meinst du nicht, das würde uns guttun?«
Helle schwieg. Wie oft hatte sie an diese Möglichkeit schon gedacht. Sörens Ruf nach Kopenhagen zu folgen. Mordkommission! Das war schon was. Aber sie hatte gleichzeitig auch Angst vor so einem Neubeginn. Ihr würden nicht nur ihre lieb gewonnenen Kollegen, ihr würde vor allem das Meer, die Weite, der Strand, die Dünen und, ja, die Einsamkeit Skagens fehlen. Außerdem hatte sie Angst davor, in einer Gruppe von Profis nicht bestehen zu können. Sie würde die Entscheidung einfach weiter hinausschieben, das wusste sie. Sie war noch nicht so weit. Noch nicht unzufrieden genug. Stuck in the middle.
Die Sonne war nun ganz an der Horizontlinie verschwunden, Helle fröstelte. Emil schlief schon wieder tief, aber sie weckten ihn auf und schlenderten Hand in Hand zu ihrem Apartment zurück. Bengt sprach noch ein bisschen über ein Leben in der Hauptstadt, sodass Helle der Verdacht beschlich, er wolle nicht ihretwegen den Lebensmittelpunkt verlagern, sondern weil ihm selbst die Decke auf den Kopf fiel.
Während sie den Tisch deckten, mit Weißbrot, Salzbutter, einem Käseteller, der von selbst laufen konnte, Oliven, Tapenade, gegrillten Paprika, terrine de canard und eingelegten Zwiebeln, sprach Helle ihren Mann darauf an. Bengt gab zu, dass es ihn reizen würde, gleichzeitig war er an Jütland beruflich gebunden und außerdem war sein Vater Stefan noch in einem Heim in Frederikshavn, auch ihn wollte er nicht im Stich lassen.
»Aber ich würde alles tun, damit wir beide nicht vor Langeweile sterben«, fügte er ernsthaft an.
»Dann musst du ein paar Leute umbringen«, lachte Helle. »So hätte ich was zu tun.«
»Dein Humor gefällt mir nicht«, meinte Bengt. »Du tickst manchmal nicht richtig.«
Helle wollte dem etwas entgegnen, aber dann rappelte ihr Handy und zeigte eine Flut von Anrufen und Nachrichten an – sie hatte es gedankenverloren wieder aktiviert und nicht damit gerechnet, gleich bombardiert zu werden.
»Verdammt, was …?«
Fünf Anrufe ihres Kollegen Ole. Drei Textnachrichten.
»Ruf bitte mal an.«
»Helle, bitte RR!«
Und zuletzt: »Wir haben eine Tote.«
Helle ignorierte alle weiteren Nachrichten und wählte augenblicklich die Nummer ihres Kollegen.
»Na endlich«, stöhnte Ole Halstrup.
»Was gibt’s?«
»Hier ist ein junges Mädchen gefunden worden. Am Strand bei Møjen. Wahrscheinlich ertrunken.«
»Um Gottes willen. Kennen wir sie?«
Ole schwieg einen Moment. »Helle, es tut mir leid. Es ist Merle.«
Helle wurde auf einen Schlag kalt. Es war, als gefröre ihr Blut. Merle. Merle Brabant. Eine enge Freundin von Leif. Sie kannte das Mädchen seit dem Kindergarten.
Bengt sah sie an. Er wusste sofort, dass etwas Schreckliches geschehen war und kniete sich vor seine Frau.
»Weiß man … ist sie … ein Unfall? Wissen die Eltern davon? Ich … o Gott, wie furchtbar.«
»Die Eltern sind benachrichtigt. Wir wissen noch nichts, Doktor Holt war gleich da und hat Tod durch Ertrinken festgestellt. Vermutlich ist sie fünfzehn bis achtzehn Stunden im Wasser gewesen. Fremdeinwirken können wir nicht ausschließen, sie hat ein paar Druckstellen an den Handgelenken. Aber um Genaueres zu sagen, müssen wir den offiziellen Befund abwarten. Sie ist in der Rechtsmedizin.«
Oles Ton war klar und sachlich, fast spröde, und Helle war ihm dankbar dafür. Trotzdem.
»Ich komme.«
»Helle, Frederikshavn übernimmt das.«
»Ich muss!«, unterbrach ihn Helle. »Ich nehme den nächsten Flieger.«
Und bevor sie auflegte: »Ruf Runstad an. Der soll sich den Fall rüberziehen. Ich will nicht, dass Holt da herumdilettiert. Wir dürfen keinen Fehler machen.«
Den letzten Satz hatte sie mehr geschrien, dann legte sie auf und schmiss das Handy quer über den Tisch. Presste sich die Hand vor den Mund, um den Schrei, der aus den Tiefen ihrer Seele drängte, zu unterdrücken. Bengt nahm sie wortlos in den Arm.
Eine Viertelstunde später hatte Bengt für Helle einen Flug von Nizza nach Kopenhagen gebucht, der erste am folgenden Tag. Hatte Helle in eine Decke gewickelt und mit Emil auf die Terrasse verfrachtet, die Flasche mit dem Pastis dezent verräumt und stattdessen einen Tee gekocht. Jetzt sprach er mit Leif, ihrem Sohn, um ihm die Nachricht zu überbringen, dass seine Freundin aus Kindertagen ertrunken war.
Helle hörte die Stimme ihres Mannes, die Worte drangen aber nur wie durch Watte an ihr Ohr, der Sinn erschloss sich nicht, sie konnte und wollte sich die Reaktion ihres Sohnes nicht ausmalen.
Merle war tot.
Ein Leben endete, noch bevor es sich wirklich entfalten konnte. Merle stand wie Leif an der Schwelle zu einem selbstbestimmten Leben, sie sollte jetzt entscheiden dürfen, welche Richtung sie einschlagen würde. Reisen oder Studium, Ausbildung oder doch erst einmal jobben? Großstadt oder Jütland, Fun oder Karriere, Frauen oder Männer, wer bin ich eigentlich. Die ganz großen Fragen, die sie sich jetzt stellen sollte, waren mit ihr auf den tiefen dunklen Grund des Meeres gesunken. Fredrick und Inez, ihre Eltern, die Helle so gut kannte, würden niemals erfahren, welchen Weg ihre Tochter Merle gewählt hätte.
Helle dachte an ihre Tochter Sina, die seit drei Jahren aus dem Haus und bei jedem Besuch eine andere war, sie immer wieder mit neuen Plänen überraschte und, anstatt ihre Eltern damit in den Wahnsinn zu treiben, Stolz und Freude in ihnen hervorrief, weil sie so voller Energie und Ideen war.
Und Helle dachte stets: Sieh mal einer an, was meine Tochter alles kann. Für was sie sich interessiert. Eine schillernde Person voller Möglichkeiten, die alle um sich herum in Atem hielt. Im Moment war sie mit ihrer Band als Straßenmusikerin irgendwo in Osteuropa unterwegs.
Aber Merles Eltern würden immer an ihre Tochter denken müssen, die leblos im dunklen Meer trieb, einsam im kalten Wasser.
Lieber Gott, dachte Helle, warum befolgst du Arschloch nicht die einfachsten Regeln: Kinder dürfen nicht vor ihren Eltern sterben.
Aalborg
Seit dem Auftauchen von Hiob war Willem komplett von der Rolle, und Marit, die ihn so gut kannte, hörte nicht auf nachzubohren. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte er einen seiner Albträume bekommen, er war davon wach geworden, dass Marit neben ihm saß und ihn rüttelte. Sie sagte ihm, er habe gestöhnt und geschrien. Sein Körper war überzogen mit kaltem Schweiß und die Zähne klapperten.
Willem wusste, dass er mit ihr reden musste, er war Marit eine Erklärung schuldig, jedenfalls wenn er es nicht schaffte, sich zu kontrollieren und seine Angst wieder in den Griff zu bekommen. Kurz hatte er in Erwägung gezogen, mit der Psychologin zu sprechen, aber die Furcht, dass sie sein Geheimnis einem Vorgesetzten offenbarte, war zu groß. Natürlich unterlag sie der Schweigepflicht, aber Willem traute niemandem. Das hatte Hiob geschafft, Willems Vertrauen in die Welt war und blieb erschüttert.
Heute hatte er eigentlich keinen Dienst gehabt, deshalb hatte er sich auch nicht um Hiobs Ansinnen kümmern können. Stattdessen war er nach dem Frühstück mit den Kindern in den Wald gegangen. Sie hatten Moos gesammelt und schöne Äste und nach Tierspuren gesucht, und es war so wundervoll gewesen, mit seinen beiden Engeln, die glücklich und so unschuldig waren, dass er Tränen in die Augen bekam, wenn er an seine eigene verkorkste Kindheit dachte. Aber dann schlich sich immer wieder die Angst zwischen ihn und seine Kinder, er dachte daran, dass sie Marit allein zu Hause zurückgelassen hatten, und er bekam Angst um sie.