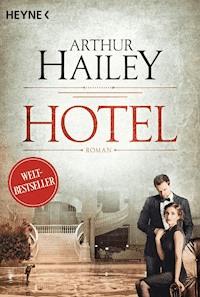
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Montagabend. In dem luxuriösen St. Gregory Hotel in New Orleans herrscht Hochbetrieb. Alles klappt wie am Schnürchen: beim Empfang, auf den Etagen, in der Bar, in Küche und Keller. Man könnte zufrieden sein. Doch unter der gleißenden Oberfläche knistert es: In dieser glamourösen Welt der Schönen und Reichen geben sich Leidenschaften, Liebe und Intrigen die Hand. Damit nicht genug: Das St. Gregory befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Nicht nur der Hotelbesitzer Warren Trent ist davon betroffen. Auch seine hübsche Assistentin Christine sowie der ehrbare Geschäftsführer Peter McDermott müssen alles auf eine Karte setzen, um das Hotel zu retten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Es ist Montagabend. In dem luxuriösen St. Gregory Hotel in New Orleans herrscht Hochbetrieb. Alles klappt wie am Schnürchen: beim Empfang, auf den Etagen, in der Bar, in Küche und Keller. Man könnte zufrieden sein. Doch unter der gleißenden Oberfläche knistert es: In dieser glamourösen Welt der Schönen und Reichen geben sich Leidenschaften, Liebe und Intrigen die Hand. Damit nicht genug: Das St. Gregory befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Nicht nur der Hotelbesitzer Warren Trent ist davon betroffen. Auch seine hübsche Assistentin Christine sowie der ehrbare Geschäftsführer Peter McDermott müssen alles auf eine Karte setzen, um das Hotel zu retten …
Der Autor
Arthur Hailey ist einer der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten. Seine legendären Romane Airport und Hotel erreichten Auflagen in Millionenhöhe und wurden weltweit zu Bestseller-Erfolgen. Arthur Hailey starb 2004 in Lyford Cay auf den Bahamas.
ARTHUR
HAILEY
HOTEL
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Renate Steinbach
Durchgesehene und verbesserte Neuausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe HOTEL erschien bei Bantam Books, Dobleday & Company Ltd., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Ausgabe 12/2017
Copyright © 1965 by Arthur Hailey Ltd.
This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Umschlagillustration: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock (August_0802, Kiselev Andrey Valerevich)
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-21821-8V001
www.heyne.de
Reisender,
bitte, suche Unterkunft
in diesem unwürdigen Haus.
Das Bad ist bereitet.
Ein friedliches Zimmer wartet auf dich.
Tritt ein! Tritt ein!
Inschrift über dem Eingang eines Gasthofes
in Takamatsu, Japan
MONTAGABEND
1
Wenn es nach mir ginge, dachte Peter McDermott, hätte ich den Hausdetektiv längst rausgeworfen. Aber es geht nicht nach mir, und jetzt ist dieser dicke Expolizist wieder mal nicht da. Wie immer, wenn man ihn dringend braucht.
McDermott, athletisch gebaut und eins neunzig groß, beugte sich über den Schreibtisch und rüttelte ungeduldig an der Telefongabel. »Im Hotel ist der Teufel los, und der verflixte Kerl ist nirgends aufzufinden«, sagte er zu dem Mädchen, das am Fenster des geräumigen, mit Teppichen ausgelegten Büros stand.
Christine Francis warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war kurz vor elf. »Versuchen Sie’s doch mal mit der Bar in der Baronne Street.«
Peter McDermott nickte. »Die Zentrale ruft der Reihe nach Ogilvies Stammkneipen an.« Er zog eine Schreibtischschublade auf, holte Zigaretten heraus, bot sie Christine an und gab ihr Feuer. Während er sich selbst eine anzündete, beobachtete er, wie Christine den Rauch tief einatmete. Christine Francis hatte Überstunden gemacht und ihr eigenes kleines Büro im Verwaltungstrakt des St. Gregory Hotel erst vor wenigen Minuten verlassen. Sie wollte eigentlich nach Hause gehen, aber der Lichtschein unter der Tür des stellvertretenden Direktors hatte sie magisch angezogen.
»Unser Mr. Ogilvie macht, was er will«, sagte sie. »So war’s schon immer. Und W. T. stärkt ihm den Rücken.«
McDermott sprach kurz ins Telefon und wartete weiter. »Stimmt«, sagte er zu Christine. »Ich habe vor Kurzem ja einmal versucht, unseren lahmen Detektivtrupp ein bisschen aufzumöbeln. Prompt wurde ich zurückgepfiffen.«
»Das wusste ich nicht«, sagte sie leise.
Er sah sie forschend an. »Und ich dachte, Sie wüssten alles.«
Im Allgemeinen traf das auch zu. Als persönliche Assistentin von Warren Trent, dem launenhaften und jähzornigen Eigentümer des größten Hotels in New Orleans, war Christine über die wohlgehüteten Geheimnisse des Hotels ebenso genau im Bilde wie über die täglichen Routineangelegenheiten. Daher wusste sie, dass Peter, der vor ein oder zwei Monaten zum stellvertretenden Direktor befördert worden war, das riesige, von emsiger Geschäftigkeit erfüllte St. Gregory praktisch allein leitete, aber ein keineswegs angemessenes Gehalt bezog und nur über begrenzte Befehlsgewalt verfügte. Sie kannte auch die Gründe dafür, die in einer Akte mit der Aufschrift »Streng vertraulich« zusammengetragen waren und Peter McDermotts Privatleben betrafen.
»Wo brennt’s denn?«, erkundigte sie sich.
Peter McDermott verzog sein kantiges, verärgertes Gesicht zu einem süffisanten Grinsen. »Überall. In der elften Etage beschwert sich jemand über eine Art Orgie; die Herzogin von Croydon in der neunten beklagt sich über einen Zimmerkellner, der angeblich ihren Herzog beleidigt hat; in 1439 stöhnt jemand so laut, dass seine Nachbarn nicht schlafen können; der Nachtmanager ist krankgeschrieben, der Hausdetektiv treibt sich Gott weiß wo rum, und seine beiden Leute sind anderweitig beschäftigt.«
Er sprach wieder ins Telefon, und Christine ging zurück zum Fenster, das sich im ersten Stock befand. Sie bog den Kopf leicht zurück, um die Augen vor dem Zigarettenrauch zu schützen, und blickte abwesend hinaus auf die Stadt. Durch eine breite Schlucht, die sich unmittelbar vor ihr zwischen hochragenden Gebäuden auftat, konnte sie in das enge, von Menschen wimmelnde Französische Viertel hineinsehen. Eine Stunde vor Mitternacht war für diese Gegend noch früh am Abend; die Lampen vor den Nachtclubs, Bistros, Jazzkellern und Striptease-Lokalen – und die Lichter hinter den heruntergelassenen Jalousien – würden bis weit in den nächsten Morgen hinein brennen.
Irgendwo im Norden, vermutlich über dem See Pontchartrain, braute sich im nächtlichen Dunkel ein Sommergewitter zusammen. Mit dumpfem Grollen und Wetterleuchten kam es näher. Wenn sie Glück hatten und das Unwetter nach Süden zum Golf von Mexiko zog, würde es vielleicht noch vor dem Morgen regnen.
Der Regen wäre eine Wohltat, dachte Christine. Seit drei Wochen lag New Orleans im Bann schwüler, lähmender Hitze, die an den Nerven zerrte, Spannungen erzeugte und Unfrieden stiftete. Auch für das Hotel wäre er eine Entlastung. Erst am Nachmittag hatte der Chefingenieur wieder einmal seinem Kummer Luft gemacht. »Wenn ich die Klimaanlage noch lange auf vollen Touren laufen lassen muss, kann ich für nichts mehr garantieren.«
Peter McDermott legte den Hörer auf, und Christine fragte: »Wissen Sie, wie der Gast heißt, der so schrecklich stöhnt?«
Er schüttelte den Kopf und griff erneut nach dem Hörer. »Nein, aber ich kann mich erkundigen. Wahrscheinlich war’s nur ein Albtraum, aber wir wollen doch lieber mal nachsehen.«
Als sich Christine in einen tiefen Ledersessel vor dem großen Mahagonischreibtisch sinken ließ, merkte sie plötzlich, wie müde sie war. Sonst war sie um diese Zeit schon längst daheim in ihrer Wohnung in Gentilly. Aber es war ein ungewöhnlich arbeitsreicher Tag gewesen, da nicht nur eine Menge regulärer Gäste, sondern auch die Teilnehmer zweier Kongresse eingetroffen waren, und viele der auftretenden Schwierigkeiten hatte sie schließlich selbst lösen müssen.
»Das wär’s, danke.« McDermott machte sich eine Notiz und legte den Hörer auf. »Der Name ist Albert Wells aus Montreal.«
»Dann kenne ich ihn«, sagte Christine. »Ein netter kleiner Mann, der jedes Jahr herkommt. Wenn Sie wollen, kümmere ich mich um ihn.«
Er betrachtete unschlüssig ihre zarte, schlanke Gestalt.
Das Telefon schrillte, und er hob den Hörer ab. »Tut mir leid, Sir«, sagte das Mädchen aus der Zentrale, »aber wir können Mr. Ogilvie nirgends finden.«
»Da kann man nichts machen. Geben Sie mir den Concierge.« Wenn er auch den Chefdetektiv nicht hinauswerfen konnte, dachte McDermott, so würde er wenigstens gleich morgen früh ordentlich Krach schlagen. Im Übrigen konnte er ebenso gut jemand anderen mit Nachforschungen in der elften Etage betrauen, und mit der Beschwerde des Herzogs und der Herzogin von Croydon würde er sich selbst befassen.
»Chefportier«, tönte es aus der Hörmuschel, und Peter McDermott erkannte die fade näselnde Stimme von Herbie Chandler. Der Chefportier des St. Gregory gehörte wie Ogilvie zu den langjährigen Angestellten und betrieb angeblich mehr dunkle Nebengeschäfte als irgendjemand sonst vom Personal.
McDermott erklärte Chandler kurz, worum es sich handelte, und beauftragte ihn, der Sache nachzugehen. Es überraschte ihn nicht sonderlich, als der Chefportier protestierte. »Das geht mich nichts an, Mr. Mac, und außerdem kann ich jetzt hier unten nicht weg. Wir haben alle Hände voll zu tun.« Der Tonfall war typisch für Chandler – kriecherisch und unverschämt zugleich.
»Keine Ausreden. Sie werden sich um die Angelegenheit kümmern.« Nachträglich fügte er hinzu: »Und noch eins: Schicken Sie einen Boy mit einem Hauptschlüssel in den ersten Stock zu Miss Francis.« Er legte rasch auf, bevor Chandler antworten konnte.
»Gehen wir.« Er berührte Christines Schulter leicht mit der Hand. »Nehmen Sie den Boy als Leibwache mit, und sagen Sie Ihrem Freund Mr. Wells, wenn er Albträume hat, soll er künftig unter die Bettdecke kriechen.«
2
Herbie Chandler lehnte nachdenklich an seinem Stehpult in der Halle des St. Gregory. Auf seinem Wieselgesicht zeigte sich inneres Unbehagen.
Von seinem Befehlsstand aus, neben einer der kannelierten Betonsäulen, die bis zur reich dekorierten, gewölbten Decke hinaufreichten, hatte er einen ausgezeichneten Überblick über das Kommen und Gehen in der Halle. Im Moment herrschte reger Betrieb. Die Kongressteilnehmer waren den ganzen Abend über auf den Beinen gewesen, und je später es wurde, desto mehr bestärkte sie der konsumierte Alkohol in ihrem Entschluss, sich nach Kräften zu amüsieren.
Während Chandler gewohnheitsmäßig die Augen schweifen ließ, kam eine Gruppe lärmender Zecher von der Carondelet Street herein, drei Männer und zwei Frauen; in den Händen schwenkten sie Schnapsgläser, die sie in Pat O’Briens Bar im Französischen Viertel für einen Dollar pro Stück als Souvenir erstanden hatten. Einer der Männer, der nicht mehr fest auf den Beinen war, musste von den beiden anderen gestützt werden. Alle drei waren Kongressteilnehmer und trugen eine Plakette am Revers mit dem Aufdruck »Cold Crown Cola« und darunter ihren Namen. Als sie im Zickzack durch die Halle steuerten, machten die anderen Gäste gutmütig Platz, bis das schwankende Quintett schließlich in der Bar verschwand.
Noch immer trafen neue Gäste ein – mit den späten Zügen und Verkehrsflugzeugen. In kleinen Gruppen sammelten sie sich vor dem Empfang und wurden dann von Chandlers Boys in ihre Zimmer geführt. Die Bezeichnung »Boy« bezog sich hier allerdings nur auf die Berufsgattung, denn keiner der sogenannten Boys war unter vierzig, und einige der ergrauten Veteranen arbeiteten seit einem Vierteljahrhundert oder noch länger im Hotel.
Herbie Chandler, der in seinem Ressort frei entscheiden konnte, stellte lieber ältere Männer ein. Ein alter Mann, der nur mühsam unter Schnauben und Grunzen mit dem Gepäck zurechtkam, kassierte aller Voraussicht nach größere Trinkgelder als ein junger Bursche, der schwere Koffer auf den Schultern balancierte, als wären sie leicht wie Balsaholz. Einer der langjährigen Angestellten, ein kräftiger, sehniger Kerl, hatte sich einen speziellen Trick ausgedacht. Wenn er vor dem Gast herging, setzte er die Koffer alle paar Meter ab, drückte sich japsend die Hand aufs Herz und schleppte die Last kopfschüttelnd weiter. Der Kniff brachte ihm selten weniger als einen Dollar ein, weil seine zerknirschten Opfer überzeugt waren, dass ihn an der nächsten Ecke ein Herzschlag treffen würde. Was sie nicht wussten, war, dass zehn Prozent aller Trinkgelder in Herbie Chandlers Tasche wanderten und dass jeder Boy ihm außerdem täglich zwei Dollar zahlen musste, wenn er seinen Posten behalten wollte.
Chandlers privates Besteuerungssystem erboste seine Untergebenen, obwohl ein Boy, der seine Sache verstand, es trotzdem auf hundertfünfzig Dollar Reinverdienst in der Woche bringen konnte, wenn das Hotel voll besetzt war. Bei starkem Andrang, wie in dieser Nacht, blieb der Chefportier weit über die normale Dienstzeit auf seinem Posten. Er traute niemandem und zog es vor, selbst ein Auge auf seine Prozente zu haben. Die Genauigkeit, mit der er Gäste und Trinkgelder einschätzte und erriet, wie viel ein Ausflug in die obersten Etagen einbringen würde, war unheimlich. Es gab immer wieder verstockte Individualisten, die Herbie zu betrügen versuchten und ihm einen Teil ihrer Einnahmen unterschlugen. Aber die Strafe ließ nie auf sich warten und erfolgte mit so unfehlbarer, grausamer Treffsicherheit, dass die armen Ketzer schnell zu Kreuze krochen.
Chandlers Ausdauer hatte jedoch in dieser Nacht noch einen anderen Grund. Seine Nervosität hatte seit Peter McDermotts Anruf ständig zugenommen. McDermott hatte ihm befohlen, der Beschwerde in der elften Etage nachzugehen. Aber Chandler brauchte ihr nicht nachzugehen, weil er sich ohnedies so ziemlich vorstellen konnte, was oben los war.
Er selbst hatte die Orgie arrangiert.
Vor etwa drei Stunden hatten zwei junge Burschen ihm ihre diesbezüglichen Wünsche ganz offen mitgeteilt, und da ihre Väter reiche ortsansässige Bürger und gute Kunden des Hotels waren, hatte Herbie respektvoll zugehört. »Also, Herbie«, hatte der eine gesagt, »heute Abend steigt hier der Verbindungsball … der gleiche alte Krampf wie jedes Jahr, und wir möchten gern mal was anderes erleben.«
»Was zum Beispiel?«, hatte er gefragt, obwohl er die Antwort im Voraus wusste.
»Wir haben eine Suite gemietet, und« – der Junge errötete – »wir wollen ein paar Mädchen.«
Herbie entschied sofort, dass die Sache zu riskant war. Die beiden waren Studenten, und außerdem kam es ihm ganz so vor, als hätten sie getrunken. Er schüttelte den Kopf und fing an: »Tut mir leid, meine Herren …« Aber der zweite Junge unterbrach ihn.
»Kommen Sie uns bloß nicht mit dummen Ausreden. Wir wissen doch, dass Sie hier die Gäste mit Callgirls versorgen.«
Chandler zeigte seine Frettchenzähne und verzerrte das Gesicht zu einem gezwungenen Lächeln. »Ich möchte wissen, wer Ihnen das eingeredet hat, Mr. Dixon.«
Der Junge, der zuerst gesprochen hatte, ließ nicht locker. »Wir können zahlen, Herbie, das wissen Sie doch.«
Der Chefportier war noch immer unschlüssig, aber seine Gedanken kreisten gierig um das verlockende Geschäft. Gerade in den letzten Wochen hatte sein Nebenverdienst nachgelassen. Vielleicht war die Sache doch nicht so gefährlich.
»Also los«, sagte der Junge namens Dixon. »Geben Sie sich einen Ruck. Wie viel?«
Herbie musterte die Kunden, dachte an ihre wohlhabenden Väter und multiplizierte den Einheitstarif mit zwei. »Hundert Dollar.«
»Abgemacht«, erklärte Dixon und wandte sich an seinen Kameraden. »Hör zu, Lyle, den Schnaps haben wir schon bezahlt, und was dir zu deinem Anteil fehlt, pump ich dir.«
»Na gut …«
»Gezahlt wird im Voraus, meine Herren.« Herbie fuhr sich mit der Zunge über die dünnen Lippen. »Und noch eins. Machen Sie bloß keinen Lärm. Falls es zu laut wird und die anderen Gäste sich beschweren, kann das sehr unangenehme Folgen haben.«
Vor einer Stunde hatten die Mädchen wie üblich die Halle durch den Haupteingang betreten, und nur ein paar eingeweihte Hotelangestellte hatten gemerkt, dass es sich nicht um reguläre Gäste handelte. Normalerweise hätten die zwei schon längst wieder auf demselben Weg unauffällig verschwunden sein müssen.
Die Beschwerde aus der elften Etage, in der ausdrücklich auf eine Orgie hingewiesen wurde, ließ darauf schließen, dass irgendetwas schiefgegangen war. Aber was? Herbie fiel Dixons Bemerkung über die Schnapsvorräte ein, und ihm wurde noch unbehaglicher zumute.
Trotz der auf Hochtouren laufenden Klimaanlage war es drückend heiß in der Halle, und Herbie zog ein seidenes Taschentuch heraus, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Zugleich verfluchte er insgeheim seinen idiotischen Leichtsinn und fragte sich, ob er hinaufgehen oder sich, in diesem Stadium, nicht lieber vom Schauplatz des Geschehens fernhalten sollte.
3
Peter McDermott fuhr im Lift bis zur neunten Etage. Dort verließ er Christine, die mit dem Boy bis zum vierzehnten Stock fuhr. An der offenen Lifttür blieb er zögernd stehen. »Rufen Sie mich, falls es zu Unannehmlichkeiten kommt.«
Sie lächelte. »Wenn es brenzlig wird, schreie ich laut um Hilfe.« Während die Türen geräuschlos zuglitten, blickte sie ihn einen Moment lang direkt an. Dann schlossen sich die Türen, und der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Peter starrte nachdenklich auf die leere Stelle, wo er eben noch ihr Gesicht gesehen hatte, wandte sich ab und eilte mit großen Schritten durch den mit Teppichen ausgelegten Korridor auf die Präsidentensuite zu.
Die größte und eleganteste Suite des St. Gregory – von den Angestellten auch »Prominentenstall« genannt – hatte im Lauf der Jahre viele distinguierte Gäste beherbergt, darunter auch Präsidenten, Adlige und gekrönte Häupter.
Die meisten Prominenten mochten New Orleans. Die Stadt besaß eine eigene, sympathische Form von Gastlichkeit. Sie begrüßte ihre Gäste – und ließ sie dann tun, was sie wollten. Sie respektierte ihr Privatleben, auch wenn es ein wenig über die Stränge schlagen sollte.
Die gegenwärtigen Bewohner der Präsidentensuite, nicht gerade Staatsoberhäupter, aber doch wichtig genug, um als besondere Gäste gelten zu können, waren der Herzog und die Herzogin von Croydon mit ihrem Gefolge: einem Privatsekretär, der Kammerzofe der Herzogin und fünf Bedlington-Terriern. Peter McDermott blieb vor der doppelt gepolsterten, mit vergoldeten Wappenlilien geschmückten Tür stehen und drückte einen Perlmuttknopf. Er hörte innen den gedämpften Ton des Summers und, Sekunden später, das aufgeregte Gekläff der Hunde. Während er wartete, rief er sich ins Gedächtnis, was er vom Hörensagen und aus eigener Erfahrung über die Croydons wusste. Der Herzog, Nachkomme eines alten Geschlechts, hatte sich mit untrüglichem Gefühl für Popularität den Erfordernissen einer neuen Zeit angepasst. In den letzten zehn Jahren war er, unterstützt von der Herzogin, die selbst eine profilierte Persönlichkeit war und als Verwandte des englischen Königshauses im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand, als Gesandter der britischen Regierung zu besonderer Verwendung immer wieder mit schwierigen und heiklen diplomatischen Missionen betraut worden. In der letzten Zeit waren allerdings ab und zu Gerüchte aufgetaucht, dass die Popularität des Herzogs sich Gebieten zuwandte, die seiner diplomatischen Karriere nicht eben förderlich sein konnten. Man munkelte von einer gewissen Vorliebe für Alkohol und verheiratete Frauen. Andere Gerüchte wollten allerdings wissen, dass solche Vorkommnisse die Aussichten des Herzogs nicht getrübt hätten und dass die energische Herzogin die Situation fest in der Hand hatte. Man sprach sogar davon, die Ernennung des Herzogs von Croydon zum britischen Botschafter in Washington stehe bevor.
»Verzeihen Sie, Mr. McDermott«, murmelte eine Stimme hinter Peters Rücken, »haben Sie einen Moment Zeit für mich?«
McDermott schwenkte herum und erkannte Sol Natchez, einen der älteren Etagenkellner, der lautlos den Korridor heruntergekommen war. Natchez war ein hagerer Mann, leichenhaft blass mit eingefallenen Gesichtszügen. Er trug eine kurze weiße Jacke mit Bordüren in Rot und Gold – den Farben des Hotels. Seine Haare waren mit Pomade geglättet und in einer altmodischen Stirnlocke nach vorn gekämmt. Die fahlen Augen tränten, und die Adern auf seinen dürren Händen, die er nervös knetete, ragten wie Stränge hervor.
»Was gibt’s, Sol?«
Mit einer Stimme, die vor unterdrückter Erregung bebte, sagte der Kellner: »Ich nehme an, Sie sind wegen der Beschwerde hier … der Beschwerde über mich.«
Peter warf einen Blick auf die Tür, die bisher nicht geöffnet worden war. Aus dem Inneren der Suite war außer dem Kläffen der Hunde bisher kein Laut gedrungen. »Erzählen Sie mir schnell, was passiert ist.«
Der Kellner schluckte krampfhaft. Ohne auf die Frage einzugehen, flüsterte er hastig und flehend: »Wenn ich meine Stellung verliere, Mr. McDermott, ist es für mich in meinem Alter schwer, eine neue zu finden.« Er betrachtete die Präsidentensuite mit halb besorgter, halb gehässiger Miene: »Im Allgemeinen komme ich gut mit ihnen aus … aber heute Abend war es wie verhext. Sie sind ziemlich anspruchsvoll, aber das hat mir nie was ausgemacht, obwohl sie keine Trinkgelder geben.«
McDermott musste unwillkürlich lächeln. Angehörige des englischen Adels gaben selten ein Trinkgeld, vielleicht weil sie glaubten, dass die Ehre, sie bedienen zu dürfen, Belohnung genug sei.
»Sie haben mir noch immer nicht gesagt …«
»Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, Mr. McDermott.« Peter war die Zerknirschtheit dieses Mannes, der alt genug war, um sein Großvater zu sein, fast peinlich. »Es ist ungefähr eine halbe Stunde her. Sie hatten ein spätes Nachtmahl bestellt – der Herzog und die Herzogin, meine ich –, Austern, Champagner und Shrimps Creole.«
»Schön, und was ist dann passiert?«
»Es ist bei den Shrimps Creole passiert, Sir. Als ich sie servierte – also, ich weiß selbst nicht, wie es zuging –, in all den Jahren ist mir das kaum jemals passiert …«
»Mein Gott, kommen Sie zur Sache, Sol!« Peter ließ die Tür nicht aus den Augen, um das Gespräch sofort abzubrechen, falls sie sich öffnete.
»Ja, Mr. McDermott. Als ich die Creole servierte, stand die Herzogin vom Tisch auf, und als sie zurücktrat, stieß sie mich am Arm. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie hat es absichtlich getan.«
»Das ist doch absurd!«
»Ich weiß, Sir. Aber das Theater danach …! Es hat nur einen kleinen Fleck gegeben – ich schwöre Ihnen, Sir, er war nicht größer als ein halber Zentimeter – auf dem einen Hosenbein des Herzogs.«
»Und das ist alles?«, fragte Peter zweifelnd.
»Ja. Ich kann beschwören, dass es nicht mehr war, Mr. McDermott. Aber bei dem Theater, das die Herzogin machte, hätte man denken können, ich hätte einen Mord begangen. Ich habe mich entschuldigt und eine saubere Serviette und Wasser geholt, um den Fleck wegzumachen, aber das genügte ihr nicht. Sie wollte unbedingt mit Mr. Trent sprechen …«
»Mr. Trent ist nicht im Hotel.«
Peter beschloss, sich zunächst die Version der anderen Seite anzuhören, bevor er eine Entscheidung fällte. »Wenn Sie für heute fertig sind, gehen Sie am besten nach Hause. Melden Sie sich morgen wie immer zum Dienst. Dann werden Sie erfahren, was weiter geschieht.«
Als der Kellner verschwunden war, drückte Peter McDermott wieder auf die Klingel. Kaum hatten die Hunde von Neuem zu bellen begonnen, als die Tür von einem jungen Mann geöffnet wurde, der ein rundes Gesicht hatte und einen Kneifer auf der Nase trug – dem Sekretär der Croydons.
Bevor einer der beiden etwas äußern konnte, rief eine weibliche Stimme aus dem Inneren der Suite: »Wer immer auch an der Tür ist, sagen Sie ihm, er soll endlich aufhören zu klingeln.« Es war eine Stimme, fand Peter, die trotz ihres herrischen Tonfalls anziehend wirkte und durch ihre raue Klangfülle Interesse erregte.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte er zum Sekretär, »ich dachte, Sie hätten das Klingeln vielleicht nicht gehört.« Er nannte seinen Namen und fügte hinzu: »Man hat mir berichtet, dass die Bedienung Anlass zur Klage gab. Ich kam her, um zu fragen, ob ich Ihnen behilflich sein kann.«
»Wir erwarten Mr. Trent«, antwortete der Sekretär.
»Mr. Trent ist heute Abend nicht im Hotel.«
Während des Gesprächs hatten sich die beiden Männer von der Tür entfernt und standen nun in der Diele, einem mit dicken Teppichen ausgelegten und mit zwei Polstersesseln und einem Tischchen geschmackvoll ausgestatteten Raum. Ein Kupferstich von Morris Henry Hobbs zeigte das alte New Orleans. Am einen Ende der Diele befand sich die Doppeltür zum Korridor, am anderen die Tür zum Salon, die einen Spaltbreit offen stand. Rechts und links führte je eine Tür in die kleine Küche und in ein Schlaf-Wohnzimmer, das gegenwärtig vom Sekretär bewohnt wurde und ihm auch als Büro diente. Die zwei nebeneinanderliegenden Hauptschlafzimmer der Suite waren sowohl durch die Küche als auch durch den Salon zu erreichen, eine wohlüberlegte Anordnung des Architekten, die es heimlichen Schlafzimmerbesuchern ermöglichte, notfalls durch die Küche herein- und hinauszuschlüpfen.
»Warum kann man ihn nicht holen lassen?« Die Herzogin war in der Tür zum Salon aufgetaucht, drei wild kläffende Terrier auf den Fersen, und schoss die Frage auf Peter ab, ohne sich mit Vorreden aufzuhalten. Mit einem Fingerschnippen, das sofortigen Gehorsam erzwang, brachte sie die Hunde zum Schweigen und richtete ihren Blick forschend auf Peter. Er betrachtete das wohlgeformte Gesicht mit den hohen Wangenknochen, das ihm von zahllosen Fotos her vertraut war, und bemerkte, dass die Herzogin auch in salopper Kleidung ihre Eleganz nicht verleugnete.
»Offen gestanden, Eure Hoheit, wusste ich nicht, dass Sie Mr. Trent persönlich verlangt hatten.«
Graugrüne Augen musterten ihn abschätzend. »Wenn Mr. Trent schon nicht da ist, hätte ich wenigstens seinen Stellvertreter erwartet und nicht einen jungen Mann.«
Peter errötete unwillkürlich. Die Haltung der Herzogin von Croydon war von einer erhabenen Arroganz, die seltsamerweise etwas Anziehendes hatte. Peter fiel dabei ein Foto ein, das er in einer Illustrierten gesehen hatte. Es zeigte die Herzogin, wie sie auf einem Hengst über ein hohes Gatter setzte. Unter Nichtachtung jeder Gefahr hatte sie alles vollkommen unter Kontrolle. Bei der Erinnerung daran überkam ihn das Gefühl, als wäre er in diesem Moment zu Fuß und die Herzogin hoch zu Ross.
»Ich bin stellvertretender Direktor. Deshalb bin ich selbst gekommen.«
In ihren Augen schimmerte es belustigt auf. »Sind Sie nicht noch ein bisschen jung für solch einen Posten?«
»Nicht unbedingt. Heutzutage haben viele junge Männer leitende Posten in der Hotelbranche inne.« Er stellte fest, dass sich der Sekretär diskret zurückgezogen hatte.
»Wie alt sind Sie?«
»Zweiunddreißig.«
Die Herzogin lächelte. Wenn sie wollte – wie jetzt –, strahlte ihr Gesicht bezaubernde Wärme aus. Dann war ihr viel gerühmter Charme nicht zu übersehen. Sie mochte fünf oder sechs Jahre älter sein als er, aber um einiges jünger als der Herzog, der fast fünfzig war. Nun fragte sie: »Haben Sie einen Kurs besucht oder so etwas?«
»Ich habe das Diplom der Cornell-Universität – der Hotelfachhochschule. Bevor ich hierherkam, war ich stellvertretender Direktor des Waldorf.« Es kostete ihn Überwindung, das Waldorf zu erwähnen, und fast hätte er hinzugefügt: wo man mich mit Schimpf und Schande davongejagt hat, sodass ich jetzt auf der schwarzen Liste aller Hotelkonzerne stehe und froh sein kann, dass ich hier, in einem konzernfreien Haus, unterkriechen konnte. Aber natürlich sagte er nichts dergleichen, denn mit seiner privaten Hölle musste er allein fertig werden, auch dann, wenn jemand mit seinen Fragen unwissentlich alte, kaum verheilte Wunden wieder aufriss.
»Das Waldorf hätte einen Zwischenfall wie den von heute Abend nie geduldet«, entgegnete sie.
»Falls wir im Unrecht sind, Eure Hoheit, kann ich Ihnen versichern, dass auch das St. Gregory so etwas nicht durchgehen lässt.«
»Falls Sie im Unrecht sind? Ist Ihnen eigentlich klar, dass der Kellner meinem Mann die Shrimps Creole über den Anzug geschüttet hat?«
Das war so offensichtlich eine Übertreibung, dass er sich verblüfft fragte, was die Herzogin eigentlich damit bezweckte. Es fiel auch völlig aus dem Rahmen des Üblichen, denn bisher waren die Beziehungen zwischen dem Hotel und den Croydons ausgezeichnet gewesen.
»Ich weiß, dass es eine kleine Panne gegeben hat, die vermutlich auf eine Unachtsamkeit des Kellners zurückzuführen ist. Und ich bin gekommen, um mich im Namen des Hotels zu entschuldigen.«
»Der ganze Abend wurde uns durch diese ›kleine Panne‹ verdorben. Mein Mann und ich wollten ihn hier in der Suite verbringen – ganz für uns allein. Wir machten nur einen kurzen Gang ums Viertel und freuten uns aufs Dinner, und dann passierte das!«
Peter nickte mitfühlend und ohne sich seine Verwunderung über die Haltung der Herzogin anmerken zu lassen. Es hatte fast den Anschein, als wollte sie ihm den Zwischenfall fest ins Gedächtnis einprägen.
Er sagte: »Könnte ich vielleicht auch dem Herzog unser Bedauern über …«
»Das ist nicht nötig«, erwiderte die Herzogin entschieden.
Er war im Begriff, sich zu verabschieden, als die Tür zum Salon, die angelehnt gewesen war, sich vollends öffnete und der Herzog auf der Schwelle erschien.
Er war nachlässig gekleidet und trug nur ein zerknittertes weißes Oberhemd und Smokinghosen. Instinktiv suchte Peter nach den Spuren der Shrimps Creole, die Natchez, wie die Herzogin behauptete, über den Anzug ihres Mannes geschüttet hatte. Er entdeckte einen kaum wahrnehmbaren Fleck, so winzig, dass der Kellner ihn sofort hätte entfernen können. Hinter dem Herzog, an einer Wand des Salons, flimmerte der Bildschirm des eingeschalteten Fernsehapparats.
Das Gesicht des Herzogs war gerötet und faltig und wirkte älter als auf seinen letzten Fotos. Er hielt ein Glas in der Hand, und seine Stimme klang verschwommen. »Oh, Verzeihung! Hör mal, altes Mädchen!«, sagte er zur Herzogin gewandt, »ich muss meine Zigaretten im Wagen liegen gelassen haben.«
Sie erwiderte scharf: »Ich bringe dir welche.« Ihr Ton war schroff abweisend. Der Herzog machte mit einem Nicken kehrt und verschwand im Salon. Der kurze Wortwechsel hatte etwas seltsam Beklemmendes und schien den Zorn der Herzogin aus unerfindlichen Gründen noch stärker anzufachen.
»Ich bestehe darauf, dass Mr. Trent ein ausführlicher Bericht zugeht«, fauchte sie, »und ich erwarte, dass er sich persönlich bei uns entschuldigt.«
Verdutzter als zuvor trat Peter den Rückzug an, und er war kaum draußen, als die Tür hinter ihm energisch geschlossen wurde.
Zum Nachdenken blieb ihm jedoch keine Zeit. Auf dem Korridor wartete der Boy, der Christine in die vierzehnte Etage begleitet hatte. »Mr. McDermott«, sagte er eindringlich, »Miss Francis braucht Sie in der Nummer 1439. Kommen Sie bitte, schnell!«
4
Etwa eine Viertelstunde früher, während sie zum vierzehnten Stock hochfuhren, sagte der Boy grinsend zu Christine: »Sie spielen wohl ein bisschen Detektiv, Miss Francis?«
»Wenn der Hausdetektiv da wäre, könnte ich mir das sparen«, antwortete Christine.
Der Boy, Jimmy Duckworth, ein untersetzter Mann mit beginnender Glatze und einem verheirateten Sohn, der in der Buchhaltung des St. Gregory arbeitete, machte nur verächtlich: »Ach, der!« Gleich darauf hielt der Lift.
»Es ist Nummer 1439, Jimmy«, sagte Christine, und ganz automatisch schwenkten beide nach rechts. Sie waren mit dem Grundriss des Hotels vertraut, wenn auch auf sehr verschiedene Weise; der Boy hatte sich diese Sicherheit erworben, indem er jahraus, jahrein Gäste aus der Halle in ihre Zimmer führte, Christines Ortskenntnis beruhte auf einer Serie geistiger Bilder, die sich ihr beim Studium des Hotelplans mit seinen einzelnen Stockwerken eingeprägt hatten.
Falls jemand vor fünf Jahren an der Universität von Wisconsin die Frage gestellt hätte, womit sich die zwanzigjährige Chris Francis, eine begabte Studentin mit einer Vorliebe für moderne Sprachen, später wohl beschäftigen würde, dann wäre selbst die ausschweifendste Phantasie nicht darauf verfallen, dass sie als Direktionsassistentin in einem Hotel von New Orleans landen könnte. Zu jener Zeit kannte sie die mondsichelförmige Stadt kaum und interessierte sich denkbar wenig für sie. Sie hatte in der Schule im Geschichtsunterricht den Erwerb von Louisiana durchgenommen und sich »Endstation Sehnsucht« angesehen. Aber sogar das Theaterstück war überholt, als sie nach New Orleans kam. Die »Desire«-Straßenbahnlinie hatte einem Dieselbus Platz gemacht, und »Desire« war ein unbedeutendes Viertel im Osten der Stadt, das Touristen selten aufsuchten.
Vermutlich war es in gewisser Weise gerade die völlig fremde Umgebung, die sie nach New Orleans zog. Nach der Katastrophe in Wisconsin hatte sie dumpf und fast planlos nach einem Fleck Ausschau gehalten, wo man sie nicht kannte und der auch für sie neu war. Vertraute Dinge, ihre Berührung, ihr Anblick und ihr Klang, verursachten einen Herzschmerz, der sie ganz durchdrang, ihre Tage erfüllte und sie sogar bis in den Schlaf verfolgte. Seltsamerweise – und damals schämte sie sich dessen beinahe – litt sie nie unter Albträumen; sie sah nur immer wieder die Geschehnisse vor sich, so, wie sie sich an jenem denkwürdigen Tag auf dem Madison-Flughafen vor ihren Augen abgespielt hatten. Sie hatte ihre Familie, die einen Europatrip plante, dorthin begleitet; ihre Mutter, fröhlich und aufgeregt und geschmückt mit einer Orchidee, die eine Freundin ihr zum Abschied übersandt hatte; ihren Vater, entspannt und überaus zufrieden darüber, dass die wirklichen und eingebildeten Leiden seiner Patienten einen Monat lang jemand anderen auf Trab halten würden. Er hatte seine Pfeife am Schuh ausgeklopft, als die Maschine ausgerufen wurde. Babs, ihre ältere Schwester, hatte Christine umarmt; und sogar Tony, zwei Jahre jünger und öffentlichen Gefühlsergüssen abgeneigt, ließ sich gnädig küssen.
»Auf Wiedersehen, Stubbs!«, hatten Babs und Tony gerufen, und Christine hatte über den alten kindischen Spitznamen gelächelt. Und alle hatten versprochen, ihr zu schreiben, obwohl sie zwei Wochen später, nach dem Semesterende, in Paris wieder mit ihnen zusammentreffen sollte. Ganz zum Schluss hatte ihre Mutter sie fest an sich gedrückt und gesagt, sie solle gut auf sich achtgeben. Dann war das große Flugzeug zur Startbahn gerollt und hatte mit einem Dröhnen majestätisch vom Boden abgehoben. Aber es hatte noch nicht richtig an Höhe gewonnen, da sackte es mit einem herabhängenden Flügel ab, wurde zu einem wirbelnden, purzelnden Katharinenrad, dann einen Moment lang zu einer Staubwolke, flammte auf wie eine brennende Fackel und war schließlich nur noch ein Haufen weit verstreuter Trümmer – von Metallteilen und menschlichen Überresten.
Das war vor fünf Jahren passiert. Einige Wochen nach dem Unglück hatte sie Wisconsin verlassen und war nie mehr dorthin zurückgekehrt.
Christine und der Boy gingen den Korridor entlang, und der dicke Läufer dämpfte das Geräusch ihrer Schritte. Jimmy Duckworth dachte laut nach. »Nummer 1439 – das ist doch der alte Herr, Mr. Wells. Vor ein paar Tagen haben wir ihn aus einem Eckzimmer dorthin umquartiert.«
Einige Meter weiter öffnete sich eine Tür, und ein gut gekleideter Mann Mitte vierzig trat auf den Korridor. Er machte die Tür hinter sich zu und war im Begriff, den Schlüssel einzustecken, zögerte aber, als er Christine erblickte, und musterte sie mit unverhohlenem Interesse. Als er zum Sprechen ansetzte, schüttelte der Boy fast unmerklich den Kopf. Christine, der das stumme Gebärdenspiel nicht entgangen war, dachte, dass sie sich eigentlich geschmeichelt fühlen müsste, für ein Callgirl gehalten zu werden. Sie wusste vom Hörensagen, dass sich unter Herbie Chandlers Damen einige außerordentlich schöne Mädchen befanden.
Im Weitergehen fragte sie: »Warum hat man Mr. Wells umquartiert?«
»Wie ich hörte, Miss, hat der Gast, der die Nummer 1439 vorher hatte, Krach geschlagen, und da haben sie die Zimmer einfach getauscht.«
Christine erinnerte sich nun wieder an die Nummer 1439; es hatte schon öfter Beschwerden über dieses Zimmer gegeben. Es lag unmittelbar neben dem Personalaufzug und war anscheinend Treffpunkt sämtlicher Rohrleitungen. Infolgedessen war es sehr laut und unerträglich heiß. Fast in jedem Hotel gab es mindestens einen solchen Raum – bei manchen hieß er die Folterkammer –, und im Allgemeinen wurde er nur dann vergeben, wenn das Hotel bis zum letzten Platz belegt war.
»Wenn Mr. Wells ein besseres Zimmer hatte, warum hat man ihn dann gebeten umzuziehen?«
Der Boy zuckte mit den Schultern. »Das sollten Sie lieber die Mitarbeiter am Empfang fragen.«
Sie gab nicht nach. »Aber Sie haben sich doch sicher Ihre Gedanken gemacht.«
»Tja, also ich glaube, es liegt daran, weil er sich nie beschwert. Der alte Herr kommt seit Jahren her und hat noch nie auch nur einen Mucks gesagt. Und es gibt welche, die scheinen sich einen Spaß daraus zu machen.« Christine presste ärgerlich die Lippen zusammen, als Jimmy hinzufügte: »In der Küche habe ich gehört, dass sie ihm unten im Speiserestaurant den Tisch direkt neben der Küchentür angewiesen haben, den sonst niemand haben will. Dem macht’s ja nichts aus, sagen sie.«
Morgen früh würde es einigen Leuten sehr viel ausmachen; dafür würde sie sorgen, dachte Christine grimmig. Als sie sich vorstellte, wie schäbig ein Stammgast, nur weil er ein ruhiger und friedlicher Mensch war, behandelt worden war, spürte sie, wie es in ihr kochte. Und wenn schon! Ihre Temperamentsausbrüche waren im Hotel nicht unbekannt, und einige schrieben sie, wie sie sehr wohl wusste, ihrem roten Haar zu. Im Allgemeinen nahm sie sich sehr zusammen. Aber gelegentlich hatte ein solches Donnerwetter auch sein Gutes, weil es die Schuldigen zum Handeln zwang.
Sie bogen um eine Ecke und machten vor der Nummer 1439 halt. Der Boy klopfte an die Tür. Sie warteten und lauschten. Niemand antwortete, und Jimmy Duckworth klopfte noch einmal und kräftiger als vorher. Diesmal meldete sich der Bewohner sofort – mit einem unheimlichen Stöhnen, das leise begann, anschwoll und unvermittelt abbrach.
»Den Hauptschlüssel, schnell!«, drängte Christine. »Machen Sie die Tür auf!«
Sie blieb zurück, während der Boy hineinging; selbst in einer so offenkundigen Notlage musste die vom Hotel vorgeschriebene Etikette gewahrt werden. Im Zimmer war es dunkel; Duckworth knipste das Licht an und verschwand aus Christines Blickfeld. Gleich darauf rief er beschwörend: »Kommen Sie schnell, Miss Francis!«
Als sie den Raum betrat, empfing sie eine erstickende Hitze, obwohl der Schalter der Klimaanlage, wie sie mit einem Blick feststellte, auf »Kalt« zeigte. Zu weiteren Beobachtungen fehlte ihr die Zeit, denn ihre Aufmerksamkeit wurde völlig in Anspruch genommen von der röchelnden Gestalt, die halb aufgerichtet in den Kissen lehnte. Das Gesicht des vogelähnlichen kleinen Mannes war aschgrau; mit hervorquellenden Augen und zitternden Lippen rang er verzweifelt nach Atem.
Christine trat rasch ans Bett. Vor Jahren hatte sie im Sprechzimmer ihres Vaters einen Patienten bei einem Erstickungsanfall erlebt. Sie konnte zwar nicht alles tun, was ihr Vater damals getan hatte, aber an eine Maßnahme erinnerte sie sich noch genau. »Öffnen Sie das Fenster«, befahl sie Duckworth. »Wir brauchen hier drinnen unbedingt Luft.«
Die Augen des Boys klebten am Gesicht des keuchenden alten Mannes. Er erwiderte nervös: »Das Fenster ist versiegelt. Wegen der Klimaanlage.«
»Dann brechen Sie es auf. Schlagen Sie meinetwegen die Scheibe ein, wenn es nicht anders geht.«
Auf dem Nachttisch stand ein Telefon. Sie griff nach dem Hörer, und als sich die Zentrale meldete, sagte sie: »Hier ist Miss Francis. Ist Doktor Aarons im Hotel?«
»Nein, Miss Francis, aber er hat eine Telefonnummer hinterlassen, unter der ich ihn erreichen kann, wenn es sich um einen dringenden Fall handelt.«
»Der Fall ist sehr dringend. Sagen Sie Doktor Aarons, wir brauchen ihn auf Zimmer 1439, und er möchte sich bitte beeilen. Fragen Sie ihn, wann er frühestens im Hotel sein kann, und rufen Sie mich hier an.«
Sie legte auf und wandte sich wieder dem Bett zu. Der schmächtige, gebrechliche Mann rang noch immer krampfhaft nach Luft, und sie bemerkte, wie sein fahles Gesicht allmählich blau wurde. Das Stöhnen begann von Neuem; es wurde von den Atembeschwerden verursacht, aber Christine erkannte, dass sich die schwache Widerstandskraft des Kranken vor allem durch seine verzweifelten körperlichen Anstrengungen erschöpfte.
»Mr. Wells«, sagte sie und versuchte ein Gefühl der Zuversicht zu übermitteln, das sie keineswegs empfand, »ich glaube, Sie können besser atmen, wenn Sie ganz still liegen.« Erleichtert stellte sie fest, dass der Boy am Fenster Fortschritte machte. Er hatte mit einem Kleiderbügel das Siegel an der Verriegelung entfernt und stemmte nun den unteren Teil des Fensters Zentimeter für Zentimeter hoch.
Wie als Antwort auf Christines beruhigende Worte ließ das Keuchen des kleinen Mannes nach. Er hatte ein altmodisches Flanellnachthemd an, und als Christine einen Arm um ihn legte, spürte sie unter dem groben Stoff seine knochigen Schultern. Sie stopfte ihm die Kissen so in den Rücken, dass er, von ihnen gestützt, fast aufrecht sitzen konnte. Seine sanften Rehaugen sahen sie an und versuchten, ihr seine Dankbarkeit auszudrücken. »Ich habe einen Arzt benachrichtigt«, sagte sie tröstend. »Er muss jeden Moment kommen.« Währenddessen unternahm der Boy keuchend eine letzte Kraftanstrengung, der Verschluss gab plötzlich nach, und das Fenster glitt weit auf. Ein Schwall kühler Luft drang ins Zimmer. Das Unwetter war also doch auf dem Weg nach Süden, dachte Christine dankbar; es trieb eine frische Brise vor sich her, und die Außentemperatur musste niedriger sein als seit Tagen. Das Telefon läutete. Sie bedeutete dem Boy durch ein Zeichen, ihren Platz am Bett des Kranken einzunehmen, und hob den Hörer ab.
»Doktor Aarons ist auf dem Weg ins Hotel, Miss Francis«, sagte das Mädchen aus der Zentrale. »Er war in Paradis, und ich soll Ihnen ausrichten, dass er in zwanzig Minuten eintreffen wird.« Christine überlegte. Paradis lag jenseits des Mississippi, noch hinter Algiers. Selbst ein schneller und geschickter Fahrer würde die Strecke kaum in zwanzig Minuten schaffen. Außerdem zweifelte sie manchmal an der Kompetenz des behäbigen, trinkfesten Dr. Aarons, der als Hausarzt umsonst im Hotel wohnte und dafür stets verfügbar sein musste. »Ich glaube nicht, dass wir so lange warten können«, sagte sie zu dem Mädchen. »Schauen Sie doch mal nach, ob wir unter den Gästen einen Arzt haben.«
»Das habe ich schon getan.« Die Antwort klang eine Spur zu selbstgefällig, so als habe das Mädchen zu viele Geschichten über heldenhafte Telefonistinnen gelesen und sich vorgenommen, den leuchtenden Vorbildern nachzueifern. »In der Nummer 221 wohnt ein Doktor Koenig und in der 1203 ein Doktor Uxbridge.«
Christine notierte sich die Nummern auf einem Block, der neben dem Apparat lag. »Schön, dann verbinden Sie mich bitte mit der 221.« Ärzte, die in Hotels abstiegen, erwarteten zu Recht, dass man ihr Privatleben respektierte. Aber im Notfall durfte man sich schon mal über das Protokoll hinwegsetzen.
Es klickte ein paarmal in der Leitung, während der Apparat am anderen Ende läutete. Dann meldete sich eine verschlafene Stimme mit deutschem Akzent: »Ja, wer ist da?«
Christine stellte sich vor. »Verzeihen Sie die Störung, Doktor Koenig, aber einer unserer Gäste ist schwer erkrankt.« Ihr Blick schweifte zum Bett hinüber. Die beängstigende Blaufärbung des Gesichtes war verschwunden. Aber der kleine Mann war noch immer leichenblass und atmete mühsam wie zuvor. Sie fügte hinzu: »Es wäre sehr freundlich, wenn Sie herüberkommen könnten.«
Eine kurze Pause trat ein. Dann erwiderte dieselbe Stimme liebenswürdig: »Junge Dame, ich wäre nur zu glücklich, Ihnen einen wenn auch noch so bescheidenen Dienst erweisen zu können. Aber ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen.« Er schmunzelte hörbar. »Sehen Sie, ich bin Doktor der Musik und in Ihre wunderschöne Stadt gekommen, um als Gastdirigent – das ist, glaube ich, das richtige Wort – Ihr ausgezeichnetes Sinfonieorchester zu leiten.«
Trotz ihrer Besorgnis hätte Christine fast gelacht. Sie entschuldigte sich. »Es tut mir leid, dass ich Sie im Schlaf gestört habe.«
»Bitte, nehmen Sie sich das nicht zu Herzen. Sollte auch die andere Sorte Doktoren Ihrem unglücklichen Gast nicht mehr helfen können, dann könnte ich natürlich mit meiner Geige hinüberkommen und für ihn spielen.« Ein tiefer Seufzer kam durch die Leitung. »Gibt es einen schöneren Tod, als bei einem Adagio von Vivaldi oder Tartini sanft zu entschlafen?«
»Vielen Dank. Ich hoffe, das wird nicht nötig sein.« Sie legte auf und verlangte ungeduldig die nächste Verbindung.
Dr. Uxbridge in der Nummer 1203 meldete sich sofort mit einer Stimme, der jede Alberei fernlag. Christines erste Frage beantwortete er kurz und sachlich: »Ja, ich bin Arzt – Internist.« Er hörte sich Christines Erklärungen kommentarlos an und sagte dann knapp: »Gut, in ein paar Minuten bin ich bei Ihnen.«
Der Boy stand noch neben dem Bett. Christine befahl ihm: »Mr. McDermott ist in der Präsidentensuite. Warten Sie dort und bitten Sie ihn, so schnell wie möglich herzukommen.« Sie griff wieder nach dem Telefonhörer. »Den Chefingenieur, bitte.«
Zum Glück war der Chefingenieur fast immer zu erreichen. Doc Vickery war Junggeselle, wohnte im Hotel und hatte nur eine einzige Leidenschaft: die technischen Eingeweide des St. Gregory in ihrer gesamten Ausdehnung vom Keller bis unters Dach. Seit einem Vierteljahrhundert, seit er der See und seinem heimatlichen Clydeside Ade gesagt hatte, beaufsichtigte er die Installationsanlagen des Hotels, und in mageren Zeiten, wenn das Geld für Ersatzteile knapp war, verstand er es, den abgenutzten Maschinen Sonderleistungen abzuschmeicheln. Der Chefingenieur war ein Freund von Christine, und sie wusste, dass sie zu seinen Lieblingen zählte. Nach wenigen Sekunden hörte sie seine Stimme mit ihrem rauen schottischen Akzent. »Aye?«
In wenigen Worten berichtete sie ihm über die Erkrankung von Albert Wells. »Der Doktor ist noch nicht da. Aber er wird wahrscheinlich Sauerstoff brauchen. Wir haben doch ein tragbares Gerät im Hotel, nicht wahr?«
»Aye, wir haben Sauerstoffzylinder, Chris, aber wir verwenden sie bloß beim Schweißen.«
»Sauerstoff ist Sauerstoff«, antwortete sie. Einiges von dem, was sie bei ihrem Vater aufgeschnappt hatte, fiel ihr allmählich wieder ein. »Die Verpackung spielt keine Rolle. Könnten Sie einen Mann von Ihrer Nachtschicht mit allem Notwendigen heraufschicken?«
Der Chefingenieur brummte zustimmend. »Natürlich, und ich mache mich auf den Weg, sobald ich in meine Hose geschlüpft bin. Sonst kommt noch irgend so ein Witzbold auf die Idee, dem alten Mann einen Pott mit Acetylen unter die Nase zu halten, und das würde ihm bestimmt den Rest geben.«
»Bitte beeilen Sie sich.« Sie legte auf und beugte sich übers Bett.
Die Augen des kleinen Mannes waren geschlossen. Jetzt, da er nicht mehr nach Luft rang, schien er überhaupt nicht mehr zu atmen.
Es klopfte leicht an die halb geöffnete Tür, und ein hochgewachsener, hagerer Mann kam herein. Er hatte ein eckiges Gesicht, und sein Haar war an den Schläfen ergraut. Unter dem konservativen dunkelblauen Anzug kam ein beigefarbener Pyjama zum Vorschein. »Ich bin Doktor Uxbridge.« Die Stimme des Arztes strahlte Ruhe und Sicherheit aus.
»Herr Doktor, er hat eben erst …«
Dr. Uxbridge nickte und entnahm seiner Ledertasche, die er aufs Bett stellte, ein Stethoskop. Ohne Zeit zu verlieren, schob er es unter das Flanellnachthemd des Patienten und horchte rasch Brust und Rücken ab. Dann nahm er mit schnellen, sicheren Bewegungen eine Spritze aus der Tasche, setzte sie zusammen und brach den Hals einer kleinen Ampulle ab. Nachdem er die Spritze gefüllt hatte, beugte er sich über den Kranken, schob einen Ärmel des Nachthemdes hoch und drehte ihn zu einer provisorischen Aderpresse zusammen. »Halten Sie das fest und ziehen Sie es eng zusammen«, sagte er zu Christine.
Mit alkoholgetränkter Watte tupfte er die Haut über der Vene ab und stach die Nadel in den Unterarm. Er wies mit dem Kopf auf die Aderpresse. »Sie können jetzt loslassen.« Dann, nach einem Blick auf seine Uhr, begann er, die Flüssigkeit langsam zu injizieren.
Christines Blick heftete sich fragend auf das Gesicht des Arztes. Ohne aufzusehen, erklärte er: »Aminophyllin, es soll das Herz anregen.« Er blickte wieder auf die Uhr und erhöhte die Dosierung nach und nach. Eine Minute verstrich. Zwei Minuten. Die Spritze war zur Hälfte geleert. Bisher zeigte sich keine Wirkung.
»Was fehlt ihm eigentlich?«, flüsterte Christine.
»Schwere Bronchitis in Verbindung mit Asthma. Ich vermute, er hat diese Anfälle schon früher gehabt.«
Plötzlich dehnte sich die Brust des kleinen Mannes. Sie hob und senkte sich, langsamer als vorher, aber in vollen, tiefen Atemzügen. Er schlug die Augen auf.
Die Anspannung im Raum ließ nach. Der Arzt zog die Spritze heraus und nahm sie auseinander.
»Mr. Wells«, sagte Christine. »Mr. Wells, können Sie mich hören?«
Er nickte mehrmals hintereinander und sah sie aufmerksam an.
»Wir fanden Sie sehr krank vor, Mr. Wells. Das ist Doktor Uxbridge, ein Hotelgast, den wir um Hilfe baten.«
Der Blick des Kranken wanderte zum Arzt hinüber. »Danke«, flüsterte er mühsam. Es war fast ein Keuchen und das erste Wort, das er hervorbrachte. Sein Gesicht bekam allmählich wieder ein wenig Farbe.
»Wenn jemand Dank verdient, dann diese junge Dame.« Der Arzt verzog sein Gesicht zu einem knappen Lächeln und sagte dann zu Christine: »Der Herr ist noch immer sehr schwach und benötigt auch weiterhin ärztliche Betreuung. Mein Rat wäre, ihn sofort in ein Krankenhaus zu überführen.«
»Nein, nein! Das möchte ich nicht!«, kam es hastig und eindringlich vom Bett her. Der kleine Mann beugte sich in den Kissen vor, mit unruhigem Blick, und seine Arme, die Christine vorhin zugedeckt hatte, lagen nun auf der Decke. Er atmete noch immer keuchend und mit Anstrengung, aber die akute Gefahr war vorüber.
Christine hatte zum ersten Mal Zeit, sein Äußeres genau zu betrachten. Ursprünglich hatte sie ihn auf Anfang sechzig geschätzt; aber nun revidierte sie ihre Annahme und fügte ein halbes Dutzend Jahre hinzu. Er war von Gestalt schmächtig, und seine geringe Größe sowie seine abgemagerten, spitzen Gesichtszüge und die ein wenig eingefallenen Schultern gaben ihm das sperlinghafte Aussehen, dessen sie sich von früheren Begegnungen her erinnerte. Die spärlichen grauen Haarsträhnen, sonst ordentlich zurückgekämmt, waren jetzt zerzaust und feucht von Schweiß. Auf seinem Gesicht lag meistens ein milder, harmloser, fast flehender Ausdruck, und dennoch spürte Christine die darunter verborgene stille Beharrlichkeit.
Ihre erste Begegnung mit Albert Wells hatte vor zwei Jahren stattgefunden. Er war schüchtern ins Verwaltungsbüro gekommen, tief beunruhigt über eine Unstimmigkeit in seiner Rechnung, über die er sich mit der Kasse nicht hatte einigen können. Es handelte sich um einen Betrag von 75 Cent, und während sich der Hauptkassierer bereit erklärt hatte, den Posten ganz zu streichen – wie es gewöhnlich geschah, wenn Gäste geringfügige Beträge anzweifelten –, ging es Albert Wells darum, zu beweisen, dass der Posten auf seiner Rechnung überhaupt nichts zu suchen hatte. Nach einigen geduldigen Befragungen stellte Christine fest, dass der alte Mann recht hatte, und da sie selbst gelegentlichen Anwandlungen von Sparsamkeit unterworfen war, die allerdings jedes Mal von Ausbrüchen wilder weiblicher Extravaganz abgelöst wurden, sympathisierte sie mit dem kleinen Mann und achtete ihn angesichts seiner Charakterstärke. Außerdem schloss sie aus seiner Hotelrechnung, die sich in bescheidenen Grenzen hielt, und aus seiner Kleidung, die offensichtlich von der Stange kam, dass er nur über geringe Mittel verfügte, vielleicht als Rentner lebte, und dass die jährlichen Besuche in New Orleans Höhepunkte in seinem Dasein waren.
»Ich mag Krankenhäuser nicht«, erklärte Albert Wells. »Hab sie nie gemocht.«
»Falls Sie hierbleiben«, wandte der Arzt ein, »brauchen Sie regelmäßige ärztliche Betreuung und wenigstens für die nächsten vierundzwanzig Stunden eine Pflegerin. Und eigentlich müssten Sie auch ab und zu Sauerstoff bekommen.«
Der kleine Mann ließ nicht locker. »Für die Pflegerin kann doch das Hotel sorgen. Sie können das, Miss, nicht wahr?«
»Ich denke schon.« Albert Wells’ Abneigung gegen Krankenhäuser war anscheinend im Augenblick sogar stärker als seine natürliche Zurückhaltung und der Wunsch, niemandem zur Last zu fallen. Christine fragte sich allerdings, ob er ahnte, wie kostspielig Privatpflege war.
Sie wurden unterbrochen. In der Tür tauchte ein Mechaniker im Overall auf und schob einen Sauerstoffzylinder auf einem Wägelchen vor sich her. Ihm folgte der stämmige Chefingenieur, der einen kurzen Gummischlauch, Draht und einen Plastikbeutel trug.
»Krankenhausmäßig ist es zwar nicht, Chris«, sagte er, »aber ich schätze, es funktioniert.« Er hatte sich hastig angezogen und trug ein altes Tweedjackett sowie eine Hose; das Hemd war offen und enthüllte ein Stück seiner behaarten Brust. Seine Füße steckten in offenen Sandalen, und unter dem kahlen, gewölbten Schädel saß ihm die breitrandige Brille wie gewöhnlich fast auf der Nasenspitze.
Dr. Uxbridge machte ein erstauntes Gesicht. Christine erklärte ihm, sie habe damit gerechnet, dass Sauerstoff benötigt würde, und stellte den Chefingenieur vor. Dieser nickte, ohne sich bei der Arbeit stören zu lassen, und spähte nur kurz über den Rand seiner Brille. Gleich darauf, nachdem er den Schlauch angeschlossen hatte, verkündete er: »An diesen Plastikbeuteln ist schon ein Haufen Leute erstickt, aber das ist noch kein Grund, warum einer nicht auch mal das Gegenteil bewirken sollte. Was meinen Sie, Doktor, geht es so?«
»Davon bin ich überzeugt.« Dr. Uxbridge war nicht mehr ganz so zugeknöpft wie bisher. Er sah Christine an. »Dieses Hotel scheint einige äußerst tüchtige Mitarbeiter zu haben.«
Sie lachte. »Warten wir’s ab. Wenn wir erst mal Ihre Zimmerreservierungen durcheinandergebracht haben, werden Sie Ihre Meinung bestimmt ändern.«
Der Arzt ging wieder zum Bett zurück. »Der Sauerstoff wird Ihnen Erleichterung verschaffen, Mr. Wells. Diese Bronchialbeschwerden haben Sie vermutlich schon länger.«
Albert Wells nickte. »Die Bronchitis habe ich mir als Grubenarbeiter geholt«, sagte er heiser. »Und später kam dann noch das Asthma dazu.« Seine Augen schweiften zu Christine hinüber. »Mir tut das alles sehr leid, Miss.«
»Ich bin auch traurig, vor allem, weil Sie Ihr Zimmer wechseln mussten.«
Der Chefingenieur hatte währenddessen das andere Ende des Schlauchs an den grün gestrichenen Zylinder angeschlossen. Dr. Uxbridge sagte ihm: »Wir wollen mit fünf Minuten Sauerstoff beginnen und danach fünf Minuten pausieren.« Gemeinsam befestigten sie die improvisierte Maske über dem Gesicht des Kranken. Ein stetiges Zischen zeigte an, dass der Sauerstoff einströmte.
Der Arzt warf einen Blick auf seine Uhr und fragte dann: »Haben Sie einen hiesigen Arzt benachrichtigt?« Christine bejahte und erklärte, warum Dr. Aarons noch nicht da war.
Dr. Uxbridge nickte befriedigt. »Dann kann er alles Weitere veranlassen. Ich komme aus Illinois und bin nicht befugt, in Louisiana zu praktizieren.« Er beugte sich über Albert Wells. »Wie fühlen Sie sich? Besser?« Unter der Plastikmaske versuchte der kleine Mann zu nicken.
Auf dem Korridor hörte man feste Schritte, und gleich darauf erschien Peter McDermotts athletische Gestalt in der Türöffnung. »Ich habe Ihre Nachricht bekommen«, sagte er zu Christine und sah zum Bett hinüber. »Geht es ihm besser?«
»Ja. Aber ich glaube, wir sind Mr. Wells einiges schuldig.« Sie winkte Peter auf den Korridor hinaus und schilderte ihm die Umquartierung des kleinen Mannes, von der ihr der Boy erzählt hatte. Als sie sah, wie Peter die Stirn runzelte, fügte sie hinzu: »Falls er hierbleibt, müssten wir ihm schnell ein anderes Zimmer geben, und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch eine Pflegerin ohne allzu viel Mühe beschaffen ließe.«
Peter nickte. In einem Angestelltenzimmer auf der anderen Seite des Korridors befand sich ein Haustelefon. Er ging hinüber und verlangte den Empfang.
»Ich bin im vierzehnten Stock«, sagte er, als sich der Empfang meldete. »Ist in der Etage noch ein Zimmer frei?«
Eine spürbare Pause folgte. Der Empfangschef war einer von den alten Mitarbeitern, die Warren Trent vor vielen Jahren eingestellt hatte. Kaum jemals wurde seine fast automatische und wenig einfallsreiche Arbeitsweise bemängelt. Er hatte Peter McDermott bei mehreren Gelegenheiten zu verstehen gegeben, er könne Neulinge nicht leiden, und schon gar nicht, wenn sie jünger als er und ihm übergeordnet waren und zudem aus dem Norden stammten.
»Also«, sagte Peter, »ist nun ein Zimmer frei oder nicht?«
»Ich habe noch die Nummer 1410«, erwiderte der Angestellte in bestem Südstaatenakzent, »aber ich bin gerade im Begriff, sie einem Herrn zu geben, der soeben eingetroffen ist.« Er fügte hinzu: »Falls Sie es noch nicht wissen sollten, wir sind nahezu voll besetzt.«
Die Nummer 1410 war ein Zimmer, an das Peter sich erinnerte. Es war groß und luftig und ging auf die St. Charles Avenue hinaus. »Wenn ich die 1410 nehme, können Sie Ihren Mann dann woanders unterbringen?«
»Nein, Mr. McDermott. Ich habe nur noch eine kleine Suite in der fünften Etage, und der Herr möchte keinen höheren Preis bezahlen.«
»Schön«, sagte Peter entschieden, »dann geben Sie dem Mann für heute Nacht die Suite zum normalen Zimmerpreis. Morgen können wir ihn dann umquartieren. Ich brauche die 1410 für den Gast von 1439. Schicken Sie bitte sofort einen Boy mit dem Schlüssel herauf.«
»Einen Moment, Mr. McDermott.« Bisher hatte sich der Empfangschef um einen leidlich höflichen Ton bemüht; nun wurde er ausgesprochen renitent. »Es war immer Mr. Trents Geschäftstaktik …«
»Im Augenblick handelt es sich um meine Taktik«, antwortete Peter kurz angebunden. »Und noch eins: Richten Sie Ihrer Ablösung aus, dass ich morgen früh eine Erklärung dafür erwarte, warum Mr. Wells aus seinem Zimmer in die Nummer 1439 abgeschoben wurde, und Sie können hinzufügen, dass es schon ein verdammt guter Grund sein muss.«
Er sah Christine an und schnitt ein Gesicht, während er den Hörer auflegte.
5
»Du musst verrückt gewesen sein«, fauchte die Herzogin. »Verrückt und von allen guten Geistern verlassen.« Nachdem Peter McDermott die Präsidentensuite verlassen hatte, war sie in den Salon zurückgekehrt und hatte die innere Tür sorgfältig hinter sich geschlossen.
Der Herzog rutschte unbehaglich hin und her, wie immer, wenn seine Frau ihn mit ihren regelmäßig wiederkehrenden Gardinenpredigten traktierte. »Das Ganze tut mir verdammt leid, altes Mädchen. Der Fernseher war eingeschaltet. Ich konnte den Burschen nicht hören. Ich dachte, er hätte sich schon verzogen.« Er nahm mit unsicheren Händen einen kräftigen Schluck aus seinem Whiskyglas und fügte wehklagend hinzu: »Außerdem bin ich noch ganz durcheinander.«
»Es tut dir leid! Du bist durcheinander!« In der Stimme seiner Frau lag ein Unterton von Hysterie, eine Schwäche, zu der sie sich selten hinreißen ließ. »Wenn man dich hört, könnte man glauben, alles wäre nur eine Art Spiel. Und dabei ist das, was heute Nacht passiert, vielleicht der Ruin …«
»Denk bloß nicht, dass ich das nicht weiß. Ich weiß genau, dass es ernst ist. Verdammt ernst.« Er hockte unglücklich und zusammengekrümmt in seinem Sessel wie ein Häufchen Elend und erinnerte in diesem Augenblick an einen Hamster mit Schnurrbart und Melone, den englische Karikaturisten so gern zeichneten.
Die Herzogin fuhr anklagend fort: »Ich habe getan, was ich konnte. Nach deiner Wahnsinnstat habe ich mein Menschenmögliches versucht, um jedermann einzuhämmern, dass wir einen ruhigen Abend im Hotel verbracht haben. Ich habe sogar einen Spaziergang erfunden, für den Fall, dass uns jemand beim Hereinkommen gesehen hat. Und dann platzt du in deiner unglaublichen Naivität dazwischen und verkündest laut und deutlich, dass du deine Zigaretten im Wagen vergessen hast.«
»Das hat bloß einer gehört. Dieser Geschäftsführer oder was immer er auch ist. Er hat sonst aber überhaupt nichts gemerkt.«
»Und ob er etwas gemerkt hat! Ich habe sein Gesicht genau beobachtet.« Die Herzogin bewahrte mühsam ihre Selbstbeherrschung. »Ist dir eigentlich klar, in welcher scheußlichen Klemme wir sind?«
»Natürlich.« Der Herzog trank seinen Whisky aus und betrachtete das leere Glas. »Ich schäme mich maßlos. Wenn du mich nicht überredet hättest – und wenn ich nicht besäuselt gewesen wäre …«
»Besäuselt? Du warst betrunken! Du warst betrunken, als ich dich fand, und du bist es auch jetzt noch.«
Er schüttelte den Kopf, als wollte er Klarheit in seine Gedanken bringen. »Ich bin jetzt ganz nüchtern.« Nun war er an der Reihe mit Vorwürfen. »Du musstest mir ja unbedingt nachspionieren, dich einmischen. Du konntest mich nicht in Ruhe …«
»Hör auf damit. Wichtig ist jetzt nur das andere.«
»Du hast mich überredet …«, wiederholte er.
»Wir hätten sonst nichts tun können. Nichts! Und so haben wir vielleicht noch eine Chance.«
»Verlass dich nicht zu sehr darauf. Wenn die Polizei erst mal anfängt zu bohren …«
»Dazu müsste man uns erst einmal verdächtigen. Deshalb habe ich den Zwischenfall mit dem Kellner inszeniert und so viel Aufhebens davon gemacht. Es ist zwar kein echtes Alibi, aber fast so gut. Damit habe ich ihnen eingebläut, dass wir heute Abend hier waren – oder vielmehr, ich hätte es ihnen eingebläut, wenn du nicht alles verdorben hättest. Ich könnte heulen.«
»Das wundert mich«, sagte der Herzog. »Ich wusste gar nicht, dass du so weiblich bist.« Er hatte sich im Sessel aufgerichtet und irgendwie seine Unterwürfigkeit ganz oder fast abgeschüttelt. Diese chamäleonhafte Verwandlungsfähigkeit verblüffte alle, die ihn kannten, immer von Neuem und veranlasste sie zu der Frage, wie er nun eigentlich wirklich war.
Die Herzogin errötete, ein Reiz, der ihre statuenähnliche Schönheit noch erhöhte. »Das war überflüssig.«
»Vielleicht.« Der Herzog stand auf und begab sich zu einem Sideboard, wo er sich eine freigebige Portion Whisky ins Glas schüttete und ein wenig Sodawasser nachfüllte. Seiner Frau den Rücken zuwendend, fügte er hinzu: »Trotzdem kannst du nicht leugnen, dass das die Ursache all unserer Schwierigkeiten ist.«
»Ich gebe nichts dergleichen zu. Das mag für deine Angelegenheiten gelten, aber nicht für meine. Es war eine Wahnsinnsidee von dir, heute Abend in diese scheußliche Spelunke zu gehen, und dass du dieses Frauenzimmer mitgenommen hast …«
»Wir haben das bereits besprochen«, sagte der Herzog erschöpft. »Zur Genüge. Auf der Rückfahrt. Bevor es passiert ist.«
»Es freut mich, dass etwas von dem, was ich gesagt habe, hängen geblieben ist. Ich hatte nicht damit gerechnet.«
»Deine Worte durchdringen den dicksten Nebel, altes Mädchen. Ich versuche mich dagegen immun zu machen. Hab’s aber bisher nicht geschafft.« Er nippte an seinem frischen Drink. »Warum hast du mich geheiratet?«
»Ich glaube, vor allem deshalb, weil du in unseren Kreisen der Einzige warst, der etwas getan hat, das der Mühe wert war. Ich hörte immer nur: Der Adel hat sich überlebt. Du schienst zu beweisen, dass es nicht so war.«
Der Herzog hob sein Glas und starrte es an wie eine Kristallkugel. »Jetzt nicht mehr?«
»Nein. Wenn es dennoch den Anschein hat, dann nur, weil ich die Fäden ziehe.«
»Washington?«, fragte er.
»Wir könnten es schaffen, wenn du es fertigbringen würdest, weniger zu trinken und im eigenen Bett zu schlafen.«
»Haha!« Ihr Mann lachte hohl. »Ein verdammt kaltes Bett, wenn du mich fragst.«
»Ich sagte bereits, dass wir darauf nicht einzugehen brauchen.«
»Hast du dich eigentlich nie gefragt, warum ich dich geheiratet habe?«
»O doch, ich habe mir so meine Gedanken gemacht.«
»Wenn du das Allerwichtigste wissen willst.« Er nahm noch einen Schluck, als müsse er sich Mut antrinken, und murmelte undeutlich: »Ich wollte dich fürs Bett. Schnell. Legal. Ich wusste, das war der einzige Weg.«
»Es wundert mich, dass du dir die Mühe gemacht hast. Du brauchtest unter so vielen anderen nur zu wählen – vor unserer Hochzeit und danach.«
Er starrte sie mit blutunterlaufenen Augen an. »Ich wollte keine andere. Ich wollte bloß dich. Auch jetzt noch.«
»Schluss damit!«, sagte sie scharf. »Ich will nichts mehr davon hören.«
Er schüttelte den Kopf. »Bloß noch eins. Dein Stolz, altes Mädchen. Prachtvoll. Unbändig. Hat mich immer gereizt. Ich wollte ihn nicht brechen, wollte nur daran teilhaben. Du auf dem Rücken. Mit gespreizten Oberschenkeln. Leidenschaftlich. Bebend …«
»Sei still! Sei still, du – du Wüstling, du!« Ihr Gesicht war weiß, ihre Stimme schrill. »Es ist mir egal, ob dich die Polizei erwischt! Ich hoffe, sie tut’s! Ich hoffe, du kriegst zehn Jahre!«
6
Nach seiner schnell beendeten Auseinandersetzung mit dem Empfang ging Peter McDermott quer durch den Korridor der vierzehnten Etage und betrat wieder die Nummer 1439. »Wenn Sie einverstanden sind«, sagte er zu Dr. Uxbridge, »schaffen wir Ihren Patienten in ein anderes Zimmer im selben Stockwerk.«
Der hochgewachsene hagere Arzt, der Christines Hilferuf so rasch gefolgt war, nickte. Er betrachtete die enge Folterkammer mit ihrem Gewirr von Heizungs- und Wasserrohren. »Jeder Wechsel kann nur von Vorteil sein.«
Während der Arzt ans Bett und zu dem Patienten zurückkehrte, der eben wieder seine Fünf-Minuten-Dosis Sauerstoff bekam, meinte Christine: »Jetzt brauchen wir nur noch eine Pflegerin.«
»Mit dem Problem kann sich Doktor Aarons befassen«, erwiderte Peter und fügte nachdenklich hinzu: »Das Hotel wird sie engagieren müssen, vermute ich, und das bedeutet, dass wir für die Kosten haften. Glauben Sie, dass Ihr Freund Wells zahlen kann?«





























