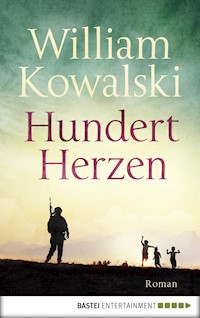
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
USA, heute, mitten im Nirgendwo: Der 25-jährige Jeremy Merkin leidet stark unter den Erinnerungen an seinen Kriegseinsatz in Afghanistan. Er wird wieder und wieder von Panikattacken heimgesucht. Seine Familie ist ihm dabei keine Hilfe und erweist sich als genauso haltlos und verloren wie er. Als Jeremy sich an ein besonders traumatisches Erlebnis erinnert, eskaliert die Situation, und er trifft eine radikale Entscheidung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog: Der Psychopomp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Epilog: Das Dorf
Danksagungen
Über den Autor
William Kowalski ist preisgekrönter Bestseller-Autor. Sein erster Roman, EDDIES BASTARD, gewann 1999 den Rosenstein Award und 2001 den Ama-Boeke Preis. HUNDERT HERZEN ist sein fünfter Roman und wurde im September 2014 mit dem Thomas H. Raddall Atlantic Fiction Award ausgezeichnet. Kowalskis Bücher wurden in fünfzehn Sprachen übersetzt.
William Kowalski
HUNDERTHERZEN
Aus dem Englischen vonJürgen Bürger
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by William Kowalski
Titel der kanadischen Originalausgabe: »The Hundred Hearts«
Originalverlag: Thomas Allen Publishers, Markham, ON
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ilona Jaeger
Titelillustration: Johannes Wiebel, punchdesign, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Oleg Zabielin;
shutterstock/Nate Derrick; shutterstock/Zurijeta
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1499-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Alexandra
Aber dir bestimmt, o Geliebter von Zeus, Menelaos, nicht das Schicksal den Tod in der rossenährenden Argos; sondern die Götter führen dich einst an die Enden der Erde, in die elysische Flur, wo der bräunliche Held Radamanthus wohnt, und ruhiges Leben die Menschen immer beseligt: dort ist kein Schnee, kein Winterorkan, kein gießender Regen; ewig wehn die Gesäusel des leiseatmenden Westes, welche der Ocean sendet, die Menschen sanft zu kühlen.
– HOMER, Odyssee
Sie nennen es den Amerikanischen Traum, denn man muss schon schlafen, um’s zu glauben.
– GEORGE CARLIN
Prolog:Der Psychopomp
Helen Merkin verstarb am 3. August 2011 im Alter von sechsundsechzig Jahren, nachdem sie in ihrem ganzen Leben nur dreimal krank gewesen war – und niemals ernstlich. Die Frauen in ihrer Familie wurden nicht krank. Sie erreichten vielmehr alle ein beneidenswertes Alter. Ihre Mutter war vierundneunzig geworden, ihr Leben hatte am Ende der Ära von Pferd und Kutsche begonnen und dann die Zeitalter des Automobils, des Fliegens, eines Weltkriegs, des Radios, eines weiteren Weltkriegs, der Atombombe, der Mondlandung bis zu dem des Computers überdauert, um nur einige wenige zu nennen. Ihre Großmutter, die zu Zeiten von Präsident Garfield in einem Planwagen geboren worden war und als Kind zwei Angriffe von Kickapoo-Kriegern überlebt hatte, hatte die achtundneunzig erreicht. Das waren Helens Gene, starke Gene, Gene wie Betonsteine, die aber aus etwas noch Unnachgiebigerem gemacht waren – wie Quarz oder Obsidian oder Elementen, von denen sie noch nie etwas gehört hatte, Elementen, die äonenlang im Herzen eines eine Million Lichtjahre entfernten Sternes gebrodelt hatten und dann quer durchs Universum geflogen waren, um sich kurzzeitig in ihrem Wesen anzusammeln, wie es bei uns allen geschieht.
Doch auch wenn ihr Körper aus ewigem Sternenstaub gemacht war, am Ende ließ er sie im Stich wie eine billige Uhr vom Straßenhändler. Todesursache war eine schwere, chronische Schlafapnoe, unter der sie fast ihr gesamtes Leben lang gelitten hatte – besonders in den letzten Jahren, als sie zugenommen hatte, weil sie ihr eigenes Gebäck so sehr liebte. Normalerweise wachte Helen panisch und wild um sich schlagend auf, wenn das Schnarchen ihr die Luft raubte. Diesmal jedoch hörte sie einfach auf zu atmen. Daher war Helens letzter Gedanke eigentlich auch gar kein Gedanke. Es war ein Traum.
Es ist ein Traum von etwas, das wirklich passiert ist. Sie ist wieder neun Jahre alt, noch ohne Brüste und drahtig, und befindet sich wieder auf der Farm in den schroffen, smaragdgrünen Tehachapi Mountains, wo sie aufgewachsen war. Ihre Eltern sind Schafzüchter, genau wie im wirklichen Leben. Ihr Vater hat gerade ein mutterloses Lamm in ihre Obhut gegeben, ein süßes Weibchen, das sich auf Spinnenbeinen unterwürfig heranschiebt und an ihrem kleinen Finger saugt. Helen ist entzückt. In der Nähe leben keine anderen Kinder, und ihre Brüder sind erheblich älter: Ihre Spielkameraden sind entweder Tiere oder nur imaginär, und keiner davon braucht sie so wie dieses Lamm. Ohne sie wird es sterben. Noch nie zuvor hatte das Überleben eines Wesens von ihr abgehangen. Sie spürt, wie sich ihr Herz weitet, um es aufzunehmen, empfindet eine neue Wichtigkeit. Ihr Uterus beginnt zu erwachen, und sie verspürt ein winziges Ziehen an den Stellen, wo eines Tages ihre Brüste wachsen werden. Binnen Jahresfrist, in einem Schwall, der in diesem Augenblick seinen Anfang nimmt, wird sie beginnen zu menstruieren.
Sie tauft das Lamm auf den Namen Agnes. Agnes, Agnus, Agnus Dei, Lamm Gottes. Was ihre gläubige Mutter glücklich macht – der Grund für viele Dinge, die Helen tut.
Aber es ist nicht wirklich alles richtig. In diesem Traum hat Agnes irgendwie gelernt, zu gehen und zu sprechen wie ein Mensch, wenn auch mit schafhaften Neigungen. Sie sieht eigentlich wie ein kleines Mädchen mit einem Schafskopf aus. Was Helen nicht wirklich beunruhigt, aber ihr Traum macht auf sich selbst aufmerksam, und das ist sie nicht gewohnt. Sie erinnert sich nur selten an ihre Träume, aber dieser hier ist so lebendig wie der IMAX-Film, in den sie 1990 in Los Angeles mit Al gegangen ist – der über die Wale.
Agnes begrüßt Helen voller Liebe. Als sie sie umarmt, spürt Helen ihr wollenes Gesicht auf ihren Wangen. Nach kurzem Zögern erwidert sie die Umarmung.
»Komm, lass uns spazieren gehen«, sagt Agnes, denn in diesem Traum kann sie sprechen. Ihr Atem ist grasig, die Schnauze deutlich abgesetzt und rosa, die feinen weißen Haare schimmern im Sonnenschein. »Ich muss dir was zeigen.«
»Wohin gehen wir denn?«
»Zum Fluss«, antwortet Agnes.
»Welcher Fluss? Hier gibt’s keinen Fluss.«
»Jetzt schon«, sagt Agnes.
Sie gehen bis ans entfernte Ende der Ländereien ihres Vaters, bis sie schließlich eine Stelle erreichen, die Helen vertraut erscheint, obwohl sie sich nicht erinnern kann, wann sie schon einmal hier war. Der Weg endet tatsächlich an einem Fluss, einem breiten, sprudelnden Abschnitt gemächlich silbrig fließenden Wassers, wo eine uralte Pappel steht, deren Äste weit genug ausholen, dass ein ganzes Dorf darunter Schutz findet. Am anderen Ufer ragt ein grüner Bergrücken bis zum Himmel hinauf. Helen findet das sehr hübsch, und das sagt sie auch. Dann schlägt sie zaghaft vor, jetzt doch besser wieder zurückzukehren.
»Zurückkehren wohin? Wir sind angekommen«, sagt Agnes. »Dies ist der Ort, an den wir gehen.«
Erst da dämmert es Helen langsam, dass sie nicht träumt und dass Agnes sie mit Absicht hergeführt hat. Sie fühlt sich getäuscht. Und ihr gefällt nicht, was Agnes gesagt hat: Dies ist der Ort, an den wir gehen. Als wäre dies schon immer das Ziel gewesen.
»Ich will nach Hause«, sagt sie.
»Es gibt kein Zuhause.«
»Was meinst du damit?«
»Warte«, sagt Agnes. »Da kommt jemand.«
»Wer ist es?«
»Jemand, der dir wichtig ist. Du wirst es schon bald sehen«, erwidert Agnes.
Helen fühlt sich, als wäre sie sowohl neun als auch sechsundsechzig; sie hat wieder den Körper eines Kindes, doch sie erinnert sich an ihr gesamtes Leben, an das Aufwachsen, zu heiraten und dann zuerst Mutter und schließlich Großmutter zu werden. Wie kann das sein? Sie mag diesen Traum nicht, und außerdem beschleicht sie das Gefühl, dass dies auch nicht wirklich ein Traum ist. Furcht windet sich wie eine Schlange an ihren Knöcheln empor und legt sich um ihre Taille. Sie fühlt sich getäuscht und orientierungslos. Sie ist sicher, jeden Zentimeter dieser Farm zu kennen, und es gibt hier keinen Fluss. Jemand spielt ihr einen Streich. Nicht Agnes. Jemand, der noch rätselhafter ist.
»Warum bin ich wieder ein kleines Mädchen?«, fragt sie, den Blick auf ihren flachen Bauch, ihre dürren Beine gerichtet. »Ich war eine erwachsene Frau. Ich weiß, dass ich es war. Ich erinnere mich.«
»Wir sind alle so alt, wie wir sein wollen«, sagt Agnes.
»Mir gefällt es hier nicht. Ich will nach Hause«, sagt Helen wieder und beginnt zu weinen.
»Du ka-a-annst nicht einfach nach Hause gehen«, sagt Agnes. In ihrer Ungeduld fällt sie ins Schafhafte zurück. »Verstehst du denn nicht? Wir gehen hinüber. Du hast gar keine Wahl.«
Helen setzt sich auf den Boden und verschränkt die Arme vor der Brust. »Du gehst hinüber. Ich gehe nicht. Ich will meine Familie sehen.«
»Du wirst sie sehen.«
»Wann?«
»Jetzt. Aber sie werden dich nicht sehen.«
»Warum nicht?«
»Weil«, erklärt Agnes ihr wie einer sehr begriffsstutzigen Person, »du keinen Körper mehr besitzt.«
Diese Neuigkeit ist nicht so schockierend, wie sie hätte sein sollen. Tatsächlich empfindet Helen sogar eine gewisse Erleichterung. Seit jenem Tag, an dem sie den ersten Blutfleck in ihrem Höschen bemerkte, gefolgt von dem schmerzhaften Anschwellen hinter ihren Nippeln, durch die sie aufgebläht und unansehnlich wurden, hat sich ihr Körper wie eine stetig anwachsende Belastung angefühlt, wie eine zusätzliche Schicht, die sie mit sich herumschleppen musste und die ihr wirkliches Selbst verdeckt. Mit jedem verstreichenden Jahr wurde sie fülliger, ihre Brüste wurden schlaffer und ihr Hintern breiter, bis es ihr schließlich unangenehm war, sich im Spiegel anzusehen. Liebend gern würde sie das alles hinter sich lassen.
»Wie kann ich sie sehen?«, fragt sie.
»Schau«, sagt Agnes und deutet auf das Wasser. »Du siehst alles im Fluss.«
Also schaut Helen hinein.
Im Wasser sieht sie Al Merkin, ihren Ehemann, wie er sie grau und leblos vorfindet, steif wie eine Statue. Aus Gewohnheit kommt Al morgens als Erstes in ihr Zimmer, um sie zu wecken und seine Frühstückswünsche zu äußern. Zuerst wird er starr vor Schreck, dann zuckt er bei der Berührung des toten Körpers zurück, des ersten, den er seit vielen Jahren sieht. Schließlich nimmt er sie in die Arme und weint. Er schilt sich laut dafür, nicht gewusst zu haben, dass sie starb. Hatte sie nach ihm gerufen? Hatte sie nach seiner Hand gegriffen, auch wenn sie seit Jahren nicht mehr im gleichen Bett geschlafen hatten? Würde sie noch leben, wenn er nicht auf seinem eigenen Schlafzimmer bestanden hätte? Er wird es nie erfahren. Es quält ihn ungemein, dass er während ihrer letzten Augenblicke im Nachbarzimmer gelegen hat, wahrscheinlich von Theresa Talley-Graber träumend, die ihm bei einem Tanz auf der Highschool einmal erlaubt hatte, sie unzüchtig zu berühren, und die sich, auch wenn er sie gut und gern mehr als ein halbes Jahrhundert lang nicht gesehen hat, in letzter Zeit zurück in seine Gedanken geschlichen hatte.
Wie sie ihn so im Fluss beobachtet, ist Helen davon angetan, dass er Gefühle zeigt; es ist erst das zweite Mal, dass sie ihren Mann weinen sieht. Sie kann all seine Gedanken lesen, daher weiß sie ganz genau, dass er an Theresa Talley-Graber gedacht hat, doch sie verzeiht ihm. Sex war ihr schon seit langer Zeit blöd vorgekommen, und jetzt ist es fast schon skurril, die quetschenden, spritzenden Albereien Sterblicher, die letztendlich nicht besser sind als Hunde und Katzen, wenn es um die Beherrschung ihrer niederen Instinkte geht.
»Sieh ihn dir an«, sagt sie zu Agnes. »Er führt sich auf wie ein kleiner Junge.«
»Wir sind alle Kinder«, sagt Agnes. »Einfach nur alte Kinder, nichts weiter.«
»Bin ich deshalb wieder ein Kind?«
»Nein. Du hast diese Gestalt gewählt, ob du dich nun daran erinnerst oder nicht. So hast du dich selbst gesehen. Du hast dich immer als kleines Mädchen gefühlt, selbst als Erwachsene. Stimmt doch, oder?«
»Ja. Jetzt wo du es sagst, ja, das hab ich. Aber woher wusstest du das?«
»Hier weiß man alles«, sagt Agnes. »Jede noch so kleine Kleinigkeit, alles, was jemals war oder sein wird.«
Jetzt liegen sie auf dem Bauch im Gras, Helens Kinn auf den Händen abgestützt, Agnes’ auf ihren Hufen, und starren ins Wasser. Dann hört Helen das Platschen von Wasser auf Ruderblättern. Sie schaut auf und sieht einen Mann, der in gemächlichem Tempo ein Boot rudert. Er ist noch ein gutes Stück flussabwärts, kommt aber näher. Er hat ihnen seinen breiten Rücken zugewandt, daher kann sie sein Gesicht nicht sehen. Er trägt ein olivbraunes T-Shirt und hat einen militärischen Haarschnitt. Es klingt, als würde er pfeifen. Die Melodie kommt ihr vertraut vor. Im Heck des Bootes steht ein Hund, dessen Zunge wie eine feuchte Flagge im Wind flattert und der mit seinem aufgestellten Schwanz wedelt. Auch der Hund kommt ihr vertraut vor.
»Hey, da ist Proton!«, sagt Helen und steht auf. »Jeremy hat ihn überall gesucht! Hier, Proton! Komm her, mein Junge!«
»Er wird schon bald hier sein«, sagt Agnes. »Hab einfach Geduld.«
Also setzt Helen sich wieder und wartet darauf, dass der Fährmann eintrifft.
1
Elysium, Kalifornien, liegt auf halber Strecke zwischen Barstow und Bakersfield am Highway 58, westlich der Mojave-Wüste. Die Trostlosigkeit der Mojave nimmt vielerlei Gestalten an, wie etwa blendend weiße Salzebenen, Bergzüge, die an Schneidezähne erinnern und höllische Täler. In diesem Teil ist es eine endlose Ebene aus rostbraunem Staub, Heimat übel riechender Kreosotbüsche und Josua-Palmlilien, aufragend wie die Fäuste von Gladiatoren und bevölkert von ernsten, sonnenverbrannten Menschen, die es gewohnt sind, sich so unbedeutend zu fühlen wie Insekten in der heulenden Einöde. Es ist so heiß, dass sich Knochen in Gummi verwandeln und an den falschen Stellen biegen. Zum Ausgleich entwickeln die Menschen eine Starrheit, einen großen Widerwillen, nachzugeben. Jesus ist der Herr. Der Staat hat’s auf dich abgesehen. Das Recht, Waffen zu tragen, ist heilig. Das sind die Überzeugungen, die ihnen seit Generationen Kraft geben. Mit jedem Jahr, das verstreicht, verwurzeln sie nur noch fester.
Für Jeremy Merkin ist die Stadt Elysium nichts als ein eingetrockneter Pickel auf dem Arsch einer Hure. Ein ziemlich unanständiger Gedanke, aber so zu denken hat er in seiner Zeit bei der Army gelernt, und obwohl er heute seit fast fünf Jahren Zivilist ist, fällt es ihm schwer, mit dieser Angewohnheit zu brechen.
Der Bauunternehmer, der sich die Stadt ausgedacht hat, ein griechischer Einwanderer namens Ouranakis, war ein großer Freund der klassischen Mythologie. Das war noch bevor er selbst in eine Mythologie einging, die er selbst erschaffen hatte und die am Abendbrottisch in den Häusern älterer Elysianer, zu denen Jeremys Großvater zählt, von Zeit zu Zeit wieder heraufbeschworen wird. Das ursprüngliche Elysium war das ewige Paradies, von dem die alten Griechen glaubten, ihre Seelen würden nach dem Tod dorthin wandern. So wurde es auch auf einer Plakatwand an einem künstlichen See im Zentrum der Stadt dargestellt, auf der ein Mann in einer Toga vor endlosen grünen Feldern steht und einen stets vollen Kelch Wein erhebt, wobei seine munteren hellenischen Gesichtszüge stark von der kalifornischen Sonne mitgenommen wirken. Auf die Reklametafel hat ein Witzbold mit Sprayfarbe eine Sprechblase gesprüht, die sich aus dem Mundwinkel des Griechen löst und die Worte enthält: WILLKOMMEN IN DER HÖLLE.
Dank Ouranakis’ geschickter Zurschaustellung und seines Talents, sich selbst ins rechte Licht zu rücken, war hier einst ein Immobilienboom erwartet worden. Die Leute redeten darüber, als wäre er etwas Gegenständliches, wie ein Zug beispielsweise, der jeden Moment auftauchen könnte. Ouranakis baute mehrere Wohnviertel und versprach hundert weitere. Er hatte sogar die Güte, Anzahlungen erwartungsvoller Hausbesitzer in Höhe von fast einer Million Dollar anzunehmen. Ein ausgedehntes Straßennetz war in die Wüste planiert und asphaltiert worden, so wie zusätzlich viele Meilen Bürgersteige und Hauszufahrten.
Der Boom kam nie. Jahrzehnte später enden die Straßen immer noch abrupt, ohne irgendwo hinzuführen. Bürgersteige verlaufen durch Viertel, in denen es keine Häuser gibt, nur leere Betonflächen. Es ist, als wäre ein riesiger Staubsauger gekommen und hätte alles aufgesaugt, was nicht fest mit der Erde verbunden war, Kinder und Hunde inbegriffen. Und vielleicht auch Ouranakis selbst. Er verschwand eines Tages, als wäre er in die Wolken gesaugt worden, und man entdeckte ihn erst 1973 wieder, als er auf einer griechischen Insel starb, wo er wie ein Prinz gelebt hatte.
Hier ist Jeremy aufgewachsen, in einer Stadt, die aussieht, als wäre sie für eine Gemeinde von Geistern angelegt worden, zum Teil real, aber größtenteils imaginär. Amerikanische Flaggen flattern im tobenden Brausen der Santa-Ana-Winde und erinnern an die Peitschen der Fuhrmänner, die einst die mit Borax bepackten Maultierzüge aus den Bergen gelenkt hatten. Zwei-, dreimal am Tag wird die Gegend von einem Überschallknall von der nahegelegenen Edwards Air Force Base erschüttert. Gelegentlich schiebt sich ein dunkler Schatten unter der Sonne durch und wirft einen deltaförmigen Schatten. Es ist der Tarnkappenbomber, der bei der Durchführung von Übungseinsätzen ein dezentes Dröhnen von sich gibt, während die Besatzung so tut, als würden sie Bomben auf ihre nichts ahnenden Landsleute abwerfen. Die Seltsamkeit der Dinge erreicht hier ein extremes Ausmaß, genau wie die Temperatur, die ungeheure Weite und die Abgeschiedenheit. Amerika war schon immer groß und bizarr. Und nirgendwo ist es größer und bizarrer als in der Mojave-Wüste.
Einen Monat, nachdem sie die sterblichen Überreste seiner Großmutter Helen den Flammen des Krematoriums übergeben haben, sitzt Jeremy in seinem Wagen auf dem Parkplatz von Sam »The Patriot« Singhs Fortress of America Motel und hält einen zerknüllten Zettel in der Hand. Die Mitteilung ist heute in seinem Brieffach im Lehrerzimmer aufgetaucht. Sie ist mit Bleistift auf einem Blatt geschrieben, das aus einem Notizbuch herausgerissen wurde. Die Handschrift ist eindeutig weiblich. Er weiß, wem sie gehört. In nur wenigen Wochen hat er gelernt, die Handschriften der meisten seiner fast vierzig Schüler zu erkennen. Er hat mit sich gerungen, ob er ihn öffnen soll. Instinktiv spürte er, dass das, was immer darin stünde, ihn in Schwierigkeiten bringen würde. Aber im Kampf zwischen Neugier und Besonnenheit, der sich in seinem Kopf abspielte, hatte die Neugier über die Besonnenheit die Oberhand gewonnen.
Zimmer 358. Ich brauche dich, Jeremy.Nur du kannst mir helfen.
Helfen wobei, das weiß er nicht. Allein schon der Besitz dieses Zettels macht Jeremy nervös. Er musste bereits einen Vortrag von Peter Porteus, Rektor der Elysium High School, über die Wichtigkeit von Anstand über sich ergehen lassen: Achten Sie um Himmels willen darauf, niemals mit einer Schülerin allein zu sein, und falls es sich doch einmal ergibt, halten Sie die Türen offen, behalten Sie Ihre Hände bei sich, und so weiter und so fort. Vorzugsweise wickeln Sie sich hermetisch in Plastikfolie ein und bleiben auf der anderen Seite des Raumes.
»Sie sind ein Mann, also sind Sie ein potentieller Verbrecher«, sagte Porteus. »So ist es heutzutage. Wir sind alle Vergewaltiger. Selbst wenn Sie niemals jemanden vergewaltigt haben. Unterlassen Sie einfach alles, was missgedeutet werden könnte. Behalten Sie Ihren Johannes in der Hose, halten Sie sich von verfänglichen Situationen fern, und alles ist bestens.«
Jeremy glaubte nicht, dass dies ein Problem für ihn sein würde. Das einzige Mal, dass er seinen Johannes in einer beruflichen Umgebung aus der Hose geholt hatte, lag sieben Jahre zurück, während seiner Zeit an der Eistheke des Freezie Squeeze, als er und Samantha Bayle, die rechte Hand des Inhabers, auf ihrem Schreibtisch Gas gegeben hatten – eine kleine akrobatische Meisterleistung, zu der er heute dank seiner Kriegsverletzung nicht mehr in der Lage war. Und wenn man es genau nahm, dann war sie diejenige, die ihm seinen Johannes aus der Hose geholt hatte, nicht er selbst.
Aber das war in einer anderen Zeit gewesen, vor dem Krieg, vor improvisierten selbst gebastelten Bomben, und es war eine Nummer, an deren Wiederholung er keinerlei Interesse hatte. Er hat sich größte Mühe gegeben, dies Porteus unmissverständlich zu versichern, und er hat ebenfalls versprochen, nicht in »schwierige Situationen« zu geraten. Porteus hat nichts darüber gesagt, ob man mit Schülern in Motelzimmer gehen sollte, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass das mehr als offensichtlich ist.
Das hier, denkt Jeremy, ist ganz klar eine verfängliche Situation.
Der Wagen schaukelt von Seite zu Seite, während er von den Santa-Ana-Winden durchgerüttelt wird. Jeremy schaukelt im Rhythmus mit und lässt seinen Kopf locker wippen, während er die Tür des Motelzimmers betrachtet. Er kann sich nicht entscheiden. Reingehen oder nach Hause fahren? Er hat das deutliche Gefühl, dass sein Leben in diesem Moment an einem Scheideweg angelangt ist, und genau in solchen Momenten wird durch seine Unentschlossenheit jene Lähmung vervollständigt, die ihn seit dem 7. April 2007 heimsucht, seit dem Tag, an dem die Bombe hochging. Er sollte jetzt wirklich einfach fahren. Aber er muss feststellen, dass seine Hand dem Befehl des Gehirns, den Zündschlüssel zu drehen, nicht gehorcht. Also sitzt er da und wartet auf ein Zeichen.
Befindet man sich im Wartemodus, sieht man praktisch überall Zeichen: im Muster der Wolken, in den Spuren der Insekten, dem Ticken eines abkühlenden Pkw-Motors. Oder in der Nummerierung auf Motelzimmertüren.
358. Irgendetwas an diesen Zahlen kommt ihm bekannt vor. Nach einem Augenblick begreift er, was es ist: 358 war ebenfalls Protons Steuernummer. Nachdem Jeremy ihn 1999 aus einem Massenzuchtbetrieb für Hunde in Lancaster gerettet hatte, war er der dreihundertachtundfünfzigste Hund, der in jenem Jahr angemeldet worden war. Er hatte ihn für kleines Geld bekommen, nachdem ein Kojote in den Zwinger eingedrungen war und eine der Hündinnen geschwängert hatte. Kein Mensch wollte einen Hund, der einem womöglich im Schlaf den Kopf abriss. Wie sich herausstellte, hatte Proton auch nicht einen Funken Aggressivität im Leib. Als Wachhund war er daher nicht zu gebrauchen; er spielte einfach mit allen Leuten Ball.
Vor fünf Wochen, unmittelbar vor dem Tod seiner Großmutter, verschwand Proton. Jeremy suchte überall nach diesem dummen Hund, zumindest soweit seine zusammengeflickte Wirbelsäule es ihm erlaubte. Doch er war weg. Sein Großvater Al meinte, wahrscheinlich wäre Proton von einem Skorpion oder einer Klapperschlange gebissen worden und hätte sich danach zum Sterben in die Wüste verkrochen. Das war typisch Al; am meisten schien er sich darüber zu freuen, dass Proton ihm die sechzig Mäuse erspart hatte, die es gekostet hätte, ihn am Ende einschläfern zu lassen. Also entschied Jeremy, nicht zu erzählen, dass er sieben Tage hintereinander noch vor Tagesanbruch aufgestanden war und Proton vom Ende jeder in Sanddünen übergehenden Straße aus gerufen hatte und durch das hüfthohe Gestrüpp geirrt war, bis seine Wirbelsäule gedroht hatte, den Geist aufzugeben. Proton war sein Hund gewesen. Er hatte ihn von dem Geld gekauft, das er im Freezie Squeeze verdient hatte. Alles und jedes sonst hatte sich verändert, während er in Afghanistan war, die Menschen wurden älter und fetter, die Stadt irgendwie schmieriger und trauriger, doch als er schließlich als Zivilist wieder durch die Tür hereingekommen war, war Proton auf ihn zugesprungen gekommen und hatte ihm einen Tennisball vor die Füße gelegt, als wäre der ganze Krieg nichts anderes gewesen als nur eine übermäßig lange Unterbrechung ihres endlosen Spiels. Dafür hatte er tiefe Dankbarkeit empfunden. Am siebten Tag seiner Suche überraschte er sich, als er weinte und den Namen des Hundes nicht mal mit erstickter Stimme ausstoßen konnte. Als er an diesem Morgen nach Hause kam, war seine Großmutter im Schlaf gestorben und das ganze Haus war in Aufruhr. Danach hörte er auf, Proton zu suchen.
Da ist noch etwas an den Ziffern 3, 5 und 8, woran er sich erinnert. Als einzelne Ziffern genommen, sind sie Fibonacci-Zahlen. Eines Tages drehte sich Smarty, sein bester Freund in der Army, aus heiterem Himmel zu ihm um und sagte: »Falls es einen Gott gibt, und ich denke, es gibt einen, dann ist die Fibonacci-Folge ein Beweis seiner Existenz.«
Das war eine typische Behauptung, wie sie nur von Smarty kommen konnte. Sein richtiger Name war Ari P. Garfunkel, aber in der Army nannte nie irgendwer irgendwen beim richtigen Namen. Für die meisten Typen in ihrem Trupp war Smarty ein Rätsel, ein akademisch orientierter Anachronismus. Er kommentierte nahtlos alles – was sich für Uneingeweihte wie eine Aneinanderreihung unlogischer Aussagen anhörte. Jeremy war der Einzige, der verstand, dass dies lediglich der sprachliche Ausdruck der Gedankenströme war, die gerade durch Smartys absolut außergewöhnliches Hirn gerauscht waren.
Jeremy hatte noch nie von der Fibonacci-Folge gehört, andererseits hatte er aber auch mindestens die Hälfte all der anderen Dinge nie gehört, von denen Smarty redete. Während der Rest des Trupps in augenverdrehender Verwirrung zuhörte und sich anderen soldatischen Dingen widmete, durch die Verpflegungspakete verursachte Furze abließ, Witze riss und sich schier endlos die Eier zurechtrückte, erklärte Smarty in seiner ruhigen Stimme, die das einzige Normale in diesem irrsinnigen Land war, dass die Fibonacci-Folge aus einer Reihe von Zahlen bestand. Man fand sie überall in der Natur wieder, angefangen bei den Proportionen von Bäumen und Bergen bis hin zur Anordnung der Samen im Blütenstand einer Sonnenblume. Sie war ein kosmischer Code, eine seltene Offenbarung der Matrix, auf die durch die Haut der physischen Welt ein flüchtiger Blick fiel. Null, eins, eins, zwei, drei, fünf, acht, dreizehn, einundzwanzig … Man erhielt sie, indem man jeweils die letzte Zahl in der Reihe mit der vorangegangenen addierte. Mehr brauchte es nicht, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen.
»Woher weißt du so was?«, wollte Jeremy wissen.
»Ich lese«, lautete Smartys Antwort. So war er auch an seinen Spitznamen gekommen: Er las die ganze Zeit. In seinem Musculus gluteus maximus steckte mehr Wissen als im Rest des ganzen Zugs zusammen. Jeremy bewunderte Smarty nicht einfach nur, er beneidete ihn. Denn das, begriff er, war das geheime Wissen, welches Smarty seine Gelassenheit angesichts all der Dinge verlieh, die sie wahnsinnig machten: der Staub, die Hitze des Tages, die Kälte der Nacht, der geistesgestörte Captain Woot, die schwirrenden Kugeln, die dröhnenden Mörser und die Tatsache, dass der Rest der Army sie offenbar komplett vergessen zu haben schien, sie bei schwindenden Vorräten an Nahrung und Munition in ihrem vorgeschobenen Posten gestrandet zurückließ. Das Einzige, wovon sie reichlich hatten, waren Leichensäcke. In kalten Nächten schliefen sie darin.
Und jetzt wieder diese Zahlen.
»Verdammt auch«, flüstert Jeremy leise. Er überlegt, den Kopf gegen das Lenkrad zu schlagen, beschließt dann jedoch, dass es zu wehtäte.
Schließlich steigt er aus dem Wagen. Die Santa-Anas sind wie ein Fön auf seinem Gesicht, schrubben den Schweiß von seiner Haut, bevor er Gelegenheit bekommt, sich abzusetzen. Er hat zu lange gesessen; seine Beine sind taub. Er humpelt zur Tür, dreht den Knauf und stellt fest, dass nicht abgeschlossen ist.
In den wenigen Momenten, bis sich seine Augen auf das Halbdunkel eingestellt haben, nimmt er ein halbes Dutzend Gerüche wahr, alle und ausnahmslos auf vertraute Weise unangenehm. Haarspray. Zigarettenqualm. Billiges Parfüm. Shampoo. Feuchte Handtücher. Schimmel vom Verdunstungskühler. Dieser undefinierbare Geruch nach Motelzimmer, der alles überlagert – vielleicht der Geruch nach flüchtiger Verzweiflung und ruinierten Familienurlauben. Diese Gerüche dringen nicht einfach in seine Nase ein, sondern rammen sich auch in seine Kehle. Motelzimmer konnte er noch nie leiden, obwohl er das bis zu diesem Moment vergessen hatte. Zögernd schließt er die Tür.
Er hatte recht, was die Handschrift betrifft. Er hat sie als Jennifer Moons Schrift identifiziert, und hier ist sie, sitzt auf der Kante eines der beiden Doppelbetten, die Hände auf dem Schoß. Sie ist siebzehn, klein für ihr Alter, mit einem rundlichen, aber dennoch elfenhaften Gesicht, das von strähnigen, schwarz gefärbten Haaren umrahmt ist. Ein Ohr ist bis oben hin gepierct und bildet einen glitzernden Halbmond, ein weiterer Stein funkelt auf ihrem Nasenflügel. In der Zunge hat sie, wie er weiß, eine silberne Miniaturhantel, die sie manchmal gedankenverloren gegen die Schneidezähne klackern lässt. Außerdem hat sie die Angewohnheit, langärmelige Hemden zu tragen, was in diesem Klima schon recht ungewöhnlich ist; normalerweise versuchen die Menschen in der Mojave, so wenig wie möglich anzuziehen.
Jennifer gehört zu seinen ruhigsten Schülern – höflich, ja, aber nicht übermäßig engagiert. Genau genommen hat sie bislang noch keinerlei Hausaufgaben abgegeben. Was nicht heißen soll, dass viele der ungefähr drei Dutzend Teenager, mit denen er jeden Tag zu tun hat, ein besonderes Interesse für die Naturgesetze gezeigt hätten. Warum sollten sie auch? Diese Gesetze beherrschen sie, ob sie nun aufpassen oder nicht, und hilfreich bei der endlosen Suche nach Bier, Popularität und Sex sind sie auch nicht. Kein pickeliger Teenager ist jemals flachgelegt worden, weil er ein megakrasses Vektordiagramm zeichnen konnte. Die meiste Zeit im Unterricht verbringt Jennifer damit, aus dem Fenster zu starren oder Männchen zu malen, und häufig starrt sie wie die meisten anderen konzentriert auf ihren Schoß. Sie glotzen auf ihre Genitalien, als wären sie eine der faszinierendsten Sachen der Welt. Diese Generation hat das heimliche Simsen perfektioniert. Jeremy hat es bereits am dritten Tag des Schuljahres aufgegeben, sie zu bitten, ihre Handys wegzulegen. Jetzt ist er bei Tag einundzwanzig angelangt. Der Rest seines Berufsweges sieht von hier aus betrachtet unglaublich lang und niederschmetternd aus.
»Jeremy«, sagt das Mädchen. »Sie sind gekommen. Sie sind voll geil.« Sie steht auf, und ihn beschleicht das ungute Gefühl, dass sie ihn gleich umarmen wird.
»Hi, Jennifer«, sagt Jeremy. Er wirft einen vorsichtigen Blick durch die zugezogenen Vorhänge nach draußen, lenkt so ihren Angriff um. Es wäre klug gewesen, sich zu vergewissern, dass niemand zuschaut, bevor er aus dem Wagen gestiegen ist. Er setzt einen weiteren auf die Liste der Berufe, in denen er eine Katastrophe wäre: Spion. »Hab deine Nachricht bekommen«, fügt er unnötigerweise hinzu. »Was ist los? Alles in Ordnung?«
»Nicht wirklich«, sagt sie. »Nennen Sie mich einfach Jenn, okay? So heiß ich für meine Freunde.«
»Was machst du überhaupt hier?«
»Ich … na ja, ich bin weggelaufen«, antwortet Jenn.
Ihrer Kunstpause entnimmt er, dass sie erwartet, ihn würde das irgendwie beeindrucken, aber eine ganze Menge Leute haben Jeremy schon eine ganze Menge verrückter Scheiße erzählt, und wenn man das jetzt mal in größere Zusammenhänge setzt, dann rangiert die Neuigkeit ziemlich weit unten. Also steht er da und wartet.
»Okay«, sagt er. »Du bist also weggelaufen.«
»Ja. Ich habe auf Ihren Rat gehört.«
»Meinen Rat?« Jeremy schnappt nach Luft, versteht nur Bahnhof. »Ich erinnere mich nicht, gesagt zu haben –«
»Sie haben mich inspiriert, das meine ich. Sie haben mir Mut gemacht, es zu tun. Dieser tolle Vortrag, den Sie uns gehalten haben, dass man sich für seinen eigenen Scheiß selbst einsetzen muss, denn das nimmt einem keiner ab. Und Sie haben auch gesagt, der Überlebenskampf wäre etwas, wofür man keinen um Erlaubnis bitten muss. Man müsste es einfach tun. Es war, als hätten Sie in meinen Gedanken gelesen. Ich hätte echt geschworen, dass Sie nur zu mir gesprochen haben. Haben Sie auch, oder?«
Jeremy schließt die Augen, während er versucht, sich zu erinnern, wovon zum Teufel sie da quasselt. Vage erinnert er sich an eine improvisierte Rede, die er vor ein paar Tagen vor einem Raum gelangweilter Heranwachsender gehalten hat. Es war eines der immer häufiger werdenden Male, an denen die Unterrichtsvorbereitung, an der er stundenlang gearbeitet hatte, gerade mal für fünfzehn Minuten reichte, sodass sich vor ihm eine gähnende Kluft von dreißig Minuten auftat, die er irgendwie füllen musste. Etwas Merkwürdiges passierte mit der Zeit, wenn er vor der Klasse stand; sie dehnte sich aus, sodass mit einem Mal Sekunden zu Minuten wurden. Nichts hatte ihn in seinen Online-Fernkursen auf so etwas vorbereitet – allerdings hatten sie ihn ohnehin nicht auf sonderlich viel vorbereitet. Und außerdem hatte er ja sowieso nicht Lehrer werden wollen. Er hatte sich nur für den Job beworben, weil er gehört hatte, dass der Rektor der Elysium High jeden einstellen würde, selbst jemanden ohne die entsprechende Ausbildung. Es war quasi unmöglich, Leute in diesen Winkel der Welt zu locken. Was hatte er denn eigentlich vorgehabt, nachdem er seinen Abschluss gemacht und sein virtuelles Diplom erhalten hatte? Er kann sich nicht mal mehr erinnern.
»Okay, pass auf«, sagt er. »Das war nur Zeugs, das ich mal irgendwo in einem Film aufgeschnappt habe. Ich habe nicht gemeint, dass du weglaufen sollst. Ich meine … Warum machst du das überhaupt? Was ist los?«
»Ziemlich übel. Richtig übel. Ich hatte keine Wahl. Mein, äh … mein Stiefbruder …«
Im Geiste geht Jeremy das komplizierte Netz familiärer Verflechtungen durch, das diese Stadt zusammenschweißt. »Du meinst Lincoln?«, sagt er nach einem Augenblick.
»Ja. Den mein ich.«
»Was ist mit ihm?«
»Ich muss echt mit jemandem reden«, sagt Jenn.
»Um was geht’s? Was ist los?«
Doch jetzt weicht sie seinem Blick aus. Sie kauert auf dem Bett, die Knie zur Brust hochgezogen, ein emotionales Gürteltier.
»Jenn, hör zu«, sagt Jeremy. »Wenn ich dir helfen soll, musst du mit mir reden. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Wenn uns jemand gesehen hat, müssen sie doch denken … Na ja, ein paar überhaupt nicht gute Gedanken. Verstehst du das?«
Sie sieht ihn an, die Augen dunkel geschminkt. Ihre Finger wandern unbewusst auf die Innenseite ihres Handgelenks, heben den Ärmel leicht an. Jeremy weiß bereits, warum sie bei spätsommerlichem 38-Grad-Wetter mit langärmeligen Hemden rumläuft. Er kannte das feine Gitternetz aus Narben auf ihren Handgelenken; im Unterricht hat sie die Angewohnheit, sie mit einem Finger nachzuzeichnen, nicht wissend, dass sie damit ihr Geheimnis verrät. Man hatte ihn instruiert, solche Dinge zu melden, also hatte er es gegenüber der Sekretärin Mrs. Bekins erwähnt, die gleichzeitig als inoffizielle Schulkrankenschwester fungierte, zumindest insoweit, dass sie aus einer Schachtel, die sie in ihrem Schreibtisch aufbewahrte, Tampons an Bedürftige ausgab. Sie ist eine Ritzerin, hatte Mrs. Bekins ihm erklärt. Die Mutter ist vor einigen Jahren abgehauen. Der Vater war im ersten Golfkrieg dabei, ist verrückt zurückgekommen. Schlimmes Familienleben. Jeremy hatte leise genickt und ging später ins Internet, um nachzusehen, was ein Ritzer ist. Ein Ritzer ist jemand, der sich wiederholt und vorsätzlich Schnittwunden zufügt, häufig mit einer Rasierklinge. Ritzer sind fast ausnahmslos Mädchen.
»Oh ja«, sagt Jenn. »Ich verstehe.«
»Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe«, sagt Jeremy. »Du weißt schon, einen Arzt oder so. Jemanden, mit dem du reden kannst.«
Was Jenn lustig zu finden scheint. Ihre Oberlippe hebt sich eine Nuance, dann atmet sie verächtlich aus. »Ich rede mit jemandem. Ich rede mit Ihnen.«
»Aber du … du kennst mich doch gar nicht.«
»Ich sehe, dass Sie nicht so sind wie die anderen Lehrer. Wir dürfen Sie beim Vornamen nennen. Sie reden mit uns, als wären wir richtige Menschen. Von den anderen interessiert sich keiner auch nur die Bohne für uns. Es ist, als wären sie alle Zombies oder so. Aber Sie sind anders. Sie sind noch nicht hirnamputiert. Sie haben noch eine Seele.«
»Ich freue mich, dass du mir vertraust, Jenn. Echt. Ich möchte dir helfen. Aber du musst verstehen, dass ich nur ein …«
Diverse mögliche Beschreibungen seiner selbst kommen ihm in den Sinn: ein Fünfundzwanzigjähriger, der bei seinem Großvater im Keller wohnt. Ein Krüppel mit Marihuana-Problem und einer heftigen Form von PTBS. Ein Kriegsveteran, dessen Invalidität prozentual nur ein kleines bisschen zu niedrig ist, um den Rest seines Lebens zu Hause zu bleiben und vor der Glotze zu hängen. Ein Loser, der seit Jahren keine Freundin mehr hatte.
»… Kerl bin«, sagt er schließlich. »Ich bin nur ich. Ich besitze keinerlei Fähigkeiten.«
»Aber Sie sind ein Lehrer«, sagt Jenn. »Sie sind eine Autoritätsperson. Sie können irgendwas unternehmen.«
»Was unternehmen wegen was? Geht’s um Lincoln?«
Darauf will sie nicht antworten. Sie wandert weiter mit dem Finger über ihr Handgelenk.
»Ist es etwas, wegen dem du vielleicht besser zu den Cops gehen solltest?«
»Er ist ein Cop«, sagt Jenn.
»Lincoln ist Cop? Seit wann das denn?« Er erinnert sich an Lincoln noch aus der Schulzeit, obwohl er ein paar Jahre jünger ist. Er war ein kleiner Junge, der wie ein Engel aussah und dann zu einem coolen, selbstbewussten Teenager mit übergroßen braunen Augen und langen Wimpern und einem großen, langgliedrigen Körper heranwuchs. Seit seiner Rückkehr hat Jeremy ihn nicht gesehen, vielleicht hätte er ihn aber auch gar nicht wiedererkannt, wenn er ihm begegnet wäre. So viele seiner Klassenkameraden hatten sich bereits in nicht wiedererkennbare ältere Versionen derer verwandelt, die am Fliegenpapier seiner Erinnerung klebten. Aus Jungs waren Väter mit kahlen Stellen und Bierbäuchen geworden; aus Mädchen waren Mütter mit ausgelaugten Brüsten und Krampfadern geworden. Alle sahen aus wie vierzig, fünfzig, hundert. Als wäre Afghanistan ein schwarzes Loch gewesen, das für ihn die Zeit angehalten hatte, während sie sich weit weg vom Krieg zu Hause beschleunigt hatte.
»Er ist letztes Jahr Deputy Sheriff geworden. Also gehört er zu ihnen. Und die decken sich immer gegenseitig. Das hat er mir selbst gesagt. Ich so: ›Was ist mit mir? Wir sind doch praktisch zusammen aufgewachsen. Gehöre ich damit nicht auch zu dir?‹ Und er hat nur gelacht. Wissen Sie, was er gesagt hat? Die Cops sind jetzt seine Familie, hat er gesagt. Seine wichtigste, echte Familie. Das hat er zu mir gesagt.«
Sie beginnt zu weinen, ihre schmalen Schultern beben. Jeremy muss den Drang unterdrücken, seine Hände darauf zu legen. Fass sie nicht an, ermahnt er sich. Du willst deinen Job behalten, nicht im Knast landen? Dann wickle dich in Plastikfolie und bleib auf der anderen Seite des Raumes.
»Ich hab Geld gespart«, fährt sie mit einem Tremolo in der Stimme fort. »Ich hab vierhundert Mäuse. Ein bisschen davon hab ich für das Zimmer hier ausgegeben, aber ich hab immer noch genug, um irgendwohin zu fahren. Hier, sehen Sie.« Sie greift in ihre Handtasche und zieht ein Geldbündel heraus. Sie fängt an zu zählen. Die Verzweiflung in ihrer Stimme weckt in Jeremy den Wunsch, sich die Bauchspeicheldrüse herauszureißen. »Hundert, zweihundert, dreihundert, drei-zwanzig, drei-fünfzig –«
»Warte, sag’s nicht«, sagt Jeremy. »Du hast da noch dreihundertachtundfünfzig Dollar.«
Jenn starrt ihn mit großen Augen an. Sie hält einen Fünfer und drei Einer hoch. »Woher wussten Sie das?«
Jeremy reibt sich das Gesicht. Geist von Smarty, denkt er, aktiviere deine Zauberkräfte. Verwandle mich in einen Wirbelwind oder einen Superhelden oder sonst irgendeinen Kack.
»Ich hab von hier aus mitgezählt«, sagt er.
»Und wie viel würd’s jetzt kosten?«
»Wie viel würde was kosten?«
»Dass Sie ihn umlegen«, sagte Jenn.
Jeremy schwankt zurück, wie eine Schießbudenente mit aufgemalter Zielscheibe, ein aufblasbarer Clown mit beschwertem Hintern. Die Unterhaltung hatte schon schräg begonnen und war jetzt innerhalb weniger Minuten völlig aus dem Ruder gelaufen.
»Jenn«, sagt er geschockt. »Scheiße, wofür hältst du mich eigentlich? Für einen Auftragskiller? Ich bin dein Physiklehrer!«
»Ja, klar, aber Sie waren doch im Krieg, stimmt’s? Sie haben schon Leute umgelegt. Ich hab gehört, nach dem ersten Mal geht’s erheblich leichter. Alle sagen, Sie sind so was wie ein großer Kriegsheld oder so. Für Sie wäre das doch ein Klacks!«
»Du verarschst mich, ja?«
»Bitte, Jeremy«, fleht sie ihn an. Das Make-up läuft ihr inzwischen übers Gesicht. »Ich würde Sie ja jetzt nicht darum bitten, wenn ich der Meinung gewesen wäre, es gebe noch eine andere Möglichkeit. Aber es gibt einfach keine.«
Plötzlich fühlt er sich ganz schwach, und ihm beginnt der Kopf zu schwirren. Er erkennt dieses Gefühl wieder. Nein, nein, nicht jetzt, denkt er. Normalerweise wird es ausgelöst durch laute Geräusche oder durch Bilder im Fernsehen oder Artikel im Internet, die er besser nicht gelesen hätte. Aber er hat seit Monaten keinen dieser Anfälle mehr gehabt. Lola Linker, seine Beraterin, hatte angedeutet, dass er womöglich geheilt sein könnte. Aber er fühlt sich nicht geheilt. Das Mysterium dieses einen Tages, der in seinem Gedächtnis fehlt, jenes Tages, an dem die Bombe hochging, der Tag, an dem Smarty und zwei weitere in tausend Stücke gefetzt wurden, hatten sie immer noch nicht gelöst. Und in letzter Zeit leidet er auch immer öfter unter Kopfschmerzen. Üblen Kopfschmerzen. Sie entstehen irgendwo in seinem Schädel, wie eine Messerklinge, die mit der Spitze voran auftaucht. Und jedes Mal ist die Klinge ein wenig breiter, ein wenig schärfer; und jedes Mal macht sie die Kluft zwischen seinen beiden Hirnhälften noch ein bisschen breiter.
»Was ist los? Mit Ihnen alles in Ordnung?«, fragt Jenn.
»Ich … weiß nicht.«
»Was ist denn?«
Ich fühle mich schwer, will er sagen. Ich fühle mich, als wäre ich auf dem Jupiter. Aber er findet nicht die richtigen Worte. Irgendetwas presst von innen seine Brust zusammen, versucht, sein Herz aufplatzen zu lassen. Er setzt sich auf das Bett ihr gegenüber, legt sich hin und versucht zu atmen.
»Alles in Ordnung?«, fragt sie. Sie klingt verängstigt. »Jeremy? Ist das jetzt ein Herzinfarkt oder so?«
»Schon okay«, keucht er. »Kein Herzinfarkt. Ist gleich vorbei.« Doch er weiß, dass es auch erheblich länger dauern könnte. Manchmal ziehen sich diese Anfälle stundenlang hin. Er legt die Stirn auf seine Knie und atmet tief durch. Wirre Gedanken schießen ihm durch den Kopf, ein Krähenschwarm krächzt die Neuigkeit seiner unmittelbar bevorstehenden Vernichtung hinaus. Einmal, während einer dieser Anfälle, war er zu der Überzeugung gelangt, dass ihn eine Rotte paschtunischer Stammesangehöriger in der Dusche erwartete, wild entschlossen, ihm die Kehle aufzuschlitzen, während er auf der Toilette saß. Das hatte zwei Tage lang angehalten, während derer er in einen Plastikbeutel kacken musste, weil er zu viel Angst hatte, ins Bad zu gehen. Er hatte es in der gleichen Dose versteckt, in der er auch Protons Hundescheiße aufbewahrte. Davon hat er nicht mal Lola Linker erzählt. Es gibt Sachen, die sind einfach zu abgedreht, um sie seinem Seelenklempner zu erzählen.
»Soll ich Ihnen irgendwas holen? Wollen Sie ein Glas Wasser?«
»Okay«, sagt er, denn was spricht dagegen?
Sie verschwindet ins Bad. Er hört das Wasser durch die Rohre laufen, die unter dem Fußboden knacken und rauschen, und einen Augenblick später kehrt sie mit einem Glas zurück, das eine wirbelnde, lauwarme, bräunliche Substanz enthält. Wüstenwasser, durch verrostete Rohre tief aus dem Boden hochgepumpt und gnadenlos behandelt, um es trinkbar zu machen. Sein Großvater hatte sein gesamtes Berufsleben im Pumpwerk damit zugebracht, dieses Wasser über die Berge zu bringen. Es sollte eigentlich in Mexiko ankommen, hatte Al Jeremy einmal erzählt. Aber Amerika bekam es zuerst, was auch Amerikas gutes Recht war. Indianerstämme südlich der Grenze mussten ihren Kram einpacken und weiterziehen, weil ihre Flüsse ausgetrocknet waren und als Swimmingpools in LA endeten, statt die historische Reise in die Heimat ihrer Ahnen anzutreten. Tja, scheiß auf sie. Wenn sie die Chance dazu hätten, hat Al erklärt, würden sie unser Wasser auch nehmen.
Jeremy nimmt das Glas mit gestohlenem indianischem Wasser und stellt es auf den Nachttisch. »Tut mir leid. Das passiert manchmal –«
Mit einem Mal weiß er, dass er – allen möglicherweise gegenteiligen Absichten seiner Beine zum Trotz – schleunigst auf die Toilette rennen muss. Er schafft es so gerade eben noch, die Tür hinter sich zu schließen, bevor ihm das Mittagessen in einem gewaltigen Schwall hochkommt.
In diesem Moment steigt eine Erinnerung in ihm auf. Überrascht begreift er, dass es eine der fehlenden ist, gerettet aus den Wirren seines Unterbewusstseins, ein einzelner Halm aus einem chaotischen Haufen. Er erinnert sich an lauten Rap aus einer Stereoanlage – wahrscheinlich die von Jefferson. Er schaltete das Ding nie aus. Und er erinnert sich an einen Mann, in dessen Hals ein Schlauch steckte, Arme und Beine mit Kabelbindern gefesselt, um ihn herum Soldaten, einer davon Jeremy, während Cap’n Woot mithilfe eines Trichters Wasser in den Schlauch schüttete. Der Bauch des Mannes schwoll sichtlich an. Dann trat Woot im Takt der Musik auf seinen Bauch. Wasser brach aus seinem Leib hervor, genauso wie Jeremy sich jetzt übergibt. Scheiß auf Waterboarding, sagte Woot. Genau darum nennt man mich auch den Schwedentrunk-Mann, Jungs! So machen wir das bei den Spitting Cobras!
Wer war der Mann? Keine Ahnung.
Warum machten sie das mit ihm? Auch daran kann er sich nicht mehr erinnern.
Er verharrt noch einige Minuten über der Kloschüssel, wartet, dass mehr kommt, aber nichts passiert. Die Musik hämmert immer noch in seinem Kopf. I’s a mothafuckin’ killah, yeah, a loony with a gun. I chase them raghead niggahs and I smoke they ass fo’ fun. I’m a homicidal maniac, a baby-shootin’ brainiac, a totally insaniac …
Schließlich spült er sich so gut es geht den Mund aus. Ohne Zahnbürste, ohne Mundwasser, ohne alles muss er den beißenden Geschmack seiner eigenen Magensäure aushalten, bis er nach Hause kommt. Er sieht zum Fenster hinüber, und ihm kommt eine abstruse Idee: Er wird dort hinauskriechen, ums Haus herum zu seinem Auto gehen, nach Hause fahren und so tun, als wäre nichts von alledem jemals passiert. Aber das kann er nicht. Er kann sie nicht so sitzen lassen, wie er sitzen gelassen worden ist, so wie er viel zu viele andere Leute sitzen gelassen hat.
It’s a mothafuckin’ killah …
Er kehrt in das Zimmer zurück. Jenn kauert auf dem ersten Bett, starrt über ihre Kniescheiben ins Nichts. Sie rührt sich, als er die Tür öffnet.
»Mit Ihnen alles okay?«, fragt sie.
… a loony with a gun.
»Ja, alles bestens.« Er braucht seine Medikamente, mindestens drei oder vier Gramm Humboldt County Hybrid. Wenn er einen Joint dabeihätte, dann würde er das Ding jetzt anzünden, selbst in ihrer Gegenwart. Er muss unbedingt zu seinem Depot.
»Mein Dad kotzt auch dauernd«, sagt sie. »Er sagt, er kotzt jetzt schon seit zwanzig Jahren. Ausgebranntes Plutonium, sagt er. Scheiß Staat, häh?«
»Pass auf«, sagt Jeremy. Er setzt sich ihr gegenüber hin. »Wir müssen reden. Weil, äh … Ich glaube, du machst dir eine falsche Vorstellung von mir.«
»Tu ich das?«
»Ja. Weißt du, worum du mich gebeten hast? Ich kann nicht, ich meine, so bin ich nicht.« Nicht mehr, fügt er in Gedanken hinzu, und fast kann er das Gelächter des Trupps in seinem Kopf hören, der einzige Ort, an dem die meisten von ihnen noch existieren. »Ich glaube nicht, ähem … ich glaube nicht an Gewalt.« Nicht mehr. »Ich finde, sie ist falsch.« Jetzt. »Und deine Probleme würde sie auch nicht lösen.« Bis auf eines.
»Dann haben Sie noch nie jemanden umgebracht?«, fragt Jenn.
Mit einem Mal möchte er den naiven Ausdruck aus ihrem Gesicht prügeln. Stattdessen jedoch steht er auf und schreitet den Raum auf und ab. I’m the niggah on the triggah and I see you in my sights. Gonna waste your mom and daddy, gonna fuck yo ass all night. Herr im Himmel. Er muss unbedingt diese Musik aus dem Kopf bekommen.
»Tut mir leid«, sagt Jenn. »Vielleicht geht mich das alles gar nichts an.«
»Ja, vielleicht ist das so«, sagt Jeremy. »Vielleicht solltest du nie wieder irgendwem diese bescheuerte Frage stellen.«
»Entschuldigung, tut mir leid«, wiederholt Jenn. »Hab mir nichts dabei gedacht.«
»Es tut dir leid? Du hast ja überhaupt keinen Schimmer, was das bedeutet! Willst du wissen, was Entschuldigung bedeutet, schön, das kann ich dir zeigen! Und vielleicht solltest du verdammt noch mal erst nachdenken, bevor du mit so einem Scheiß anfängst. Du ahnst ja gar nicht, was du da lostrittst.« Dann hört er abrupt auf und presst sich eine Hand auf den Mund, bevor er sie sich so richtig vorknöpft. So ist es immer nach einem Anfall. Er könnte vor Wut alles kurz und klein schlagen.
Wer war der Typ überhaupt? Warum kann er sich nicht an sein Gesicht erinnern?
Jetzt hat er ihr Angst eingejagt. Er atmet tief durch. Die Messerklinge schiebt sich wieder langsam nach vorn, schneidet durch die Sanftheit, die er noch in sich trägt. Viel ist an diesem Punkt nicht mehr übrig.
»Ich denke, ich gehe jetzt wohl besser nach Hause«, sagt Jeremy.
»Okay«, antwortet sie. Sie sieht erleichtert aus. Weil er geht. Scheiße. Er ist völlig durchgedreht. Immer noch.
»Jenn, tut mir leid. Ich wollte nicht, ähem … Ich wollte dich nicht anbrüllen. Es tut mir leid. Echt.«
»Schon okay, Mr. Merkin«, erwidert Jenn. Ihre Haltung hat sich verändert. Sie ist ernst und zurückhaltend, sitzt gerade da, hat den Blick auf ihre Hände gesenkt. Versucht, ihn nicht aufzuregen. »Sie haben recht. Ich habe nicht nachgedacht.«
»Und? Was machst du jetzt?«, fragt er. Er versucht sein Bestes, völlig normal zu klingen. Zu wenig und zu spät, aber er will nicht, dass sein Name als ein weiterer auf der Liste von Teufeln in ihrem Leben steht. Verflucht. Warum ist er hergekommen? Er hätte den Zettel wegschmeißen sollen. Weil er dieses Arschloch Lincoln umlegen könnte, kein Problem. Er könnte sich an ihn heranschleichen, ihm ein Messer über die Kehle ziehen und ihm anschließend damit in die Niere ficken. So einfach wie Fahrrad fahren. Woher hatte sie es gewusst? Konnte sie es ihm einfach so angesehen haben? Konnte sie das Kainszeichen auf seiner Stirn erkennen?
»Hierbleiben, schätze ich«, sagt Jenn. »Heute Nacht. Hier bin ich wenigstens sicher.«
»Vielleicht solltest du es deinem Dad erzählen.«
»Ja, genau. Super Idee.«
»Wird er dir nicht helfen?«
»Mein Dad ist kein sonderlich gefestigter Mensch«, sagt sie.
»Hör zu, Jenn. Wenn du’s nicht jemandem erzählst, muss ich es Porteus berichten. So sind die Vorschriften. Ich bin dein Lehrer, und du bist noch minderjährig. Wenn ich erst einmal so etwas höre, kann ich das nicht mehr ungehört machen.«
»Was?«, kreischt sie. »Nicht Porteus! Scheiße, Jeremy, dann weiß es innerhalb einer Stunde die ganze Schule!«
»Nein, wird sie nicht«, sagt Jeremy und weiß doch, dass sie recht hat, weiß aber gleichzeitig, dass er gar keine andere Wahl hat. »Außerdem wird es nicht aufhören, bis du es jemandem erzählst. Er wird nicht einfach so von sich aus aufhören.«
»Bitte, Jeremy, bitte, bitte, bitte. Ich blas Ihnen einen. Wie wär’s?«
»Oh, scheiße, Jenn, nein, mach das nicht. Jetzt gehe ich wirklich. Sieh mich an. Ich gehe.« Er steht wieder auf, aber er versucht sich zu schnell zu bewegen, und ein stechender Schmerz dringt wie eine glühende Degenklinge in ihn ein und zwingt ihn in die Knie.
»Ich mach das echt gut!«, kreischt Jenn. »Ich hab jede Menge Übung!«
Sie steht auf dem Bett, das Gesicht puterrot, die Sehnen auf ihrem Hals treten so deutlich hervor, als würde sie von ihrer eigenen Wut erdrosselt. Sie hat nicht mal mitbekommen, dass er fast kollabiert wäre. Sie sieht aus, als stünde sie kurz davor, vollends auszurasten. Er hat schon Leute gesehen, die durchgedreht sind, erst kürzlich den Typen im Spiegel, und sein Gesichtsausdruck ist dem ihren verdammt ähnlich gewesen. Er hat keine Ahnung, was er sagen soll, also sagt er nichts. Jetzt ist er der Ruhige. Schmerz hat bei ihm diese Wirkung. Sie nivelliert ihn, relativiert die Dinge. Genau deshalb ist er manchmal dankbar dafür. Er wartet einfach ab.
»Okay«, sagt sie schließlich schwer atmend. »Okay. Ich hab’s ja sowieso nie offen ausgesprochen. Oder? Also können Sie auch nichts melden, was ich nicht gesagt habe.«
»Ich schätze, nein«, antwortet Jeremy.
»Ich hab nur Andeutungen gemacht. Ist gut möglich, dass ich nur Scheiße labere. Sicher können Sie nicht sein.«
»Genau.«
»Gut möglich, dass ich mir alles nur ausgedacht hab. Sie wissen es nicht. Stimmt’s? Stimmt’s?«
»Okay«, sagt Jeremy. »Okay, ich werde nichts sagen.«
»Danke«, sagt Jenn, inzwischen völlig ruhig, und dann steigt sie vom Bett und setzt sich wieder hin, faltet wie zuvor die Hände sittsam auf dem Schoß. Sie wirkt erschöpft. »Jeremy.«
»Ja.«
»Es … tut mir leid, was ich da gerade gesagt habe. Das mit dem Blowjob. Ich hab mich nicht bremsen können, es ist mit mir durchgegangen. Ich weiß doch, dass Sie nicht so ein Typ sind.«
Einen Moment lang denkt Jeremy, sie meint, er sei nicht der Typ, der auf Blowjobs steht, und will schon Einwände erheben, doch dann versteht er, was sie wirklich meint: dass er nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie ihr Stiefbruder Lincoln Moon, der es voll verdient hätte, wenn ihm etwas ausgesprochen Fieses zustoßen würde – wenn schon nicht der Tod, was sowieso viel zu einfach wäre, dann doch zumindest etwas, das extrem schmerzhaft und von langer Dauer ist. Zu blöd, dass Woot nicht hier ist, denkt Jeremy. Er würde ihn den ganzen Tag lang foltern. Aber Jeremy hat nicht mehr die Nerven für so was. Dieser Teil seines Lebens ist vorbei.
»Gib mir dein Telefon«, sagt er.
Sie reicht es ihm. Er tippt seine Nummer ein und gibt es ihr zurück. »Ich sollte das nicht tun, aber falls du in Schwierigkeiten gerätst, schickst du mir ’ne SMS. Halt mich auf dem Laufenden, so oder so. Okay? Damit ich weiß, dass es dir gut geht.«
»Okay. Danke. Und es tut mir leid, falls ich Sie wütend gemacht habe mit dem, was ich gesagt habe.«
»Schon okay«, sagt Jeremy. »Vergiss es einfach. Ich … hab ein paar Sachen, an denen ich arbeiten muss.«
»Jeremy?«
»Was?«
»Sie haben mir echt einen Augenblick lang ’ne Scheißangst eingejagt.«
»Tut mir leid«, sagt er und denkt: Entschuldigen wir uns jetzt immer weiter beieinander für alles Mögliche?
»Nein, nein«, sagt sie. »Es war sehr männlich.«
Sie steht auf und kommt zu ihm, nimmt sein Gesicht in die Hände und zieht es zu sich hin. Doch er stößt sie weg, macht sich gar nicht erst die Mühe, behutsam zu sein, denn wer ist diese blöde kleine Schlampe überhaupt, dass sie in seinem Kopf ein solches Chaos anrichtet? Fünf Jahre Therapie den Bach runter. Er wartet nicht mal ab, um zu sehen, ob sie auf den Arsch fällt. Er geht einfach zur Tür heraus.
Er fährt eine halbe Meile die Straße hinunter, bevor er rechts ranfahren muss. Er legt sich quer über die Vordersitze, damit niemand ihn sieht. Jetzt wühlt sich das Messer wie verrückt von einer Seite zur anderen. Als würde jemand in einem Topf rühren.
Er bohrt sich die Finger in den Kopf, als könnte er sein ganzes Gehirn rausziehen, es dann einfach so an den Straßenrand schmeißen und wegfahren. Er hat Angst vor dem, was er tun wird, falls jemand an seine Scheiben klopft. Wenigstens ist keiner in der Nähe, der die Geräusche hört, die er von sich gibt. Da ist nur der Wind, und dem ist es scheißegal.
2
Al Merkin sitzt in seinem Wohnzimmer und wartet darauf, dass jemand nach Hause kommt und Abendessen macht. Auf der anderen Seite des Raumes lümmelt Henry gemütlich in seinem Fernsehsessel, wie eine Muschel in ihrer Schale, die Augenmaske fest auf dem Gesicht, und hört zu, was da gerade im Fernsehen gesagt wird. Seine Hände ruhen auf dem gewaltigen Bauch, und sein Teddybär, Smitty, sitzt auf dem Schoß.
Es ist 16:35. Das Abendessen muss um 17:30 fertig sein, allerdings wird daraus wohl nichts, sofern nicht Henry eine psychische Metamorphose durchmacht und mit einem Mal in der Lage ist, tatsächlich etwas zu tun. Al hat bereits beschlossen, dass er bei der ersten Person, die durch die Tür hereinkommt, vor moralischer Entrüstung explodieren wird, wobei er jedoch beabsichtigt, den Ausbruch völlig spontan aussehen zu lassen. Es sieht so aus, als hätte Helens Tod das präzise Zeitbewusstsein abgestellt, das er benötigt hatte, um seine Familie zusammenzuhalten. Bis vor fünf Wochen war alles noch in einem vorhersehbaren, wenn auch bisweilen abgehackten Rhythmus verlaufen. Sie alle waren Planeten in Helens Umlaufbahn gewesen. Nachdem sie nun nicht mehr von ihrer Anziehungskraft gehalten wurden, war plötzlich jeder wie entfesselt – beinahe vergnügt, so kommt es Al vor, als hätten alle nur auf einen Vorwand gewartet, um sich schnellstmöglich vom Zentrum zu entfernen. Er ist sich bewusst, dass manche Menschen, zum Beispiel Hippies, lieber im Chaos der Achronizität leben, aber für Al ist das kaum besser, als sich zu den Schweinen zu legen. Uhren wurden aus gutem Grund erfunden. Also, verdammt noch mal, wo stecken alle?





























