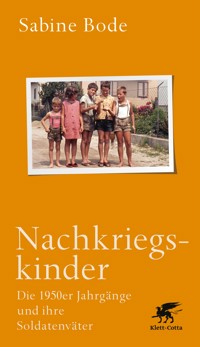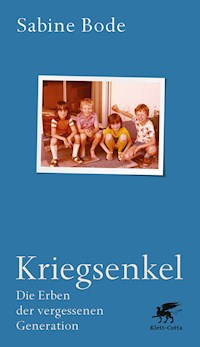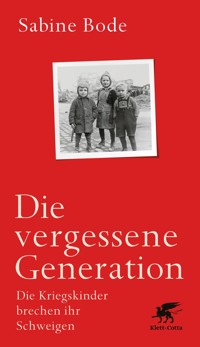12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Verhöhnt und geföhnt, verlacht und gefeiert...
...Abba spiegelt alles, was das Leben an Höhen und Tiefen zu bieten hat: Fame und Frust, Erfolg und Trennung, Disco-Beat und Düster-Balladen.
Bestsellerautorin Sabine Bode war Fünf, als die Schweden den Eurovision Song Contest gewannen und hat seither kaum einen Tag ohne Abba-Songs verbracht. Hiermit legt sie nicht das hundertste Fanbuch vor, sondern bettet Kurioses aus dem Abba-Kosmos in pointierte Geschichten, in denen sich nicht nur Fans der fragwürdig frisierten Schweden wiedererkennen.
Wer sind diese Vier, mit denen wir erst groß und dann alt geworden sind? Welche Lebensweisheiten stecken zwischen den unzähligen „Ah-haaa“s? Sollte man mit Mitte Fünfzig noch in die Naturborsten-Rundbürste singen?
Dabei bieten nicht nur unfreiwillig komische Songtexte, sondern auch die Bandgeschichte viel Raum für abba-witzige Analysen. Ein Buch, so nachdenklich wie „The Winner Takes It All“, so lebensfroh wie „Voulez-Vouz“ und so schreiend komisch wie der zurecht wenig gewürdigte „King Kong Song“.
Ein mitreißend melodischer Pop-Galopp mit der heimlichen Message: „Wenn Dir das Leben zu grau wird, hast Du noch nicht genügend blauen Lidschatten drauf!“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Bestsellerautorin Sabine Bode war vier, als die vier Schweden von Abba den Eurovision Song Contest gewannen und hat seither kaum einen Tag ohne Abba-Songs verbracht. Hiermit legt sie nicht das hundertste Fanbuch vor, sondern bettet Kurioses aus dem Abba-Kosmos in pointierte Geschichten, in denen sich nicht nur Fans der fragwürdig frisierten Schweden wiedererkennen.
Wer sind diese vier, mit denen wir erst groß und dann alt geworden sind? Welche Lebensweisheiten stecken zwischen den unzähligen »Ah-haaa«s?
Dabei bieten nicht nur unfreiwillig komische Songtexte, sondern auch die Bandgeschichte viel Raum für abba-witzige Analysen.
Ein mitreißend melodischer Pop-Galopp!
Autorin
Sabine Bode arbeitete nach dem Studium der Anglistik, Germanistik und Publizistik als Journalistin und Übersetzerin sowie als Gagschreiberin für das Who‘s who der deutschen Comedyszene. Inzwischen ist sie selbst Komikerin und Bestseller-Autorin (u. a. Älterwerden ist voll sexy, man stöhnt mehr), kennt seit fünf Jahrzehnten jeden ABBA-Song auswendig, weiß allerdings oft nicht mehr, warum sie eigentlich in die Küche gegangen ist.
Außerdem von Sabine Bode im ProgrammÄlterwerden ist voll sexy, man stöhnt mehrLassen Sie mich durch, ich muss zum YogaSorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viele
Sabine Bode
»Ich will aber Agnetha sein!«
Verehrt, verhöhnt, verföhnt: Mein Leben mit Abba
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe September 2024
Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
GS ∙ CB
ISBN 978-3-641-31775-1V002
www.goldmann-verlag.de
Für C & A
© FinePic
Inhalt
Intro: No History Book On The Shelf
Ein Interview, das (noch) nicht stattgefunden hat
Und es war Sommer: ABBA-Kalypse und Filterkaffee
Bilder im Kopf: Who the f*** is Benny?
Waterloo in Wuppertal: ABBA ist für alle da
Kitsch perfect: Monotonie in der Südsee
Intermezzo No. 1
Wie ABBA dafür gesorgt haben, dass ich vom Glauben abgefallen bin
Unterschätzte Schätze I
If It Wasn’t for the Nights: Insomnia und If-Clauses
Väter der Klamotte(n): Nice In White Satin
Hummelflug: Frida For Future
3 Non Blondes: Helle Köpfe, alte Zöpfe
Das Popstar-Paradox: Coolsein für Fortgeschrittene
Unterschätzte Schätze II
I Wonder: Die Markenballade mit der Goldkante
Mystery und Migräne: The Sound Of ABBA
Bandenkrieg in Bullerbü: Der Scandic-Tick der Deutschen
Intermezzo No. 2
Warum ABBA Schuld haben, dass ich nicht flirten kann
Alltagspoesie am Arsch: Move on … oder lass es bleiben
Echt jetzt? (V)erklärwerke der Vergangenheit
Unterschätzte Schätze III
Die Folterkammer der Popmusik: The Day Before You Came
Mottoparty From Hell: Saturday Fight Fever
Lust an der Langsamkeit: What’s Another Forty Years?
Outro: Das Ding mit ABBA
Anmerkungen
Danksagung
Intro: No History Book On The Shelf
Ein Interview, das (noch) nicht stattgefunden hat
O-ha. Noch ein ABBA-Buch. Was unterscheidet Ihr Buch von den Millionen anderen Titeln wie »ABBA – die komplette Story«, »ABBA – die jetzt aber wirklich total vollständige Premium-Story«, »ABBA – die Föhnfrisur im Wandel der Jahreszeiten« und »Conni hört ABBA«?
Ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das ich selber gerne lesen würde und in dieser Art noch nicht gefunden habe. Es ist eine Mischung aus Kolumne, Glosse, Kurzgeschichte und biografischen Splittern. Mal analytisch, mal albern, oft beides zusammen. Manchmal geht es viel um ABBA, manchmal liefern ABBA aber auch nur den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit weiteren absurden Phänomenen.
Gibt es denn irgendwas über ABBA, das noch nicht geschrieben wurde?
Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mir erlaubt, nicht nur über Musik, Mode und Zeitgeist zu schreiben, sondern mit Hilfe von ABBA auch zu verwandten Themen zu kommen, die mit auf dem Weg liegen. Es ist gewissermaßen ein Spagat in Spandexhosen zwischen ABBA und allem anderen, was das Leben so mit sich bringt.
Hat uns eine Band, die vor fünfzig Jahren berühmt geworden ist, überhaupt noch was zu sagen?
Ich will es mal so ausdrücken, die Länge der Schulstunden unserer Kinder basiert auf einer Verordnung von 1911. Erwachsene Menschen gehen in Strumpfhosen auf Mittelaltermärkte. Und wegen eines characters, dessen Existenz noch nicht mal belegt ist, dürfen wir sonntags keine Wäsche im Garten aufhängen. Und ABBA sollen keine Bedeutung mehr haben? Waterloo war doch sozusagen gestern.
Sind Sie selbst ein Hardcore-ABBA-Fan?
Ich bin kein Fan-Girl, das man nachts um drei wecken und nach der Platzierung von Knowing Me, Knowing You am 4. April 1977 in Simbabwe fragen kann. Aber auch niemand, der nur eine Best of ABBA-CD im Schrank stehen hat und glaubt, das reicht für den Superfan-Ausweis. Ich sage »Anjäta« statt »Ak-neeta«, mein erstes Haustier hieß Frida und ich habe mir von meinem Taschengeld sämtliche LPs gekauft. Aber ein faktenspeiender Nerd bin ich auch nicht.
Muss man ausgewiesener ABBA-Experte sein, um dieses Buch zu goutieren?
Na ja, man sollte schon ein paar Basics wissen oder sich zumindest dafür interessieren. Der Rest ergibt sich auf dem Weg. Wer irgendwo zwischen Realität und Retro-Romantik, zwischen Glamour und Gesundheitsschuh taumelt, der wird hoffentlich in Gedanken mittanzen.
Gibt es eine empfohlene Altersklasse?
Da ich selbst Mitte fünfzig bin und aus meiner Perspektive schreibe, gibt es in dieser Altersgruppe vielleicht das meiste Kopfnicken. Wobei das nichts heißen muss, denn in diesem Alter wackelt der Kopf ja oft von ganz alleine. Aber auch Menschen außerhalb der Doppelherz-Zielgruppe werden sicher einige, wie wir ABBA-Fans sagen, »Ahaaa-Erlebnisse« haben.
Warum sind ABBA auch heute noch omnipräsent?
Sie sind wie der Knirps in der Handtasche und der Notfall-Müsliriegel für unterwegs: Wenn’s hart auf hart kommt, muss es eben ABBA sein.
Was erwartet die Leser konkret?
Det handlar om musik och kläder, om att vara blond och om konkurrens kvinnor emellan, men också om sömnlöshet och eskapism, en nyckelring och en knubbig humla.
(Das war Schwedisch).
Es geht etwa um Musik, um Klamotten, Schlaflosigkeit, eine Pummel-Hummel und ’nen Schlüsselanhänger.
Und es war Sommer: ABBA-Kalypse und Filterkaffee
Würde man eine Umfrage unter ABBA-Fans meiner Generation (also Fifty-Somethings) machen, wann sie das erste Mal von der Gruppe gehört haben, würden sicher viele sagen: Na klar, beim Eurovision Song Contest! Ich war fünf (acht? elf?) und auf dem Tisch standen ein Käse-Weintrauben-Igel und die eigens für Fernseh-Fressabende in Form gegossenen und in verschiedenen Sorten angebotenen Schokokugeln aus der Tele Bar. Aber wer hat diesen Moment wirklich miterlebt? Vor allem als Kind – die Siegerehrung dürfte ja erst weit nach Mitternacht erfolgt sein? Und wer hätte damals schon so hellseherische Fähigkeiten gehabt, diesen silber-blau glänzenden Star-Trek-Anziehpuppen eine Weltkarriere zu attestieren?
Der Auftritt ist so oft in diversen Dokus und Reportagen runtergenudelt worden, dass man glaubt, man war live vor dem Fernseher dabei. Wie so oft im Leben ist die Wahrheit oft bedeutend unglamouröser. Meine erste Begegnung mit ABBA, so habe ich es nach einigem Nachdenken aus meinem Erinnerungs-Kopfsalat herausgepult, hatte ich in einem Krankenhaus, in welchem ich dank eines zu spät entdeckten Hüftschadens einen großen Teil meiner Kindheit verbracht habe.
Ich war sieben Jahre alt und verbrachte meine Zeit in einem Gitterbett, was irgendwie seltsam war, denn von den Füßen bis zur Brust eingegipst, waren die Chancen, dort herauszufallen, sehr gering. Die einzigen Beschäftigungen, die sich in Rückenlage ausführen ließen, bestanden darin, ein Max-und-Moritz-Schiebe-Puzzle bis zum Exzess hin- und herzuschieben, bis das Bild richtig war, oder einer nackten Puppenschablone auf einer selbstklebenden Scheibe diverse Modesünden anzuziehen. Nicht gerade tagesfüllend, und die auf mittwochs und samstags beschränkten Besuchszeiten gestalteten den Alltag auch nicht gerade abwechslungsreicher.
Nachmittags saßen die Krankenschwestern in einer Ecke des großen Saals immer am Tisch und tranken Bohnenkaffee. Es roch herrlich, und ich fragte mich, ob er auch so gut schmeckte, wie der Duft verhieß. Wenn sie ihren Kaffeeklatsch veranstalteten, legten sie uns manchmal einen Säugling von der angrenzenden Neugeborenen-Station ins Bett. Zum Spielen, wie mit einem Welpen. Was bei mir wenig Sinn machte, denn ob da nun ein zappelndes Bündel zu meinen Füßen lag oder ein Handtuch, war ziemlich egal, ich kam ja eh nicht dran.
Überhaupt fand ich die Kompetenzen des Betreuungspersonals eher fragwürdig. Eine Schwester fragte mich abends mal, warum ich meine Brille absetzen würde, so würde ich ja gar nicht sehen, was ich träume. Ich dachte, sie sei nicht mehr ganz bei Trost, oder wie man damals im Ruhrgebiet sagte: Die hamse wohl mit’m Hammer gekämmt.
Ich weiß nicht, ob es nur meinen eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten oder dem generellen Misstrauen gegenüber dem Pflegepersonal geschuldet war, jedenfalls entwickelte ich nach einigen Monaten in der Waagerechten etwas, von dem ich erst später erfahren sollte, dass man es stereotype Bewegungen als Folge von Hospitalismus nennt: Wie ein Elefant im Zirkus den Kopf hin- und herschaukelt, bewegte ich den Oberkörper in fast schon zwanghaften Bewegungen abwechselnd zur einen und zur anderen Seite, so weit es eben ging. Da kam es mir gerade recht, dass aus dem Zimmer nebenan, in dem die Älteren (also ab zehn aufwärts) untergebracht waren, auf ihren Kassettenrekordern die Hits des Jahres 1976 dudelten: Moooviestar, Mi-hi-ssissippi oder das textlich doch sehr schlichte Daddy Cool. Ich wunderte mich, warum es für Peter Maffay das erste Mal im Leben Sommer war, denn der sah ja schon damals ziemlich alt aus, und was Jürgen Drews eigentlich meinte, als er in Ein Bett im Kornfeld zugab »Ich brauch’ keine weichen Daumen«. Am meisten aber blieben mir Fernando, Mamma Mia und Dancing Queen im Ohr. Wenn diese Songs liefen, summten auch die Schwestern in der Kaffee-Ecke mit, und ich konnte ungeniert mit den Schultern zucken, ohne dass es weiter auffiel.
Irgendwann kam der Gips ab. Meine Beine waren streichholzdünn, und ich wurde in einem Rollstuhl nach draußen gefahren, wo gerade ein Sommerfest im Gange war. Dort gab es Eierlaufen, Sackhüpfen und lauter anderes Zeug, was sicher großen Spaß machte, wenn man gehfähig war. Mir war’s schnurz, denn durch meine Hornbrille hatte ich einen guten Blick auf ein kleines Podest, auf dem ein etwa zehnjähriges Mädchen in Schlagjeans und geblümtem T-Shirt zur Begleitung einer Schülerband Mamma Mia sang. Das Lied, zu dem ich im Bett in meinem kalkweißen Korsett immer zur Gipsi-Queen mutierte und in Wipp-Ekstase verfiel! Auf Englisch oder vielmehr dem, was ich und sie dafür hielten! Auswendig! In ein echtes Mikrofon! Ohne Lampenfieber! Ich war völlig geflasht. Dieses Kind war für mich eine Göttin. So viel Traute müsste man erst mal haben!
Es war ein zaghaftes Blicken durch den Türspalt hinein in das Zimmer, das man Zukunft nennt. Und ich hatte die leise Ahnung, dass es kompliziert werden würde: Ich wollte so alt werden, dass ich mich trauen würde, vor Publikum Mamma Mia zu singen, aber nicht so alt, dass ich glauben würde, man bräuchte zum Träumen eine Brille.
Im Nachhinein betrachtet war mir dieser kleine Moment lieber als ein nach Mettschnittchen müffelnder Europa-singt-um-die-Wette-Abend. Ich gönne allen, die dabei waren, dass sie sich lebhaft an die gereichten Fliegenpilz-Eier und das Fürst-Pückler-Eis auf dem guten WMF-Servierteller erinnern und davon vor dem Bluescreen in irgendwelchen »Die 50 meistabgenudelten Hits der letzten 99 Jahre«-Retro-Shows berichten. Mein Mamma-Mia-Girl aber gehört mir ganz alleine. Es hat sich fest in mein Hirn gebrannt wie mein Gips in die wundgescheuerte Haut. Was auch immer Peter Maffay in seinem denkwürdigen Sommer erlebt haben mag, besser als diese Darbietung kann es nicht gewesen sein. Und so möchte ich diesem unbekannten Wesen jetzt und hier entgegenrufen: Danke, dass du mein erstes Role Model warst. Wer braucht schon Marie Curie, Audrey Hepburn oder eine von diesen ABBA-Frauen, die ich damals noch gar nicht namentlich kannte?
Denn Wembley Arena kann jeder. Aber auf einem Sommerfest im popeligen Herten neben einem verpeilten Bontempi-Orgel-Typen »Mamma Mia, hiwi go ä-häm« zu säuseln, während nur circa fünf Leute zuhören und der Rest sich lautstark erkundigt, wie viele Wertmarken man für eine Bratwurst benötigt, dazu braucht man ein Mindset, das einem heute nicht mal ein Jürgen Höller in einem Zehntausend-Euro-Motivationskurs einpflanzen könnte. Und so ließ ich mich an jenem Tag freudig wieder ins Zimmer zurückschieben, selig grinsend und wissend: Das Leben kann kommen.
Bilder im Kopf: Who the f*** is Benny?
Ich habe ein guilty pleasure. Beim abendlichen Spazierengehen gucke ich gerne im Vorbeigehen in erleuchtete Wohnungen hinein. Nicht notorisch wie James Stewart in Das Fenster zum Hof, nein, ich versuche vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes beiläufig einen kurzen Blick auf die Einrichtung oder gar einen Moment der sozialen Interaktion zwischen den Bewohnern zu erhaschen und so ein wenig Kopfkino-to-go mitzunehmen. »Lünkern« heißt dieses interessierte Observieren bei uns im Ruhrgebiet und ich gestehe: Ich liebe es.
Reise zurück in die Zukunft
© Dave J. Hogan/Getty Images
Manchmal sieht man jemanden emsig in der Küche hin- und herlaufen. Manchmal sieht man nur Schatten am Tisch sitzen und hört durchs offene Fenster Musik. Ich kenne diese Menschen nicht, aber durch eine kleine Bewegung oder auch einen Ausruf (»Ker, dooh, mamma die Musik leiser!«) wird sofort meine Fantasie angekurbelt.
Wenn einer etwa das Wort »Musik« auf der ersten Silbe betont, stelle ich mir sofort vor, dass dieser Mensch mit Sicherheit Volker mit Vornamen heißt und beim Servieren »Guten Appe« wünscht. Dann denke ich, gut, dass ich kein Teil dieses Familienverbunds bin. Ist ja schnell passiert, einmal nicht hingeguckt, und man hat Nachkommen mit jemandem, der beim Verabschieden »Piss dann, aber nicht vor meiner Haustür« sagt.
Wenn ich sehe, wie jemand mit einer Designer-Schere ein paar Blättchen Basilikum von der Fensterbank schnippelt, denke ich sofort: Was für ein aufmerksamer Typ Mensch! Der hat bestimmt seinem Schatz nach einem langen Arbeitstag schon ein Entspannungsbad eingelassen und bringt diesem gleich ein selbst geschmiertes Bütterchen mit Grünzeug-Haube an die Chaiselongue. Oder ist es einer von diesen dopaminsüchtigen Food-Influencern, die sich ein Tiefkühlbaguette in die Mikrowelle werfen, ein paar Blättchen drüberstreuen, sich damit lässig in die Fensternische fläzen, alles auf Insta hochladen (#comfortfood) und so tun, als hätten sie den Sauerteig drei Tage lang selbst geknetet?
Dieses leicht verboten scheinende Eindringen in die Privatsphäre fremder Menschen ist ein bisschen peinlich, aber auch sehr kurzweilig.
So ist das auch mit meinen Bildern der ABBA-Mitglieder. Ich bilde mir ein, etwas über sie zu wissen, mir davon etwas abzugucken oder mich davon abzugrenzen, und versuche damit mein eigens Dasein irgendwie zu definieren, ganz egal, wie bruchstückhaft meine Persönlichkeitszeichnung auch sein mag.
Genauso wie ich gerne Rezeptbücher durchblättere und in den Abbildungen schwelge, genau wissend, dass ich die 35-Zutaten-Kreationen niemals nachkochen werde, schaue ich mir gerne ABBA-Bildbände an und tauche in die Gesichter und Geschichten ein. Es sind nicht nur Erinnerungen an alte Zeiten, die einen dann so wohlig streifen wie ein altes Fruit Of The Loom-Sweatshirt, das man seit vierzig Jahren im Schrank hat. Es ist auch das willkürliche Hineininterpretieren von Charaktereigenschaften und Abgleichen mit dem eigenen Empfinden, ohne die Person je getroffen zu haben. Dann kann ich mir ganz ohne Schuldgefühle wie eine Adelsexpertin vorkommen, so eine Föhnfrisuren-Tante mit komischem Namen wie Sophie von Kiesbach-de-Lumière, die aufgrund von vagen Anspielungen in der Klatschpresse ein Psychogramm von Thronfolger XY aus dem Ärmel schüttelt, das in puncto Fundiertheit einem Friseursalon-Gespräch in nichts nachsteht:
»Hömma Hilde, datt Prinzessin Viktoria iss ja der ihre Mutter wie aussen Gesicht geschnitten!«
»Jau, Inge, und die ist genauso pfiffich! So wie dat Silvia sich als Olympia-Saftserviererin den Könich geschnappt hat, hat die sich ja ihren schmucken Fitnesstrainer gekrallt, nä! Dabei kann der noch nich ma richtig schreiben tun!«
Wenn ich mir zum Beispiel Frida angucke, dann sehe ich eine bodenständige Frau, lebenslustig und nahbar. Sie hatte die Haare meistens über die Rundbürste nach innen geföhnt und sah damit aus wie meine Grundschullehrerin, wenn nicht gar wie ALLE Grundschullehrerinnen der 70er-Jahre. Freundlich, aber direkt und ohne Sinn für Firlefanz. Sie nahm Tanzunterricht, genoss ihre Solo-Einlagen auf der Bühne und hatte ein Faible für Pelzmäntel, das fand ich immer scheiße. Andererseits: In Schweden ist es sicher etwas kälter als hier und die haben’s da vielleicht nicht so mit Tierschutz.
Die Schüchterne zu spielen überließ sie lieber Agnetha. Diese biss sich beim Singen immer verlegen auf die Unterlippe, was immer ein komisches Bild zwischen lasziv und verzweifelt ergab. Mit ihren blonden Haaren war sie quasi die Blaupause der hübschen Schwedin von nebenan und eine Melange aus dem Rama-Girl, das in der TV-Werbung im Garten versammelten Familien mit dem Fahrrad die Margarine bis an den Frühstückstisch ausfuhr, und einem engelsgleichen Bühnenstar ohne Extravaganzen. Überhaupt schien sie die ewig Zerrissene, zwischen Popstar und Mutti, zwischen Glamour und Grundgütigkeit, zwischen Showgirl und Schnee-Spaziergängerin, deren Vorliebe für hellblauen Lidschatten die Dramatik ihres Daseins zart unterstrich.
Björn war für mich immer ein erwachsener Lillebror, dieser pausbäckige Junge aus Karlsson vom Dach. Ich fand ihn stets ein wenig weird, weil er immer wieder versucht hat, ohne irgendwelche diesbezüglichen Qualifikationen zu singen und sich auch gerne in die lächerlichsten Klamotten gezwängt hat, ohne zu merken, dass er in einem violett glänzenden Gymnastikanzug aussah wie die lange lila Praline in der Quality Street-Dose. Gepunktet hat er bei mir in späteren Jahren, als er seine Rolle im charmanten Medienprofi gefunden hatte, immer gentlemanlike und einen Scherz auf den Lippen. Er gibt sich quasi als Alleinverwalter des ABBA-Erbes, der souverän vor die Mikros tritt und sich und seinen Hund gerne auf Social Media inszeniert.
Und Benny? Wer ist eigentlich Benny? Über Benny weiß ich am wenigsten. Er ist für mich der ewig grinsende und wippende Typ am Keyboard, der es irgendwie geschafft hat, modische Monstrositäten zu umgehen und sich auch verbal eher im Hintergrund zu halten. Er hat ein verschmitztes Grinsen. Eines, mit dem Michael Schanze einen fünfjährigen Steppke nach der lückenhaften Intonierung von Alle meine Entchen mit einem »Du, das war tomatenstark!« abmoderiert hätte.
Sehr herzerwärmend war auch sein Auftritt bei der Voyage-Premiere, als die Damen in edlem cremefarbenen Designer-Stöffchen erschienen, Björn im Smoking – und Benny in einem langen, gewagt geblümten Walla-Mantel. Vielleicht war es ein Designer-Cape von irgendeinem Top-Couturier, aber es sah halt aus wie der Morgenmantel von Oscar Wilde, der darin das Feuilleton des Daily Telegraph gelesen und Scones gefrühstückt hat. Und das war auch ein Statement: Sollen die anderen sich doch abstimmen, ich zieh meinen Blumenmantel an. Ich wette, Benny ritzt seiner Familie morgens ein Herzchen ins Toastbrot und nennt die Vögel, die im Morgengrauen seine reichlich bestückte Fütterungsstelle aufsuchen, alle beim Vornamen.
Dies alles sind sehr subjektive Wahrnehmungen und sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts oder nur sehr wenig mit der Realität zu tun. Da ich aber weder mit Frida in einer Aqua-Gymnastik-Gruppe bin noch Björn morgens auf der Hundewiese treffe, muss ich mich auf das stützen, was ich habe: Geschriebenes, Gesungenes, Gesagtes, von ihnen selbst und von anderen. Kleine Gesten und Gesprächsfetzen, die vielleicht aufschlussreicher sind als dicke Biografie-Schinken. Vielleicht ist es auch besser, an das Gute in Menschen zu glauben, die man gar nicht kennt, als sich mit der bröckelnden Fassade jener zu befassen, die nur scheinbar gute Freunde oder liebende Familie sind. Wie dieser eine Typ, der sich bei Goodbye Deutschland als liebenswerter Schweden-Auswanderer inszeniert hat, in Wahrheit aber ein gesuchter Mutter-Mörder war.
Da halte ich lieber fest an meiner Lünker-Leidenschaft, die ja vielleicht doch weniger pathologisch ist, als ich vermute – immerhin leben wir in Zeiten, in denen unbekannte Botox-Visagen im australischen Urwald von ihren missglückten Butt Lifts und Klinikaufenthalten wegen Labellosucht berichten, während sie in der Hocke ihre tägliche Bohnenmahlzeit entleeren.
Egal, ob beim Durch-die-Fenster-Spähen oder beim Bildbände-Bestaunen, man kann sich aus diesem Persönlichkeits-Puzzle vortrefflich jene Teilchen herausfischen, die einem bemerkenswert erscheinen, und sich sein eigenes Lebensziel basteln. Und es ist doch in jedem Fall besser, sich eine bruchstückhafte Meinung von jemandem zu bilden, als die Kürbis-Avocado-Torte aus dem Lieblingsrezeptbuch nachzubauen, die in jedem Fall in die Hose gehen wird.
Wenn ich mal irgendwann zum neunzigsten Geburtstag von einem Lokaljournalisten gefragt werden sollte, was man für ein langes, zufriedenes Leben braucht, so stelle ich mir jetzt schon vor, wie ich sagen werde: Ein bisschen Drama, eine Rundbürste, Basilikum auf der Fensterbank und einen geblümten Mantel für alle Fälle.
Mein …
… Lieblings-Agnetha-Moment: Als sie 2013 mit Gary Barlow bei Children In Need Rocks den gemeinsamen Song I Should Have Followed You Home performt. Es ist der erste Auftritt nach langen Jahren des Rückzugs. Ein eher schwacher Song, aber der »Da isse wieder!«-Effekt im Publikum ist deutlich spürbar: Mein Gott, sie ist es wirklich! Diese Stimme! Diese sich beim Singen kräuselnde Nase! Der zaghafte Hüftschwung! Man spürt im Publikum die wohlig-warme Welle der Rührung, die man sonst nur verspürt, wenn man ein altes, verloren geglaubtes Schmusetier auf dem Dachboden findet.
Lieblings-Björn-Moment: Als er bei der Premiere von Mamma Mia – das Musical in Essen 2007 auf die Bühne kommt und ich mit zittrigen Händen ein Video mit der Digitalkamera mache, um seine Dankesworte (auf Deutsch!) festzuhalten: »Ich war schon einmal in Essen, mit ABBA in der Grugahalle vor dreißig Jahren. Hier bin ich wieder … mit denselben Liedern!« Während ich mich sonst über filmende Konzertbesucher gerne aufrege, konnte ich hier nicht umhin, das aufgeregte Fan-Girl zu spielen. Aber hey, damals war ich jung (noch unter vierzig!) und ungehemmt.
Lieblings-Frida-Moment: Als sie im (zugegebenermaßen etwas amateurhaften) Video zu Head Over Heels übermütig und ein wenig »drüber« die Titelheldin mimt. In dem Song geht es um eine egozentrisch-überzogene Frau, die mit ihrer Geltungssucht anderen auf den Keks geht. Während Agnetha in The Winner Takes It All oder One Of Us perfekt die Leidende mimt und damit auch ihr Image als einsame Greta Garbo fördert, spielt Frida hier genüsslich die Rolle der überkandidelten Nervensäge, ohne dass jemand auf die Idee kommen würde, die private Frida mit der gezeigten Drama-Queen zu verwechseln. She’s extreme … if you know what I mean!
Lieblings-Benny-Moment: Als er bei der Voyage-Premiere in London 2022 einem englischen Reporter des NME, der ihm das Mikro hinhält, einfach nur trocken entgegenschleuderte: »You never liked us.« Ohne Rachegefühle, ohne Häme, einfach nur feststellend und allenfalls mit einem kleinen Fünkchen Genugtuung. Es war fast, als hätte der Flower-Power-Mantel auch die unsichtbare Superkraft »Sag immer die Wahrheit!« um ihn gelegt. Klarer Fall: Die Welt braucht mehr Bennys!
Waterloo in Wuppertal: ABBA ist für alle da
Gelegentlich belauscht man zufällig Gespräche, die man nie vergisst und immer wieder gerne auf Partys erzählt. Eine meiner lebhaftesten Erinnerungen an ein solches ist diese hier: Ich stehe in einem Plattenladen in Wuppertal (Plattenladen, liebe Kinder, das ist wie Spotify, nur dass ständig einer nuschelt »Nö, hamwanich!«). Einem kleinen Indie-Laden mit einem Plattenverkäufer im Pearl Jam-Shirt, der, wie wohl alle Plattenverkäufer Anfang der 90er, gedankenverloren hinter der Kasse sitzt und die Visions liest.
Auf einmal kommt ein Typ in den Laden, der mangels Band-Shirt oder schräg umgehängter Streetworker-Tasche keine rechte Indie-Credibility zu haben scheint, auf den Verkäufer zu und sagt: »Grüß Gott. Ich bin auf der Suche nach einem Song von Kate Bush. Der geht so …« Just in dem Moment, als der Mann zum Gesang ansetzen will, den ich wirklich sehr gerne vernommen hätte, schreitet der Kassenmann mit einer verbalen Blutgrätsche ein und schreit: »Stopp! In meinem Plattenladen singt niemand Kate Bush! Außer Kate Bush!«
Bäm, das war mal eine Ansage! Ich weiß nicht mal mehr, ob er den perplexen Tenor direkt des Ladens verwiesen hat, aber dieser resolute Ehrenretter des elegischen Elfengesangs von Frau Bush ist heute noch mein heimlicher Held. Allerdings einer, auf den man sich nicht verlassen kann: Wo warst du, als Markus Söder im ABBA-Museum in Stockholm auf der Bühne versuchte, Dancing Queen zu singen und diesen Volksnähe-Fail dann auch noch zwischen den Fotos von seinem mittäglichen Bratwurstgemetzel gepostet hat? Und auch noch von seinem Mediateam darunter tippen ließ »Dancing Queen ist mein absolutes Lieblingslied« (der Nachsatz »und auch das einzige, das ich kenne« passte wohl leider nicht mehr ins Insta-Textfeld).
Warum hat ihm keiner das Mikro weggenommen? Oder gleich das ganze Internet, damit er nicht mehr seinen drei Hobbys frönen kann – Tiere streicheln, Tiere essen oder sinnlos auf Wiesen rumstehen wie der Bärenmarke-Bär?
Söder als Popliebhaber – das ist so edgy wie Helmut Kohls Vorliebe für den Wolfgangsee. Wenn Mucker-Markus in einen bayerischen Plattenladen gehen würde, würde er sicher sagen: »Griasdi, ich suche da so ein Lied von Genesis, und das geht so: ›Weee are se Schämpjens, mai Frääänds!‹ Wissens, des is mei Lieblingslied vom Collins Phil! Habens auch noo was von die Wildecker Herzbuam?«
Sorry, ABBA, dass ihr das noch erleben musstet. Ihr wart schon so vielem schutzlos ausgeliefert: Mamma Mia 2, Chers Cover-Album Dancing Queen oder André Rieu celebrates ABBA.
Haben die euch eigentlich gefragt? Natürlich nicht, weil sie nicht müssen. Die paar Cent GEMA-Gebühren zahlt jeder Showact-Simulant aus der Portokasse. Wo bleibt der Respekt vor Leuten, die ihren Job gelernt haben? So wie sich jeder Makler nennen darf, der »exquisite Wohngegend« buchstabieren kann, und jeder ein Journalist ist, der unter Recherchieren Googeln versteht, darf sich jeder Vorstadt-Vollhonk im halbärmigen karierten Freizeithemd und jede Nagelstudio-Nadine, die ihre Lack-Laube nicht weniger selbstüberschätzend »Nici’s Nail’s« nennt, zum Teilzeit-Popstar ernennen.
Solide Ausbildungsberufe gelten anscheinend nichts mehr. Würde man bei einem Neurochirurgen, den man auf einer Vernissage trifft, sagen: »Ach, wie interessant, das werde ich auch mal machen, wenn ich in Rente bin!«?
Um rohen Fisch in Algenblättern aufzuwickeln, braucht man eine zweijährige Ausbildung zum Sushi-Meister und muss vorher schon drei Jahre Koch gelernt haben. Aber die edelsten Popsongs der Welt vor den Augen der Öffentlichkeit zu Grütze zu stampfen, das darf jede dahergelaufene Schlager-Else auf jedem beliebigen runden Geburtstag und jeder Ministerpräsident auf Reisen, wenn gerade kein Hochwassergebiet zum Posieren in der Nähe ist.
Nur so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Urheber: Pharrell Williams hat eine Unterlassungsaufforderung an Donald Trump gerichtet, nachdem dieser seinen Song Happy 2018 bei einer Kundgebung spielen ließ. Neil Young und Eddy Grant haben sogar geklagt, weil er einfach deren Songs bei seinen Wahlveranstaltungen genutzt hat. Ich frage mich, was in ABBA vorgeht, wenn ihnen Bilder vom deutschen ESC-Vorentscheid zugespielt werden, in dem Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen wie selbstverständlich ein ABBA-Medley stammeln, ohne vorher um Vergebung gebettelt zu haben.
Wenn sie so was sehen, müssten sie doch mindestens so leiden wie Die Toten Hosen, als Tage wie diese auf der Wahlfeier der CDU gespielt wurde, die bei der Bundestagswahl 2013 als stärkste Partei hervorging und Volker Kauder, Angela Merkel und Ursula von der Leyen ungehemmt klatschten und tanzten wie ein Kegelclub aus Wanne-Eickel im ZDF-Fernsehgarten. Die Band kommentierte damals nur trocken: »Das war wie ein Autounfall: Nicht schön, aber man schaut trotzdem hin …«, während in jedem Einzelnen wohl eine kleine Welt zerbrochen ist.[1]
ABBA hingegen scheinen die Devise zu haben: »Was stört’s die Eiche, wenn sich die Sau dran wetzt?«
Und ist es nicht schön, dass Musik Menschen zusammenbringt? Auf jeden Fall. Aber ob damit wirklich gemeint ist, dass der brasilianische Begrüßungstrupp die AIDA-Touristen aus der Eifel beim Landgang in Rio mit Tropical Loveland begrüßt? Steht uns gar der ABBA-Overkill bevor?
Allein im Ruhrgebiet, so ergaben Stichproben, gibt es am heutigen Samstag, an dem ich diesen Text hier verfasse, einen ABBA-Mitsing-Abend, eine Coverband, einen Dancing Queen Boogie-Tanzkurs sowie ein Queen-meets-ABBA-Candlelight-Dinner. Letzteres ist offenbar eine ticketgewordene Packung Die Besten von Ferrero; ein Notfall-Geschenk für Leute, die man nicht kennt: »Och, Queen und ABBA