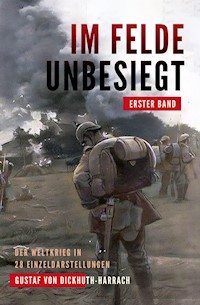
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In kurzen Abständen brausen Feuerüberfälle über uns hin, das Wimmern der Schwerverletzten erstirbt, prasselnd hageln Schauer von Erd- und Geschossbrocken auf unser Blechdach, Splitter singen und zischen umher und wild drängen vorüberziehende Reserven auf uns ein, Deckung suchend treten sie auf die hilflosen Verwundeten, deren Aufschrei sich mengt mit dem ohnmächtigen Warnen und Schimpfen der Sanitätsleute. Ein Kassandraschicksal trägt der Arzt; er muss vielen im Geiste das Todesurteil sprechen, muss langes Siechtum ohne Rettung, muss ewige Verstümmelung und bitterste Not bei vielen voraussehen. Und sie haben doch fast alle so kindliche Zuversicht und sind so glücklich, aus der Hölle der Schlacht geborgen zu sein. Ein braver Sanitäts-Unteroffizier kommt bleich wie der Tod mit zerschmettertem Oberarm zu Fuß an. Obwohl der Arm nur noch an schmaler Muskelbrücke hängt, gönnt er sich trotz allen Zuredens nicht fünf Minuten Rast, in zäher Energie wankt er weiter dem Hauptverbandplatz zu: "Vielleicht kann man mir dort doch noch helfen, operieren, wenn ich nur rasch, rasch hinkomme, ich muss meinen rechten Arm behalten — muss!" In 28 Einzeldarstellungen beschreibt General Gustaf von Dickhuth-Harrach die Fronterlebnisse während des Ersten Weltkrieges. Eindrucksvoll wird der Kriegsverlauf anhand bedeutender Stationen geschildert und geht weit über einen Überblick hinaus. Der Krieg verschlang ungeheure Mengen an Mensch und Material, forderte eine fast übermenschliche Kraftanstrengung. - Nach vier Jahren blieb nur die Trauer und Ernüchterung. – Die Schicksale Einzelner dürfen nicht in Vergessenheit geraten und so kämpft der Autor gegen die Ergebenheit in das Schicksal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Felde unbesiegt
Der Weltkrieg in 28 Einzeldarstellungen
von
Gustaf v. Dickhuth-Harrach
General der Infanterie
______
Erstmals erschienen im
J. F. Lehmanns Verlag, München, 1921
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung
© 2017 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-179-0
© Alle Rechte vorbehalten.
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zum Geleit
Die Dankesschuld.
Von Walter Flex, gefallen auf Oesel für Kaiser und Reich.
Deutsche Infanterie.
Von Franz Schauwecker, im Felde zuletzt Leutnant d. R. im Res.-Inf.-Rgt. Nr. 46.
Der Handstreich auf Lüttich am 5.—7. August 1914.
Von General der Infanterie z. D. Erich Ludendorff, damals Generalmajor und Oberquartiermeister der 2. Armee.
Die Schlacht bei Tannenberg.
Von Generalfeldmarschall Paul v. Hindenburg.
S. M. S. „Emden“ im Kreuzerkrieg in der Straße von Tsushima und im Hafen von Penang.
Von Kapitänleutnant Robert Witthoeft von der Admiralität, damals Wachhabender Offizier an Bord S. M. S. „Emden“.
Der Durchbruch der 3. Garde-Infanterie-Division nach Brzeziny in der Schlacht von Lodz am 23. November 1914.
Von General der Infanterie z. D. Karl Litzmann, damals Generalleutnant und Kommandeur der 3. Garde-Infanterie-Division.
Die Winterschlacht in Masuren im Februar 1915.
Von Major d. Res. a. D. Hans v. Redern, damals Hauptmann d. Res. und Kompagnieführer im Infanterie-Regiment Graf Barfuß (4. Westfäl.) Nr. 17.
Der Überfall in der Wüste auf die Ayesha-Leute. Mai 1915.
Von Oberbootsmannsmaat Friedrich Pinkert. Mit einer Einleitung von Kapitänleutnant a. D. v. Mücke, damals Wachhabender Offizier S. M. S. „Emden“.
Die Eroberung von Nowo Georgiewsk, August 1915.
Von General der Infanterie Gustaf von Dickhuth-Harrach, damals Generalleutnant und Führer des Korps Dickhuth.
Das k. u. k. Kärntner Infanterieregiment Graf von Khevenhüller Nr. 7 am Monte San Michele, November 1915.
Von Major Eduard Barger, damals Hauptmann und Kommandant des III. Feldbataillons dieses Regiments.
Der Kampf um Gallipoli 1915—16.
Von Marschall Otto Liman v. Sanders, Oberbefehlshaber der 5. Osmanischsn Armee, Königlich Preußischer General der Kavallerie.
Ein Zeppelinangriff auf England.
Von Oberleutnant z. S. Hans von Schiller, im Kriege Wachoffizier und Kommandant auf Marineluftschiffen.
Die 43. Reserve-Division am „Toten Mann“, 21. Mai 1916.
Von Hauptmann Felix v. Frantzius im Reichswehr-Schützen-Regiment Nr. 18, damals Hauptmann und Führer des III. Batls. Res.-Inf-Regts. Nr. 201.
Die Seeschlacht vor dem Skagerrag am 31. Mai 1916.
Von Korvettenkapitan Richard Foerster von der Admiralität, damals l. Artillerie-Offizier S. M. S. „Seydlitz“.
Dies Irae. Die Sprengung des Cimonegipfels am 23. September 1916.
Von Major d. R. Otto Sedlar, ehem. Generalstabsoffizier des k. u. k. 11. Armeekommandos, Südtirol.
Schwere Batterie im Großkampf, Frühjahr 1917.
Von Oberleutnant Rudolf Nieter, damals Batterieführer im Mörser-Bataillon 45.
Der Tod von Ypern, Herbst 1917.
Von Wilhelm Schreiner.
Der Adler des Weißen Meeres
Von Hauptmann a. D. Georg Heydemarck, damals Führer der Fliegerstaffel Drama (Vorkommando Flieger-Abteilung 30).
Die Kärntner beim Sturm auf den Polouniß (Flitsch), Oktober 1917.
Von Major Eduard Barger, damals Hauptmann und Kommandant des IV. Feldbataillons dieses Regiments.
Der Durchbruch von Flitsch, Oktober 1917.
Von k. u. k. General der Infanterie a. D. Alfred Krauß, damals Kommandant des k. u. k. 1. Armeekorps.
Die Armeegruppe Arras in der Tank- und Angriffsschlacht von Cambrai im November 1917.
Von Generalleutnant z. D. Otto v. Moser, damals Führer der Armeegruppe Arras.
„UB 57“ in den Gewässern um England, Februar 1918.
Von Korvettenkapitän Friedrich Lützow von der Admiralität, damals Admiralstabsoffizier beim Befehlshaber der Unterseeboots der Hochseestreitkräfte.
Das Bayerische Infanterie-Leib-Regiment stürmt den Kemmelberg am 25. Äpril 1918.
Von Hauptmann a. D. Hans Freiherrn v. Pranckh, damals Bataillonskommandeur im Infanterie-Leib-Regiment.
Truppenverbandplatz.
Von Hans Spatz, damals Feldhilfs- und Bataillonsarzt im Bayrischen Infanterie-Leib-Regiment.
Durchbruch.
Von Hans Caspar von Zobeltitz, Major a. D., damals Hauptmann im Generalstab und erster Geneealstabsoffizier der 227. Infanterig-Division.
Das letzte Mal an der Front, Juli — August 1918.
Von Oberleutnant a. D. Lothar Freiherrn v. Richthofen, damals Leutnant und Führer der Jagdstaffel Richthofen.
Ein Kerl.
Von Walter Bloem, im Felde Hauptmann d. R. und Bataillons-Kommandeur im Grenadierregiment Nr. 12.
Deutsche Asienkämpfer 1918.
Von Generalmajor a. D. Werner v. Frankenberg und Proschlitz, damals Oberst und Kommandeur der Brigade Pascha II (Asienkorps).
Die Ostafrikaner im Weltkriege 1914—1918.
Von Generalmajor a. D. v. Lettow-Vorbeck, damals Kommandeur der Schutztruppe für Deurtsch-Ostafrika.
Zur großen Armee.
Von Franz Schauwecker, im Felde zuletzt Leutnant d. R. im Res.-Inf.-Rgt. Nr. 46.
Zum Geleit
„Haben wirklich irdische Wesen dieses alles geleistet? Oder ist das Ganze nur ein Märchen oder Geisterspuk gewesen — die Ausgeburt erregter menschlicher Fantasie?“ So fragt der Generalfeldmarschall v. Hindenburg bei der Schilderung der Winterschlacht in Masuren; und so werden noch nach vielen Jahrhunderten die Menschen fragen, wenn sie lesen von den Taten der deutschen Soldaten und Matrosen in dem Riesenkampfe des Weltkrieges.
An Euch, deutsche Männer, wendet sich in erster Reihe dieses Buch; an Euch Kämpfer zu Lande, zu Wasser und im weiten Luftmeer. Ihr sollt darin Euch selbst und Eure Taten wieder finden. Die Erinnerung soll aufsteigen an die herrliche Zeit, da Ihr noch kämpftet im festen Glauben an Deutschlands Zukunft, in froher Zuversicht auf die Größe des Vaterlandes. Nach der äußersten Anspannung aller Kräfte und nach der darauffolgenden furchtbaren Enttäuschung ist eine Zeit dumpfer Ergebung in das Schicksal gefolgt. Sie ist begreiflich, aber sie darf nicht dauern. Die Erinnerung an all das, was Ihr selbst vollbracht habt, soll Euch wieder hochreißen aus dieser Abspannung; soll Euch wie in einem Spiegel zeigen, was das deutsche Volk gewesen ist, und was es ganz gewiss wieder sein wird, wenn es den Weg zurück findet zu sich selbst und seinem ureigensten Wesen.
Euch, Ihr heranwachsenden Söhne des Volkes, wird hier in schlichten Bildern gezeigt, was Eure Väter geleistet haben an unsterblichen Taten, ein Leiden und Entbehren, in Kämpfen und Schmerzen, im Ausharren und in heldenhaftem Sterben, fast über Menschenmaß hinaus. Nehmt diese Bilder auf in Eure junge Seele; sie werden sie erfüllen mit scheuer Ehrfurcht, mit unauslöschlichem Dank und mit dem kraftvollen Willen, den Vätern gleich zu werden. An Euch aber, Deutschlands Frauen und Mädchen, richtet das Buch eine ernste Mahnung. Sorgt Ihr dafür, dass die Männer deutsch denken und deutsch empfinden, hütet als treue Priesterinnen die heilige Flamme der Vaterlandsliebe und des Nationalgefühls, und setzt Euer Leben dafür ein, dass schon die Herzen der Kinder von dieser reinen Flamme erwärmt und erleuchtet werden. Wenn wir so zusammen leben und zusammen wirken, Männer, Frauen und Kinder, dann wird die große Stunde kommen, in der die Morgenröte eines neuen Tages glückverheißend emporsteigt, und der deutsche Adler wird seine mächtigen Schwingen wieder entfalten, um aufs Neue der Sonne entgegenzufliegen.
v. Dickhuth-Harrach.
Die Dankesschuld.
Von Walter Flex, gefallen auf Oesel für Kaiser und Reich.
Ich trat vor ein Soldatengrab
und sprach zur Erde tief hinab:
„Mein stiller grauer Bruder du,
das Danken lässt uns keine Ruh’.
Ein Volk in toter Helden Schuld
brennt tief in Dankes Ungeduld.
Dass ich die Hand noch rühren kann,
das dank’ ich dir, du stiller Mann.
Wie rühr’ ich sie dir recht zum Greis?
Gib Antwort, Bruder, dass ich’s weiß!
Willst du ein Bild von Erz und Stein?
Willst einen grünen Heldenhain?“
Und also bald aus Grabes Grund
ward mir des Bruders Antwort kund:
„Wir sanken hin für Deutschlands Glanz.
Blüh’, Deutschland, uns als Totenkranz!
Der Bruder, der den Acker pflügt,
ist mir ein Denkmal, wohlgefügt.
Die Mutter, die ihr Kindlein hegt,
ein Blümlein überm Grab mir pflegt.
Die Büblein schlank, die Dirnlein rank
Blüh’n mir als Totengärtlein Dank.
Blüh’, Deutschland, überm Grabe mein
jung, stark und schön als Heldenhain!“
Aus „Walter Flex. „Im Felde zwischen Nacht und Tag“ (C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck, München).
Deutsche Infanterie.
Von Franz Schauwecker, im Felde zuletzt Leutnant d. R. im Res.-Inf.-Rgt. Nr. 46.
er Draht summt. Die halbe Nacht lang summt und surrt der Draht und zittert unter den Worten, die durch ihn hindurch hasten und ihn erschüttern. Alle Geschäftszimmer und Schreibstuben kommen in Aufregung; Befehlsempfänger schnallen um und stürzen davon, Helm auf, Aktenmappen unterm Arm. Kraftwagen springen an, fauchen, rasen und überholen Meldereiter, die, Rücken vornüber, auf schweißigen Gäulen durch den Dreck der Bandstraßen preschen. Dunkle Fenster schimmern auf. Schatten bewegen sich auf dem mattlichten Viereck verhangener Scheiben. Dumpfer Lärm rumort in den Häusern kleiner Städte.
Ein paar Worte quirlen alles durcheinander, als gälte es das Leben. Und es gilt das Leben. Das Leben von Tausenden, Millionen, das Leben eines Volkes und Staates. Der Draht summt. Leise, unmerkbar leise ist das Gemurr seines metallenen Fadens. Ruf aber und Schrei ist in dem leisen Summen, Ruf und Schrei des Befehls, Ruf und Schrei des Vaterlandes, hörbar für Millionen. Lebendig wird die Nacht. Dunkles Leben wandert rastlos mit unzähligen Füßen auf breiten Straßen und schmalen Wegen, über Brücken, durch Dörfer und Wälder, zwischen Hügeln und Tälern und an blinkenden Flüssen. Die Nacht murmelt und rollt unter den marschierenden Füßen. Viele, viele schwarze Kolonnen kriechen unaufhaltsam zu einem unsichtbaren Ziel in der weiten Ferne: Brigaden, Regimenter, Bataillone, Kompagnien. Deutsche Infanterie marschiert nach vorn auf das murrende Geräusch zu, das leise herüberzittert, leise wie der summende Draht und doch Ruf und Schrei gleich ihm. All die rastlosen Füße haben nur eine Richtung, all die Herzen schlagen nur einen Schlag, all die Seelen sind nur eine Erwartung, ein Ingrimm, eine Entschlossenheit. In dem dumpfen Trappeln der Stiefel, im leisen Geklirr der Waffen, in dem tiefen Atem all der Leiber ist nur ein Gedanke, der alle bewegt und vorwärts drängt: Das Vaterland, der Sieg . . . Der düstere Himmel über dem drohenden Knurren der Ferne wird zuweilen von lautlosem Sprung matten Glanzes erhellt. Immer schneller zuckt der fahle Schimmer empor, immer höher flattert er in die Nacht, immer heller wird diese blasse Flamme, bis sie plötzlich über den ganzen Himmel springt und fliegt, ein wilder Tanz tödlichen Lichtes. Lauter wird die Musik der Ferne: schwere Schläge pauken, rollender Wirbel grollt, ächzender Krach dröhnt, stößt und rüttelt die dunkle Luft, dass sie erbebt unter dem Takt der Musik zu dem Tanz des lautlosen Lichts am Himmel. Keiner der zahllosen Soldaten weiß, wie die Schlacht vor ihm steht. Ihm ist nur bewusst, was die Sinne seines Körpers wahrnehmen. Was er sieht, das allein kennt er; was er hört, nur das weiß er; nur was er fühlt, ist ihm bewusst. Und er sieht nur die dunkle Helmwölbung seines Vordermannes gegen den lichtflatternden Himmel, er hört nur den anschwellenden Donner des Geschützbereichs, den eignen hastigen Atem und verworrenes Getrappel der rastlosen Beine, er fühlt nur die Sohlen seiner Füße, scheuernden Druck des Tornisters, kühle Nachtluft, die Wucht des Stahlhelms, Müdigkeit und einen hungrigen Magen. Und ganz unbestimmt fühlt er, dass da vorn hinter der Schwärze der Nacht etwas Bedrohliches wartet, das ohne Gnade und Barmherzigkeit ist, mit eisernen Kehlen brüllt und mit stählernen Klauen packt. Und doch stockt sein Schritt nicht, zittert er nicht zurück vor dem Mahlen und Knirschen des Triebwerks, in das er hinein soll. Über der schwarzen Bedrohlichkeit steht ein Licht, heller als der springende Glanz des Todes, ruhiger als der zuckende Schimmer am Himmel. Irgendwo wacht eine eiskalte, unerschütterliche Besonnenheit, der auch die heimlichste Bewegung des Feindes nicht entgeht, wacht ein Hirn und arbeitet eine Hand, die die wirrsten Fäden entwirrt und ordnet, wacht eine unermüdliche Sorge über jedem Schritt, den er tut, und bewahrt vor jedem Hinterhalt. Menschenleben sind kostbar; jeden Tropfen Blutes brauchen die klopfenden Adern des Vaterlandes. Vom Leben des Einzelnen lebt das Leben des Staats. In der Hand des Feldherrn liegt das Leben der Männer, die hier marschieren, liegt das Leben des Vaterlandes in ihnen.
Der Geist jenes Feldherren über ihnen allen ist mitten unter den vormarschierenden Regimentern. Führer von seinem Geist reiten und marschieren in den Kolonnen. Wenn die Stunde kommt, in der der Tod unter ihnen ist, in der unter seinen kalten Augen jede Hülle fällt und Wert oder Unwert des Mannes sich offenbart, in jener Stunde sind die Führer Flügel oder Last an den Seelen der Soldaten, die handeln, wie ihre Führer handeln. In tausend feinste Verzweigungen flutet der große Strom der Verantwortung.
Das Herz des Feldherrn erfüllt er mit dem Druck der Pflicht, das Herz des letzten Gefreiten reißt er hoch in den Minuten der Entscheidung um Großes. Wie er ist, sind seine Soldaten. Jeder weiß es . . . So marschieren sie durch die Nacht zur Front. Hoch in die Lüfte wird die Schlacht jeden von ihnen erheben, jedem von ihnen wird der Tod tief, tief in die Augen starren. Bekenne! wird der unerbittliche Blick sagen, bekenne, was du wert bist! Jeder weiß es.
Stundenlang schleppt sich der Marsch hin. Gedanken kommen und gehen, wie die schattenstummen Sträucher und Bäume am Wegrande kommen und gehen, — einer nach dem andern gleich einer endlosen Kette, die Richtung und Halt gibt.
Manch einer ist schon seit Anfang dabei, ohne verwundet worden zu sein, und steht jahrelang an der Front. Die Liste der mitgemachten Gefechte in seinem Soldbuch ist seitenlang, und es sind viele stolze, bekannte Namen darunter: Tannenberg und Gorlice-Tarnow, die Winterschlacht in der Champagne und die Lorettohöhe, die Argonnen und plötzlich die furchtbarste aller Schlachten, die Sommeschlacht. Der Mann hat Schwein gehabt, dass er da überall heil durchgekommen ist, sagt der Soldat . . . Ein andrer war dreimal schon verwundet und ist jetzt zum vierten Male draußen. Er hat lauter „Heimatschüsse“ erhalten: Fleischwunden durch Arm, Hand und Schenkel. Er braucht sich darauf aber gar nichts einzubilden, und er tut es auch nicht. Schon sein Nebenmann ist zwar nur zweimal verwundet worden, aber dafür hat er einmal Gasvergiftung gehabt und war mal für vierundzwanzig Stunden in französischer Gefangenschaft. Der Franzose hat ihn bloß sechzehn von den vierundzwanzig Stunden oben auf dem Grabenwall deckungslos im deutschen Geschützfeuer liegen lassen, sich von Zeit zu Zeit gütig von der bombensichern Sappe aus nach seinem Befinden erkundigt und ihn, als alles ruhig war, mit herzlichem Bedauern unverletzt wieder in den Graben gezogen, bis ihn die Deutschen im Gegenangriff wieder befreiten. Weiter ist ihm nichts geschehen, aber dass er damals keine grauen Haare bekommen hat, wundert ihn noch heute — nicht nur ihn allein. Lieber tot als gefangen!
Sie sprechen nicht von diesen Dingen, — sie denken nur dran. Das genügt. Sie verscheuchen diese Gedanken und schaffen Raum für Bilder der Erinnerung, die neben ihnen zwischen den Baumsäulen und Strauchklumpen sich regen.
Hier in Frankreich marschiert es sich leicht auf den harten Kunstwegen, wenn auch die Sohlen allmählich zu brennen beginnen. Aber Russland! Russlands Wege waren Wege für ganz besondere Liebhaber. Damals in den Wochen des sommerlichen Durchbruchs von 1915. Als begänne der Erdboden sich aufzulösen, ist es. Alle Felder schwimmen in einem zähen Brei, jeder Fußbreit Bodens ist wie ein klammernder Saugnapf, und dazwischen überall blinkt Wasser in trüben, gelben Lachen. Am schlimmsten aber, und Abgründe voll Schlamm, sind die Wege. Infanterie, Artillerie, Fuhrparkkolonnen der fliehenden Russen haben aus ihnen stillstehende Kotflüsse gemacht und alle Geleise zu grundlosen Mulden zerfahren. Die Dorfstraßen aber sind so dreckbesudelt und morastüberschleimt, dass Fuß und Stiefel eine Weile in der Luft zögern, ehe sie zutreten. Wie auf Dämmen stehen die Holzhäuser über dem braunen Sumpf der Wege, der dick und zäh sich gleich einer klammernden Faust über dem Oberleder, um die Knöchel, um den halben Schaft schließt und wenn die Tiefpunkte des Marsches kommen, die schmierigen Anger oben in die Stiefel steckt, dass Kot und Wasser hineinquellen und der Fuß auf einem schlapfenden Polster geht . . .
Schweiß rinnt, durchtränkt die vier Wochen alte Wäsche und macht sie und die Haut klebrig. Langsam läuft und tastet Kitzeln und Jucken über die Schienbeine und steigert sich rasch zu unerträglichem Brennen. Der harmlose Neuling denkt, er habe sich wundgelaufen, indes er sich wundert, dass gerade die Schienbeine darunter leiden; der schlaue Neuling glaubt an Krätze und Flechte; der Erfahrene aber denkt bloß: das fehlte noch — und weiß ganz genau, dass dies der Schweiß ist, der in den Wunden der Läusebisse frisst wie Schwefelsäure am Eisen. Wunden?
Nein, es sind keine Wunden, die den Knochen bloßlegen; es sind nur Hautabschürfungen, eine dicht an der andern, ein blutiges Netzwerk, das sich allmählich mit einer Schorfborke bekrustet, die nicht frei von Schmutz ist und immer wieder abgekratzt wird, — eine dauernd peinigende Marschqual.
Nur der Tornister geht darüber, wie etwa ein Geschütz über ein Gewehr geht. Regen rieselt. Decken und Zeltbahn saugen sich gierig voll, und der Tornister beginnt seinen Beruf zu erfüllen: scheuern und würgen.
Jeden Atemzug macht er schwerer und quetscht mühsam die Luft wie durch eine verstopfte Röhre. wie ein Erschlagener hängt er über Schulter und Schlüsselbein, presst auf die Schulterblätter und wird schwerer und schwerer. Ist es ein Wunder?
Alle Gedanken der Heimat hängen sich an ihn, alle Sorgen um Frau, Kinder und Beruf stecken in seinen Fächern, Klappen und Taschen neben den Lichtbildern und Briefen, bis er wie eine Eisenkugel ist. Das Gewehr hilft ihm, der Helm unterstützt ihn, und die lehmklotzigen Dinger an den Beinen, die durchaus Stiefel sein wollen, verstärken Druck und Eindruck.
Weiter, weiter! rufen die Steine am Weg. Vorwärts, vorwärts! rufen die vorwärtsstampfenden Beine des Vordermanns. Kommt, kommt! schreit die Front mit tausend brüllenden Eisenmäulern. . . . Ein Leutnant, kotbespritzt vom Helm bis zu den Gamaschen, läuft an der Kompagnie lang.
„Kopf hoch, Herrschaften!“ ruft er. „Wir marschieren alle! Wir sehen alle aus wie die Torfschweine! Kopf hoch! Wir alle ziehen an einem Strang!“
Eilt, eilt! rufen die Lüfte: Da vorn bricht Russland zusammen. Lasst es nicht hochkommen. Nur im Kampfe winkt der Sieg!
Und die Beine stampfen weiter. Der Tornister ist voll, dafür ist der Magen leer. Aber eine Erleichterung ist das trotzdem nicht. Ein Kochgeschirrdeckel voll Graupen und Dörrgemüse hält nicht lange vor, und der Körper verschluckt das Essen wie der Schlamm die Füße: als ob nie etwas da war. Ein Blick späht über die tanzenden Helmspitzen nach vorn zur Spitze des Bataillons und sucht den tröstlichen Rauch der Feldküchen.
„Die Lokomotiven sind vorn und ziehen das ganze Bataillon wie einen D-Zug hinter sich her“, hieß es gewöhnlich beim Anblick der Rauchballen.
Aber heute rollt dort kein Rauch voran. . . . Ein rascher Blick rückwärts.
„Donnerwetter, — heut ist dicke Luft. Heut schieben die Lokomotiven schon das Bataillon wie einen Lastzug“, hieß es, wenn die Küchen am Bataillonsschluss klebten.
Aber heut ist auch dort die Luft leer und nur neblig und verregnet.
„Verfluchte Zucht!“ sagt einer. „Heut entgleist aber der Balkanzug. Heut ist die Pest drin und der Eisenbahndamm aufgerissen. Aber richtig!“
Und jeder weiß, dass die Feldküchen irgendwo in Gottes unendlicher Schlammwelt bis an Aschenfall und Radachsen in einem hoffnungslosen Dreck sitzen und dass die Küchenunteroffiziere Beschäftigung bis morgen früh haben. Vor morgen wird es kein Essen geben. Schlimm, schlimm, — denn das Mittagessen ist mit Wunsch der Kompagnie als Trost-, Glanz- und Endpunkt des Marsches auf den Abend gelegt worden, und jetzt ist es erst drei Uhr nachmittags. Weiter, weiter! Hart bleiben, nicht weich werden. Dreck ist weich! Hart, hart!
Die Muskeln an den Kiefern schwellen und werden hart, wenn man Zähne auf Zähne beißt; und wenn man die schlappen Hände zu starken Fäusten ballt, dann wird der Wille stark und hart — hart.
Am Wegrande hält der Bataillonskommandeur und sieht sich seine Kompagnien an. Seit vier Stunden sind sie mit nur zwei knappen Pausen bei diesen auspumpenden Wegeverhältnissen auf den Beinen, und sehr frisch sehen sie nicht mehr aus. Manch erwartungsvoller Blick trifft ihn, und er hört ein verflogenes Wort, das genauso wie „Marschpause“ klingt. So unrecht hat dieses Bittwort nicht, aber er kann vorläufig keine Pausen einlegen. Die Front ruft und ruft. Der Sieg winkt und winkt. Aber irgendwas muss geschehen. . . . Er prescht nach vorn, dass der Schlamm spritzt und die Soldaten fluchen.
Und mit einem Male kommt rasselnder Wirbel und helles Quieken der Knüppelmusik von vorn. Wenn es auch nur Trommeln und Pfeifen sind, — die Beine straffen, die Rücken recken, die Häupter heben sich doch, der Schlamm verliert mindestens zwei Drittel seiner Anziehungskraft und die nebligen Gedanken werden heller, die schweren Herzen schlagen leichter im Takt der Musik. Wie ein klingender Flügel über dem marschierenden Bataillon ist die Musik, obwohl die Trommelfelle regenschlaff sind, und wenn auch der Querpfeifer beim Stolpern über Schlammlöcher mit ganzen Tönen querpfeift. . .
Das ist ein einziges Erinnerungsbild eines einzigen Soldaten in einem einzigen der Regimenter, die hier in Frankreich zur Front marschieren. Tausende vor und hinter diesem einen, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, sehen ähnliche Dinge zwischen den Büschen. Neben jedem von ihnen auf lautlosen Füßen läuft die Erinnerung und flüstert hastige Dinge. . . .
Ein Ackerfeld in Russland ist gewöhnlich von russischer Endlosigkeit. Wenn es ein Sturzacker ist, kommt es dem, der drüber weg muss, noch einmal so lang und breit vor, als es ist. Wenn es ein gefrorener Sturzacker, wenn es außerdem kohlenhaufenartige Nacht und wenn der Magen leer ist, wenn der Marsch den halben Tag unaufhörlich gedauert und die Kompagnie schärfsten Befehl zur Eile hat, dann erscheint der Sturzacker zehnmal so holprig und fünfzigmal so lang, als er in der platten Wirklichkeit ist. Wie eine Erlösung vom Himmel wirkt dann das zweitschönste Kommando „Kompagnie — halt“! (Das Schönste heißt: „weggetreten“!) Ruhe winkt, ein paar Augen voll schnellen Schlafs auf den eckigen Kissen der Erdschollen. Merkwürdig nur ist es, dass das Kommando leise abgegeben wurde. Eigentümlich ist es, dass die Kompagnieführer zum Bataillonskommandeur befohlen werden; seltsam, sehr seltsam ist es, dass sie nach der Rückkehr ausschwärmen lassen: aber gradezu wahnwitzig kommt den Neulingen der Befehl zum Eingraben vor. Aber der Erfahrene, der durch nichts im Kriege mehr zu verblüffen ist, sucht sich seinen Platz mit derselben äußeren Ruhe, mit der er in die nächste Panjehütte zum Ausschlafen marschiert wäre. Nur ist diese äußere Ruhe eine innere Ergebenheit in das Unvermeidbare. Aber sie ist auch ein wortloses Zutrauen: Die es befehlen, wissen besser, wozu es gut ist. Vielleicht wäre ich einen Kilometer weiter in das tödliche Geschoss hineingetapert. Mal müssen wir uns im Kriege doch eingraben. Im Dorf hinter uns ist es wahrscheinlich warm und ruhig, aber es könnte noch wärmer werden, wenn der Russe mit Granaten einheizt, und mit der Ruhe ist es dann auch vorbei. Dies also ist das Beste. . . . Und zugleich ist in dieser inneren Ergebenheit die stumme, willige Fügung in die große Pflicht Aller und in den Gedanken des Vaterlandes.
Eine wilde, schweißtriefende Arbeit stürzt sich mit Spaten und Beilpicke auf den Acker, haut Schollen ab, zerrt und hebelt sie mit den starren Fingern los und trägt sie zu einem kümmerlichen Erdwall zusammen. Wütende Anstrengungen, in den Boden selber hineinzukommen, haben am nächsten Morgen das klägliche Ergebnis von flachen Mulden, in denen nicht allzu groß geratene Zwerge zur Not volle Deckung finden.
Nächtliche Spähtrupps haben den Anmarsch starken Gegners gemeldet. Vorgeschobene Posten sichern die mühselige Plackerei des Schanzens. Wer ermattet die Arme sinken lässt, auf den stürzt sich die Kälte wie eine Furie, umklammert ihn mit dürren, eisigen Armen, haucht ihm ihren erstarrenden Atem in das Gesicht und bohrt und wühlt ihm ihre heimtückischen Messer ins Fleisch. Die Soldaten ringen gegen sie an. Hartgefrorene Stiefelsohlen klappern stampfend gegen den brettharten Boden; Armschlagen und Händereiben sucht stockendes Blut aufzujagen; Schaudern bis in das Mark der müden Knochen rüttelt Kiefern, Leib und jedes Glied. Aber die Kälte lässt nicht locker. Grimmig packen die Fäuste in den zerriebenen Wollhandschuhen den Spaten, dem das dünne Blatt schon krumm genug geschlagen wurde, und der Kampf gegen die Unerbittlichkeit des Bodens beginnt wieder. Dampfender Atem, klingende Spatenhiebe, Hagel von Flüchen, Fußgestampf, Treiben und Mahnen der Vorgesetzten und über all dem der klirrende Speer der Kälte.
Und fern, fern über flache Höhen, durch düstere Nadelwälder schiebt sich die ungeheure Masse der Russen heran, wälzt sich die stumpfe, formlose Siegeszuversicht der Menge und Zahl gegen die Sittlichkeit freien Willens und den entschlossenen Geist kriegerischer Tüchtigkeit, gegen die Siegesgewissheit des geschmeidigen, gleich einem Bildwerk durchgeformten Kämpfers. Wenn der Russe heran ist, dann schwindet aller Schmerz der Kälte, dann springt der Kampfgeist empor, dann bohrt und spitzt sich der Blick über Kimme und Korn gleich geschliffener Schärfe auf jene Schützenreihen, die heranrollen wie die unendlichen Wellen eines Meeres, und die zerschellen, verschäumen und zurückfluten wie dieselben Wogen des gleichen Meeres . . .
Weiter marschieren die Regimenter durch die Luftgebilde der Erinnerungen. Noch erblassen diese Bilder nicht vor dem huschenden Widerglanz des Mündungsfeuers aus zahllosen, brüllenden Geschützen; noch verstummen sie nicht vor dem Toben des Trommelfeuers vor ihnen . . . .
Arbeitsdienst an einer weit zurückliegenden Aufnahmestellung. Große Spaten der Schanzzeugwagen knirschen mit wuchtigem Stoß in kieselige Lehmerde und fressen sich mühsam hinein gleich eisernen Kiefern und spitzen Zähnen. Aber wenn sie auch eisern sind, sie splittern auf Stein, und hart und mühselig ist der Kampf zwischen Eisen und Stein. Widerwillig zerklafft die Erde zu Löchern, Gräben, Schächten und Schlünden, die zu bombensicheren Unterständen ausgebaut werden sollen. Regen rieselt und füllt alle Tiefen und zerweicht sie zu Brei, in dem die Soldaten breitbeinig bis an den halben Stiefelschaft stehen wie Baumstumpfe im Sumpf. Durch feinste Risse dringt die schlammige Nässe in die Stiefel und verklebt die oft geflickten Strümpfe zu einer Schmutzhaut. Mit grimmigem Ruck stößt der Spaten den zähen Erdbrei vom Blatt, und trotzdem fällt die Hälfte schwer zurück in das Erdloch. . . .
Von fernem Hügelhang kommt eine lange Reihe von Soldaten. Schwere Stämme lasten von Schulter zu Schulter. Langsam kommt die Reche heran, feierlich, in gemessenen Schritten, als würden die Baumleichen zu Grabe getragen. Längslang neben dem Schützengraben marschieren die Baumträger auf und kippen die runden Säulen nach Zählen von den schmerzenden Schultern. Wie eine lange Reihe frisch aufgeworfener Gräber für Bäume sieht die Stellung aus. Die triefnassen Soldaten gehen in regellosen Gruppen mit finsteren Gesichtern zu der Höhe, von der dumpfe Axtschläge den Tod eines ganzen Gehölzes verkünden.
Dies ist keine Arbeit für Infanteristen, dies ist Arbeit für Sondertruppen, und es macht unwirsch und misswillig. Aber der Infanterist ist so ganz nebenbei alles: Telefonist und Blinker, Artillerist und Minenwerfer, Maschinengewehrschütze und Feuerwerker. Er hat sein Morsealphabet im Hirn und weiß, wie eine Gasflasche behandelt sein will, er kennt die französische Handgranate und zur Not, in die er oft kommen kann, vermag er ein englisches Maschinengewehr zu bedienen. Er muss alles sein, sonst ist er im Kampf ein Nichts, das einfach über den Haufen gerannt wird. Und wenn er so vielseitig ist, warum soll er nicht auch Erdarbeiter und Bergmann sein? Er ist ja auch Totengräber!
. . . Der Morgen dämmert bleich über fahlen Hügeln und tastet nach einem Nebelrauch, der schwer auf der Gegend liegt. Die springenden Lichtwellen der Abschüsse und Sprengungen verblassen, aber das furchtbare Hämmern und Poltern der Geschütze hört nicht auf. Aus den Schatten der Nacht heben sich Hügel, Gehöfte, Büsche und Hecken düster, verworren und undeutlich wie Klippen, Sandbänke und Schlickfelder aus verrollender Flut.
Das Regiment marschiert über eine dünnbewaldete Hügelwelle. Durch die leeren Schatten zwischen den Büschen und Baumstämmen fliegt der Blick plötzlich in eine unendliche Ferne, als stürze er haltlos hinaus ins Waagerechte. Und vor diesem einen einzigen Blick vergehen alle Bilder und Gestalten der Erinnerung und fallen kraftlos zu Boden wie Schemen und Puppen.
Ein Ruck fährt durch alle Reihen, und wir erstarren für den Bruchteil einer Sekunde.
Vor uns liegt die Schlacht. . . Wir stehen dicht vor dem dröhnenden Tor, das in ihren ungeheuren Raum hineinführt.
Einen Augenblick zweifeln wir, ob es Nebelrauch ist, was da unten über welligem Gelände in schweren Schwaden dahintreibt und in dicken Klumpen und Wolkenballen sich aufreckt gleich ungeheuren Bäumen. Dann sehen wir, dass es Granateinschlage, Brandwolken, Gasnebel und vereinzelte Sprengungen von Munitionsstapeln sind. Das finstere Gefühl wächst, schießt, sinkt und wogt rast, los, und darüber schwebt wie dünnes Gewebe ein trüber Dunst von Erdstaub, gelblichen Gasen, zerschlagenem Kalkstein und bläulichem Sprengungsqualm. All diese schwerfälligen Rauchgespenster brüllen und heulen zu uns empor. Die ganze verhüllte Landschaft ist von dem Geräusch einer dröhnenden Maschinenhalle und einer tobenden Volksmenge erfüllt.
Dann verschwindet die jähe Offenbarung hinter dem Laub wie fortgewischt, und der wütende Lärm wird um einen Schatten weniger laut. Wir beginnen den Abstieg in das Tal hinab. . . Und allmählich nehmen all die großgewordenen Augen der Soldaten meiner Kompagnie eine starrblickende Richtung an, vereinigen sich auf einen Mann, der auf einem Pferde hoch über allen vor uns sichtbar ist, hängen sich an ihn und betrachten ihn mit gieriger Eindringlichkeit, als wollten sie ihm durch die Uniform in das Herz blicken.
Es ist, als fühlte der Reiter körperlich den packenden, enthüllenden Blick hinter ihm, denn er dreht sich auf seinem Gaul um. Die ganze Kompagnie sieht ihrem Führer voll ins Gesicht. Sie sehen in ein Antlitz, das lächelnd und doch ernst ist, in ein Antlitz, das noch jung und doch fest und hart ist. Die dunklen Augen des Leutnants halten den Blick seiner Soldaten ruhig aus und geben ihn voll und stark zurück.
Wer bist Du, dass Du uns führst? begehren die Blicke seiner Soldaten.
Wer seid ihr, dass ich mich auf euch verlassen kann? fragt der Blick des Führers.
Stumm ringt Blick mit Blick. Mensch sucht den Menschen. Dann dreht sich der Leutnant wieder zurück auf seinem Gaul. Als er sein Pferd wendet und aus der Kolonie heraus neben seiner Kompagnie reitet, ist er beruhigter.
„Eine schöne Schweinerei da vorn, — was!“ sagt er prüfend und mustert die Gesichter.
„Grad genug für ’ne Armeeabteilung, Herr Leutnant“, antwortet einer vom Fleck und von der Leber weg.
„Stimmt. Was meint ihr: schaffen werden wir’s doch. Oder —?“
„Wenn wir genug sind, — natürlich. Wir haben’s doch immer geschafft“, sagt ein anderer.
In diesem Augenblick schwillt die Luft wie eine Woge unter dem wuchtigen Fall eines Felsblocks, — so nah birst und zerklirrt die erste, schwere Flachbahngranate.
Der Leutnant beherrscht sich und sieht sich nicht mal um nach der Einschlagstelle. Die Soldaten wissen das richtig zu bewerten, und das Vertrauen steigt. Als das hohle Heulen der Sprengstücke vorbeigeschwirrt ist, sagt der Leutnant: „Wenn die immer so schießen, kann man hundert Jahre alt werden und kerngesund bleiben. Nur die Ohren steif halten!“ — Der Leutnant hebt seine Stimme für die vielen Neulinge, die die Westfront noch nicht genossen haben — „Freuen tun wir uns ja alle nicht, dass wir da rein dürfen. Wir sind alle bloß Menschen. Aber als Menschen haben wir unseren gesunden Verstand darauf zu bekommen, und deshalb wissen wir, warum wir hier sind und da rein marschieren. Wenn der da vorn uns packt und von hier bis nach Berlin mit uns geht, dann wissen wir, wie Deutschland aussehen wird. Und wenn wir den Krieg verlieren, dann wissen wir, dass er uns fünfzig Jahre lang ununterbrochen das Genick umdrehen wird. Müller und seine Frau leiden darunter ebenso sehr wie ich, wenn meine Frau vorläufig auch bloß noch meine Braut ist. Eins ist die Hauptsache da vorn: Ohren steif und den inneren Schweinehund totgeschlagen. Ihr versteht mich.“
„Jawoll, Herr Leutnant“, sagt ein Stimmengewirr. Und der Leutnant weiß, dass er voran gehen muss, wenn er sich nachher wirklich verständlich machen will, voran als erster. Und er weiß, dass der Franzose einen verflucht scharfen Blick für Offiziere hat und mit einem Schuss meistens zwölf Punkte schießt. Der Leutnant denkt an seine Frau, die vorläufig noch seine Verlobte ist, und denkt an die Mutter und an verschiedenes andre, das alles gar nicht mehr hierher gehört. Aber dann hält er sich selbst die Rede, die er den Soldaten gehalten hat. Der gesunde Menschenverstand kommt. Eiserner Wille hebt die Faust; im Trotz erwacht der Kampfgeist. Er fühlt, fühlt, fühlt, wie in seinen Adern das Blut des Volkes rinnt, wie in seinem Herzen heißer Herzschlag des Vaterlandes pocht und klopft, — pocht und klopft. Was nun kommt — mag sein, was will — das ist von jetzt ab alles selbstverständlich. Vergangenheit, Heimat, Angehörige, Beruf und Zukunft, es muss alles tot sein und versinken, und es versinkt. . . .
Wir marschieren weiter und treten ein durch das dröhnende Tor in die Schlacht. In eine waldige Hügelecke geklemmt, wälzt sich ein gelber Drache und schwankt mit ungeheuer geblähtem Bauch schwerfällig auf und ab, steigt langsam baumgerade empor und zieht Bündel von Drähten und Seilen nach sich, Nerven und Adern, die ihn mit der Erde verbinden. Als wir einen halben Kilometer weiter sind, schwebt der Fesselballon schon hoch in den Lüften. . . . Weiter geht der Marsch. Metallischer Klang französischer Bombengeschwader wandert hoch über uns hinweg und stößt plötzlich auf das dumpfe Gesurr deutscher Kampfflieger, die sich ohne weiteres zu den Franzosen emporschrauben und auf sie stürzen. Wie ein Schwarm von Fliegen und Mücken sehen sie von der Erde aus. . . Wir marschieren durch Waldstücke, vorbei an rastenden Munitionskolonnen, durch zerschossene Dörfer, die wie graugelbe Steinhaufen uns umzingeln und von allen Seiten finster auf uns starren aus Löchern in Dach und Mauern, die wie lidlose, ausgestochene Augen erscheinen. Fortwährend ist die Landschaft um uns ein einziger, dumpfer Aufschrei qualmiger Sprengwolken, als schreie die Erde unter den Fausthieben der Granaten und zucke in einer ununterbrochenen Qual. Ab und zu schlägt ein Geschoss neben dem Wege ein, auf dem wir marschieren, aber die weite Entfernung erlaubt keine treffsicheren Schüsse, und das Regiment schiebt sich unbeirrbar, unaufhaltsam weiter vor. Die Soldaten betrachten die Formen der Einschlagswolken und unterhalten sich leise über ihre mannigfachen Bilder. Da gibt es eine Art, die wie ein Erdfächer ist, der mit einem dumpfknallenden Ruck plötzlich nach beiden Seiten auseinanderzuckt. Andre erscheinen wie dichtes Buschwerk, jene sehen dicken Baumwollknäueln oder klumpigen Leibern ähnlich, und diese da gleichen Springbrunnen voll einzelner Erdbrocken, Steinblöcken, Grasfetzen. Diese letzten werden oft von Blindgängern hochgeworfen, die wie Elefanten wuchtig ins Erdreich prallen, Stücke reißen und brechen und sie zornig emporschleudern. Klirrende Trichter tanzen plötzlich auf der Erde, wie der rasende Mittelpunkt eines Wirbelsturms: Brisanzgranaten mit hochempfindlichen Zündern, gehüllt in einen unsichtbaren Mantel von Splittern und Scherben. Und manchmal — und alle Augen werden ganz groß und starr bei dem Schrecken dieses Anblicks — birst eine furchtbare Wolke aus der Erde gleich der Baumwolke des Vesuvausbruchs und steht blauschwarz wie ein finsterer Dämon, die ganze Landschaft beherrschend. Ein Krach brüllt auf, als stürbe die Erde in diesem ächzenden Schrei. Das sind die Granaten aus den Riesengeschützen, die ihre stählerne Last in steilen Bögen über zwanzig Kilometer weg schleudern.
Lärm der herannahenden Geschosse keucht und faucht in der Luft. Manche kommen heran wie brausende Schiffe mit vollen Segeln, andre keifen mit bösem Zischen über die Köpfe weg. Manche murmeln und würgen nur ganz leise, so hoch fliegen sie, aber sie senken sich nieder schwer wie das Schicksal und kreischen vor wütender Gier, bis sie mit einem erschütternden Krach enden, dass wir denken, die Hügel müssten zu wackeln beginnen. Und Sprengungsgeräusche gibt es, die sind ganz leise vor Hass und Heimtücke und ersticken tief in der Erde vor Wut wie eine heimlich geballte Faust.
„Verflucht“, sagen die Soldaten. „Das war ‘n Stollenbrecher.“
Ja, das war ein Stollenbrecher, der metertief im Boden erst birst und die Erde umrührt wie ein riesiger Quirl. Es knirscht wie ein zermalmendes Gebiss, wenn er seine Beute packt.
Immer weiter marschieren wir unter dem Gurgeln und Heulen, Röcheln, Winseln und Pfeifen der fliegenden Granaten wie unter den Stahlbögen eines hallenden Saales. Leben ist in diesen tönenden Flugbahnen und Sprüngen der Unsichtbaren über uns, in diesem tosenden Lärm um uns. Mitten durch geifernden Hass, stöhnende Wut, krachenden Grimm, brüllenden Zorn bewegt sich das Regiment, wie ein Schiff durch schäumende Meerflut sich vorwärts wühlt. Ruhig marschiert das Regiment, nur die Nerven jedes Mannes tanzen wie das Schiff auf den Wellen. Aber sie bleiben über dem Ansturm des Lärms und der Schreckbilder, wie das Schiff über den Wellen bleibt. Sie versinken nicht . . .
Die feindlichen Fesselballons sehen uns genau wie ein Mann einen Zug Ameisen. — Die ersten gezielten Schüsse hetzen uns in eine tiefe Talsenke. Schwere Artillerie von uns steht dort, 21 cm-Haubitzen. Wir Infanteristen freuen uns wie die Kinder über jeden Schuss. Die Augen funkeln, der Mund lacht.
„Feste!“ schreit einer. „Immer feste! Nischt wie: gib ihm! Wenn die Trommelfelle heil bleiben, hat’s gar keinen Zweck gehabt. So war’s richtig.“
Rrrums — wie brüllende Stiere grölen die eisernen Rachen. Mächtige Stimmen! Rrrums! Gellendes Gekreisch des Geschosses, das abfährt wie ein Blitzzug. Wir schießen auch noch. Das hebt und stärkt. Wenn sie drüben auch mehr haben als wir, aber wir schießen auch!
Weiter, immer weiter. Dorfein- und ausgänge verschwinden in regelmäßigen Pausen unter hämmernden Feuerüberfällen. Der Gegner streckt seine Arme und will sich mit den Granatfäusten alle Verstärkungen vom Leibe halten. Zugweise jagt das Regiment durch das lange Dorf hindurch. Ab und zu brechen die Granaten auch mal mitten hinein ins Dorf. Ziegelwerk, Balken, Qualm, Staub fliegen in einem irrsinnigen Ausbruch des Jähzorns hoch.
Ein großer Wald verschluckt uns. Seine grünen Tiefen hallen und schallen von Sprengungen. . . Am Rande des Waldes liegt endlich das Dorf, in dem irgendein Stab liegt, bei dem das Regiment zur weiteren Verwendung sich zu melden hat. Wir warten in dem lärmenden Wald. Der Regimentskommandeur verschwindet zum Dorf hin. Als er zurückkommt, erfahren wir, dass das Regiment aufgeteilt wird. Mein Bataillon kommt zur Ablösung in die Stellung drei Kilometer vor uns. Der Feind hat die schwache vorderste Linie schon einige Kilometer zurückgepresst, Schritt um Schritt, und die Soldaten da vorn haben Ablösung bitter nötig.
„An die Gewehre. . . Ohne Tritt — marsch.“
Wir treten aus dem Walde, und hinter uns bleiben alle andern Waffengattungen weit, weit zurück. Jetzt beginnt das Reich des Fußsoldaten, das Land der Unerbittlichkeit. . . . Was jetzt kommt, ist nur mit Vorsicht und fertigem Testament zu genießen . . . Dicht, zum Greifen dicht vor jedem Manne steht von nun ab der Tod; fühlbar, deutlich fühlbar an jedes Herz rührt sein harter Finger und senkt sich nicht mehr. Bekenne, wer Du bist! fordert der kalte Blick. . .
Eine Brücke schwingt sich hart am Waldrand über einen Bach in tiefer Schlucht. Ein Zug beeilt sich hinüberzukommen. Kaum ist er darüber, rast ein heulendes Geschwader heran, und zwei, vier. fünf, sechs Granaten kleben wie Stoßvögel mit mächtigen Schwingen am Schluchthang. Riesige Schnäbel und Krallen hauen in die Erde. . . Der Franzose sieht alles.
Jetzt sind wir dran.
„Kopf hoch — Kaisermanöver! Das ist bloß der Anfang!“ schreit mein Nebenmann. Ich kenne ihn gut: ein und ein halb Jahr Dienstzeit bei Kriegsausbruch, jetzt drei und ein halb Jahre Kriegsdienst, macht fünf Jahre Soldat; zweimal verwundet, eine Frau und ein Kind, Geschäft in die Brüche; — einer von Vielen. Vaterland! Los!
Hinter uns saust eine Lage in den Wald, und wir sausen über die Brücke. Der dritte Zug folgt. Während wir uns drüben am Hügelhang sammeln, setzt sich eine schwere Granate wuchtig und schwerfällig auf die Brücke wie ein Riese auf einen Puppenstuhl. Wumm . . . Qualmwolke, Balken, Splitter. Das Gebälk ist Gefetz.
Ein Offizier des abzulösenden Regiments ist drüben, zeigt auf einer Karte den Weg und macht an den Stellen, die unter Sperrfeuer oder Feuerüberfällen liegen, verheißungsvolle Grabkreuze.
„Sechs Erbbegräbnisse hat er gemalt“, sagt einer.
Wir werden bis nach vorn viel Nerven- und Seelenkräfte brauchen und verbrauchen. Humor, grimmigster Galgenhumor, völlige Gedankenlosigkeit, starre Ergebung und dazwischen wie funkelnde Blitze: das Vaterland, der Sieg. Wem dieser Blitz nicht strahlt und den Weg hellt, der verirrt sich in Nacht und Nebel.
Wir treten an. . .
In breiter Mulde auf unserm unerbittlichen Wege liegt ein düsteres Ungeheuer und atmet mit schwerwogenden, Zuckenden Flanken, mit rauchendem Stoß und qualmigem Hauch des Atems und brüllt rastlos, unaufhörlich mit einer rasenden Gier des Hasses. Das Sperrfeuer!
Niemand sagt ein Wort. Stumm geht der Bataillonskommandeur voran, und wir folgen. Das tobende Wesen quer über der ganzen Breite der Mulde erwartet uns. Alle Gedanken verwehen wie ein Blatt im Sturm. Wir stürzen drauf los, der krachende Strudel tut einen Satz und verschlingt uns.
Glühender Atemstoß, Hieb des Luftdrucks, blasse Feuerbüschel, stickender Qualm und eine betäubende Dämmerung von Erdstaub und Rauch rollt über uns weg und zerfetzt die Nacht unsrer Gedanken. Die Luft zerreißt unter Splittern und einem Gekrach, das schartig ist wie zerbrochenes Eisen und tausend Töne hat, vom Gebell zerklirrender Scheiben bis zum Dröhnen fallender Felsblöcke und stürzender Bäume.
Wir tauchen auf aus dem Urwald von Tönen und Farben, Hitze, Schatten und wirbelnden Kreisen, und wir ordnen uns mühsam mit verworrenen Gedanken. Sechs Soldaten meiner Kompagnie, der Bataillonsadjutant und noch einige fehlen. Sie liegen begraben in dem kreisenden Bauch des Sperrfeuers, das sie gepackt und zerrissen hat.
Wir warten wieder, bis der Bataillonskommandeur die Verteilung der Kompagnien bringt. Nach vier Richtungen, strahlig nach vorn wandern die Kompagnien auseinander. Der Blick sucht nach den feindlichen Fesselballons, ob sie uns wohl hier sehen können. Keine Sorge. Sie haben uns schon längst gesehen, und sie beweisen uns das deutlich und laut. Ein Hagel von Granaten, durchsetzt mit Schrapnells, ergießt sich plötzlich über das ganze Anmarschgelände des Bataillons gleich suchenden Fühlern und zuckenden Tastern eines unsichtbaren Ungeheuers der Ferne. . . Einen Mann seh’ ich, der plötzlich vor einer flatternden Wolke steht, die kleiner als alle andern rasch wie eine schlagende Tatze über den Boden kratzt. Er wird ganz steif und lang und fällt um wie ein Brett. Rechts vor mir flucht und lacht ein Leichtverwundeter, und vor mir sinkt einer hinkend ins Knie und stöhnt, stöhnt wie ein in versteckter Falle gefangenes Tier. Ich laufe vorbei und sehe noch, wie er zu einem Gebüsch kriecht. Weiter — weiter!
In unsrer vorgeschriebenen Aufnahmestellung versuchen wir in den kalkigen Boden hineinzukommen. Der Stein aber stößt uns von sich. Nur notdürftigste Deckung ist ihm in keuchender Arbeit abzutrotzen. Jede Bodenfalte wird ausgenutzt. In tiefer Gliederung, möglichst unübersichtlich, liegen wir und gleichen einem federnden Polster, das jeden Stoß fängt und zurückstößt. Links neben mir, am Rande eines hohen, gelben Kornfeldes, klopft und hämmert es: ein Maschinengewehr von uns wird eingebaut.
Geschützfeuer verschont uns noch. Flieger haben sich den Schaden noch nicht aus der Nähe besehen. Weiter rechts von uns geschieht etwas Seltsames. Dort liegt ein kleegrüner Hügel. Plötzlich fällt ein Gewitterhimmel von Granatwolken auf ihn hernieder und verhüllt sein Grün unter grauen und schwarzen Klumpen. Nach einer Viertelstunde taucht er wieder hoch, aber — was ist das? Ist Schnee aus jenen donnernden Wolken auf ihn gefallen? Er ist weiß, nur wenige grüne Lappen unterbrechen die helle Farbe. Nein, es hat nicht geschneit, nur die Granaten haben die Erde fortgerissen und den Kalkstein bloßgelegt. Ebenso gut hätten wir dort gelegen haben können. . .
Am Nachmittage knattert Maschinengewehrfeuer vor uns auf. Leuchtkugeln zeichnen kaum sichtbare, rote Linien in die Helle des Tages. Leuchtkugeln: das stumme, inbrünstig steigende Flehen des bedrängten Fußsoldaten um Hilfe der Geschütze, um Sperr- oder Vernichtungsfeuer. . . Lauter gellen die Knalle vor uns. Eine Begleitbatterie erscheint neben einem Hügel und rast — Frechheit und Tatsache! — mit lebendigen Pferden weithin sichtbar über den kahlen Hügelkamm. Auf ihre Spuren senkt die feindliche Artillerie ihre dröhnendsten Flüche und ballt ein halbes Dutzend Granatfäuste hinter ihr. Aber die Batterie ist durch! Heute noch sind mir die lebendigen Pferde ein Rätsel, denn aus Pappe waren sie bestimmt nicht.
Allmählich kommt unsere vorderste Linie zurück und geht durch unsre Reihen hindurch. Blasse, schmutzüberkrustete Gesichter, gepresste Lippen, schweigende Blicke. Freut euch! sagen diese leeren Augen, wir haben unsre Pflicht getan. Diese Soldaten sind unbrauchbar. Ihre Nerven hängen locker, ihre Kampfsittlichkeit zerläuft. Sie haben dem Vaterland gegeben, was des Vaterlandes ist: fünfzehn Mann zählt die Kompagnie und zählte vor drei Tagen noch sechzig!
Sie sind vorbei, und nun bilden wir die eiserne Grenze Deutschlands. Was jetzt kommt, ist der Feind und in ihm der Wille zur Vernichtung. Wille gegen Wille, Vernichtung gegen Vernichtung. Es gibt nur eins: siegen, — nicht durchhalten, wie das ängstliche Kennwort der Regierung heißt.
Und dann flackert es hier auf und dort, andern Orts und vor uns, und plötzlich ist überall ein Knattern und Hacken, Knallen, Hämmern und Rattern und springt von den Hügeln zurück und rast im Widerhall zwischen den schallenden Tälern und Senkungen. Der Franzose ist an uns geraten . . .
Da steht der Krieg. Ich sehe ihn genau: riesig, düster und plump ragt er über die Wälder und schwenkt seine klirrenden Waffen und stampft über die Landschaft mit drohender Glut und schwerem Rauch der Fackel. Blitz ist sein Blick, Donner ist seine Stimme, Tod und Vernichtung ist im Tritt seiner klotzigen Füße. Neben ihm aber wandelt ein andrer — und ich vergesse ihn nie — strahlend, groß, mit glänzendem Antlitz, neben ihm wandelt ein andrer, der hat schneeweiße Schwingen und breitet sie über uns allen, weit, weit über Millionen: der Schutzgeist des Vaterlandes. . .
Keiner der Soldaten weiß, wie die Schlacht steht, was links und rechts von ihm vor sich geht; nur an dem mächtigen Bogen der Fesselballons kann er ungefähr den Lauf der vordersten Linie feststellen. Nur eins wissen wir alle: diese Linie muss gehalten werden und auf jeden aufgefangenen Angriff muss der Stoß unsres Gegenangriffs stoßen. Bricht der Pfeil des Ansturms durch unsre Linie hindurch, dann können die Folgen unabsehbar sein, wie der Eindrang eines Giftpfeils in einen gesunden Leib.
Über unsern Häuptern klingt Hasslied und Todesgesang der Gewehrgeschosse. Manche zwitschern wie lustige Schwalben, als wollten sie uns locken, einige zischen wie zwischen giftigen Zähnen, andre surren wie schwirrende Metallbänder, diese fauchen wie stoßende Schlangen, und jene überschlagen sich am Gehälm und trillern und schnarren vor Ingrimm. Wir heben Kopf und Brust hinein in den wegfegenden Regen der kupfernen Tropfen. Schussfeld geht vor Deckung! Wenn wir das Leben nicht wagen, gewinnen wir Tod oder Gefangenschaft. Dann ist unsre Reihe krachendes Leben, rüttelt an den Nerven des Feindes und duckt ihn nieder in tatlose Deckung.
Neues stößt auf uns hernieder. Starre Flügel, gierige Augen, klingendes Schwirren rast heran und herab: Infanterieflieger des Feindes. Sie sausen unsre Linie entlang, zeichnen, schießen und werfen Bomben auf unsre schutzlosen Leiber. Und sie bringen das Artilleriefeuer, das uns, die wir hier durch Befehl und durch Selbstzwang unverrückbar festgebannt liegen, gnadenlos fassen und in die wuchtigen Arme nehmen kann. Das Selbstverständliche geschieht: die Artillerie fingert nach uns und schlägt auf uns los. . . . Unbeugsamer Wille zur Vernichtung ist drüben, unbeirrbarer Wille zum Sieg sieht nur das eine Ziel, geht, rennt, springt und kriecht darauf los. Jedes Mittel ist ihm recht, wenn es zum Siege führt. Und bei uns, bei unsrer Regierung?
Ich blicke die Reihen entlang und sehe den Leutnant, den Führer unsrer Kompagnie. Und wie mein Blick ihn fasst, da wird sein Gesicht plötzlich schlaff, der kniende Leib sinkt ein wenig und wird kleiner. Eine heftige Bewegung der Meldeläufer ist um ihn.
„Sanitäter!“ schreit jemand.
Ich krieche zu dem Leutnant; er hat sich zuweilen sehr kameradschaftlich mit mir unterhalten. Er ist sehr blass und still, der Atem rollt schwer und eintönig und schwingt wie der Pendel einer ablaufenden Uhr. Als er mich ansieht, lächelt er ein bisschen und zwingt die Hand empor in die Brusttasche.
„Offizierstellvertreter“ — er nennt den Namen — „übernimmt die Kompagnie. Ich bin fertig“, sagt er leise, aber deutlich.
Dann reicht er mir seine Brieftasche.
„Da sind zwei Bilder drin“, flüstert er. „Legen Sie beide bitte neben mich. . . Zwei Bilder. . .“
Und ich finde die zwei Bilder: eine grauhaarige Frau, der die Augen munter im Kopf blitzen, und ein junges Mädchen, deren lose gesteckte Haare wie lauter blondes Licht um das schmale, lächelnde Antlitz flimmern. Seine Mutter die eine, die andre seine Verlobte. Sie wird nie seine Frau werden. Sorgsam lege ich beide Bilder neben ihn an den Rand des Granattrichters, in dem er liegt, so dass er, ohne den Kopf zu drehen, die beiden Bilder vor sich hat. Jetzt ist die Pflicht getan bis zum Ende, jetzt gibt es keine Kompagnie, keine Uniform, keinen Krieg mehr für ihn, jetzt kann er an sich denken und sich etwas Gutes antun und Mensch sein, — für wenige Minuten, zum letzten Mal. Und da liegt er und starrt aus bleichem Antlitz mit Augen, die immer starrer werden, auf die beiden lächelnden Häupter vor ihm. Seine Soldaten sehen ihn zuweilen mit scheuen Seitenblicken an . . . . Er starrt und starrt. Und das Antlitz der Mutter und das blühende Gesicht des jungen Mädchens leben, neigen sich über ihn und erfüllen und verhüllen ihm die ganze Welt aus Dreck, Schweiß und Blut. Immer verzichtender wird sein Atem, immer tiefer und verhangener sein Blick, lächelnder das schmerzliche Antlitz, und dann hat er seine große Pflicht für sein Vaterland getan und ist zu Hause und im Frieden . . .
Andre sterben neben ihm. Vor einem Granateinschlag springt ein Soldat rückwärts und setzt sich hin wie auf einen Stuhl. Da liegt er, lacht und hält mit den Zähnen noch die Fetzen einer Zigarre. Ein armlanges Sprengstück hat ihm den Bauch zerschlagen und nicht einmal zum Verzerren des Gesichts Zeit gelassen. Hart nebeneinander stehen Tod und Leben; keines Grashalmes Breite trennt sie. Auf fremdem Boden fallen sie, und auch das fremde Land nimmt sie weich in die Mutterarme der Erde.
Verwundete schreien und machen alle um sich her erregt und unruhig. Einige liegen ganz still und ergeben wie der sterbende Leutnant; andre wollen nicht sterben, müssen es doch und kämpfen mit ihren letzten, armseligen Kräften gegen den Tod, mit Handzuckung und Blick, vor allem aber mit Keuchen, Röcheln und Schreien. Das trifft die Nerven derer, die es sehen und hören, wie Sporenstiche und Peitschenhiebe ein Pferd treffen. Die Nerven springen, bäumen sich, toben gegen die Marter, der sie nicht entgehen können, ahnen gleiches Schicksal, bis Gewöhnung sie beruhigt, bis der stürmende Feind sie ablenkt, neue Schrecken sie rütteln und bis die Kampfsittlichkeit sie wieder in ihre festen Zügel bekommt. Fester sehen die Augen dem neuen Angriff entgegen. Das Blei zischt aus dem Lauf, der Ansturm wird abgeschlagen, und im Gegenangriff wird die Stellung gefestigt und behauptet. . . .
Als am Abend eine erschöpfte Kampfpause sich zwischen Freund und Feind legt und die Kompagnie zur Besinnung kommen kann, springt plötzlich ein kleiner Soldat hinter einem Busch hoch und schreit, als gälte es das Leben: „Das war der Schluss der Vorstellung. Sollte es den Herrschaften gefallen haben, so —“
Wumm — brüllt ihn eine Granate an und baut sich dreißig Schritte entfernt herausfordernd neben ihn. Mit einem Satz ist der Kompagniekaspar im Boden verschwunden. Aber ehe die Kameraden wieder ernst geworden sind, ist er schon wieder da, ganz wie es ihm zukommt.
„Umstände, deren ich leider nicht Meister bin, zwingen mich —“
Pack . . . pack. . . pack. . . pack hackt ein Maschinengewehr giftig nach ihm hinüber. Im ersten Knall wird er unsichtbar . . .
Die Gegensätze splittern draußen aneinander wie Tod und Leben, wie Granate und Erde, wie Schlacht und Sommertag. Und in manchem Gegensatz liegt rettende Erleichterung vor dem Überdruck der Lasten auf uns da draußen.
Dann aber packt uns eine jener fortreißenden Überraschungen, wie sie der Krieg schafft. Rechts von uns beginnt plötzlich die unsichtbare Ferne hinter blauen Wäldern und Höhen zu brodeln, rollen und dröhnen. Immer lauter schwillt das tiefe Drohen und Zürnen herüber gleich dem Knurren und Grollen eines gereizten Löwen, der sich erhebt und zum Sprunge bereit macht. Unaufhörlich haut Hieb in Hieb, Krach in Knall, Abschuss in Einschlag. Immer wirbelnder, rollender wird der Donner, bis mit einem Mal einer von uns den Spaten tief in die Erde rennt, lauscht und sagt: „Wenn das nicht Trommelfeuer ist und wenn wir da nicht diejenigen sind, welche . . . dann weiß ich’s auch nicht. Ich grab keinen Stich mehr. Ich spar meine Kraft.“
Und wir alle haben das Gefühl: dort prallt Großangriff gegen Großangriff, dort ist der Franzose zu Boden geschlagen, und dort packen wir ihn. Der Soldat hat ein feines, untrügbares Gefühl für die Dinge des Krieges.
Näher und näher wandert das tobende Gedonner; Kilometer um Kilometer ergreift es, Meile um Meile springt es weiter wie Waldbrand im Geäst. Jetzt ist es dicht heran. Das ist kein Spähunternehmen und kein Gefecht mehr, — nein, nein, das ist Schlacht und Großangriff, Sturmgesang des Sieges, Vorsturm des Vaterlandes. Zwanzig, dreißig Kilometer Front recken sich dort empor in einem glühenden Atem gesteigertsten Liebens. Hunderttausende von Augen starren nur auf den Feind, auf ihn allein. Hunderttausend Willen und Herzen schlagen nur in einem Gefühl: Sieg.
Und dann springt die Flamme des Angriffs in unsre Herzen. Über uns schreit es auf wie in befreitem Grimm und jauchzendem Zorn. Nicht zehn und zwanzig Granaten rauschen über uns weg, — hunderte sind plötzlich in den Lüften. Immer neue folgen, rastlos, ununterbrochen, Bahnbrecher des Sturms, eiserne Götter des Siegs.
„Endlich!“ schreit eine aufatmende Stimme neben mir. Es ist der Mann, der vorhin zuerst mit Schanzen aufgehört hat. Er zeigt nach oben zu den unsichtbar brausenden Schwingen des Stahls.
„Die beenden den Krieg!“ fügt er hinzu. „Die und wir hier!“ Und dann mit einem Blick auf den verdreckten Spaten: „Ein Segen, dass die elende Buddelei aufhört.“
Befehle kommen von rückwärts, Munition wird geschleppt, eiserne Portionen werden verteilt. . . Vor uns rast das Qualmgewitter über die Stellungen des Feindes und zerschlägt seine Gräben und Sappen, vergast seine Geschützstellungen und zertrümmert Nerven und Kampfsittlichkeit. Dann springt das Artilleriefeuer plötzlich empor, wirft sich mit mächtigem Satz und Prankenschlag voran in das Gelände und stürzt sich auf alle Heimtückereien der Maschinengewehrnester. Feuerwalze heißt dies zermalmende Wandern der Granaten. Zeichen und Führer zum Angriff ist es.
Wir erheben uns groß und breit und gehen dem bahnbrechenden Granatfeuer nach rasch auf die Stellungen des Feindes los. Letzte Zuckungen des Widerstandes, wütende Krämpfe der Verteidigung werden im ersten Anlauf erstickt und überrannt. Ein Schwarm verstörter Gefangener bleibt ratlos, verwirrt, angstvoll, betäubt hinter uns. Über alle Hindernisse und Hinterhalte dringen unsre Reihen vor. Versteckte Widerstandsnester plötzlich losschnatternder Maschinengewehre werden von Stoßtrupps umklammert wie von kräftigen Armen und schnell niedergerungen wie von entschlossen packenden Fäusten, die zu fassen und zu zerbrechen wissen.
Dann ergießt sich auf dreißig und mehr Kilometer Frontbreite eine wegschwemmende Flut deutschen Volkstums, unbeugsamen Siegwillens, freudiger Siegesgewissheit in feindliches Volkstum, in gebrochenen Siegwillen, in zusammenbrechenden Widerstand. Im Rausch des Angriffs fällt alles Kleinelend ab von den Herzen derer, die im zermürbenden Stumpfsinn des Grabenkrieges, unter dem Schutthaufen kleinlicher Entbehrungen, mühseliger Erdwühlereien und erfolglosen Pendelns der festen Kämpfe zu ersticken drohten. Die betäubende Keulenhaftigkeit des Stellungskrieges ist zu Ende, und aus der Scheide fährt die im Angriff blitzende Schärfe des Schwertes. . .
Der Handstreich auf Lüttich1 am 5.—7. August 1914.
Von General der Infanterie z. D. Erich Ludendorff, damals Generalmajor und Oberquartiermeister der 2. Armee.
er Sturm auf die Festung ist mir die liebste Erinnerung meines Soldatenlebens. Es war eine frische Tat, bei der ich kämpfen konnte, wie der Soldat in Reih und Glied, der im Kampf seinen Mann stellt.
Am 1. August wurde die Mobilmachung ausgesprochen.
Ich fuhr am 2. August früh mit meinen Werden über Köln nach Aachen, wo ich abends eintraf. Meine Mobilmachungsbestimmung ließ mich Oberquartiermeister bei der 2. Armee werden, deren Oberbefehlshaber General v. Bülow, Chef General v. Lauenstein waren.
Ich trat zunächst zum General v. Emmich, der die Aufgabe hatte, mit einigen schnell mobilgemachten, gemischten Infanterie-Brigaden, die aber nicht die volle Kriegsstärke hatten, die Festung Lüttich durch Überraschung zu nehmen. Dem Heere sollte hierdurch der Weg nach Belgien hinein freigemacht werden. Mein Quartier in Aachen war das Hotel Union. Am 3. August früh traf General v. Emmich ein. Ich sah ihn zum ersten Male. Tiefe Hochachtung verband mich von da ab mit diesem bedeutenden Soldaten bis zu seinem Tode. Sein Stabschef war Oberst Graf v. Lambsdorff, ein ausgezeichneter Offizier, der sich bei Lüttich und später große Verdienste erwarb.
Am 4. August früh erfolgte der Vormarsch über die belgische Grenze. Am gleichen Tage machte ich bei Vise, hart an der holländischen Grenze, mein erstes Gefecht mit. Es war ganz klar, dass Belgien auf unsern Einmarsch seit langem vorbereitet war. Die Straßen waren so planmäßig zerstört und gesperrt, wie es nur bei anhaltender Arbeit möglich war. An der belgischen Südwestgrenze haben wir nichts von ähnlichen Sperren entdecken können. Warum hat Belgien gegen Frankreich nicht die gleichen Maßnahmen ergriffen?
Die Frage, ob wir die Brücken bei Visé unversehrt besetzen würden, war von besonderer Bedeutung. Ich begab mich zu dem Kavalleriekorps v. der Marwitz, das dorthin angesetzt war. Es kam nur langsam vorwärts, da ein Verhau nach dem andern die Straße sperrte. Auf meine Bitte wurde eine Radfahrer-Kompagnie vorgeschickt. Bald darauf kam ein Radfahrer zurück: die Kompagnie wäre nach Visé hineingefahren und vollständig vernichtet. Ich machte mich mit zwei Mann dorthin auf und fand zu meiner Freude die Kompagnie unversehrt, nur der Führer war gerade durch einen Schuss vom anderen Maasufer her schwer verwundet. Die Erinnerung an diese kleine Episode hat mir später geholfen. Ich wurde unempfindlicher gegen Tataren- oder, wie es später hieß, Etappengerüchte.
Die schönen, großen Maasbrücken bei Vise waren zerstört: Belgien war auf den Krieg eingestellt.
Am Abend war ich in Herve, meinem ersten Quartier auf feindlichem Boden. Wir übernachteten in einem Gasthof gegenüber dem Bahnhof. Alles war unversehrt. Wir legten uns ruhig schlafen. In der Nacht erwachte ich durch ein lebhaftes Geschieße, auch gegen unser Haus. Der Franktireurkrieg in Belgien begann. Er lebte am nächsten Tage allerorts auf und hat so ausschlaggebend zu der Erbitterung beigetragen, die diesen Krieg im Westen, im Gegensatz zu der Stimmung im Osten, in den ersten Jahren kennzeichnen sollte. Die belgische Regierung hat eine schwere Verantwortung auf sich geladen. Sie hat den Volkskrieg planmäßig Organisiert. Die Garde civique, die im Frieden ihre Waffen und Uniformen hätte, konnte einmal in diesem, dann in jenem Gewande auftreten. Auch die belgischen Soldaten müssen zu Beginn des Krieges noch einen besonderen Zivilanzug im Tornister mitgeführt haben. Ich sah auf der Nordostfront Lüttichs in den Schützengräben bei Fort Barchon Uniformen liegen, die die dort kämpfenden Soldaten zurückgelassen hatten.
Solche Art von Krieg entsprach nicht den kriegerischen Gebräuchen. Es ist unserer Truppe nicht zu verdenken, wenn sie mit größter Schärfe dagegen einschritt. Unschuldige werden mit zu leiden gehabt haben, aber die „belgischen Gräuel“ sind eine überaus geschickte und mit allem Raffinement erfundene Und verbreitete Legende. Sie müssen einzig und allein der belgischen Regierung zur Last gelegt werden. Ich selbst war mit dem Gedanken einer ritterlichen und humanen Kriegführung ins Feld gezogen. Dieser Franktireurkrieg musste jeden Soldaten anwidern. Riem soldatisches Empfinden hatte eine schwere Enttäuschung erlitten. Die Aufgabe, die die vorausbeförderten Brigaden vor Lüttich zu lösen hatten, war schwer. Es war auch eine unerhört kühne Tat, durch die Fortlinie einer neuzeitlichen Festung hindurch in deren Inneres einzudringen. Die Truppen fühlten sich beklommen. Aus Gesprächen mit Offizieren entnahm ich, dass die Zuversicht auf Gelingen des Unternehmens nur gering war.
In der Nacht vom 5. zum 6. August begann der Vormarsch durch die Werke nach Lüttich hinein.
Gegen Mitternacht des 5./6. verließ General v. Emmich Hervé. Wir ritten zur Versammlung der 14. Infanterie-Brigade — Generalmajor v. Wussow — nach Micheroux, etwa 2—3 km von Fort Fléron entfernt. Auf der Straße, die von dem Fort aus unmittelbar bestrichen werden konnte, sammelten sich in tief dunkler Nacht die Truppen mit den ihnen noch recht ungewohnten, aber so überaus segensreichen Feldküchen in einer wenig kriegsmäßigen Weise. In diese Versammlung hinein fielen einige Schüsse aus einem Hause südlich der Straße. Es entstanden Kämpfe. Das Fort aber schwieg, es war ein Gotteswunder. Etwa gegen 1 Uhr begann der Vormarsch. Er führte uns nördlich Fort Fléron vorbei über Retinne hinter die Fortlinie und dann auf die am Rand« der Stadt gelegenen Höhen der Chartreuse. Dort sollten wir am frühen Vormittag sein; die übrigen Brigaden, die die Fortlinie an anderer Stelle durchbrechen sollten, hatten zu gleicher Zeit die Stadt zu erreichen.





























