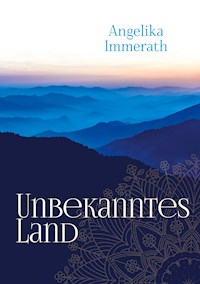Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lisa Romeike hält ihren neuen Nachbarn für einen sonderbaren Menschen. Er drängt sich ständig ungefragt in ihr Leben, gibt jedoch nur Belangloses von sich selbst preis. Das setzt ihre Phantasie in Bewegung. Verbirgt er womöglich ein Geheimnis, das nicht ans Tageslicht kommen soll? Es reizt sie, dieses Rätsel zu lösen, zuerst nur spielerisch, dann aber zunehmend verbissen. Die Vergangenheit, mit der sie konfrontiert wird, erweist sich als ein Netz von Lügen, in dem sie sich schließlich selbst verfängt, weil sie die Wahrheit vor ihrer Familie verschweigt. Das ist der entscheidende Fehler, der sie zum Aufgeben zwingt. Doch war wirklich am Ende all ihre Mühe vergeblich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.“
André Malraux
Vorbemerkung
Bei ihrem letzten Besuch vor einigen Monaten – genau weiß ich das nicht mehr, weil hier ein Tag dem anderen gleicht, ich nehme aber an, es war im Oktober, denn die Ahornbäume im Park glühten herbstlich unter einem geradezu unanständig blauen Himmel – damals also hatte sie zu mir gesagt:
„Warum schreibst du das eigentlich nicht auf, Lila? Ich meine, dass es dir guttun würde.“
Ich hatte ihr nicht geantwortet, weil mir damals einerlei war, was andere meinten.
Jetzt aber, ich kann vom Schreibtisch am Fenster aus die blühenden Forsythien vor der Eingangstür sehen, habe ich die Packung mit den 500 DINA4- Blättern geöffnet, die sie mir geschickt hat, den Drucker bestückt, mein Notebook samt Stick überprüft, die üblichen Vorbereitungen getroffen und angefangen mit der ersten sehr weißen, sehr leeren Seite, die mich höhnisch angrinst, solange ich sie noch nicht gefüllt habe mit meinen Erinnerungen. Das Grinsen wird ihr und all ihren Schwestern bald vergehen.
Schloss Herrentann,
im April 2014 Lisa Romeike
Inhaltsverzeichnis
Kapitel: Familienbande
Kapitel: Schicksalsschlag
Kapitel: Konsequenzen
Kapitel: Mutmaßungen
Kapitel: Planspiele
Kapitel: Entsorgung
Kapitel: Zufallsfund
Kapitel: Attacke
Kapitel: Quellenstudium
Kapitel: Fiasko
Kapitel: Silberstreifen
Kapitel: Erleuchtung
Kapitel
Kapitel: Entscheidung
1. Kapitel: Familienbande
Gelegentlich beginnen Tragödien im wirklichen Leben ähnlich banal wie die Filme von Alfred Hitchcock. Beispielsweise so:
„Ich glaub’, der tickt nich’ richtig!“, verkündete Nicole beim Frühstück eines Samstags im Mai und tunkte ihr Butterhörnchen energisch in den Milchkaffee. Warum hätte ich mich über diese Bemerkung wundern sollen? Etwas in dieser Art bekam ich fast täglich zu hören. Nikki war eben noch zu jung für eine gewisse Ausgewogenheit im Urteil. Ich mochte sie trotzdem. Sogar, wenn sie wie jetzt beim Abbeißen ein Stück des durchweichten Hörnchens in den Becher platschen ließ und die frische Tischdecke mit einem guten Dutzend Kleckse sprenkelte.
Sie beachtete nicht, was sie angerichtet hatte, spann, nachdem sie genüsslich gekaut hatte, ihren Gedankengang weiter: „Was denkt sich dieser alte Kerl eigentlich? Dem sind vorhin die Augen bald aus dem Kopf gefallen, als ich mich im Liegestuhl gesonnt hab’!“
Alt! Nicht zu fassen! Der neue Nachbar ist, über den Daumen gepeilt, nicht einmal 50! Das war folglich eine Beleidigung. Auch für mich. Diese freche Göre brauchte dringend einen Dämpfer!
„Also erstens“, fing ich an, als wäre sie bestenfalls 13, „erstens solltest du unbedingt diese ausgiebigen Sonnenbäder meiden. Willst du bald so faltig sein wie eine Galapagos-Eidechse? Oder später Hautkrebs kriegen?“
„Geschenkt! Diese Platte hatten wir doch schon mal, oder? Bleib’ cool! Noch was?“
„Zweitens: Bist du das Anschauen nicht wert?“
„Na ja, wenn du die Sache so sehen willst … Aber trotzdem, ich mag ihn nicht!“
„Obwohl du noch nie ein Wort mit ihm gesprochen hast?“
„Du vielleicht?“
„Nein, das nicht. Aber ich lehne auch niemand ab, den ich gar nicht kenne. Du steckst voller Vorurteile!“
„Na und? Alle haben Vorurteile. Auch du!“
Ich schüttelte empört den Kopf und spielte meinen Trumpf aus: „Musst du immer das letzte Wort haben?“
Das war ein Fehler.
Nikki beugte sich zu mir herüber und drückte mir einen klebrigen Kuss auf die Wange. Mein Zorn schmolz dahin. Sie war meine Kleine, mein Hätschelkind, nachdem die Zwillinge das Haus zum Studieren verlassen hatten. Und sie nutzte diese Tatsache schamlos aus. Ich war ihr einfach nicht gewachsen.
„Tschüs, Muddi“, säuselte sie − einer ihrer rohen Scherze, die sich Nikki auf meine Kosten leistete − wedelte flüchtig mit der Hand und verschwand. Zu irgendwem. Irgendwohin, wo ich sie nicht beschützen konnte.
Das kann man nie, sobald man einen anderen zu nah an sich heranlassen hat. Wer klug ist, verzichtet besser von vornherein auf derlei Bindungen. Im eigenen Interesse. Zu viel Schmerz, zu viele Niederlagen. Wer das nicht rechtzeitig einsieht, ist entweder ganz und gar unerfahren oder hat eine selbstquälerische Ader. Eines Tages wird er seine Entscheidung bereuen. So, wie ich sie jetzt bereue. Sie hat mich in die Sackgasse hineingetrieben, aus der ich vermutlich nicht mehr entkommen werde.
Ich stopfte die verkleckerte Tischdecke in die Waschmaschine, räumte das Frühstücksgeschirr ab, spülte, saugte, wischte Staub, erledigte all das, was die Woche über liegengeblieben war. Achim hatte seinen üblichen Termin im Fitness-Studio. Je älter er wurde, desto mehr achtete er auf seine Figur.
(Da behaupte bloß keiner, Männer seien weniger eitel als Frauen! Aber das ist nicht mein Thema.)
Beim Abendessen zu zweit gestand ich meinem Mann die Ängste, die mich plagten, sobald Nikki das Haus verließ.
„Mein Gott! Ständig bist du dem Mädchen auf den Fersen. Sie ist total überbehütet. Das wird sich noch mal rächen!“, unkte er.
Wie hatte ich nur diese männliche Kassandra ins Vertrauen ziehen können! Ich hätte wissen müssen, dass nichts dabei herauskäme. Also lieber über Einzelheiten schweigen. Das aber brachte ihn erst so richtig in Fahrt. Was folgte, war ein echtes Horrorszenario, Nikkis mögliche Zukunft betreffend – ausgelöst durch meine „verdrehte“ Erziehung (in die er sich bisher freilich nie eingemischt hatte). Er ließ nicht einmal das Näschen Koks und den Straßenstrich aus.
Als er fertig war mit seiner Tirade, lächelte ich ihn an und sagte: „Danke! Du hast mir sehr geholfen. Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe.“
Seine Antwort: „Na also, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung“. Für Ironie hatte er kein Gespür.
Und ebenso wenig dafür, wann er mir zur Seite springen müsste. „Helfen“ war ein Fremdwort für ihn. Er tat es nur, wenn ich ihn förmlich zwang. Darin ähnelte er Nikki aufs Haar.
Erstaunlich, denn schließlich ist er nicht ihr Vater. Nein, nicht, was man jetzt vermuten könnte. Ich bin auch nicht ihre Mutter − bloß ihre Tante. Allerdings eine Blutsverwandte. Also wenigstens ein Teil gemeinsame Gene.
(Obwohl die Wissenschaft … Aber was hat die schon alles behauptet! Beispielsweise über den gesundheitlichen Nutzen von Spinat oder fleischloser Ernährung oder auch über die angeblich von uns Menschen verursachte Klimakatastrophe, die uns eigentlich zum kollektiven Selbstmord veranlassen müsste, falls man ihre Prophezeiungen für bare Münze nähme.
An dieser Jahrhundert-Mär stricken tausend selbsternannte Experten fleißig weiter, auch wenn die Tatsachen jedem, der seine fünf Sinne beisammen hat, das Gegenteil beweisen. Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf, das schrieb Christian Morgenstern schon vor rund hundert Jahren.)
Doch ich schweife wieder einmal ab, komme „vom Hölzken auf Stöcksken“, eine meiner übelsten Angewohnheiten, die Achim furchtbar auf die Nerven fielen und die er mir bei passender Gelegenheit unter die Nase rieb. Mit dem, was mich an ihm störte, hielt ich, das kann ich nicht abstreiten, auch nicht hinter dem Berg. Wozu sind wir Frauen denn gleichberechtigt!
Wie zu erwarten wurden die Waffen durch den ständigen Gebrauch im Laufe der Jahre stumpf oder auch das Fell allmählich dicker. Das Gefecht jedenfalls verkam zu einem ziemlich lächerlichen Ritual, dessen Ablauf bis in die Formulierungen hinein festgelegt war, und keiner der Kontrahenten lernte mehr irgendetwas dazu. Warum auch?
Es funktionierte doch insgesamt durchaus befriedigend zwischen uns. Nicht besser, aber auch nicht schlechter als bei Millionen anderer, die den Sprung ins Ungewisse gewagt haben. Kurz gesagt, wir waren ein ganz normales Ehepaar. Steuertechnisch ausgedrückt, eine „Zugewinngemeinschaft“ mit allen Vor- und Nachteilen.
Doch wieder zurück zu Nikki.
Das Leben meiner Nichte war nicht so geradlinig verlaufen wie das ihrer Klassenkameraden. Und trotzdem hatte sie unserer Meinung nach keinen gar so schlechten Start. Wir versuchten, soweit das überhaupt möglich ist, den Verlust zu ersetzen, den sie als kleines Mädchen erlitten hatte.
Meine Schwester Beate, zwölf Jahre älter als ich, trug schwer an der Last ihres Namens. Sie war keineswegs glücklich, sondern ein Trauerkloß und, was die Jungen anging, ein rechtes „Kräutchen-rühr-mich-nicht-an.“ Während ich unsere lärmempfindliche, an Migräne leidende Mutter mit meiner Beatles-Manie fast in den Wahnsinn trieb, regelmäßig in Discos verkehrte, was mein Vater auch mit drakonischen Strafen nicht verhindern konnte, da wir im Erdgeschoss wohnten, mit 16 meinen ersten festen „Lover“ hatte, einen grünhaarigen Punker von mäßiger Intelligenz, den ich bald gegen einen Bäckerlehrling mit enorm abstehenden Ohren austauschte. Ihm folgte eine beachtliche Reihe anderer sonderbarer Typen, mit denen ich mich zu Hause nicht sehen lassen durfte.
Beate dagegen warf sich ganz aufs Lernen, war Klassenbeste beim Abitur und studierte, was meine Eltern ein Vermögen kostete. Nach 16 Semestern Biologie und Chemie mit Prädikatsexamen wurde sie als rechte Hand des Laborleiters in einer bedeutenden Pharmafirma eingestellt, verdiente gut, legte einen Großteil ihres Einkommens gewinnbringend an und verbrachte ihren Urlaub in immer derselben billigen bayrischen Pension. Mode und Kosmetik ließen sie kalt. Obwohl ganz und gar nicht reizlos, machte sie nichts von sich her, und Männer waren für sie Wesen von einem anderen Stern.
Ich blieb die „liederliche Lisa“, wie meine sonst so sanfte Mutter mich beschimpft hatte, als ich mich mit einem Joint auf der Schultoilette hatte erwischen lassen. Zwar war ich allseits beliebt, aber mit meinen mäßigen Zeugnissen auch der Sargnagel meiner alternden Eltern.
„Sie ist begabt, aber scheut jede Anstrengung“, so die taktlose Auskunft meines Klassenlehrers, die man mir nicht verschwieg. Wohl um mich anzuspornen. Ich hörte förmlich, wie es gelegentlich hinter Papas und bestimmt pausenlos hinter Mamas Stirn arbeitete – sie brauchten es nicht auszusprechen: „Was soll nur aus ihr werden?“
Zwei Schwestern also, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten.
Dann aber entschloss sich das Schicksal einzugreifen. Die Sekretärin ihres Chefs, die eine mütterliche Ader hatte, ließ Beate durch die Blume wissen, dass sie sich unbedingt ein angemessenes „Outfit“ für den geplanten Kongress in Hamburg anschaffen müsse, klemmte sie sich nach Dienstschluss gewissermaßen unter den Arm und schleppte sie in ihre Lieblingsboutique, erteilte ihr einen Grundkurs im Gebrauch der wichtigsten Kosmetika und schickte sie zum Friseur.
Als ich Beate besuchte, öffnete mir eine ansehnliche junge Frau die Wohnungstür, die durchaus auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten bestehen konnte.
Ich erkannte meine eigene Schwester kaum wieder, wie sie sich da vor dem Spiegel hin- und her drehte, ihrem Abbild wohlgefällig zulächelte. Ich schloss sie in die Arme und sagte, als sei sie nach jahrelangem Exil nach Hause zurückgekehrt: „Na, endlich!“ Und wir vergossen tatsächlich gemeinsam ein paar Tränen, was noch nie vorher passiert war.
Ich liebte meine Familie, aber verabscheute normalerweise jede Gefühlsäußerung, gab mich betont ruppig. So war ich nun mal zu dieser Zeit. „Cool“ um jeden Preis. So ähnlich wie Nikki. Meine Eltern nannten das „schnodderig“ oder auch „pampig“, je nach Anlass. Sie waren eben durch und durch altmodisch. Fossile sozusagen. Ich verzieh ihnen das, obwohl ich ständig gegen sie opponierte. Das war ich schon meinen Freunden schuldig.
Einen Tag danach, spät am Abend, der Hamburger Kongress war längst beendet, klingelte das Telefon. Beate! Aufgeregt, hörbar animiert. Auch das war noch nie vorher passiert.
„Stell‘ dir vor, der Prof konnte seinen Vortrag nicht halten, war total heiser. Und ich durfte …“
„Und es war, wie ich dich kenne, ein voller Erfolg!“
„In jeder Hinsicht!“ Das klang vielversprechend. Doch bevor ich ihr noch mehr Einzelheiten entlocken konnte, brach die Verbindung nach einem ungewohnt zärtlichen „Mach’s gut, Schwesterchen“ ab. Ihre geheimnisvolle Andeutung hatte ein Karussell von reichlich haltlosen Vermutungen in Gang gesetzt, und daher schlief ich sehr unruhig in dieser Nacht.
Meine Mutter schüttelte den Kopf, als ich ihr Beates wundersame Veränderung schilderte und fragte sichtlich verärgert: „Das ist wohl wieder einer deiner albernen Scherze, mit denen du mich aufs Glatteis führen willst. Darauf falle ich diesmal nicht rein, nein, diesmal nicht! Denkst du vielleicht, ich wäre schon senil?“, stand auf und verfügte sich in die Küche, um den Auflauf in den Herd zu schieben.
„Auch gut, dann eben nicht“, dachte ich, „du wirst es schon mit eigenen Augen sehen!“, und half ihr beim Tischdecken.
Meine Schwester war ein Muster an Pünktlichkeit. Jeden Sonntag. Eine Minute nach eins klingelte es. Ich reagierte nicht. Mit Absicht. Vater goss noch die Blumen auf dem Balkon.
Unsere Mutter war gezwungen zu öffnen. Eine lange Minute vollkommene Stille. Was für eine Enttäuschung! Dann ein ersticktes „Beate!“ Ich lauerte in den halbdunklen Flur. Die beiden lagen sich wortlos in den Armen. Na also!
Auch mein Vater konnte es kaum fassen, wie gründlich sein hässliches Entlein sich gemausert hatte. Jetzt war er zum ersten Mal rundherum stolz auf seine Älteste.
Ich stimmte etwas halbherzig in das Loblied meiner Eltern ein, weil Beates elegantes Kostüm ganz und gar nicht meinem Geschmack entsprach. Doch warum sollte ich die gelöste Stimmung durch kleinliches Gemecker ruinieren?
Ach ja, – über die wirkliche Triebfeder für Beates Metamorphose zum schönen Schwan wurde nicht gesprochen. Sie ließ ein karges „Ihr werdet es noch früh genug erfahren“ verlauten, als meine Mutter Anstalten machte, sie auszufragen. Auf diese Weise nährte sie allerlei beunruhigende Spekulationen, doch offensichtlich war ihr das gleichgültig. Was ihre Sturheit anging, ähnelten wir uns frappierend; das hatte ich bisher nicht gemerkt. Und nicht nur darin, wie sich bald herausstellte.
In den nächsten sechs Wochen tat sich nichts weiter, als dass sie uns mit immer neuen modischen Überraschungen verblüffte. Mein Vater beharrte darauf, man hätte sie zur Leiterin der Abteilung befördert, mindestens mit einer Verdoppelung des Gehalts. Mutter ihrerseits war nicht davon abzubringen, dass sie womöglich in „leichtlebige“, also zweifelhafte Kreise geraten sei, in der man nur mithalten könne, wenn man sein Geld vorwiegend für aufwendige „Kledage“ hinblättere. Sie sei in großer Sorge um Beate.
Ich selbst verkniff mir übrigens jede Äußerung zu solchen Spekulationen, hatte ich doch schon von Anfang an einen bestimmten Verdacht, der unseren Eltern fernlag, denn sie waren nach eigener Aussage ja schon „jenseits von Gut und Böse“, was immer das genau bedeuten mochte.
Am siebten Sonntag schwänzte meine Schwester das gutbürgerliche Mittagessen und auch den hausgemachten Marmorkuchen. Sie verreise, erklärte sie am Telefon. Und ob sie vielleicht in der Woche danach jemanden mitbringen dürfe zum Kaffee.
Mein Vater, der sich oft langweilte, seitdem er seinen Schreibtisch als Leiter der Steuerfahndung mit der Pensionierung hatte verlassen müssen, sagte spontan: „Warum nicht?“, wollte noch eine Frage nachschieben, doch die Leitung war schon tot.
„Mein Gott, Walter, wie kannst du nur? Wer weiß, wen sie uns da anschleppt! Vielleicht ihren Chef, den Professor. Die Fenster sind so schmutzig, dass man sich schämt, und die Gardinen müssten unbedingt gewaschen werden. Wie soll ich das denn alles nur schaffen in den paar Tagen?“ So war sie, meine Mutter.
Na, sie brauchte sich nicht zu schämen an diesem Sonntagnachmittag. Der Gast sah weder Fenster noch Gardinen, nur seine strahlende Beate. Er war nicht mein Typ, aber zweifellos ein attraktiver Mann. Blond und braungebrannt, durchtrainierter Körper. Ein angenehmer Bariton namens Harald mit Nelkenstrauß für die Dame des Hauses, vielleicht ein paar Jahre älter als meine Schwester, ganz locker trotz all der kritisch prüfenden Augen. Man sprach bei Schwarzwälder Kirschtorte von diesem und jenem, auch übers Wetter, aber weder über die Missgriffe der gegenwärtigen Regierung noch über das, was meine Eltern ausschließlich interessierte: seine finanzielle Lage. Immerhin waren sie höflich genug, ihre Neugier wenigstens beim Antrittsbesuch zu bezähmen.
Kaum aber hatte das „junge Paar“ sich verabschiedet, fragte meine Mutter besorgt: „Verdient er überhaupt genug, um eine Familie zu gründen?“
„Aber Mama … “, setzte ich an.
Da griff mein Vater ein: „Lass deine Mutter! Sie meint es doch gut.“
„Die moralisch wertvolle Absicht als Entschuldigung für dummes Gerede. Wieder mal typisch“, dachte ich und versuchte es zum letzten Mal mit einem Appell an die Vernunft: „Ist das nicht egal, wer heutzutage das Geld verdient? Beate hat doch genug für beide. Hauptsache, sie lieben sich!“
Doch meine Eltern ließen sich durch nichts von ihren steinzeitlichen Vorstellungen abbringen. Nach diesem Muster verlief neuerdings jede Diskussion. Wut kochte in mir hoch.
„Wo lebt ihr eigentlich? Mit euch kann man nicht reden. Jetzt reicht’s mir! “, schrie ich, knallte die Tür hinter mir zu, zog mich um und fuhr in die Disco. Das hatten sie nun davon!
Am nächsten Tag lag meine Mutter mit Migräne im abgedunkelten Schlafzimmer und durfte nicht gestört werden.
Ich unterstellte ihr, dass sie uns Kinder auf diese hinterhältige Art für unsere fortschrittlichen Ansichten bestrafen wollte. Dass Haralds Besuch für sie zu belastend gewesen sein könnte, kam mir nicht in den Sinn.
Das folgende sonntägliche Familientreffen stand unter einem ungünstigen Stern. Unerträgliche Schwüle, aber kein reinigendes Gewitter. Mutter hatte sich wieder einmal besonders ins Zeug gelegt mit dem Kochen – umsonst. Wir beiden „Mädchen“ mussten die Hälfte des Kalbsnierenbratens und der hausgemachten Roten Grütze in den Kühlschrank verfrachten.
„Es hat euch nicht geschmeckt“, stellte Mutter beleidigt fest. Kein Widerspruch. Vater, der wie üblich unmäßig schwitzte, riss das Fenster auf. Eine heftige Bö fuhr herein, blähte die Übergardinen. Ganz fern grollte der Donner. Niemand machte Anstalten, das schmutzige Geschirr abzudecken. Nicht einmal Mutter ermahnte mich, meine Pflicht zu tun. Vier Augenpaare beobachteten gespannt eine fette Schmeißfliege, die sich an den Soßenresten gütlich tat.
„Also“, sagte Beate plötzlich entschlossen in die Stille hinein, „nun fangt schon an mit der Ausfragerei. Ihr könnt euch ja kaum noch beherrschen.“
Vater verlegte sich aufs Argumentieren: „Na, immerhin sind wir doch deine Eltern“. Dagegen konnte man nichts einwenden. Obwohl es eigentlich im Klartext hieß: „Wir haben ein Anrecht darauf, alles zu erfahren, was diesen deinen Liebhaber und potentiellen Ehemann betrifft.“
Jetzt gab es kein Halten mehr. Die Fragen prasselten nur so auf die arme Beate herunter wie die Hagelkörner auf den Gehsteig vor dem Haus.
Sie ließ den Schauer zuerst über sich ergehen, dann schaffte sie, wie es ihr als Wissenschaftlerin zukam, eine gewisse Ordnung in das Chaos, indem sie berichtete, was ihr wichtig erschien.
Ihr Harald verfüge, was die Familie bestimmt beruhige, über ein ansehnliches Vermögen.
„Und woher?“, fragten die Eltern gleichzeitig.
Beates folgender Satz wirkte, als hätte ein Blitz eingeschlagen.
„Er ist ausgebildeter Taucher und Fachmann für Münzen und arbeitet für eine renommierte Gesellschaft, die die Hebung von Schätzen aus Schiffswracks finanziert. Wie üblich wird er auf Erfolgsbasis honoriert. Aber er ist erfolgreich. Hat einen sechsten Sinn für wirklich wertvolle Objekte.“
„Ich habe es gleich gewusst!“, stöhnte Mutter und fing an zu weinen. „Du bist einem Glücksritter in die Hände gefallen!“
„Einem Windhund ohne festes Einkommen, der nie zu Hause ist!“, ergänzte Vater.
„Auch Künstler leben oft von der Hand in den Mund und haben trotzdem eine Familie. Es soll ja auch Frauen geben, die ordentlich verdienen. Habt ihr bestimmt schon gehört.“
Mutter schaute missbilligend und mahnte „Ironie ist hier fehl am Platze, Beate! Es ist uns bitterernst.“
Doch ihre Tochter war nicht zu bremsen: „Außerdem − was ist mit Monteuren, Lastwagenfahrern, Soldaten, Seeleuten und Forschern? Sitzen die ständig am heimischen Herd?“
Nicht einmal der Hinweis auf die enormen Schwierigkeiten, falls sie Kinder in die Welt setzen wollten, konnte sie von ihren Plänen abbringen.
„Für solche Probleme haben Millionen eine akzeptable Lösung gefunden“, widersprach sie unbeeindruckt. „Ihr traut uns viel zu wenig zu.“
„Du tust mir leid, mein Kind“, war Mutters Antwort.
„Warum? Ich bin doch eher beneidenswert! Und wir werden heiraten, sobald Harald wieder zurück ist.“
In dem Stil ging es noch eine Weile weiter. Konkretes erfuhren meine Eltern nicht, mit welchen Tricks sie es auch versuchten.
Ich nahm an, eine so rationale Person wie meine Schwester würde sich nicht sehenden Auges Hals über Kopf in eine Affäre stürzen, die mein Vater als „eine Wahnsinnsidee, ausgebrütet im Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit“ bezeichnete. Allerdings – unmöglich war es auch nicht. Die Literatur ist voll von solchen Affären, die unglücklich enden – siehe „Anna Karenina“.
Nach Stunden fruchtloser Diskussionen mussten meine Eltern einsehen, dass sie hier nichts mehr ausrichten konnten.
„Gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen“, so Mutters Bilanz, als sei die Liebe eine besonders gefährliche Krankheit, die dringend behandelt werden müsste.
Zwischen den Alten und uns lagen Welten, das war offensichtlich.
Mich hatten Beates Offenbarungen übrigens nicht überrascht; denn sie hatte mich längst eingeweiht. Und ich hatte wochenlang dichtgehalten, auch wenn es mir schwerfiel. Zum Dank durfte ich in Hamburg als ihre Trauzeugin fungieren, was meine Eltern ihr nachhaltig übelnahmen.
Das früher so ungebrochene Verhältnis zu ihrer erfolgreichen Tochter hatte seit dieser Zeit einen Knacks.
Ein Gutes hatte die Heirat allerdings für uns Schwestern: Wir waren einander so nahegekommen wie nie zuvor.
Unsere Eltern sprachen nur noch selten offen über ihre Sorgen, aber man sah sie ihnen an: Sie alterten rapide. Nicht nur äußerlich. Mutter stieg nicht mehr auf die Leiter, um die Gardinen aufzuhängen, das überließ sie ihrer Putzhilfe. Immer öfter bestellte sie Essen auf Rädern. Den Rasen mähte ein junger Mann aus der Nachbarschaft. Sie rochen neuerdings seltsam, ein bisschen säuerlich. Ob das Nebenwirkungen der Medikamente waren, die sie Tag für Tag aus ihren dreigeteilten silbernen Döschen zu festgelegten Stunden schluckten und gelegentlich auch vergaßen? Oder auch nur der Geruch des Alters, ausgelöst durch den Rückgang der Hormonproduktion?
Selbstverständlich behielt Beate auch als verheiratete Frau ihre bisherige Stellung in der Pharmafirma. Das Ehepaar kaufte ein älteres geräumiges Haus zwischen Aachen und Mönchengladbach, genauer, am Rand der Kleinstadt E., mit direkter Bahnverbindung zu ihrer Arbeitsstelle, um Beate den täglichen Stress auf der Autobahn zu ersparen. Nach einer umfänglichen, sündhaft teuren Renovierung wurden wir zur Besichtigung gebeten. Meine Eltern, die sich bisher nicht für ihren Schwiegersohn hatten erwärmen können, fanden nichts Wesentliches an der neuen Bleibe auszusetzen, unterließen sogar abfällige Bemerkungen jeder Art. Nein, herzlich wurde ihr Verhältnis zu Harald trotzdem nicht gerade, eher schlossen sie mit ihm eine Art Waffenstillstand, der aber jederzeit aufgekündigt werden konnte, falls sich Beates Mann einen gravierenden Fehler zuschulden kommen ließe. Deshalb verliefen die traditionellen Einladungen zu hohen Festtagen oder Familienereignissen wie Vaters 75. Geburtstag eher unterkühlt, obwohl sich Harald jede Mühe gab. Er erwies den Alten den Respekt, den sie von ihm erwarteten, geizte auch nicht mit aufwendigen Geschenken, was leider besonders Mutters Misstrauen hervorrief. Sie hielt ihn unverändert für einen „Windhund“. Welcher Mann mit Familie hat schon einen derart riskanten Beruf? Nur ein Hallodri!
Ich mochte ihn, nicht nur, weil er so spannend von seinen Expeditionen erzählen konnte, sondern weil er Beate liebevoll umsorgte und sie ganz zufrieden schien, auch wenn sie oft wochen- oder gar monatelang auf ihn warten und sich mit einem gelegentlichen Telefonat per Funk begnügen musste. Vielleicht bewahrten diese Trennungen die beiden vor der gängigen Eheroutine, hielten die Leidenschaft wach, die sie anfangs füreinander empfunden hatten. Nicht das schlechteste Modell für eine dauerhafte Beziehung zwischen zwei starken Charakteren, nahm ich an. Besser jedenfalls als der langsame Erstickungstod der Liebe unter Wäschebergen und Grünschnitt wie bei meinen Eltern.
Gesprochen habe ich mit meiner Schwester allerdings darüber nie; denn sie gab keine Intimitäten aus ihrem Eheleben preis, auch nicht mir gegenüber.
Auf die Idee, dass sie aus der Not eine Tugend machte, kam ich nicht, weil mir die Erfahrung fehlte.
Mittlerweile hatte auch ich mein Abitur bestanden, nur mit 2,5, in erster Linie wegen Mathematik, und einer Aachener Buchhändlerin einen Lehrvertrag abgerungen. Sie brauchte es nicht zu bereuen: Hier war ich in meinem Element, legte die meisten meiner Untugenden allmählich ab und wurde bei der Prüfung Landesbeste. Jetzt konnte ich meinen Lebensunterhalt selbst bestreiten, und meine Eltern waren endlich einmal mit mir zufrieden.
Meine wilden Jahre gehörten der Vergangenheit an. Keine dubiosen Freunde mehr, sondern einen achtbaren Krankenpfleger als ständigen Begleiter, mit dem ich erst einmal für eine Weile in einem Ort mit dem sonderbaren biblischen Namen Baal probeweise zusammenzog und nach zwei Jahren ganz bürgerlich zum Standesamt ging.
Es hatte sich eben so ergeben – wie bei den meisten Ehen. Schon möglich, dass sich unter den Millionen männlicher Kandidaten einer gefunden hätte, den man in minderwertigen Romanen als „andere Hälfte“ bezeichnet, aber die Wahrscheinlichkeit, ihm zu begegnen, wäre noch sehr viel geringer gewesen als ein Sechser im Lotto. Es war die alte Geschichte vom Spatz in der Hand, der besser ist als die Taube auf dem Dach. Wenn man sich einmal entschieden hat, sollte man mit dem Suchen aufhören. Es macht nur unglücklich.
Drei Monate, bevor unsere Frühchen per Kaiserschnitt zur Welt kamen, fiel mein Vater einem zu spät erkannten Schlaganfall zum Opfer. Und er hatte sich so auf seine Enkelchen gefreut! Mutter vergrub sich in ihre Trauer.
„Diese leere Wohnung bringt mich noch um“, sagte sie jedes Mal, wenn eine von uns Töchtern kurz hereinschaute. Was also lag näher, als ihr den Umzug in ein sehr wohnlich ausgestattetes Seniorenstift zu empfehlen, wo sie geeignete Gesellschaft hätte? Doch damit hatten wir das Übel nicht an der Wurzel gepackt: Unsere Mutter glitt eines Morgens am Frühstückstisch lautlos vom Stuhl. Herzstillstand, obwohl sie vorher nie ernsthaft krank gewesen war.
„Sie hat den Verlust ihres Mannes nicht verkraftet“, darauf bestand eine ihrer Betreuerinnen. „Das erleben wir hier sehr oft.“
Vermutlich hatte sie recht. Meine Eltern waren sehr viel enger miteinander verbunden gewesen, als ich es mir hatte träumen lassen.
„Warum haben wir bloß nicht besser auf sie aufgepasst?“, grübelte Beate mehr als einmal. Sie litt unter denselben Schuldgefühlen wie ich. Doch sie hatte ihren Beruf, der sie stark forderte. Und wie hätte ich mich auch noch um Mutter intensiv kümmern können? Die Pflege unserer anfälligen Zwillinge beanspruchte meine ganze Kraft.
Beate hatte ein „Händchen“ für Kinder. Ina und Tina liebten sie so abgöttisch, dass ich regelrecht eifersüchtig wurde.
„Du solltest ein eigenes Baby kriegen, bevor deine biologische Uhr abläuft,“ schlug ich ihr eines Tages vor, als ich sie auf dem Sofa sitzen sah, Ina links neben sich und Tina rechts, alle drei begeistert grunzend, als wären sie selbst die dicken rosa Schweine aus dem Bilderbuch.
Obwohl meine Schwester zuerst ein bisschen beleidigt war wegen der boshaften Anspielung auf ihr Alter, befreundete sie sich doch mehr und mehr mit dem Gedanken, meinem Beispiel zu folgen.
„Es müssen doch nicht unbedingt Zwillinge werden, oder?“, fragte Harald beklommen, als er erfuhr, dass Beate schwanger war. (Sie hatte die Pille, ohne ihn zu fragen, kurzerhand abgesetzt.) Wir konnten ihn beruhigen: Das sei eher unwahrscheinlich, denn so einen Doppelpack gäbe es außer bei mir in unserer Familie weit und breit nicht mehr.
Mein Schwager erwies sich, sobald er ein paar Wochen zwischen seinen Expeditionen zu Hause verbrachte, als Mustervater, was ich von Achim nun gerade nicht behaupten konnte.
Seine Begründung, die sich keinen Deut von der meines Vaters unterschied: „Du hast den Haushalt und die Kinder. Ich verdiene das Geld.“
„Das ich ausgebe“, ergänzte ich. Er nickte zufrieden.
Diese Arbeitsteilung würde sich ändern. Das schwor ich mir. Sobald wie möglich. Sollte Alice Schwarzer wirklich umsonst mit aller Kraft gekämpft haben?
Obwohl Beate beschlossen hatte, drei Jahre lang ganz für ihre Nicole da zu sein, gab es keinen Engpass wegen des fehlenden Gehalts: Harald hatte „einen fetten Fisch geangelt“ – womit er die Ortung und Hebung eines tonnenschweren Goldschatzes aus einer spanischen Karavelle in der Karibik meinte – und eine beachtliche Prämie kassiert. Nichts war schiefgelaufen, wie meine Mutter das prophezeit hatte. Wir Erwachsenen verstanden uns gut, es gab keine außergewöhnlichen materiellen Sorgen, die Kinder gediehen, dass man nur seine helle Freude daran haben konnte – so hätte es getrost weitergehen dürfen, jahrzehntelang.
Im Sommer, bevor die Zwillinge in den Kindergarten gingen, entschlossen wir uns zu einem gemeinsamen Urlaub auf Borkum. Sie waren beide „ein wenig schwach auf der Brust“, wie die Kinderärztin ihre ständigen Hustenattacken umschrieb. Der Juni ist nun nicht gerade der ideale Monat für eine solche Kur, aber die Ferientermine aller Beteiligten waren nur genau während dieser drei Wochen unter einen Hut zu bringen. Wir mieteten für uns sieben ein Häuschen mit zwei getrennten Wohnungen, und nichts konnte unsere gute Laune trüben, weder die völlig regellos auftretenden Wutanfälle unserer Dreijährigen, deren Trotzalter sich gerade dem Höhepunkt näherte, noch die zwei verregneten Tage, die wir nicht Burgen bauend am Strand verbringen konnten. Zwar hatte ich mir beim Einkaufen den Knöchel auf dem Kopfsteinpflaster verknackst (Unglaublich, welche Mengen an Nahrungsmitteln zwei Familien täglich vertilgen können!), doch der gute alte Inseldoktor, dem nach eigener Aussage „nichts Menschliches fremd“ war, legte mir einen Verband an, und ich konnte mich kurzzeitig in der Rolle der Kranken sonnen, eine vollkommen neue Erfahrung. Achims Bilanz am letzten Abend der drei Insel-Wochen lautete „Friede, Freude, Eierkuchen!“, und er sah, als er dieses Sprüchlein von sich gab, beifallheischend in die Runde. Doch keiner lachte. Er hatte wieder mal total danebengegriffen.
Am Morgen der Abreise, das Gepäck war schon in den beiden Kombis verstaut, und wir saßen beim Frühstück, klingelte das Telefon. Eine barsche Männerstimme, die Harald verlangte. Der riss mir den Hörer aus der Hand, raffte die lange Schnur zusammen und klemmte sie unter die Wohnzimmertür, die er anschließend fest zuzog.
So hatte ich ihn noch nicht erlebt: Nervös, laut, ja richtig aggressiv. Man konnte kein Wort verstehen, doch es war garantiert kein erfreuliches Gespräch.
„Mach’ dir keine Sorgen, Liebes. War nur beruflich. Manchmal gibt es halt Ärger, sobald man nicht vor Ort ist“, versuchte er Beate zu beschwichtigen, als Harald an den Frühstückstisch zurückkehrte, aber er war blass unter seiner Sonnenbräune. Sie schien trotz seiner beruhigenden Worte alarmiert. Wir enthielten uns der Stimme, mischten uns nicht ein, hielten uns für überaus diskret.
Wären wir weniger gleichgültig gewesen, hätten wir manches verhindern können, was unsere gemeinsame Zukunft bedrohte.
Ganz gegen ihre Gewohnheit blieben meine Schwester und ihr Mann für den Rest des Tages sehr einsilbig, und es wollte keine gelöste Stimmung mehr aufkommen.
Sobald wir wieder in unser heimisches Umfeld zurückgekehrt waren, fiel der Alltag über mich her. Die Mühsal hinterher, die die Erholung zunichtemacht, jede Frau kennt sie. Ich hatte einfach keine Zeit, mir den Kopf über dieses unerfreuliche Telefonat zu zerbrechen, und vergaß es irgendwann – um es nach Jahren aus dem Gedächtnis hervorzukramen. Es hatte sich, das ging mir schlagartig auf, dabei nur um die Spitze des des Eisbergs gehandelt. Wie damals bei der „Titanic“:
2. Kapitel: Schicksalsschlag
Eines Nachmittags saß ich an meinem Schreibtisch, den ich vor das breite, nach Süden ausgerichtete Fenster gerückt hatte, und schaute hinaus in den Garten. Er wird beschattet von einem mächtigen Walnussbaum, von einem der früheren Besitzer in weiser Voraussicht gegen die pralle Sommersonne gepflanzt.
Achim, der sich nach zähen Verhandlungen zuletzt bereiterklärt hatte, die Pflege des Gartens zu übernehmen – ich musste erst mit einem totalen Putzstreik drohen – war zu Hause ein Minimalist, der nur das Nötigste tat, beispielsweise den Rasen erst mähte, wenn das Unkraut schon seine Samen ausstreute, und er den Einspruch der Nachbarn fürchtete. Im Krankenhaus dagegen schätzte man ihn wegen seines unermüdlichen Einsatzes und seiner Freundlichkeit. Ein Mann mit zwei höchst widersprüchlichen Seiten, die friedlich nebeneinander existierten.
Für Nikki war der Garten die „Grüne Hölle“, womit sie erstens wie gewöhnlich maßlos übertrieb und sich gleichzeitig sozusagen legitim vor jeglicher Mitarbeit in diesem angeblich gefahrenträchtigen Gelände drückte. So konnten die Hecken, die das Grundstück einfrieden, ebenso ungehindert wuchern wie die blauen und rosa Hortensien, die Beate so liebte.
Meine Schwester war für mich noch immer gegenwärtig. Auch nach mehr als 15 Jahren.
Ich ignorierte den Stapel, der sich auf meinem Schreibtisch türmte: Rechnungen, Reklamen, Bittbriefe, Zeitungsausschnitte, inhaltsleere Postkarten unserer Zwillinge, Computerausdrucke, Fachzeitschriften und Bücher aller Art, die ich unbedingt in meiner Freizeit lesen müsste, starrte hinaus in das Grün, bis die Konturen der Blätter und Blüten vor meinen Augen verschwammen.
Unvermittelt tauchten dieselben Szenen eines Films aus meiner Erinnerung auf, die unserem Leben jedes Mal eine entscheidende Wendung gegeben hatten und die ich immer wieder neu zu ertragen gezwungen war. Niemand außer mir wusste, dass dieser Film existierte. Ich hatte kein Wort darüber verlauten lassen – man hätte ja vermuten können, ich sei nicht ganz richtig im Oberstübchen. Solche Verdächtigungen machen schnell die Runde, besonders in einer Siedlung wie unserer, wo die Leute recht eng aufeinandersitzen und jeder jeden beobachtet. Aus Langeweile vielleicht, weil das eigene Dasein so ereignislos dahinplätschert, oder auch, weil es einen freut, anderen Leuten möglichst viel am Zeug zu flicken. Dann schrumpfen logischerweise die eigenen Mängel.
Ich will nun nicht beschwören, es hätte sich alles haargenau so abgespielt, wie ich es hier erzähle. Im Laufe der Zeit hat sich gewiss manches verändert, ja verzerrt oder ist unwiederbringlich abgesunken auf die unterste Sohle meines Gedächtnisses. Warum aber sollte ich nicht trotzdem versuchen, die einzelnen Phasen der Tragödie so genau wie möglich abzubilden, an deren Ende ich mich in einer Lage befand, die ich mir so sehnlich gewünscht hatte?
Am Anfang stand ein Ereignis im Sommer kurz nach Nikkis erstem Geburtstag.
Kaum dass ich die Tür geöffnet hatte, stürzte die sonst so zurückhaltende Beate auf mich zu und rief empört: „Wie denken die sich das bloß? Erwarten von mir, dass ich Knall und Fall … Sind nur an ihrem Profit interessiert! Menschen sind ihnen total gleichgültig!“
Sie überflog das Blatt in ihrer Linken, deutete auf eine bestimmte Textstelle, die ich aus der Ferne gar nicht entziffern konnte, und fuhr aufgeregt fort:
„Hör’ dir das bloß mal an! Glatte Erpressung ist das!“
„Muss das denn sofort sein?“, wandte ich ein. „Ich möchte erst noch ganz schnell …“
Aber sie überging meinen Einwand und fing an, das Schreiben ihres Arbeitgebers vorzulesen.
Der bat sie höflich, aber kalt, sie solle so rasch wie möglich mit der Geschäftsleitung telefonischen Kontakt aufnehmen. Man hielte es für erforderlich, dass sie nach der Babypause zumindest halbtags an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehre, um sich an einem Forschungsauftrag von besonderer Wichtigkeit zu beteiligen. Es täte ihnen außerordentlich leid, wenn es zu einer Absage ihrerseits käme. Sie sähen sich dann zum größten Bedauern gezwungen, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger umgehend einzuleiten.
Ich setzte mich auf das Sofa, klopfte einladend auf den Platz neben mir und legte meiner Schwester den Arm um die Schultern. „So etwas hast du doch insgeheim erwartet, oder?“, fragte ich und versuchte, ruhig zu bleiben. „Du solltest diesen Brief positiv sehen. Offensichtlich können sie auf eine erstklassige Spezialistin wie dich nicht mehr verzichten. Der Hinweis auf einen möglichen Nachfolger ist deshalb eine leere Drohung. Sie werden nicht so schnell, wenn überhaupt, einen finden, der dir das Wasser reichen kann. Wie ich die Sache sehe, rechnen sie auch gar nicht mit einer Absage; denn sie wissen genauso gut wie du, dass du dann raus wärst aus diesem Job, vermutlich für immer, und das nach der jahrelangen Plackerei auf der Uni! Du auf Dauer als Nur-Hausfrau – könntest du das aushalten?“
Wir schwiegen beide eine Weile. Man hörte nur den endlosen Westminster-Stunden-Schlag der verschnörkelten Standuhr, die meine Schwester von unseren Eltern geerbt hatte. Als der letzte Ton verklungen war, antwortete Beate mit einer Gegenfrage, die bewies, dass sie sich, gestützt auf meine Argumente, blitzschnell entschieden hatte: „Aber was wird aus Nikki, wenn ich nicht mehr für sie sorgen kann wie bisher?“
„Mach’ dir keine Sorgen! Ich lasse dich doch nicht im Stich“, versicherte ich. „Selbstverständlich kümmere ich mich um die Kleine. Ich habe ja jetzt viel Zeit, wo die Zwillinge bis mittags im Kindergarten sind. Du bringst Nikki morgens zu mir und holst sie wieder ab, sobald du aus Aachen kommst. Wo also ist das Problem?“
Ich gab meiner Schwester einen ermunternden Klaps auf die Schulter, und sie umhalste mich stürmisch, meine sonst so kühle Beate, und flüsterte gerührt: „Mir fällt ein Mount Everest vom Herzen. Lisa, du bist ein Engel.“
Wenn sie gewusst hätte, welche Selbstsucht, Verlogenheit und Hinterlist in diesem „Engel“ steckten! Der Gedanke, dass sie mich gerade ebenso manipuliert haben könnte wie ich sie, der schoss mir erst durch den Kopf, als ich mir diese Szene noch einmal durch den Kopf gehen ließ. Beate hatte sich für meinen Geschmack viel zu rasch entschieden. Warum aber sollte ich ihr meine diesbezüglichen Vermutungen darlegen? Das hätte nur Streit gegeben.
Beates Tochter war das entzückendste Kind, das mir je untergekommen ist. Ich liebte sie schon damals mehr als meine eigenen Mädchen. Aus Gründen, die kein anderer verstehen kann – ich selbst übrigens auch nicht. Gott sei Dank! So etwas muss es geben in einer Welt, in der nahezu alles erklärbar ist und das Geheimnis keinen Platz mehr hat.
Ich kostete meine Vorfreude auf das Zusammensein mit Nikki ungestört aus.
Und, das möchte ich der Wahrheit halber hinzufügen, auch auf das Taschengeld, das ich nun verdienen würde und nach Lust und Laune ausgeben könnte.
Achim stimmte diesem Arrangement ohne viel Federlesens zu. Seine Vorteile leuchteten ihm ein. Schließlich ist er Realist.
Harald jedoch versuchte, seine Frau umzustimmen und redete gegen eine Wand. Beate war das, was Feministinnen gemeinhin als „starke Frau“ bezeichnen, das heißt, ebenso halsstarrig wie ich, sobald sie sich einmal festgelegt hatte.
War wahrscheinlich genetisch bedingt.
Dagegen ist schwer anzukommen.
Bis zu diesem Zeitpunkt gleicht unsere Geschichte im Großen und Ganzen der von Millionen anderer, die man seit längerem als „Bildungsbürger“ abqualifiziert. Sie nachzuerzählen war für mich unproblematisch, stellenweise sogar vergnüglich.
Seit heute habe ich jedoch Angst, mich mit dem zu befassen, was nun erzählt werden muss. So relativ glimpflich wie bisher sind wir nämlich nicht mehr davongekommen.
Manche von den Experten, die die Deutungshoheit für sich beanspruchen, raten mir, endlich „Trauerarbeit“ nach der Methode Mitscherlich zu leisten, um die Vergangenheit und meine Schuld zu „bewältigen“ (Was für ein scheußlicher Begriff!). Andere warnen davor, kaum vernarbte Wunden wieder aufzureißen. Wem soll ich denn nun glauben, welchen Weg einschlagen?
Wochenlang habe ich meinen Laptop nur gelegentlich angeworfen, begrüße im Moment sogar die Unterbrechungen, die mich vom Schreiben abhalten, obwohl ich gegen sie anfangs noch heftig, aber erfolglos protestiert hatte.
Nikki, die mich häufig besucht, hat mir jedoch den Rücken gestärkt: „Wenn du weiterschreiben willst, schreibe. Wenn nicht, lass’ es bleiben. Es ist deine Entscheidung!“
Ich habe mich entschieden. Keine Ausflüchte mehr, keine schäbigen Tricks, keine Lügen – sondern nichts als die Wahrheit. Vor allem die Wahrheit über mich.
Der milde Herbsttag zwei Jahre nach der Rückkehr meiner Schwester in den Beruf ist in meiner Erinnerung so lebendig geblieben, als hätte sich alles erst gestern ereignet. Damals unterspülte eine dieser nicht voraussehbaren Fluten, von denen die Öffentlichkeit nicht das Mindeste erfährt, alle für unzerstörbar gehaltenen Fundamente von Beates Leben.
Unsere Mädchen, mittlerweile sechs und rund drei Jahre alt, tobten im Kinderzimmer, wir Schwestern gönnten uns am Küchentisch einen Cappuccino. Heute hatte ich Nikki ausnahmsweise nach Hause gebracht.
„Versuche lassen sich nun mal nicht immer nach der Uhr planen“, entschuldigte sich Beate, aber ich winkte ab und griff, als es ungeduldig und anhaltend klingelte und sie zur Haustür eilte, nach einem Florentiner, einer Kalorienbombe, die ich mir unbedingt hätte verkneifen sollen.
Eine Männerstimme, die „Telegramm für Sie“ schnarrte. Meine Schwester schlitzte hastig den Umschlag mit einem Küchenmesser auf, las die Nachricht, blieb stocksteif mitten im Raum stehen. Das Telegramm flatterte zu Boden.
Ich las die wenigen Zeilen, die die „Research Company“, Haralds Auftraggeber, seiner Frau mitzuteilen hatte.
„Haben soeben von der „Cap Hoorn“ die Nachricht erhalten, dass Ihr Gatte Harald Wiedeking gestern während eines Orkans über Bord gegangen ist. Rettungsversuche sind leider fehlgeschlagen. Mit seinem Ableben muss gerechnet werden. Näheres brieflich. Herzliches Beileid.“
Wie tröstet man eine Frau, die vor Entsetzen zur Salzsäule erstarrt ist wie Lots Weib? Es gibt keinen Trost, nur tätige Hilfe.
Die wenigstens habe ich meiner Schwester geben können bei den zahllosen Gängen, die unsere Bürokratie den Angehörigen auferlegt. Und ich habe mich um meine kleine Nichte gekümmert, die Beate, eingesponnen in ihre Verzweiflung, Monat um Monat aus den Augen verlor.
Nikki erinnerte sich nicht mehr an ihren Vater, weil sie zu klein und er zu selten daheim gewesen war. Sie imitierte also einfach ihre Kusinen und nannte meinen Mann ebenfalls Papa. Ich aber war ihre „Lila“, und dabei blieb es, auch als sie meinen Namen längst richtig aussprechen konnte.
Ich brachte ihr die ersten Wörter bei, badete, wickelte und fütterte sie, sorgte dafür, dass sie „sauber“ wurde, spielte und sang mit ihr, hielt sie an beiden Händen, als sie die ersten Schritte versuchte, wachte an ihrem Bettchen, wenn sie Fieber hatte oder Bauchschmerzen – kurz, ich war ihre Ersatzmutter, wobei ich unter „Ersatz“ durchaus keinen Notbehelf verstand. Sie wahrscheinlich auch nicht. Wenn sie ihre Arme um meinen Hals legte und ich sie an mich drückte, waren wir beide glücklich, ganz ohne Worte. Nikki schien nichts und niemand zu fehlen, auch nicht ihre Mutter.
Die war wieder ganztags im Labor beschäftigt und widmete sich geradezu besessen den so wichtigen Forschungen, mit denen man sie geködert hatte. Jeden Tag, den Gott werden ließ, kam sie später zurück aus Aachen, und Nikki wurde ständig aus dem ersten Schlaf gerissen. Das würde sich auf die Dauer gewiss zu einer Belastung für meinen Schützling auswachsen. Höchste Zeit für mich einzuschreiten.
Irgendwann, Harald war noch nicht für tot erklärt, aber es bestand nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt haben könnte mitten im tobenden Ozean, zogen wir vier dann, auf meine Bitte hin, die schon eher ein Diktat war, in das Haus, das nun Beate allein gehörte.
Eine deutliche Verbesserung unserer Situation. Wir bewohnten das ganze Untergeschoss. Endlich gab es für jedes Kind ein eigenes Zimmer, ich konnte in der geräumigen Wohnküche wirtschaften, der Garten stand uns jederzeit offen. (Achim zimmerte wahrhaftig für Nikki einen Sandkasten und installierte eine Riesenschaukel, die mittlerweile total verrostet dem Sperrmüll überantwortet wurde.) Und was für mich am wichtigsten war: Wir hatten im Haus nur unseren eigenen Lärm zu ertragen. Der geht einem, kein Wunder, viel weniger auf die Nerven als der fremder Leute.
Für Beate änderte sich durch unseren Einzug nichts Wesentliches – außer dass sie sich nun ganz unbelastet ihrem Beruf widmen konnte.
Nicht, dass sie ihre Tochter, sobald sie sich ihr zuwandte, unfreundlich behandelt oder gar jemals gereizt auf sie reagiert hätte. Sie ging nur mit ihr um wie mit einem beliebigen Kind. Neutral, ohne Zärtlichkeit. Sie tat ihre Pflicht, mehr nicht.
Auch jeder andere hätte an meiner Stelle gegengesteuert.
Meine Schwester hatte sich bis zur Unkenntlichkeit verändert.
Und diese Veränderung hielt an, wurde nicht abgemildert durch die Zeit, die doch alle Wunden heilen soll. Sie gehörte zu denen, deren Trauer Wurzeln schlägt und zu einem Baum heranwächst, der bittere Früchte hervorbringt.