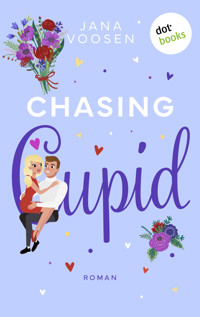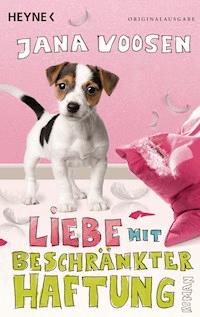6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wärst du bereit, für deine Träume zu kämpfen? Ein Buch über den Mut in schweren Zeiten.
Hamburg, 1940: Anni ist das Lieblingskind des Süßwarenfabrikanten Friedrich Brand. Aufgewachsen zwischen Karamell und Schokolade, kann sie es kaum erwarten, in den Familienbetrieb einzusteigen. Doch der Krieg bringt ihre heile Welt mehr und mehr ins Wanken. Plötzlich verlangt ihr Vater, dass sie heiratet, und lädt immer öfter seinen Parteifreund Julius nach Hause ein. In der Fabrik sieht Anni "Fremdarbeiter" unter schlimmsten Bedingungen schuften. Auch den jungen Polen Pawel, dem sie sich auf unerklärliche Weise nahe fühlt. Doch es ist eine Liebe, die nicht sein darf. Als ihre Beziehung entdeckt wird, stellt ausgerechnet Julius Anni vor eine schier unmögliche Wahl.
„Jana Voosen erzählt emotional und tiefgründig—eine faszinierende Autorinnenstimme, die lange im Ohr bleibt" Teresa Simon
- Wärst du bereit, für deine Träume zu kämpfen? Ein Buch über den Mut in schweren Zeiten.
- Hamburg, 1940: Anni verliebt sich in den polnischen Zwangsarbeiter Pawel. Ihre Liebe ist verboten, und doch ist sie das Beste, was ihnen jemals passiert ist.
- Für Leserinnen von Barbara Leciejewski und Teresa Simon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jana Voosen
Im nächsten Jahr zur selben Zeit
roman
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Editorische Notiz
Im historischen Kontext dieses Romans verwenden die Figuren auch diskriminierende Sprache, die zu der dargestellten Zeit üblich war.
Copyright © 2023 by Jana Voosen
Copyright © dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung von einem Motiv von Trevillion Images / Mark Owen
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-27013-1V001
www.heyne.de
Erster Teil
1
Hamburg, 5. April 1928
So aufgeräumt wie an diesem Donnerstagmorgen im April des Jahres 1928 hatten die Angestellten des Süßwarenfabrikanten Friedrich Brand ihren Chef selten erlebt. Seine Kehle fühlte sich noch ganz rau an von den Jubelschreien, die er am vorherigen Abend vor dem Rundfunkgerät im Arbeitszimmer ausgestoßen hatte. Ein leises Brummen hinter den Augenbrauen erinnerte ihn an die zahlreichen Gläschen Schnaps, die er gestern auf den neuen Deutschen Meister im Schwergewicht getrunken hatte. Nach einem nervenzerfetzenden Kampf über fünfzehn Runden war der deutsche Boxer Max Schmeling zum Sieger über seinen Kontrahenten Franz Diener erklärt worden.
Brands Schritte waren beschwingt, und er selbst bester Laune. Mit seiner Tochter an der Hand durchquerte er die weitläufigen Fabrikhallen, während sein Sohn vorneweg lief. Die fünfjährige Anni betrachtete aufmerksam die riesigen Maschinen ringsum, die laut ratterten und dröhnten, und die Dutzenden von Menschen in langen weißen Kitteln, die an den Bändern arbeiteten. Sie konnte spüren, wie eine Veränderung in den Angestellten ihres Vaters vor sich ging, wenn er vorbeikam. Sie grüßten respektvoll, um sich dann mit doppeltem Eifer wieder ihrer Arbeit zuzuwenden. Anni war unendlich stolz auf ihren Vati, der Chef von all diesen Leuten war – eigentlich fast so etwas wie ein König. Und sie, als seine Tochter, war die Prinzessin. Mit hocherhobenem Haupt schritt sie an seiner Seite und begutachtete fachmännisch die Arbeitsabläufe. Der schwere Duft von flüssigem Zucker, der in einem riesigen Trog unter ständigem Rühren geschmolzen wurde, lag in der Luft. Wenn die süße Masse vollkommen gleichmäßig zerlassen und schon leicht karamellisiert war, wurde sie zu langen flachen Streifen gewalzt und schließlich von Hand mit der Stanze in die gewünschten Formen gebracht. Über Fließbänder gelangten die Karamellen in den hinteren Bereich der Fabrik, wo sie einer sorgfältigen Kontrolle unterzogen und schließlich in die mit dem Firmenlogo bedruckten Papiertütchen abgefüllt wurden.
Ein Mann in einem weißen Kittel trat zu ihnen und ging vor Anni in die Hocke. »Guten Tag, kleines Fräulein! Wie schön, dass du uns wieder mal besuchst.«
Anni ergriff die dargebotene Hand und blickte dem Mann forschend ins Gesicht. Alle sahen hier gleich aus in ihrer Arbeiterkleidung, und fast alle trugen wie ihr Vater Oberlippenbärte, die sich lediglich in der Farbe voneinander unterschieden. Das Haar des Mannes vor ihr war blond, und er hatte freundliche Augen, an denen sie ihn nun erkannte.
»Guten Tag, Herr Biel«, sagte sie und knickste.
Der Mann richtete sich wieder auf, griff nach einer der Bonbontüten, die transportbereit in einem Rollwagen lagen, öffnete sie und hielt sie Anni hin. Sie wählte eins der rot-weiß gestreiften Drops aus und steckte es in den Mund. Sofort erfüllte sie der intensive Geschmack von Kirschen und Karamell.
»Und?«, fragte ihr Vater. »Wie schmecken sie?«
Anni überlegte. »Süß«, antwortete sie nach einer Weile. Die Männer lachten.
»Ein großartiger Kampf gestern Abend«, wandte der Vorarbeiter sich an seinen Chef.
»Das können Sie laut sagen, Biel.«
Das Bonsche in Annis Mund wurde kleiner und kleiner, und noch immer ließen die beiden Männer Runde um Runde des Boxkampfes Revue passieren. Annis Blick schweifte umher, und sie entdeckte ihren neunjährigen Bruder Hans, der im hinteren Teil der Halle auf einem der Transportwagen herumkletterte. Langsam zog Anni ihre Hand aus der des Vaters. Er bemerkte es nicht. Sie machte ein paar Schritte rückwärts, weg von den Männern, die ihre Anwesenheit vergessen zu haben schienen.
Auf eigene Faust ging das Mädchen durch die Fabrikhalle und erklomm schließlich die hölzerne Treppe vor dem riesigen Schmelztiegel. Auf der Plattform angelangt, legte sie sich auf den Bauch und schob sich vorwärts bis zum Rand. Fasziniert starrte sie hinunter in die glänzende, wabernde Masse, die von einem gewaltigen Spatel bewegt wurde. Anni wusste, dass der flüssige Zucker zwar köstlich roch und aussah und dazu einlud, den Finger hineinzustecken, doch mit einer Temperatur von über 140 Grad gleichzeitig sehr gefährlich war. Sie robbte noch ein Stückchen weiter nach vorne, Hitze schlug ihr ins Gesicht, und sie spürte deutlich den Sog der süßen Gefahr. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, mit aller Kraft umklammerten ihre Hände das Geländer, und sie schloss die Augen.
In diesem Moment packte sie jemand am Fußgelenk und zog sie zurück.
»Da haben wir ja die Ausreißerin«, sagte Herr Biel.
»Anni!« Die Stimme ihres Vaters klang streng, als er sie von der Plattform herunterhob. »Was fällt dir ein, einfach wegzulaufen? Du hättest hineinfallen können.« Alleine bei dem Gedanken wurde er blass um die Nase.
»Nein, Vati«, Anni schüttelte den Kopf, dass ihre dunklen Locken flogen. »Ich weiß, dass der Zucker heiß ist. Und ich hab sehr gut aufgepasst.«
Er stieß einen verärgerten Laut aus, setzte seine Tochter auf dem Boden ab, hielt aber ihre Hand fest umklammert. »Ich werde dich nicht mehr mitnehmen, wenn du nicht folgst. Du bleibst an meiner Hand und läufst nicht einfach durch die Gegend«, sagte Friedrich Brand. »Hast du das verstanden?«
»Aber Hans hat doch auch …«
»Das ist was anderes«, unterbrach sie ihr Vater. »Er ist älter. Und ein Junge.«
Anni schob die Unterlippe vor. Sie verstand nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hatte, und fühlte sich ungerecht behandelt. Doch sie drängte die Tränen zurück, die in ihren hellblauen Augen brannten, und nickte. »Entschuldigung, Vati.«
»Na also.« Sofort verschwand der zornige Ausdruck aus dem Gesicht ihres Vaters. Erneut nahm er sie hoch und drückte sie zärtlich an sich. »So ist es recht. Du bist mein braves, kleines Mädchen.«
2
Köln, BDM-Haushaltungsschule, Juni 1940
Mit Schwung öffnete Anni die Türen des schmalen Kleiderschranks ihres Zimmers im Mädchenpensionat, das sie sich mit ihrer Freundin Käthe und der gemeinsamen Feindin Else teilte. Fein säuberlich, gestärkt und gebügelt, lagen darin Kante auf Kante Blusen, Schürzen, Unter- und Nachtwäsche sowie Handtücher. An der Stange hingen in Reih und Glied wie Soldaten beim Spalier drei Röcke, ein Mantel und das Kleid für besondere Gelegenheiten, das sie in dem ganzen vergangenen Jahr hier kaum je einmal hatte tragen können. Was hätten das auch für Gelegenheiten sein sollen? Die Haushaltungsschule des Bunds Deutscher Mädel konnte man nicht gerade als Vergnügungsstätte bezeichnen.
Nachdenklich musterte Anni das karierte Blatt Papier, das sie mit einer Reißzwecke an der inneren Schrankwand befestigt hatte. Dreißig Karos in der Breite und zwölf in der Höhe. Der Zettel war klein, und doch enthielt er dreihundertsechzig Kästchen, eines für jeden Tag, den sie hier verbracht hatte. Manchmal war es Anni so vorgekommen, als zöge die Zeit sich endlos dahin. Als würden die Sekunden langsamer schleichen, während man Wäsche legte, Säume umnähte, kochen, backen und bügeln lernte oder endlose Vorträge über Rassenkunde über sich ergehen ließ. Sie griff in ihre Schürzentasche und holte einen Bleistift heraus. Der Zettel zeigte nur noch ein einziges leeres Quadrat, die dreihundertneunundfünfzig anderen hatte sie an jedem Abend sorgfältig mit einem Kreuz versehen. Und heute war es endlich vorbei. Sie hatte das Jahr überstanden und durfte zurück nach Hause. Nach Hamburg, in ihr wunderschönes Elternhaus am Alsterufer.
Anni malte das letzte Kreuz und betrachtete zufrieden ihr Werk. Ihr Herz machte einen kleinen Hüpfer vor Freude. Mit Schwung warf sie ihren Koffer, den der Hausmeister für sie aus dem Keller geholt hatte, auf ihr Bett, das eher einer Pritsche glich und jedes Mal empört quietschte, wenn man sich darauf niederließ oder auch nur im Schlaf umdrehte. Staub wirbelte auf und verschmutzte die blütenweiße Bettwäsche. Gestern hätte Anni das noch mit Schrecken erfüllt. Fräulein Winter, die Hauswirtschaftslehrerin, führte ein strenges Regiment im Haus. Doch von heute an konnte ihr das ganz gleichgültig sein.
Sie sah hinunter auf den Stapel Blusen, die sie soeben aus dem Schrank genommen hatte, und wurde von plötzlichem Übermut erfasst. Statt die sorgfältig gefalteten Kleidungsstücke ordentlich auf den Boden des geöffneten Koffers zu legen, griff sie nach dem obersten und warf es von der Stelle, an der sie stand, die gut zwei Meter in Richtung Bett. Weitere Kleidungsstücke folgten, mit beiden Händen griff Anni in den Schrank und schleuderte alles kunterbunt durcheinander in den Koffer, bis ein wüster Haufen entstanden war. Anni lachte auf, doch sie zuckte zusammen, als sie hörte, wie sich die Zimmertür hinter ihrem Rücken öffnete. Wenn das Fräulein Winter war, war sie geliefert. Selbst wenn dort bloß ihre Mitbewohnerin Else im Türrahmen stand, würde diese sofort auf dem Absatz kehrtmachen, um sie bei der Lehrerin anzuschwärzen …
Anni, die herumgefahren war, ließ befreit die Luft entweichen, als sie Käthe erkannte, die mit offenem Mund auf die Bescherung starrte.
»Was machst du denn da?« Käthe schüttelte den Kopf, dass die dunkelblonden Zöpfe flogen. »Nun musst du zu Hause alles noch mal bügeln.«
»Ach, das …«, Anni unterbrach sich. Das macht unsere Hilde, hatte sie eigentlich sagen wollen, sich aber gerade noch rechtzeitig auf die Zunge gebissen. Bei Käthe gab es keine Hausangestellten, dafür aber fünf weitere Geschwister in einer viel zu kleinen Wohnung. »Das macht mir nichts aus«, sagte sie stattdessen, obwohl Käthe wusste, wie sehr sie Hausarbeiten hasste. Plötzlich fragte sich Anni, wie Hilde es wohl finden würde, einen Berg Wäsche von ihr bügeln zu müssen, den sie aus bloßem Übermut zerknüllt hatte.
Sie ging zu dem Koffer hinüber und versuchte halbherzig, etwas Ordnung in das Chaos zu bringen. Käthe trat hinzu und half ihr dabei.
Als sie gerade das Gepäckstück mit den Lederschnallen verschlossen und mit vereinten Kräften vom Bett gewuchtet hatten, betrat Else das Zimmer. Keinen Moment zu früh. Mit einer schnellen Bewegung schlug Anni das Deckbett zurück, um die verräterischen Staubflecken darauf vor den Augen der anderen zu verbergen. Gleichzeitig ärgerte sie sich über sich selbst, dass sie sich noch immer von Else einschüchtern ließ. Diese schien jedoch beschlossen zu haben, ihre Zimmernachbarinnen jetzt, da das gemeinsame Jahr im Pensionat beendet war, zu ignorieren. Sie marschierte bis zur Fensterseite, wo sich ihr Bett befand, öffnete den Spind daneben und begann ihrerseits mit dem Packen. Natürlich nicht ohne ihren schlichten braunen Koffer mit energischen Strichen vom Schmutz des Kellers befreit zu haben, bevor sie ihn auf die Matratze hievte. Mit geübten Handgriffen beförderte sie die Kleidungsstücke hinein, und Anni hätte schwören können, dass dabei nicht eine einzige neue Falte entstand.
Else summte mit demonstrativer Fröhlichkeit ein Lied, und Anni wechselte einen Blick mit Käthe. Beide verdrehten die Augen. Erneut von Übermut gepackt, stupste Anni die Freundin mit dem Ellenbogen an, nickte ihr aufmunternd zu, und dann schmetterte sie aus vollem Hals den Text dazu.
»Mütter, ihr gleicht reifen Ähren, die der Zukunft Sinn gebären.
Niemals endend, Liebe spendend,
hütet ihr die jungen Saaten,
dass dem Führer sie geraten.«
Natürlich war die schüchterne Käthe nicht in den Gesang mit eingefallen, aber sie grinste bis über beide Ohren. Else hatte zu summen aufgehört und kniff verärgert die Lippen zusammen.
»Was ist los, Else?«, fragte Anni und ließ sich auf ihre Matratze plumpsen. »Gibt es vielleicht was, das du uns mitteilen möchtest? Sag bloß, du trägst schon das erste Kindlein für den Führer unterm Herzen? Konnte der Herr Verlobte bei seinem letzten Besuch etwa nicht an sich halten?«
Sie hörte, wie Käthe nach Luft schnappte. »Anni«, hauchte sie entsetzt, während Else zu ihnen herumfuhr.
»Wie kannst du es wagen?«, zischte sie und wurde rot bis unter den flachsblonden Haaransatz. Doch ebenso schnell fasste sie sich wieder und setzte eine hochmütige Miene auf. »Ihr seid doch bloß neidisch. Weil ich nach Hause fahren und Hermann heiraten werde, während ihr entweder Kühe melken oder die Schmutzwäsche anderer Leute waschen müsst.«
Anni wandte sich an Käthe. »Was ist der Unterschied zwischen einer Ziege und einem Ehemann?«, fragte sie, zwinkerte ihr spitzbübisch zu und fuhr gleich darauf, ohne eine Antwort abzuwarten, fort: »Es gibt keinen. Beide meckern rum, wenn man sie nicht füttert.«
Käthe kicherte.
Else schlug mit einem Knall ihren Koffer zu und musterte Anni verächtlich. »Wenn du es hier schon schrecklich findest, dann warte mal ab, bis das Pflichtjahr beginnt. Da wirst du von morgens bis abends schuften und dir nachts vermutlich noch den Hausherrn vom Leibe halten müssen. Wobei, da besteht bei dir vermutlich keine Gefahr. So wie du aussiehst …«
»Ach ja?« Anni erhob sich und funkelte sie kampfeslustig an. »Und was bitteschön meinst du damit?« Es war eine rhetorische Frage. Sie wusste genau, was Else meinte, nämlich die Tatsache, dass Anni mit ihrem dunklen Haar von Weitem wie eine Jüdin oder sogar eine Zigeunerin wirkte. Man musste schon ein wenig näherkommen, um zu erkennen, dass ihre Augen so blau waren wie der Himmel an einem wolkenlosen Tag. Auf der Augenfarbentafel, mit denen ihr Rassenkunde-Lehrer Herr Dengermann die Iriden aller Schülerinnen in der ersten Stunde des Schuljahres verglichen hatte, erreichte sie als Einzige die Nuance 1a. Das war der Moment gewesen, ab dem Else, blond und blauäugig, sie gehasst hatte. Es hatte eine Weile gedauert, bis Anni kapiert hatte, dass die andere es schlicht nicht ertragen konnte, nicht die arischsten Augen der Klasse zu haben. Selbst wenn die im Kopf eines Mädchens saßen, das ansonsten nicht einmal entfernt dem Idealbild der deutschen Frau entsprach.
Als Else nichts erwiderte, sondern wortlos an ihr vorbei in Richtung Tür gehen wollte, verstellte ihr Anni den Weg.
»Ich werde mir überhaupt niemanden vom Leibe halten müssen. Weder den Hausherrn noch einen Ehemann. Ich werde eine Stelle in der Süßwarenfabrik meines Vaters antreten.«
Else hielt mitten in der Bewegung inne. Mit einiger Genugtuung registrierte Anni, dass es ihrem Gegenüber die Sprache verschlagen hatte.
»Natürlich«, sagte Else, nachdem sie sich gefangen hatte. »Ich hätte mir ja denken können, dass unsere verwöhnte Fabrikantentochter einen Weg findet, um sich zu drücken. Vati macht’s möglich. Herzlichen Glückwunsch.«
Anni spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Ihre Feindin hatte einen empfindlichen Nerv getroffen. »Ich werde in der Firma gebraucht«, versetzte sie so würdevoll wie möglich.
»Das kann ich mir vorstellen. Deine Expertise im Wäschefalten und Kuchenbacken ist natürlich genau das, was in einem Unternehmen gebraucht wird.« Else umklammerte den Griff ihres Koffers fester. »Leider haben wir nicht alle das Glück, einflussreiche Väter zu besitzen, die uns in Watte packen und uns jeden Stein aus dem Weg räumen.« Sie verließ das Zimmer und schlug die Tür mit einem Knall hinter sich zu. Anni stemmte die Hände in die Hüften und wollte gerade ihrem Ärger Luft machen, als ihr Blick den von Käthe traf. Die, anders als sie selbst, im nächsten Monat ihr Landjahr antreten würde.
Die Worte blieben Anni im Halse stecken. Sie biss sich verlegen auf die Unterlippe und schwieg.
3
Hamburg, Juni 1940
Als Anni am frühen Abend aus dem Hamburger Hauptbahnhof auf den Vorplatz trat, fühlte sich ihr Rücken steif an von der langen Bahnfahrt, und das blaue Sommerkleid klebte ihr unangenehm am Körper. Und doch verflog jetzt ihre Erschöpfung wie ein Schwarm aufgeschreckter Möwen. Anders als in Köln, wo man an heißen Tagen von der Hitze schier zu Boden gedrückt wurde, wehte hier im Norden ein angenehmer, lauer Wind. Er brachte die Feuchtigkeit auf Annis Haut zum Verdunsten und schien das vergangene Jahr, das sie im Pensionat verbracht hatte, mit sich fortzutragen.
Sie stellte ihren Koffer ab, breitete die Arme aus und hielt das Gesicht in die bereits tief am Himmel stehende Sonne. Sog die Gerüche der Stadt, die sie so liebte, tief in sich ein, lauschte ihren Geräuschen, dem Bimmeln der Straßenbahn, dem Verkehrslärm und den Stimmen der Reisenden ringsum.
»Verzeihung.« Ein unsanfter Stoß gegen die Schulter riss sie aus ihrer Versenkung, und sie blickte direkt in die Augen eines jungen Mannes in Uniform, der sie mit seinem vollgestopften Tornister gerammt hatte.
»Schon gut. Verzeihen Sie. Ich sollte hier nicht so im Weg herumstehen«, entschuldigte sie sich ihrerseits und ließ verlegen die Arme sinken.
Der junge Mann starrte sie an.
»Geht es Ihnen nicht gut?« Sie konnte sich gerade noch davon abhalten, diesem vollkommen Fremden besorgt die Hand auf den Oberarm zu legen.
Er schüttelte den Kopf und straffte die Schultern. »Alles in Ordnung, Fräulein. Sie … haben mich nur an jemanden erinnert.«
»Tatsächlich?«
Er nickte zerstreut und wandte sich zum Gehen. »Ich muss meinen Zug erreichen. Auf Wiedersehen, mein Fräulein. Ich meine, Heil Hitler.«
Sie sah ihm nach, wie er in der Menge verschwand, und erst jetzt wurde ihr bewusst, wie viele Soldaten sich auf dem Bahnhofsvorplatz befanden. Ihr Hochgefühl verflog. So viel hatte sich verändert seit jenem Tag vor einem Jahr, als sie Hamburg verlassen hatte. Schon damals hatten die Zeichen auf Krieg gestanden, jeder in der Bevölkerung hatte geahnt, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Spätestens mit dem Erlass der Verdunkelungsverordnung im Mai letzten Jahres hatte dann auch der Letzte begriffen, dass es ernst wurde.
Seit September 1939 befand sich das Deutsche Reich im Krieg, zuerst mit Polen, dann hatten sich in rascher Folge immer mehr Länder gegen Hitler gestellt. In der Abgeschiedenheit des Mädchenpensionats hatte Anni kaum etwas von all dem mitbekommen. Sie hatte lediglich bei den seltenen Ausflügen der Mädchen in die Stadt bemerkt, dass vermehrt junge Männer in Uniform herumliefen, was ihnen, da waren sich alle Schülerinnen einig, einen außerordentlichen Schneid verlieh.
»Anni!« Der Ruf riss sie aus ihren Gedanken, und gleich darauf fühlte sie sich vom Boden hochgehoben und durch die Luft gewirbelt. Nach mehreren Umdrehungen stellte ihr Bruder Hans sie wieder auf die Füße, doch statt sie loszulassen, drückte er sie so fest an sich, dass es ihr den Atem raubte.
»Hans«, keuchte sie, während sie über seine Schulter ihre Eltern auf sich zukommen sah. Ihr Vater Friedrich, blond, hochgewachsen und im tadellos sitzenden Zweireiher – Anni konnte sich nicht erinnern, ihn jemals anders als im Anzug gesehen zu haben – und ihre zierliche Mutter Magdalene, von der sie das dunkle Haar, nicht aber die goldbraunen Augen geerbt hatte. Beide strahlten beim Anblick ihrer Tochter. »Du brichst mir ja alle Knochen«, japste sie, und endlich ließ ihr großer Bruder sie los.
»Entschuldige, Schwesterherz, das war ganz sicher nicht meine Absicht.« Er grinste sie an, und seine Augen, so leuchtend blau wie ihre, blitzten. »Ich freue mich nur so sehr, dass ich dich nicht verpasst habe.«
»Wieso könntest du mich denn verpassen?«, fragte Anni, doch da hatten ihre Eltern sie bereits erreicht und zogen sie abwechselnd in ihre Arme.
»Du solltest doch am Bahnsteig warten«, sagte ihre Mutter. »Wie soll man in diesem Gewusel irgendjemanden finden?«
»Ihr habt mich ja gefunden.« Anni schloss die Augen, genoss die Umarmung ihrer Mutter und roch den Duft nach Rosenblüten und Seife, der sie sofort mit einem Gefühl von Geborgenheit erfüllte. Gleich darauf wechselte sie in die Arme ihres Vaters, der ihr einen Kuss auf die Wange drückte. Sein Schnauzbart kitzelte, doch das in der Kehle hochquellende Lachen verging ihr, als ihr Blick erneut auf Hans fiel.
Meine Augen müssen sich schon so an den Anblick gewöhnt haben, dass es mich gar nicht mehr befremdet, fuhr es Anni durch den Kopf. Doch jetzt war sie befremdet.
Sie trat einen Schritt zurück und ließ den Blick über Hans’ schlanke, jungenhafte Gestalt in der grauen Uniform gleiten. Der Adler auf der rechten Brusttasche hielt das Hakenkreuz in den Fängen und wirkte mit einem Mal ungeahnt bedrohlich auf sie. Neben Hans’ blank geputzten Schuhen stand ein brauner Koffer, ihrem eigenen nicht unähnlich.
»Was …?«, hauchte sie. Ihr Hirn weigerte sich zu begreifen. Die Puzzleteile zusammenzusetzen, die doch so offensichtlich waren. Ihr Bruder in Uniform und mit Gepäck. Ich freue mich nur so sehr, dass ich dich nicht verpasst habe.
Anni erinnerte sich an die Berichte, denen sie gemeinsam mit den anderen Mädchen zugehört hatte, dicht um den Volksempfänger im Aufenthaltsraum gedrängt. Da war die Rede gewesen von stolz in den Krieg ziehenden Soldaten und von Familien, die ihren Männern jubelnd an den Bahnhöfen hinterherwinkten, voller Stolz und Dankbarkeit. Anni fühlte nichts von alldem. Stattdessen lief ihr ein eiskalter Schauer über den Rücken.
»Willst du etwa verreisen?«, fragte sie in einer Anwandlung von Trotz. Doch ihre Stimme klang zugleich piepsig und heiser.
Hans grinste schief, und Magdalene brach in Tränen aus.
»Mutti«, sagte Anni und bekam sofort ein schlechtes Gewissen, weil sie und ihre alberne Frage der Auslöser gewesen waren für den sich Bahn brechenden Kummer ihrer Mutter.
Ihr Vater kramte umständlich seine goldene Taschenuhr heraus, die schon sein Vater und Großvater vor ihm getragen hatten, und warf einen Blick darauf. Eine unnötige Handlung, die nur der Ablenkung diente, wie Anni klar wurde. Schließlich prangte direkt über ihnen und für jedermann sichtbar der markante Uhrturm des Bahnhofs.
»Dein Zug fährt gleich ab«, sagte Friedrich zu seinem Sohn und ließ die Uhr zuschnappen. »Du solltest dich beeilen.«
Annis Mund fühlte sich staubtrocken an. »Das ist ja ein seltsamer Zufall, dass du genau zur gleichen Zeit abreist, wie ich ankomme«, zwang sie sich zu sagen.
Hans zuckte leichthin mit den Achseln. »An Zufälle glaube ich ja bekanntlich nicht«, sagte er. »Ich wollte dich auf keinen Fall verpassen. Und ich bin nun mal ein Glückskind.«
»Hoffentlich«, entfuhr es Anni, bevor sie es verhindern konnte.
Die Miene ihres Bruders wurde ernst. »Ja.« Er nickte. »Hoffentlich.« Er küsste seine schluchzende Mutter auf die Wange, reichte dem Vater die Hand. Dann umarmte er Anni erneut, und obwohl es wieder wehtat, sagte sie kein Wort.
»Wir bringen dich zum Bahnsteig«, hörte sie ihre Mutter sagen, doch Hans schüttelte den Kopf.
Ganz offensichtlich lag ihm ein Scherz auf den Lippen, irgendetwas nach dem Motto, dass er nicht mehr fünf Jahre alt war, sondern fast zweiundzwanzig. Doch das verkniff er sich. »Bitte nicht«, sagte er stattdessen bloß und griff nach seinem Koffer.
Anni blickte ihm nach, wie er sich zielstrebig durch das Gewusel der Menschen bewegte, der Eingangshalle zu. Woher kam nur dieses Gefühl von Panik, das plötzlich in ihr hochstieg? Die Überzeugung, dass sie ihn nie wiedersehen würde? Anni schüttelte heftig den Kopf. Was waren das nur für Gedanken? Der Krieg würde im Handumdrehen vorbei sein, das sagten alle. Der Armee des Deutschen Reiches hatten seine Feinde wenig bis nichts entgegenzusetzen, sie siegte an allen Fronten. Ehe sie so richtig begriffen haben würde, dass er fort war, käme Hans wieder nach Hause und würde sie mit seinen dummen Witzen je nach Stimmung zum Lachen oder zur Weißglut bringen. Es gab keinen Grund zur Besorgnis.
4
Die erste Mahlzeit zu Hause nach einem Jahr hatte sie sich anders vorgestellt. Zwar gab es ein köstliches Drei-Gänge-Menü, für das, wie Anni nach einem Jahr Hauswirtschaftsschule zum ersten Mal in ihrem Leben realisierte, Hilde und die Köchin Gertrud lange in der Küche gestanden hatten. Feine Karottensuppe, Kassler mit Soße, Sauerkraut und Kartoffeln und zum Nachtisch Pudding mit Früchten.
Doch die Stille bei Tisch verdarb Anni den Appetit. Wie oft hatte sie im Pensionat die lebhaften Mahlzeiten mit ihrer Familie vermisst. Im großen Speisesaal waren Unterhaltungen während des Essens verboten gewesen, eine weitere, vollkommen unnötige Schikane, wie Anni stets gefunden hatte. Die Mahlzeiten waren schweigend einzunehmen, und im Laufe der Monate hatte Anni eine tiefe Abneigung gegen die Geräusche entwickelt, die Menschen beim Essen von sich gaben. Das Gluckern, wenn Wasser eine Kehle hinunterlief, das krachende Schmatzen, wenn jemand in einen Apfel hineinbiss, das leise Quietschen von Fleisch zwischen mahlenden Zähnen.
Während sie nun ihrem Vater dabei zuhörte, wie er den Pudding vom Löffel schlürfte, überkam sie eine plötzliche Übelkeit, und sie presste die Serviette vor den Mund.
»Geht es dir nicht gut?«, fragte Magdalene sogleich, und Anni schüttelte den Kopf.
»Doch, alles bestens. Danke. Ich glaube, ich bin satt.«
»Das wäre das erste Mal, dass du den Nachtisch stehen lässt«, sagte Friedrich.
Es hat sich viel verändert, hätte sie am liebsten geantwortet. Ich habe mich verändert. Als ich vor einem Jahr ins Pensionat abgereist bin, unter Protest übrigens, den du aber nicht hören wolltest, war ich fast noch ein Kind. Jetzt bin ich beinahe achtzehn. Schon fast eine Frau.
Selbstverständlich sagte sie nichts, sondern lächelte nur verlegen.
»Magst du etwa keine Süßigkeiten mehr?«, fragte Friedrich und zwinkerte seiner Tochter zu. Offenbar war er froh, seine Gedanken auf etwas anderes richten zu können als auf seinen Sohn, der sich auf dem Weg nach Frankreich befand.
»Doch, natürlich.« Das war Annis Stichwort. »Wann kann ich anfangen, Vati?«
»Anfangen womit?«
»Na, in der Firma zu arbeiten.« Das Blut sackte Anni in die Füße, als sie sah, wie ihr Vater die Stirn runzelte.
»Du hast es mir versprochen.« Ihre Stimme klang schriller als beabsichtigt. »Du hast gesagt, nach dem Jahr im Pensionat darf ich bei Brand’s Bonsche anfangen. Du hast es versprochen.«
Ihre Mutter versuchte zu schlichten. »Kind, nun reg dich doch nicht auf. Du bist ja eben erst aus Köln zurückgekommen.«
Anni fuhr zu ihr herum. »Ich bin kein Kind mehr«, erwiderte sie heftig. »Ich war ein Jahr lang fort. Und ich habe es gehasst, jeden einzelnen Tag.« Anni spürte, dass sie ungerecht war. Es war nicht ihre Mutter, die ihren Zorn verdiente, allerdings war sie ein leichteres Ziel als der Vater, der so viel strenger war und so viel mehr Macht über sie besaß. »Es gibt nur einen einzigen Grund, weshalb ich ins Pensionat gegangen bin. Weil Vati mir versprochen hat, dass er mich vom Pflichtjahr befreien lässt. Und mir eine Arbeit in der Firma besorgt.«
Mit einem lauten Knall schlug Friedrich mit der flachen Hand auf die Tischfläche, dass das Porzellan darauf schepperte. »Du bist ins Pensionat gegangen, weil wir es so wollten. Das ist wohl Grund genug!«, sagte er scharf.
»Aber …« Anni wollte protestieren, doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Schluss jetzt!«
Anni biss sich auf die Lippen und vermied es nur mit Mühe, in Tränen auszubrechen. Er konnte doch nicht vergessen haben, dass er ihr sein Wort gegeben hatte. Der Gedanke an Brand’s Bonsche hatte sie aufrecht gehalten, wenn ihr am Waschbrett der Rücken wehgetan, sie sich die Finger mit der Nähnadel zerstochen oder am Bügeleisen verbrannt hatte. Es ist nicht für immer, diesen Glaubenssatz hatte sie sich stets wiederholt, nur ein Jahr, danach darf ich tun, was mir Freude macht.
Ihr Vater hatte sich wieder seinem Nachtisch zugewandt, und sie hörte überlaut das Bersten einer Kirsche zwischen seinen Zähnen. Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten. Sie überlegte fieberhaft, wie sie ihn an sein Versprechen erinnern konnte, ohne erneut seinen Zorn zu erregen. Zugleich erschienen vor ihrem inneren Auge Bilder einer Zukunft, die vielleicht sogar die furchtbare Zeit in der Haushaltungsschule in den Schatten stellen würde. Würde sie nun doch, wie die anderen deutschen Mädels, ihr Pflichtjahr absolvieren müssen? In einem fremden Haushalt ungeliebte Arbeiten verrichten, ungezogene Kinder hüten, oder, noch schlimmer, auf einem Bauernhof irgendwo auf dem Land vergammeln? Hatte sie den Einfluss ihres Vaters etwa überschätzt? Sie dachte an Käthe und bekam ein schlechtes Gewissen. Wie halbherzig hatte sie den Sorgen der Freundin gelauscht, die Angst vor allen Tieren hatte, die größer als ein Hund und kleiner als eine Katze waren! Sie selbst hatte dieses Problem nicht, dennoch war die Vorstellung, auf einem Bauernhof zu arbeiten, sich jeden Tag schmutzig zu machen und den Dreck unter den Fingernägeln auch am Abend nicht mehr loszuwerden, für sie unerträglich.
Sie wollte arbeiten, auf eigenen Beinen stehen und am liebsten irgendwann zusammen mit Hans die Firma führen. Im Lyzeum, das sie bis zur zehnten Klasse besucht hatte, war sie mit glänzenden Noten entlassen worden, vor allem in Mathematik und Kunst. Sie war kreativ und organisiert zugleich, weshalb sie viel lieber auf die Handels- als auf die Haushaltungsschule gegangen wäre. Leider war ihr Vater in diesem Punkt hart geblieben. Eine Frau müsse lernen, ein Haus zu führen.
Damals hatte sie sich gefügt, aber jetzt würde sie nicht kampflos aufgeben. Entschlossen hob Anni den Kopf und wandte sich mit allem Mut, den sie aufbringen konnte, an ihren Vater. Doch noch bevor sie den Mund öffnen konnte, hatte er zu sprechen begonnen.
»Ich habe meine Kontakte bereits spielen lassen. Die Tochter von Friedrich Brand wird nicht auf einem Bauernhof Kühe melken und dann möglicherweise mit einem Bastard von irgendeinem Bauernlümmel nach Hause kommen.«
Magdalene zog scharf die Luft ein, und Anni schoss das Blut in die Wangen.
»Friedrich, was ist denn das für eine Ausdrucksweise vor dem Kind?«, fragte ihre Mutter, und obwohl ihre Stimme sanft wie immer klang, bewirkte ihre Frage, dass ihr Mann einen Rückzieher machte.
»Entschuldige.«
Anni verzichtete darauf, ihre Mutter erneut darauf hinzuweisen, dass sie kein kleines Mädchen mehr war. Unwillkürlich fragte sie sich, was Magdalene wohl zu der Lektüre gesagt hätte, die im Pensionat heimlich zwischen den Mädchen herumgereicht worden war. Niemand von ihnen wusste genau, woher der mit reichlich Eselsohren versehene, erotische Taschenroman eigentlich stammte, doch gab es kaum eine Schülerin, die das Werk nicht von vorne bis hinten gelesen hatte. Anni hatte sogar Else eines Tages mit roten Ohren darin blättern sehen.
Sie wusste also, wovon ihr Vater sprach, und fühlte sich beleidigt von dem, was er über sie dachte. Als würde sie mit irgendeinem Kerl im Heu landen und das tun, was in jenem Büchlein so detailverliebt geschildert worden war. Während Käthe die ganze Sache befremdlich und peinlich gefunden hatte, weckten die Schilderungen in Anni durchaus eine gewisse Neugier. Dennoch hatte sie nicht vor, ihre Jungfräulichkeit einfach zu verschleudern.
Sie bemerkte, dass ihr Vater sie musterte, und begriff erst in diesem Moment, was er gerade gesagt hatte. Dass er Wort gehalten und sie vor dem Pflichtjahr bewahrt hatte. Gespannt hielt sie den Atem an, als er fortfuhr.
»Es war schwieriger als erwartet«, sagte Friedrich. »Man wollte natürlich eine Erklärung dafür, weshalb ausgerechnet meine Tochter von ihrer Pflicht am Vaterland befreit werden sollte.«
Anni spürte mehr, als dass sie sah, wie Magdalene auf ihrem Platz die Haltung änderte. Sie wusste genau, woran ihre Mutter dachte: an Hans, der als Soldat in den Krieg zog. Denn sie selbst dachte das Gleiche. Dass die Pflicht ihrer Familie am Vaterland damit ja wohl abgegolten sein sollte. Doch sofort schämte sie sich für diesen Gedanken. Wollte sie wirklich ein paar Monate Kühemelken und Stallausmisten mit dem vergleichen, was Hans bevorstand? Mit einer Waffe auf dem Schlachtfeld zu stehen und feindlichen Soldaten entgegenzustürmen, die darauf aus waren, ihn zu töten?
Der Krieg ist bald vorbei, der Krieg ist bald vorbei, erinnerte sie sich, um das Bild zu vertreiben. Es konnte nicht mehr lange dauern, ein paar Monate noch, höchstens ein Jahr. Im nächsten Jahr zur selben Zeit würden sie schon wieder gemeinsam bei Tisch sitzen, und alles wäre so wie früher.
»Du kannst also aufhören, so ein Gesicht zu ziehen.«
Anni schrak aus ihren Gedanken. Sie hatte gar nicht mitbekommen, was ihr Vater gesagt hatte. Und nun blickte er sie an, als erwartete er eine Reaktion von ihr, doch auf was?
»Am Montag fängst du an. Glaub aber nicht, dass ich dir in der Firma weitere Extrawürste brate. Du arbeitest im Büro und wirst Fräulein Lindner zur Hand gehen.«
Anni strahlte über das ganze Gesicht. Sie konnte sich nur mit Mühe davon abhalten, vom Tisch aufzuspringen und ihrem Vater um den Hals zu fallen.
»Vielen Dank, Vati!«, sagte sie stattdessen und griff erleichtert nach ihrem Löffel. Der Pudding sah einfach köstlich aus. Sie schob sich einen Bissen in den Mund und ließ ihn auf der Zunge zergehen. Ja, sie hatte es tatsächlich geschafft. Kein Bauernhof, sondern eine echte Stelle in der Fabrik ihres Vaters. Sie verdrängte den Gedanken daran, dass Hans nicht bloß als Handlanger der Sekretärin ihres Vaters im Unternehmen angefangen hatte. Natürlich nicht. Hans war ein Mann. Er hatte das Abitur machen dürfen, danach für ein Jahr die Handelsschule besucht und hatte vor einem knappen Jahr sein eigenes Büro neben dem des Vaters bezogen.
Das jetzt leer stand.
»Im Moment kann ich wirklich jede deutsche Arbeitskraft dringend brauchen«, erklärte ihr Vater und trank einen Schluck Wein aus seinem Glas. »Einen nach dem anderen holen sie an die Front, und wir Fabrikanten können sehen, wo wir bleiben. Die Ostarbeiter können einen Deutschen nicht ersetzen. Sie sprechen unsere Sprache nicht, sind faul und schmutzig. Außerdem klauen sie wie die Raben. Alleine der Aufwand, das Arbeitslager auf dem Fabrikgelände zu betreiben …«
»Dafür sind es billige Arbeitskräfte«, wandte Magdalene ein.
»Mehr ist ihre Arbeit ja auch nicht wert«, entgegnete Friedrich mürrisch, und seine üble Laune legte sich über sie alle wie eine Wolke. Er nahm einen weiteren tiefen Schluck, dann zeigte er mit der Hand, in der er das Glas hielt, auf Anni. »Von den Polacken musst du dich fernhalten«, warnte er sie, und Anni nickte gehorsam, obwohl sie nur halb begriff, worum es überhaupt ging.
»Es ist nicht mal mehr die Hälfte der Belegschaft in der Firma«, erklärte ihr Hilde freimütig, als sie an diesem Abend heißes Wasser heranschleppte und damit die Badewanne füllte.
Anni legte derweil ihre Kleider ab. Rock und Bluse fielen zu Boden, gefolgt von Unterwäsche und Strümpfen.
»Viele sind eingezogen worden oder abbeordert für die Rüstungsindustrie. Ihre Arbeit machen jetzt die Ostarbeiter.«
Anni löste ihre Zöpfe, hüllte sich in einen weichen Morgenmantel und lehnte sich gegen die geflieste Wand des Badezimmers. Wieder einmal wurde ihr bewusst, wie abgeschieden sie im Mädchenpensionat gelebt hatte. Sie hatte schlicht nicht mitbekommen, wie sehr der Krieg die Welt verändert hatte.
»Und woher genau stammen die?«
Hilde leerte ächzend einen weiteren Eimer heißes Wasser in die Wanne. »Na, aus den besetzten Gebieten. Aus Polen.«
Das fand Anni irgendwie seltsam, doch sie fragte nicht nach. Ihr Blick fiel auf die zerknüllten Kleider zu ihren Füßen, doch bevor sie sich bücken und sie aufheben konnte, hatte Hilde sie schon aufgesammelt.
»Nu rein mit dir, bevor das Wasser kalt wird«, sagte das Dienstmädchen gutmütig und ließ sie im Badezimmer allein, nicht ohne vorher ein frisches Handtuch bereitgelegt zu haben.
Anni durchforstete den Schrank auf der Suche nach ihrer Lieblingsseife, zog den Morgenmantel aus und ließ sich in das dampfende Wasser gleiten. Sie konnte spüren, wie ihre verkrampften Muskeln sich entspannten, tauchte die Seife unter und schäumte sie mit den Händen auf. Weiße, nach Lavendel duftende Schwaden waberten über die Wasseroberfläche, und Anni schloss verzückt die Augen. Ein Jahr lang hatte sie sich an der Waschschüssel im Gemeinschaftsbad waschen müssen, mit meist eher lauem als warmem Wasser, sogar im tiefsten Winter. Doch nun war sie wieder zu Hause, und alles würde gut werden.
5
In den nächsten Tagen war Anni glänzender Laune. Sie überredete ihren Vater dazu, ihr ein neues Kleid für den Arbeitsantritt in der Firma zu kaufen. Er hielt das zwar für unnötig, doch letzten Endes gab er nach. So war es meistens. Friedrich Brand konnte herrisch sein, sogar aufbrausend, doch die Frauen in seinem Leben konnten ihn um den kleinen Finger wickeln. Und so stand er am Samstagmorgen mit ihr im Damen-Modehaus Ahrendt am Neuen Wall und ließ sich geduldig ein Kleid nach dem anderen vorführen.
Anni entschied sich schließlich für ein streng geschnittenes Kostüm in Dunkelblau mit kurzer, taillierter Jacke und knielangem Rock. Zufrieden drehte sie sich vor dem Spiegel hin und her. Sie sah älter aus als ihre fast achtzehn Jahre. Wie eine richtige berufstätige Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben stand. Die man ernst nehmen konnte. Sie probte ein Lächeln und präsentierte sich dann ihrem Vater.
»Das hier«, sagte sie entschlossen.
Friedrich nickte, obwohl sie das Gefühl hatte, er habe gar nicht richtig hingeschaut. »Es steht dir ausgezeichnet. So, und da wir schon mal hier sind …« Er wandte sich der Verkäuferin zu, die dienstbeflissen mit einem Berg von Kleidern über dem Arm herbeieilte. Sie hob eines davon hoch und hielt es so, dass Anni es betrachten konnte. Himmelblaue Seide und eng anliegend bis zur Taille, wo es in einen weit schwingenden, langen Rock überging. Das Kleid sah teuer aus und sehr elegant. Anni zog eine Augenbraue hoch.
»Wäre das nicht ein bisschen unpassend für dein Vorzimmer?«, fragte sie ironisch und ließ den Blick über den Kleiderberg auf dem Arm der Verkäuferin gleiten. Alles edle Stoffe in leuchtenden Farben.
»Dummerchen«, erwiderte Friedrich schmunzelnd und strich sich über den Oberlippenbart. »Das ist natürlich nicht für die Arbeit gedacht. Aber ein Vater kann doch seiner Tochter wohl ein hübsches Kleid kaufen. Es sei denn, du bist nicht interessiert …?«
»Oh doch«, beeilte Anni sich zu sagen und riss der Verkäuferin das Kleid beinahe aus den Händen.
Minuten später stand sie vor dem Spiegel und betrachtete sich hingerissen. Die Seide des Kleides hatte exakt die Farben ihrer Augen und ließ deren Blau noch intensiver leuchten als sonst. Ihre Haut wirkte zart wie Elfenbein und kontrastierte gut mit dem sehr dunklen Braun ihrer Haare.
Schließlich trat sie aus der Umkleidekabine und drehte sich übermütig im Kreis, sodass der weite Rock um sie herumschwang.
»Ach, es ist einfach wunderschön.«
»Perfekt«, zwitscherte die Verkäuferin und klatschte in die Hände. Anni wusste, warum. Sie hatte im Inneren der Kabine einen Blick auf das Preisschild riskiert, und die Zahl hatte ihr den Atem stocken lassen. Gespannt wartete sie auf die Reaktion ihres Vaters. Der betrachtete sie aufmerksam und nickte.
»In der Tat«, sagte er. »Perfekt. Wir nehmen es. Und das Kostüm.«
»Sehr gerne, selbstverständlich.« Die Verkäuferin war vollkommen aus dem Häuschen. Kein Wunder. Mit ziemlicher Sicherheit hatte Friedrich Brand ihr den Tagesumsatz gerettet.
»Danke, Vati«, sagte Anni liebevoll, legte ihm die Arme um den Hals und küsste ihn auf die Wange.
»Gern geschehen.« Er schmunzelte. »Vielleicht kannst du mir nun auch verzeihen, dass ich dich ins Pensionat geschickt habe.«
»Ich verzeih dir alles«, antwortete Anni und meinte es auch so. Obwohl sie erst seit zwei Tagen zurück war, schien die Zeit in Köln bereits unendlich weit weg, nicht viel mehr als eine ferne Erinnerung. Sie hatte es überstanden und war zurück in Hamburg. Und noch dazu in dem schönsten Kleid, das sie je besessen hatte.
»Das freut mich. Nun zieh dich um, wir müssen los. Das Kleid kannst du gleich heute Abend tragen.«
Anni, die bereits den Vorhang der Umkleide geschlossen hatte, lugte noch einmal dahinter hervor. »Heute Abend?«
Friedrich nickte. »Wir bekommen einen Gast zum Essen. Einen meiner Parteifreunde.«
»Wie schön.« Ihrem Vater zuliebe verbarg sie ihr Desinteresse. Die Abendessen mit den Parteifreunden ihres Vaters waren immer eine gähnend langweilige Angelegenheit, und sie bezweifelte, dass sich daran im Laufe des vergangenen Jahres irgendetwas geändert hatte. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich heute Abend einen Film im Uhlenhorster Lichtspiel anzuschauen, mit ihrer besten Freundin Erika oder einer ihrer anderen Freundinnen aus dem Lyzeum. Aber das Kino lief ihr nicht weg, und sie konnte möglicherweise sogar noch die Spätvorstellung erwischen. Es würde nett werden, sich heute Abend richtig herauszuputzen, und sei es auch nur für eine langweilige Mahlzeit mit alten Herren, die über nichts anderes als Politik redeten.
Am Abend stand Anni vor dem Wandspiegel in ihrem Zimmer und musterte sich eingehend. Das Kleid war wirklich ein Traum, dennoch war sie nicht zufrieden mit sich. Es war fast, als würde sie ihm nicht gerecht werden, ihre an beiden Seiten geflochtenen Zöpfe wirkten plötzlich so kleinmädchenhaft und bieder. Zögernd löste sie die Flechten und fuhr sich mit gespreizten Fingern durchs Haar, bis es ihr wellig und glänzend auf die Schultern fiel. Fasziniert studierte Anni den Effekt, den das offene Haar auf ihre Gesamterscheinung hatte. Ihr schmales Gesicht wirkte weicher, die markante Nase weniger auffällig. Gleichzeitig fand sie sich beinahe frivol, denn diese Frisur, wenn man die wilde Mähne überhaupt so nennen konnte, trug sie sonst nur, wenn sie gerade ins Bett gehen wollte oder eben daraus aufgestanden war. Dennoch. Mit ein wenig Trotz warf sie das Haar über die Schulter zurück und funkelte ihrem Spiegelbild herausfordernd entgegen. Fast erinnerte es sie an Vivien Leigh.
Heidrun, eine ihrer Mitschülerinnen im Pensionat, hatte von ihrer Tante aus den Vereinigten Staaten ein Journal namens Movies geschickt bekommen. Die britische Schauspielerin Leigh zierte nicht nur das Cover, sondern wurde auch in einem mehrseitigen Artikel darin porträtiert. Sie spielte die Scarlett in der Hollywood-Verfilmung des Buches »Vom Winde verweht« von Margaret Mitchell. Anni hatte den Roman verschlungen und war enttäuscht gewesen, dass der Film im Deutschen Reich nicht gespielt wurde. Seither hegte sie eine glühende Verehrung für die schöne Schauspielerin mit den Katzenaugen.
Sie trat einen Schritt zurück und versuchte sich an einem Lächeln à la Scarlett. Es gelang gar nicht so schlecht. Wie gerne hätte sie sich noch die Lippen blutrot bemalt, aber das ging natürlich nicht. Zum einen besaß sie gar keinen Lippenstift, zum anderen hätte ihr Vater sie gleich wieder hoch in ihr Zimmer geschickt, sobald sie auch nur einen Fuß in den Salon setzte. Die deutsche Frau schminkte sich nicht. Ihre neue Frisur war vermutlich schon Provokation genug, aber Anni konnte sich nicht dazu überwinden, die Locken wieder zu bändigen. Sie würde einfach warten, bis der Besuch eingetroffen war. Wenn sie dann hinzukäme, würde Friedrich sicher nicht mehr so genau hinschauen. Das hoffte sie zumindest.
Ein letztes Mal drehte sie sich vor dem Spiegel hin und her, strich mit den Händen über den glänzenden, ihren Oberkörper fest umschließenden Seidenstoff, dann hallte auch schon das Klingeln der Türglocke durch das Haus. Aufmunternd zwinkerte sie ihrem Spiegelbild zu.
6
Schon auf der breiten, in einem weiten Bogen verlaufenden Treppe, die ins Erdgeschoss der Brand’schen Villa führte, duftete es köstlich nach gebratenem Fleisch und allerlei Kräutern. Wie immer, wenn man Gäste hatte, war die Köchin angewiesen worden, weder Kosten noch Mühen zu scheuen und ein Festmahl aufzutischen.
Langsam durchschritt Anni die Eingangshalle und betrat das Speisezimmer, aus dem lebhafte Stimmen drangen. Im Rahmen der geöffneten Flügeltür blieb sie stehen. Die Kerzen im Leuchter brannten und tauchten alles in ein warmes Licht, der Tisch war natürlich mit dem guten Porzellangeschirr gedeckt.
»Guten Abend«, sagte Anni, und drei Augenpaare wandten sich ihr zu.
Magdalene sog bei ihrem Anblick die Luft ein, sagte aber nichts.
Friedrich lächelte zu ihrer Überraschung wohlwollend und fasste den neben ihm stehenden Mann beim Arm. »Da bist du ja. Julius, darf ich dir meine Tochter Anni vorstellen? Anni, das ist Julius Wenzel.«
Der Mann trug einen eleganten hellgrauen Anzug, sein Gesicht war glatt rasiert, die dunkelblonden Haare kurz geschnitten. Er trat auf Anni zu und reichte ihr die Hand.
»Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Anni«, sagte Julius. Seine Augen waren von einer Farbe wie heller Stein, und obwohl er sie freundlich musterte, fühlte Anni sich merkwürdig durchbohrt von diesem silbernen Blick. Sie ergriff seine Hand und knickste automatisch.
»Guten Tag.« Ihr war bewusst, dass ihre piepsige Stimme in krassem Kontrast zu Kleid und Frisur stand, und räusperte sich verlegen. »Freut mich ebenfalls«, setzte sie fest hinzu, doch die mühsam aufgebaute Selbstsicherheit fiel sogleich wieder in sich zusammen, als seine Augen über ihren Körper zu wandern begannen. Hastig schlug sie den Blick nieder. Sie war vollkommen aus dem Konzept gebracht. Die Freunde ihres Vaters waren normalerweise gediegene alte Männer, keiner unter fünfzig, mit ergrauten Haaren und Wohlstandsbäuchen. Julius war zwar auch nicht mehr ganz jung, sicher Anfang oder Mitte dreißig, aber er strotzte vor Kraft und Selbstsicherheit. Und wie er sie ansah. Anni wusste nicht recht, ob ihr das gefiel oder nicht. Auf jeden Fall würde der Abend nicht so langweilig werden wie erwartet.
Sie hob den Blick und begegnete dem seinen. Er grinste, wobei sich nur sein linker Mundwinkel hob und ein scharfes Grübchen in seine Wange schnitt.
Meine Güte, Anni, sag was, befahl sie sich selbst. Steh nicht herum wie eine Kuh, wenn’s donnert.
»Darf ich?«, fragte Julius, während sie noch immer nach Worten suchte, und hielt ihr galant seinen Arm hin.
Zögernd schob sie die Hand in seine Ellenbeuge, und er führte sie zum Tisch. Rückte ihr den Stuhl zurecht und ließ sie darauf Platz nehmen. Dann setzte er sich ihr gegenüber. Ihr Vater nahm wie immer seinen Platz am Kopfende des Tisches ein.
»Julius und ich haben uns letztes Jahr auf einem Parteitag kennengelernt. Er ist seitdem übrigens der Anwalt von Brand’s Bonsche«, erklärte Friedrich ihr, und Anni nickte.
»Interessant. Ich werde ab Montag ebenfalls in der Firma arbeiten.« Endlich hatte sie ihre Sprache wiedergefunden.
Julius zog erstaunt die Brauen hoch. »Tatsächlich?«
»Sie wird meiner Sekretärin unter die Arme greifen«, beeilte sich Friedrich zu sagen. »Es kann nicht schaden, wenn eine Frau sich auch mit wirtschaftlichen Prozessen auskennt.«
»Da bin ich ganz deiner Meinung, Friedrich.« Julius nickte zustimmend und griff nach seinem Glas.
Schön, dass ihr euch da einig seid, dachte Anni bei sich, aber sie wollte sich durch die Gönnerhaftigkeit der beiden Männer die gute Laune nicht verderben lassen.
»Anni ist erst vor zwei Tagen aus Köln zurückgekehrt«, mischte sich nun Magdalene in das Gespräch ein. »Sie hat dort ein Jahr lang ein Pensionat für Hauswirtschaft besucht.«
Anni warf ihrer Mutter einen finsteren Blick zu und wandte sich dann an Julius. »Ja«, sagte sie. »Ein Jahr lang kochen, nähen, stricken, Wäsche waschen und bügeln. Alles, was die gute deutsche Hausfrau können muss. Und ab jetzt werde ich mich bemühen, alles Gelernte so schnell wie möglich wieder zu vergessen.«
Stille senkte sich über den Tisch. Friedrich sah aus, als stände er kurz vor dem Explodieren. Die blaue Ader an seiner rechten Schläfe puckerte bedrohlich, und sein Hals über dem blütenweißen Hemdkragen verfärbte sich dunkelrot.
Prompt wurden Annis Handflächen feucht, und ihr Herzschlag beschleunigte sich. Wie kam sie dazu, derart offen ihren Widerwillen zur Schau zu stellen, noch dazu vor einem Fremden? Sie wusste, dass ihr Vater ihr die Stelle in der Firma mit einem Fingerschnipsen wieder nehmen konnte. Noch schlimmer, er konnte veranlassen, dass sie schon nächste Woche auf irgendeinem Bauernhof in der Provinz hockte und dort versauerte.
Hilfe suchend blickte sie zu Julius herüber, der sie interessiert musterte, als wäre sie ein seltenes Insekt unter dem Mikroskop. Dann verzog er den Mund wieder zu diesem schiefen Lächeln.
»Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Fräulein Anni. Es ist äußerst fragwürdig, ob einen Haushalt zu führen wirklich das Potenzial einer vielversprechenden jungen Frau wie Ihnen ausschöpft.«
Annis Schultern entspannten sich, und sie spürte, wie sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete. »Dankeschön«, sagte sie inbrünstig.
»Selbstverständlich.«
Friedrich schnaubte. »Als Parteimitglied solltest du es besser wissen, Julius. Der Platz der Frau ist in der Familie, und ihre höchste Aufgabe ist die Mutterschaft.«
Anni biss sich auf die Unterlippe. Sie wollte nicht schon wieder etwas sagen, was sie später bereute. Natürlich war es nicht das erste Mal, dass ihr Vater solche Reden schwang, vor allem im Beisein seiner Parteigenossen. Aber Anni dachte gar nicht daran, den Rest ihres Lebens als Ehefrau und Mutter zu verbringen. Wahrscheinlich würde sie gar nicht heiraten, und wenn, dann einen modernen Mann, der nichts dagegen hatte, wenn eine Frau arbeitete.
»Ich stimme dir zum Teil zu.« Julius ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Ihre höchste Aufgabe. Aber nicht ihre einzige. Und wenn ich das so sagen darf, lieber Friedrich, eine aufgeweckte Mitarbeiterin wie deine Tochter kann das Unternehmen gut gebrauchen. Vor allem in diesen Zeiten.« Er warf seinem Freund einen bedeutungsschwangeren Blick zu, und der seufzte leise.
»Da magst du recht haben.«
In diesem Moment erschien Hilde mit der dampfenden Suppenterrine, um den ersten Gang zu servieren. Nachdem sie aufgetragen und das Speisezimmer wieder verlassen hatte, griff Friedrich zum Löffel.
»Wohl bekomm’s«, sagte er und sah von einem zum anderen. Seine schlechte Laune schien verflogen. »Es freut mich ja, dass ihr jungen Leute euch so gut versteht.«
Anni beugte sich tief über den Teller, um ihr Grinsen vor den anderen zu verbergen. Junge Leute! Dieser Julius war doch fast doppelt so alt wie sie. Wenn auch lange nicht so konservativ wie ihr Vater. Sie spürte, dass Julius sie beobachtete, hob den Blick und lächelte ihm zu.
7
Der folgende Montagmorgen fühlte sich für Anni an wie ihr erster Schultag. Sie selbst war genauso aufgeregt wie damals, als sie zum ersten Mal mit dem Lederranzen auf dem Rücken das Haus verließ, und Magdalene wirkte ebenso besorgt. Was Anni nicht nachvollziehen konnte. Was sollte schon geschehen? Sie würde den Tag im Vorzimmer ihres Vaters verbringen, unter der Anleitung von Fräulein Lindner, die sie vermutlich keine Sekunde lang aus den Augen lassen würde. Dennoch wuselte ihre Mutter um sie herum wie ein aufgescheuchtes Huhn.
Wenigstens bei ihrer Frisur hatte sie sich gegen Magdalene durchsetzen können, die zunächst darauf bestanden hatte, dass Anni sich wie immer strenge Zöpfe flocht.
»Ich bin kein Kind mehr«, hatte sie heftig erwidert. »Und mit Zöpfen sehe ich aus wie ein kleines Mädchen, das sich als Sekretärin verkleidet hat.«
Sie hatten sich schließlich darauf geeinigt, dass sie die Haare in einem um den Kopf geflochtenen Kranz bändigte, und Magdalene hatte widerwillig nachgegeben.
»Na schön«, sagte sie, als Anni zum Aufbruch bereit in der Eingangshalle stand und vor lauter Aufregung kaum stillzustehen vermochte. Ihr Vater, mit dem gemeinsam sie zu der im Stadtteil Hammerbrook liegenden Firma fahren wollte, ließ auf sich warten. Magdalenes Blick wurde weich, als sie zu ihrer Tochter trat und ihr eine Hand an die Wange legte. »Ich muss mich wohl daran gewöhnen, dass du eine junge Frau geworden bist.« Sie seufzte leise.
»Ach Mutti«, murmelte Anni ein bisschen verlegen.
»Und gerade deshalb möchte ich dich warnen.« Der Tonfall ihrer Mutter hatte sich von einer Sekunde zur nächsten verändert, und Anni starrte sie überrascht an. »Es sind schwere Zeiten, in denen wir leben. Du hast es ja gehört, viele der Arbeiter wurden zum Kriegsdienst eingezogen. Es blieb deinem Vater gar nichts anderes übrig, als sie durch Fremdarbeiter zu ersetzen. Ich möchte, dass du dich von ihnen fernhältst, hast du das verstanden?«
Anni, irritiert über die Schärfe in der Stimme ihrer sonst stets so sanften Mutter, nickte perplex. »Aber wieso …«
»Geh ihnen einfach aus dem Weg«, schnitt Magdalene ihr das Wort ab. »Vor allem den Männern. Sie sind wie Tiere.« Der letzte Satz war nicht viel mehr als ein Flüstern. »Versprich mir, dass du dich von ihnen fernhalten wirst!«
»Ja, gut, ich verspreche es.« Anni zuckte mit den Schultern. Sie hätte alles versprochen, wenn sie nur endlich losfahren und ihren ersten Arbeitstag beginnen durfte.
Von draußen hörte man nun den Motor eines Wagens, der die Auffahrt zur Villa hinauffuhr. Das war der Chauffeur Herr Hansen. Im gleichen Moment, als das Auto zum Stehen kam, schritt Friedrich die geschwungene Treppe zur Eingangshalle herunter. Er musterte Anni kurz und nickte.
»Wollen wir?«
»Ja.« Anni strahlte über das ganze Gesicht, und Friedrich musste über ihren Eifer lächeln.
Draußen stand Hansen an der geöffneten Autotür bereit und begrüßte seinen Chef und dessen Tochter mit einer formvollendeten Verbeugung. Magdalene trat ebenfalls aus der Tür und begleitete Anni bis zum Wagen. Sie stand so dicht hinter ihr, als wollte sie gleich mit einsteigen. Anni lächelte und legte ihr beruhigend die Hand auf den Unterarm.
»Ist schon gut, Mutti«, sagte sie leise. »Bis heute Abend.«
»Denk an das, was ich dir gesagt habe«, antwortete ihre Mutter, und Anni nickte ungeduldig.
»Jaja, ich weiß schon. Ich werde mich von den Tieren fernhalten.«
Durch den morgendlichen Verkehr dauerte es fast eine Dreiviertelstunde, bis sie endlich auf das weitläufige Fabrikgelände von Brand’s Bonsche einbogen. Noch bevor das mächtige Gebäude aus rotem Backstein vor ihnen auftauchte, stieg Anni schon der unvergleichliche Duft von geschmolzenem Zucker in die Nase. Im Schritttempo fuhr Hansen über das holprige Kopfsteinpflaster in Richtung des Verwaltungsgebäudes, das sich auf der anderen Seite der Fabrik befand. Sie passierten die Lagerhallen, und Anni stutzte, als sie zwei Männer in SA-Uniformen entdeckte.
»Aufseher«, erklärte Friedrich, der ihren Blick bemerkt hatte. »Dort hinten befinden sich die Arbeiterbaracken.« Er deutete in Richtung mehrerer großer Hallen, die, wie Anni bemerkte, von einem Stacheldrahtzaun umschlossen waren.
»Aha«, sagte Anni, ohne recht zu verstehen.
»Du wirst nichts mit ihnen zu tun haben, sei unbesorgt«, sagte Friedrich und lächelte ihr aufmunternd zu.
»Da bin ich ja beruhigt«, sagte Anni und fragte sich gleichzeitig, was es mit den Arbeitskräften aus dem Osten nur auf sich haben mochte, dass ihre Eltern solche Angst vor ihnen hatten. Das waren doch auch bloß Menschen. Minderwertige Menschen dazu, wie sie in der Schule gelernt hatte; das hatte man ja auch daran gesehen, dass die deutsche Armee nach dem Angriff durch die Polen quasi ohne jeden Widerstand in das Land hatte einmarschieren und es besetzen können1.
»Da wären wir«, unterbrach ihr Vater ihre Gedanken. Nachdem der Chauffeur ihr die Tür von außen geöffnet hatte, kletterte Anni aus dem Wagen. Der Geruch nach Karamell intensivierte sich, und sie atmete tief ein, dann folgte sie ihrem Vater.
Nachdem Friedrich seine Tochter bei seiner Sekretärin abgegeben hatte, war er in seinem eigenen Büro verschwunden.
»So«, sagte Fräulein Lindner, »dann wollen wir mal.« Sie führte Anni zu einem kleinen Tisch in einer Ecke des Büros. Der wackelige Stuhl davor wirkte alles andere als bequem. »Hier habe ich dir deinen eigenen Arbeitsplatz eingerichtet.«
Anni versuchte gar nicht erst, ihr Missfallen zu verbergen. »Hier ist es aber sehr dunkel«, sagte sie und sah sich in dem Raum um, der auf der gegenüberliegenden Seite zwei hohe Kreuzsprossen-Fenster besaß. »Wieso kann ich nicht dort vor dem Fenster arbeiten?«
»Weil es sich bei dem Vorzimmer um einen repräsentativen Raum handelt«, erklärte Fräulein Lindner geduldig. »Jeder Gast deines Vaters kommt zunächst hier herein, und der wunderbare Blick auf das Fabrikgelände sollte durch nichts gestört werden, verstehst du?«
Anni biss sich auf die Unterlippe. Diesem Argument hatte sie tatsächlich nichts entgegenzusetzen. Vorsichtig ließ sie sich auf dem unbequemen Holzstuhl nieder.
»Du kannst gleich wieder aufstehen«, erklärte Fräulein Lindner ihr munter. »Die erste Aufgabe des Tages besteht darin, deinem Vater seinen Kaffee zu bringen.«
Von unten herauf starrte Anni die andere an. »Seinen Kaffee?«, fragte sie gedehnt.
»Sehr heiß, mit einem Schuss Sahne und einem Stück Würfelzucker. Aber das weißt du ja sicher.«
Fräulein Lindner scheuchte Anni vor sich her auf den Flur und in die kleine Büroküche. Auf dem Spültisch standen Unmengen von gebrauchten Kaffeetassen sowie eine Kranenkanne aus Zinn.
»Ach«, sagte die Sekretärin, »da habe ich wohl gestern Abend vergessen, den Abwasch zu erledigen. Sei doch bitte so freundlich, ja?« Sie streckte sich, angelte ein Glas mit braunem Inhalt von einem Regalbrett über ihren Köpfen herunter und stellte es vor Anni hin. »Und vergiss nicht, den Kaffee aufzusetzen.«
Annis fassungsloser Blick wurde von Fräulein Lindner ungerührt erwidert. »Gibt es ein Problem?«, fragte sie freundlich.
Anni schüttelte den Kopf. Es kostete sie viel Anstrengung, nicht zu sagen, was ihr auf der Zunge lag.
»Dann ist es ja gut.« Fräulein Lindner lächelte und verließ die Küche.
Anni sah auf das schmutzige Geschirr hinunter. So hatte sie sich ihren ersten Arbeitstag in der Firma ihres Vaters weiß Gott nicht vorgestellt. Dafür war sie schließlich nicht der verhassten Haushaltungsschule entflohen. Elses gehässige Bemerkung kam ihr in den Sinn. Deine Expertise im Wäschefalten und Kuchenbacken ist natürlich genau das, was in einem Unternehmen gebraucht wird.